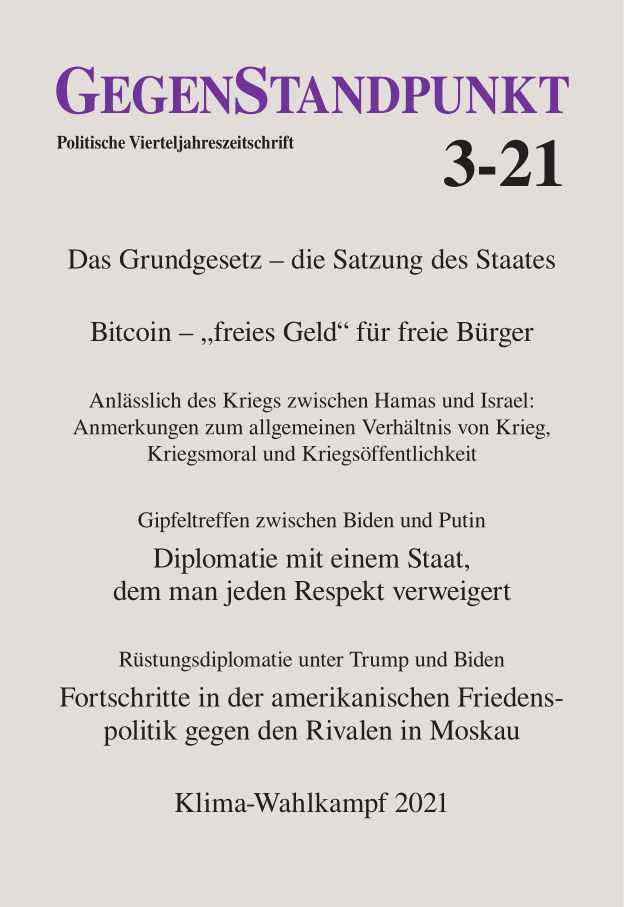Das Grundgesetz – die Satzung des Staates
Das deutsche Grundgesetz ist eine super Sache, da sind sich alle politischen Lager von queer bis quer einig, wenn sie sich für ihre Anliegen auf es berufen. Dem tut es keinen Abbruch, dass die Allermeisten sich auf Nachfrage hart damit tun würden, mehr über den Inhalt seiner 146 Artikel kundzutun als ausgewählte Kalauer an Grundrechten aus den ersten paar Seiten. Die restlichen 130 Artikel spielen für den guten Ruf des Grundgesetzes offenbar keine Rolle. Kein Wunder, denn spätestens dieser große Rest beweist das glatte Gegenteil dessen, wovon das Lob dieses Schriftstückes lebt: Die Satzung des Staates präsentiert die bis ins Kleinste geregelten Organisationsfragen einer politischen Monopolgewalt, die sich außerdem die Lüge schuldig ist, die das Grundgesetz in seinen ersten Artikeln elaboriert und die ihm seinen unverdienten Ruf einträgt: Das Volk höchstselbst habe sich hier eine Verfassung gegeben und den Staat als Diener am Volkswillen über sich installiert. Dass die Wahrheit eher umgekehrt aussieht, erklärt unser Artikel anhand eines Durchgangs durch die heilige deutsche Schrift.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Gliederung
- I. Die Selbstorganisation der souveränen Gewalt
- Scheingründung des Staates oder: Trennung der Herrschaft vom regierten Volk
- Ermächtigung und Beschränkung der Inhaber der Macht: Herrschaft als Amt
- Die herrschaftliche Produktivkraft geteilter Gewalten
- Föderalismus – Staatsaufbau von unten für Legitimation und Durchgriff der Staatsmacht von oben
- Die Indienstnahme der Regierten für die Ermächtigung des Herrschaftspersonals
- Eine notwendige Ergänzung: der staatliche Notstand
- II. Die Grund- und Menschenrechte: Was die Bürger dürfen, also müssen
Das Grundgesetz – die Satzung des Staates
Die deutsche Verfassung beginnt feierlich. Die „Väter und Mütter des Grundgesetzes“ erinnern an die höchsten Werte, die jede Nation kennt, nicht beiläufig und mal eben im Anhang wie manche Kollegen auswärts, sondern breiten sie in, sage und schreibe, 19 Artikeln an prominenter Stelle aus. Dort stehen die Prinzipien der Rechtsordnung nun, absteigend nach Graden der Heiligkeit geordnet, und erwecken den Eindruck, als würden die Wirklichkeit des heutigen deutschen Staates und das von ihm geregelte Leben der Gesellschaft aus ursprünglichen humanistischen Wertentscheidungen hervorgehen, über die sich die Deutschen einig geworden wären. Würde, Freiheit und Gleichheit, die elementaren Setzungen des Grundrechtskatalogs, sind es denn auch, die in Festreden Beachtung finden und Lob ernten. Wenn sich der Verfassungstext im Weiteren – in der erdrückenden Mehrzahl seiner Artikel und in durchaus nüchternem Ton – den Einrichtungen, Ämtern, überhaupt der Organisation der Staatsmacht widmet, winken auch die hartnäckigsten Fans ab: „Die gute Ordnung, das sind die ersten Artikel, die Grundrechte. Das Grundgesetz: Vorne hui! Hinten – naja.“ [1]
Wer in den Artikeln 20 – 146 GG nichts als eine zum chaotischen „Verhau“ [2] geratene Institutionenlehre sieht, geht damit über die Auskünfte hinweg, die sich dort finden. Im Folgenden soll deshalb zuerst die Prosa der verfassungsstaatlichen Hausordnung gewürdigt werden; immerhin wird an ihr deutlich, dass „die gute Ordnung“ der humanistischen Werte, die so viele Freunde hat, von A bis Z auf Gewalt beruht.
I. Die Selbstorganisation der souveränen Gewalt
Scheingründung des Staates oder: Trennung der Herrschaft vom regierten Volk
Definitiv zur Lyrik der Verfassung gehört ihre Präambel, die das Dasein des deutschen Staates als Produkt einer Beschlussfassung des Volkes präsentiert:
„Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, von dem Willen beseelt, als gleichberechtigtes Mitglied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen, hat sich das Deutsche Volk kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben.“
Das ist natürlich Unsinn. Nicht nur, dass dieses Grundgesetz selbst erst festlegt, wer „Deutscher im Sinn des Grundgesetzes“ (Artikel 116, Abs. 1) ist, dass also das Volk durch es definiert wird und ihm nicht als entscheidungsfähiges Subjekt vorausgeht; nicht nur, dass ferner die entscheidenden Behörden und Machtorgane – kurz nach dem Zweiten Weltkrieg noch unter alliierter Oberhoheit – längst existiert und die Lebensbedingungen in Deutschland diktiert haben, ehe sie durch die Verabschiedung des Grundgesetzes zur Verwirklichung des Volkswillens erklärt und geadelt wurden; vor allem spricht gegen diesen Gründungsmythos – und das bestätigt das Grundgesetz mit seiner Definition von Volkssouveränität selbst ganz klar –, dass das Volk überhaupt kein entscheidungsfähiges Subjekt mit einem Willen ist. Als Instanz, die sich das Grundgesetz als seine Verfassung gegeben haben soll, ist dieses Volk eine noch nicht einmal irgendwie rechtswirksame, mehr eine bloß staatsphilosophische Fiktion, deren rein legitimatorischer Inhalt im Fortgang nur allzu deutlich wird. Da handelt das Grundgesetz nämlich vom wirklichen Volk, der real existierenden Gesamtheit der Bürger, denen die Staatsgewalt als die wirkliche hoheitliche Macht gegenübersteht. Davon handelt es aber eben so, als wäre beides dasselbe: die Masse der gehorsamspflichtigen wahlberechtigten Deutschen und das fiktive Subjekt, dem sogar ein kollektives „Bewusstsein“ und ein gläubiger Bezug zur traditionsreichen ideellen Zuflucht von Unwissenheit und Unterwürfigkeit namens „Gott“ zugeschrieben wird. Den Übergang – und damit die Generallüge der Verfassung – macht es in aller Unbefangenheit ausdrücklich:
Artikel 20. (2) Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt.
Dasselbe Wort steht hier für die fiktive Quelle „aller Staatsgewalt“ und für eine Praxis, die die fertige Abtrennung und das autonome Funktionieren der „besonderen Organe“ staatlicher Herrschaft als keiner Erklärung bedürftige Gegebenheit unterstellt. Das Wörtchen „durch“ und der abstrakte Verweis auf „Wahlen und Abstimmungen“, also der pure Formalismus einer Befragung der Bürgerschaft durch ihre institutionalisierte Obrigkeit, die die Identität von fiktivem und wirklichem Volk verbürgen sollen, sind in der Sache ein Offenbarungseid über deren Haltlosigkeit. Auf den Scherz will das Grundgesetz aber nicht verzichten: Es beruft sich aufs Volk als seinen Erfinder und macht sich ganz entschieden nichts daraus, dass dieser eigentümliche Souverän seine „freie Selbstbestimmung“ sehr indirekt und stellvertretend ausüben lässt; durch Organe der Herrschaft, denen das wirkliche Bürgervolk in der Realität nur in der Weise verbunden ist, dass es sie machen lässt, was nun einmal zu einer ordentlichen Herrschaft gehört. Was, nebenbei, schon für den Erlass des Grundgesetzes selber gilt: Es wurde 1949 von einem „Parlamentarischen Rat“ verfasst und von den Parlamenten der schon vorher eingerichteten Länder angenommen.
Und wo dieses Volk seine Souveränität verfassungsmäßig wirklich spielen lässt, nämlich in der Wahl der Leute, die dadurch das Mandat zur Ausübung definierter Herrschaftsfunktionen erwerben, beeilt sich die Verfassung, explizit klarzustellen, was das heißt und was nicht. Sie erinnert wieder an ihre Lebenslüge, hier in der Fassung des „ganzen Volkes“, das sich seine Vertretung wählt, und macht daraus gleich – soweit es überhaupt so etwas wie Argumente andeutet – eine Begründung dafür, dass diese Vertretungstätigkeit mit den wirklichen Interessen von Bürgern, Klassen und Genossenschaften dem Prinzip nach nichts zu tun haben darf. Die Gewählten haben mit ihrer Herrschaftsbefugnis darüber zu stehen:
Artikel 38. (1) Die Abgeordneten des Deutschen Bundestags sind Vertreter des ganzen Volkes, an Aufträge und Weisungen nicht gebunden und nur ihrem Gewissen unterworfen.
Die Parlamentarier werden von den Wählern zur Gesetzgebung ermächtigt, sind ihnen gegenüber aber zu nichts verpflichtet, schon gar nicht zur Bedienung von Interessen oder Erwartungen, die diese mit ihrer Stimmabgabe womöglich verknüpfen. Die Parlamentarier sind „nur ihrem Gewissen unterworfen“, in ihren Entscheidungen also frei. Mit solchen freien Entscheidungen setzt die Legislative das Recht, an das die Bürger sich zu halten haben, und buchstabiert ihnen die Sanktionen vor, die fällig sind, wenn sie es nicht tun. Die ebenfalls gleich erwähnte „vollziehende Gewalt“, die mit der unmittelbaren Machtausübung beauftragte Regierung, lenkt den Staat, fällt laufend neue Entscheidungen über das Leben der Bürger und setzt sie durch. Die Judikative sorgt für die Geltung des Rechts, d.h. sie unterwirft die Bürger den gesetzlichen Ge- und Verboten, indem sie deren Tun und Lassen mit der staatlichen Norm vergleicht und Verletzungen der Norm dadurch heilt, dass sie dem Täter eine wohldosierte Vergeltung verpasst, die, in staatlicher Zuständigkeit geübt, Sühne heißt und die Herrschaft des Rechts klarstellt.
In diesem Sinn legt das Grundgesetz als Satzung des Staates die Verfahrensweisen fest, nach denen die politische Herrschaft vom regierten Volk getrennt und ihm gegenübergestellt wird; sie definiert den abstrakten Staatsaufbau und die verschiedenen Kommandoposten bei der Staatsmacht.
Ermächtigung und Beschränkung der Inhaber der Macht: Herrschaft als Amt
Die Definition der diversen hohen und höchsten Positionen im Staat ist ganz formell und besteht darin, festzulegen, wie interessierte Bürger die Macht im Staat erwerben können, wie sie von der Macht auch wieder getrennt werden, wem sie was zu sagen haben und von wem sie sich etwas sagen lassen müssen.
Auf die Art konstruiert und dekretiert die Verfassung eine Hierarchie von mit begrenzten Kompetenzen ausgestatteten Machtpositionen im Staatsapparat und sichert ein doppeltes Ziel: einerseits einen von der Spitze her bestimmten, einheitlichen, entscheidungs- und handlungsfähigen Staatswillen – verkörpert in der Führungsfigur an der Spitze –, der sich im Staatsapparat und über seine föderativen Untergliederungen bis in die letzten Winkel der Gesellschaft durchsetzen und die Bürger seinen Zwecken und Ratschlüssen unterwerfen kann. Andererseits setzen die den jeweiligen Posten zugeteilten Kompetenzen und deren Grenzen sowie in letzter Instanz die Regelungen zur Trennung von Macht und Machtträger fest, dass die Macht im Staat nicht Privatbesitz des Machthabers ist und ihr Einsatz nicht seinen persönlichen Interessen dient: Herrschen im Verfassungsstaat ist die Ausübung eines Amtes, sein Inhaber ein Diener an einem ihm vorgegebenen Herrschaftszweck. Das gilt als ein besonderes Gütesiegel der demokratischen Staatsverfassung. Allein das Verbot von Willkür und Bereicherung im Amt, das die Träger der Macht auf einen Dienst am Staat und seinem Programm festlegt, hat ihnen das konstruktive Missverständnis eingetragen, sie seien eben dadurch auch gleich Diener der Bürger; von Herrschaft im Wortsinn könne im modernen Staat eigentlich keine Rede mehr sein.
Um diesen Schwindel kümmert sich das Grundgesetz aber nicht weiter; dem ist mit der elementaren Lebenslüge vom Volk als seinem eigenen Souverän abschließend Genüge getan. Die Verfassung abstrahiert von Erwartungen oder Versprechungen guter Herrschaft ebenso vollständig wie von Notwendigkeit, Inhalt und Zweck der wirklichen; Erinnerungen daran kommen in viel späteren Artikeln als Stoff für das, was das Grundgesetz wesentlich interessiert, nämlich die Abgrenzung von Kompetenzen und Befugnissen. Ebenso wenig ist von den Mitteln, dem Apparat flächendeckender Herrschaft, sogar vom Machtinstrument Nr. 1, dem Geld des Staates die Rede; bzw. von ihm nur hinsichtlich gewisser Modalitäten seiner Beschaffung und Verwendung. Dass das alles irgendwie mitgedacht ist, dafür verlässt sich das Grundgesetz offenkundig auf den gesunden Menschenverstand des an vorgeschriebene Lebensbedingungen als „die Realität“ angepassten Mitmachers der effektiv zu regierenden bürgerlichen Konkurrenzgesellschaft, für den sogar die Ausübung von Macht ein Job in der Hierarchie der Berufe ist.
Ganz in dem Sinn formuliert die Verfassung, und das durchaus unmissverständlich, die einschlägigen Regelungen für das Amt des höchsten Staatsdieners: Der Weg ins Kanzleramt wird als eine Ermächtigung organisiert, die souveräne Entscheidungs- und Handlungsmacht freisetzt.
Artikel 63. (1) Der Bundeskanzler wird auf Vorschlag des Bundespräsidenten vom Bundestage ohne Aussprache gewählt.
(2) Gewählt ist, wer die Stimmen der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages auf sich vereinigt. Der Gewählte ist vom Bundespräsidenten zu ernennen.
Die Verfassungsgeber wollen bei der Machtzuteilung erst einmal eindeutige Verhältnisse. Der Bundespräsident schlägt bloß vor. Der Bundestag wählt; ein „doppelter, zu Loyalitätskonflikten führender Legitimationsbezug“, [3] der das oberste Bundesamt schwächt, wird so verhindert. Der Verzicht auf eine Aussprache „[soll] den Kandidaten vor einer Vorabdiskussion seiner politischen Absichten schützen“, [4] steht also dafür, dass die Kanzlerwahl als reine Ermächtigung unbedingt vollzogen und nicht abhängig gemacht wird von politischen Erklärungen oder Zusagen, die den Willen des Kandidaten irgendwie binden könnten. Allein auf den korrekt vollzogenen Akt der Machtübertragung kommt es an. Gelingt die nicht, so verlangt die Verfassung binnen zweier Wochen weitere Versuche, eine Mehrheit für einen Kanzlerkandidaten zu finden, danach genügt ihr eine relative Mehrheit unter den abgegebenen Stimmen. Eine Staatsspitze muss auf jeden Fall her – sonst hat das Parlament an seiner Aufgabe, die Machthierarchie zu besetzen, versagt und darf vom Präsidenten heimgeschickt werden. Der so oder so Gewählte ergreift dann aber nicht die Macht, sondern wird ernannt, vom Bundespräsidenten, der ihn zwar nicht nicht ernennen kann, aber doch erst in den Dienst am höchsten Staatsamt berufen muss. Danach ist es so weit, der Gewählte kann zur Tat schreiten; die Befugnis zur Machtausübung ist ihm nach den Regularien des Grundgesetzes erteilt; die Macht selbst, die er ausübt, hat ihre Quelle selbstverständlich nicht im verfassungsgemäßen Procedere. Die „freien“ Setzungen des Grundgesetzes beziehen sich eben auf eine ihm vorausgesetzte, funktionierende Staatsgewalt, die sich auf ihrem Territorium durchzusetzen versteht und die dem Kanzler die Macht wirklich an die Hand gibt, die das Grundgesetz ihm rechtlich zuschreibt.
Aufgabe des gewählten Bundeskanzlers, wieder rein im Sinn der hierarchischen Organisation der Macht, ist es, die Bundesminister vorzuschlagen – nicht jedoch zu ernennen; diesen Akt vollzieht wieder der Bundespräsident (Artikel 64, Abs. 1) – und die „Richtlinien der Politik“ (Artikel 65) zu bestimmen. Als Generalist der Macht steht er für die einheitliche Ausrichtung der „vollziehenden Gewalt“. Chef der Minister ist er gleichwohl nicht, denn innerhalb der „Richtlinien leitet jeder Bundesminister seinen Geschäftsbereich selbständig und unter eigener Verantwortung“ (ebd.), was den Ressortchef als Anwalt von Staatsnotwendigkeiten ausweist, die im Geschäftsbereich inkorporiert sind und durch Machtworte des Kanzlers nicht einfach außer Kraft gesetzt werden dürfen. Unmittelbares Hineinregieren muss er sich also nicht gefallen lassen. Seine Entlassung kann der Kanzler aber schon (nicht vollziehen – das ist wieder Sache des Bundespräsidenten –, aber eben doch:) verbindlich vorschlagen, wenn sich der Minister seinen allgemeinen Richtlinien nicht unterordnet.
Zur Definition der höchsten Machtposition als Dienst am Staat gehört schließlich, dass auch wieder die Trennung von Amt und Person geregelt wird: So endet „das Amt des Bundeskanzlers oder eines Bundesministers ... in jedem Falle mit dem Zusammentritt eines neuen Bundestages“ (Artikel 69, Abs. 2). Nach vier Jahren ist von einem neuen Bundestag eine neue Regierung und damit auch der Kanzler neu zu wählen. Auch ein parlamentarischer Kanzlersturz ist vorgesehen; allerdings steht der unter dem Gebot, die Handlungsfähigkeit des Staates nicht zu gefährden. Weil das Fehlen eines obersten Chefs der größte anzunehmende Unfall wäre, kann der Bundestag „dem Bundeskanzler das Misstrauen nur dadurch aussprechen, dass er mit der Mehrheit seiner Mitglieder einen Nachfolger wählt und den Bundespräsidenten ersucht, den Bundeskanzler zu entlassen“ (Artikel 67, Abs. 1).
Im Sinn der einheitlichen Durchsetzung des von oben bestimmten Staatswillens kommen die Verfassungsväter auf die Staatsdiener unterhalb der politischen Ebene zu sprechen, auch hier so, dass sie schlicht dekretieren, was die Funktionsträger der Bürokratie und der Gewaltorgane, die die Herrschaft des Staates über die Gesellschaft an tausend Stellen praktisch wahr machen, dürfen und müssen.
Artikel 33. (4) Die Ausübung hoheitsrechtlicher Befugnisse ist als ständige Aufgabe in der Regel Angehörigen des öffentlichen Dienstes zu übertragen, die in einem öffentlich-rechtlichen Dienst- und Treueverhältnis stehen.
(5) Das Recht des öffentlichen Dienstes ist unter Berücksichtigung der hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums zu regeln und fortzuentwickeln.
Vertreter des Staates auf den verschiedenen Stufen seines Apparats, die hoheitliche Befugnisse, also „ein klassisches Über-/Unterordnungsverhältnis zum Bürger“ exekutieren, das „durch Befehl und Zwang gekennzeichnet“ [5] ist, haben selbst als weisungsgebundene Befehlsempfänger zu agieren, die tun, was ihnen ihre Vorgesetzten in der hierarchisch durchkonstruierten Bürokratie anschaffen. Ihnen wird eine besondere Loyalität gegenüber dem System der politischen Herrschaft abverlangt, der sie ja nicht nur wie alle anderen gehorchen müssen, deren Macht über die Bürger sie in ihrem Zuständigkeitsbereich vielmehr selbst in Händen haben und exekutieren. Für das dem Beamten aufgetragene „jederzeitige Eintreten für den Staat und seine verfassungsmäßige Ordnung, Neutralitätsgebot und Wahrnehmung der Interessen der Gesamtheit sowie Wahrnehmung der Interessen des Dienstherrn“ [6] steht ihm „wohlwollende Behandlung, Förderung und Schutz sowie allgemeine Fürsorgepflicht“ seitens des „Dienstherrn“ zu, die ihn vor der Versuchung seines Berufes bewahren soll – vor der er auch mit der Bedrohung durch Strafen und den Verlust seiner Privilegien abgeschreckt wird: den Zipfel der Macht, den er selbst verwaltet und mit dem er von seinen Entscheidungen abhängige Bürger in der Hand hat, zum eigenen Vorteil einzusetzen.
Auch den Regierten weist die Verfassung die ihnen gemäße Stellung im Staatsaufbau und in der staatlichen Willensbildung zu. Sie haben das Recht, „sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen schriftlich mit Bitten oder Beschwerden an die zuständigen Stellen und an die Volksvertretung zu wenden“ (Artikel 17) und ihre freie Meinung öffentlich vorzutragen (Artikel 5) – beides bekräftigt die hoheitliche Zuständigkeit derjenigen, an die sich Appelle und Vorschläge richten: Sie sind es, die über Bürgerwünsche befinden.
Die herrschaftliche Produktivkraft geteilter Gewalten
Schon bei der ersten Nennung der drei Gewalten legt das Grundgesetz deren sich gegenseitig sowohl begrenzendes wie legitimierendes Verhältnis fest:
Artikel 20. (3) Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden.
Die Regierung und alle ihre Organe haben sich an die gültigen Gesetze zu halten. Über dem Gesetz stehen nur die Parlamentarier, die ihre Gesetzgebungshoheit im Rahmen und nach dem Sinn der Verfassung ausüben müssen. Per Mehrheitsentscheid beschließen und verändern sie die Gesetze nach aktuellen Staatsbedürfnissen, die sie zumeist von der von ihnen getragenen Regierung mitgeteilt bekommen. Damit „das Recht“, d.h. der in den Gesetzen verobjektivierte Staatswille herrscht und nicht die parlamentarische Mehrheit selbst – auch sie dient dem Staat nur durchs verbindliche Ge- und Verbieten –, ist die Aufsicht über die Befolgung der Gesetze, die Sorge für die Geltung des Rechts wieder einer anderen Instanz, der Judikative, übertragen. Sie wacht nicht nur über die Gesetzestreue der Bürger, sondern auch über Einhaltung oder Überschreitung der verfassungsmäßigen oder gesetzlichen Kompetenzen der beiden anderen Säulen des Staates.
Mit solchen Vorkehrungen verpflichtet die Verfassung die Amtsträger an der Spitze des Staates – worauf eigentlich? Implizit und ohne jede weitere Begründung formuliert sie hier Vorkehrungen gegen allzu weitgehende Freiheiten der Staatsorgane, auch der gesetzgebenden „Vertreter des ganzen Volkes“. Ohne es explizit zu machen, bezieht sie sich auf ein Moment staatlicher Herrschaft, das den Verfassungsvätern, selbst engagierte Sachwalter staatlicher Gewalt und Protagonisten einer ziemlich neuen bundesdeutschen Staatsräson, als Problem offenbar selbstverständlich war: Wer sich um ein hohes, erst recht ums höchste Staatsamt bemüht, bringt einen Machtwillen mit, ein politisches Programm für den Gebrauch herrschaftlicher Gewalt, der womöglich geeignet ist, den Rahmen des fürs bürgerliche deutsche Gemeinwesen Passenden – wo, inwiefern und wie auch immer – zu überschreiten. Auf diesen Rahmen nimmt das Grundgesetz Bezug; explizit mit Bezug allein auf sich selbst, implizit natürlich im Hinblick auf das ganze herrschaftlich verfasste bzw. zu verfassende gesellschaftliche Gebilde, um dessen Ordnung die Verfassung sich auf ganz hoher Ebene und dann doch sehr detailliert kümmert. Den Inhabern staatlicher Gewalt wird ein ganz prinzipieller Konservatismus verordnet – und in dieser denkbar abstrakten Form ein prinzipieller Respekt vor dem irgendwie selbstverständlichen Weiß-Warum und Wozu der Herrschaft, um deren Satzung es geht. Die Verpflichtung darauf steckt in den peinlich genau geregelten Prozeduren für die Kooperation unter den verschiedenen, gegeneinander selbständigen Staatsinstitutionen.
Dass es so etwas braucht, war den Verfassungsvätern klar: Schließlich ermächtigt ihr Regelwerk Individuen dazu, anderen Vorschriften zu machen und für sie verbindliche Entscheidungen zu fällen, identifiziert deren persönliches Urteil mit dem Volkswohl – je höher in der staatlichen Hierarchie, desto mehr. Und in diesem Sinn identifizieren auch die Inhaber hoher Ämter ihren Willen mit dem Auftrag des Amtes – und bestehen auf der Geltung ihres Willens. Ebenso klar war den Autoren des Grundgesetzes, dass solchen Machthabern die demokratische Lektion, dass die Ausübung ihrer Macht ein Dienst an einer ihrem Willen vorausgesetzten staatlichen Räson zu sein hat, nur von ihresgleichen, von anderen Inhabern von Macht, klargemacht werden kann. So statten sie mit der Autorität einer Satzung, deren Geltung davon lebt, dass sich die diversen Inhaber von Machtpositionen an sie halten, andere Posten und deren Inhaber mit konkurrierenden, die ersten begrenzenden Machtbefugnissen aus.
Der Wille zur Durchsetzung, den das Amt freisetzt und die Amtspflicht verlangt, trifft so im Ensemble der Dienststellen auf die Kompetenzen anderer als Bedingung und Schranke seiner Verwirklichung. Die Funktionsbereiche können und sollen sich aneinander reiben. Kein Beteiligter muss an mehr denken als an das Stück Macht, das Inbegriff der „Verantwortung“ seines Amtes ist, und es gegen andere Institutionen als seinen Besitz verteidigen. Amtsinhaber, die sich nicht an die vorgegebenen Demarkationslinien halten, die tun, wofür andere, oder nicht tun, wofür sie zuständig sind, bekommen es mit den betroffenen Dienststellen zu tun. Eingemauert in die „checks and balances“ ihres gegensätzlich-arbeitsteiligen Verhältnisses hindern sich die Amtsinhaber wechselseitig daran, die rechtlich fixierten Notwendigkeiten des Staatshandelns, für die ihr Amt steht, auf Kosten anderer und damit der Staatsziele überhaupt absolut zu setzen. Die vielgelobte demokratische Gewaltenteilung teilt also nicht das – schon dem Namen nach unteilbare – Gewaltmonopol des Staates gegenüber der Bürgerschaft, mit dem er sie auf seine Verordnungen festlegt. Sie teilt und begrenzt die Macht der Funktionäre im und über den Staat und wahrt damit die Souveränität des Staates und seiner Räson nicht nur gegenüber der Gesellschaft, sondern auch gegenüber den Figuren, die seine Macht in Händen halten und ausüben. Sie haben den in geregelter Kooperation mit anderen Staatsorganen ermittelten Staatswillen zu exekutieren – und nicht ein persönliches Gutdünken.
Jedenfalls sollen sie das nach dem Willen der Verfassungsgeber. Die wissen, dass sie mit ihren Kompetenzzuschreibungen Machtfragen aufwerfen, sich also nicht darauf verlassen können, dass der Streit der Funktionäre jederzeit konstruktiv bleibt. So haben sie eine „Indemnität“ der Bundestagsabgeordneten verfügt, um sie vor juristischen Nachstellungen politischer Gegner zu bewahren, [7] und ebenso die Unabhängigkeit der Richter unter einen besonderen Schutz gestellt. [8] Auch explizite Kontrollfunktionen sieht das Grundgesetz vor. So hat der Bundestag „das Recht und auf Antrag eines Viertels seiner Mitglieder die Pflicht, einen Untersuchungsausschuss einzusetzen, der in öffentlicher Verhandlung die erforderlichen Beweise erhebt“ (Artikel 44, Abs. 1), weil mit dem Missbrauch politischer Macht als fester Größe gerechnet wird. Und ein oberstes Gericht steht bereit, um
Artikel 93. (1) 1. ... Streitigkeiten über den Umfang der Rechte und Pflichten eines obersten Bundesorgans oder anderer Beteiligter, die durch dieses Grundgesetz oder in der Geschäftsordnung eines obersten Bundesorgans mit eigenen Rechten ausgestattet sind,
in letzter Instanz zu entscheiden.
Föderalismus – Staatsaufbau von unten für Legitimation und Durchgriff der Staatsmacht von oben
Einen gewissen Höhepunkt hat die Kunst, die Einheit der politischen Herrschaft als Konkurrenz aufeinander verwiesener Teilmächte zu organisieren, im bundesdeutschen Föderalismus erreicht.
Die Verfassungsväter des Kriegsverlierers haben sich bei der für Präsenz und Schlagkraft überall im Land nötigen „vertikalen Gliederung“ der Staatsmacht für eine vergleichsweise dezentrale Organisation entschieden. Auch in dieser Frage erfinden sie nichts Neues, sondern orientieren sich an Gegebenheiten, die sie mit rechtlichen Setzungen lediglich sanktionieren: einerseits am Willen der alliierten Oberhoheit, die nur einen föderalen Staat genehmigen wollte, sowie an den Grenzen der alliierten Besatzungszonen, die das Land schon gegliedert hatten; andererseits an überkommenen Grenzen früherer Fürstentümer und Königreiche auf deutschem Boden, die das natürliche Produkt jahrhundertelanger kriegerischer Machtproben zwischen den damaligen Herrschern waren. Die Grundgesetzgeber freilich präsentieren sich als Schöpfer von Bund und Ländern, wenn sie souverän verordnen, dass sich ihr neuer Staat von unten aufbauen soll, d.h. von Untereinheiten der Staatsgewalt getragen wird, eben den Bundesländern, denen sie eine „Eigenstaatlichkeit“ mit Verwaltungshoheit und exklusiven Staatsaufgaben spendieren. Der Zusammenschluss der Länder, der so natürlich nie stattgefunden hat und von denen auch nicht infrage gestellt werden darf, bildet den Bund. Zunächst sind grundsätzlich sie es, die das „Recht der Gesetzgebung“ haben – „soweit dieses Grundgesetz nicht dem Bunde Gesetzgebungsbefugnisse verleiht“ (Artikel 70, Abs. 1). Das tut es allerdings ziemlich gründlich. Dafür erhalten die Länder – durch die deutsche Spielart des Zwei-Kammer-Systems – nicht unerhebliche Mitspracherechte bei der Gesetzgebung des Bundes (Artikel 50). Sie dürfen eigene Verfassungen haben, die aber „den Grundsätzen des republikanischen, demokratischen und sozialen Rechtsstaates im Sinne dieses Grundgesetzes entsprechen“ müssen (Artikel 28, Abs. 1). Im einzelgesetzlichen Zweifelsfall gilt: „Bundesrecht bricht Landesrecht.“ (Artikel 31) Und wenn „ein Land die ihm nach dem Grundgesetze oder einem anderen Bundesgesetze obliegenden Bundespflichten nicht erfüllt, kann die Bundesregierung“ dem „im Wege des Bundeszwanges“ entgegentreten – „mit Zustimmung des Bundesrates“, versteht sich. (Artikel 37, Abs. 1)
Die Arbeitsteilung des Staates und seiner Verwaltungseinheiten wird so auf die Höhe eines Verhältnisses parallel existierender, souveräner Herrschaftssubjekte gehoben, für die es bei jeder Sachfrage um die Über- und Unterordnung zwischen ihnen geht. [9] Soweit Länderchefs auf den ihnen reservierten Hoheitsrechten bestehen oder wegen regionaler Interessen eine alternative Bundespolitik fordern, sind sie eine Einspruchsinstanz gegen Durchmärsche der Zentralregierung, die diese zum Konsens bei der Herrschaft über das Land nötigt. [10] Einfaches Durchregieren „des Bundes“ wird verhindert, eine „Pattsituation“ der Gewalten, die dem Regieren im Weg steht, aber auch. [11] Die Verfassung legt fest, welcher der Instanzen welches Gewicht zukommt und wann Schluss ist mit ihrem Streit,[12] und für den Fall, dass doch nicht Schluss ist „bei Meinungsverschiedenheiten über Rechte und Pflichten des Bundes und der Länder“ (Artikel 93, Abs. 3), entscheidet wieder das Verfassungsgericht.
Auch auf der untersten Ebene der staatlichen Hierarchie, den Kommunen, hält sich das Grundgesetz daran, dass es Städte und Stadt- sowie Gemeindeverwaltungen schon gibt, und weist ihnen eine rechtliche Stellung im Staatsaufbau zu: Sie dürfen die „Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung“ (Artikel 28, Abs. 2) erledigen. Dass die Bürger des „demokratischen und sozialen Bundesstaats“ neben Bundes- auch noch Landeschefs und Bürgermeister mit ihren jeweiligen Kompetenzen über sich haben, gilt – jedenfalls hierzulande – als vorbildlich „bürgernah“. Was dem Bürger da nahe kommt, ist aber allemal Herrschaft. Indem die staatliche Ordnung, die von oben her die allgemeinen Lebensbedingungen bestimmt, sich zugleich von unten – den „örtlichen Gemeinschaften“ – her aufbaut, sichert sie nicht nur, dass am Regelungsanspruch des staatlichen Gewaltmonopolisten noch im letzten Dorf niemand vorbeikommt, sie besteht zugleich darauf, dass die politische Herrschaft über die Nation einem Bedürfnis des lokalen Zusammenlebens entspricht, auf das die Macht setzen kann – eine freundliche Grußadresse an Heimatliebe und Lokalpatriotismus; Tugenden, die noch jede Herrschaft als Beweggrund für tatkräftige Anpassungsbereitschaft brauchen kann.
Die Indienstnahme der Regierten für die Ermächtigung des Herrschaftspersonals
Die demokratische Herrschaft des Grundgesetzes geht aber noch ganz anders auf ihre regierten Bürger zu. Sie gestattet ihnen, sogar als unveräußerliches Grundrecht, eine freie Meinung über politische Belange. Und das nicht bloß als privates Räsonieren: Erlaubt ist eine an eigenen Interessen und Urteilen orientierte Einmischung in Staatsangelegenheiten, sogar in organisierter Form und mit dem Ziel, wirksam zu werden. Das Grundgesetz lässt politische Parteiungen im Volk zu, Polemik und Werbung für abweichende Meinungen darüber, was der Staat tun und bewirken soll. Immerhin riskiert die Herrschaft damit Entzweiung in ihrem Volk, das im Parlament doch „als ganzes“ vertreten sein soll, und dass organisierte Unzufriedenheit das Vertrauen der Regierten in die Sachwalter des Gemeinwesens untergräbt.
Mit dem „Parteienprivileg“ sind derlei Aktivitäten freilich nicht bloß lizenziert, sondern zugleich auf den rechten Weg verwiesen:
Artikel 21. (1) Die Parteien wirken bei der politischen Willensbildung des Volkes mit. Ihre Gründung ist frei. Ihre innere Ordnung muss demokratischen Grundsätzen entsprechen...
„Politische Willensbildung“ durch die erlaubten Parteien, das versteht sich fürs Grundgesetz offenkundig von selbst, hat ihr Ziel in der Ermächtigung von Volksvertretern, deren Ehrgeiz sich darauf richtet, die Organe der Staatsgewalt zu leiten und diese Aufgabe im festgelegten Rahmen zu erledigen. Offenbar zur Absicherung dekretiert es als Erstes, dass die innere Verfassung der Parteien selbst als ein solches Ermächtigungsverfahren zu gestalten ist: ein schönes Beispiel für das Vertrauen der Staatssatzung darauf, dass das rechte Procedere wie von selbst auch das rechte Ergebnis hervorbringt. Eine Verbotsandrohung gibt es anschließend freilich auch noch:
(2) Parteien, die nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgehen, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden, sind verfassungswidrig.
Aus dem so vorsortierten Angebot dürfen die Bürger dann ganz frei auswählen:
Artikel 38. (1) Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages werden in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt.
Die Wahl ist allgemein – d.h. jeder und jede, die das ebenfalls vorgeschriebene Wahlalter erreichen, dürfen abstimmen; jeder individuellen Präferenz steht so die Gesamtheit der Voten der anderen gegenüber. Sie wird nur im Aggregat wirksam, sodass das gleiche Gewicht, das jeder Wahlstimme zugesichert wird, vor allem das gleich geringe Gewicht unterstreicht, das sie im Millionentopf, in dem sie landet, entfaltet. Dass bei einer geheimen Wahl keiner seine Entscheidung öffentlich rechtfertigen muss, gilt als Garant der Freiheit des sonst offenbar vielerlei Druck und Kontrolle ausgesetzten und dafür empfänglichen Bürgers, heißt aber auch, dass er keine vertretbaren Gründe für sie braucht, und charakterisiert das Wählen als eine beliebige Geschmackssache.
Indem die Demokratie die Karrieren von politischen Bewerbern vom Geschmack der Wähler abhängig macht und die Amtsführung der amtierenden Mannschaft einer Bewertung durch sie aussetzt, entzieht sie den Staat selbst jedem Urteil: Die Bürger wählen Amtsträger. Wen sie auch bevorzugen – selbst wenn viele gar nicht wählen –, die Ämter, die der Wahl ihrer Funktionäre vorausgesetzt sind, werden immer von Personen besetzt, die den Staat in seinem Sinn zu verwalten versprechen. Die Verfassung organisiert die Entscheidungsfreiheit des wahlberechtigten Volkes insgesamt also so klug, dass es bei seinem Freiheitsakt eigentlich nichts mehr falsch machen kann. Ob der Wähler mit seiner Stimme bei der Mehrheit landet und das Glück genießt, seinem Wunschkandidaten gehorchen zu dürfen, oder ob er zu der Minderheit gehört, die von Leuten regiert wird, die sie nicht haben wollte; der Staat verbucht das Votum beider Fraktionen schlicht als die Zustimmung zum Regiertwerden, auf die es ihm ankommt.
Eine notwendige Ergänzung: der staatliche Notstand
Wenn diese Zustimmung oder wenigstens das Sich-Gefallen-Lassen der verfassungsgemäßen Herrschaft aber doch einmal nicht zu haben ist, wenn die Staatsführung sich nicht mehr auf den Willen der Regierten oder auf ihre eigenen Untereinheiten verlassen kann, dann gilt unbedingt ihr Wille und nicht der abweichende der Untergebenen. Auch darauf ist das Grundgesetz – nach einigen Verfassungsänderungen – perfekt vorbereitet. Es definiert den Notstand – Naturkatastrophen, äußere Bedrohung oder innerer Aufruhr gelten ihm gleichermaßen als Störfälle souveräner Machtausübung – und legt fest, wie die Souveränität der Herrschaft unter solchen Bedingungen zu wahren ist, d.h., was die Staatsführung dann alles darf. Egal, ob zur Staatsrettung entschlossene Politiker auf solche Erlaubnisse warten, ob sie sie brauchen und was sie ihnen in dieser Lage nützen; die Verfassung regelt auch die Außerkraftsetzung des Rechtsstaats rechtsstaatlich: Weite Teile des üblichen Procedere – sonst Instrumente der Legitimität und Unwidersprechlichkeit seiner Anordnungen – werden als Hindernisse der Durchsetzung des Gewaltmonopols außer Kraft gesetzt. „Erfordert die Lage unabweisbar ein sofortiges Handeln und stehen einem rechtzeitigen Zusammentritt des Bundestages unüberwindliche Hindernisse entgegen oder ist er nicht beschlussfähig“ (Artikel 115a, Abs. 2), übernimmt ein deutlich dünner besetztes Gremium von Bundestags- und Bundesratsmitgliedern die Geschäfte („Gemeinsamer Ausschuss“). Der Bund kann auf Landesregierungen und ‑verwaltungen durchgreifen, die Gesetzgebung vollständig an sich ziehen und die Bundespolizei im gesamten Bundesgebiet einsetzen. Ist seine Souveränität angefochten, gestattet sich das Gewaltmonopol gegen Willen, Person und Leben der Bürger eine Rücksichtslosigkeit, die im Normalbetrieb nicht vorgesehen ist. All das ist keine Absage an Demokratie und Rechtsstaat, sondern deren Rettung dann, wenn Teile des Volkes kein Interesse mehr daran haben. Für diesen Fall gesteht das Grundgesetz „allen Deutschen“, „wenn andere Abhilfe nicht möglich ist“, sogar ein „Recht zum Widerstand“ zu „gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen“ (Artikel 20, Abs. 4). Einzig zur Staatsrettung erlauben die professionellen Hüter der wehrhaften Demokratie den Bürgern einen Widerstand gegen die – falsche – Obrigkeit, der auf die Wiederherstellung ihres Regimes zielt. Mit diesem Artikel gewährt die Verfassung den Bürgern ein schönes Recht, das garantiert nie zur Anwendung kommt: Schließlich müssten die falschen Machthaber, gegen die den Bürgern das Demokratie rettende Widerstandsrecht zusteht, die Rechtslage auch so sehen.
II. Die Grund- und Menschenrechte: Was die Bürger dürfen, also müssen
Eine Verfassung setzt Recht; Gründe dafür nennt sie nicht. Wenn das Grundgesetz also ein solides, vielfältig sich selbst kontrollierendes, dadurch sehr unerschütterliches Gewaltmonopol konstruiert und der Gesellschaft gegenüberstellt, dann selbstverständlich ohne jede Reflexion darauf, warum dieses Zusammenleben der Bürger eine monopolisierte Gewalt über sich braucht und was sie, Zwangsmacht, die sie ist, den Bürgern aufzwingt. Die rechtliche Konstruktion des Staates kommt ohne Bezug auf seinen Zweck bzw. auf die Staatsräson aus, der er in seiner Praxis folgt.
Und das kann sie auch, denn das Korpus des bürgerlichen Rechts und all der anderen Regale füllenden Gesetzeswerke, mit denen der Staat ein juristisches Abziehbild seiner Gesellschaft liefert und mit denen er sie seinen Zielen unterwirft, brauchen das Grundgesetz für ihre Abfassung nicht, gehen nicht aus seinen Setzungen hervor und sind in weiten, vor allem den grundsätzlichen Teilen sowieso viel älter als die aktuelle deutsche Verfassung. Das Grundgesetz schafft nicht die Eigenart der Gesellschaft und auch nicht den Staat, sondern setzt beides schlicht und einfach voraus, wenn es ihm die Rechtsprinzipien seines Aufbaus und seines legitimen Agierens aufschreibt. Die vielfältigen Politikfelder und Staatsaufgaben, die seinen Verfassern natürlich nicht unbekannt sind, greift es einfach so, rein empirisch, ohne Logik und ohne Befassung mit ihrem Stoff aus der Praxis des Staates auf. Vom Schul-, Bank-, Gesundheits-, Verkehrs- und Geldwesen über den Arbeits-, Umwelt- und Verbraucherschutz bis zum steuerlichen Zugriff der Obrigkeit auf das Geld der Regierten findet alles Erwähnung – konsequent unter dem selbstbezüglichen Regelungsgesichtspunkt des Grundgesetzes: Welches Staatsorgan oder welche staatliche Ebene soll für welches Feld zuständig gemacht werden und wie sollen Bund und Länder sich konkurrierende Zuständigkeiten teilen.
Ein Zweck aber geht aus der juristischen Konstruktion des Staatsaufbaus selbst hervor: Wenn die Verfassung dem Staat das alleinige Recht auf eine monopolisierte Gewalt zuschreibt, die er freilich nicht von der Verfassung hat, sondern von der Durchsetzung ebendieser Gewalt in der Gesellschaft; wenn sie jede davon getrennte, autonome Gewalt als illegitim verurteilt, dann bezieht sich das Machtsubjekt, dem sie die Satzung formuliert, auf eine Gesellschaft gewaltträchtiger Interessengegensätze und zwingt die Inhaber dieser Interessen zur Gewaltlosigkeit. Davon zeugen ja auch alle erwähnten Gesetze und Politikfelder: Sie regeln mit der Entscheidungsmacht der Staatsgewalt konkurrierende Ansprüche. Das Gewaltmonopol zwingt die Bürger zum Frieden untereinander, das heißt zur Koexistenz mit ihnen feindlichen Interessen – damit es diese Interessen und ihre vom Staat geschützten Gegensätze überhaupt gibt. Mit diesem Bezug auf seine nie genannte Unterstellung bekennt das Grundgesetz, dass nicht ethische Wertpräferenzen bzw. die juristische Phantasie von Verfassungsgebern Staat und Gesellschaft determinieren, sondern, wie Marx sagt, die materielle Produktionsweise der Gesellschaft die politische Herrschaft und die gewaltsamen Setzungen des Rechts bestimmt, die sie braucht.
Auf genau diese idealistische Verkehrung legt das Grundgesetz aber viel Wert. In Form der den Artikeln zum Staatsaufbau vorangestellten Grund- und Menschenrechte gibt es eine verhimmelte Auskunft darüber, wofür der Staat da ist und gebraucht wird. In Form hoher Pflichten, Aufgaben und Schutzgüter schreibt er sich da selbst vor, was er in Bezug auf die regierten Menschen darf und was nicht; das vor allem: Auftrag und Leistung der politischen Herrschaft soll in der Hauptsache in ihrer Selbstbegrenzung, Zurückhaltung sowie in der Anpassung an ihre Herrschaftsobjekte liegen – an sie freilich nicht als verschiedene, auf ihre Rollen zu verpflichtende Charaktere einer kapitalistischen Wirtschaft, sondern als Menschen schlechthin. Die 19 einleitenden Artikel handeln von lauter Selbstverpflichtungen des Staates, legen fest, was er zu respektieren, zu erlauben, zu gewährleisten und zu schützen hat, um „dem Menschen“ gerecht zu werden. Herrschaft und Unterordnung, die vom Gewaltmonopol ausgehen, präsentiert das Grundgesetz als Dienst am Menschen und als ein Entsprechungsverhältnis zu dem, was der von sich aus ist und braucht.
Die Selbstbindung des Staates an die Menschenrechte will als Konzession an die Bürger und als Hemmung der ihm eigenen Gewalt verstanden werden und wird auch so verstanden. Über die Freude am demokratischen Ethos der öffentlichen Gewalt bzw. über die einzige kritische Frage, ob es ihr damit auch Ernst ist, gerät freilich die Wahrheit dieser Konzessionen aus dem Blick. Wenn der Staat sich in der Frage, was er gegenüber den Objekten seiner Herrschaft darf und was nicht, bindet, dann definiert er damit zugleich die Rechtsstellung der Untertanen gegenüber der Staatsmacht, legt eben auch fest, was diese dürfen und was nicht, und das nicht nur im Verhältnis zur Obrigkeit, sondern auch untereinander; wie sie also miteinander zu verkehren haben. Insofern ist den menschenrechtlichen Idealen dann schon anzumerken, zu welchen wirklichen gesellschaftlichen Gegensätzen und Rechtspositionen sie die idealisierten Fassungen sind.
Die Würde des Menschen
ist der an erster Stelle genannte Höchstwert der Verfassung, dem alle anderen Artikel nachgeordnet sind und gerecht werden müssen.
Artikel 1. (1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.
Aus der Natur des Menschen leitet das Grundgesetz eine unbedingte Verpflichtung ab, die sich an den Staat selbst richtet: Er hat bei der Ausübung seiner Gewalt über die Regierten etwas an ihnen bzw. sie als Träger einer Eigenschaft – eben der unantastbaren Würde – zu achten. Der Respekt vor dem „allgemeinen Eigenwert des Menschen“ ist so prinzipiell und unbestimmt, dass es auch Verfassungsrechtlern nicht leichtfällt, zu sagen, worauf er sich bezieht. So viel steht erst mal fest: Per Verfassung verbietet sich der Staat, mit den Menschen alles zu machen, was er als Staat könnte. Das schöne Verbot enthält somit ein weniger schönes Selbstbekenntnis der politischen Herrschaft: Die Bürger sind ihrer Gewalt vollständig und alternativlos unterworfen; sie könnte alles mit ihnen anstellen, wenn sie es sich nicht großzügigerweise versagen würde. Der Wert der edlen Selbstbeschränkung, die diese schrankenlos überlegene Gewalt sich auferlegt, gewinnt Plausibilität, wird zu etwas Positivem, zu dem die Menschen in ihrem Herrschaftsbereich sich gratulieren dürfen, einzig und allein durch den impliziten Vergleich mit staatlicher Gewalt zu anderen Zeiten und in anderen Weltgegenden, vor allem durch den Vergleich mit dem faschistischen Vorgängerstaat auf deutschem Boden: Staaten können auch anders. Und dass der heutige darauf verzichtet, muss man ihm hoch anrechnen. Die Bürger sollen sozusagen ein sich selbst zügelndes Monster gut finden, weil es sich zügelt.
Tatsächlich liegt Verzicht gar nicht vor. Allen Dienst an seinen Potenzen, den der Staat von der Gesellschaft haben will, mutet er ihr auch zu; von den Zwängen des Geldverdienens mit seinen vielfältigen ruinösen Folgen über das steuerliche Abkassieren bis zum Kriegsdienst kennt er keine Zurückhaltung beim Einfordern dessen, was er braucht. Verzichtet wird lediglich auf eine Behandlung der Bürger, die dieser Staat nicht braucht und die nicht zu seinem Programm gehört. Weil er die private Interessenverfolgung seiner Untertanen, die dem Kapitalwachstum dient, haben will, behandelt er sie eben nicht wie Sklaven. Mit der Abgrenzung von dem, was er nicht vorhat, erteilt er sich ein billiges Gütesiegel: für all das, was er tut. Dass er die ominöse Würde des Menschen nicht antastet, qualifiziert ihn als menschengemäß, als selbst ein Menschenrecht, auf das deshalb niemand pfeifen darf.
Was die menschliche Qualität denn nun sei, die der Staat in jedem Fall zu respektieren hat, bleibt unbestimmt, das Grundgesetz beschränkt sich auf das große Wort. Weil es die Achtung der Menschenwürde aber nicht nur als höhere Rechtfertigung und Selbstbeweihräucherung der Staatsordnung, die sie ist, den übrigen Grundrechten voranstellt, sondern sie zugleich als „unmittelbar geltendes Recht“ setzt, das die Staatsorgane bindet und vor Gericht eingeklagt werden kann, mussten Verfassungsrichter doch irgendwie festlegen, was aus dem Respekt vor der Würde der regierten Menschen folgen soll. Zu Recht nähern sie sich der Frage mit einer „Negativdefinition“: Die Würde sehen sie verletzt, wenn „das Individuum zum bloßen Objekt staatlichen Handelns“ degradiert wird und der Umgang mit ihm „seine Subjektqualität prinzipiell in Frage stellt“. [13] Damit nehmen sie eine bemerkenswerte Scheidung am Willen der Bürger vor: Sie trennen deren Charakter als freie Willenssubjekte von dem, was ihren Willen ausmacht – seinem Inhalt – und fordern, dass der Staat ersterem auch und gerade dann seine Reverenz erweise, wenn er letzteren nicht gelten lässt, auf Gehorsam gegenüber seinem übergeordneten Willen verpflichtet und Zuwiderhandeln bestraft. Er bekennt sich zu einer Schranke seines Verfügens über den Bürger, die durch dessen Willensnatur gesetzt sein soll, ohne sich aus dem zu ergeben, was er will; eine Schranke, über die klarerweise nur an höherer Stelle entschieden werden kann.
Der Bereich legitimen Herrschens ist also ziemlich weit gespannt. Entsprechend trostlos fallen die konkreten Auskünfte darüber aus, was die Hochachtung vor der menschlichen Würde dann doch verbietet. Sie ziehen die Grenze des Zumutbaren durch ein ununterschreitbares Minimum, das nicht eben schnell erreicht ist. „Ächtung“, „Verfolgung“ und „Terror“ [14] muss der Staat schon aufbieten, um gegen die selbstgesetzte Schranke zu verstoßen. Das Brechen des Bürgerwillens durch Folter ist gegen die Menschenwürde, so viel steht fest. Das Einsperren ungehorsamer Bürger in Mehrbettzimmern ist es nicht – es sei denn, sie sind überbelegt. Isolationshaft geht in Ordnung. [15] Verletzt ist die Würde aber, „wenn die Zelle des Gefangenen immer wieder mit Fäkalien aus einem defekten Abflussrohr verunreinigt wird“. Sind Bürger auf sozialstaatliche Leistungen angewiesen, muss das „existenzielle Lebensminimum“ [16] gewährleistet sein – usw. Jede rote Linie, die gezogen wird, überführt das höchste Schutzgut der bürgerlichen Herrschaft seiner Schäbigkeit – und eröffnet ein neues Feld des Rechtens um Euros, die mit gutem Grund vorenthalten werden, und Schikanen, die verfassungsrechtlich in Ordnung gehen. Indem sie dieses Feilschen um ihren Höchstwert institutionalisiert, achtet die demokratische Herrschaft das letzte Residuum von Subjekt-Sein, das sie ihren Bürgern konzediert: die Würde, die auch Obdachlosen und Häftlingen nicht bestritten werden darf und jedenfalls durch die Lage, in der sie sich befinden, nicht bestritten ist.
Der Staat, der sich verpflichtet, diese menschliche Würde zu schützen, kündigt den Bürgern damit an, dass auch sie das freie Willenssubjekt im Anderen, dessen Recht auf das Haben eines eigenen Willens und einer Ehre zu respektieren haben – egal wie sie sonst zueinander stehen. Offenbar vielfach nicht so gut, wenn die Würde staatlichen Schutz nötig hat.
Gleich nach der Würde, als ersten und entscheidenden Fall von Anerkennung ihres „Subjektcharakters“ garantiert die Verfassung den Menschen das Grundrecht der
Freiheit
Artikel 2. (1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt.
Im hohen, philosophischen Ton verpflichtet sich der Staat darauf, dem Bürger ein selbstbestimmtes Verhältnis zu sich zu gestatten. Er darf im Prinzip, und solange nichts dagegen spricht, tun, was er will. Mit dieser großzügigen Konzession kündigt das Grundgesetz freilich keinen Rückzug des Staates aus dem Leben der Bürger an, sondern das Gegenteil: Mit ihr bezieht die Staatsmacht alles Tun und Lassen der Bürger auf sich; stellt es unter ihren Genehmigungsvorbehalt und verwandelt deren Betätigung ganz grundsätzlich in ein Wahrnehmen staatlicher Lizenzen und ein Ausfüllen eines ihnen zugestandenen Spielraums.
Kein Wunder also, dass die Gewährung der Freiheit gleich mit der Benennung ihrer Bedingungen und Grenzen einhergeht. Auch die werden wieder ethisch hochwertig formuliert: Die Freiheit des einen darf die Freiheit des anderen nicht verletzen. Die Beschränkung, die der freie Wille sich gefallen lassen muss, soll daraus folgen, dass die gute Sache schließlich allen Bürgern gewährt wird: Jeder hat ein Recht auf seine Freiheit. Das Grundgesetz führt die Freiheiten mehrerer ganz selbstverständlich als kollidierende ein: Die Betätigung des freien Willens des einen behindert und bedroht dasselbe beim anderen – eine Eigentümlichkeit, die nicht aus der abstrakten Bestimmung von menschlicher Subjektivität, sondern aus den sehr bekannten, zur kapitalistischen Gesellschaft gehörigen Gegensätzen folgt.
So – mit der prinzipiell gewährten Freiheit und ihren Grenzen – bezieht sich die Verfassung auf die feindlichen, einander bestreitenden Interessen dieser Gesellschaft. Die nimmt sie nicht nach ihrem Inhalt zur Kenntnis, sondern allein nach ihrer Form: als selbstbestimmte Betätigung von Individuen – und unterwirft sie mit Erlaubnissen und Verboten ihrer Aufsicht. Unter der Lizenz des Staates dürfen Interessen – eben als Rechte – verfolgt werden. Unter der Bedingung, dass der Akteur sich im Rahmen dieser Lizenz bewegt, genießt sein Interesse den Schutz des Staates und darf dessen Gewalt gegen die Inhaber anderer Interessen hinter sich wissen. Wo er mit seiner Interessenverfolgung haltmachen und Rücksicht auf andere üben muss, entscheidet sich ebenfalls nicht an anderen Individuen, deren Bedürfnissen oder Nöten, sondern an den Lizenzen, die sie von Staats wegen für ihre Interessen vorweisen können. Die Grenze der Freiheit des einen ist nicht das andere Individuum, sondern eben auch auf seiner Seite das staatlich geschützte Recht, das respektiert werden muss. Das drückt der Verfassungstext noch gesondert aus, wenn er zu den Freiheitsrechten der anderen – für den Fall, dass damit noch nicht alle Gründe abgedeckt sein sollten, aus denen den Bürgern etwas zu verbieten ist – die Generalklausel ‚Sittengesetz‘ und die Staatsordnung selbst in Anschlag bringt.
Was das Grundgesetz als Verhältnis des Individuums zu sich, als Selbstbestimmung, präsentiert, ist also erstens die Subsumtion dieser Selbstbestimmung unter staatliche Erlaubnis, zweitens eben darüber ein Verhältnis zu den anderen Mitgliedern der Gesellschaft und deren Interessen. Was den verschiedenen Bürgern im Einzelnen zu erlauben oder zu verbieten ist – und das ist immerhin das, wovon der tatsächliche Handlungs- und Freiheitsraum der Bürger und ihr praktisches Verhältnis zueinander bestimmt sind –, gehört ins materiale Recht, nicht in die Verfassung. Sie selbst bleibt abstrakt und legt nur fest, dass alle Interessen und alle Beziehungen der Gesellschaftsmitglieder untereinander in staatlich kontrollierte Gewaltverhältnisse zu transformieren und die kollidierenden Freiheiten der Bürger dadurch zur Koexistenz zu zwingen sind.
Gleichheit
Erstaunlich, dass die Gründerväter der Republik den Mut hatten, ein Rechtsprinzip, das nur die Herrschaft des Rechts – nämlich die Allgemeinheit der Gesetze und ihre gleiche Anwendung auf alle, die sie betreffen – zum Inhalt hat, als ein Grundrecht der Bürger zu präsentieren, das der Staat ihnen schuldet und das sie als einen Besitz ihm gegenüber ansehen sollen.
Artikel 3. (1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
Höchstens im Rückblick auf vergangene Formen von Ausbeutung und Herrschaft kann die Gleichheit vor dem Recht als etwas Wertvolles erscheinen. Der moderne Staat hält sich zugute, dass er keine politischen Stände mehr kennt, keinen Adel, der Vorrechte genießt, selbst Recht setzt und exekutiert und dessen Willkür die Knechte zu fürchten hatten. Er lässt auch keine Unterschiede von Rasse, Herkunft oder Religion mehr gelten, wenn er Menschen einmal in sein Volk aufgenommen hat: Dann kennt er nur noch freie, gleiche, nämlich gleichermaßen seinem Recht unterworfene Bürger. Früher übliche Privilegien der einen bzw. die rechtliche Diskriminierung der anderen erspart der moderne Staat seinen niederen Schichten. So weit ist der Verfassungsgrundsatz eine weitere billige Absetzung der heutigen politischen Herrschaft von historisch obsoleten Vorläufern.
Was der Staat der Rechtsgleichheit den Bürgern nicht erspart, sind die Unterschiede und Dienstbarkeiten, die sich aus der Macht des Geldes ergeben. Ihre Gleichheit ist eine Abstraktion von den das ganze Leben bestimmenden ökonomischen und sozialen Unterschieden im Kapitalismus. Das Grundgesetz erklärt sie für rechtlich belanglos, nimmt sie als private Umstände der Bürger, die ihre rechtliche Stellung im Staat nicht betreffen. Ebendadurch schützt und erhält er sie als das Recht der Privaten.
Den deutschen Gesetzgebern ist selbst aufgefallen, dass die Gleichheit vor dem Recht mit einer „tatsächlichen Gleichberechtigung“ in der Gesellschaft nichts zu tun hat, wenn man die an Nachteilen misst, die manche im Vergleich zu anderen hinnehmen müssen. Im besonderen Fall des Geschlechterverhältnisses ändern sie nachträglich die Verfassung und fügen dem Grundsatz, den sie in Artikel 3, Abs. 2 zur Rechtsgleichheit von Mann und Frau erlassen, ausnahmsweise die interessante staatliche Pflicht hinzu, auch auf seine tatsächliche und praktische Geltung zu achten: Auf das Geschlecht sollen Unterschiede nicht nur vor dem Recht, sondern auch in der gesellschaftlichen Stellung nicht gründen:
(2) Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Männern und Frauen und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.
Seitdem ist der ins Grundgesetz eingefügte Rechtsanspruch der Frauen der bleibende und zugleich sehr uneindeutige Maßstab dafür, ob ihre tatsächliche soziale Lage in Ordnung geht. Was immer ein Gericht oder der Gesetzgeber an der gegebenen wirtschaftlichen Lage der Frauen – geringere Löhne, Aufstiegschancen, Renten – oder an ihrer Stellung in der Familie als Ergebnis „sachgrundloser Benachteiligung“ betrachtet und nicht auf frei gewählten Lebensstil, geringere Eignung oder Einsatz zurückführt, verstößt gegen das Grundgesetz; aber auch nur das. Mit der „tatsächlichen Durchsetzung der Gleichberechtigung“ verspricht es eben nicht Ergebnisgleichheit, sondern Geschlechtsneutralität bei der Herstellung von sozialer Ungleichheit und gesellschaftlicher Hierarchie. [17]
Die Gleichheit, die der Staat sich in seinem rechtlichen Verhältnis zu den Bürgern verordnet, müssen freilich nicht nur seine Behörden, sondern auch die Bürger untereinander respektieren:
(3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.
Nichts davon ist im Alltag selbstverständlich. Die Verfassungsväter kennen eben den Laden, dem sie die Prinzipien verordnen: Sie fassen – ohne es anzusprechen – die ökonomischen Machtverhältnisse der Gesellschaft ins Auge, die Beziehungen, in denen Bürger überhaupt in der Lage sind, andere nennenswert zu „benachteiligen“ oder zu „bevorzugen“, weil sie über deren materielle Existenz bestimmen. Und da wird die ökonomische Macht und das Recht, Bewerber um Arbeitsstellen, Wohnungen und sogar um Plätze im Restaurant auszuwählen, für jede Menge Ausschluss hier und Vetternwirtschaft da genutzt. Das Recht, andere Leute an Gesichtspunkten des eigenen Vorteils zu sortieren, soll auch gar nicht verboten werden; nur eben das Sortieren nach sogenannten „sachfremden Kriterien“, also solchen, die nach dem Willen der Verfassung nicht den Grund für Unterschiede abgeben sollen. Das allgemeine Diskriminierungsverbot beendet daher nicht das Diskriminieren, sondern eröffnet – und auch das nur für den Fall, dass ein Benachteiligter im Namen dieses Verbots ein Gericht anruft – den juristischen Streit um die Gerechtigkeit der Sortierung, der er unterliegt und bleibend unterliegen soll. Verfassungsjuristen wissen zudem, dass der heilige Gleichheitsgrundsatz selbst gar keine Entscheidungshilfe in diesem Streit bietet: Aus ihm ergibt sich nämlich nicht, worauf er angewendet gehört.
„Der Gleichheitssatz verbietet, wesentlich Gleiches ungleich, und gebietet, wesentlich Ungleiches seiner Eigenart entsprechend ungleich zu behandeln. Dabei ist es grundsätzlich Sache des Gesetzgebers, diejenigen Sachverhalte auszuwählen, an die er dieselbe Rechtsfolge knüpft, die er also im Rechtssinn als gleich ansehen will. Der Gesetzgeber muss allerdings seine Auswahl sachgerecht treffen.“ [18]
Das „unmittelbar bindende Grundrecht“ der Gleichheit entfaltet praktische Wirkung – nicht anders als Würde und Freiheit – also nur als Leitidee gerichtlicher oder verfassungsgerichtlicher Entscheidungen, wenn Gesetze oder Handlungen des Staates (oder von Bürgern) im Namen dieser abstrakten Prinzipien juristisch angegriffen werden. Aber auch dann sind nicht sie es, an denen sich entscheidet, ob sie verletzt worden sind, sondern die Beurteilung der Gründe, die der Staat für die unterschiedliche Behandlung von Bürgern bzw. für die ihnen zugemuteten Freiheitsbeschränkungen anführt. Geprüft wird dann die „Verhältnismäßigkeit“ einer Ungleichbehandlung von Personengruppen oder von Verbotsverfügungen im Licht anderer staatlicher Ziele oder konkurrierender Rechte.
Eigentum
Artikel 14. (1) Das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet.
Spät, eher beiläufig und äußerst wortkarg wird den Bürgern dann noch etwas erlaubt: das Haben im Allgemeinen. Die Kategorie des Eigentums, die nur benannt, nicht erläutert wird, setzt den Gebrauchsartikel, der nur einmal konsumiert werden kann, mit Dingen (Immobilien, Ländereien, Fabriken) gleich, die mit individuellem Gebrauch überhaupt nichts zu tun haben. Die Selbstverständlichkeit, dass man die Mahlzeit haben muss, die man isst, wird in Anspruch genommen für etwas gar nicht Selbstverständliches: das Haben von Besitztümern, die man selbst nicht benutzt und gar nicht individuell benutzen kann, und das seinen Nutzen für den Besitzer nur durch den Ausschluss anderer von ihrer Benutzung bzw. durch den Tribut entfaltet, den er von denen fordern kann, die auf die Benutzung seines Eigentums angewiesen sind. Beides stellt das Grundgesetz unter den gleichen Schutz des Staates. Als ginge es um die Ergänzung der Bürgerfreiheit um ein Spielfeld ihrer äußeren Betätigung, um den Umgang mit Dingen, wird so das juristische Gewaltverhältnis eingeführt, das in dieser Gesellschaft den Umgang der Menschen miteinander umfassend determiniert; um das sich deshalb das gesamte ökonomische Leben dreht: Eigentum zu erwerben ist lebensnotwendig, es zu haben verleiht Macht über andere, es nicht zu haben verdammt zum Dienst an fremden Interessen. Das Grundgesetz erklärt es zu einem Menschenrecht, das Reichen wie Armen gleichermaßen zusteht.
Und als ob es dasselbe wäre oder weil es eben dasselbe ist, wird das Erben gleich mit „gewährleistet“. Dieses Menschenrecht reicht über den Menschen hinaus; das Eigentum überlebt den Eigentümer, geht als rechtliche Institution auf Nachfolger über und verewigt sich. So wird dann schon merklich, dass die Verfassung von dem für den Kapitalismus konstitutiven Rechts-Institut ‚Eigentum‘ und nicht von einem unschuldigen Umgang mit Sachen handelt. Für diese von ihr geschützte Privatmacht weiß die Verfassung noch einen guten sozialen Auftrag.
(2) Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen.
Weil das Eigentum das Wohl des Eigentümers vom Wohl aller anderen trennt, muss für das Wohl der Allgemeinheit noch einmal extra Sorge getragen werden. So nimmt die Verfassung den Gegensatz, der im Eigentum liegt, zur Kenntnis: als Herausforderung für die politische Garantiemacht. Denn, wer ist die Allgemeinheit? Dem Staat selbst, nur ihm, räumt das Grundgesetz ein Recht ein, aufs private Eigentum in seinem Interesse zuzugreifen – normalerweise in Form der Besteuerung, im äußersten Fall in Form von Enteignung bzw. Vergesellschaftungen (Artikel 15). Dabei allerdings muss der Eigentümer entschädigt, also unter Respektierung seines Eigentums von seinem Besitz getrennt werden. Auch nach dieser Seite ist das Eigentum ewig.
Zur Freiheit en gros kommen die vielen Freiheiten en détail
So grundsätzlich und umfassend, wie die Garantie von Würde & Freiheit „des Menschen“ klingt, ist sie vom Gesetzgeber auch gemeint. Nichts, was nicht in seinen Umkreis des Gewährens und Zulassens fallen würde. Das Treffen mit anderen unter freiem Himmel (Artikel 8), das Haben und Äußern von Gedanken (Artikel 5, Abs. 1) gehören ebenso dazu wie Kunst, Wissenschaft, Forschung und Lehre (Artikel 5, Abs. 3) oder die Verehrung eines höheren Wesens eigener Wahl (Artikel 4); die Bürger dürfen sich (Artikel 10) Briefe schreiben, ohne dass der Staat mitliest, Eltern nach ihrem Gusto Kinder erziehen (Artikel 6, Abs. 2; Artikel 7, Abs. 2). Auf dem Feld der wirtschaftlichen Aktivitäten erlaubt das Grundgesetz den Bürgern alles, was sie müssen: Zwangsarbeit, die dem System der Lohnarbeit widerspricht, ist (außer im Gefängnis und beim Wehrdienst) verboten (Artikel 12). Wo die Not, einen Erwerb und einen Lebensunterhalt zu finden, schon den nötigen Druck entfaltet, gestattet das Grundgesetz dem Einzelnen, dieser Notwendigkeit nach eigener Wahl nachzukommen: „Alle Deutschen haben das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte frei zu wählen.“ (Artikel 12, Abs. 1) Und weil die Jobs nicht zu den Leuten kommen, sondern diese zu ihnen, genießen sie „Freizügigkeit im gesamten Bundesgebiet“ (Artikel 11, Abs. 1). Sogar gegen die Übermacht ihrer Bosse dürfen sie sich zur Wehr setzen, Gewerkschaften gründen und um die „Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen“ (Artikel 9) kämpfen – vielleicht das schönste aller Menschenrechte.
Die vielen Erlaubnisse wollen als Ausweis des Humanismus der Herrschaft gewürdigt werden und verraten doch zuallererst eines: dass es für den demokratischen Gewaltmonopolisten schlechterdings nichts gibt, was ihn nichts angeht und worauf sich seine Herrschaft nicht erstreckt. Jede Lebensregung ist – prinzipiell – zugelassen, damit aber auch unter den Vorbehalt der Lizenzierung gestellt. Alle Grundrechtsartikel enden mit Sätzen wie: „Das Nähere regelt ein Gesetz“ oder „Dieses Grundrecht darf nur auf Grund eines Gesetzes beschränkt werden“. So stellt die Verfassung klar, dass sie mit den Grundfreiheiten der Bürger nicht etwa Felder staatlicher Nichtzuständigkeit oder gar staatsfreie Räume definiert, dass sie mit ihnen nicht dem Staat Grenzen, sondern seine Hoheit über die Grundrechte setzt, die er mit besonderen Gesetzen erst ausgestaltet, verwirklicht und als solche schützt.
[1] Heribert Prantl: Eigentum verpflichtet. Das unerfüllte Grundgesetz, München 2019, S. 24
[2] Ebd.
[3] Michael Sachs (Hrsg.): Grundgesetz-Kommentar, München 4. Aufl. 2007, S. 1348, Rdnr. 12
[4] Michael Sachs, a.a.O., S. 1350, Rdnr. 22
[5] Christof Gramm, Stefan Pieper: Grundgesetz. Bürgerkommentar, Bonn 2015, S. 321
[6] Michael Sachs, a.a.O., S. 1098, Rdnr. 71
[7] Artikel 46. (1) Ein Abgeordneter darf zu keiner Zeit wegen seiner Abstimmung oder wegen einer Äußerung, die er im Bundestage oder in einem seiner Ausschüsse getan hat, gerichtlich oder dienstlich verfolgt oder sonst außerhalb des Bundestages zur Verantwortung gezogen werden. Dies gilt nicht für verleumderische Beleidigungen.
[8] Artikel 97. (2) Die hauptamtlich und planmäßig endgültig angestellten Richter können wider ihren Willen nur kraft richterlicher Entscheidung und nur aus Gründen und unter den Formen, welche die Gesetze bestimmen, vor Ablauf ihrer Amtszeit entlassen oder dauernd oder zeitweise ihres Amtes enthoben oder an eine andere Stelle oder in den Ruhestand versetzt werden.
Der Rechtspraktiker weiß, warum: „Die Unversetzbarkeit ist Ergänzung und Ausdruck der richterlichen Unabhängigkeit, denn die inhaltliche Weisungsfreiheit wäre nicht gesichert, wenn ‚missliebige‘ Richter befürchten müssten, von der Justizverwaltung auf entfernte Dienstposten verschoben zu werden.“ (Thomas Fischer, Bundesrichter a. D., Über das Strafen, München 2018, S. 312)
[9] Zur Austragung der institutionalisierten Gegensätze der Länder mit dem Bund und umgekehrt gehört es, dass immer mal wieder die Frage aufgeworfen wird, wer sich eigentlich wen „leistet“ – „der Bund die Länder“ oder nicht vielmehr „die Länder den Bund“. Als ob das eine Frage wäre.
[10] Dass sie damit einen Machtkampf zwischen den höchsten Staatsorganen institutionalisieren und entsprechend verschlagene Kampfformen provozieren, haben die Verfassungsgeber klar gesehen und dem Wechselspiel von Überrumpelung und Verschleppung, das zu einer solchen gegensätzlichen Kooperation gehört, auch wieder peinlich genau definierte Grenzen gesetzt:
Artikel 76. (2) Vorlagen der Bundesregierung sind zunächst dem Bundesrat zuzuleiten. Der Bundesrat ist berechtigt, innerhalb von sechs Wochen zu diesen Vorlagen Stellung zu nehmen. Verlangt er aus wichtigem Grunde, insbesondere mit Rücksicht auf den Umfang einer Vorlage, eine Fristverlängerung, so beträgt die Frist neun Wochen. Die Bundesregierung kann eine Vorlage, die sie bei der Zuleitung an den Bundesrat ausnahmsweise als besonders eilbedürftig bezeichnet hat, nach drei Wochen oder, wenn der Bundesrat ein Verlangen nach Satz 3 geäußert hat, nach sechs Wochen dem Bundestag zuleiten, auch wenn die Stellungnahme des Bundesrates noch nicht bei ihr eingegangen ist; sie hat die Stellungnahme des Bundesrates unverzüglich nach Eingang dem Bundestag nachzureichen. Bei Vorlagen zur Änderung dieses Grundgesetzes und zur Übertragung von Hoheitsrechten nach Artikel 23 oder Artikel 24 beträgt die Frist zur Stellungnahme neun Wochen; Satz 4 findet keine Anwendung. (Entsprechendes in umgekehrter Richtung und gleicher Ausführlichkeit: Abs. 3.)
[11] Verfassungskritik von oben wirft sich bevorzugt auf diese Thematik: „Gelebter Föderalismus bedeutet heute zu oft Kompetenzwirrwarr, diffuse Verantwortlichkeiten, einen Wust an miteinander verschränkten Verhandlungsarenen und eine intransparente föderale Finanzverflechtung, die zudem falsche Anreize setzt. Kurz: Alle sind für alles zuständig und niemand ist für irgendetwas verantwortlich.“ (Wolfgang Schäuble, Glücksgriff oder Sanierungsfall? Das Grundgesetz und die bundesstaatliche Ordnung, in: Norbert Lammert, Ordnung. Gut verfasst? 70 Jahre Grundgesetz, Die politische Meinung, Nr. 555, März/April 2019, 64. Jahrgang, S. 73) Klar abgegrenzte, einander kontrollierende, aber nicht behindernde Kompetenzen und Verantwortlichkeiten sind ein ewiges, nicht realisierbares Ideal der Staatskonstruktion, das zu dem Widerspruch der Notwendigkeit von Durchregieren und Handlungsfreiheit einerseits, der Einbindung der selbstständigen Untereinheiten und der Nutzung von deren Eigeninteresse andererseits einfach dazugehört.
[12] So bei der Entscheidung über „Einspruchsgesetze“:
Artikel 77. (4) Wird der Einspruch mit der Mehrheit der Stimmen des Bundesrates beschlossen, so kann er durch Beschluß der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages zurückgewiesen werden. Hat der Bundesrat den Einspruch mit einer Mehrheit von mindestens zwei Dritteln seiner Stimmen beschlossen, so bedarf die Zurückweisung durch den Bundestag einer Mehrheit von zwei Dritteln, mindestens der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages.
[13] Helge Sodan: Grundgesetz, 4. Auflage, München 2018, S. 27 und 28
[14] Christof Gramm, Stefan Pieper: Grundgesetz. Bürgerkommentar, Bonn 2015, S. 83
[15] Helge Sodan, a.a.O., S. 29
[16] Christof Gramm, Stefan Pieper, a.a.O., S. 84
[17] „Gleichberechtigung bedeutet Gleichheit im Recht, bezieht sich also auf die Rechtslage und fordert i. d. R. Chancengleichheit. Darin besteht der Unterschied zu Gleichstellung, ein Begriff, der in Artikel 3 II – zu Recht – nicht vorkommt.“ (Christoph Gröpl, Kai Windthorst, Christian von Cölln: Grundgesetz. Studienkommentar, München 2017, S. 111, Artikel 3, Rdnr. 70)
[18] Michael Sachs (Hrsg.): Grundgesetz-Kommentar, München, 4. Auflage 2007, S. 176 (BVerfGE 90, 145, 195 f.) Mit dem Gleichheitsgrundsatz, demzufolge Ungleiches ungleich behandelt gehört, erweist das aller Gleichmacherei abholde Grundgesetz den bekannten und krassen gesellschaftlichen Unterschieden seinen Respekt. Der Fachmann kann dem hoch abstrakten Grundrecht also schon entnehmen, was sein eigentlicher „Schutzgegenstand“ ist: Es ist der „Anspruch des Berechtigten auf Berücksichtigung und Achtung seiner Position innerhalb der Gesellschaft. Geschützt sind alle Menschen in ihren rechtlich, wirtschaftlich und sozial differenzierten Relationen zueinander.“ (Michael Sachs, a.a.O., S. 177)