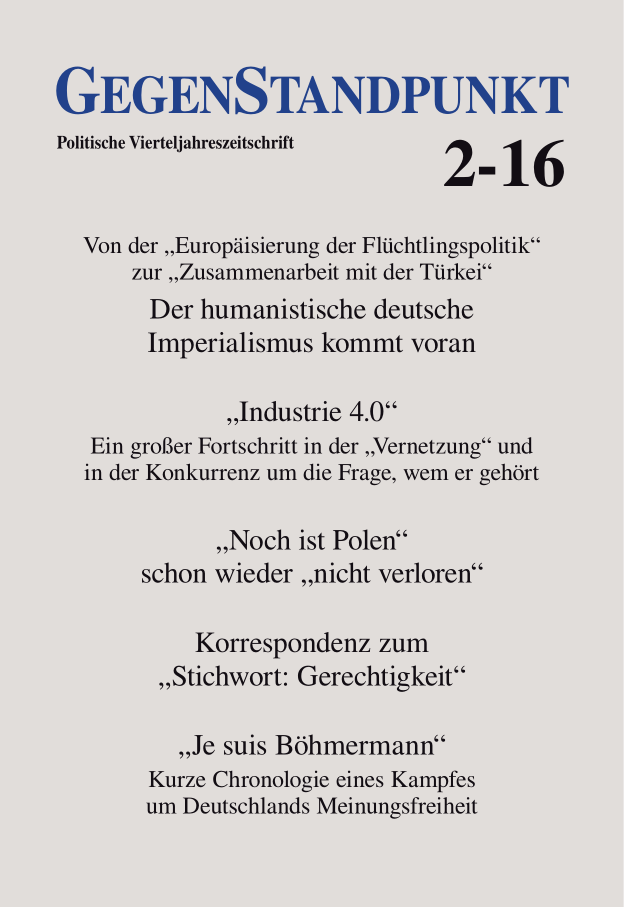Leserbrief
Fragen zum Sozialstaat & zu Freiheit und Zwang in der Politik
Nach dem Studium der meisten eurer Texte und Vortragsmitschnitte zum Thema „Staat(lichkeit)“ habe ich festgestellt, dass bei mir beharrlich zwei Fragen übrig bleiben, die ich mir nicht beantworten kann.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Fragen zum Sozialstaat & zu Freiheit und Zwang in der Politik
Leserbrief
Nach dem Studium der meisten eurer Texte und Vortragsmitschnitte zum Thema „Staat(lichkeit)“ habe ich festgestellt, dass bei mir beharrlich zwei Fragen übrig bleiben, die ich mir nicht beantworten kann.
1. Der deutsche Staat unternimmt die Bewirtschaftung der Löhne. Mit seinen Renten- und Krankenkassen, die er in die Landschaft gestellt hat, will er dafür sorgen, dass den ansässigen Kapitalen stets das für sie notwendige Quantum rentabler Arbeitskraft zur Verfügung steht. Nun zeigt aber der Blick hinüber zum kapitalistischen Klassenprimus USA, dass eine solche, d.h. eine die Reproduktion der Arbeitskraft irgendwie noch sichernde Bewirtschaftung der Löhne überhaupt nicht zwingend notwendig wäre, um am Ende einen Staat mit Steuereinnahmen zu versorgen, mit denen er dann in der zwischenstaatlichen Konkurrenz vorankommen kann. Den Kapitalen in den USA scheint die rentable Arbeitskraft – trotz kärglichster Sozialstaatlichkeit – bislang jedenfalls nicht ausgehen zu wollen, und auch der amerikanische Staat macht keine Anstalten, an seiner Form der Lohnbewirtschaftung in Zukunft grundsätzlich etwas zu ändern. (Warum auch?)
Warum sollte nun aber der deutsche Staat, angesichts der anhaltenden ökonomischen Erfolge einer amerikanischen Weltmacht, nicht sofort seine Art der Bewirtschaftung der Löhne aufgeben? Ich verstehe nicht, warum der deutsche Staat seine Art der Lohnbewirtschaftung überhaupt noch für zweckmäßig, für notwendig hält.
2. Wer sich in Demokratien politisch engagiert in der Weise, dass er von innen verändernd aufs System einwirken will, wer sich also anschickt, Politiker zu werden, dessen Zwecke sind festgelegt. Eine Umwidmung demokratischer Herrschaftsmittel zum Wohle der Beherrschten ist nicht möglich. Politiker sind Verwalter und Hüter des nationalen Wohls, das aufgeht in einer möglichst erfolgreichen Akkumulation von Kapital im jeweiligen Hoheitsgebiet.
Was aber ist es, das die Demokratie an sich hat, dass diesen inhaltlichen Ausschluss der politischen Zwecke betreibt? Warum kann kein Politiker, von links bis rechts, nie etwas anderes wollen, wenn er sich in der Demokratie parteipolitisch auf den Weg macht, als das nationale Wohl zu betreiben? Jetzt könnte man sagen: Ja, ein Bäcker backt eben Brot, und montiert keine Reifen, und ein Automechaniker montiert Reifen, und backt keine Brötchen. Und der Politiker verwaltet eben das nationale Wohl, und organisiert keine Bedürfnisbefriedigung für die Leute. Die ersten beiden Beispiele leuchten mir ein, das letzte irgendwie nicht, selbst, wenn ich anerkenne, dass es einen guten Anhaltspunkt liefert für all die üblen Resultate von 60 Jahren kapitalistischer Demokratie. Mir fehlt da eine Begründung, was ich besonders dann merke, wenn ich mit Leuten darüber diskutiere und die Frage gestellt bekomme: „Warum soll’s denn nicht anders gehen?“ Ja, warum eigentlich nicht? – denke ich mir dann selbst. Ich weiß zwar: der Staat ist eben kein offenes Kampffeld der Interessen und gegensätzlichen Willen, sondern die Manifestation eines bestimmten Willens, aber wessen Wille ist das? Und warum wollen alle Generationen von Politikerfressen immer automatisch genau diesen einen Willen politisch vertreten? Warum macht es keinen Sinn, Politiker zu werden, mit der festen Absicht, Kapital und Nation einfach abzuschaffen?
Ich komme da selbst oft nicht weiter. Vielleicht könnt ihr mir mal helfen.
Antwort der Redaktion
Zu 1.
Warum unterhält Deutschland einen Sozialstaat?
Zunächst: Deine Bestimmung des Sozialstaates, mit der du deine Überlegungen eröffnest, stimmt nicht. Dieser verfolgt nicht die Absicht, dafür zu sorgen, dass den ansässigen Kapitalen stets das für sie notwendige Quantum rentabler Arbeitskraft zur Verfügung steht
. Als Beispiel wählst du selbst ausgerechnet die Betreuung aus dem Arbeitsleben und Arbeitsmarkt ausgeschiedener Rentner, für die das Kapital keine Verwendung mehr hat. Wie soll die Unterhaltung einer Rentenkasse ein Beitrag zur von dir behaupteten Zwecksetzung sein? Aber auch, was die anderen Abteilungen des Sozialstaates angeht, ist die Verfügbarmachung bzw. -haltung rentabler Arbeitskraft
in passender Stückzahl weder deren leitender Gesichtspunkt noch ihr Resultat. Zum einen schon deshalb nicht, weil der Sozialstaat sich an keiner Stelle fragt, wie viele Arbeitskräfte das Kapital überhaupt braucht. Zum anderen nicht, weil Arbeitskräfte nicht rentabel sind, sondern – mit etwas Glück – vom Kapital rentabel angewandt werden. Zur Verfügung
stehen diese Arbeitskräfte dem Kapital in der total passiven und unselbstständigen Rolle arbeitssuchender Lohnabhängiger; aus ihnen etwas zu machen – oder auch nicht – fällt ganz in den Zuständigkeitsbereich der Unternehmen, die ungeachtet aller Wirkungen auf den Erhalt oder Nicht-Erhalt der Arbeitskräfte für ihre Geschäftskalkulationen frei über sie disponieren. Für die Erhaltung dieser Leute – auch und gerade dann, wenn sie nicht rentabel angewandt werden – spielt der Sozialstaat eine entscheidende Rolle.
Du gehst in deinen Überlegungen einfach davon aus, dass die Betreuung einer minderbemittelten Klientel durch die sozialstaatlichen Einrichtungen ein Dienst am Kapital statt an den Arbeitskräften sei. Wie kommst du darauf? Der Sozialstaat ist schließlich zuallererst eine Hilfe für all diejenigen, die ihn brauchen und deswegen immer wieder in Anspruch nehmen. So wird er auch verstanden. Kein Unternehmer schätzt die ihm auferlegte Verpflichtung, ‚Lohnnebenkosten‘ für unproduktive Umstände des Nicht-Arbeitens (für Krankheit und Alter, also Arbeitsunfähigkeit, oder gar Arbeitslosigkeit, also Überflüssigkeit) abführen zu müssen, als Dienst an seinem Interesse oder den Interessen seiner Zunft. Auch die vom Sozialstaat abhängigen Hilfsbedürftigen sehen dessen Leistungen nicht als Dienst an ihren Arbeitgebern, sondern – je nachdem, ob sie aus der Position des Beitragsempfängers oder ‑zahlers urteilen – als ihnen zukommende, nötige, wahlweise wohlverdiente oder demütigende, womöglich viel zu knapp bemessene Hilfe oder als ärgerliche bis unnötige Belastung ihres Nettolohns. Und noch nicht einmal die Sozialpolitiker, die den Sozialstaat betreiben und ständig reformieren, tun das in dem Bewusstsein, er sei für nichts als die Beförderung der Unternehmer und des kapitalistischen Wachstums da. Sozialpolitiker wissen nämlich, dass sie sich um Einrichtungen zur Betreuung diverser, immerzu aufkommender bzw. eintretender ‚Wechselfälle des Lebens‘ kümmern, und wollen das auch als dankenswerten, notwendigen Dienst an jenen Gesellschaftsmitgliedern verstanden wissen, die den Sozialstaat zum Zurechtkommen in ihren Lebenslagen benötigen.
Auf seine Klientel bezieht sich der Sozialstaat dabei gar nicht als Klasse der Lohnarbeitenden, wenn er ‚abhängig Beschäftigte‘ gemäß ihrer Einkommenshöhe zur Einzahlung in die entsprechenden Kassen verpflichtet. In diesem Sinn kennt er keine Klassen, sondern Unterschiede zwischen Gutverdienern, die seiner Betreuung im Prinzip nicht bedürfen, und einer weniger gut verdienenden Mehrheit, die, mit weniger ergiebigen Erwerbsquellen ausgestattet, auf die Mitgliedschaft in seinem Kassenwesen unbedingt angewiesen ist. Nur in Form dieses pragmatischen Blicks auf die Widrigkeiten des Gelderwerbs, differenziert nach Beschäftigungsarten und Einkommenshöhe, existiert das staatliche Bekenntnis zur Notwendigkeit der Betreuung eines Großteils der Erwerbstätigen, die in ihrer Einkommensquelle ihre Gemeinsamkeit haben.
Diesen Objekten seiner Betreuung erlegt er die Pflicht zur Mitgliedschaft auf und überlässt nichts dem privaten Zufall, wenn er die entsprechenden Kassenbeiträge direkt vom Bruttolohn einzieht. Das ist aufschlussreich: Auf Mitgliedschaft angewiesen ist dieser Haufen deshalb, weil seine Einkommensquelle die unweigerlichen ‚Wechselfälle des Lebens‘ offenbar nicht absichert, Lohnarbeit also als Einkommensquelle im Sinne eines lebenslangen Lebensmittels nichts taugt. Zur Mitgliedschaft verpflichtet ist er, weil der Staat dieses untaugliche Lebensmittel durch seine gesetzlich regulierte Umverteilung innerhalb der Arbeitnehmerschaft (Solidarprinzip) auf die Leistung festlegt, die es nicht erbringt. Der Staat besteht auf der Lebenslüge der Einkommensquelle Lohnarbeit, nämlich ihrer Tauglichkeit als das Lebensmittel derer – ein anderes haben sie ja nicht –, deren Leben so umfassend durch die Abhängigkeit von ihrer Dienstbarkeit für das Kapital bestimmt ist, was Paupers, Greise und sonstiges ‚totes Gewicht‘ glatt mit einschließt. Dieser Grundwiderspruch des Sozialsystems, dem Lohn qua dessen Umverteilung die Versorgungsleistung abzuverlangen, die er nicht hergibt, wird vom Sozialstaat bewirtschaftet, weswegen er im Übrigen beständiger Gegenstand von Reformen ist. Das garantiert nicht nur den Sachbearbeitern in den Amtsstuben ihre Jobs.
Auch den zuständigen Sozialpolitikern geht die Arbeit nicht aus. Die ‚sozialen Sicherungsnetze‘ gestaltend, verwaltend, reformierend widmen sie sich den Nöten ihrer Klientel, bestehen damit praktisch auf der Haltbarkeit der Lohnarbeit als Erwerbsquelle und bewerkstelligen damit den Erhalt der Gesellschaft als das, was sie ist, nämlich als Klassengesellschaft: Der Gegensatz zwischen Lohnarbeit und Kapital als gesellschaftliches Reproduktionsprinzip wird für alle Klassen haltbar. Der Dienst des Sozialstaates an der Klasse der Lohnarbeitenden, der vom Gesichtspunkt der rentablen Benutzung gerade emanzipiert und auf Hilfebedürftigkeit gemünzt ist, stellt mit dem Überleben die Benutzbarkeit der Klasse in ihrer Gesamtheit sicher und ist deswegen letztlich auch ein Dienst an den Interessen, die in der Lohnarbeit wirklich ihr Mittel, nämlich das ihrer Bereicherung und in der Klassengesellschaft das umfassend betreute Gesellschaftsprinzip ihres Nutzens, nämlich der Benutzung aller gesellschaftlichen Reichtumsquellen für die Vermehrung ihres Kapitalreichtums haben. Dass der lebendige Teil dieser als Waren käuflichen Reichtumsquellen – in Gestalt qualifizierter und motivierter Arbeitssuchender – so todsicher auf der Matte steht, wenn die Wirtschaft die entsprechenden Arbeitsplätze zu besetzen hat, ist ohne die fürsorgliche Nachhilfe staatlicher Arbeitslosen-, Kranken- und Nachwuchsbetreuung wirklich nicht zu haben. Das ist der systemeigene, kapitalistische Grund von Sozialpolitik.
*
Auch deine Charakterisierung des amerikanischen Sozialsystems ist nicht richtig. Auch der amerikanische Staat stellt sich den peinlichen, klassenspezifischen Nöten eines großen Teils seines Volkes: Einen guten Teil des Streits um die Sozialleistungen und Lohnbestandteile überantwortet er der Konkurrenz von Kapital und Gewerkschaften.[1] Gleich nach der ersten sozialen Wohltat des amerikanischen Staates für die Seinen – zur Geburt kriegen sie eine Sozialversicherungsnummer verpasst – fällt ihm auf, dass jenseits allen Nutzens und aller Hilfe für die diversen proletarischen Lebenslagen der Sozialstaat zuvörderst einen Abzug von dem Lebensmittel bedeutet, auf das auch die große Mehrheit der Menschen jenseits des Atlantik alternativlos festgelegt ist. Zu dieser Einsicht gehört die zuletzt prominent gegen die gesundheitspolitischen Reformanstrengungen des Präsidenten – Stichwort ‚Obamacare‘ – breitgetretene Ideologie, man solle den ‚hard-working Americans‘ von ihrem Lohn möglichst wenig wegnehmen, weil die wohl am besten selber wissen, wann sie wirklich zum Arzt müssen, wie sie für sich vorsorgen und was sie wirklich nötig haben, weshalb ‚Freiheit statt Bevormundung‘ die wichtigste Sozialleistung sei, die jedem Amerikaner zustehe.
Der von dir angeregte Vergleich zwischen dem amerikanischen und dem deutschen Sozialsystem verweist also nicht auf die Überflüssigkeit des Sozialstaats, sondern gibt anhand zweier unterschiedlicher Varianten einen Einblick in die Bandbreite der besonderen Arten und Weisen, wie bürgerliche Staaten ihre Sozialsysteme bewirtschaften. Dieses Spektrum verweist auf die Bedeutung dessen, was mit der Notwendigkeit des Sozialstaates ausgedrückt sein soll. Die scheinst du bei uns missverstanden zu haben. Die Eigenarten der Einkommensquelle Lohnarbeit sind, wie gesagt, der Grund für die betreuerische und kompensatorische Bezugnahme des Staates auf diesen Teil seiner Gesellschaft. In der Konkurrenzgesellschaft, über die der bürgerliche Staat herrscht, liegt überhaupt die Notwendigkeit seiner – in diesem Fall auf die Lohnarbeiterklasse bezogenen – Maßnahmen. Wie er diesen Notwendigkeiten Rechnung trägt – mehr à la Deutschland, mehr wie im ‚land of the free‘ oder in irgendeiner anderen Variante –, ist mit dieser Einsicht weder ausgemacht noch aus ihr deduzierbar. Wenn du wirklich wissen willst, warum der deutsche Staat seine Art der Lohnbewirtschaftung überhaupt noch für zweckmäßig, für notwendig hält
, dann schau’ dir die Gesichtspunkte der zuständigen Politiker an, die all ihre Entschlüsse ausgiebig öffentlich begründen. Welches Maß sozialstaatlicher Betreuung für notwendig erachtet und entsprechend organisiert wird, ist Gegenstand des politischen Dauerstreits, den Politiker erstens untereinander und zweitens mit Wohlfahrtsverbänden, Gewerkschaften usw. führen, der sich jedenfalls nicht um die Frage des notwendigen Quantums
verfügbarer Arbeitskräfte dreht. Was wirklich zwingend notwendig
ist und was angesichts der stehenden ‚schwarzen Null‘ oder des forcierten Abbaus von ‚Verkrustungen‘ und ‚Beschäftigungshindernissen‘ möglicherweise verzichtbar, bildet den Stoff eines Dauerexperiments am lebenden Objekt. Spätestens, wenn Politiker den ‚sozialen Frieden‘ zu bedenken geben und zur Begründung ihrer Maßnahmen im Munde führen, kann man bemerken, wie fest sie davon ausgehen, dass diese Gesellschaft ihren staatlich verordneten Zusammenhalt unbedingt braucht. Welche sozialen Wohltaten dafür nötig sind, ist dann wieder eine andere Frage.
Zu 2.
Was Politiker wollen, können und müssen
Bevor wir zu deinen Fragen kommen, braucht es ein paar Richtigstellungen zur Demokratie, weil du falsche Auffassungen über sie pflegst.[2]
Erstens: Deine Gegenüberstellung von nationalem Wohl
, das in erfolgreicher Akkumulation von Kapital
besteht, und dem Wohl der Beherrschten
bzw. der Bedürfnisbefriedigung
ist nicht zutreffend. Politiker kümmern sich sehr wohl um das Wohl der Beherrschten. In der Ökonomie, über die der bürgerliche Staat herrscht und die er verwaltet, hängt nämlich alles – die Produktion und Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums, alle darauf bezogenen Geldinteressen von Arm und Reich, damit die Art und Weise, wie Bedürfnisse im Kapitalismus überhaupt befriedigt werden – von der Akkumulation des Kapitals ab. Politiker tun daher durchaus etwas für die Beherrschten, wenn sie die universelle Bedingung – das wachsende Geschäft muss sich lohnen – als ein ganzes System von Notwendigkeiten und Sachzwängen verwalten. Wo die Gleichung gilt, dass Wachstum die Bedingung für alle privaten Interessen ist, da trifft glatt zu, dass man für die Interessen der Menschen am ehesten dann etwas tun kann, wenn man die kapitalistischen Geschäfte zum Sprudeln bringt. Umgekehrt gelesen offenbart diese Gleichung noch etwas anderes: Wenn die Politik mit der Bewirtschaftung der Universalbedingung Wachstum praktisch auf dessen Alternativlosigkeit besteht, wenn sie also festlegt, dass der gültige Materialismus in all seinen gegensätzlichen Formen von ein- und demselben, nämlich Wachstum abhängt, sich an ihm zu messen hat, durch es definiert und für es da ist, dann zeigt sich daran, dass Wachstum selbst der Zweck ist, dem die Politik sich und den sie ihrer Gesellschaft verschreibt.
Zweitens: Das heißt nicht, dass mit dem Imperativ Wachstum über die Zwecke der staatlichen Maßnahmen schon alles gesagt wäre. Der Zusammenhang von politischer Zwecksetzung und Akkumulation von Kapital
, wie du ihn präsentierst, ist ein Kurzschluss. Für das Funktionieren des kapitalistischen Gemeinwesens, dem der Staat sich verschrieben hat, ergeben sich haufenweise ‚Baustellen‘, also Notwendigkeiten, derer Politiker sich annehmen – der erste Teil des Briefs ist dafür ein Beispiel. Den Gewaltbedarf der Gesellschaft teilen sich Wanka, Schäuble und Co. gemäß ihren Ressorts ein und kümmern sich jeweils um das ihre, also um ganz Unterschiedliches. Sie nehmen sich der ‚Gestaltung‘ von Arbeitsmarkt und Sozialsystem, der Stadtentwicklung, der Strafverfolgung, der Familie, der Investitionssicherheit oder des Haushaltes – durchaus auch widerstreitend – gemäß ihren politischen Vorstellungen an. Für all diese Vorhaben brauchen sie Marx nicht studiert zu haben, weshalb von so etwas wie ‚Kapitalakkumulation‘ in ihren Verlautbarungen zu ihrer Politik ohnehin keine Rede ist. Von ‚Wachstum‘ schon eher, aber auch davon nicht als dem Zweck ihrer ganzen Maßnahmen, sondern als Teil von magischen Zwei-, Drei- oder Vierecken, also einem Ziel unter mehreren, die man alle im Auge und in Balance zu halten hätte, oder als bedenkenswerte Angelegenheit, die mit Prädikaten wie ‚nachhaltig‘, ‚sozial gerecht‘ oder ‚ökologisch‘ zu versehen sei.
Wenn Politiker damit den ganzen Standort für die Akkumulation des Kapitals herrichten, dann nicht als Büttel des Gewinninteresses von Unternehmern, quasi als politischer Arm des Arbeitgeberverbands, sondern über die Dienste an einem ganzen System von Interessen, derer sie sich betreuend, rechtsstiftend, kompensierend und korrigierend annehmen. Allen Bürgern jeweils die Bedingungen ihrer Geldinteressen zu garantieren, setzt deren materielle Unterschiede frei; das garantiert den Eigentümern, die über genug Geld verfügen, um es zu investieren, dass sie alle nötigen Bedingungen ihres Erfolgs vorfinden. Damit ist umgekehrt allen anderen die Abhängigkeit ihrer Geldinteressen von denjenigen garantiert, die die Vermehrung des Geldes bewerkstelligen. Die Politik dient also allen Interessen, die in diesem schönen System des privaten Eigentums polemisch gegeneinanderstehen und in ihrer Konkurrenz zugleich auf Kooperation angewiesen sind. So dient sie der Akkumulation des Kapitals.
Drittens: Deswegen schließt die Demokratie keine politischen Zwecke aus, sondern alle ein. Alle Zwecke, die in diesem System zu Hause sind, kriegen von der Politik ihr Recht zugewiesen und damit ihre Einhegung verpasst. Im Namen seines berechtigten Interesses kann ein jeder sich an die Politik wenden und versuchen, ihm mehr Berücksichtigung zu verschaffen. Man kann in die Politik gehen, sich als Politiker oder Interessenverband für seine Sache engagieren, eine Seniorenpartei gründen usw. Insofern ist uns überhaupt kein politischer Zweck bekannt, den die Demokratie ausschließen würde – das Schöne ist doch gerade, dass sie allen ihren Platz zuweist. Wie es sich für eine Konkurrenzgesellschaft gehört, herrscht auch zwischen den politischen Zwecken und unter ihren Vertretern ein erbitterter Streit. Welche Anliegen verdienen besonderes Gehör, eine rechtliche oder materielle Korrektur, damit sie im großen Ganzen des Gemeinwesens nicht untergehen, sondern ein Beitrag zu ihm sein können? Die Politik ist insofern nichts als ein offenes Kampffeld der Interessen
. Was denn sonst.
*
Nur einen politischen Zweck hat die Demokratie nicht im Programm. Ausgerechnet daran – nämlich an der puren Negation ihres Daseins, ihrer Selbstabschaffung – misst du sie und verschaffst dir damit einen ziemlich absurden Maßstab für ihre Beurteilung. Entsprechend einfältig fällt sie aus: Warum kann kein Politiker, von links bis rechts, nie etwas anderes wollen, … als das nationale Wohl zu betreiben?
Die Frage lebt davon, dass du dich nicht fragst, was Politiker wollen, wenn sie das nationale Wohl betreiben
, sondern, warum sie nicht das wollen, was dir vorschwebt. Weil sie etwas anderes wollen als du, kommt es dir so vor, als wollten alle Politiker dasselbe, als seien sie die lebendige Manifestation eines bestimmten Willens
und als sei daher all ihr Treiben unter die Feststellung zu subsumieren, dass das alles der gleiche Mist, nämlich Unterdrückung und Akkumulation sei – eine Negativkonstruktion, bei der wir dir auch nicht sagen können, wessen Wille
das sein soll.
Ausgerechnet die Herrschaft daraufhin zu befragen, warum sie ihre Macht nicht für ihre eigene Abschaffung funktionalisieren lässt, ist einfach albern. Kein Staat sieht die Möglichkeit seiner Abschaffung vor. Darum ist es genauso albern, ausgerechnet Politiker, also diejenigen, die sich um die Ämter im Dienste der nationalen Sache bewerben und Herrschaft exekutieren wollen, daraufhin zu befragen, was sie eigentlich daran hindere, auf ihre Abschaffung und die Abschaffung ihrer Ämter hinzuwirken. Warum macht es keinen Sinn, Politiker zu werden, mit der festen Absicht, Kapital und Nation einfach abzuschaffen?
Was sollte daran denn Sinn machen? Warum man in die Politik gehen sollte, weil man sie verkehrt findet und ablehnt, wissen wir jedenfalls auch nicht. Entnommen haben wir deiner Frage allerdings, dass du gar nicht so recht zu wissen scheinst, was du mit Kapital und Nation
eigentlich vor dir hast. Weder ist es einfach
, sie einfach abzuschaffen
, noch lässt sich dieses Vorhaben an Volksvertreter delegieren. Wir würden dich jedenfalls nicht wählen.
Noch eine Bemerkung zu den Debatten, die du zitierst. Warum soll’s denn nicht anders gehen?
, lässt du dich fragen. Frag’ dich und deine Mitdiskutanten mal, was ’s
eigentlich sein soll. Was soll denn da anders gehen, und inwiefern anders? Davon, wie man sich Gemeinwohl und Politik erklärt, was man daran überhaupt auszusetzen hat – was dir in deinem Brief nur einen Buchstaben und ein Auslassungszeichen wert ist –, hängt schon ein bisschen ab, wie man sich praktisch zu engagieren hätte. Vielleicht musst du die Auffassung deiner Diskussionspartner, das Engagement in der Demokratie sei der richtige Weg für ihr ‚anders‘, ihnen ja überhaupt nicht madig machen, weil es genau der richtige Weg zu ihrem ‚anders‘ ist.
[1] Ausführliche Aufsätze zum Thema Gesundheits- und Sozialsystem in den USA: Socialized Health – oder: Volksgesundheit als Systemfrage in GegenStandpunkt 3-10 sowie Die reichste kapitalistische Macht betreut ihre Arbeiterklasse: Die proletarische Fassung des ‚American way of life‘ in GegenStandpunkt 4-05.
[2] Der Frage nach der Staatsräson und dem Streit um die alternativen Erfolgswege zum nationalen Wohl widmet sich das Kapitel Die Staatsräson der Demokratie
aus dem Aufsatz Die demokratische Wahl
in Decker (Hrsg.): Demokratie. Die perfekte Form bürgerlicher Herrschaft, Gegenstandpunkt Verlag (2013), S. 26 ff.