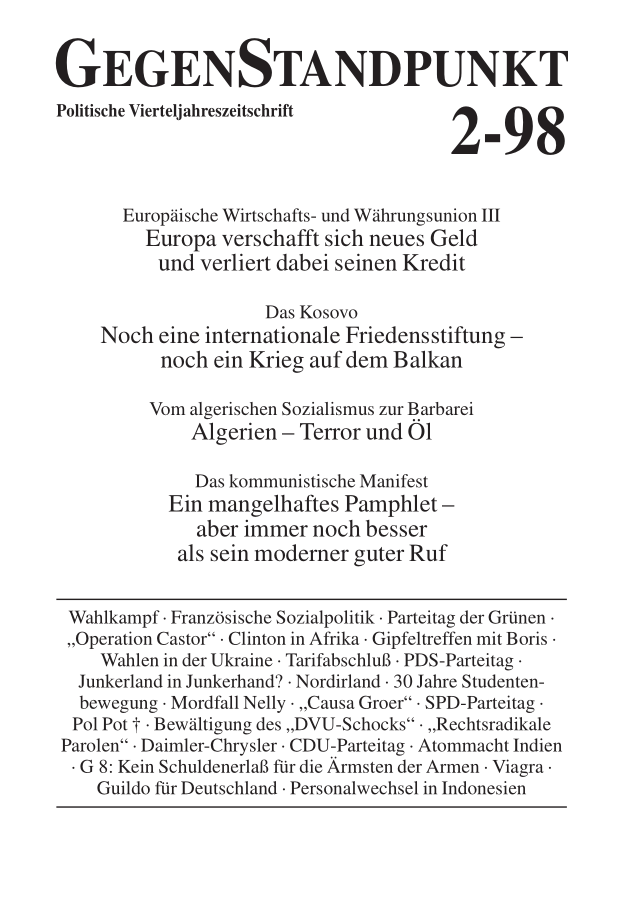Europäische Wirtschafts- und Währungsunion (III)
Europa verschafft sich neues Geld – und verliert dabei seinen Kredit (Teil 3)
- 4. Die Punktlandung
- Das neue Weltgeld – eine gefährdete Art
- Das Risiko: Der Umgang von 11 Souveränen mit 1 Geld
- Geldwertstabilität als kategorischer Imperativ
- 5. Damit der Euro hart wird: Vertrauensbildung durch eine Geschäftsordnung, die das Mißtrauen institutionalisiert
- Die EZB: Geldpolitik im „politikfreien Raum“
- Die Fortentwicklung der europäischen Geschäftsordnung zum Kontrollregime
- Die Aufsichtsführung: eine neue Herausforderung für Europas Hierarchie und Streitkultur
- 6. Europas neuer Kredit und der Angriff auf die Geldmacht Amerikas – mit Brüsseler Streitkultur als vertrauensbildender Maßnahme
Aus der Zeitschrift
Teilen
Siehe auch
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Europäische Wirtschafts- und
Währungsunion (III)
Europa verschafft sich neues Geld –
und verliert dabei seinen Kredit (Teil 3)[1]
Im Sommer 97 – Deutschlands Haushalts-„Löcher“ wurden immer größer, ihre Schließung durch neubewertete Goldbestände der Frankfurter Zentralbank war durch deren Hüter abgewehrt worden, die Finanzchefs der Nation, die mit ihrer Devise die Haltbarkeit des projektierten Euro-Geldes garantieren sollte, standen mit Schulden im Übermaß und amtlich blamiert da – fingen „die Märkte“ so langsam an, den Verlust europäischen Kredits zu befürchten, zu registrieren und zu bestätigen. Denn für den Euro sprach eigentlich nur noch, daß der Verzicht darauf noch mehr kosten und Europas Geldwesen noch mehr durcheinanderbringen würde als seine Einführung – wahrlich kein guter Vertrauensvorschuß für eine neue Währung.
Im Frühjahr 98 sieht dann doch alles ganz anders aus: Der Euro kommt; alle elf Bewerber, die ihn wollen, sind dabei; und „die Märkte“ toben ihr Mißtrauen gegen die Geldqualität staatlicher Zahlungsmittel in ganz anderen Weltgegenden aus und behandeln die Euros als vergleichsweise sichere Anlagesphäre.
Dazwischen ist allerdings auch einiges passiert: Die zuständigen Finanzpolitiker haben sich kräftig angestrengt, das Mißtrauen, das sie selbst gesät hatten, als bloßes Mißverständnis darzustellen, das endlich aus der Welt zu schaffen sei.
4. Die Punktlandung
Immerhin haben die Chefs der Maastrichter Vertragsstaaten jahrelang engagiert und entschieden die Festlegung vertreten, Europa bekäme entweder ein gutes oder gar kein neues Geld. Mit Verweis auf den berühmten „Kriterienkatalog“, von dem nicht die geringsten Abstriche gemacht würden, wurden euro-skeptische Nationalisten beruhigt, andere ermahnt, drastische Einschnitte in die gewohnten nationalen Lebensverhältnisse vor- bzw. hinzunehmen. Statt jedoch auf diese Weise Vertrauen in das Projekt zu stiften, haben die Herren des geplanten Geldes je länger, um so mehr Zweifel geweckt, ob die Sache überhaupt zustande kommen könnte. Die fraglichen Bilanzen wurden nirgends so recht durchgreifend besser, gegen Ende ausgerechnet in Deutschland sogar deutlich schlechter; zeitweise machte der Witz die Runde, Luxemburg müßte die Währungsunion mit sich alleine durchziehen; unterdessen rückte das vertraglich festgelegte Datum der Entscheidung näher. Was tat da not? Richtig: Aufklärung.
So wurde die bekannte und beliebte Debatte über den semantischen Unterschied zwischen einer ausgeschriebenen „drei“ und dem Zahlenwert „3,0“ eröffnet und dahingehend entschieden, daß es in jedem Fall auf die Zahl vor dem Komma ankäme. Was die in derartigen Kennziffern gemessenen volkswirtschaftlichen Sachverhalte betrifft, so wurde die sachkundige Öffentlichkeit mit dem Eingeständnis überrascht, daß deren Bedeutung mit einer nackten Zahl sowieso nicht zu erfassen sei, schon gar nicht wissenschaftlich eindeutig. Der zuvor offiziell gepflegte Verdacht, die selbstverständlich dennoch wichtigen nationalen Bilanzen würden von den Verantwortlichen in unverantwortlicher Weise geschönt, wurde erst fallengelassen, dann mit dem Akt der offiziellen Anerkennung der eingereichten Ziffern durch die zuständige Behörde widerlegt, schließlich als ungerechtfertigte üble Nachrede und arrogante Besserwisserei zurückgewiesen – durch dieselben Politiker, die ihre Kollegen jahrelang auf eben die Weise drangsaliert hatten. Und unter Berufung auf eindeutig außerökonomische, gleichwohl höchste Werte, Frieden und Freundschaft in Europa nämlich am Ende eines kriegerischen Jahrhunderts, bekannten sich die regierenden Anhänger des neuen Geldes zunehmend offen dazu, daß sie ohnehin keineswegs bloß als Notare einwandfreier statistischer Daten und ebensowenig als Exekutoren eines ökonomischen Sachgesetzes zu fungieren gedachten, sondern eine politische Entscheidung vorzunehmen hatten.
Auf deren ökonomistische Rechtfertigung haben
sie dabei freilich überhaupt nicht verzichtet. Der
Umfang, in dem verschiedene Ziffern des Kriterienkatalogs
von verschiedenen Bewerbern verfehlt worden sind, wird
als Annäherung an die gesteckten Ziele interpretiert; mit
nie für möglich gehaltener Disziplin hätten sich speziell
die fragwürdigen Kandidaten aus Europas Süden den
Vorgaben solider Haushaltsführung unterworfen, mit alten
finanzpolitischen Gepflogenheiten gebrochen und sich und
ihre Völker an die vereinbarte „Stabilitätskultur“
gewöhnt. Der Wille, alles für ein hartes Geld zu tun,
wird wichtiger genommen als ein – doch „bloß punktueller“
– Erfolg; die Richtung stimmt!
Das Mißtrauen von
gestern wird zum Vertrauensargument: Es hätte seine
Wirkung getan und für korrektes Verhalten gesorgt, könne
also guten volkswirtschaftlichen Gewissens aus dem
Verkehr gezogen werden. Am Ende hat dann auch noch die
Deutsche Bundesbank einen Beweis ihrer politischen
Unabhängigkeit geliefert und dem Beschluß einer
11er-Gemeinschaft der Euro-Länder mit vielen Bedenken und
Ermahnungen, also dermaßen fachidiotisch ihren Segen
erteilt, daß nicht einmal der bayerische
Ministerpräsident mehr bei seinem ablehnenden Votum
bleiben mußte.
Bemerkenswert ist das Ganze nicht deswegen, weil Politiker da wieder einmal die Maxime beherzigt haben: ‚Was geht mich mein Geschätz von gestern an!‘ Immerhin hatte das ‚gestrige Geschwätz‘ einen sehr fundamentalen politökonomischen Inhalt: Recht besehen, nämlich an der Meßlatte von Maastricht gemessen, wären die Schulden etlicher Euro-Länder zu hoch, ihre Kreditzettel im Grunde wertlos, das darauf bezogene nationale Geld insoweit nichts wert; und das nicht bloß irgendwie und ein bißchen, sondern in solchem Umfang, daß die neue Gemeinschaftswährung gleich auch schon wieder in prekärer Weise mehr Reichtum vorspiegeln als wirklich repräsentieren würde, wenn die überkommenen nationalen Schuldenberge darin neu angeschrieben würden. So ein Urteil kommt einem Offenbarungseid über die Finanzlage und das Kreditgeld wichtiger Bewerberstaaten nahe. Das soll nun nicht mehr gelten; und das nicht etwa, weil sich an den so kritisch beurteilten Verhältnissen selbst etwas Substanzielles zum Besseren verändert hätte; fürs größte und wichtigste Mitgliedsland gilt eher das Gegenteil. Die buchstäbliche Dis-Kreditierung etlicher europäischer Währungen, ihre Denunziation als wertloser Zettelkram, wird widerrufen – in einem eingestandenermaßen politisch motivierten Entscheidungsakt, der sich dafür auf nichts als ein angeblich allseits gebessertes Haushaltsgebaren beruft: Dadurch wäre das neue Geld ökonomisch hinreichend beglaubigt, seine inskünftige Güte unzweifelhaft.
Das neue Weltgeld – eine gefährdete Art
Zu den „harten Fakten“, die einem zählebigen Gerücht zufolge die Welt der Ökonomie bestimmen, gehört dieser Ökonomismus ganz sicher nicht. Was die so gearteten „Fakten“ betrifft, wäre darauf zu verweisen, daß es für die „Härte“ eines Geldes nach allen Regeln der kapitalistischen Ökonomie darauf ankommt, wie gut, d.h. in welchem Umfang es gelingt, mit dem staatlich geschöpften Kreditgeld die rentable Produktion neuen kapitalistischen Eigentums anzuzetteln – eine Erfolgsfrage der kapitalistischen Konkurrenz, die vorweg für die Zukunft ohnehin nicht zu beantworten ist. Genau umgekehrt wollen jedoch die Befürworter des inskünftigen Euro-Geldes den Zusammenhang betrachtet haben: Weil das neue Geld aufgrund bewiesener allseitiger Haushaltsdisziplin unweigerlich gut und hart wird, sind die Erfolgsaussichten für alle, die damit wirtschaften, ausgezeichnet. In Europa lassen sich damit Geschäfte ungeahnten Ausmaßes anzetteln: Produktion und Handel nehmen zu und die Finanzgeschäfte sowieso; fürs dienstbare Volk setzt es irgendwann sogar neue Arbeitsplätze. Über Europas Grenzen hinaus beginnt mit dem Euro die Karriere eines neuen Weltgeldes: Weil vom Start weg stabil, findet es weltweit Zuspruch als Geschäftsmittel wie als „Medium“ privaten Vermögens und staatlicher Reserven. Nachgefragt und benutzt wird es weit mehr als die bisherigen 11 Landeswährungen zusammengenommen, so daß das europäische Geschäftsleben endlich unabhängiger wird: von „auswärtigen Finanzzentren“ – gemeint ist natürlich New York –, von den Entscheidungen fremder Notenbanken – der amerikanischen nämlich – und von unvorhersehbaren wie vorhergesehenen Schwankungen der Wechselkurse – zum Dollar…
Bei aller demonstrativen Vorfreude auf derlei
segensreiche Wirkungen des neuen Geldes warnen freilich
andere oder sogar dieselben Macher und Experten des Geld-
und Kreditwesens vor „übertriebenen Hoffnungen“ und
dementieren jeden „Automatismus“: Arbeitsplätze gibt es
sowieso bestenfalls „mittelfristig“, und auch sonst sind
die positiven Effekte keineswegs sicher kalkulierbar. Sie
stehen vielmehr unter einem großen Vorbehalt – und
unversehens wandelt sich das selbstsichere weil
zu
einem sorgenvollen wenn
: Die Rechnung mit einer
neuen Weltwährung, in der kapitalistische Geschäfte in
Europa und von Europa aus einen Aufschwung nehmen und die
Finanzpolitiker über ein wirkliches Äquivalent zum
US-Dollar verfügen, geht nur unter der Bedingung
auf, daß der Euro „hart“ wird. Ums Verhältnis
geht es also, das der freie Devisenhandel zwischen der
neuen europäischen Geldware und dem überkommenen
amerikanischen Weltgeld herstellt; um ihre Beliebtheit
als Zahlungsmittel, Anlagewährung und Reservemedium:
Davon hängt ab, was die Euro-Partner überhaupt in die
Hand kriegen, wenn sie ihre nationalen Währungen gegen
eine gemeinschaftliche eintauschen.
Europas Geldpolitiker sehen sich mit ihrem so wohlfundierten Euro-Gründungsbeschluß also noch überhaupt nicht am Ziel, sondern vor der bleibenden Aufgabe, ihr projektiertes Gemeinschaftsgeld zum Objekt der Begierde aller Geldhändler und Finanzkapitalisten zu machen, damit die es ihrerseits als einwandfreies, erstklassiges Geschäftsmittel anerkennen, benutzen und dadurch praktisch beglaubigen. Auf diesen Effekt war schon die Kritik berechnet, der die europäischen Geldhüter etliche ihrer Landeswährungen unterzogen haben: Bei der Unterscheidung zwischen „guten“ und „schlechten“ Schulden und Währungen haben sie an den Kriterien Maß genommen, die sie der vergleichenden Bewertung nationaler Zahlungsmittel durch die dazu ermächtigten Devisenhändler der kapitalistischen Welt entnommen haben, um umgekehrt für die Bewertung der neuen Euro-Ware Maßstäbe zu setzen. Von diesem Ziel sind sie überhaupt nicht abgerückt, wenn sie mit ihrem Beschluß, das Ding nun zu machen, die gesetzten Maßstäbe zwar kontrafaktisch, aber im Prinzip für erfüllt erklären und ihre eigene Mißtrauenserklärung widerrufen: Sie haben einfach gemerkt, daß sie ihr Projekt hintertreiben, wenn sie dessen Erfolgskriterien nicht schleunigst revidieren, und daß sie erfolgreichen Vollzug in Sachen Stabilitätspolitik melden müssen, um es zu retten.[2] „Die Märkte“ sollen dieser Meldung praktisch Recht geben, damit das neue Geld wirklich so ‚hart‘ wird, wie es aufgrund seiner soliden Startbedingung eigentlich schon ist…
Man liegt sicher nicht falsch, wenn man dieses Manöver für den Versuch der Konstruktion einer „self-fulfilling prophecy“ oder eines günstigen „circulus vitiosus“ hält: Es handelt sich um eine Spekulation auf die Spekulation. Bevor man sich aber Sorgen macht, ob die wohl gut geht, sollte man lieber die Sorgen zur Kenntnis nehmen, die sich die Veranstalter selbst um das Gelingen ihres Projekts machen, und die Anstrengungen würdigen, die sie dafür unternehmen. Die halten nämlich ihr neues Weltgeld, kaum beschlossen, selber für eine gefährdete Art und machen seine Haltbarkeit zu ihrem obersten politischen Sorgeobjekt.
Das Risiko: Der Umgang von 11 Souveränen mit 1 Geld
Die Gefährdung, der die Schöpfer des Euro ihr Produkt ausgesetzt sehen, ist einerseits dieselbe, wie sie für jede nationale Währung besteht: Jedes lokale Geld ist darauf angewiesen, daß die international aktiven Finanzkapitalisten es als Zahlungs-, Finanz- und Wertaufbewahrungsmittel anerkennen und benutzen. Denn nur in dem Maße, wie sie das tun, bestätigen sie es als internationale Geldware, verschaffen ihm ein stabiles Außenverhältnis und rechtfertigen so seine Schöpfung und Vermehrung durch den Staat, der damit seine nationale Ökonomie und sich selber kreditiert. Umgekehrt steht mit dem Währungsvergleich die Geldqualität des nationalen Zahlungsmittels selber auf dem Spiel. In der Frage, was für die praktische Anerkennung einer nationalen Währung durch die Agenturen des internationalen Geldgeschäfts politisch zu tun sei, fällt den Vätern der neuen europäischen Geldware gleichfalls nichts anderes ein, als was sie mit ihrer nationalen Haushaltspolitik schon immer betrieben haben: Es geht um die Regierungskunst, die Staatsgelder immer genau dorthin zu befördern, wo sie das Wirtschaftswachstum fördern, und die Anhäufung unproduktiver Schulden zu vermeiden, die am Ende auf den Wert des nationalen Kreditmittels selbst durchschlagen. Ob und in welchem Umfang das gelingt, ist zwar, wie schon gesagt, eine Frage des Konkurrenzerfolgs, und der ist durch politische Beschlüsse und Aktionen gar nicht zu erzwingen; die Bewertung von Erfolgen und Mißerfolgen einer Nation bei der Verwandlung von Kredit in akkumulierendes Kapital ist dann noch einmal ein eigener Geschäftszweig mit besonderen Kriterien. Für die Macher der nationalen Haushaltspolitik ist genau das aber die „Herausforderung“, der sie sich stellen: Bei all ihrem Regierungsgeschäft gilt ihr spezielles Augenmerk der „Stabilität“ des Mittels, mit dem sie regieren und ihre kapitalistische Gesellschaft bewirtschaften; und eben weil sie die nicht im Griff haben, werden sie erfinderisch bei der Konstruktion von haushaltspolitischen Vorkehrungen gegen eine „Überforderung“ ihres Kredits und eine zu massive Inflationierung ihres Geldes – Proben dieser Sorte „Stabilitätspolitik“ haben die Euro-Aspiranten seit Maastricht zur Genüge abgeliefert.
Damit ist aber auch schon der Punkt benannt, in dem sich – andererseits – die Währungssorgen der Euro-Schöpfer von der bisher bekannten und üblichen Problemlage einer „stabilitätsorientierten“ Geld- und Haushaltspolitik wesentlich unterscheiden. Wo elf Souveräne mit einem Geld wirtschaften, da trennt sich der Erfolgsgesichtspunkt der Geldwertstabilität, der die staatliche Haushaltsführung immerzu begleitet und rückblickend wie vorausschauend Korrekturen daran gebietet, ganz grundsätzlich von dem mit Geld exekutierten nationalen Regierungsgeschäft ab. Nicht in dem Sinn, daß er von den nationalen Regierungen vernachlässigt werden könnte: Die Haltbarkeit des gemeinsamen Geldes wird zum ersten wirklich supranationalen Sorgeobjekt aller Beteiligten. Weil die Bewertung des Geldes durch „die Märkte“ keinen Unterschied macht zwischen den Nationen, die es mal mehr, mal weniger erfolgreich als ihren kapitalistischen Grundstoff und ihr politisches Kommandomittel verwenden, bleibt die Herbeiführung stabiler Währungsverhältnisse nicht den einzelnen Staaten als begleitender Gesichtspunkt und mehr oder minder gewichtiges Korrektiv ihrer jeweiligen Regierungskunst überlassen, sondern rangiert als verbindliches Gemeinschaftsanliegen vor den Haushaltsbedürfnissen der elf Beteiligten und tritt zu denen in einen förmlichen Gegensatz. Die „Sicherung der monetären Rahmenbedingungen“ europäischen Wirtschaftens verliert den Charakter eines Dienstes und gerät zum handfesten Vorbehalt gegen dieses Wirtschaften.
Geldwertstabilität als kategorischer Imperativ
Das wäre anders, wenn die Elf mit der Einführung des gemeinsamen Geldes gleich auch eine gemeinsame Haushaltsführung beschlossen hätten – also die Zusammenführung ihrer nationalen Haushaltspolitiken zu einer einzigen euro-weiten Herrschaft, wie sie von manchen Kritikern der jetzt realisierten Konzeption ja auch als Voraussetzung für eine gemeinschaftliche Währung gefordert worden ist. Dann wären Geld und Souveränität wieder deckungsgleich; „Stabilitätspolitik“ wäre der Titel, unter dem die Verantwortlichen ihren Haushalt führen, oder auch der Gesichtspunkt, unter dem sie ihn dem „Ernst der Lage“ entsprechend korrigieren; die Sache wäre wieder im normalen Gleis – also der ganze Reiz des Neuen weg. Der liegt nämlich eben darin, daß die Regierungen, sobald sie den zu jeder Wirtschaftspolitik und Staatshaushälterei untrennbar hinzugehörigen Geldstandpunkt einnehmen, einander dazu anhalten, den nationalen Haushaltsstandpunkt zu verlassen. Zum supranationalen Anliegen verselbständigt, tritt der „Gesichtspunkt“ der Geldwertstabilität dem nationalen Haushaltswesen prinzipiell negativ und äußerlich: als äußere Schranke gegenüber. Ihr eigener Umgang mit dem gemeinsamen Stoff ihres eigenen Reichtums wird für die Staaten zum Problem, die Disziplinierung der nationalen Haushaltspolitiken zum vorweg feststehenden Imperativ. Und das nicht erst dann, wenn Rückmeldungen von der Front des internationalen Währungsvergleichs klarmachen, daß der politökonomische Gesamterfolg der staatlichen Herrschaft den haushälterischen Aufwand dafür mal wieder nicht bestätigt hat: Solche „Rückmeldungen“ sind zwischen den elf Euro-Nationen ja gerade außer Kraft gesetzt, treffen stattdessen unterschiedslos alle zusammen und werden daher zwischen ihnen durch ein von allen anerkanntes und dauernd zu beachtendes Stabilitätsgebot ersetzt.
Mit genereller Zurückhaltung bei der Schöpfung von Euro-Krediten hat dieser Imperativ nichts zu tun. Im Gegenteil: Innerhalb des Euro-Gebiets soll für Kreditnehmer wie Kreditgeber die große Freiheit anbrechen – die Befreiung von den längst viel zu engen Schranken gesetzlich behüteter nationaler Währungsräume. Und auf den Weltmärkten soll die neue Währung sich als Zahlungs- und Finanzierungsmittel in weit größerem Umfang beliebt machen als die bisherigen elf Landeswährungen zusammengenommen – schließlich geht es darum, eine neue Weltwährung zu etablieren, die den Gebrauch des US-Dollar als Kauf- und Kreditmittel, Vermögenstitel und Staatsreserve großflächig ersetzt; und dazu muß die Masse verfügbarer Euros „explodieren“.[3] Zunehmen soll die Menge der neuen Geldware aber eben so: als Stoff innereuropäischer und weltweiter Geschäftstätigkeit, in dem sich lauter private Geschäftserfolge realisieren und andere Nationen ihren Reichtum aufbewahren. Denn nur so fällt die Vermehrung der Währung mit ihrer Stärkung zusammen: der Beglaubigung ihrer Weltgeldqualität, von der sämtliche politökonomischen Leistungen des neuen Stoffs ja abhängen.
Unter demselben Geldgesichtspunkt gilt dagegen jede Euro-Schöpfung als prekär, die auf staatliches Schuldenmachen zurückgeht: Der Freisetzung kapitalistischer Kreditschöpfung, der der gesamte Euro-Raum als eine einzige Quelle von Finanzmitteln und schrankenlose Anlagesphäre zur Verfügung stehen soll, korrespondiert der Standpunkt der Beschränkung staatlicher Verschuldungsfreiheit.[4] Denn was die nationalen Haushaltspolitiker für ihre Schulden an Notwendigkeiten geltend machen oder sich als guten wirtschaftspolitischen Zweck zurechtlegen, das geht die Hüter des supranationalen Stabilitätsanliegens – also sie selbst in ihrer Eigenschaft als Europapolitiker – nichts an. Da registrieren sie nur eine Aufblähung des Kreditvolumens, die gefährlich ist, weil sie sich nicht aus privatem Geschäftsbedarf oder sonst einer stabilitätsfördernden Nachfrage ergibt, also auch nicht schon dadurch kapitalistisch gerechtfertigt ist; und der begegnen sie prinzipiell mit dem Verdacht, unproduktiv zu sein, Stabilität und Haltbarkeit des Geldwerts zu gefährden, das Kapital dadurch auf ganzer Linie zu schwächen und so die Leistung zu konterkarieren, die es für die neue Währung gerade erbringen soll: deren Bestätigung als Weltgeld erster Qualität.
Ganz nüchtern betrachtet ist dieser Verdacht unsinnig und für den Erfolg der neuen Währung eher kontraproduktiv: Für den Wert des Euro gibt es schließlich keine andere substanzielle Grundlage als die Konkurrenzerfolge, die die Kapitalisten, die ihn benutzen, zustandebringen – und ohne Kreditierung durch ihre Nation ganz gewiß nicht in der geforderten Größenordnung. Einigermaßen absurd ist auch das Projekt einer eigenständigen Stabilitätspolitik getrennt von der souveränen Haushaltspolitik, die allenfalls mit der Art ihrer Mittelbeschaffung wie mit ihrer Mittelverwendung praktisch auf die Vermeidung unproduktiver und die Mehrung produktiver Schulden hinwirken kann. Beides ist aber nur konsequent: Wenn die EU 1 Währung haben und zugleich 11 Souveräne mit ihren Haushalten bestehen lassen will, dann eröffnet sie eben damit den Gegensatz zwischen einem verselbständigten stabilitätspolitischen Gemeinschaftsanliegen und nationalen Belangen, die allemal Geld kosten. Dann definiert sie sich grundsätzlich – und keineswegs bloß in dem so bezeichneten Sonderabkommen – als Stabilitätspakt zu Lasten der nationalen Standortbewirtschaftungs- und -förderungsprogramme.
Und dann kann sie es bei der bloßen ‚Definition‘ selbstverständlich nicht belassen.
5. Damit der Euro hart wird: Vertrauensbildung durch eine Geschäftsordnung, die das Mißtrauen institutionalisiert
Dem Vertrauen, das die Mitglieder der Währungsunion mit ihrem Gründungsbeschluß einander ausgesprochen, ihrer Schöpfung attestiert und der Welt kundgetan haben, folgt das geldpolitische Mißtrauensvotum auf dem Fuß. Kaum haben sie einander das Reifezeugnis einer glaubwürdigen Stabilitätskultur ausgestellt, gehen die Euro-Partner schon davon aus, daß auf diese Errungenschaft kein Verlaß ist – wenn man sie nicht in eine wirksame Aufsicht überführt. Der Umgang mit dem neuen Geld braucht eine Geschäftsordnung, die gegen alle nationalen Eigeninteressen den Beweis für die Güte des Geldes dauerhaft sicherstellt. Die gilt es zu organisieren; die Frage ist, wie.
Die EZB: Geldpolitik im „politikfreien Raum“
Wichtigster Garant der neuen europäischen Stabilitätspolitik ist nach dem Willen der Veranstalter und laut Maastricht-Vertrag die Europäische Zentralbank, die den Euro nach den allgemeinüblichen Regeln notenbankamtlicher „Geldversorgung“ herausgibt. Dieses Institut ist so konstruiert, daß es satzungsgemäß für nichts anderes einsteht als den reinen Geldstandpunkt: die Pflege eines stabilen Geldwerts als abgetrennte, eigenständige Aufgabe. Völlig unabhängig soll sie sein, jeder politischen Einflußnahme entzogen; noch viel autonomer als das große Vorbild, die Deutsche Bundesbank, die nach ihrer Gründungsurkunde immerhin verpflichtet ist – bzw. war –, die Politik der Bundesregierung zu unterstützen; schon insofern also bestens gerüstet für ihren Kampf um den Wert des Euro. So steht sie als Institution für sämtliche Sachzwänge einer stabilen Währung ein, an denen sich dann ganz von selbst die Souveränität der nationalen Haushaltspolitiker bricht und relativiert. Das staatlich autorisierte Geldschöpfungsinstitut wirkt als eine einzige Bremse für den staatlichen Geldgebrauch, einfach deswegen, weil die Parlamente mit ihrer Haushaltssouveränität den Zentralbankern keine Vorschriften zu machen haben – das jedenfalls ist die Idee.
Freilich haben umgekehrt die Zentralbanker den nationalen Haushaltspolitikern auch keine Vorschriften zu machen; so etwas wie eine Zuteilung von Finanzmitteln von Frankfurt aus an die Regierungen und Parlamente findet nicht statt. So stellt sich den Freunden dieses Arrangements dann doch wieder die Frage nach der Macht, die mit den autonomen Vollmachten der EZB verbunden sein mag. Beantwortet wird sie mit Beispielen von der Art, daß etwa eine „stabilitätspolitisch gebotene“ Zinserhöhung nicht mehr am Einspruch einer Regierung scheitern könne, die für die leichtere Bedienung ihrer Schulden sowie zur Förderung der Konjunktur billigere Kredite wünscht… Man darf also gespannt der historisch erstmaligen Probe aufs Exempel beiwohnen, ob allein mit den geldpolitischen Maßregeln, die nach der Institutsideologie der Deutschen Bundesbank die Stabilität der Mark herbeigeführt haben, getrennt von der sonstigen staatlichen Finanz-, Wirtschafts-, Verschuldungs- und überhaupt Haushaltspolitik und deren Erfolgen und Fehlschlägen, tatsächlich irgendetwas zu bewirken ist – womöglich sogar ein erfolgreicher Währungsvergleich mit dem Dollar. Eine Wirkung steht dabei auf alle Fälle schon fest: Es wird viel gestritten werden zwischen den Frankfurter Geldexperten und den Haushaltspolitikern aus elf Ländern; um so heftiger, je mehr Wirksamkeit man den Manövern der Zentralbank zutraut. Und zwar nicht zuletzt um den Kanon geldpolitischer Erfordernisse selbst, den die Frankfurter Währungshüter jeweils zur Anwendung bringen. Denn daß der über jeden Expertenstreit erhaben wäre, gehört mehr zu den alten Lebenslügen der Deutschen Bundesbank als zu den politökonomischen Wahrheiten.[5] Die erbitterte Auseinandersetzung um die Person des ersten EZB-Chefs hat das gleich zu Beginn der Euro-Geschichte dankenswert eindeutig klargestellt: Obwohl Meinungsverschiedenheiten zwischen den beiden Kandidaten angeblich überhaupt nicht auszumachen sind, wurde doch ein Machtkampf um die Besetzung des Postens geführt, in dem es allen Seiten darum ging, jeweils ihren Mann durchzubringen – als Garanten einer von offenbar mehreren konkurrierenden „Linien“ „stabilitätsorientierter“ Geldpolitik. Auch insoweit macht also nicht einfach die Bank irgendwelche immanenten Sachzwänge des Geldes gegen die Politik der elf Mitgliedsländer geltend; vielmehr entscheiden elf nationale Mächte darüber, was die Bank aus ihrer Autonomie macht und was sie damit ausrichtet.
Das bedeutet auf der anderen Seite allerdings auch: Auf die Art geben die Euro-Länder tatsächlich ein bedeutendes Stück ihrer Souveränität in Gelddingen auf; nur deswegen wird ja so heftig um „Weichenstellungen“, die ersten vor allem, gerungen. Denn auch wenn letztlich wieder die Staaten mit ihren politischen Interessen hinter der Vollmacht stehen, mit der das gemeinsame Finanzinstitut ausgestattet ist: Das eben ist der Unterschied, daß die Partner nicht mehr machen, was sie – nach Lage der Dinge, unter dem Druck der Umstände, also keineswegs aus freier Willkür, aber doch allemal aus eigenem Beschluß – für richtig halten; vielmehr streiten sie stattdessen um Direktiven für dieses supranationale Gemeinschaftsorgan, um die Definition seiner Befugnisse und die Art ihrer Ausübung. Das ist dann ihre nationale Geldpolitik.
Dabei läßt sich die Hauptlinie der Euro-internen Auseinandersetzung auch schon deduzieren; und die Fronten in dem großen Streit von Birmingham haben sie bereits zur Anschauung gebracht, noch bevor die EZB überhaupt loslegt. Mit diesem supranationalen Institut verhält es sich nämlich so, daß dessen Politik – die ja in dem Sinn gar keine ist… – einem „Sachzwang“ tatsächlich unterliegt. Zwar nicht dem ideologisch so gern beschworenen einer rein fachidiotischen Geldhüterei; stattdessen aber der ganz von selbst wirksamen ökonomischen Notwendigkeit, bei den allfälligen geldpolitischen Entscheidungen den Verhältnissen Rechnung zu tragen, die sich aus dem höchst unterschiedlichen wirtschaftlichen Gewicht der Mitgliedsländer sowie der schieren Masse des von ihnen geschöpften und – sei es erfolgreich oder mit mangelndem Ertrag – angewandten Euro-Kredits ergeben. Denn davon hängt tatsächlich entscheidend ab – und folglich von den verschiedenen Euro-Nationen in höchst unterschiedlichem Maß –, wie gut oder schlecht der Euro wird, was die EZB mit ihren „Instrumenten“ daher überhaupt zu „steuern“ hat, und demzufolge dann auch, wie sie ihre „Steuerungsinstrumente“ einsetzt. Je autonomer, desto automatischer richtet sich die Bank nach dieser „Macht des Faktischen“: Das ist das politische Kalkül in all den ideologischen Albernheiten über den Segen einer „politikfernen“ Notenbank, in deren Namen das deutsche Mitglied auf eine entsprechende Satzungskonstruktion für die EZB hingewirkt hat. Und gegen diesen Automatismus versucht der Konkurrent deutscher Wirtschaftsmacht ein paar Bremsen einzubauen, der sein Heil nicht von vornherein in dem Programm sucht, sich als ohnehin fremdbestimmtes Anhängsel des Größten zu bewähren.
Die Fortentwicklung der europäischen Geschäftsordnung zum Kontrollregime
Gerade den Fans einer autonom stabilitätsorientierten EZB-Geldpolitik ist freilich klar, daß die Kontrolle, die nötig ist, um die nationalen Haushalte hinreichend glaubwürdig und auf Dauer zu disziplinieren, mit dem Frankfurter Institut und seinen Vollmachten nicht zu erreichen ist. Ein wirksames Kontrollregime über die als Grund und Inbegriff aller Währungsrisiken definierte Freiheit der elf Mitglieder, mit „aufgeblähten“ Staatshaushalten zu regieren und dafür Euro-Schulden zu machen, steht der Bank nicht zu; dafür bedarf es eines besonderen supranationalen Regelwerks zur Haushaltspolitik.
Der ausdrücklich so genannte Dubliner „Stabilitätspakt“ mit seinen Vorschriften zur Ahndung „übermäßiger“ Defizite in den öffentlichen Haushalten einer Nation ist davon ein erstes Stück, langt aber bei weitem nicht. Gewissermaßen komplementär dazu – und insofern ganz folgerichtig – hat die deutsche Seite die Summen ins Gespräch gebracht, um die ein zuvor veranschlagtes Defizit im Vollzug des Haushalts womöglich unterschritten wird, und für die Vorschrift plädiert, solche „Haushaltsüberschüsse“ zur Schuldentilgung zu verwenden – statt etwa, wie von Frankreich vorgeschlagen, für den „Abbau der Arbeitslosigkeit“, was ja bekanntlich Sache nationaler Verantwortung bleiben soll. Bemerkenswert ist an so einer Initiative nicht bloß die Borniertheit, mit der da einmal mehr auf dem Dogma von der prinzipiellen Unvereinbarkeit von Staatsverschuldung und Geldwertstabilität herumgeritten wird. Schön langsam machen die Finanzpolitiker der EWWU da den Schritt von der bloßen Beaufsichtigung des nationalen Haushaltsgebarens zu einem regelrechten Regime über die Kreditaufnahme und -verwendung durch die Partnerstaaten, das in Richtung einer Zuteilung von Finanzmitteln an die nationalen Regierungen geht. In diesem Sinne konsequent ist daher auch als nächster Schritt die Initiative zur „Vereinheitlichung“ der Steuergesetze: Das Verlangen nach „Einheitlichkeit“ begründet sich aus nicht länger gerechtfertigten Verzerrungen bei der fiskalischen Standortkonkurrenz und zielt immerhin auf nichts Geringeres als die nationale Souveränität bei der Beschaffung von Haushaltsmitteln.
Sein anderes großes Betätigungsfeld hat das Bemühen um eine neue Geschäftsordnung fürs Haushalten mit dem Euro im überkommenen EU-Haushalt selber. Da müssen die Imperative des harten Geldes überhaupt vorbildlich beherzigt werden; und deswegen kommen alle Positionen, die sowieso auch im Hinblick auf die dereinstige Osterweiterung des Clubs revidiert werden müssen, unter dem Gesichtspunkt auf den Prüfstand, ob da nicht laufend der Tatbestand unproduktiven Staatskonsums erfüllt wird. Sobald dann die entsprechenden Vorschläge zur Entlastung des EU-Haushalts auf den Tisch gelegt werden,[6] bringen die – von sich selbst so genannten und eingestuften – „Netto-Zahler“ mit ganz neuer Dringlichkeit die Forderung vor, die – angeblich oder wirklich – eingerissene Umverteilung von Haushaltsmitteln von den „Reichen“ zu den „Ärmeren“ abzubauen. Der gute Grund für derartige Transfers, daß nämlich die starken Euro-Partner ihren Reichtum nicht zuletzt der freien europäischen Konkurrenz gegen die schwächeren verdanken und ein gewisser Ausgleich schon deswegen geboten ist, damit die Unterlegenen als brauchbare Geschäftssphäre erhalten bleiben, gilt nicht mehr viel, wenn strikte Haushaltsdisziplin zwecks Beglaubigung eines stabilen Euro angesagt ist. Dann sieht nämlich jeder nationale Haushaltspolitiker zu, wie er bei sich eine vorschriftsmäßige Finanzierung des staatlichen Aufgabenkatalogs hinbekommt, und verbietet sich jede Großzügigkeit gegenüber anderen, die sich dann womöglich bloß ihre mühsam errungene Stabilitätskultur gleich wieder abgewöhnen. Und noch ein anderes supranationales Stabilitätsargument hat der frisch belebte nationale Egoismus in diesem Punkt auf seiner Seite: „Geldgeschenke“ an notorische Verlierer verderben nur den Kredit, aus dem in notorisch erfolgreichen Ländern ein viel besserer Beitrag zum Welterfolg des gemeinsamen Geldes zu machen wäre…
Eine gewisse Ironie liegt schon darin, daß ausgerechnet mit dem Beschluß, eine gemeinsame Währung einzuführen, alle Ansätze zu so etwas wie einer gemeinsamen Haushaltsführung der EU-Partner revidiert werden; noch dazu um der Stabilität des gemeinsamen Geldes willen, die, wenn schon, dann nur über die erfolgreiche kapitalistische Bewirtschaftung des gesamten Euro-Landes zu erzielen wäre, also als erste Erfolgsbedingung eher eine gemeinsame Haushaltspolitik erfordern würde. Doch so ist die Gemeinsamkeit beim Euro nun einmal konstruiert: als Aufsichtsregime gegen die autonom festgelegten Etatbedürfnisse der Mitglieder. Deswegen ist es nur folgerichtig, wenn alle sich als Betroffene eines allgemeinen Beschränkungswesens begreifen und entsprechend eifersüchtig darauf achten, ihre beschränkten Haushaltsmittel nicht auch noch mit den Partnern teilen zu müssen. Sie bezeugen damit, wie sehr die europäische Geschäftsordnung sich tatsächlich wandelt: hin zu einer Kontrolle, der die Mitglieder substanzielle Souveränitätsrechte opfern.
Die Aufsichtsführung: eine neue Herausforderung für Europas Hierarchie und Streitkultur
Natürlich passiert dieser Wandel nicht einfach; schon gar nicht von selbst. Er ist das politische Werk der betroffenen Regierungen selber: Sie konstruieren das Regime über sich und üben die supranationale Kontrolle aus.
Dabei ergibt sich freilich – auch das nicht ganz von selbst – eine unübersehbare Scheidung zwischen den gleichberechtigten Partnern. Aus der Tatsache, daß er bisher schon immer über das meiste und noch dazu das weltweit am meisten benutzte nationale Geld Europas verfügt hat und auch in Zukunft über die meisten Euros verfügen wird, leitet ein Mitgliedsstaat sein selbstverständliches Recht ab, bei der Beaufsichtigung der nationalen Haushalte ziemlich maßgeblich zu sein; umgekehrt steht er für eine eingreifende Kontrolle durch die Gemeinschaftsorgane,[7] geschweige denn durch die Partner einfach nicht zur Verfügung. Die Rolle der kontrollbedürftigen Geldverschwender soll sich mit gleicher Selbstverständlichkeit für andere Länder anbieten, aufgrund deren weit weniger erfolgreicher geldpolitischer Vorgeschichte; für die Funktion des entscheidungsbefugten Kontrolleurs kommen diese Nationen von vornherein kaum in Frage. So begründen die wirtschaftlichen Kräfteverhältnisse recht unterschiedliche Kompetenzen; und die wirken ziemlich machtvoll auf ein Regime über die Verteilung der nationalen Finanzmittel hin, das für die Fortschreibung der alten Gewichte und Ungleichgewichte im neuen gemeinsamen Euro-Land sorgt.
Allerdings setzt auch dieses Regime nicht die Grundregel des europäischen Supranationalismus außer Kraft, daß die souveränen Mitglieder immer noch Ja sagen müssen zu dem, was ihnen an Kontrolle zugemutet wird; insbesondere diejenigen, die vielleicht weniger ökonomisch begründeten Kredit, dafür um so mehr historisch erworbene und aktuell zur Geltung gebrachte Fähigkeit zu diplomatischer und militärischer Vertrauensstiftung in die gemeinsame europäische Sache einzubringen haben. Deswegen artet die allgemeine Anerkennung eines supranationalen Aufsichtsregimes in Gelddingen auch nicht in eine automatische Unterwerfung der minder Großen und Starken unter die Machtworte derer aus, die sich für die Wahrnehmung dieses Regimes zuständig wissen. Eingerichtet ist damit vielmehr ein weites Feld des Streits der Partner: um ihre jeweilige Haushaltsführung; um das Recht, einander in dieselbe hineinzureden; um die Pflicht, solche Einsprüche zu akzeptieren… usw. So gibt es sie dann: die unerläßliche Gemeinsamkeit der Euro-Partner beim Gebrauch ihres gemeinsamen, so dringend pflegebedürftigen Verschuldungsmittels.
6. Europas neuer Kredit und der Angriff auf die Geldmacht Amerikas – mit Brüsseler Streitkultur als vertrauensbildender Maßnahme
Nun sind Streit, Erpressung und „Kuhhandel“ seit jeher die Methoden, mit denen die europäischen Partner – erst als EWG, dann als EG, mittlerweile als EU – ihren Einigungsprozeß vorangetrieben haben. Sie alle haben langjährige Erfahrungen darin, strittige Souveränitäts- und Unterordnungsfragen in konsensfähige Verfahrensteile und einen auszuklammernden Rest zu zerlegen, Kompromißpakete zu schnüren und aufzuschnüren, Fristen und Ultimaten aufzustellen und die Uhren anzuhalten… Und offenbar verlassen sie sich darauf, daß diese Techniken der „Konsensfindung“, die sich im Verlauf der über Jahre hingezogenen Beschlußfassung über die Einführung des Euro einmal mehr praktisch bewährt haben, auch in Zukunft ihr Werk tun, wenn es nicht mehr bloß darum geht, Märkte zu „ordnen“ und einige Promille vom Bruttosozialprodukt einzusammeln und wieder auszugeben, sondern um Ziele, Methoden und Durchführung der Geldpolitik der EZB sowie um eine verbindliche Normierung der staatlichen Haushalte. Europas regierende Nationalisten scheinen sich ohne größere Umstellungsprobleme darauf einzustellen, daß sie in Zukunft dann eben im Namen des gemeinsamen Geldes, seiner Intaktheit und Haltbarkeit, für die Berechtigung ihrer vielfältigen haushaltswirksamen Anliegen und Vorhaben eintreten müssen.
Dabei ist jedoch nicht zu übersehen, daß dieser gewohnten
und bewährten europäischen Streitkultur mit dem Übergang
zur Währungsunion eine durchaus neue und sehr starke
Leistung abverlangt wird. Einerseits ist die
Sache, über die da in Zukunft gemeinsame
Beschlüsse gefaßt werden müssen, nichts Geringes: Es geht
um ein wirksam begrenzendes Aufsichtsregime über die
nationalen Haushalte, und das rührt schon sehr an die
ökonomische Substanz nationalstaatlicher Souveränität –
der bürgerliche Staat regiert nun einmal mit Geld. Von
der Einigung über die Streitfragen, die damit
fortwährend zur Entscheidung anstehen, hängt andererseits
ganz unmittelbar enorm viel ab, nämlich die Stiftung und
Erhaltung allgemeinen Vertrauens in das gemeinsame,
separat als Herrschaftsmittel verwandte Geld: Ständig
geht es darum, vor der kritischen Instanz des Weltmarkts
für Geld und Kredit das vom Eurostaatenkollektiv
verantwortete Kreditmittel als stabilen, nach allen
Regeln der Kunst gemanagten, extrem umsichtig und
zweckmäßig eingesetzten, folglich jedes Vertrauen der
Geschäftswelt rechtfertigenden, also absolut
kreditwürdigen kapitalistischen Grundstoff zu
beglaubigen. Gewiß entsteht damit auch ein erheblicher
Einigungsdruck auf die souveränen Partner. Unter
Politprofis bewirkt solcher Druck aber alles andere als
Nachgiebigkeit; da dient er eher als Hebel für
Erpressungsversuche der härteren Art – auch dafür hat der
EU-Gipfel in Birmingham mit seinem nicht-enden-wollenden
Mittagessen der Chefs zu Ehren des zu benennenden
EZB-Präsidenten ein Beispiel gegeben. Jedenfalls ist der
in der gemeinsamen Sorge ums Euro-Geld begründete
Einigungszwang alles andere als eine Garantie, daß ein
gemeinsamer Nenner auch gefunden wird – und schon gar
nicht dafür, daß seine Herstellung so überzeugend
gelingt, wie es jeweils nötig wäre, um den
Finanzkapitalisten dieser Welt einen guten Eindruck zu
machen und sie zu einem praktischen, nämlich tagtäglich
mit Milliardensummen in die Tat umgesetzten
Vertrauensvotum zu bringen. Um nochmals an den Zirkus um
Herrn Duisenberg und seine 8-minus-x-jährige Amtszeit zu
erinnern: Der hat bereits genügt, um die besorgte Frage
aufzuwerfen, ob damit nicht ein Fehlstart des Euro auf
den Weltfinanzmärkten programmiert sei – die hatten
aktuell freilich andere Sorgen… Derartige Bedenken werden
in Zukunft alle Ministerratssitzungen begleiten, auf
denen es Dinge zu entscheiden gibt, die den Euro
betreffen – und welche hätten schon nicht mit Geld zu
tun! Ihr Konsens, einschließlich der Art seiner
‚Findung‘, wird so zu einer dauernden Bewährungsprobe für
die Euro-Partner; und die ist kein Experiment, das ohne
Schaden für die engagierten Kapitalstandorte ruhig auch
mal schlecht ausgehen könnte. Von einem überzeugenden
Ergebnis hängt vielmehr ab, ob und in welchem Maß die
EWWU für ihr neues Geld über den Zuspruch des
Finanzkapitals verfügt und was ihre Schöpfung folglich
überhaupt taugt: Die Überzeugungskraft ihres
Konsenses ist die Schicksalsfrage
ihres
Geldes.
Und mit dem haben dessen Schöpfer immerhin einiges vor. Sie machen sich die ganze Mühe ja schließlich nicht, um mit dem neuen Stoff weiterhin business as usual zu treiben; dafür hätten sie es wirklich bei ihrer Währungsvielfalt belassen können. Mit dem Geld, für dessen Haltbarkeit sie sich fortan laufend zusammenraufen müssen, gedenken sie nichts Geringeres zustandezubringen als einen kompletten Umsturz auf dem Weltmarkt für Geld und Kredit: die massive Zurückdrängung des US-Dollars im Weltfinanzgeschäft, die Umschichtung also von Geldvermögen und Zahlungsverpflichtungen aus der bewährten amerikanischen Geldware in die neue europäische.
Dieser Angriff auf die überlegene Geldmacht der USA trägt sich bescheiden vor: als Initiative zur „Normalisierung“ der Verhältnisse auf den Weltmärkten, zur Bereinigung des überkommenen „Mißverhältnisses“ nämlich, daß Amerika bei geringerer Bevölkerungszahl als die EU und kaum größerem Bruttosozialprodukt dennoch mit seinem Dollar Welthandel und Weltfinanzgeschäfte eindeutig dominiert. Der Anspruch, die bislang so turmhoch überlegene Währungsmacht der Vereinigten Staaten auf ein „Normalmaß“ zu reduzieren, das dem Euro Ebenbürtigkeit garantiert, beruft sich da auf die interessante Diagnose, durch ökonomische Gegebenheiten sei die singuläre Weltgeltung des US-Geldes gar nicht gedeckt; sie verdanke sich vielmehr einer außerökonomisch begründeten weltwirtschaftlichen Ungerechtigkeit, sei eine bloß politisch fundierte „Verzerrung“ der wahren Verhältnisse. Es ist, als hätten die Schöpfer des Euro – Jahrzehnte nach dem gleichlautenden Vorwurf einer international hochsolidarischen Linken – ihre Lesart von „Dollar-Imperialismus“ entdeckt: Gegen den gehen sie jedenfalls in die Offensive. Und zwar mit einem Mittel, das ihre ökonomischen Fähigkeiten und Potenzen fürs Erste gar nicht weiter verändert, geschweige denn vergrößert: Mehr als ihre nationalen Kreditmittel legen sie gar nicht zusammen; eine gemeinsame, einheitlich von einer souveränen Zentrale aus betreute, wirklich gesamtkontinentale Volkswirtschaft setzen sie gerade nicht auf ihre europapolitische Tagesordnung. Ohne wirkliche Vergemeinschaftung der 11 bis 15 nationalen Kapitalismen, ohne weitergehende Veränderung an der ökonomischen Basis – außer eben beim Geschäftsmittel –, folglich nur aufgrund des politischen Beschlusses zum gemeinsamen Geld soll der Euro leisten, was den Nationalwährungen einzeln und zusammengenommen bislang nicht gelungen ist: das politische Privileg außer Kraft setzen und alles quasi ungeschehen machen, was dem Dollar seine weltweite Beliebtheit unter Kapitalisten, Spekulanten und Finanzpolitikern verschafft hat und bis heute sichert. Die Einheit des politischen Willens, die sie mit ihren erpresserischen Streitereien immer wieder zustandezubringen gedenken und auch glaubwürdig herbeiführen müssen, um ihrem Geld die nötige Weltgeltung zu verschaffen, ist die Waffe der währungsunierten Euro-Länder gegen die politischen Qualitäten des US-Geldes und soll die glatt aufwiegen.
Das ist ohne Zweifel einigermaßen kühn. Denn auch wenn sie ausdrücklich nichts weiter davon wissen wollen, worin die besonderen politischen Gründe bestehen, die den Dollar zur bevorzugten Geldware des Weltkapitalismus machen: Auf die zielt die Offensive der Euro-Politiker. Sie mögen noch so sehr darauf bestehen, die „ungerechtfertigten Privilegien“ des US-Geldes wären ein Relikt eigentlich längst überwundener Nachkriegszeiten: Mit ihrem Angriff darauf stellen sie tatsächlich den Bonus in Frage, mit dem die frei spekulierenden Finanzkapitalisten dieser Welt heute die strategischen Kräfteverhältnisse honorieren, für deren Herstellung ein gewonnener Weltkrieg, für deren aktuelle Fassung ein siegreich beendeter Kalter Krieg nötig war und die aktuell die postsowjetische Staatenwelt beherrschen. Dem US-Imperialismus wollen die Europäer – einstweilen – nicht zu nahe treten; aber den Dollar-Imperialismus, unter dem sie leiden, wollen sie außer Kraft setzen, so als hätte der damit gar nichts zu tun. Sie probieren aus, wie weit sie mit ihrer Initiative kommen, eröffnen den Kampf um die Weltmacht auf dem Feld des Weltgeldes – und arbeiten sich dann doch gleichzeitig zu der Klarstellung vor, daß ihre Union letztlich nicht darum herumkommt, die politische Statur zu gewinnen, die dem ökonomischen Kredit entspricht, den sie für ihr gemeinsames Geld beanspruchen.
Man mag gar nicht fragen, wie die dann aussehen soll.
[1] Teil 1 ist in
GegenStandpunkt 2-97, S.137
erschienen: 1. Der Aufbruch / Die Weiterentwicklung
des Binnenmarkts
/ Die Selbstkritik am Binnenmarkt:
ebenso radikal wie inkonsequent / 2. „Stabilität“: Die
Verpflichtung der Nationen auf die Macht des
Euro-Geldes / Vom Herstellen einer stabilen Währung
für Europa /… Teil 2 steht in GegenStandpunkt 3-97, S.169: …/
Das Unbehagen an der Stabilitätskultur
/
Stabilitätspakt / 3. Die Tücken des Projekts.
[2] Die Alternative wäre eine wirkliche Währungsreform gewesen: Die zumindest teilweise Annullierung der in der Währung eines Beitrittslandes aufgeschriebenen Schulden vor dem oder beim Umtausch in Euro-Wertpapiere hätte das Verdikt über die Nichtigkeit dieser Kredite und den daraus folgenden schlechten Stand der fraglichen Gelder praktisch wahrgemacht und einen Neubeginn mit niedrigerem Schuldenstand und entsprechend geringerer „Vorbelastung“ des neuen Kreditgelds herbeigeführt. Der Preis wäre freilich eine massive Enteignung aller Gläubiger des so entschuldeten Staates gewesen, vorgenommen ohne die Not eines nicht aufzuhaltenden totalen Währungsverfalls, vielmehr zwecks Beglaubigung des neuen Geldes – eine denkbar paradoxe Art der Vertrauenswerbung… Die mochten sich die Länder, die auf diese Art dis-kreditiert worden wären, auf gar keinen Fall gefallen lassen; und bei den Gläubigern und Gläubigerstaaten bestand genausowenig Interesse daran, die dann fälligen Abschreibungen vorzunehmen.
[3] Das dürfte ja wohl auch der Grund sein, aus dem vor allem Europas Bankenwelt die Einführung des neuen Geldes so vorbehaltlos begrüßt und betreibt, daß fast der Eindruck entstehen kann, recht eigentlich hätten sie ihn sich bei ihren „ideellen Gesamtkapitalisten“ bestellt: Wenn die Durchsetzung des Euro als Anlagewährung und Kreditmittel in einem Ausmaß gelingen soll, daß der Dollar empfindlich verliert, dann ist das vor allem ihr Geschäft.
[4] Die Euro-Staaten
setzen mit dem Angebot eines neuen Geldes den
Anspruch in die Welt, die Kapitalisten aller
Länder sollten es gefälligst extensiv benutzen, in
Europa und anderswo, mindestens so gut und gern wie den
bislang bevorzugten Dollar. Sie richten diesen Anspruch
kritisch gegen sich selbst, nämlich gegen ihre
Freiheit, sich in dem neuen Geld nach Belieben zu
verschulden. Vor jeder ermittelten nationalen
Haushaltsnotwendigkeit definieren sie ihren
Kreditbedarf als Risiko, ihre hoheitliche Geldschöpfung
als Gefahr dafür, daß „die Märkte“ den Euro zum Geld
der Welt machen, und nehmen dieser „Sachlage“ gegenüber
den Standpunkt nationaler Ohnmacht ein, der sie zu
strikter Ausgabenbegrenzung zwingt, also zu
„Einschnitten“ bei allen als „konsumtiv“ verdächtigten
Ausgabeposten. Kurz: Sie betreiben, was die
dazugehörige imperialistische Ideologie als
subjektlosen, selbsttätigen, die Nationen und Souveräne
sachzwanghaft überrollenden „Prozeß“ verstanden haben
will: die Globalisierung
.
[5] Derzeit liest man von einem „Streit hinter den Kulissen“ um die Festlegung der EZB auf die einen oder anderen der speziellen Manipulationstechniken, die von den verschiedenen Zentralbanken zur Pflege der Geldwertstabilität entwickelt worden sind: Steuerung nach einem Geldmengenziel oder nach Inflationsprognosen, mit dem Mittel der Mindestreservepflicht oder nur mit Offenmarktgeschäften usw. Daß hinter dem „rein fachlichen“ Streit Regierungen mit ihren jeweils besonderen, national modifizierten Ansprüchen an die zentralbankamtliche „Geldversorgung“ stehen, wird auch gleich mitgeteilt. Und ebenso, daß die 6 Häuptlinge in der Frankfurter Zentrale es schwer haben werden, sich gegen die 11 Chefs der als Untergliederungen und eigentliche Eigentümer der EZB fortbestehenden nationalen Notenbanken durchzusetzen, die selbstverständlich jeweils ihre nationalen Sonderinteressen vertreten werden…
[6] Betroffen sind vor allem die Summen, die sich die EU-Partner gemeinsam für die Erhaltung von 15 nationalen Bauernständen leisten. Der „Agenda 2000“, die die Rückübertragung dieses Aufwands an die nationalen Haushalte vorsieht, geht es nicht mehr – wie allen bisherigen Reformen – um die Optimierung der widersprüchlichen Kombination von Agrarpreissubvention und Eindämmung der Überproduktion. Sie befindet es überhaupt für auf Dauer untragbar, als Gemeinschaft, die Wichtigeres zu tun und zu finanzieren hat, für einen falschen sozialen Wert der Agrarproduktion einzustehen, bloß damit die letzten Anhängsel der kapitalistischen Ernährungsindustrie auch noch was verdienen. Betroffen sind außerdem die diversen „Strukturfonds“, die ökonomische Nachteile kompensieren sollen, die ganzen Regionen daraus entstehen, daß sie als Randgebiete der EU und unter dem Druck der innereuropäischen Konkurrenz in den Status von Armutsgebieten hineinwachsen. In die Logik einer Politik, die im Kampf um die Glaubwürdigkeit ihres neuen Geldes unproduktive Staatsausgaben bekämpft und dringend vorzeigbare Wachstumsziffern braucht, passen solche Ausgabeposten einfach nicht mehr hinein.
[7] Wie es heißt, ist die BRD mittlerweile dasjenige Mitgliedsland, gegen das die meisten Verfahren der EU-Kommission wegen Nicht-Vollzug europäischer Rechtsregeln oder wegen Verstößen gegen Kommissionsentscheidungen laufen. Bekannt wird dergleichen in so großkalibrigen Fällen wie dem Streit um die Subventionen für das ostdeutsche VW-Werk. Auf die Rückendeckung ihrer heimischen Europapolitiker können deutsche Firmen sich offenbar selbst dann verlassen, wenn sie – wie wiederum VW mit seiner Verkaufspolitik in Nachbarländern der BRD – gegen das Kartellrecht verstoßen, das angeblich doch zu den Grundfesten der marktwirtschaftlichen Ordnung gehört, und Bußgelder zahlen sollen: Spätestens da fängt die „Brüsseler Bürokratie“ an, von der ein deutscher Bürger sich nichts vorschreiben läßt!