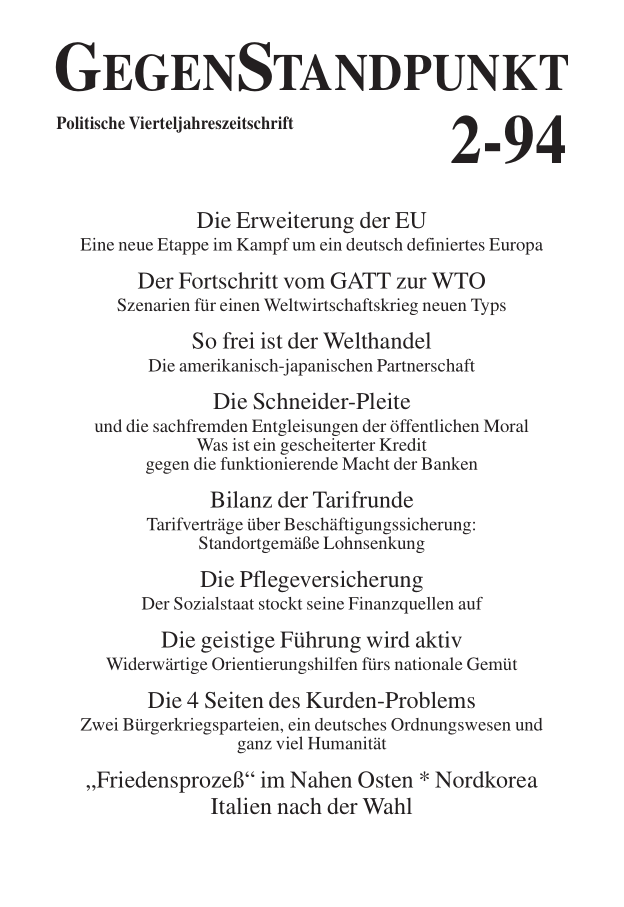Die Erweiterung der EU
Eine neue Etappe im Kampf um ein deutsch dominiertes Europa
Die Anträge Österreichs und der Nordstaaten (Schweden, Norwegen, Finnland) auf den EU-Beitritt besiegeln das Ende der EFTA. Mit der Kapitulation des Ostblocks waren der neutrale Status dieser Länder (Ausnahme: Norwegen) und ihr konkurrierendes Wirtschaftsbündnis hinfällig geworden. Deutschland beansprucht nach dem Anschluss der DDR naturwüchsig mehr „politisches Gewicht“ auch in Form der Federführung in dieser Erweiterungsrunde um „Nettozahler“; es drängt darüber seine europäischen Partner zur Überprüfung ihrer ökonomischen und politischen Bilanzen, zum Streit über die Ausgestaltung dieser Erweiterungsrunde und um ihre Positionen in der größer werdenden EU.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Gliederung
- I. Der Sieg der EU über die EFTA
- II. Die Auseinandersetzung innerhalb der EU um eine Erweiterung mit deutschen Führungsperspektiven
- 1. Die Streitgrundlage: Politökonomische Gegensätze im Gefolge der Krise
- 2. Das deutsche Änderungsprogramm – Das Europa der DM
- – Das „Europa der reichen Nationen“
- – Das Europa der „Ost-Erweiterung“
- 3. Der Widerstand in der EU
- 4. Der Streit um den institutionellen Umbau
- 5. Der Streit um Deutschlands Führungsrolle
- III. Schönes neues Europa!
Die Erweiterung der EU
Eine neue Etappe im Kampf um ein
deutsch dominiertes Europa
Im Zuge der Beitrittsverhandlungen ereiferten sich deutsche Journalisten im Verein mit dem Außenminister, daß sich „an ein paar tausend Tonnen Kabeljau nicht das Schicksal Europas entscheiden darf“; dieselben Journalisten, die sich wegen der paar Millionen Verluste deutscher Importeure über die neue Bananenmarktordnung nicht beruhigen wollen. Was bei Deutschland als berechtigte Ansprüche an den europäischen Handel und Wandel in Ordnung geht, ist bei anderen Nationen nationalistische Quertreiberei, die der gemeinsamen Sache Europa schadet. Daß Europa ein „Einigungswerk“ sein soll, in das alle beteiligten Staaten ihre Interessen einbringen, scheint deutschen Europafans nicht mehr geläufig. Die „Erweiterung der Gemeinschaft“ muß um jeden Preis über die Bühne gehen, auch wenn die Mitglieder in elementaren Fragen der Wirtschafts- und Währungsunion mehr denn je uneins sind und die Beitrittsfrage sie offen entzweit; erst einmal die internen Streitfragen beilegen und dann einvernehmlich über die Beitritte befinden, das kommt nicht in Frage – so der allgemeine Tenor.
Die Sicherheit ließ sich die Öffentlichkeit von der deutschen Politik vorgeben. Daß der Außenminister bis zum diplomatischen Eklat auf den Abschluß gedrängt hat; daß er bei einem Scheitern mit unabsehbaren Konsequenzen für ganz Europa gedroht hat und Spanien auf gut schwäbisch „das Rückgrat brechen“ wollte – das alles hat hiesige Journalisten bewogen, das von Deutschland beförderte Europa-Programm unhinterfragbar gut zu finden. Entsprechend fielen die Siegesmeldungen über das „erste diplomatische Meisterstück Kinkels auf der europäischen Bühne“ aus, die deutsche Blätter sich von Kinkel und Kohl in die Feder diktieren ließen:
„Der Bonner Außenminister, kämpferisch wie nie zuvor, wollte mit aller Macht den Erfolg. Er war es, der verhinderte, daß der entnervte Theodoros Pangalos, der den Vorsitz bei den Verhandlungen führte, den „Basar“ (Pangalos) vorzeitig abbrach. Der Deutsche gab diesmal unangefochten den Ton an.“ (Spiegel 10/94)
„… muß sich nicht nur Paris nun endgültig vom Ideal eines „West“-Europas verabschieden, das sich selbst bereitwillig als politisches wie wirtschaftliches Fundament für den Führungsanspruch Frankreichs begriff. Die Gemeinschaft wiederum zeigt so, daß sie bereit und fähig ist, sich zu verändern und ihre vergleichsweise bescheidene Nachkriegsrolle abzustreifen …
In diesem Sinne schickt es sich denn auch, wahrheitsgemäß zu berichten, daß die Brüsseler Verhandlungen die Stunde des Bonner Außenministers Klaus Kinkel waren. In Abwesenheit seiner Kollegen aus Frankreich und Großbritannien kam ihm unausgesprochen die Rolle des Regisseurs zu, und er nutzte sie, um den Erfolg der Verhandlungen fast herbeizuordern. Sie waren zu Beginn des Schlußtages praktisch gescheitert. Aber Kinkel ließ die Unterhändler einfach nicht von dannen ziehen. Sein Auftreten war heikel. Deutschland bereite seinen Hinterhof, so wurde geargwöhnt, zumal da ein finnischer Diplomat unbedacht bekannte, für sein Land gehe es in erster Linie darum, sich den Zugang zum deutschen Markt zu sichern. Es kann ja sein, daß sich das Epizentrum der Gemeinschaft mit ihrer Erweiterung über den Rhein hinweg verlagert. Aber dann ist es Sache der Deutschen, ihren Partnern vorzuleben und ihnen das Vertrauen darin einzuflößen, daß nationale Muskelspielerei nicht mehr in Betracht kommt.“ (Süddeutsche Zeitung 3.3.94)
Eine deutsche Öffentlichkeit, die bei jeder Gelegenheit den unseligen Brüsseler Zentralismus entdeckt, war mehr als zufrieden, daß sie Deutschland den Rang der europäischen Zentrale übertragen konnte, die die Führungsansprüche anderer zurechtstutzt und die gewachsene Macht Europas repräsentiert. – Und mokierte sich dann blauäugig über den verbreiteten Argwohn und die
„Skepsis europäischer Abgeordneter gegenüber vermuteten Gewichtsverschiebungen zugunsten Deutschlands nach einer Norderweiterung der Union“, wie wenn der auswärtige „Verdacht, in einer erweiterten Europäischen Union nehme die Bedeutung Deutschlands zu“ (Frankfurter Allgemeine 20.4.),
nicht lautstark verkündete Absicht und energisch eingefordertes Recht Deutschlands sowie der ganze Inhalt der öffentlichen Anteilnahme an der „Erweiterung der EU“ gewesen wäre.
Deutschland steht im Begriff, endgültig Frankreichs ewigen Führungsanspruch zu brechen und sich unwiderruflich als Vormacht Europas zu etablieren, der sich die anderen unterordnen! Mit diesem Anspruchsdenken eilte die Öffentlichkeit der Realität zwar weit voraus. Sie traf aber ganz den Geist der deutschen Politik und des von ihr betriebenen „europäischen Fortschritts“. Der soll nämlich mehr sein als eine bloße „Erweiterung“ der Union um 18 Millionen neue Angehörige und vier leistungsfähige Volkswirtschaften: Ein Stück Umwälzung Europas im deutschen Interesse.
I. Der Sieg der EU über die EFTA
Die Einordnung von vier Nationen in den europäischen Wirtschaftsblock
Diese Umwälzung betrifft zunächst die vier Länder, die sich jetzt der EU endgültig und vollständig anschließen wollen. Erbittert haben sie bis zuletzt um ihre Eintrittsbedingungen gestritten, um Fischereirechte, Agrarsubventionen, Regionalfonds, Transitabkommen, Beitragsverhältnisse… Dabei sind die ökonomischen Erwartungen und beanspruchten Rücksichten der anschlußwilligen Staaten von der EU wie lauter Sonderregelungsfälle behandelt worden, die bestenfalls eine ausnahms- oder übergangsweise Berücksichtigung verlangen können. Lauter nationale Rechnungen und Standortbemühungen, die diese Staaten bisher als Nichtmitglieder unternommen haben und die sie teilweise sogar mit der EU in Verträgen ausgehandelt hatten, sollen in dem Augenblick, wo sie Vollmitglieder werden wollen, hinfällig sein. Ihrer nationalen Rechnungsweise wird grundsätzlich keine „Konzession“ mehr gemacht. Die EU besteht gegenüber den Beitrittskandidaten auf dem „wichtigsten Grundsatz“, daß „die sofortige und vollständige Übernahme des Acquis Communautaire zum Beitrittszeitpunkt“ Voraussetzung des Beitritts ist. „Ausnahmen vom Acquis sind nicht vorgesehen“, egal wie die nationalen Gegebenheiten davon betroffen sind. Ihr „Europawille“ wird also überhaupt nicht honoriert, sondern sie werden mit ihrem Beitrittswillen erpreßt; von „Zusammenwachsen“ kann keine Rede sein.
Die Beitrittskandidaten verpflichten sich, ihre Wirtschaftspolitik entsprechend den EU-Konkurrenzregeln zu ändern, also alle möglichen bisher gewohnten Anstrengungen aufzugeben, mit denen sie den internationalen Erfolg ihrer heimischen Geschäftswelt befördert, staatlich für wichtig erachtete Wirtschaftsbereiche gegen die auswärtige Konkurrenz geschützt und nationale Bilanzposten gesichert haben. Das ist einerseits für sie nicht neu. Nationale Souveränitätsvorbehalte und wirtschaftspolitische Sonderbedürfnisse haben sie nämlich längst dem Interesse an wachsenden Geschäften mit dem mächtigen Wirtschaftsblock untergeordnet. Mit ihrer faktischen Orientierung an den Anforderungen des EG-Marktes haben sie schon vor ihren Beitrittsgesuchen dem Umstand Rechnung getragen, daß erfolgreiche Geschäftsbeziehungen von der Bewährung an den EU-Konkurrenzbedingungen abhängen. Und durch den Zusammenschluß mit der EU zum sogenannten Europäischen Wirtschaftsraum haben sie bereits den größten Teil der geltenden EU-Regelungen für den zwischenstaatlichen Geschäftsverkehr verbindlich übernommen.
Aber egal, wie weit diese Anpassung bisher schon gediehen ist, neu für die vier Staaten ist, daß sie mit dem Beitritt grundsätzlich und unwiderruflich ihre Souveränitätsverhältnisse ändern. Sie geben ihr Außenverhältnis zum Wirtschaftsblock, ihre bisher gewahrte Freiheit auf, das Verhältnis des nationalen Standorts zum Weltmarkt zu regeln, also nationale Bereiche der internationalen Konkurrenz auszusetzen oder mitunter auch ein Stück aus ihr herauszunehmen, Wirkungen dieser Konkurrenz zum Zuge kommen zu lassen oder mit staatlichen Geldern und Bestimmungen zu modifizieren. Durch den Beitritt sortieren sie sich als Teile eines Gemeinschaftsstandorts ein, unterwerfen die Beurteilung der Tauglichkeit ihrer heimischen Reichtumsquellen damit unwiderruflich und verbindlich den Maßstäben, die in der EU gelten, auch wenn das zur Folge hat, daß sie ganz neue Formen der Verarmung ihrer Bauern durchsetzen, ganze Landstriche veröden und Industriezweige brachlegen, also einiges in ihren staatlichen Bilanzen durcheinanderbringen. Und mit ihrer Eingliederung in das Finanzsystem der Gemeinschaft, durch das die Geschäfte übernational gefördert und ihre unterschiedlichen Wirkungen auf die verschiedenen Nationen betreut werden, wird nicht nur über ein Stück nationaler Haushaltsrechnung mitentschieden. Mit der Statuszuweisung als „Nettozahler“, die der Gemeinschaft zusätzliche Finanzmittel einbringen und für andere Nationalhaushalte die Aufwendungen verringern sollen, wird zugleich ihr Anspruch auf Maßnahmen und Haushaltsmittel beschränkt, durch die Geschäftsschäden insbesondere für die Landwirtschaft und benachteiligte Regionen kompensiert werden sollen. Sie werden nicht als Nationalökonomien eingestuft, deren Brauchbarkeit durch Gemeinschaftsanstrengungen erst hergestellt und laufend gesichert werden muß, sondern als unmittelbar lohnende Anlagesphäre für europäisches Kapital und als Staaten, die mit den Wirkungen auf ihre Nationalökonomie weitgehend selber fertig werden müssen. Das ist die neue Gemeinschaftsbasis, auf der die vier Staaten künftig konkurrieren, falls die Beitritte vollzogen werden.
Der angeblich so naturwüchsige „europäische Vereinigungsprozeß“ hat für diese Staaten insofern den Charakter einer regelrechten nationalen Umwälzung. Mit ihrem Beitritt verabschieden sie ihren bisherigen nationalen Erfolgsweg. Auch wenn ihre nationalen Geschäftsverhältnisse immer schon oder zunehmend in Abhängigkeit von den geschäftlichen Konjunkturen und politischen Regelungen des gemeinsamen Marktes standen – die sorgsam gewahrte nationale Selbständigkeit gegenüber dem vereinten Europa war ja keineswegs bloß formell oder Ergebnis eines immer weniger zeitgemäßen nationalen Eigensinns bzw. einer endlich beseitigten nationalen Beschränkung durch die alte Weltlage, wie jetzt Beitrittsbefürworter wissen wollen. Die Staatengemeinschaft hat nämlich ihre eigenständigen ökonomischen Rechnungen respektiert, in gewissem Sinn sogar mitgarantiert. Die geschäftlichen Beziehungen mit ihnen basierten auf Abmachungen, die eine Anerkennung ihrer Sonderinteressen und nationalen Sonderstellung einschlossen, so daß sie selber entscheiden konnten, wie sie von den Wachstumsfortschritten des gemeinsamen Marktes profitieren wollten. Ihnen standen nämlich neben dem und für ihr Verhältnis zur EG noch andere Mittel nationaler Bereicherung zur Verfügung. Erstens – teils freiwillig, teils mehr gezwungenermaßen – eine politische und damit auch ökonomische Sonderstellung gegenüber dem Osten: Insbesondere Finnland, Schweden und Österreich haben sich darüber bereichert, daß die Staatshandelsländer mit ihnen zu Sonderkonditionen verkehrten. Mit ihnen und über sie lief ein Gutteil des realsozialistischen Westhandels, und umgekehrt mußten sie ihre Ostgeschäfte keinen automatischen NATO-Rücksichten unterwerfen. Darüber hinaus stellten sie als geschäftsfähige kapitalistische Industrienationen ohne feste Blockeinbindung auch ein Angebot für das Interesse der Dritten Welt dar, sich ohne politische Beschränkung auszurüsten – nicht zuletzt mit Waffen, wie Schwedens und Österreichs Rüstungsindustrie bezeugen. Norwegen andererseits hat in seinem Ölgeschäft eine Quelle seiner ökonomischen Unabhängigkeit gesehen und gepflegt. Auf diese Grundlagen haben sich die Sonderrechnungen dieser Staaten gestützt; auf diese Sonderstellung gründete sich im übrigen auch ein Gutteil ihrer Attraktivität für die Europäische Gemeinschaft; und diese Sonderstellung haben sie durch die EFTA absichern wollen, also durch ein Wirtschaftsbündnis, das über die gemeinsame Regelung von Zöllen hinaus die nationale Wirtschaftspolitik nicht beschränkt.
Unter diesen alternativen europäischen Weg ziehen die Beitrittskandidaten einen definitiven Schlußstrich. Sie sind nämlich zu der Auffassung gelangt, daß die Fortführung der alten Rechnung nicht mehr zu haben bzw. nicht mehr nötig ist. Der politische Sonderstatus zwischen Ost und West, der diesen Länder vorgeschrieben war oder den sie sich selber gewählt hatten, ist mit dem Ende des Ostblocks unwiderruflich dahin. Hinfällig ist damit aber auch sein ökonomischer Nutzen. Die ehemaligen Staatshandelsländer sind für jedermann geschäftlich zugänglich; mit dem Zerfall der Nachfolgestaaten ist ihre Geschäftsfähigkeit weitgehend ruiniert; Geschäfte hängen daher von auswärtigem Interesse und Kredit und damit von der Fähigkeit der entsprechenden Staaten ab, diesen zur Verfügung zu stellen; und da machen sich Entschlossenheit und Vermögen der EU, insbesondere Deutschlands, geltend, sich die beschränkten Geschäftsgelegenheiten zu sichern, die der Osten eröffnet. Und die Dritte Welt ist geschäftlich ein- und untergeordnet und unterliegt einer neuen Aufsichtskonkurrenz, bei der bisherige Rüstungsgeschäfte und Sonderbeziehungen nicht mehr als prinzipiell nützlicher Beitrag zur Einbindung in den Westen geduldet werden.
Damit sehen sich die bisherigen Sonderfälle in Europa mit ihren geschäftlichen Bestrebungen in ganz neuem Maß auf die EU verwiesen. Es gibt für sie keinen durchschlagenden Grund für ihre Selbständigkeit mehr, umgekehrt aber einige gute Gründe, sich der EU anzuschließen. In dem Maße, wie sie für ihr nationales Wachstum auf den europäischen Markt verwiesen sind, den die EU-Staaten gemeinschaftlich organisieren, erscheint ihnen die Perspektive, lieber gleich ganz dabeizusein, verlockend: Schließlich enthält diese Alternative zu ihrer bisherigen Selbständigkeit das Angebot, daß sie beim Kampf um internationale Marktanteile neuen Zugang zum größten Markt erhalten, wenn sie sich dem Gemeinschaftsregime ganz unterstellen. Darüber hinaus sind sie damit am Protektionismus des Blocks nach außen beteiligt, dürfen entsprechend dem ihnen zugestandenen Gewicht künftig mitentscheiden über die politischen Organisation der Konkurrenz und können gleichberechtigt mitmachen beim Streit um die Anerkennung und Förderung nationaler Standortbedürfnisse von der Landwirtschaft bis zu den Währungsfragen.
Beflügelt wird diese neue Rechnung durch die Krisenerfahrungen, die den EFTA-Resten drastisch vor Augen geführt haben, wie sehr sie in ihren Wachstumsanstrengungen von den Geschäftsfortschritten und den Konjunkturen der politischen Standortregelungen abhängig sind. Kaum bleiben die Wachstumsfortschritte der EU wegen der Krisenlage aus, kommen auch ihre Bilanzen durcheinander. Nicht nur das; sie haben auch zu spüren bekommen, daß die Qualität ihres nationalen Geldes an der Verläßlichkeit der europäischen Geschäftsverhältnisse, an den Sicherheiten und Kreditgarantien, die sich die EU-Mitglieder in Währungsfragen leisten, und an dem Vertrauen hängt, das die Spekulationswelt in diese Garantien setzt. Als im Gefolge von Maastricht die gemeinschaftliche Betreuung der Euro-Gelder von Deutschland faktisch aufgekündigt wurde; als die Spekulationswelt daraufhin die Nationalkredite nach ihrer eigenen Geschäftsfähigkeit in Konkurrenz zu anderen Euro-Krediten und insbesondere zur DM beurteilt hat, sind die Währungen von Schweden und Finnland schlagartig als schlechtes Geld bewertet worden: An den Währungsblock angebunden, aber außerhalb des EWS stehend, waren bei ihnen noch weniger als bei den Nationalkrediten der Gemeinschaftsmitglieder währungspolitische Rücksichtnahmen der Bundesbank abzusehen, daher ist gegen sie spekuliert worden. Durch die Kündigungen der DM-Hüter sind sie also ihrer beschränkten Souveränität über ihren Nationalkredit überführt worden. Umgekehrt hat sich der österreichische Schilling nur deshalb behauptet, weil er sowieso an die DM „angebunden“, also gar nicht Gegenstand einer eigenen, souveränen Wirtschafts- und Geldpolitik ist. Da ihre Bilanzen an den politischen Regelungen des Wirtschaftsblocks, also am Grad der Zulassung oder des Ausschlusses von den Geschäftsgelegenheiten auf dem Binnenmarkt hängen, müssen die außenstehenden Länder darüber hinaus befürchten, daß sie in der Krise zu Verlierern der Standortkonkurrenz innerhalb der EU und des Blocks gegen außen werden, weil unsicher wird, wieweit ihnen der gemeinsame Markt als Geschäftsraum offensteht, um ihre geschrumpften Geschäftsbilanzen zu verbessern.
Im Gefolge der Krise haben sich maßgebliche Kreise daher endgültig zu der Auffassung durchgerungen, daß der nationale Selbständigkeitsstandpunkt haltlos geworden ist. Die Beitrittsverhandlungen haben sie weniger im Bewußtsein eines großartigen nationalen Aufbruchs als aus dem Leiden heraus geführt, daß sie ihre wirtschaftspolitische Freiheit schon viel weiter als gedacht verloren haben. Von einer Europa-Euphorie in diesen Ländern kann keine Rede sein. Die Politiker warnen laufend eine gar nicht begeisterte Öffentlichkeit, daß ohne Beitritt die ökonomische Lage auf jeden Fall unhaltbar würde. In welche Lage sie sich mit dem Beitritt begeben, darüber legen sie in ihrem Setzen auf den überlegenen Wirtschaftsblock sich und ihren Völkern keine Rechenschaft ab. Die Aufgabe ihres bisherigen ökonomischen Nationalismus hat für sie den Charakter einer zwar risikoreichen, aber letztlich unausweichlichen Neuorientierung.[1]
Zweitens verfolgen die EU-Anwärter mit ihrem Eingliederungswillen eine umfassende politische Neuausrichtung; mit dem Zusammenbruch des Ostens haben sie nämlich auch ihre politische Sonderstellung zwischen Ost und West verloren. Für sie sind Beschränkungen, aber auch Freiheiten verlorengegangen, auf die sich – Norwegen mit seiner NATO-Zugehörigkeit ausgenommen – ihre „Neutralität“ gegründet hat: Zugehörig zum Westen, waren sie zugleich bevorzugte Adresse östlicher Koexistenzwünsche und Sicherheitsverlangen, pflegten Sonderbeziehungen zu Drittweltstaaten und Blockfreien, waren Standort und Vertretung internationaler Institutionen. Egal, ob sie den Wegfall des Ostblocks wie Österreich und Finnland mehr als Befreiung von aufgezwungener Zurückhaltung verstehen oder wie Schweden mehr als Hinfälligwerden einer freiwilligen Abgrenzung von der NATO, mit der man immer schon eng kooperiert hat: Sie sehen sich einer neuen weltpolitischen Lage, einer Konkurrenz um die Beaufsichtigung der Staatenwelt durch die führenden Nationen gegenüber, an der sie sich beteiligen wollen, aber mit ihren begrenzten Kräften gar nicht können. Das ist der Kern ihrer Sorge vor „Isolierung“, die die Kandidaten bei allen Unterschieden eint.[2] Die Berechnung, im Block an Sicherheit und Zuständigkeit nur gewinnen zu können, setzt dabei auf besondere Aufgaben, die sie in der EU wahrnehmen und mit denen sie ihr Gewicht bekommen könnten: die Beaufsichtigung und Eingliederung des Baltikums, bzw. des östlichen Staatenvorfelds Rußlands von Polen bis zum Balkan. Ihre alte Sonderrolle wollen sie neu produktiv machen, indem sie jetzt mit der EU im Rücken den Osten mitbetreuen. Diese weltpolitische Perspektive beflügelt ihren Drang zum vereinten Europa mindestens so sehr wie ihre Wachstumserwartungen im gemeinsamen Markt.
Die nationale Neusortierung, die den langen „Prozeß der Annäherung und des Zusammenwachsens“ abschließt, hat in diesen Staaten noch einmal eine aufgeregte Diskussion über die politische Grundausrichtung provoziert und einen alternativen Nationalismus hervorgebracht, der mit Berufung auf die Vorzüge ihrer bisherigen Selbständigkeit den Beitritt als Souveränitätsverlust beklagt. Was sich da zu Wort meldet, ist keine normale Opposition, sondern eine radikale Kritik, die die politische Krise dieser Länder bezeugt: Das verläßliche staatliche Weiß-Warum ist unsicher geworden, der gewohnte Handel und Wandel steht in Frage, die nationalen Bedingungen werden umgewälzt, und zugleich gibt die Regierung zu Protokoll, daß es gar nicht mehr in ihrer Macht liegen soll, wie die nationale Lage künftig beschaffen sein soll. Sie wirbt für den Anschluß an Europa mit dem für Nationalisten schwer eingängigen Argument, der Staat würde an Macht gewinnen, indem er auf ihren eigenständigen Gebrauch verzichtet. Der Vorteil der Nation soll ausgerechnet darin liegen, daß sie auf große Teile ihrer Souveränität verzichtet, und das deshalb, weil sie sie sowieso schon verloren hat. Das Eingeständnis der Ohnmacht soll man ausgerechnet als Garantie künftigen nationalen Vorankommens auffassen. Diese Zwiespältigkeit des Anschlußprogramms sorgt für entsprechende Aufregung, wobei die zur Verhandlung stehenden Besonderheiten der Staaten vom Bergbauern bis zur Stahlindustrie, vom Quarkstrudel bis zum Kautabak, vom Sozialstaat bis zur außenpolitischen Ausrichtung das Material bieten. Der Schlußstrich, der unter die alten Staatsverhältnisse gezogen werden soll, wird in eine Preisfrage übersetzt – Was kostet der Anschluß an die EU und was bringt er? –, ohne daß Befürworter wie Kritiker darauf eine Nationalisten überzeugende Antwort geben könnten.
Die soll ausgerechnet das Volk selber geben, das aufgerufen ist, über die nationale Frage abzustimmen. Das ist keine übliche demokratische Praxis, sondern Konsequenz der politischen Ausnahmesituation: Die befugten Politiker wollen durch außergewöhnliche Entscheidungsprozeduren die Verläßlichkeit des politischen Kurses sichern, wo sie gerade alles Verläßliche durcheinanderbringen. Sie wollen ihren politischen Zwiespalt klären und die notwendige nationale Geschlossenheit sicherstellen, machen sich damit aber von einer zwiespältigen Gemütslage ihrer Untertanen abhängig, die sie selber aufgerührt haben. Das Volk hält ja seine Betroffenheit und die der Nation überhaupt nicht auseinander, verwechselt daher den Beitrittsstreit mit einem mehr oder weniger entschiedenen Einsatz der Politik für die Belange der Bauern oder Fischer und klagt die Politiker deshalb des nationalen Verrats an. Daher verwandelt sich jede Auseinandersetzung über berechtigte und unberechtigte, erfüllte und unerfüllte Beitrittserwartungen in den nationalistischen Streit, ob ihre Eigenständigkeit als Norweger, Finnen, Österreicher, Schweden überhaupt noch zum Zuge kommt. Und bei der positiven Beantwortung dieser Frage muten die Regierungen mit ihrer Propaganda für den Anschluß ans größere Europa ihren Völkern einiges zu: Schließlich rufen sie im Namen der Nation zur Einschränkung des Nationalismus auf.[3] Als überzeugte Anhänger des jeweiligen Staatskollektivs sollen die Bürger ihr Nationalgefühl zügeln und sich für die Unterordnung ihres Landes unter ein größeres Europa aussprechen, das alle gewohnten nationalen Herrschaftsverhältnisse gründlich durcheinanderzubringen verspricht. Das demokratische Verfahren, das die Nation einen soll, stiftet daher Gegensätze unter den Nationalisten; es macht die Neuausrichtung fragwürdig, statt sie für jedermann verbindlich zu entscheiden.[4]
II. Die Auseinandersetzung innerhalb der EU um eine Erweiterung mit deutschen Führungsperspektiven
1. Die Streitgrundlage: Politökonomische Gegensätze im Gefolge der Krise
Auch zwischen den entscheidungsberechtigten 12 Staaten selber fand eine erbitterte Konkurrenz um die Ausgestaltung der Beitrittsbedingungen statt. Und auch zwischen ihnen ging es dabei um viel mehr. Der Beschluß, das exklusive Zugriffsrecht des europäischen Wirtschaftsblocks auf vier entwickelte „Industrieländer“ mit einer „leistungsfähigen, gesunden Volkswirtschaft“ auszuweiten, war kein Werk gemeinsamer Überzeugung. In der Frage der EU-Erweiterung sind gar keine sich positiv ergänzenden Standortrechnungen zwischen den Mitgliedsländern zur Sprache gekommen und ausgestritten worden. Die Beitrittsanträge, angeblich Beweis der unschlagbaren Attraktivität und Gelegenheit zum harmonischen Weiterwachsen des vereinigten Europa, treffen die Gemeinschaft nämlich in einer ökonomischen Krisen- und politischen Zerwürfnissituation: Es herrscht generelle Unzufriedenheit mit dem Gang der Geschäfte, und die Mitglieder der Gemeinschaft machen sich wechselseitig die verringerten Geschäftsgelegenheiten auf dem gemeinsamen Markt und außerhalb streitig. Mit den Beitritten findet also nicht einfach eine Erweiterung der Geschäftsmöglichkeiten für jede beteiligte Nation auf der Grundlage allseitigen Wachstums statt, sondern mit der Öffnung der Beitrittsländer werden zugleich Konkurrenten weit mehr als bisher auf einen prinzipiell erschlossenen und überfüllten Markt zugelassen, auf dem die Mitgliedsnationen mit den politischen Instrumentarien der EU sowieso schon um Geschäftsgelegenheiten konkurrieren, die für die Wachstumsbedürfnisse aller beteiligten Nationen nicht mehr ausreichen. Und es ordnen sich nicht einfach vier weitere Währungen in ein System von Kreditgarantien ein, das die Zahlungsfähigkeit aller Staaten gewährleistet und damit jedem nationalen Geld seinen verläßlichen Wert sichert. Denn mit den Maastricht-Beschlüssen sind ja gerade nicht die projektierten Fortschritte der Gemeinschaft hin zu einer Einheitswährung vorangekommen, sondern die Nationalkredite dem Anspruch ausgesetzt worden, sich als tauglich für die Beteiligung an einer künftigen Euro-Währung zu beweisen. Angesichts der daraufhin einsetzenden Spekulation auf die DM ist die Währungsunion von Deutschland bekanntlich ausgesetzt worden; die auf Konsolidierung ihrer nationalen Bilanzen verpflichteten Staaten konkurrieren jetzt ohne verläßliche EWS-Garantien um die Geschäftsfähigkeit ihrer Nationalkredite.[5]
Der Streit um die Erweiterung beweist, wie sehr sich die EU-Länder dabei unterscheiden, wie groß die ökonomischen Unterschiede sind, die 40 Jahre gemeinsames Europa mit seinen Fortschritten zustandegebracht haben. Sie reichen viel weiter als die Differenzen in diesem oder jenem nationalen Bilanzposten: Sie betreffen die Qualität ganzer Nationalökonomien. Die Beitrittsfrage hat für alle Nationen die Frage aufgeworfen, wie sie in ihren jeweiligen Geschäftsrechnungen betroffen sind – und die unterschiedlichen Antworten haben zutage gefördert, wie einseitig sich inzwischen Nutzen und Schaden verteilen. Das ist das eine.
Das andere ist, was die verschiedenen Nationen daraus an Konsequenzen ableiten, zu welch gegensätzlichen Standortbemühungen im Bezug auf Europa sie sich bemüßigt sehen und welche widerstreitenden politischen Perspektiven sie damit verbinden. Die programmatischen Gegensätze in den Verhandlungen sowie die wechselnden Kontrahenten zeigen, wie tiefgreifend unter dem Titel „Erweiterung“ bisherige europäische Gegebenheiten in Frage gestellt worden sind und wer sich dabei als Aktivist und wer als Betroffener verstanden hat: Es war Deutschland, das mit seinen Erweiterungsperspektiven seine „Partner“ herausgefordert hat – Spanien als Vertreter der Südländer; Großbritannien als Nation, deren Großmachtinteressen durch die Gemeinschaft prinzipiell nicht befriedigt werden; Frankreich als konkurrierende Führungsmacht.
2. Das deutsche Änderungsprogramm – Das Europa der DM
„Ich habe in der Nachtverhandlung erklärt, daß es wirklich nicht richtig sein kann, daß wir hier über Dimensionen verhandeln und sprechen, die 2, 3, 4 Millionen ECU ausmachen. Daran darf der Beitritt Norwegens nicht scheitern… Die jetzige Erweiterungsrunde geht nicht zu Lasten der südlichen Länder Europas. Diese werden ebenso wie alle übrigen Mitgliedstaaten und die neuen Mitglieder davon profitieren, daß die Europäische Union politisch, wirtschaftlich und kulturell durch Hinzutreten von vier erprobten demokratischen Staaten mit leistungsfähigen, dem freien Welthandel verpflichteten Volkswirtschaften gestärkt wird … Die erweiterte Europäische Union wird den größten Markt der Welt darstellen, mit 370 Millionen Menschen und einer deutlich höheren Wirtschaftskraft als die USA oder Japan… Es gibt kein großes Industrie- und Wirtschaftsland auf dieser Erde, das vergleichbar so wie Deutschland wirtschaftlich von einer einzigen Region, nämlich Europa abhängig ist.“ (Kinkel, Erklärung der Bundesregierung vom 10.3.94)
Interessante Auskünfte aus berufenem Mund. Auf die Idee, die Bedenken anderer Länder dadurch auszuräumen, daß er die paar Millionen aus deutscher Kasse zuschießt, wenn es Deutschland schon so dringlich auf ein Gelingen der Erweiterung ankommt, kommt der deutsche Außenminister jedenfalls nicht. Er erklärt die Sorge um nationale Bilanzen einfach für keinen berücksichtigenswerten Einwand. Jedem, der besondere Sphären als nationale Geldquelle sichern will, tritt der deutsche Außenminister einerseits mit der trockenen Versicherung entgegen, solche Bemühungen seien völlig überflüssig, weil sowieso alle nur gewinnen; Bereicherungsmittel einer Nation sei eben nicht dieses oder jenes zusätzliche Geschäft in einzelnen Sphären, sondern die Möglichkeit zu vermehrten Geschäften überhaupt. Andererseits führt er die Abhängigkeit Deutschlands vom europäischen Markt ins Feld, so daß das deutsche Interesse an der Erweiterung wie ein Zwang erscheint, dem sich zu widersetzen eine vitale Schädigung dieses Landes darstellt. Jede Streitpartei, die auf bestimmte nationale Bilanzposten pocht und das elementare nationale Interesse daran berücksichtigt haben will, wird so gleich doppelt zurechtgewiesen – unbeschadet dessen, daß Deutschland bei anderer Gelegenheit genauso entschieden um die politische Berücksichtigung für wichtig erachteter deutscher Geschäftssphären feilscht. In der Frage der Erweiterung vertritt Kinkel die apodiktische Auffassung, es käme auf keine einzelne Rechnung mit lohnenden Fangquoten, Agrarsubventionen usw. an, ja überhaupt auf keine nationale Bilanz, sondern auf die Ausweitung der Geschäftsmöglichkeiten an und für sich, derer sich die Kapitalisten rein nach den Kriterien der Rentabilität bedienen sollen.
Der Vertreter Deutschlands stellt sich damit scheinbar ohne jeden nationalen Vorbehalt auf den Standpunkt des Wirtschaftsblocks als solchen: Durch Erweiterung der Grenzen der Gemeinschaft sollen immer mehr Geschäftsgelegenheiten unter einem einheitlichen politischen Kommando versammelt werden; im Innern soll ohne beschränkende Dazwischenkunft nationaler Gewalten allein die Fähigkeit der Unternehmen den Ausschlag geben, sich in der Konkurrenz um Kosten und Überschuß zu bewähren. Zugleich soll gegenüber außen per staatlicher Gewalt der Zugang zu diesem Markt kontrolliert und modifiziert, umgekehrt der Zugriff auf auswärtige Geschäftsquellen zu möglichst günstigen Bedingungen eröffnet werden. Für diese erweiterte Wucht des gemeinsamen Marktes macht sich Deutschlands Außenminister stark, wie wenn die Verfügung der Staatengemeinschaft über einen größeren Geschäftsraum mit einem vermehrten Nutzen der Einzelnationen automatisch zusammenfiele und Deutschland gar keine gesonderten Konkurrenzinteressen zu verteidigen hätte.
Die Erweiterung selber ist nämlich das spezielle deutsche Konkurrenzinteresse. Deutschlands Macher setzen darauf, daß das, was im erweiterten Markt für jede Nation an Geschäft zustande kommt, nicht davon abhängig ist, was im einzelnen alles in dieser oder jener Abteilung geht, sondern daß sich das vor allem anderen daran entscheidet, wer sich überall konkurrenzentscheidenden Zugang verschaffen kann, wer also über genügend Kapital und Kredit verfügt, um sich tendenziell aller Geschäftsgelegenheiten zu bedienen; kurz: daß es eine Frage der Kapitalproduktivität, der Kapitalgröße und des Nationalkredits, also der erreichten ökonomischen Wucht der Nation ist. Und da setzen die Herren über das deutsche Geld auf Deutschlands Sonderstellung: Deutsche Multis sind allenthalben mitführend, wenn es gilt, sich in der Konkurrenz zu bewähren oder in ihr Maßstäbe zu setzen. Der deutsche Nationalkredit ist Hauptgeschäftsmittel und Reservewährung, der Qualität und Masse nach führender Euro-Kredit, so daß alle Gelder und ihre politischen Verwalter von deutschem Kredit und deutschen Kreditbeschlüssen abhängig sind. Die Krise hat ja aufgedeckt, welche Abhängigkeitsverhältnisse gegenüber dem deutschen Geld existieren, denen sich keine europäische Nation mehr entziehen kann und die den deutschen Staat mit einer ausnahmsweisen Verschuldungsfreiheit ausstatten. Das macht Deutschland – jedenfalls nach Auffassung und Anspruch seiner politischen Verwalter – quasi automatisch zum umfassenden Nutznießer der Erweiterung. Sie bauen darauf, daß ihr Staat mit der größten Nationalökonomie und dem gefragtesten Geld auf jeden Fall gewinnt, wenn Staaten sich dem Konkurrenzvergleich zu Bedingungen öffnen, unter denen Deutschland zur führenden europäischen Wirtschaftsnation aufgestiegen ist.
Damit haben sie nicht einfach eine ökonomische Wahrheit ausgesprochen, sondern das Konkurrenzprogramm einer ökonomischen Vormacht: Deutschland will sich als Krisengewinnler etablieren, mit seinem umfassenden Zugriff auf alle ökonomischen Potenzen in Europa und einer vergrößerten Marktmacht gegenüber den Hauptkonkurrenten USA und Japan die Sonderstellung der DM nach innen stärken und Europa als DM-Zone ausbauen. Dem soll sich jede Sonderrechnung unterordnen; dahinter soll jedes nationale Bedenken anderswo zurückstehen, das diesen erweiterten Zugriff durchkreuzen könnte. So der prinzipielle Standpunkt, mit dem Kinkel die Verhandlungen geführt hat.
– Das „Europa der reichen Nationen“
Bei diesem Programm meinen Deutschlands Erweiterungsfanatiker ganz speziell auf die vier Beitrittskandidaten bauen zu können.
„Außerdem werden drei Beitrittsländer, vielleicht auch Finnland, Nettozahler sein… Der Beitritt wirtschaftsstarker europäischer Nachbarn wird auf mittlere Sicht zu unserer, zur deutschen Entlastung beitragen… Die Aufnahme der drei nordischen Staaten und Österreichs in die Union ist ein wesentlicher Schritt auf dem Weg, die Balance in Europa wiederherzustellen. Die Bundesregierung hat sich nie mit einem Konzept der Westunion oder einer Südunion identifiziert; sie hat sich zum ganzen Europa bekannt.“ (Kinkel-Erklärung)
Das Bild, Deutschland entlaste sich mit den Beitritten leistungsstarker „Nettozahler“ endlich ein Stück von seinen Beitragsbürden, drückt mehr aus als die Hoffnung auf Ersparung von ein paar Milliarden, die andere Staaten aufbringen und Deutschland für sich beschlagnahmt. Es bezeichnet eine geänderte Rechnungsweise deutscher Europapolitik: Die Bonner Beitrittsprotagonisten setzen auf den Zuwachs durch Staaten, die dank ihrer eigenen ökonomischen Stärke umfassend geschäftlich benutzbar sind und über ein verläßliches, an der DM orientiertes Geld verfügen. Sie gehen unbesehen davon aus, daß die endgültige Eingemeindung der vier Staaten der Europäischen Union und insbesondere Deutschland den Zugriff auf ein garantiert verlockendes, aus den bisherigen Bilanzen hochzurechnendes zusätzliches Volumen an Marktgelegenheiten und Zahlungsfähigkeit erschließt, dessen man sich nur zu bedienen braucht.
Umgekehrt definieren sie die bisherigen Verfahren, den Umkreis deutschen Geschäfts mit Hilfe der EG bzw. EU auszuweiten, als eine einzige Belastung. Wie bisher Staaten geschäftsfähig zu machen und zu erhalten, erscheint ihnen zu teuer, weil das nach ihrem Geschmack viel zu wenig zur Verbesserung deutscher Bilanzen beiträgt und sie viel zu sehr strapaziert. Das ist nicht Ergebnis einer vernünftigen Rechnung, sondern einer ziemlich anmaßenden neuen Betrachtungsweise, die sich die deutschen Macher im Gefolge der auch deutsche Bilanzen schädigenden Krise endgültig zu eigen gemacht haben: Für lohnend in Europa wird nur erachtet, was sich unmittelbar in deutschen Geschäften niederzuschlagen verspricht. Der „größte Nettozahler der Gemeinschaft“ steht nicht mehr auf dem Standpunkt, daß er mit seinen Gemeinschaftszahlungen die Brauchbarkeit von EG-Staaten entwickeln und betreuen muß, weil und damit er davon immerzu profitiert, und daß er seinen Nationalkredit immerzu im Rahmen von feststehenden Gemeinschaftsverpflichtungen zur Verfügung stellen soll, um andere Währungen verläßlich zu halten und anderen Staaten ihre Zahlungsfähigkeit zu sichern.
Damit unterzieht der mit dem europäischen Markt zum „ökonomischen Riesen“ aufgewachsene Konkurrenzgewinner das bisherige Ideal einer „Angleichung“, die alle Länder immer mehr zusammenwachsen und den Nationalismus immer überflüssiger werden lassen sollte, und die dazugehörige Praxis einer radikalen Kritik. Wirklich gemeint und betrieben wurde mit der „Süderweiterung“ die Erschließung und Durchorganisation ganzer Länder für die Bedürfnisse profitabler Kapitalanlage, wozu diese Staaten auf sich gestellt nur bedingt oder gar nicht fähig waren. Diese gesamteuropäische Geschäftsförderung, von der Deutschland dank seiner Stellung in Europa mehr als andere profitiert hat, wird jetzt der Prüfung ausgesetzt, was sie eigentlich zur Verbesserung der deutschen Bilanzen taugt, eine Prüfung, die schon deswegen negativ ausfällt, weil sie aus dem Geist der Unzufriedenheit mit sämtlichen Erträgen angestellt wird. In diesem Geist mustert man die Nationen durch, die dank der kritisierten Entwicklungsbemühungen deutschem Zugriff offen stehen – und prompt erweist sich dasselbe Spanien, das bis gestern lukrative Anlagesphäre war, als insgesamt viel zu wenig lohnender Standort und dauernde Belastung des deutschen Haushalts. Jetzt, wo sie umfassend erschlossen sind, wo sie mehr denn je von deutschen Standortentscheidungen und Krediten abhängen, genügen solche Länder deutschen Ertragsansprüchen nicht mehr, die mit der Krise nicht bescheidener, sondern fordernder geworden sind. Deswegen nimmt der Hauptprofiteur der Gemeinschaft programmatisch Abschied von der Förderung der unter dem Dach der EU versammelten Ressourcen und macht sich dafür stark, die „Phase der Süderweiterung abzuschließen“.
Deutschland stellt sich damit auch polemisch dagegen, daß die gemeinschaftlich organisierte Rücksichtnahme auf nationale Bilanzen und die Pflege betroffener Geschäftssphären mit Gemeinschaftskrediten überhaupt der gute Grund der Konkurrenzverlierer war, in der EU mitzumachen. Das Versprechen, den Süden ans Europaniveau heranzuführen, war mit der Drohung mit einem „Europa der 2 Geschwindigkeiten“ – einem Kerneuropa, das sich zu einem ökonomisch leistungsfähigen Verbund zusammenschließt, und einem Rest von Staaten, die sich mit minderen Rechten und Garantien als abhängige Größen dazusortieren – im Grunde bereits verabschiedet. Daß das keine leere Drohung war, zeigt sich an der Perspektive der jetzigen Erweiterung, aus der der „größte Nettozahler der Gemeinschaft“ gar kein Geheimnis macht: Die Sortierung in ein Europa der „reichen“ Nationen und ein Umfeld von untergeordneten „armen“ Ländern, die nur noch mit begrenzter Förderung zu rechnen haben.
Ob die deutsche Erwartung aufgeht, Europa würde sich ganz automatisch und noch viel mehr als Quelle deutschen Geschäfts bewähren, wenn es nach den Bedürfnissen deutscher Ertragswut radikal durchsortiert wird, ist mehr als fraglich. Deutschland verlangt nämlich im Grund Unmögliches: Die vier Kandidaten sollen ihre nationalen Ressourcen den EU-Vorgaben unterwerfen und zugleich als ein quasi kostenloser Zuwachs für Deutschlands Bilanz funktionieren, wie wenn nicht durch den Beitritt auch einiges an bisherigem Wachstum und Zahlungsfähigkeit zum Erliegen kommt, manche Geschäftsgelegenheit der neuen Konkurrenz zum Opfer fällt, umgekehrt aber auch manche deutsche Unternehmung sich neuer Konkurrenten zu erwehren hat. Ungerührt behandeln die deutschen Erweiterungsfans jetzt die erhofften Neuzugänge wie eine einzige riesige Geschäftsgelegenheit, genauso wie sie vor einigen Jahren Spanien und Co., die sie jetzt nur noch für zweite oder dritte Wahl halten, als den europäischen Zuwachs begrüßt haben. Umgekehrt soll der Süden auch ohne laufende Standortförderung und feste Kreditgarantien wie bisher seinen Teil zur deutschen Europabilanz beitragen.
Nicht fraglich ist bei solchen Ansprüchen allerdings der Streit um die Erträge, die die deutschen Erwartungen nie und nimmer zufriedenstellen. Denn auf den Automatismus seines überlegenen Geldes verläßt sich Deutschland andererseits ja überhaupt nicht. Vom Agrarhaushalt über die Bananenordnung bis zum Ost-Förderungsprogramm der Gemeinschaft, bei dem die deutsche Regierung auf einer unmittelbaren Förderung deutschen Kapitals nach seinen politischen Gesichtspunkten statt auf einer Finanzierung nach den Standortkriterien des EU-Infrastrukturprogramms besteht, – immerzu wirft es sein ganzes Gewicht in die Waagschale, um seine speziellen Standortinteressen und Ertragsgesichtspunkte durchzusetzen. So führt der deutsche Fanatismus des Profits unweigerlich zum politischen Kampf um seine garantiert deutsche Gestalt.
Im übrigen weist Kinkels Beschwerde über die korrekturbedürftige Westlastigkeit der Union darauf hin, daß Deutschland auch politisch die bisherige Konstruktion des Staatenbündnisses längst als eine einzige Beschränkung versteht. Für ausbalanciert hält er Europa offenbar erst, wenn Deutschlands führende Stellung gegenüber Frankreichs und Großbritanniens in der Union ganz anders zum Tragen kommt. Entsprechend sehen die weiteren Perspektiven der europäischen Erweiterung aus, die die deutschen Europapolitiker entwerfen und betreiben.
– Das Europa der „Ost-Erweiterung“
Dieselben deutschen Politiker, die den Süden für eine einzige Belastung halten, scheuen andererseits vor neuen europäischen Belastungen überhaupt nicht zurück, wenn sie ihnen eine speziell deutsche Seite abgewinnen können.
„Die jetzige Erweiterungsrunde wird und darf daher nicht die letzte sein. Die Erweiterung wird – das ist ganz wichtig – auch ein ermutigendes Signal an die Reformdemokratien in Mittel- und Osteuropa geben, daß die Union eben keine geschlossene Gesellschaft der Reichen und der Sicheren ist.“ (Kinkel-Erklärung)
Statt der „Vertiefung“ der vorhandenen Beziehungen zum entwicklungsbedürftigen Süden planen sie eine Osterweiterung der EU vom Baltikum bis zum Balkan, wobei sie wie selbstverständlich auf die Interessen und Sonderbeziehungen der skandinavischen Staaten – „Nicht nur das Mittelmeer, auch die Ostsee ist europäisches Meer“ (Kohl) – und Österreichs setzen. Sie verstehen nämlich das vergrößerte Deutschland als erste Adresse und ersten Nutznießer des passiven Imperialismus der Ostländer – ihres Willens, durch ökonomische, politische und militärische Angliederung an die Bündnisse der reichen und mächtigen Staaten des Westens national voranzukommen. Deshalb definieren sie die erweiterte Gemeinschaft mit ihrer neuen „Nordausrichtung“ schon wieder als unfertig und unbedingt erweiterungsbedürftig – wenn das andere machen würden, deutsche Gemüter würden die nationalistischen Ambitionen sofort durchschauen und geißeln.
Damit nimmt Deutschland ein weiteres Stück Umorientierung der EU in Angriff: Der Block soll in den ehemaligen Machtbereich der Sowjetunion ausgreifen und die neuen Nationalstaaten an sich binden. Dafür diskutieren deutsche Politiker von Stoiber bis Scharping einen neuen Sonderstatus, der diese Länder – außer ihrer Anbindung an NATO und WEU – auch in die EU einsortiert, ihnen aber die vollen Rechte, also den gesicherten Anspruch auf Förderung und Mitsprache vorenthält. So gewinnt Deutschland dem Erschließungsstandpunkt dann doch wieder einiges ab: Mit EU-Gelder statt bloß immerzu mit deutschem Staatskredit Wachstum im Osten fördern, das deutsche Geschäfte beflügelt; Länder an Deutschland binden, ohne dafür ständig den deutschen Haushalt zu strapazieren; solide Schuldner und verläßliche politische Nationen stiften, die sich wie selbstverständlich an Deutschland ausrichten und EU und WEU stärken, ohne sie mit ihren nationalen Ansprüchen zu belasten – so ungefähr sieht die deutsche Perspektive aus. Sie zeugt vom gewachsenen deutschen Anspruchsdenken, das auch noch die Ostländer als speziell deutschen Machtzuwachs im europäischen Block verplant und sich um die Gegensätze wenig kümmert, die dieses Programm unweigerlich eröffnet. Schließlich handelt es sich dabei gar nicht um eine politökonomische Rechnung, sondern um ein Europaprojekt generellerer Natur: Mit Hilfe der EU will Deutschland seinen Zugewinn an Einfluß und Raum im Osten mit anderen als den Mitteln der Wiedervereinigung fortsetzen. Eine ganz als Vorfeld Deutschlands definierte Staatenregion soll mit Geldern, Einfluß und Institutionen der EU verläßlich eingerichtet und damit Deutschlands Sonderstellung gegenüber diesen Ländern gefestigt werden. In diesem imperialistischen Sinn wird der europäische Süden als die bisherige Hauptsphäre gemeinschaftlicher Erschließungsbemühungen ein Stück „an den entfernten Rand“ gedrängt, wo er nach den geopolitischen Vorstellungen Deutschlands neuerdings in einer richtigen europäischen Ordnung hingehört.
3. Der Widerstand in der EU
Gegen dieses Erweiterungsprogramm haben sich die davon hauptsächlich betroffenen Staaten in den Beitrittsverhandlungen zur Wehr gesetzt. Allen voran Spanien hat erbittert darum gekämpft, sich politische Geschäftsgarantien in Form von Fischfangquoten zu verschaffen, sich zusätzliche Gelder aus den vergrößerten Gemeinschaftsfonds zu sichern, den neuen Mitgliedern aber möglichst alle Ansprüche auf Gemeinschaftsmittel zu versagen und sie von der Beschlußfassung über die Umsetzung des in Maastricht beschlossenen Programms auszuschließen. Wenn es nach Spanien gegangen wäre, wären die vier Kandidaten mit viel weiter gehenden Ansprüchen konfrontiert worden, egal ob, ja eher damit die Beitrittsverhandlungen daran scheitern. Gemeint war bei all den Streitpunkten nämlich immer mehr: Spaniens gesamte politökonomische Rechnung mit der EU ist gefährdet. Seine Nationalökonomie beruht ja nur bedingt auf den Leistungen heimischen Kapitals, sie ist weitgehend abhängig von den positiven Standortentscheidungen eines nach erweiterten Anlagesphären suchenden europäischen Kapitals. Abhängig daher aber auch von den Anstrengungen, die die Gemeinschaft für eine umfassende Entwicklung des Standorts Europa unternimmt, und davon, wieviel Spanien davon auf sich zu ziehen vermag. Deshalb sind die Fonds für Spanien ein entscheidender Haushaltsposten und zugleich der Ausweis, daß seine Geschäftsfähigkeit allgemeines Interesse und förderungswürdiges Projekt des gesamten Wirtschaftsblocks ist und bleibt. Insofern ist dieses Land elementar betroffen vom Stocken der Geschäfte und von gewandelten „Prioritäten“ bei den politischen Standortbeschlüssen, die dem Land Kapitalanlage und Kredit entziehen.[6]
Und erst recht sieht es sich durch die Beitritte von Staaten bedroht, die generell als „reich“, also als lohnende Anlagesphäre eingestuft werden. Daß mit der Erweiterung Konkurrenzschranken zum eigenen Vorteil niedergerissen werden, war daher überhaupt nicht sein leitender Gesichtspunkt, sondern daß ihm eine mächtige neue Konkurrenz innerhalb der EU erwächst. Deshalb hat es gegen den Profitfanatismus der überlegenen deutschen Wirtschaftsmacht sein nationales Interesse an gesicherten Erträgen geltend gemacht. Das Land, das bis gestern zu den neuen Wirtschaftswunderländern der EG zählte, hat nicht nur deshalb mit allem nationalen Nachdruck um „ein paar tausend Tonnen“ garantierte Fangrechte auf Kosten Norwegens und um zusätzliche Fondsmittel gekämpft, weil jeder solche Posten elementare Bedeutung für seine ohnehin geschädigten Bilanzen hat. Auf diese und andere Weise hat es in generellem Sinn Barrieren gegen seine Zurückstufung in den Status einer nur bedingt lohnenden Randökonomie verankern wollen, also die alten EU-Verhältnisse verteidigt und um seine Rolle als ökonomisches Entwicklungsprojekt und aufstrebender Wirtschaftsstandort der EU gekämpft.
Doch dagegen ist mit dem Streit um Fischereiquoten, Fondsmittel und Mitspracherechte auch wieder überhaupt nicht anzukommen. Diese Forderungen sind ja schon der Ausweis, daß hier eine Europaentwicklung ihrem Kern nach spanischem Interesse widerspricht, also auch durch noch so günstige Regelungen nicht zum Hebel seiner Standortbemühungen zu machen ist. Egal, wie am Ende die Regelungen ausgefallen sind und wieweit man Spanien „entgegengekommen“ ist – das weitere „Zusammenwachsen Europas“ richtet sich unwiderruflich gegen ein EU-Land wie Spanien und seine bisher in der Gemeinschaft anerkannten und geförderten nationalen Standortbemühungen.
Wenn Deutschland auch noch ständig die schon längst fällige Korrektur der unnatürlichen „Südlastigkeit“ der Gemeinschaft propagiert und mit seiner neuen „Nord-Ost-Ausrichtung“ Abhilfe verspricht, dann ist für Spanien darüber hinaus völlig unübersehbar, daß machtvolle politische Absichten im Spiel sind. So ist es aus spanischer Sicht überhaupt nicht schwer, in den Erweiterungsverhandlungen den neuen deutschen Anspruch auf Unterordnung zu entdecken, der sich über die Europa-Interessen von Ländern wie Spanien rücksichtslos hinwegsetzt:
„Schließlich hat die Idee Europas immer darin bestanden, an die Stelle von Eroberung eine Politik des konstruktiven Ausgleichs der nationalen Interessen zu setzen. Der deutsche Durchmarsch ist ein Verstoß gegen diese europäische Räson“. (El País, 24.3.)
4. Der Streit um den institutionellen Umbau
Damit stand die politische Grundlage des Staatenbündnisses zu Debatte: die Frage des Respekts gegenüber dem Willen der beteiligten Nationen. Ausgestritten worden ist diese Frage an der Auseinandersetzung um die künftigen Abstimmungsprozeduren im erweiterten Europa – genauer darum, welche Stimmenzahl für ein Veto bei Mehrheitsbeschlüssen künftig nötig sein soll. Über die Frage, ob 23 oder 27 Stimmen ausreichen sollen, haben die EU-Mitglieder am Ende unter sich so heftig gestritten, daß daran der „Beitrittsfahrplan“ beinahe schon im Frühstadium gescheitert wäre. Und auch bei diesem Programmpunkt war es vor allen anderen Deutschland, das vorausschauend Revisionsbedarf angemeldet hat.
In der Sache ging es bei diesem Verfahrensstreit um die Frage, wann und wieweit Souveränitätsvorbehalte noch Geltung haben sollen, wieweit also auf Einvernehmlichkeit geachtet werden muß und wieweit die Ansprüche der Länder Berücksichtigung finden, die sich durch die Fortschritte der EU mehr betroffen als bedient sehen. Gestritten wurde um ein Konstruktionsprinzip der EU: daß nämlich die unterschiedlich verteilten ökonomischen Erfolge und die Wucht der ökonomischen Abhängigkeiten in der Gemeinschaft nur vermittelt über die Zustimmung aller beteiligten Nationen zum Zuge kommen. Über die Reichweite der ökonomischen Macht von Nationen und über die unterschiedlich gewichtigen nationalen Interessen wird laufend nach festen Gemeinschaftsregeln politisch entschieden; so werden die Wirkungen auf die beteiligten Nationen gebremst und für betroffene Nationen hinnehmbar gemacht, weil ihre Betroffenheit Anerkennung findet; so werden die Wirkungen aber auch verbindlich für alle durchgesetzt. Dieses Verfahren soll mit der Stimmenänderung korrigiert und damit ein Stück Machtfrage nicht an einem bestimmten Fall, sondern durch Verfahrensregeln für jeden Fall geklärt werden.
So prinzipiell haben es jedenfalls die deutschen Vertreter gesehen und im Sinne einer eindeutigeren Unterordnung entscheiden wollen. Im Verein mit der Mehrheit der EU-Länder und mit Berufung auf das Europaparlament haben sie sich darauf versteift, daß mit der Erweiterung auch das Nein-Sagen erschwert werden müsse, also der Mehrheit widerstreitende nationale Interessen künftig weniger gelten sollen und der institutionelle Zwang zum Mitmachen verstärkt wird. Sie setzen darauf, daß Deutschland mit seiner ökonomischen Sonderstellung und seinem gewachsenen politischen Gewicht sowieso die wesentliche Beschlußmaterie vorgibt, und wollten deshalb festschreiben, daß geschädigte Ansprüche von Nationen nicht mehr so wie bisher zum Einspruch geraten können.
Spanien und Großbritannien haben dagegen verlangt, daß bei der Erweiterung das Gewicht der einzelnen Nation für ein Veto gegen Gemeinschaftsbeschlüsse erhalten bleibt. Die ausgesprochene spanische Absicht war, daß die Südländer sich als Block gegen unliebsame Beschlüsse zur Wehr setzen können. Großbritannien wollte bei der Gelegenheit seinen prinzipiellen Vorbehalten gegen den Verpflichtungscharakter der Gemeinschaft Gewicht verschaffen und nach Möglichkeit dafür sorgen, daß mit der Erweiterung den einzelnen Nationen ein Stück Souveränität zurückgegeben wird. Schließlich haben Spanien und Großbritannien nicht zuletzt in den Verhandlungen erfahren, daß Deutschland mit bisher nicht gekannter Rücksichtslosigkeit gegen widerstreitende Interessen anzugehen gewillt ist. Beide Nationen haben sich – nicht zum ersten Mal – als Betroffene des „europäischen Fahrplans“, nicht als seine Macher gesehen und haben deshalb versucht, das institutionelle Procedere so festzuschreiben, daß gewichtige und koalitionsfähige nationale Interessen nicht so leicht politisch niedergebügelt werden können. Und sie haben keinen Hehl draus gemacht, daß sie dabei an Deutschland denken, das mit seinen kleineren Verbündeten Brüssel dominiert:
„Wenn die europäische Kommission einen gesetzgeberischen Vorschlag präsentiert, sind die Belgier, Deutschen und Holländer einverstanden, weil es nach ihrer Maßgabe ausfällt. Schlecht wegkommen wir an der Peripherie und die Insulaner wie Großbritannien.“ (Carlos Westendorp, spanischer Staatssekretär)
Der am Ende erreichte Kompromiß gibt der grundsätzlichen Unvereinbarkeit der Positionen die Form einer vorläufigen und bedingten Vereinbarung: Es gelten die neuen erschwerenden Anforderungen an ein Quorum, aber erst einmal nur mit Einschränkungen und vorläufig – eine Gegenkoalition von 23 Stimmen erwirkt eine neuerliche Kompromißsuche innerhalb einer „angemessenen Zeit“, und bis zur endgültigen Festlegung 96 sollen umstrittene Beschlüsse ausgesetzt werden. Seitdem wird daran heruminterpretiert, was dieser Kompromiß genau besagen soll. Der Anspruch auf die wachsende Verbindlichkeit des Mehrheitswillens ist so verankert, der künftige Streit darum aber genauso.
5. Der Streit um Deutschlands Führungsrolle
Der Aktivist der Beitrittsverhandlungen hat keinen Zweifel daran gelassen, daß er mit dieser „Erweiterung“ ein Ziel verfolgt, für das alle Änderungen am bisherigen EU-Zusammenhalt bloße Mittel sind:
„Das vereinte Deutschland wird nicht das östliche Grenzland der Europäischen Union bleiben; es rückt auch politisch wieder in die Mitte Europas… Richtig ist, daß die Beitritte die Gemeinschaft innerlich stärker ausbalancieren. Es ist offensichtlich – das haben wir in Brüssel bei den Verhandlungen gesagt; ich sage es auch hier –, daß dies für Deutschland in seiner Mittellage einen nicht unerheblichen Gewinn darstellt.“ (Kinkel-Erklärung)
Mit den ständig bemühten Bildern von der Beendigung der „deutschen Randlage“, von „Deutschland als der neuen Mitte“ eines vergrößerten und endlich ausgewogenen Europa drücken deutsche Politiker, sehr allgemein und vage, aber unübersehbar, die neue Perspektive ihres Euro-Nationalismus aus. Die deckt sich mit keinem Interesse der Länder und Institutionen mehr, auf die sich die deutsche Europapolitik beruft, mit denen sie sich verbündet und die sie für sich vereinnahmt. Deutschland arbeitet auf die Rolle einer Führungsmacht hin, die sich des Staatenbündnisses als ihres souverän handhabbaren Mittels bedient: Deutschland bildet mit seinem ökonomischen Sondergewicht einen Kernblock leistungsfähiger Staaten und schart ein Umfeld abhängiger Nationen um sich; es schmiedet die jeweils passenden Koalitionen und legt mit deren Hilfe verbindlich fest, welche nationalen Anliegen der beteiligten Länder anerkannt, weil blockdienlich sind; es organisiert darüber seinen bevorzugten Zugriff auf europäische Reichtumsquellen; und es gibt schließlich die politische Richtung vor, damit sich Europa als Aufsichtsmacht betätigt – so etwa sieht das Programm aus, das Deutschland mit „neuer Mitte“ meint.[7]
Dieses Projekt hat seinen eigentlichen Grund nicht in der Krise, die auch den Standort Deutschland nicht unberührt läßt; nicht in den unvorhergesehenen Folgen der Maastrichter Beschlüsse, die das ganze Fortschrittsprogramm durcheinandergebracht haben; nicht in den Widerständen, die andere der Erweiterung und Vertiefung entgegensetzen; und nicht in den generellen Ungewißheiten der weltpolitischen Lage. Das alles gibt an und für sich ja überhaupt noch keine Veranlassung für die ausgreifenden Ambitionen der selbsternannten neuen europäischen Mitte. Wenn Deutschland einfach allem – seinem gewachsenen Gewicht, der Krise, den EU-Beitrittsgesuchen, den Turbulenzen nach Maastricht und überhaupt der weltpolitischen Lage als solcher – gleichermaßen den Stachel für ein neues Europa unter deutscher Führung entnimmt, dann wegen der imperialistischen Logik eines erfolgreichen weltpolitischen Aufsteigers, nach der die erreichte Größe auch das Anrecht auf eine dieser Größe dienstbare Ordnung begründet.
Auch wenn die deutsche Regierung dabei so tut, als sei das alles bloß das logische Ergebnis der Befassung mit den Beitrittswünschen anderer und als ginge es um die Notwendigkeiten und Selbstverständlichkeiten einer im Prinzip doch für alle wünschenswerten „Erweiterung“ – selbstverständlich, nach den bisher gültigen Gemeinschaftsgrundsätzen zwingend und für jeden Beteiligten einsehbar sind die Fortschritte und Umstände des „Erweiterungsprozesses“ überhaupt nicht. In Wahrheit ist es genau andersherum: Deutschland hat die Beitrittsanträge als eine passende Gelegenheit be- und ergriffen, um seine Partner mit seinem weitreichenden Interesse an einer Neukonzeption der Gemeinschaft zu konfrontieren, die mit der Alternative „Erweiterung oder/und Vertiefung“ überhaupt nicht erfaßt ist. Es macht seine in und mit der EU erreichte Stellung zur Grundlage für eine gründliche Revision des alten Gemeinschaftswerks. Die EU-Erweiterung ist nicht der erste, aber der bisher radikalste Schritt Deutschlands, die Machtverhältnisse, die bisher durch die Mechanismen des gemeinsamen Europa gebremst waren, hervorzukehren und die eingerissenen Abhängigkeiten zum Hebel und Zweck seiner Europapolitik zu machen.
Insofern ist auch der von Kinkel aufgestellte „Fahrplan“ „Erweiterung vor Vertiefung“ logisch: Deutschland dringt nicht auf eine Einigung in den strittigen Fragen der „Vertiefung“, um dann – auf Grundlage geklärter innerer Verhältnisse – die „Erweiterung“ anzugehen. Es nimmt die Beitrittsanträge als Gelegenheit, um mit der Erweiterung zugleich die Änderung der gesamten inneren Verhältnisse zu betreiben und damit die anstehende Auseinandersetzung um den mit Maastricht projektierten Wirtschaftsblock ein Stück vorzuentscheiden und gleich noch ein paar weiter gehende politische Zukunftsperspektiven dazu.
Deutschland räumt auf diese Weise mit dem Schein eines einvernehmlichen Fortschritts der Gemeinschaft gründlich auf. Dafür hat Kinkel schon mit der Art der Verhandlungsführung gesorgt. Der deutsche Außenminister hat sich aufgeführt, wie wenn er die Oberentscheidung über die Interessensgegensätze hätte, die in den Verhandlungen aufeinandergeprallt sind: Er hat zielstrebig die Verhandlungen an sich gezogen; er hat gegenüber den Beitrittskandidaten den Umkreis abgesteckt, was sie – mit deutscher Unterstützung – bestenfalls erreichen könnten; er hat Spanien bis an die Grenze der offenen Brüskierung unter Druck gesetzt, ihm damit gedroht, die eigentlich schon beschlossene Haushaltsaufstockung scheitern zu lassen, und ihm damit den Schaden in Aussicht gestellt, den es gerade vermeiden wollte. Einigung wurde also nicht dadurch erzielt, daß im Interesse des „europäischen Fortschritts“ Bedenken ausgeräumt und die verschiedenen Erwartungen einigermaßen zufriedengestellt worden wären, sondern umgekehrt: Der deutsche Chefunterhändler hat die widerspenstigen Mitglieder zur Annahme der unter seiner Regie ausgehandelten Kompromisse mehr erpreßt als bewogen: „Niemand soll sich täuschen: Ein Scheitern der Beitrittsverhandlungen würde eine ernste Krise für Europa auslösen.“ (Kinkel). Er weiß offenbar nur zu gut, daß dieser Fortschritt Europas keine Sache mehr ist, die die Interessen jedes beteiligten Landes einbegreift, und pocht auf die Abhängigkeit anderer vom deutschen Interesse.
Das hat prompt Frankreich auf den Plan gerufen. Frankreichs Botschafter hat den rüden diplomatischen Stil Deutschlands und – ausgerechnet – die Unklarheit bemängelt, was der Umzug nach Berlin und das Gerede von der neuen „Mitte“ Europas und dem neuen „Scharnier“ zwischen den verschiedenen geopolitischen Interessensphären in der Gemeinschaft bedeuten solle. Gemeint und durchaus auch angedeutet hat er mehr, nämlich daß Deutschland mit seinem Führungsanspruch Frankreich, die andere Vormacht in der EU, vor den Kopf stößt.[8] Statt auf eine Mitwirkung Frankreichs Wert zu legen, hat Kinkel ja Deutschlands Sonderstellung und exklusiven Anspruch voll und ungeschminkt zum Einsatz gebracht. Damit stehen auch Frankreichs Europaansprüche auf dem Spiel: seine Berücksichtigung als zumindest Mitführungsmacht, die Anerkennung als „Mittler“ zwischen Deutschland und den anderen, insbesondere dem Süden – eben all das, was genauso begriffslos wie das deutsche Gerede von der neuen „Nordostausrichtung Europas“ für Frankreich mit der bisherigen „Südwestorientierung“ umschrieben ist. Deswegen hat Frankreich in diplomatischer Form daran erinnert, daß Deutschland für sein Programm auf seine Zustimmung angewiesen ist, und mit der Möglichkeit einer Isolierung Deutschlands gedroht, um für sich weiterhin und unter den neuen Umständen erst recht Mitbeteiligung einzuklagen.
Die Beschwerde über den mangelnden Respekt vor Frankreichs Sonderrolle wurde von deutscher Seite bereitwillig als Kritik an Kinkels Procedere mißverstanden, um sie zurückzuweisen. Natürlich ist Politikern, die sich um deutsche Repräsentation im Kreis der ehemaligen Siegermächte von der Normandie bis Berlin streiten, nur zu gut bekannt, daß an der Stilfrage, die schließlich die entscheidende internationale Ehr-, weil Anerkennungsfrage ist, nationale Rechtsansprüche höchsten Kalibers angemeldet und bestritten werden. Aber sie haben sich davon nicht übermäßig beeindrucken lassen. Zur „Bereinigung“ der Affäre stellte Kinkel Frankreichs Beschwerde öffentlich als Ungebührlichkeit bloß und verlangte öffentliche Buße. Nachdem dann die Erweiterung soweit beschlossen war, demonstrierte er Einvernehmen und bot eine gemeinschaftliche Zukunftsplanung für eine fortschreitende „Nordosterweiterung mit Berücksichtigung des Südens“ an, wie wenn das gar kein Gegensatz und das selbstverständliche Interesse Frankreichs wäre.
III. Schönes neues Europa!
Das deutsche Änderungsprogramm stößt also auf mehr oder weniger gewichtige Widerstände. Auch wenn Kinkel die zum feindseligen Akt gegen deutsche Fundamentalinteressen erklärt, und damit die widerstrebenden „Partner“ vor die Frage stellt, wieweit sie sich zu sperren wagen – umstandslos drohen und erpressen, darauf legt er es dann doch nicht an. Irgendwie sollen sich alle zur Zustimmung bereit finden, auch wenn sie mit der deutschen Lesart von „Erweiterung und Vertiefung“ überhaupt nicht mehr bedient werden. Das deutsche Hinarbeiten auf eine unbestritten hegemoniale Rolle findet in Gestalt eines zähen Ringens um schrittweise, von der gesamten Gemeinschaft abgesegnete Verschiebungen, Gewichtsverlagerungen, institutionelle Änderungen, Erweiterungen unter kleinlicher Festlegung der näheren Umstände, komplizierte Kompromißformeln usw. statt – eines Ringens, das sich am Ende in so vagen Ergebnissen wie „gestärktes deutsches Gewicht“, „neue enge Partnerschaften“ innerhalb der EU, „institutionelle Fortschritte“ niederschlägt. Und das aus gutem Grund: Für das Gelingen des Programms wollen die deutschen Politiker nämlich die Mechanismen und Methoden der „Staatengemeinschaft“ weiterhin benutzen und einsetzen. Sie wollen sich das Mitmachen der anderen Nationen sichern und daher nicht grundsätzlich an den Charakter eines Staatenbundes gleichberechtigter Mitglieder rühren, der auf die institutionell abgesicherte Berücksichtigung aller in ihm versammelten Souveräne und auf ein dauerndes Einigungswesen gegründet ist. Das ist der Hebel der betroffenen Länder, von Deutschland noch Berücksichtigung zu erreichen.
Umgekehrt stellt sich das allerdings für die mit dem deutschen Führungsanspruch konfrontierten Länder mehr und mehr als negativer Zusammenhang dar, sofern sie nicht gleich darauf setzen, als ökonomisch erfolgreiche, kleinere Mitmacher Deutschlands in der EU voranzukommen. Sie bekommen bei jeder ihrer Rechnungen mit der Gemeinschaft Deutschlands gewachsene Macht zu spüren und sind dabei mit einer generellen Drohung Deutschlands konfrontiert: Entweder sie beugen sich den deutschen Anträgen, so daß sich seine immer ausgreifenderen Ansprüche in EU-Verhältnisse verwandeln, in deren Rahmen dann die anderen zumindest der Idee nach von diesem Blockfortschritt mitprofitieren können; oder Deutschland nutzt seine erreichte Machtposition, um neben und statt seinen bisherigen EU-Bindungen lauter Sonderbeziehungen zu stiften, so daß alle anderen auf jeden Fall an Einfluß auf Deutschland und die gesamteuropäischen Verhältnisse verlieren. Daher wissen die betroffenen „europäischen Partner“ kein anderes Mittel, um Deutschlands Ansprüchen einigermaßen Herr zu werden, als im Rahmen der EU den Kampf um ihre Berücksichtigung und ihren Einfluß weiterzuführen, um Deutschland ein Stück zu bremsen – „einzubinden“, wie es so verräterisch heißt. Das bedeutet aber auch, daß sie sich den deutschen Europa-Perspektiven und den von Deutschland geschmiedeten Koalitionen nicht einfach entziehen können.
Weil die Übereinstimmung in Sachen Europa auf diese Weise zunehmend zum Schein wird, werden allerdings die Einigungen unsicher. Die Beitrittsverträge sind auf Regierungsebene und im Europäischen Parlament glücklich durchgesetzt, der Streit ist damit aber nur auf eine neue Ebene gehoben, die der nationalen Volksversammlungen. Deutschlands europäisches Änderungsprogramm liegt jetzt in der Form der von Kinkel „meisterhaft“ zustandegebrachten Beitrittsverträge Institutionen zur Beschlußfassung vor, in denen lauter nationale Vorbehalte und alternative Europavorstellungen ihren Platz haben und Berücksichtigung verlangen. Deutschlands Macher leiden gegenwärtig sichtlich daran, daß ihrer Diplomatie Grenzen gesetzt sind, daß sich der von Deutschland provozierte Nationalismus der anderen sperrt und Parlamente und Völker sich querlegen, nachdem Ministerrat und Europäisches Parlament sich widerstrebend auf ein Stück Umbau Europas haben verpflichten lassen. Deutschlands Europa-Ambitionen sind abhängig von den Mehrheitsverhältnissen, nationalen Gegebenheiten, innenpolitischen Berechnungen und Volksstimmungen in ganz Europa. Und es ist überhaupt kein Geheimnis, in welche gemeinsame Richtung die zielen. Schon bei der französischen Volksabstimmung über Maastricht war das Argument von Befürwortern wie Gegnern, es gelte, sich Deutschlands zu erwehren. Die Warnung „vor dem wachsenden Übergewicht Deutschlands“ ist jetzt mehr denn je präsent.[9] Deutschlands Erweiterungsperspektiven hängen also an der Zustimmung von lauter Nationen, deren nationalen Willen Deutschland laufend gegen sich aufbringt, weil sie mit ihren Europa-Ansprüchen auf unübergehbare deutsche Interessen stoßen, denen sie sich beugen oder gemäß machen müssen.[10] Der deutsche Außenminister gibt sich zwar sicher:
„Ich bin Optimist. Die nordischen Länder und Österreich haben sorgfältig abgewogen. Sie wissen, daß ihre Zukunft in der Europäischen Union liegt. Sie wissen auch, daß sie keinen Verlust an nationaler Eigenheit und heimischer Lebensweise befürchten müssen.“ (Kinkel-Erklärung)
Aber was, wenn nicht? Kinkels forscher Optimismus heißt ja wohl, daß Deutschland seinen Fortschritt von den Einsichten und Befürchtungen anderer Länder nicht abhängig zu machen gedenkt.
Deutschland, das die europäischen Verhältnisse radikal ändern will, ist zutiefst unzufrieden; alle anderen, die sich gegen dieses Programm wehren und Deutschland bremsen wollen, sind es auch. Das ist also das schöne erweiterte und vertiefte Europa, auf das man sich so freuen soll.
[1] Dabei unterscheiden sich die verschiedenen Kandidaten zwar in ihren ökonomischen Mitteln und der daraus gewonnenen Auffassung über die Chancen und Risiken ihres Beitritts: Norwegen hält sich immer noch eine Sonderstellung zugute und hat entsprechend gestritten; Schweden erwartet sich wegen seiner leistungsfähigen Industrie generell Vorteile in der EU; Österreich setzt auf sein bewährtes ökonomisches Sonderverhältnis zu Deutschland. Allerdings kommen in diesen Rechnungen keine unvoreingenommenen ökonomischen Selbstbeurteilungen zum Tragen. Mit diesen nationalistisch eingefärbten Zukunftsperspektiven reflektieren alle den erreichten Stand ihrer Abhängigkeit von dem „größten geschlossenen Wirtschaftsraum der Welt“. Der Unzufriedenheit mit den Beitrittsbedingungen steht daher die elementare Sorge gegenüber, ausgeschlossen zu sein.
[2] Norwegens Sonderrolle, immer schon Nato-Mitglied zu sein, stellt sich jetzt als ein ganz neuer Vorzug heraus. Schweden und Österreich als Nutznießer der alten Lage leiden jetzt daran, daß die alte „Neutralität“ ihren Stellenwert verloren hat. Während sie Kritikern mit dem nachträglichen Eingeständnis begegnen, daß die vielgepriesene „Neutralität“ sowieso schon immer eine viel engere Bindung an die NATO bedeutet hat, als sie bis gestern zugeben wollten, leiden sie gleichzeitig daran, daß diese Beziehungen ihnen jetzt überhaupt nicht mehr genügen, weil sie die erwünschte Berücksichtigung in militärischen Sicherheits- und Aufsichtsfragen gar nicht garantieren. Schweden ist deshalb jetzt genauso wie das von russischer Kontrolle befreite Finnland der Partnerschaft für den Frieden beigetreten.
[3] Das ist noch etwas anderes, als wenn etwa deutsche Nationalisten von ihrer Regierung zu europäischer Gesinnung aufgerufen werden. In diesem Fall wird die internationalistische Ideologie zu feststehenden nationalen Gegebenheiten gepflegt, die Deutschland miteingerichtet hat und in denen es groß geworden ist. Im Falle der Beitrittsländer wird der Internationalismus als praktisch wirksames Argument verlangt; die Völker sollen mit dieser Einstellung die Entscheidung für den Anschluß treffen.
[4] In der Schweiz hat immerhin das Volk der Regierung schon einen gründlichen Strich durch die Rechnung gemacht, indem es erst gegen den EWR-Beitritt gestimmt und dann, gegen alle auswärtigen Einwände und Warnungen der eigenen Regierung, den Speditionsverkehr durch die Schweiz in näherer Zukunft auf die Schiene verbannt hat. Diese Mischung aus nationalistischen und umweltmäßigen Vorbehalten hat nicht bloß den deutschen Verkehrsminister gegen die Schweiz aufgebracht, sondern die Schweiz in eine heftige nationale Grundsatzdebatte über ihren künftigen Weg gestürzt. Daß dies kein Einzelfall ist, sondern sich anderswo leicht wiederholen kann, ist kein Geheimnis. Das ist die offen ausgesprochene Befürchtung nicht zuletzt deutscher Politiker, die am liebsten auch auswärts höchstpersönlich ein Ja verordnen würden und extra nach Straßburg pilgern, um ihre deutschen Europaabgeordneten auf geschlossene Zustimmung zur Erweiterung einzuschwören und auf die widerspenstigen Vertreter anderer Nationen loszuschicken.
[5] Vgl. zur Krisenlage Europas und zu den politischen Auslösern und Reaktionen: „Einige Anmerkungen, die Krise, Abteilung Europa, betreffend“ in: GegenStandpunkt 4-92, S.105!
[6] Siehe dazu: „Spanien nach Maastricht“ in: GegenStandpunkt 1-93, S.92!
[7] Was das politisch heißt, erfährt gerade Griechenland im Zusammenhang mit der Frage der Anerkennung Mazedoniens, die von Deutschland vorrangig betrieben worden ist. Griechenlands nationale Forderungen – Mazedonien sollte offiziell auf Gebietsansprüche, entsprechende Staatssymbole usw. verzichten und damit letztlich anerkennen, daß Griechenlands Hoheit sich auch auf Mazedonien miterstreckt – werden als Zumutung zurückgewiesen und die Absicht Deutschlands und einiger anderer EU-Partner veröffentlicht, ein selbständiges Mazedonien mit vollen diplomatischen Beziehungen noch vor der Präsidentschaft Griechenlands anzustreben. Die griechische Beschwerde, Deutschland sei ein „Riese mit der Kraft eines Monstrums und dem Hirn eines Kindes“, erbittert Deutschland so, daß die Europabefähigung Griechenlands in Zweifel gezogen und eine Verhinderung seiner Präsidentschaft erwogen wird. Während Deutschland seine Anerkennungspolitik im Fall Sloweniens und Kroatiens mit der Drohung eines Alleingangs in der EU durchgesetzt hat, wird Griechenlands Reaktion auf die von der EU-Mehrheit vollzogene Anerkennung Mazedoniens, das Embargo gegen den Nachbarstaat, als untragbarer Alleingang zurückgewiesen. Sein Vorstoß gegen die rücksichtslose Gemeinschaftspolitik wird als Anschlag auf die EU-Außenpolitik gebrandmarkt, als untragbare Quertreiberei „ausgerechnet während seiner Präsidentschaft“ abqualifiziert und eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof eingeleitet. Daneben treibt „Europa“ in Gestalt von Bonn, London und Paris Balkanpolitik demonstrativ über den Kopf der griechischen EU-Präsidentschaft hinweg. Man vergleiche diesen ersten Fall, wo ein Mitgliedsstaat durch die EU politisch zurechtgestutzt wird, mit der erfolgreichen Eingemeindung der DDR, bei der sich Deutschland über alle EU-Gegebenheiten hinweggesetzt hat, aber die Anerkennung der EU und positive Berücksichtigung bis in die Haushaltsbeschlüsse und institutionellen Konsequenzen hinein beansprucht und gefunden hat!
[8] „Botschafter Scheer
erklärte mit ungewöhnlicher Offenheit, daß etwas nicht
in Ordnung ist mit den zweiseitigen Beziehungen und daß
kein wirklicher Dialog zwischen Bonn und Paris
existieren könne, ohne Aufklärung über die auswärtige
Politik des wiedervereinigten Deutschland, z.B. wenn
Bonn im Zusammenhang mit der Erweiterung der
europäischen Union mit Gewalt den Beitritt der
Nordstaaten und Österreichs vorantreibt, von einer
Umkehrung der Kräfteverhältnisse zwischen den Süd- und
Nordländern redet und sich wie ein Scharnier im Zentrum
des Kontinents aufführt… Klaus Kinkel hat gedroht,
Spanien ‚casser la colonne vertebrale(!) (Rückgrat
brechen
)‘, falls es keinen Kompromiß akzeptiere –
eine Ausdrucksweise, die vor der Wiedervereinigung
unvorstellbar gewesen ist.“ (Le Monde 19.3.94) Ein
gründlicher, Klarheit schaffender Dialog zwischen Bonn
und Paris über die Definition der Außenpolitik des
vereinten Deutschlands sei erforderlich, finde aber
nicht statt… Wir brauchen deutsche Klarheit, dann
können wir Deutschland verstehen und mit Deutschland
zusammengehen. Es müsse klar sein, daß sich an
Deutschlands Einordnung in Westeuropa nichts ändere.
‚Wir brauchen diese Bestätigung.‘ Das müsse auch außer
Zweifel stehen, wenn Deutschland seine Beziehungen zu
Rußland neu bestimmen wolle. Franzosen fragten nach der
Bedeutung deutscher Darstellungen, die Erweiterung der
Europäischen Union verschiebe die Gewichte. ‚Nicht nur
für Franzosen ist es schwierig, die neue Stellung
Deutschlands zu akzeptieren.‘… Franzosen in Bonn
sagten: ‚Die Zusammenarbeit Frankreichs mit Deutschland
bildet die Grundlage aller Fortschritte in Europa: wir
bauen zusammen das Europa des nächsten Jahrhunderts;
nur Frankreich und Deutschland können das tun.‘… Da ein
europäischer Bundesstaat nicht geschaffen werden könne,
bleibe zur Sicherung der Funktionsfähigkeit der
Gemeinschaft nur der inoffizielle Weg, zunächst mit
sechs oder sieben Mitgliedsländern und einem aus
Frankreich und Deutschland bestehenden Kern die
Wirtschafts- und Währungsunion zu verwirklichen: ‚Dort
schlägt dann das Herz Europas.‘
(FAZ 16.3.94) Die Äußerungen zeigen,
wie entschieden Frankreich seine Stellung in Europa
durch sein gleichberechtigtes Führungsverhältnis mit
Deutschland definiert und wie grundsätzlich es sich
deswegen durch Deutschlands laut proklamierte und
rücksichtslos geltend gemachte Vormacht-Ansprüche
bestritten sieht. Das spezifische französische Konzept
eines deutsch-französischen Kerneuropa, um das sich
alle anderen herumgruppieren, versteht sich als
Alternative zu den deutschen Europa-Vorstellungen,
nämlich als Beschränkung eines drohenden deutschen
Multilateralismus, durch den Frankreich seine Position
einer zweiten Vormacht bestritten sieht. Diese
Auseinandersetzung rührt also endgültig an die
Kernfrage Europas: die Konkurrenz zwischen Frankreich
und Deutschland.
[9] Die handfeste Befürchtung einer deutschen Vorherrschaft und die vage Hoffnung auf Beteiligung aus dem Munde eines spanischen Offiziellen: „Vergessen wir nicht, daß Deutschland bis heute ein ökonomischer Riese war, aber ein politischer Zwerg. Heute ist es ein Riese in allem. Die EU gewährt ihm die Möglichkeit, sich auszudehnen über den Norden Europas und über das Zentrum… Die heutige Generation der deutschen Führer aller Parteien sind Europäer. Aber sie selbst sagen dir, daß sie nichtsdestoweniger nicht wissen können, ob diejenigen, die nachkommen, dieselbe Sensibilität in bezug auf Europa haben werden oder damit spielen, eine Kehrtwendung zu vollziehen unter der Versuchung ihrer enormen Macht. Das ist ein Risiko und die ganze Welt spricht darüber. Aber ich bin überzeugt, daß Deutschland nicht so stark sein wird, um in der Form der Hegemonie aufzutreten, um alleine die Probleme zu lösen, die Europa hat; sie haben nicht die ökonomische Macht, um das Leben der Tschechischen Republik, Ungarns, Polens oder der baltischen Länder zu gestalten. Für alles das braucht Deutschland die EU.“ (Carlos Westendorp) Ganz ähnlich die Stimmen in Frankreich (s.o.) und anderswo.
[10] Wie wenig
verläßlich, weil unzufrieden der nationale Wille
innerhalb der Europäischen Union ist, belegt z.B. ein
Streit in Großbritannien, den ausgerechnet der
Staatskirchenvorsteher vom Zaun gebrochen hat. Mit dem
Gespür eines für die höheren Werte einer Nation
Zuständigen hat er Großbritanniens Leiden benannt:
Großbritannien ist nach Einschätzung des Erzbischofs
von Canterbury ein mittelmäßiger und isolierter Staat
mit großen Klassenunterschieden, der seine strategische
Macht eingebüßt hat. Das Bild, das ich beschreibe, ist
das einer zerrissenen Gesellschaft, die ihr Empire
verloren hat. Wir leben in einer großen Welt und sind
darin jetzt sehr einsam.
Eine Kritik, die dem
kirchlichen Staatsmann den Vorwurf seiner konservativen
Gesinnungsgenossen eingebracht hat, wenn Großbritannien
inzwischen eine „normale kleine Nation“ geworden sein
solle, dann werde ja wohl die „nationale Kirche zu
einer unbedeutenden verspotteten Sekte“ degradiert. Man
sieht, das Leiden an einem deutsch dominierten Europa
läßt sich auch ausdrücken, ohne ein einziges Mal
Deutschland zu erwähnen.