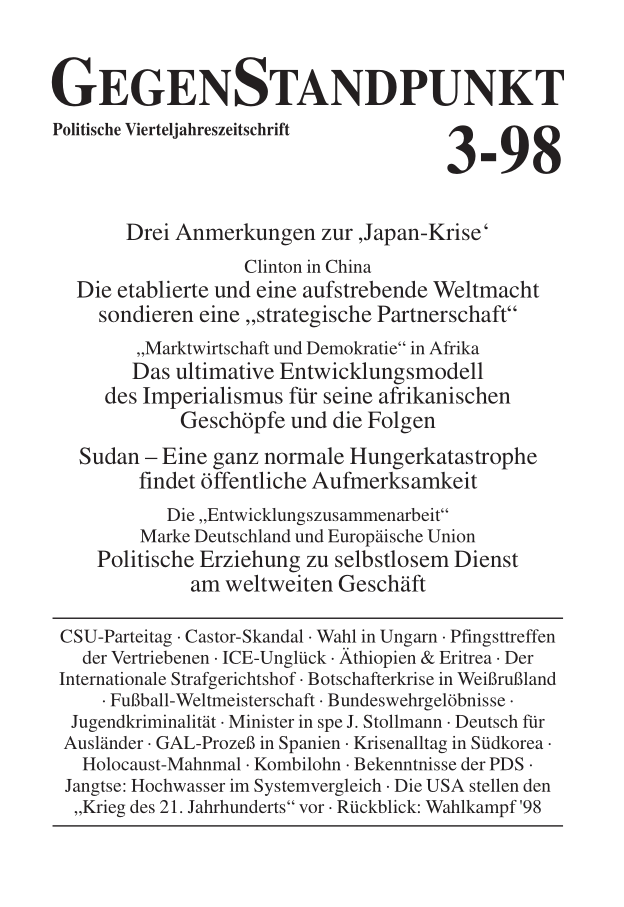„Marktwirtschaft und Demokratie“ in Afrika
Das ultimative Entwicklungsmodell des Imperialismus für seine afrikanischen Geschöpfe und die Folgen
Die US-Initiative „Partnership for Economic Growth and Opportunity in Africa“ setzt mit den Anspruchstiteln „offene Märkte“ und „Demokratie“ neue Maßregeln, an denen sich die zu „Rohstoffländer“ mit politischem Kredit hergerichtete Weltgegend in Zukunft neu zu bewähren hat: das imperialistische Reformprogramm will nichts minderes, als sich bisherigen Aufwand sparen, und mehr an den schwarzafrikanischen Ländern verdienen („offene Märkte“). Dafür werden deren Führungsfiguren, die damit für die mangelnde „Stabilität“ auf ihren Landstreifen haftbar gemacht sind, einem anspruchsvollen Leistungstest unterzogen („Demokratie“): die Herstellung ökonomischer und politischer Funktionalität auf ihrem Territorium quasi zum Nulltarif – ein Test, der ohne Gewalt und Kredit von außen gar nicht bestanden werden kann. Das Programm steht aber, und die meisten Länder des „neuen Afrika“ stellen sich darauf ein – (Zwischen-)Bilanz einiger Fälle dazu: eine im US-Auftrag installierte afrikanische Friedenstruppe sowie Kongo-Zaire und Angola.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Siehe auch
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Gliederung
- I. Wohin es Schwarzafrika ökonomisch gebracht hat: Rohstoffquellen unter Schuldenregime
- II. Die verordnete Neuorganisation der ökonomischen Dienste für den Weltmarkt: Ein ruinöses Reformprogramm
- III. Der politische Dauerzustand: Machtkämpfe um eine beschränkte Staatsgewalt
- IV. Die zeitgemäße imperialistische Antwort: Ein Programm zur gewaltsamen Befriedung der systemgemäßen Machtkämpfe
- V. Das neue Afrika
- Kongo-Zaire: Mit imperialistischem Ordnungsbedarf den Verfall einer Herrschaft vorangebracht1.
„Marktwirtschaft und Demokratie“ in Afrika
Das ultimative Entwicklungsmodell des Imperialismus für seine afrikanischen Geschöpfe und die Folgen
Im Frühjahr hat der amerikanische Präsident sechs Ländern Afrikas seine Aufwartung gemacht. Er wollte nach eigenem Bekunden der verbreiteten ‚Schwarzmalerei‘ der ökonomischen und politischen Zustände südlich der Sahara entgegentreten und eine neue afrikapolitische Initiative der USA: ‚Partnership for Economic Growth an Opportunity in Africa‘ auf den Weg bringen:
„Da Afrikas Nationen sich dem weltweiten Marsch Richtung Freiheit und offene Märkte anschließen, hat unsere Nation ein großes Interesse, zu helfen, daß sich diese Anstrengungen auszahlen… Unsere Initiative öffnet die Türe zu einer wirklichen, positiven Wende. Diejenigen, die die Demokratie stärken und in ihr Volk investieren, werden sehen, daß sich ihre Anstrengungen in der Ausweitung des Handels auszahlen, der neue Arbeitsplätze schaffen, Einkommen erhöhen, das Wachstum anspornen und die Lebensqualität von Leuten verbessern wird, die unter schlimmster Armut gelitten haben.“ (aus Clintons Ankündigung der amerikanischen „Afrika-Initative“ am 17.6.1997) [1]
Eine bemerkenswerte Auskunft. Irgendwo in Afrika herrscht immer Aufruhr und Massenelend; gewaltsame Auseinandersetzungen, Flüchtlings- und Hungerkatastrophen sind an der Tagesordnung; städtische Slums und ruinierte Landstriche nehmen zu; um Förderanlagen, Transportwege, die ‚Infrastruktur‘ überhaupt steht es nicht zum Besten; die ‚Arbeitslosen‘ werden erst gar nicht gezählt; ehemals hoffnungsvolle Entwicklungsländer zählen in der internationalen Statistik mittlerweile zur Kategorie der „ärmsten Länder“; der Abstand zu den „reichen Ländern“ wird nicht geringer, sondern größer; was wächst, sind einzig ihre Schulden… – das alles fällt unter „Schwarzmalerei“. Amerikas erster Mann weiß es besser: Das reale Elend zählt nicht viel; die Lage ist in Wahrheit hoffnungsvoll. Ansätze zu Reformen kommen unter einer Riege „neuer Führer“ ordentlich voran; ein „Zukunftsmarkt von 700 Millionen Konsumenten“ harrt seiner Erschließung; die „Renaissance Afrikas“ ist auf gutem Weg.
Der Optimismus des Präsidenten ist allerdings nicht dasselbe wie Zufriedenheit. Seiner eigenen Diagnose zufolge steht die „wirkliche positive Wende“ erst noch bevor. Und dazu, daß die „Tür“ dorthin aufgeht, hat er vor allem zwei Forderungen beizusteuern, ohne deren Erfüllung gar nichts geht, schon gar nicht von amerikanischer Seite: offene Märkte
und Demokratie
. Daran fehlt es noch in Afrika. Damit, aber auch nur damit ist der Kontinent in Ordnung zu bringen. Meint der Chef der Weltmacht, die in der ganzen Welt auf Demokratie und offene Märkte aufpaßt, und setzt damit Maßregeln in die Welt, an denen die afrikanischen Staatsmänner sich in Zukunft zu bewähren haben.
Die werden sich damit nicht leicht tun. Denn erstens widmen sie längst ihre gesamte Politik den beiden Zielen, eine gefestigte, von möglichst viel Volk getragene Herrschaft einzurichten und ihr Land in die globale Marktwirtschaft zu integrieren; mit ihren entsprechenden Bemühungen haben sie es zu der „Lage“ gebracht, die der US-Präsident in genau diesem Sinn für schwer verbesserungsbedürftig erklärt. Und zweitens stellt der mit seinem Reformanspruch keine einzige der systembedingten Ursachen von Elend und Gewalt in Afrika in Frage, stattdessen aber sehr heftig eben die Art, unter Berufung aufs Volk zu regieren und kapitalgemäß zu wirtschaften, zu der die afrikanischen Machthaber es gebracht haben.
I. Wohin es Schwarzafrika ökonomisch gebracht hat: Rohstoffquellen unter Schuldenregime
Amerikas Aufforderung zur verstärkten „Integration in den Weltmarkt“ ergeht an Staaten, die nichts anderes gemacht haben, als mit ihren Mitteln am Weltmarkt teilzunehmen und Geld zu verdienen. Der schwarze Kontinent mit seinen 700 Millionen potentiellen Marktteilnehmern ist einbezogen in die globalen Geschäfte. Auch dort dreht sich alles ums Geld, auf den Märkten, an denen die Bevölkerung herumwirtschaftet, wie bei der Staatsgewalt, die ihre Tätigkeit nach Maßgabe eines ordentlichen Budgets einrichtet. Und was bei alledem herauskommt, wird nach allen Regeln der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung zu einem Bruttosozialprodukt zusammengezählt, in Dollar umgerechnet und durch die Kopfzahl der Bevölkerung dividiert, damit man weiß, woran man mit diesen Ländern ist, nationalökonomisch.
Die Quanta freilich, die da statistisch ermittelt werden, fallen schon sehr geringfügig aus und legen bereits den Schluß nahe, daß von einem ordentlichen, die Bevölkerung insgesamt einbegreifenden bürgerlichen Erwerbsleben wohl kaum die Rede sein kann. Noch klarer wäre die Sache, wenn die statistischen Jahrbücher vermerken würden, wie die Ziffern zustandekommen, die in Schwarzafrika wie überall heutzutage den Reichtum der Nationen insgesamt und pro Kopf ausmessen. Da addieren sich nämlich nicht Löhne und Profite – respektive die Preise, die mit Gütern und Dienstleistungen erlöst und aus denen die diversen Einkommen bestritten werden – zu einem nationalen Geldprodukt, an dem der Staat partizipiert, nachdem er von der Schaffung und Betreuung eines nationalen Geldes bis hin zum letzten Zöllner und Verwaltungsbeamten alles Erforderliche für sein Zustandekommen finanziert hat. Was in diesen Ländern „Bruttosozialprodukt“ heißt, kommt eher darüber zustande, daß die Staatsmacht über Einnahmequellen verfügt, mit denen sie an Devisen kommt, also am Geldreichtum anderer Nationen mit funktionierender kapitalistischer Akkumulation partizipiert – insoweit brauchen die Buchhalter der globalen Marktwirtschaft den einschlägigen Reichtum dieser Nationen gar nicht erst ideell in Dollars umzutauschen, wenn sie dem einzelnen Neger ein Pro-Kopf-Einkommen von einigen -zig oder hundert Dollar zurechnen, sondern können sich gleich an die Ziffern halten, mit denen die zuständigen Regierungen bei ausländischen Handels- und Finanzkapitalisten in den Büchern stehen. Sparen könnten sie sich allerdings auch die Fiktion, ihrer Bruchrechnung läge, wenn schon nicht eine Teilhabe des Einzelnegers an, dann doch „irgendwie“ ein individueller erwerbsbürgerlicher Beitrag zu dem wirklichen nationalen Geldeinkommen zugrunde: Mit dem „Erwerbsleben“ der Massen hat der Reichtum ihrer Staatsmacht nämlich nichts zu tun.
„Rohstoff-Land“
Der beruht auf dem Verkauf von Gütern, die „natürliche Reichtümer“ heißen – offenbar im Unterschied zu dem „künstlich“ geschaffenen, gesellschaftlichen Reichtum, in den solche „Naturschätze“ erst durch die Produktion von Gegenständen des gesellschaftlichen Bedarfs verwandelt werden müssen und der in der Gesellschaft der Gegenwart, in der das Subjekt der Marktwirtschaft, das Kapital, den gesellschaftlichen Bedarf definiert, erst vollendet ist und fertig vorliegt, wenn aus den Bedarfsartikeln durch lohnenden Verkauf ein wirklich rein gesellschaftliches Kunstprodukt: Geld geworden ist, Reichtum in der denkbar abstrakten Form allgemeiner privater Verfügungsgewalt. Daß auch schon zur Bereitstellung dieser „Naturschätze“ für den Verkauf – zusätzlich zu den geologischen und klimatischen Verhältnissen, die die Natur bereitstellt – Arbeit notwendig ist, die durchaus nicht von Natur passiert, sondern gesellschaftlich organisiert werden muß und auch in Afrika mit kapitalistisch produzierten Produktivkräften – vom Fördergerät für Mineralien bis zum Kunstdünger für naturbegünstigte Kulturpflanzen – ausgestattet wird, versteht sich von selbst. Das aber reicht anscheinend keineswegs, um die herbeigeschaffte Naturbedingung einer kapitalistischen Produktion auch schon in wirklichen, in Geld realisierten Reichtum zu verwandeln. Jedenfalls nicht in den Ländern, wo dieser erste Schritt zur produktiven ‚Aneignung‘ der Natur stattfindet – und manchmal auch noch der eine oder andere Arbeitsgang zur weiteren Aufbereitung des Materials –, die aber dennoch in die Rubrik der Rohstoff-Länder
fallen: Diese Staaten kommen an den wirklichen gesellschaftlichen Reichtum heran, indem sie ihre „Natur“-Produkte unter der ökonomischen Bestimmung des bloß rohen Produktionsmittels verkaufen. Das tun sie als Land, also nach außen: in Länder, wo darüber erst das Geld entsteht, auf das sie scharf sind.
Und das sie auf diese Weise auch durchaus ergattern; denn das ist der andere ökonomisch sachdienliche Hinweis, der in der Etikettierung ihrer Exportware als „Naturschätze“ liegt: Sie verfügen durch ihre geologische und klimatische Ausstattung über nützliche, fürs kapitalistische Produzieren interessante Stoffe, die nicht allenthalben vorhanden, geschweige denn nach Belieben zu vermehren, sondern im Verhältnis zum gesellschaftlichen Bedarf von Natur aus selten – und nun also ausgerechnet bei ihnen anzutreffen, zu fördern, zu züchten oder wie auch immer zu beschaffen sind. Stoffe, die – womöglich sogar exklusiv – auf ihrem Gelände vorkommen und andernorts, wo richtig Geld gemacht wird, Objekt kapitalistischer Begierde sind, machen den Reichtum der afrikanischen Nationen aus. Mit dieser Einkommensquelle haben sie politökonomisch Karriere gemacht.[2]
Die Karriere zum „Schuldnerland“
Die hat in der Regel damit begonnen, daß kapitalistische Privatunternehmer – Farmer, Bergbaukonzerne, Ölmultis, Agrarfabriken – mit der „Natur“-Ware ein grenzüberschreitendes Geschäft aufgemacht, Dollars verdient und die staatlichen Instanzen sich mit ihren fiskalischen Zugriffsmitteln daran beteiligt haben. Freilich immer viel zu gering, nach deren eigener Einschätzung: In Staatshand gerieten immer nur Bruchteile der Erlöse, die mit den „Naturschätzen“ des Landes erzielt wurden. Deswegen haben die zuständigen Regierungen die größten und ertragreichsten geschäftlichen Aktivitäten auf ihrem Boden in der Regel irgendwann „verstaatlicht“ – ein Staatsakt, der deswegen in Anführungszeichen gehört, weil die politische Obrigkeit sich damit nicht als hoheitliches Aufsichtsorgan zwecks Förderung des nationalen Geschäftsgangs ins private Erwerbsleben eingeschaltet und zu dessen vorwärtstreibendem Anstifter gemacht hat, sondern dazu übergegangen ist, selber als Warenanbieter auf dem Weltmarkt für Rohstoffe, also in derselben Funktion aufzutreten wie bislang die privaten Rohstoffhändler. Die Berechnung, auf diese Art mehr Dollars in die Hand zu bekommen als durch Konzessionen, Abgaben und dergleichen, ist sicher auch aufgegangen. Allerdings waren die Staatsführungen nun auch unmittelbar mit den Tücken ihrer Einkommensquelle konfrontiert. Erlöse, die daraus entstehen, daß ein kapitalistischer Bedarf auf eine geschäftlich ausgenützte Naturbedingung trifft, sind nämlich auf der einen Seite von der Dringlichkeit der Nachfrage, also von den Kalkulationen der kapitalistischen Kundschaft im besonderen und den Konjunkturen des kapitalistischen Geschäftsgangs in den Zentren der Weltmarktwirtschaft im allgemeinen abhängig. Auf der anderen Seite mindert jedes zusätzliche Angebot, also jede neu eröffnete Erdölquelle, Plantage oder Erzmine, ganz unmittelbar die Marktmacht sämtlicher Anbieter. Das Ergebnis sind die eigentümlich extremen Schwankungen an den Rohstoffbörsen, an denen – tatsächlich einmal nach dem Kriterium der relativen „Seltenheit“ der Ware! – die Weltmarktpreise ständig neu „ermittelt“ werden, sowie der generelle Abwärtstrend dieser Preise. Den erzeugen die Lieferstaaten nämlich selber mit allen ihren Bemühungen, ihre Erlöse durch vermehrte Angebote zu steigern; und wenn sie dem Ratschlag der Diversifizierung folgen, um sich durch den Verkauf unterschiedlicher „Natur“-Produkte von der Preisentwicklung eines einzigen Rohstoffs unabhängiger zu machen, verallgemeinern sie nur die Tendenz zum Überangebot, das die Erlöse sinken läßt. Private Unternehmungen legen dann irgendwann Produktionsmittel still, weil die Differenz zwischen Aufwand und Ertrag nicht mehr stimmt, gehen andernfalls Pleite und sorgen auf die eine oder andere Weise für eine Verknappung des Angebots, die den Übriggebliebenen irgendwann wieder den Einstieg in lohnende Geschäfte gestattet. Für Regierungen jedoch, die diese Privatgeschäfte an sich gezogen haben, um ihre Einkünfte zu steigern und auch gegen derartige, privater Kalkulation entspringende Geschäftseinbrüche abzusichern, kommt eine Geschäftsaufgabe gar nicht in Betracht: Sie würden damit ja nicht nur ihre private Erwerbsquelle lahmlegen, sondern die Geldquelle des Staatshaushalts stornieren und damit den Bestand der Staatsmacht selber gefährden. Als Anbieter reagieren sie daher – wie es im Fachjargon heißt – höchst ‚unempfindlich‘ auf den Preisverfall ihrer Ware, dem sie folglich keine Grenze zu setzen vermögen – Kartelle funktionieren auch da nur, wenn sie eigentlich nicht nötig sind, wenn nämlich eine Laune der Natur das Angebot gründlich verknappt oder aus sonst einem Grund die Nachfrage überwiegt. So geraten diese Staaten ohne weiteres über den Punkt hinaus, an dem zur Aufrechterhaltung des Betriebs im Rohstoffsektor des eigenen Landes nicht bloß schlecht und in Landeswährung entlohnte Arbeitskraft erforderlich ist, sondern in Devisen zu bezahlende Importe von Material und Maschinen nötig werden, deren Kosten durch die Exporteinnahmen gar nicht mehr zu decken sind.
Freilich gibt es im Kapitalismus Sachen, mit denen sich sogar solche Situationen meistern lassen. Mit der Aufnahme von Kredit verändert sich die Rechnung: Die Einnahmen aus dem Verkauf der „Naturschätze“ des Landes müssen nicht mehr für den Staatshaushalt – einschließlich der unabweisbaren Geschäftsunkosten für die Deviseneinnahmen bringenden Staatsunternehmen – reichen, sondern bloß noch die pünktliche Bedienung der Schulden garantieren; das schafft neue Freiheit. Die hat allerdings ihren Preis; denn die Rechnung ändert sich auch nach der anderen Seite hin: In dem Maß, wie die staatlichen Exporterlöse für Zinsen und Tilgungsraten draufgehen, wächst mit jedem Staatshaushalt der Bedarf an neuem Kredit. Darüber ändert das ganze nationale Rohstoffgeschäft seinen ökonomischen Charakter – so gründlich, daß mittlerweile die Einstufung der schwarzafrikanischen Staaten als „Rohstoff-Länder“ mit schönen „Naturschätzen“ der Etikettierung als Schuldnerstaaten weitgehend Platz gemacht hat: Aus dem Mittel für staatlichen Gelderwerb wird eine Sicherheit für die Gläubiger, bei denen man Schulden hat. Und zwar eine zunehmend überforderte, sehr bald ungenügende Sicherheit; denn alle Bemühungen um Erlöszuwächse vertiefen nach wie vor bloß die Markt-Ohnmacht der Rohstoff-Anbieter und führen jedenfalls nie zu einer Steigerung der Einnahmen, die größer ausfiele als die der Kreditbedienungspflichten. Irgendwann übersteigt dann der Schuldendienst endgültig die Exporteinnahmen – heutzutage kein Ausnahmefall mehr, sondern so häufig, daß Wirtschaftsjournalisten dafür bereits die handliche Metapher von der „zugeschnappten Schuldenfalle“ eingebürgert haben.
Der politische Kredit
Zu einem solchen Zwischenergebnis ihrer politökonomischen Entwicklung bringen Schwarzafrikas rohstoffliefernde Schuldnerstaaten es freilich nur, weil sie mit ihrer Kreditaufnahme nicht allein auf das weltumspannende Bankgeschäft angewiesen sind – kein kapitalistischer Kreditgeber wirft auf eigene Rechnung so schrankenlos schlechtem Kredit gutes Geld hinterher. Kreditwürdig wurden und vor allem bleiben diese Staaten durch den politischen Kredit, der ihnen von den Weltmächten des internationalen Kapitalismus – bilateral oder über gemeinschaftlich unterhaltene Kreditagenturen, darunter die Weltbank mit ihren Entwicklungsprogrammen sowie der IWF mit seinem immerwährenden Sanierungsauftrag – eingeräumt wird. Deren Gelder bzw. Bürgschaften sorgen dafür, daß die Regierungen in Schwarzafrika immer noch einen Staatshaushalt aufstellen können, als Rohstoff-Lieferanten erhalten bleiben, irgendwie auch noch ihrem Schuldendienst gerecht werden – und dabei noch einen staatlichen Gewaltapparat zustandebringen, mit dem sie ihre inneren Verhältnisse unter Kontrolle zu halten suchen. Die entwickeln sich nämlich im Laufe der politökonomischen Karriere dieser Nationen auch; das tun sie allerdings nicht ohne eine der Sachlage entspringende und entsprechende Anwendung obrigkeitlicher Gewalt.
Die Ordnungsaufgabe der Staatsgewalt
Deren Inhaber haben als erstes dafür zu sorgen – sei es als offizielle Generalunternehmer, sei es per Absicherung der Aktivitäten privater Geschäftsleute und Konzerne –, daß auswärts verkäufliche An- resp. Abbauprodukte des „natürlichen Reichtums“ zustandekommen, ihren Bestimmungsort erreichen und ordentlich darüber abgerechnet wird. Dieser Aufgabe nimmt sich eine gesellschaftliche Elite an, die mit den vom bürgerlichen Staat bekannten besseren Berufen – vom Politiker, Armeeoffizier und Verwaltungsbeamten über den Bank- und Außenhandelskaufmann bis zum Ingenieur und Hafenaufseher – ihr Geld verdient. Das Geld, das sie verdient, entsteht nicht aus einem inneren Kapitalkreislauf, sondern kommt von außen ins Land, als Exporterlös, und gestattet seinen Besitzern eine Teilhabe am kapitalistischen Weltmarkt in umgekehrter Richtung: den Import von Waffen, Autos, medizinischer Versorgung, und was eine herrschende Elite heutzutage sonst so braucht.
Ein gewisses Quantum Proletariat ist für die Förderung und Beförderung der nationalen Exportwaren gleichfalls vonnöten: Lohnarbeiter, die allerdings schon gar nicht mehr in den Genuß von Devisen und Importware kommen, sondern mit nationalen Tauschmitteln ohne rechte „Kaufkraft“ abgefunden werden. Das reicht allerdings schon aus, um sie von der Masse der Bevölkerung zu unterscheiden, bei der von einer Indienstnahme durch das im Lande tätige Kapital und für dessen Geschäfte gar nicht die Rede sein kann. Alle Programme, diese kapitalistisch unproduktive Scheidung zwischen Exportwarenproduktion und dafür unnützer Bevölkerung wenigstens tendenziell aufzuheben, indem an den „primären“ Bereich der puren Rohstoffbeschaffung noch ein paar nächste Verarbeitungsschritte angegliedert wurden, haben – wo immer sie überhaupt mit erkennbaren Ergebnissen durchgeführt wurden – den praktischen Beweis erbracht, daß eine Kopie dessen, was Marx als „ursprüngliche Akkumulation“ bezeichnet hat, die Installierung eines die Gesellschaft ergreifenden, durchdringenden und umgestaltenden Kapitalkreislaufs, auf diese Art nicht zu erreichen ist: Die Rolle der nationalen Ökonomie als externer Zulieferer der globalen Akkumulation, die es längst gibt, wird auf die Art nur vertieft – insbesondere dadurch, daß die aufgewendeten Investitionen sich regelmäßig als ein Abzug vom alles entscheidenden Devisenerlös darstellen, dem kaum je eine entsprechende, geschweige denn überproportionale Zunahme der Exporteinnahmen gegenübersteht. Die einschlägigen Programme sind daher zumeist längst aufgegeben worden, ihre Überreste als „Industrieruinen“ inmitten von „Naturschätzen“ zu besichtigen. Ansonsten lebt eine wachsende Bevölkerungsmasse in kapitalistisch sachgesetzlicher Überflüssigkeit getrennt von allen nationalen Weltmarktdiensten und -verdiensten neben der Produktion von Exportware her und drückt mit ihrer großen Zahl den statistischen Befund über das Pro-Kopf-Nationaleinkommen auf die sagenhaft wenigen Dollars, die sie nie im Leben in die Hand kriegt.
Herstellung einer Subsistenz-Ökonomie neuer Art
Diese Scheidung zwischen Bevölkerungsmasse und nationaler Devisenwirtschaft, wie sehr auch immer die Folge eines weltmarktwirtschaftlichen – und entsprechend grundvernünftigen – Sachzwangs, macht sich selbstverständlich nicht von selbst. Sie herzustellen, ist überhaupt der wichtigste Regierungsauftrag im Rahmen der Generalaufgabe, von Staats wegen die Belieferung der Weltwirtschaft mit ein paar „natürlichen Reichtümern“ sicherzustellen. Denn dafür muß in die herkömmlichen – in diesem speziellen Sinn „vorindustriellen“ – Lebensverhältnisse der Eingeborenen ziemlich radikal eingegriffen werden. Ihr angestammter Lebensraum wird ihnen im härtesten Fall gewaltsam entzogen, auf jeden Fall eingeschränkt, in vielen Fällen vergiftet oder verwüstet; die daran hängende Subsistenz wird vernichtet. Festgelegt werden die Landesbewohner auf eine Subsistenz-Ökonomie neuer Art: Im Umkreis der ökonomischen Zentren des Landes, in den entsprechend ausufernden Hauptstädten vor allem, tut sich eine „Marktwirtschaft“ auf, in der sich das nationale Geld, vom Staat über seine vielen gewöhnlichen Dienstkräfte in Umlauf gebracht, als pures zwischenmenschliches Zirkulationsmittel zum Eintausch des Lebensnotwendigen bewährt. Zwar kann auch damit manch einer – gemessen am landesüblichen Durchschnitt – „reich“ werden, einen LKW als Erwerbsquelle und fürs Vergnügen einen Fernseher erstehen; wirklicher, kapitalistisch sich selbst verwertender abstrakter Reichtum wird aus dem landeseigenen „Geld“ darüber so wenig, daß so etwas wie eine „Konvertibilität“, ein ernsthafter praktischer Vergleich mit dem Weltgeld, erst gar nicht zustandekommt. Irgendeine rechnerische Parität existiert aber auch für dieses Tauschmittel, so daß alle, die damit umgehen, glatt noch in die nationale Sozialprodukt-Bilanz eingehen. Das unterscheidet sie von den Bevölkerungsmassen zwischen Stadtrand und Busch, denen die von der Staatsmacht durchgedrückten Verhältnisse nicht mehr als eine Ökonomie
des Hungers übriglassen: den buchstäblich ausgetragenen „Lebenskampf“ um die Abfälle vom Reichtum der staatlichen Elite; um Ackerflächen, die das Lebensnotwendige nicht erbringen; am Ende um die Proteinkekse, die die allgegenwärtige Welthungerhilfe spendiert – aus Mitleid, und weil die zuständigen Weltwirtschaftsmächte im Falle ausufernder Hungersnöte das unentbehrliche Minimum an hoheitlicher Kontrolle über Land und Leute vermissen. Die inneren Kriege, die auf Grundlage dieser politökonomischen Verhältnisse entstehen – mit einer Notwendigkeit, von der noch die Rede sein wird – machen das Elend komplett.
Eine „Stammesgesellschaft“ neuen Typs
Diese fatale Art „gesellschaftlicher Reproduktion“ stiftet innerhalb der Bevölkerung dieser Länder, zwischen den in eine Elite samt benötigten Anhängseln und überflüssige Massen geschiedenen Landesbewohnern, entsprechend eigentümliche soziale Bande. Ein Dasein als Charaktermasken verdinglichter Abhängigkeiten: als bürgerliche Individuen, die mit ihren Mitteln um marktwirtschaftlich zustandegebrachte Einkommen konkurrieren, bleibt denen jedenfalls erspart. Fürs Überleben in ihrem sprichwörtlichen Überlebenskampf sind sie vielmehr auf ein Kollektiv angewiesen, das sich aus dem primitiven Naturzusammenhang aufdrängt: auf die Zusammengehörigkeit als Familie, als Clan, schließlich als Stamm oder unterscheidbare „Ethnie“. Von den Lebensbedingungen der alten „Stammesgesellschaften“ hat die Integration Schwarzafrikas in den kapitalistischen Weltmarkt zwar nichts mehr übriggelassen; die sind durch den entsprechenden zivilisatorischen Fortschritt überwunden und ruiniert. Aus ihrer Befangenheit im Verwandschaftlichen und aus der unschönen Tradition, daß die Lebensbedingungen eine Emanzipation des einzelnen aus dem Umkreis seiner Abstammung gar nicht zulassen, brauchen die Leute aber erst gar nicht herauszutreten: Kein anderer Kollektivismus hat sie ersetzt; über Familie und Stamm verteilen sich die Überlebensmittel und -chancen.
Das sieht interessanterweise in den gehobenen Etagen der Bevölkerung gar nicht viel anders aus: Die Staatselite rekrutiert sich nicht aus konkurrierenden Karrieristen; Zugang zu den Reichtümern in Dollarform, die ins Land kommen, verschafft Protektion durch Verwandte im engsten und weiteren Sinn, nicht verfälscht durch die funktionalistischen Kriterien des Konkurrenzerfolgs – geschweige denn durch Gesichtspunkte einer vernünftigen Arbeitsteilung –, allein an der empfundenen moralischen Verpflichtung gegenüber den von Natur aus Nächsten orientiert. Kenner der Verhältnisse pflegen diese Sorte Zusammenhalt unter dem Stichwort ‚Nepotismus‘ oder ‚Klientelismus‘ als Korruption zu verurteilen, offenbaren damit allerdings vor allem, wie wenig der Standpunkt der Konkurrenzmoral, die den Rückgriff bürgerlicher Konkurrenzgeier auf ihre „informellen“ „guten Beziehungen“ kennt und als Normabweichung und Verfälschung leistungsgerechter Ergebnisse verurteilt, auf die afrikanischen Verhältnisse paßt..
Ausgerechnet mit diesem Standpunkt und im Namen seiner Ideale rücken nun die Amerikaner in Afrika an, kritisieren die eingerissenen Verhältnisse, traktieren die zuständigen Regierungen – und bringen die nächste Runde in der kapitalistischen Karriere des „Schwarzen Kontinents“ in Gang.
II. Die verordnete Neuorganisation der ökonomischen Dienste für den Weltmarkt: Ein ruinöses Reformprogramm
Die Staaten Schwarzafrikas haben keine Mittel – und seit dem Ende der sowjetischen Gegenmacht auf dem Globus auch keine Chance mehr –, ihre Rolle in der kapitalistischen Weltwirtschaft entscheidend zu ändern, geschweige denn aufzukündigen und eine solche Kündigung ökonomisch zu überleben. Vor allem aber ist nirgends – mehr – auch nur der geringste politische Wille feststellbar, grundlegende Änderungen der eigenen Stellung zum Weltmarkt auch nur zu beantragen, geschweige denn herbeizuführen. Alles, was – wie ernst gemeint auch immer – irgendwie nach Befreiung aus der Abhängigkeit von der „Ersten Welt“, nach Antiimperialismus, Sozialismus oder staatlicher Planung geklungen hat, ist längst aus dem Verkehr gezogen. Selbst die phrasenhafte Forderung nach einer „gerechten Weltwirtschaftsordnung“, in der die „Dritte Welt“ bessergestellt würde, ist völlig verstummt – als frommer Wunsch demokratieidealistischer Welt(wirtschafts)verbesserer ebenso wie als diplomatischer Anspruchstitel einer „Blockfreienbewegung“, die sich einstmals auch südlich der Sahara bemerkbar gemacht hat. Jeder Autonomie- und Entwicklungsidealismus in dieser Richtung ist den Regierungen, die dergleichen je im Programm hatten, im Rahmen der großen Auseinandersetzung zwischen „Freiheit und Sozialismus“ gründlich abgewöhnt worden und nach dem Sieg der „Freiheit“ vollends abgestorben. Die zuständigen Staatsverwalter haben sich angepaßt – und im alternativlosen Status des internationalen Schuldners mit größeren oder kleineren Rohstoffquellen eingerichtet. Von ihren Kreditgebern und dem IWF werden sie zwar regelmäßig mit der Forderung drangsaliert, ihre Einnahmen zu erhöhen und ihre Ausgaben zu vermindern; ersteres würden sie freilich gerne schon selber tun, doch liegt das gar nicht in ihrer Hand; und der Erpressung zur Sparsamkeit kommen sie auch schon von allein in der einzig systemgemäßen Form nach, daß sie die Scheidung weiter verschärfen zwischen der herrschenden Elite, die an den nationalen Dollareinnahmen aus Exporterlösen bzw. Krediten partizipiert, und der Masse der Überflüssigen, die von den damit finanzierten Staatsleistungen ohnehin weitgehend ausgeschlossen sind. So halten die Amtsinhaber den Zustand der „Überschuldung“, in den sie sich mit ihren Diensten am Weltmarkt und dem politischen Kredit der imperialistischen Mächte hineingewirtschaftet haben, ganz gut aus – jedenfalls solange ihre auswärtigen Sponsoren, denen sie ihre Lage verdanken, nicht ihrerseits die Bedingungen ändern oder gar den Kredit kündigen.
Nun kommt von denen und vor allem aus den USA Kritik, und zwar eine, die deutlich radikaler ausfällt als die vom IWF gewohnten Besserungsrezepte. Daß Clinton bei seinem Afrika-Besuch die imperialistische Mißbilligung der eingerissenen Verhältnisse in der diplomatisch-optimistischen Variante vorgebracht hat, es gelte, einen neuen Aufbruch zu schaffen, nimmt ihr nichts von ihrer Schärfe: Die Mächte, die über das Weltgeschehen Aufsicht führen, sind mit der ökonomischen Verfassung Schwarzafrikas unzufrieden und nicht mehr bereit, die unabsehbar wachsenden Schulden dieser Region weiterhin zu kreditieren. Nicht, weil die exorbitant hoch wären, sondern weil sie lohnende Perspektiven vermissen, die ihren gehobenen Ansprüchen gerecht würden, begreifen sie Afrikas Schulden als eigene Unkosten und befinden diese für nicht mehr tragbar. Allerdings kommt eine schlichte Kündigung von ihrer Seite auch nicht in Frage; „Fallenlassen“ geht nicht. Dagegen sprechen durchaus auch ökonomische Gründe: Mit ihren „Naturschätzen“ und dem Schuldendienst, für den diese längst verpfändet sind, tragen die Afrikaner immerhin doch das Ihre zum kapitalistischen Wachstum in der Welt bei, auch wenn die Kritik an ihnen diese Leistung ignoriert. Vor allem aber steht völlig außer Frage, daß auf der Welt lückenlos klare politische Gewaltverhältnisse herrschen müssen, schon damit die wirklich Verantwortlichen überall einen Potentaten für eine nützliche Ordnung haftbar machen und zu entsprechenden Diensten – und sei es nur zur Schließung seiner Grenzen für „Wirtschaftsflüchtlinge“ aus seinem Bezirk – erpressen können. Auch in Schwarzafrika muß,. das versteht sich von selbst, flächendeckend ein Ensemble staatlicher Gewalten Bestand haben.
Der politische Kredit für die afrikanische Staatenwelt wird also nicht widerrufen. Die Regierungen werden aber mit einer Abrechnung konfrontiert, die ihnen ihre nicht länger hingenommene „Überschuldung“ als ihre Schuld zur Last legt und unter diesem Blickwinkel die vorfindlichen Verhältnisse schonungslos als das Ergebnis einer völlig verfehlten, weil vom rechten marktwirtschaftlichen Gebaren abweichenden Politik anprangert: Die national Verantwortlichen hätten mit ihren Verstaatlichungen ihre Volkswirtschaften ineffektiv und unrentabel gemacht – leicht zu belegen durch die Tatsache, daß die Regierungen in ihrer immerwährenden Sorge um die nationalen Exporteinnahmen notwendigerweise betriebswirtschaftliche Rentabilitätsmaßstäbe außer Acht gelassen haben und unter dem Druck des Schuldendienstes das produktive Inventar des Landes nicht mehr erneuert worden, also verrottet ist. Etliche Machthaber hätten außerdem durch sozialistische Experimente den Bankrott ihrer Länder beschleunigt – was gleichfalls zutrifft, wenn man unter dem Titel ‚Sozialismus‘ den Versuch aufs Korn nimmt, über den bloßen Anbau von Pflanzen und Abbau von Mineralien hinaus, wenigstens zwischen Förderung bzw. Ernte und Abtransport, ein bißchen nationale Industrie als bessere Geldquelle zu installieren; aus Gründen, die mit Sozialismus nun wirklich gar nichts, viel dagegen mit den Sachgesetzen der „terms of trade“ zu tun haben, war der Devisenaufwand dafür stets höher als der Dollarertrag. Überhaupt würden laufend Staatseinnahmen unproduktiv verschwendet – eine scharfsinnige Diagnose für Länder, in denen eine innere nationale Kapitalakkumulation, der durch Staatsausgaben produktive „Impulse“ verpaßt werden könnten, gar nicht existiert und sogar Produktivitätssteigerungen im Bereich der Exportindustrien bloß das globale Überangebot vergrößern und so die Erlöse mindern. Insgesamt hätten die Regierenden sich zuviel Staatseinmischung geleistet, einen zu souveränen Umgang mit den nationalen Ressourcen gepflogen – ausgerechnet dort, wo sich in den wirtschaftspolitischen Veranstaltungen der Machthaber gar nichts anderes geltend macht als ihre wirtschaftliche Ohnmacht. Größtes Ärgernis ist schließlich die allgemein herrschende hemmungslose Korruption – auch das ein nur allzu offensichtlicher Befund, vorausgesetzt man nimmt sich das Recht, die afrikanische Art, einen Herrschaftsapparat zu alimentieren, am Ethos des bürgerlichen Berufsbeamtentums zu messen, statt ein paar systembedingte Notwendigkeiten des „Erwerbslebens“ in einem Rohstoffland zur Kenntnis zu nehmen. Ergänzt werden diese Anklagen durch eine dazu passende Selbstkritik: Durch unbedachte Hilfe hätte das besorgte Ausland diesen verantwortungslosen, teils schlampigen, teils sozialistischen, in jedem Fall sträflich ineffektiven Umgang mit Land und Leuten geradezu gefördert. Auch das läßt sich ohne Weiteres beweisen: Ohne auswärtigen Kredit hätten die Machthaber vor Ort schon längst gar keinen Staat mehr – also auch nichts falsch machen können.
Ersichtlich zielt diese Kritik auf zukunftsweisende praktische Schlußfolgerungen; man geht sicher nicht fehl in der Annahme, daß die Rezepte der Diagnose logisch vorausgehen und sachlich zugrundeliegen – wie das in der Politik bürgerlicher Staaten allemal die Regel ist. Freilich sind die praktisch gemeinten Rezepte ihrerseits eine schwer auflösbare Mixtur aus marktwirtschaftlicher Ideologie und allenfalls praktikabler Handlungsanweisung – auch das nicht anders als sonst in der Wirtschaftspolitik kapitalistischer Staaten. Insgesamt geht es um das ungemein ehrenwerte Anliegen, Erfolge an die Stelle der weniger kritisierten als inkriminierten Mißerfolge zu setzen; durch eine neue Politik in diesen Staaten und vor allem einen neuen Umgang mit ihnen. Aussehen soll das ungefähr so:
- Fürs imperialistische Einwirken auf die überschuldeten Negerstaaten, die man selbstverständlich auch in Zukunft nicht so nennen darf, gilt Clintons Maxime
Trade, but not aid
. Die fertig „entwickelten“ Staaten verabschieden sich damit von der Vorstellung, die afrikanischen „Entwicklungsländer“ müßten erst „entwickelt“, also zu einer für die Nation ertragreichen Teilnahme am Welthandel befähigt werden, bevor sie voll in die Konkurrenz um die Aneignung von Weltgeld einsteigen. Dabei ist es durchaus unwesentlich, daß diese Vorstellung überhaupt nie Gültigkeit besessen hat. Für den Imperativ, den Standpunkt des Helfens aufzugeben, langt es schon, daß mangelhafte Exporterlöse immer wieder durch allerlei Hilfskonstruktionen, letztlich durch Kredite der Heimatländer des globalen Kreditgeschäfts „überbrückt“ worden sind.: Diese Übung soll eingestellt werden. Nun ist es freilich ja so, daß die vergebenen Kredite zwar unter dem Titel „Hilfe“ an die jeweiligen Regierungen adressiert waren, aber nur als Mittel fungieren sollten und fungiert haben, deren Länder in das große Geschäftsleben hineinzuziehen und dafür nützlich zu machen und zu halten. Ihre ersatzlose Einstellung würde also die an exotischen „Naturschätzen“ nach wie vor interessierte kapitalistische Geschäftswelt treffen, außerdem die öffentlichen und privaten Gläubiger selbst. Dieser unerwünschten Nebenwirkung gilt es also vorzubeugen. Das Rezept dafür heißt: - Die afrikanischen Staaten sollen sich ausländischem Kapital öffnen. Dieser ungemein originelle Reformvorschlag zielt zum einen auf die Unternehmen des „primären Sektors“ ab, mit denen diese Länder überhaupt am Weltmarkt Geld verdienen: Sie gehören dem staatlichen Zugriff entzogen und privatisiert, also kapitalistischen Konzernen übertragen – jeder Afrika-Politiker hat da selbstverständlich Multis aus dem eigenen Land im Blick, auf deren Interessen eine heimische Lobby ihn aufmerksam gemacht hat –, die dann nach ihren harten Rentabilitätskriterien investieren, wo es sich lohnt; dort auch so, daß es sich lohnt; und ansonsten alles schließen, was sich nicht lohnt. Auf diese Weise würde – so die Kalkulation – alles, was sich an den Lagerstätten „natürlichen Reichtums“ weltmarktgeschäftlich ganz sicher lohnt, von der politischen Herrschaft, deren Schuldenstand und Geldbedarf getrennt, also von der lästigen Bedingung befreit, staatliche Bankrotteure geschäftsfähig zu erhalten. Wenn dann auch nicht mehr auf deren Dienst gerechnet werden kann, eine den Umständen entsprechende „öffentliche Ordnung“ zu gewährleisten, so ist das leicht im Preis drin: Die privaten Unternehmer müssen ihren konzerneigenen Werkschutz entsprechend groß dimensionieren – Vorbilder gibt es längst, und bei den in Afrika üblichen Billigpreisen für Waffendienste ist der Aufwand auch nicht hoch. Die Regierungen werden im Gegenzug auf den mehrfachen Vorteil verwiesen, daß ihnen aus dem so gesicherten Rohstoff-Geschäft wenigstens wieder gewisse Konzessionsgebühren und Abgaben zufließen; dabei sparen sie sich sogar den zur Aufrechterhaltung des Betriebs erforderlichen Aufwand, den sie sich bisher schon nicht haben leisten können. Mit diesen Einnahmen und den Privatisierungserlösen werden sie außerdem wieder zahlungsfähig, und zwar „aus eigener Kraft“. Und für den absehbaren Fall, daß es dafür gar nicht reicht, umfaßt das Reformprojekt noch einen zweiten Teil:
- Die Afrikaner sollen das, was es neben der Exportgüterbeschaffung in ihren Ländern an „Marktwirtschaft“ gibt, ihre inneren „Märkte“, der Begutachtung und Benutzung durch ausländische Investoren „öffnen“, die darin unweigerlich Objekte ihrer kapitalistischen Begierden finden werden. Das bringt dann schon wieder Investitionen, also Devisen ins Land und macht aus dem Tauschhandel in Landeswährung eine Geldquelle, an der der afrikanische Fiskus seine Freude haben wird. Über das kleine Problem, das dem Geschäft kapitalistischer Handelshäuser auf Afrikas Märkten im Wege steht: daß das unter den ortsansässigen Massen zirkulierende Tauschmittel kein kapitalistisch taugliches Weltgeld ist und auch weit und breit keine Instanz bereit und in der Lage wäre, ihm irgendeine Parität zu echten Devisen zu garantieren, sieht dieser geniale Vorschlag großzügig hinweg; die imperialistischen Ratgeber halten sich einfach an die Erfahrungstatsache, daß sich irgendwie auch noch an den ärmsten Kunden etwas verdienen läßt. Außerdem sind sie bereit, ihrerseits afrikanische Produkte unbehindert auf ihren Märkten zuzulassen; so bekommen ortsansässiger Unternehmer und zuständige Nationalbanken Devisen in die Hand, die sich dann gut wieder zurückverdienen lassen. Daß die Staaten Schwarzafrikas über gar keine lohnend absetzbaren Waren verfügen außer eben denen, mit denen sie bereits die Rohstoffbörsen der Welt beschicken, geht die Verfechter des Imperativs „Handel statt Hilfe“ nichts an.
- Speziell dieser letzte Teil des imperialistischen Reformprogramms für Afrika nimmt sich in seiner Mischung aus ideologischer Voreingenommenheit, zynischer Berechnung und Ignoranz einigermaßen unrealistisch aus. Das heißt allerdings nicht, daß er nicht zu praktizieren wäre: Daß er auf die ökonomischen Verhältnisse südlich der Sahara nicht paßt, spricht aufgrund der imperialistischen Machtverteilung nicht gegen das Programm, sondern gegen die Verhältnisse. Also zuallererst gegen die Regierungen, die diese Verhältnisse zu verantworten haben. Denen wird daher die erste und gründlichste Reformkur verordnet: Sie sollen sich umstellen, anständig regieren, das Mißwirtschaften lassen, weniger kosten und mehr leisten und zu diesem Zweck und in diesem Sinn die projektierten neuen Konditionen fürs Mitmachen im Weltmarktgeschäft durchsetzen. Wenn sie das nicht tun, muß man sie dazu erpressen oder austauschen; wenn sie dabei scheitern, tragen sie die Verantwortung und gehören gleichfalls ausgetauscht; und wenn sie das Verlangte machen und dadurch die Ökonomie ihrer Länder ruinieren – gilt dasselbe: Sie haften in jedem Fall für die Verwirklichung der Imperative, die in dem neuen kritischen Blick der großen marktwirtschaftlichen Nationen auf ihr afrikanisches Anhängsel als „erkenntnisleitendes Interesse“ enthalten sind.
So münden Unzufriedenheit und Reformwille der imperialistischen Mächte sehr konsequent in einen einzigen vorrangigen Programmpunkt: Gesucht wird das passende Personal für die Verwirklichung des schönen Ziels, an den Ländern des Schwarzen Kontinents bisherigen Aufwand zu sparen und mehr zu verdienen. Genauer gesagt: Es wird unter dem Titel Demokratisierung
mit aller Gewalt rekrutiert. Auf die Art kommt dann die Zerstörung der Länder, denen die modernen Entwicklungshelfer so angelegentlich ihre politische Aufmerksamkeit zuwenden, ziemlich flott voran.
III. Der politische Dauerzustand: Machtkämpfe um eine beschränkte Staatsgewalt
Auch hinsichtlich der politischen Zustände herrscht nach Auffassung der Begutachter in Washington und anderswo prinzipieller Korrekturbedarf. Ein antiwestlicher politischer Wille ist nicht mehr unterwegs. Zufrieden sind die Vertreter des Westens deswegen noch lange nicht. Überall entdecken sie störende Umtriebe, vermissen die klare politische Ausrichtung in ihrem Sinn und beklagen, daß es in vielen Fällen überhaupt an einer im Land durchgesetzten Regierungsgewalt fehlt. Ihre Unzufriedenheit hat, jenseits aller Differenzen, einen gemeinsamen Nenner: Es fehlt in Afrika überall an ‚Stabilität‘. Das Urteil ist leicht zu haben; denn die Länder haben es nicht zu einer verläßlichen Ordnung im Innern gebracht. Überall machen separate Lokalgewalten der Zentrale die Macht streitig und sind Aufständische unterwegs. Unterwegs sind überall aber auch Massen, die vor den gewaltsamen Auseinandersetzungen fliehen. Verfall der politischen Ordnung und offener Aufruhr sind keine Ausnahme, sondern Normalität. Wenn man diese Verhältnisse an dem Maßstab mißt, der hierzulande offenbar als Inbegriff des zivilisatorischen Fortschritts gilt: daß auch dort so verläßlich wie bei uns regiert gehört, dann steht das Urteil fest: Von einer ‚ordentlichen‘ Herrschaft, einem durchgesetzten und anerkannten staatlichen Gewaltmonopol, kann nicht die Rede sein. Von was dann?
Zum Status von anerkannten Souveränen, mit allen Insignien einer nationalen Herrschaft versehenen Mitgliedern der internationalen Staatenfamilie haben es die vormaligen Kolonien jedenfalls gebracht. Regiert werden sie von Politikern, die sich an internationalen Maßstäben messen; auch auf dem Schwarzen Kontinent ist es offensichtlich das geringste Problem, eine ambitionierte Machtelite zu finden, die dem Laden vorstehen und ihn in der Welt repräsentieren will. Und über einen regulären, nicht gerade bescheidenen Gewaltapparat verfügen all diese Länder auch. Nach der Seite sind sie also durchaus ‚in Ordnung‘. Allerdings kommt diese Macht – Reichtum, Waffen und Anerkennung – von außen. Über wieviel davon die Staaten gebieten, und damit über alle entscheidenden Vorgaben des Regierens entscheidet allein die Rolle, die sie ökonomisch und strategisch für auswärts spielen. Mit diesen Vorgaben Staat zu machen, das ist daher auch das gültige Herrschaftsinteresse, an dem sich die politische Führungsgarde allem inneren Aufruhr zum Trotz ausrichtet. Auch die Aufrührer wenden sich nicht gegen die Abhängigkeitsverhältnisse, sondern haben es einzig darauf abgesehen, unter diesen Verhältnissen selber zu regieren.
Was die Innenseite der Souveränität angeht, ist nicht zu übersehen, daß diese Länder nicht über haltlose Versuche hinausgekommen sind, eine bürgerliche Herrschaft zu kopieren, die über ein dienstbares Volk gebietet und sich auf dessen staatsbejahende nationale Gesinnung stützen kann. Die Anstrengungen der ersten Politikergeneration nach der Entkolonialisierung, mit Erziehung und Propaganda aus der heimischen Mannschaft ein einheitliches, loyales Volk zu machen, haben sich als hoffnungsloser Idealismus blamiert und sind längst aufgegeben. Nicht, weil Neger eben nicht reif für Demokratie sind, sondern weil die politische Ökonomie und die Erfordernisse der Macht in diesen Ländern der Staatsgewalt einen Umgang mit den Massen aufnötigen, dem die Bequemlichkeit des politischen Kommandos über ein nationales Volkskollektiv mit seiner staatsnützlichen gesellschaftlichen Gliederung abgeht, und weil deshalb auch die Massen etwas anders zu ihrer Obrigkeit stehen.
Schließlich wird nur ein geringer Teil der Bevölkerung für die ökonomischen Dienste und für die Herrschaftsfunktionen selber gebraucht; die überwiegende Zahl aber ist dafür nutzlos; bestenfalls für die ökonomischen Bemühungen der Regierenden einfach gleichgültig, meist eine einzige Belastung. Die Staatsmacht nimmt daher an ihrem inneren Inventar eine rigorose Selektion nach den Kriterien vor, die ihre externen Reichtumsquellen gebieten. Nur eine ziemlich kleine Minderheit wird gebraucht; die Mehrheit trägt zum Bestand und Gelingen der Herrschaft materiell nichts bei. Für letztere gilt im Grunde nur ein Gebot: Sie soll nicht im Wege stehen. Die Durchsetzung dieses Gebotes geht nicht ohne Gewalt ab. Die Flächen für den Exportanbau müssen bereitgestellt, die lohnenden Momente der Ökonomie, auf denen der Staat beruht, vom Rest getrennt und gegen die geschützt werden, die von ihr wie von anderen Mitteln ausgeschlossen sind. Überdies muß nach Möglichkeit dafür gesorgt werden, daß die Massen mit ihrer elenden Lage fertig werden, ohne sich unliebsam bemerkbar zu machen. Sie sollen sich schließlich in die Gegebenheiten fügen: sich nicht zur Wehr setzen, wenn sie weggeräumt werden, in den Städten stillhalten und sich irgendwie durchschlagen; auch sollen sie mit ihren gar nicht aufrührerischen Bemühungen, unter solchen Hungerverhältnissen über die Runden zu kommen, nicht zur Last fallen, sich in den Slums sortieren, auf dem Land nicht in Scharen umherziehen und dadurch die Verhältnisse durcheinanderbringen. Die Staatsgewalt organisiert also keine nationale ‚Erwerbsgesellschaft‘, in der der einzelne sich für den privaten Reichtum und für den Staat nützlich macht und so, je nach seiner Stellung in der Konkurrenz eben, ein Einkommen verschafft. Aber sie entscheidet mit ihrer Sortierung auch dort, und zwar ziemlich unmittelbar, über die Lebensbedingungen – meistens negativ. Sie kommandiert kein produktives Leben, sondern gewährt Teilhabe an den wenigen Verdienstgelegenheiten, verteilt die paar ‚Chancen‘, die sich unter solchen Verhältnissen bieten, oder schließt von den elementaren Überlebensmitteln aus.
Diese Scheidung vorzunehmen, die paar Anwartschaften zuzuteilen und zu versagen, das ist das Metier der politischen Figuren und das entscheidende Mittel ihrer Macht im Innern. So wenig an den äußeren Abhängigkeiten gerüttelt wird, so erbittert wird deshalb um diesen Gebrauch der Macht gestritten. Das ist keine Sache, die sich einvernehmlich und friedlich konkurrierend entscheiden läßt. Weil es um die Entscheidungsgewalt geht, welche Mannschaften die Machthaber mit Rücksichten bedenken und an den mageren Segnungen der Gewalt beteiligen und wer andererseits nicht dazugehört, hat die Konkurrenz um die Macht selber den Charakter eines Kampfs um ihren Besitz, der andere ausschließt. Daher tobt in diesen Ländern ständig ein Machtkampf eigener Art. Jede Regierung hat das Problem, sich gegen die enttäuschten Ansprüche von Konkurrenten und deren Anhang zu behaupten. Statt der Kumpanei demokratischer Politiker, die sie noch im erbittertsten Konkurrenzstreit eint, regiert Feindschaft, und im politischen Leben lauert laufend der Übergang zur Gewalt. Das Kommando über die Truppen ist daher das alles entscheidende Herrschaftsmittel.
In diesem Machtkampf spielen die Kollektive, in denen die Massen mit ihrem alltäglichen Kampf ums Dasein sich bewegen, ihre andere, ihre politische Rolle. Das stammesmäßig organisierte Beziehungswesen, das Freunden eines durchgesetzten Gewaltmonopols so unzivilisiert, so hoffnungslos rückständig erscheint, konstituiert den politischen Zusammenhang, in dem Führung und Massen vereint sind, vereint im Willen, die Macht und alles, was daran hängt, für ihren Verband – und das heißt – auf Kosten anderer zu sichern. Auch in diesen Ländern stützen und berufen sich die politischen Führer nämlich, allen anderslautenden Gerüchten zum Trotz, auf Leistungen, die sie für die Massen mit ihrer Macht zu erbringen gewillt und fähig sind, verschaffen sich Zustimmung und melden damit ihre Ansprüche auf die Macht an – aber alles als Vertreter ihrer eigenen stammesmäßig qualifizierten Mannschaft. Aus solchen ‚ethnischen‘ Verbänden, ehemals von den Kolonialherren als Mittel ihrer Verwaltung benützt und dadurch in Herrschaftsfunktionen hineingewachsen, rekrutiert sich die Führungselite, die sich zur Ausübung der Macht berufen weiß. Herkunft aus und Stellung in ihnen, nicht die Mechanismen einer politischen Parteienkonkurrenz qualifizieren für eine tragende Rolle in einem Staatswesen, das seine materiellen Mittel und seine politischen Sachzwänge aus ganz anderen, überhaupt nicht stammesbornierten Zusammenhängen gewinnt. Auch der gewöhnliche politische Aufstiegsweg zum Verantwortungsträger über das Militär kommt nicht ohne dieses politische Beziehungswesen zustande und nicht dauerhaft ohne es aus. Dieselben Figuren, die nach außen mit allen Insignien anerkannter Staatsmänner ihr Land in der internationalen Staatengemeinschaft vertreten, den Sachzwängen von IWF und Weltkonzernen samt ihren politischen Hintermännern Genüge tun und das dazugehörige Massenelend kommandieren, organisieren den Zusammenhalt des Staatsapparats als ein persönliches Gefolgschafts- und Klientelwesen aus militärischem Klüngel, Vetternwirtschaft und Pfründewesen. Ersteres wird ihnen hoch angerechnet, letzteres aber als persönliche Bereicherung übel angekreidet und für alles Elend verantwortlich gemacht. Dabei stiftet das die ‚Loyalität‘, die einer solchen Machtausübung Halt gibt. Eine Präsidialgarde, aus dem eigenen Anhang rekrutiert, sichert die Führungsmacht, Regierungsmannschaft und Staatsapparat werden vorrangig mit Leuten aus der „engsten Umgebung“ besetzt, so daß im Kabinett Fachleute für internationale Finanzfragen, eine Menge Militärs, Familienmitglieder, andere Mitglieder des eigenen Stammes gleichermaßen versammelt sind – aber auch Vertreter von anderen Clans, die auf diese Weise zufriedengestellt werden sollen.
Das persönliche Regime des Führers enttäuscht dabei notwendigerweise alle möglichen Ansprüche, beflügelt also unweigerlich die Gegner, die ihm die Führung streitig machen. An diesem Verhältnis ändert sich auch nichts durch den Austausch der Figuren; jeder Wechsel stellt die Nachfolger vor dieselbe Aufgabe. Afrikas Politiker versuchen deshalb auch immer, sich allgemeine Anerkennung zu verschaffen – heute allerdings kaum noch durch den einst proklamierten ‚Kampf gegen den Tribalismus‘. Politische Parteien, die allesamt ‚Demokratische Bewegung für die Erneuerung…‘ oder ähnlich heißen, organisieren bloß die Stammesklientel, aber mit dem nicht einmal erschwindelten Anspruch, daß es seinem Führer um den ganzen Staat geht. Die demonstrativen Bemühungen, die ganze Bevölkerung politisch wie eine einzige große Bewegung unter Leitung eines nationalen Führers zusammenzufassen, laufen heutzutage auf den Versuch hinaus, die gegensätzlichen Ansprüche der Anwärter auf die Herrschaft mit ihrem Anhang dadurch zu befrieden, daß man sie ein Stück weit ins Klientelwesen einbegreift. Die Privatschatulle ‚machtversessener Diktatoren‘ genauso wie die Arrangements, die sie über Beteiligungen und lokale Herrschaftsrechte mit Konkurrenten treffen, dienen allemal diesem Versuch, sind also Ausweis davon, daß es noch allen Konkurrenten bei ihren Bemühungen um etwas Allgemeines zu tun ist: die Sicherung der Macht im Staat.
Bei den Machtkämpfen spielen die Elendsgestalten, die im Land herumlaufen und sich unter den Herrschaftsbedingungen durchschlagen, eine nicht zu verachtende Rolle. In ihrer Clan- und Stammeszugehörigkeit bilden sie den Anhang und das Rekrutierungsmaterial der Kämpfer für die politische Sache, die die Führungselite ausficht. Als Gefolgschaft werden sie mit der kläglichen Perspektive betört, zur richtigen Klientel zu gehören. So bekommen die Notgemeinschaften, auf die sie materiell zurückgeworfen sind, den Charakter von positiven Ansprüchen, als deren Garanten sich auch dort ausgerechnet diejenigen präsentieren, die diese Elendsverhältnisse regieren. Auf die Weise kommt auch in diesen Staaten, die ihrer Bevölkerung vornehmlich als rücksichtslose Gewalt gegenübertreten, ein positives Gehorsamsverhältnis zustande. Allerdings keines, das dem ganzen Staat, sondern eben nur dem eigenen Verband in ihm gilt. Vermittelt über ihren alltäglichen Kollektivismus der Not, werden auch dort die Massen ‚politisiert‘, aber eben nicht als Volk, sondern in einem ‚Wir‘, das sich gegen andere von ihrem Schlage im Land richtet, die ihnen als Verantwortliche ihrer Misere vorstellig gemacht werden. Der Gegensatz, in dem die politische Gewalt zu ihnen steht, ist in die Feindschaft zwischen ihnen selber verwandelt und wird damit für die Herrschaft produktiv. Die Gestalten, die gar nicht erst auf den Gedanken verfallen, Herr über ihre Verhältnisse zu sein, denen in ihren Umständen daher tätige Berechnung und das Setzen auf die eigene Initiative fremd, das Erdulden von armseligen Umständen und das Eingebundensein in irgendeinen Clan dagegen ziemlich geläufig ist, werden massenhaft politisch tätig: Sie werden für den Machtkampf mobilisiert und aufgehetzt. Wie gut das im Bedarfsfall gelingt, bemerken hiesige Kommentatoren, wenn sie das ‚Wiederaufleben eines blindwütigen Stammesfanatismus‘ in Afrika mit seinen ‚sinnlosen Massakern‘ beklagen. Da ist eben keine Rebellion von Bürgern im Gang, die ihre Herrschaft umstürzen oder nach ihren Vorstellungen ändern wollen, sondern da ist ein Anhang unterwegs, der nicht mal eine halbwegs passende Vorstellung von den politischen Berechnungen hat, für die er eingespannt wird, aber durch die einschlägige Deutung seines Elends genau Bescheid weiß, worauf es ankommt: die vom anderen Haufen aus dem Weg zu räumen. Also exekutiert der Anhang, den sich Machtanwärter dort schaffen und bewaffnen, diese Überzeugung mit aller Gewalt, und die Anführer haben einiges zu tun, die Mannschaften auch wieder zu bremsen. Zu den erfolgreichen Tätern zu gehören, ist auch eine – und eine ziemlich gewöhnliche Existenzweise unter solchen Verhältnissen, genauso eben wie die der massenhaften Opfer von Gewalt; und eine bürgerliche Existenz haben sie ohnehin nicht zu verlieren.
Das abgebrühte Kopfschütteln über die regelmäßigen verheerenden ‚Ausbrüche von Gewalt‘ macht nicht nur wenig Aufhebens davon, daß die Mittel der Militärputsche und Revolten, der Unruhen und organisierten Aufstände gegen die Zentrale, der größeren und kleineren Massaker von den berufenen Adressen der internationalen Staatenwelt stammen. Es sieht auch völlig darüber hinweg, daß sich ihr Einsatz nicht stammesmäßiger Borniertheit, sondern weltläufigen Zielen verdankt. Es geht beim inneren Machtkampf immer darum, zum Ansprechpartner für alle Ansprüche zu werden, die sich von außen auf das Land richten und die wirklich etwas von der Macht verleihen, die die inneren Verhältnisse nicht hergeben. Also hängt ihr Bestand auch daran, wie es um diese Ansprüche steht, wie demnach der Leistungstest ausfällt, dem die afrikanischen Staatsführer laufend unterworfen werden und dessen Kriterien sie weder selber bestimmen, noch aus eigener Kraft erfüllen können: Sie sollen zugleich für die ökonomischen Dienste einstehen und unbeschadet von deren Wirkungen eine verläßliche Ordnung auf dem Boden ihres Territoriums gewährleisten.
Damit steht es allerdings nicht zum Besten. Denn die inneren Machtkämpfe zeitigen unweigerlich eine doppelte Wirkung. Erstens bleiben davon die ökonomischen Dienste und Rechnungen nicht unberührt. Vom wachsenden Militärhaushalt bis zur Beschädigung der Rohstoffquellen reicht die Mängelliste, die den Staatsmachern vorgerechnet wird. Zweitens aber kommt die Herrschaft selber nicht zur Ruhe. Laufend haben sie es mit Hunger und Aufruhr zu tun. Lokale Herrschaften machen sich breit. Immer wieder verschwimmt der Unterschied zwischen ordentlichem Militär und Bandenwesen, zwischen politischem Führer mit lokaler Machtbasis und Warlord, zwischen ordentlichem Staatsmann und Rebellenführer. In extremen Fällen geht jede Ansprechadresse verloren wie im Falle Somalia. Und diese Zustände greifen regelmäßig über die Grenzen hinaus. Zwar halten sich die Machthaber zumeist an die kolonialen Grenzziehungen als Abgrenzung ihres Herrschaftsbereichs; nicht so die Aufständischen und die von den Auseinandersetzungen betroffenen Massen. Das macht die Grenzen unscharf und trägt seinen Teil zu den Machtkämpfen bei. Die Flüchtlingsströme, die über die Grenze drängen, gefährden regelmäßig die Hoheit der Regierung über Teile des eigenen Staatsgebiets und wühlen die ohnehin vorhandenen Gegensätze dort zusätzlich auf. Daß auswärtige Aufständische vom eigenen Boden aus operieren, liegt oft am Mangel an Kontrolle über das eigene Land oder an der Absicht, Aufständischen gegen die eigene Herrschaft den Rückhalt im anderen Land zu entziehen. Was den Umgang der Staaten miteinander prägt, sind also vornehmlich die Konsequenzen ihrer innerstaatlichen Durchsetzungsprobleme. Das stiftet zeitweilig zwischenstaatliche Gemeinsamkeiten, wo sich die jeweiligen Bedürfnisse nach Herrschaftssicherung zufällig treffen, aber auch jede Menge Feindschaften.
Also hängt der Bestand dieser Länder letztlich ganz an dem Aufwand, den die außerafrikanischen Adressaten der Machtkonkurrenz dafür leisten. Das sehen diese Adressen, allen voran Amerika, ganz anders.
IV. Die zeitgemäße imperialistische Antwort: Ein Programm zur gewaltsamen Befriedung der systemgemäßen Machtkämpfe
Zu Zeiten des Kalten Krieges wurde einiges dafür getan, daß Afrikas Staaten den ihnen aufgetragenen Leistungstest bestehen. Verläßliche Parteigänger wurden mit Anerkennung, Waffen und auswärtigem Schutz ausgestattet. Bei unpassenden Kandidaten wurde dagegen den Gegnern kräftig nachgeholfen. Das Ende der Sowjetunion hat den Imperialismus von dieser Sorge befreit. Jetzt richtet sich der prüfende Blick auf fertige Objekte der einen Weltordnung: Nicht nur sind sie als Rohstoffquellen erschlossen, da herrschen Überfluß und niedrige Preise; auch die alte weltpolitische Vorgabe für Unterstützung und Bekämpfung von Regimen hat sich erledigt. Alternativen zum Imperialismus sind nicht mehr im Angebot. Daher sind nicht nur die Einnahmen dieser Länder, sondern auch die politischen Kredite gesunken, die ihnen für beide Rollen gewährt worden sind. Nicht gesunken, sondern gestiegen ist der Anspruch, den allen voran Amerika an die politischen Verhältnisse dieser Länder stellt. Die Einschränkung der äußeren Bemühungen um die Erhaltung dieser Herrschaften sollen sie durch eigene Anstrengungen in Sachen ‚gute Regierung‘ beantworten. Ein imperialistisches Programm, das wie ein groß angelegtes Besserungsprogramm daherkommt, aber auf eine fundamentale Kritik der Bemühungen um ‚gutes Regieren‘ hinausläuft, die dort unten ja durchaus angestellt werden. Sein Name heißt: „Demokratisierung“. Von Clinton ist es neulich bei seinem Besuch wieder einmal verkündet worden.
Der Ruf nach „Demokratisierung“
Demokratien in christlich-abendländischem Sinn sind die Staaten Afrikas also nicht; davon gehen die Vertreter der entsprechenden Werte aus. Was sie stattdessen sind: diese Systemfrage geht sie nichts an. Sie fordern ein, daß es bei den Negern so zugeht wie in den Staatswesen, wo die Gewalt effektiv monopolisiert ist, ein bürgerliches Recht samt Justiz und Polizei die menschenrechtliche Eigentumsordnung sichert, erwerbstüchtige Bürger mit ihren Steuern eine effektive Gewaltmaschinerie unterhalten, die ihrerseits Recht, Ordnung und die Kaufkraft des Geldes sichert und dafür die Besetzung ihrer Ämter der Konkurrenz politischer Parteien und der freien Wahl ihrer selbstbewußten Rechtssubjekte überläßt – ordentliche Verhältnisse also, unter denen das marktwirtschaftliche Geldverdienen klappt und Aktienbesitzer wie Lohnarbeiter, Freiberufler wie Rentner loyal zu ihrer Obrigkeit stehen, die ihnen mit den Sachzwängen der kapitalistischen Ökonomie auch gleich die entsprechenden Privatinteressen aufzwingt. Nicht eingeschlossen ist in dem Ruf nach „Demokratisierung“, daß die Staatsgewalt die materielle Notlage ihrer Untertanen beseitigt, ihnen einen Broterwerb bietet, überhaupt ein funktionierendes System gesellschaftlicher Reproduktion installiert: Die materiellen Lebensbedingungen der schwarzen Völker bleiben außer Betracht, also einfach unterstellt. Gefordert wird das unmögliche Kunststück, auf einer ökonomischen Basis, in der die Masse der Landesbewohner neben einer devisenbringenden Exportwirtschaft und gegen deren gewaltsam geschützte Ansprüche einen hoffnungslosen Überlebenskampf führt, einen politischen Überbau zu installieren, der eine durchorganisierte kapitalistische Klassengesellschaft voraussetzt, deren Ansprüche bedient und von ihr umgekehrt auch gewollt und erhalten wird. Blanke Not soll mit Rechtstreue, Verelendung ohne jegliches „soziales Netz“ mit politischer Loyalität, die absolute Ruinierung der Bevölkerung mit einer effektiven Verpflichtung und freiwilligen Selbstverpflichtung verbunden werden: Das verlangen die wertebewußten Demokraten aus den Zentren der Weltwirtschaft im Namen der universellen Unteilbarkeit der Menschenrechte – und in wunderbarer prästabilierter Übereinstimmung mit ihrem eigenen öffentlichen und dem von ihnen betreuten privaten Interesse, daß auch in Afrika sichere Lebens- und Wachstumsbedingungen für kapitalistisches Eigentum, eine pünktlich eingehaltene Geschäftsordnung, verläßliche Lobbies, kompetente Verwaltungen und ein Volk, das zuverlässig dafür ist, anzutreffen sein sollen.
Nun bieten sich Staatsbürger und bieten Staatsgewalten ja einiges, was den Kommunisten immer wieder ein wenig verwundert. Die Kombination von äußerster Rücksichtslosigkeit der politischen Gewalt und völkisch-staatsbürgerlichem Zusammenhalt, die unter dem Titel „Demokratisierung“ von den Rohstoff-fördernden Gemeinwesen Afrikas gefordert wird, ist allerdings wirklich nicht zu haben: Ein Staatswesen, das aus seinen Untertanen keine klassenmäßig eingeteilten – große, kleine, proletarische – Bourgeois macht, findet auch nirgends Citoyens vor, die ihrem Staat schon deswegen loyal gegenüberstehen, weil sie so viele gemeinwohlgemäßen Ansprüche an ihn haben. Die gebieterische Forderung, Demokratie zu machen, ist daher schlechterdings nicht zu erfüllen. Doch solche wirklichen Sachzwänge des nach Afrika exportierten Kapitalismus gehen, wie gesagt, die Politiker nichts an, die bei sich zu Hause über eine erstklassige Symbiose von Kapitalismus und Volksherrschaft herrschen und gleiches auch von ihren exotischen Partnern verlangen. Als höchste und allerbefugteste Rechthaber begreifen sie die Unerfüllbarkeit ihrer Ansprüche, wo immer sie auf deren Nicht-Erfüllung treffen und sich daran stören, als Mißstand, der nicht sein müßte.
Für dessen Bewältigung, die sie damit auf die afrikapolitische Tagesordnung setzen, halten sie sich an ihresgleichen: an die Politiker, die in den afrikanischen Republiken die „Verantwortung tragen“, also auch den politischen Mißstand zu verantworten haben, daß bei ihnen nichts so läuft wie in Bonn, Washington oder Paris. Deren Berufsausübung – denn wie gesagt: auch in Afrika gibt es Politik als Beruf – wird einer kritischen Überprüfung unterzogen: die Art, wie sie an die Macht im Staat kommen und Herrschaft ausüben; die Methoden, die sie dabei benützen, und die Manieren, die sie dabei an den Tag legen. Dabei stoßen sie darauf, daß der Machterwerb dort nicht über eine Karriere im Dienst an einem fix und fertigen Gewaltmonopol läuft, sondern in der Verdrängung anderer Machthaber und in der Zurückdrängung von Macht in anderen Händen durch das Oberhaupt der relativ mächtigsten Truppe, des gewichtigsten Stammesverbandes nämlich, besteht: Der steigt nicht einfach in das Amt auf, an dem die allgemeine anerkannte Staatsgewalt hängt, sondern okkupiert die vorhandenen Gewaltmittel und verallgemeinert seine persönliche Macht, per Ausschluß konkurrierender „Truppenführer“ von den vorhandenen Gewaltmitteln. Wenn die Eliminierung aller Konkurrenten gelungen ist, exekutiert der Regierungschef kein zweifelsfrei anerkanntes Gewaltmonopol, sondern agiert als persönlicher Befehlshaber der stärksten Bataillone einschließlich der von ihm monopolisierten Gewaltmittel, die den Staatsapparat ausmachen. Für die Belange der Clanchefs, die diesen Machtkampf siegreich bestehen, ist das Ergebnis allemal „stabil“ genug – jedenfalls bis sich die Konkurrenten wieder erfolgreich aufbauen. Fürs imperialistische Interesse und Urteil steht aber genau die Art persönlicher Herrschaft als Grund dafür fest, daß die Staatsmacht soviel bürgerlichen Ordnungsbedarf unbefriedigt läßt: Da regiert ja wirklich bloß einer mit seiner Mannschaft; bloß für sich und seinen Machterhalt; nicht als austauschbarer Funktionär einer fixen Staatsräson.
Und schon ist den berufsmäßigen Demokraten aus der 1. Welt klar, woran es in der 3. und 4. Welt fehlt: Die Kollegen dort halten sich nicht an die Verfahrensregeln der Macht, die in gut funktionierenden demokratischen Gemeinwesen gelten – kein Wunder, daß dann die Macht „dort unten“ nicht „funktioniert“; nicht so jedenfalls, wie sie soll. So „schließen“ die auswärtigen politischen Betreuer von der Sachlage, mit der sie unzufrieden sind, auf die Methode, deren Befolgung sie vermissen – und haben damit schon das Rezept zur Verbesserung der Verhältnisse bei der Hand: Ein ordentliches politisches Leben gehört dort eingerichtet; eine gescheite, gemäßigte, den „Konsens der Demokraten“ befördernde Konkurrenz um die Macht muß stattfinden – und als deren Ziel und als Grundlage volksgemäßer Herrschaft, die auf Loyalität und konstruktiver Opposition bestehen kann: freie Wahlen.
Daß die Forderung nach freien Wahlen sich irgendeinem Bedürfnis der „Völker Afrikas“ verdanken würde, wird von denen, die danach rufen, ernsthaft gar nicht behauptet. Sie beschwören ein Recht darauf, das man auch Negern nicht nehmen dürfe – und bekennen sich ansonsten recht offen dazu, daß das Interesse an solchen Veranstaltungen Sache auswärtiger „Ratgeber“ ist, die Wahlen als besonders wertvolles Herrschaftsinstrument kennen und schätzen: Ihnen geht es um eine „Stabilisierung durch Machtteilung“. Gedacht ist demnach an eine Befriedung der rücksichtslosen Konkurrenz um und Ausübung von Herrschaft, die dem auswärtigen Interesse an Festigkeit der Herrschaft Genüge tun soll. Und vorgeschlagen wird dafür ein Verfahren, das sich anderswo – allerdings unter anderen Umständen und für andere Zwecke – bewährt: für die Besetzung der obersten Ämter in Nationen, in denen die Sachnotwendigkeiten des Regierens allgemein anerkannt sind, Regierung und Opposition wechselnd und arbeitsteilig die Macht ausüben und das Volk mit der Auswahl des Personals auch seine Zustimmung zum Staat zu Protokoll gibt. Die Kämpfe, die in afrikanischen Ländern um den ausschließenden Besitz der Macht ausgetragen werden, mit der Veranstaltung von Wahlen befrieden zu wollen, ist dagegen eine seltsam unpassende Zumutung an die Interessenten an einer Regierungsgewalt, die gar nicht zu ‚teilen‘ ist. Denen gegenüber wird damit nämlich das Gebot erlassen, sie sollten ihre Konkurrenz bändigen, sich friedlich-schiedlich arrangieren und auf die Gewaltmittel verzichten, mit denen sie ihren persönlichen – eben nicht allgemein anerkannten und konsensfähigen – Herrschaftsinteressen alleinige Geltung verschaffen. Und es wird ihnen dafür eine unschlagbare Methode angeboten, mit der dieses Kunststück gelingen soll: die Befragung der Massen, deren Votum sie als verbindliche Richtlinie nehmen sollen, wieweit ihre Rechte an der Macht reichen. Von den politischen Aktivisten wird verlangt, sie sollten ihre Machtbasis im eigenen Anhang aufgeben und die Entscheidung über die Machtverhältnisse statt dessen einem Willensbescheid der Bevölkerung überantworten. Den Massen wird abverlangt, sie sollten sich nicht mehr als Anhänger einer Bewegung zu Wort melden, sondern als gesittete Wähler ihre Stimme abgeben, sich in ihre Verhältnisse schicken und Ruhe geben. Für oben und unten läuft die Forderung nach ‚Demokratie‘ also auf ein Gebot hinaus, für das es dort gar keine Grundlagen gibt: Unterlaßt gefälligst euren Bürgerkrieg.
Die Oberimperialisten, die daheim jedes ihrer Herrschaftsanliegen für einen unwiderleglichen Sachzwang erklären, geben mit ihrem Ruf nach Demokratisierung zu verstehen, daß es ihrer Auffassung nach bei den innerafrikanischen Auseinandersetzungen von vornherein um keine streitwürdigen Anliegen geht. Mit dem Verweis darauf, daß sich die politischen Führer mit ihren ‚Herrschaftsmethoden‘ als unfähig erwiesen haben, ein ordentliches Gewaltmonopol durchzusetzen, wird ihnen bedeutet, daß man sie ihnen deswegen auch nicht konzediert. Angetragen wird ihnen mit der statt dessen vorgeschlagenen besseren ‚Methode‘, sie sollten sich allesamt von ihren unverträglichen Machtansprüchen verabschieden und unter ein von auswärts ergangenes Einigungsgebot beugen, das keinen der Konkurrenten unbeschädigt läßt. Begründet wird das mit den untragbaren Zuständen von Gewalt und Elend, anempfohlen wird es mit dem sachdienlichen Hinweis, daß Afrikas Politiker doch selber auf haltbare Zustände aus sein müßten, und nahegebracht wird es ihnen mit politischem und ökonomischem Druck. Und Afrikas Politiker stellen sich darauf ein.
Seit für Amerika und seine Konkurrenten der Gesichtspunkt der antikommunistischen Ausrichtung nicht mehr der entscheidende ist, ist deshalb in Afrika die „Demokratie auf dem Vormarsch“. Fast alle Figuren an der Staatsmacht haben sich schon durch eine Wahl bestätigen lassen und sind dadurch der Forderung nach „good governance“ nachgekommen, von deren Erfüllung weitere auswärtige Zuwendungen, Erleichterungen beim Schuldendienst und Anerkennung abhängig gemacht werden. Regelmäßig werden irgendwo in Afrika Massen, die ansonsten jeder staatlichen Betreuung entbehren, an die Wahlurnen gerufen, und der Status des internationalen Wahlbeobachters ist inzwischen ein regelrechter Beruf. Was sie da beobachten, stellt aber die demokratischen Auftraggeber aus den Metropolen selten zufrieden. Denn daß die demokratische Art, die Staatsbürger einzeln frei, gleich und geheim ihr Bekenntnis zu einer bestimmten Führung abliefern zu lassen, auf Staaten überhaupt nicht paßt, deren Insassen sich schon um ihres schieren Überlebens willen – und am anderen Ende der Skala: im Interesse ihrer Teilhabe an den Segnungen der Staatsmacht – an Verwandtschaft und Stamm als das alles entscheidende Kollektiv halten, das kommt in der Veranstaltung durchaus zur Geltung: Der „Wahlkampf“, den die Politiker führen, ist ein einziger Appell an „Blutsbande“; nicht im Sinne der bürgerlichen Ideologie, die darin ihr auf die Nation orientiertes Gegenbild zur Klassengesellschaft mit ihren Interessengegensätzen entwirft, sondern weil unter den ortsansässigen Massen in ihrer politökonomischen Überflüssigkeit ein anderer verbindender Zusammenhang gar nicht vorkommt – und zu den Inhabern obrigkeitlicher Macht schon gleich keine andere Verbindung besteht; also ganz buchstäblich. Dieser Kollektivismus kommt selbstverständlich in einer separierten Wahlkabine überhaupt nicht zu seinem Recht; er verlangt nach Feiern und Ausleben eines unmittelbaren Gemeinschaftsgefühls, nach Akklamation – und nach handgreiflicher Abgrenzung gegen Nachbarn, die unter anderen Stammesinsignien denselben Kollektivismus leben. Das zieht sich bis zum Wahltag hin; um so blutiger, je nachdrücklicher sich die um die Macht ringenden Chiefs bei den Ihren als wichtige Patrons in Erinnerung bringen. Wahl und Wahlergebnis kommen folglich einer Volkszählung nach Stammeszugehörigkeit nahe; modifiziert durch Stammes-Koalitionen, die die „Partei“-Führer zum Zwecke der Machteroberung schmieden. Häufig verzichtet auch die Opposition darauf, sich überhaupt an den Wahlen zu beteiligen, weil sie das völlig unmanipulierte, im Wortsinn naturwüchsige Ergebnis schon vorher kennt und sich und ihrem Stamm die Stigmatisierung als hoffnungslose Minderheit im Staat ersparen – oder auch dem absehbaren Gewinner den nach außen vorzeigbaren Schein einer Legitimation durch die wahlberechtigte Allgemeinheit vorenthalten möchte. Nicht selten stört auch der Aufruhr, den die Mobilisierung fürs Wählen unweigerlich auslöst, die Kumpanei, zu der konkurrierende Stammesvertreter sich in ihrem Anspruch auf die ganze verfügbare Macht im Land zusammengetan haben; regelmäßig lösen Wahlkämpfe „Übergriffe“ aus und kosten Menschenleben. Und am Ende bleibt auch den besorgten demokratischen Wahlbeobachtern nicht verborgen, daß die „demokratische Erneuerung Afrikas“ die „Dezentralisierung“ und die „Konkurrenz zwischen den Ethnien“ befördert, „Stammeshäuptlinge und -räte wieder in den Staatsapparat eingliedert“, d.h. den Klientelismus und die gegensätzlichen Machtansprüche nicht befriedet, sondern vorantreibt.
Deshalb handeln sich die Beteiligten der Veranstaltung auch laufend Kritik ein. Die Regierenden werden zur Zurückhaltung aufgerufen, wenn sie ihre Verfügung über den Apparat in Anschlag bringen. Ohne Durchsetzung im Machtkampf ist mit Anerkennung nicht zu rechnen; sobald sich einer aber an die Machtsicherung macht, ist Kritik fällig mit dem leicht zu habenden Fingerzeig, daß das keinen inneren Frieden stiftet – jedenfalls nicht nach den anspruchsvollen Maßstäben demokratischer Imperialisten. Wenn – gar nicht verwunderlich – die Präsidentenpartei haushoch gewinnt, ist schon wieder Kritik fällig, weil ihre Gegner aus- statt eingeschlossen sind. Auf der anderen Seite haben die Oppositionskräfte ihrerseits die Pflicht, bei Wahlen in jedem Fall anzutreten. Sie bekommen von außen zwar einen Mitanspruch auf die Macht zugesprochen, werden aber zugleich mit einem Unterordnungsgebot belegt und kritisiert, wenn sie die Wahl boykottieren. In all diesen Fällen ist nur den „Prinzipien der freiheitlichen Demokratie“, aber nicht dem „Geist der Demokratie“ Genüge getan. Der heißt nämlich nach auswärtiger Lesart ein für alle Mal, daß mit Wahlen ein Beteiligungswesen zustande zu kommen hat, mit dem sich dann alle zufrieden geben sollen. Deshalb dringen die regierenden Demokraten aus den Metropolen auch des öfteren darauf, daß sich die Kontrahenten vor, nach oder statt Wahlen zu einer solchen ‚Einheit aller nationalen Kräfte‘ zusammenschließen sollen. Statt sich gegenseitig anzufeinden, so die dringliche Empfehlung, müßten sie sich nur von ihren persönlichen Machtambitionen verabschieden und sich allesamt bescheiden, dann kämen bei ihnen endlich ordentliche Verhältnisse zustande.
Den afrikanischen Machthabern und -anwärtern wird auf diese Art kundgetan, wie wenig man in den Zentren der wirklichen Macht von der Sorte Herrschaft hält, zu der sie es auf dem ihnen überlassenen Staatsgebiet bringen: Sie bleibt die beanspruchten Leistungen schuldig, und das wird der Nicht-Einhaltung des alleinseligmachenden demokratischen Verfahrens angelastet. Deswegen wird in die Machtkämpfe wie in die Machtausübung, mit denen Afrikas Politiker sich beschäftigen, auch immer wieder eingegriffen und die praktizierte Herrschaft mit Demokratiegeboten aufgemischt. Darüber soll die Herrschaft in diesen Ländern aber keinesfalls leiden; im Gegenteil: Durch Verfahrensvorschriften zurechtgebogen, soll sie den imperialistischen Anspruch auf brauchbar geordnete Verhältnisse endlich bedienen. Bei aller Erpressungskunst ist diese Demokratisierungspolitik freilich immer wieder damit konfrontiert, daß es in den Schuldnerstaaten des Schwarzen Kontinents eine andere Sorte Herrschaft als die Akkumulation von Gewaltmitteln in den Händen einer Führungsfigur und ihres „naturwüchsigen“ Anhangs ein für allemal nicht gibt. Auf Figuren dieser Art und deren Herrschaftspraktiken greifen die westlichen Imperialisten folglich immer wieder zurück – und finden das nicht im geringsten widersprüchlich. Denn auf die zielt ihre Kritik ja nicht bloß in dem Sinn, daß sie sich zum demokratisch Besseren belehren und gründlich ändern sollen: An sie, die herrschende Elite Afrikas und ihrer Führer, ergeht dieser Auftrag. Die vorfindlichen Akteure mit ihren Gegensätzen, deren politische Unvernunft bemängelt wird, sollen so, wie sie sind, als Grundlage einer ‚Stabilisierung‘ der politischen Herrschaft taugen. Die Zuständigen, so das Ansinnen, müßten sich eben nur an den auswärtigen Geboten ausrichten. Clinton & Co. verschwenden keinen Gedanken darauf, ob es für die Haltbarkeit der nach ihren eigenen Maßstäben arg beschädigten Staatsadressen nicht irgendeinen anderen ‚Stabilitätsbeitrag‘ bräuchte als solche Vorschriften für ‚gutes Regieren‘; geschweige denn, ob eine „Haltbarkeit“ nach ihren Maßstäben überhaupt zu haben ist. In der Gewißheit, daß es für die afrikanischen Länder ohnehin keine Alternative gibt, bestehen sie darauf, daß diese Staaten mit ihren nützlichen Funktionen besser verwaltet, fester regiert, ein für alle Mal befriedet zu haben sein müßten – und daß es letzlich nur am guten Willen der Verantwortlichen liegt, diesem zutiefst berechtigten Anspruch zu genügen.
So wird demokratische Kritik an Afrikas undemokratischen Zuständen am Ende ganz konsequenterweise sehr persönlich: Daß Staaten, die so zugerichtet sind wie die afrikanischen Schuldnerländer mit ihren von auswärts kreditierten Herrschern, auch politisch so und nur so funktionieren, wie die ruinierten Lebensverhältnisse der Bevölkerung und die Machtgrundlage ihrer Politiker es gestatten und erzwingen – und nicht so, wie bornierte Protagonisten der weltweiten demokratisch-marktwirtschaftlichen Effektivität sich das wünschen –, wird den Regierenden als ihre Verfehlung zum Vorwurf gemacht. Selbstkritisch wird festgestellt, daß die bislang geleistete Unterstützung der Staatsmacher nur zu persönlichem Machtmißbrauch geführt hat, also auch aller Aufwand, den man ihnen gewidmet, und der Rückhalt, den man ihnen gewährt hat, falsch war. Es kehrt keine Ruhe in diesen Ländern ein, also – so der anspruchsvolle Schluß – haben die Verantwortlichen versagt und ihre Pflichten versäumt. Daß die Herrschaftsverhältnisse den anspruchsvollen Anforderungen nicht genügen, wird also den Herrschaftsfiguren dort zur Last gelegt und praktisch gegen sie geltend gemacht, sobald sich genügend Gründe zur Unzufriedenheit akkumulieren. Den Bemühungen der Regierenden, ihre persönliche Macht haltbar zu machen, wird dann die politische Anerkennung und Unterstützung versagt und die Auswechslung des Personals betrieben.
Wann die kritischen Imperialisten von heute ein solches Eingreifen für nötig oder angebracht halten, entscheidet sich ebenso von Fall zu Fall wie die Frage, an welche neuen Figuren sie sich dabei halten können. Allgemeingültige Kriterien gibt es weder in der Frage der politischen Qualifikation der konkurrierenden Anwärter – Antikommunist und Parteigänger des Westens zu sein, ist kein Vorzug mehr, der Anerkennung verdient – noch hinsichtlich der Bedingungen, unter denen ein „Herrschaftsklüngel“ endgültig nicht mehr auszuhalten und folglich den menschenberechtigten Untertanen nicht länger zuzumuten ist; da spielt die Masse und Dringlichkeit der Ansprüche, die unbedient bleiben, ihre Rolle und auch die Art und Weise, in der die Machthaber weltpolitisch in Erscheinung treten; beim neuen globalen Abwehrkrieg der USA gegen den Terrorismus z.B… Klar ist nur, daß die Zufriedenheit mit jedem neuen Machthaber ihr Verfallsdatum hat: Irgendwann wird die Inkommensurabilität der imperialistischen Ordnungsinteressen und der Herrschaftspraxis des lokalen Machthabers allemal offenkundig und eine Revision oder sogar der Entzug des ‚Vertrauensvorschusses‘ fällig; das heizt dann wiederum den Machtkampf gehörig an.[3]
Das Ergebnis des Demokratisierungs-Verlangens fällt also einigermaßen negativ aus: Die politischen Führer werden laufend mit einem Generalvorbehalt bedacht, ohne daß ein besseres Personal in Sicht wäre. Die Sorte ‚Stabilität‘, die unter solchen Verhältnissen einzig zustande kommt, wird untergraben, ohne etwas anderes, Haltbareres – geschweige denn die gewünschte Rechtssicherheit zu stiften. Immerzu, mal bei diesem, mal bei jenem Land, mal bei dieser, mal bei jener Führung konstatieren die Aufsichtsinstanzen in Washington, Paris und anderswo, daß ein – wie es dann heißt – ‚Regime abgewirtschaftet‘ hat und ein Wechsel fällig ist. In diesem Sinne meint Clinton es durchaus ernst, wenn er Afrikas Führer als für ihr Schicksal selbst verantwortliche Souveräne würdigt: Nur Länder, die ernsthafte Reformen durchführen, werden den vollen Lohn ernten
. Der amerikanische Präsident besteht darauf, daß deren Herrschaftsbemühungen sich mit Amerikas Erwartung an sie zu decken hätten; eine Übereinstimmung, die es nicht gibt, und die die USA, kaum sind sie wieder mal enttäuscht, selber aufkündigen – selbstverständlich mit dem Hinweis auf den Mangel an ‚Demokratie‘ und die Leichen, die irgendein ‚Potentat‘ auf dem Gewissen hat.
Die afrikanische Friedenstruppe: Der imperialistische Auftrag zur Selbstkontrolle
An Ordnungsbedarf mangelt es also nicht; die Betreuer Afrikas rechnen permanent mit Krieg und Bürgerkrieg in und zwischen den afrikanischen Staaten. Dauerhafte Aufsicht ist geboten, wenn die Zerwürfnisse beendet und alle zur Unterordnung unter das Einigungsgebot bewogen werden sollen; das wissen die USA nicht erst seit den Ereignissen in Ruanda und Somalia. Allerdings haben sie in Somalia zu ihrem Leidwesen auch erfahren, daß es gar nicht einfach ist, allen Kämpfern vor Ort ihre Ansprüche auszutreiben. Statt daß schlagartig Ordnung eingekehrt ist, sind die US-Truppen zur Zielscheibe der Kampfparteien geworden. Eine untragbare Zumutung und Blamage für eine Weltmacht, die gegen die Mannschaften vor Ort gerade den Standpunkt geltend macht, sie sollten allesamt Frieden geben. Das soll anders werden: Wir wollen nicht wieder in derselben Lage sein, vor der Wahl zu stehen, entweder gar nichts tun zu können, oder es selber tun zu müssen.
(ein US-Offizieller)
Der neue Weg afrikanischer Friedenssicherung, den Amerika sich ausgedacht hat – und zu dem es die anderen Imperialisten, Frankreich voran, einlädt –, ist die Bildung einer eigenen afrikanischen Friedenstruppe. Der Frieden, den die Truppe stiften soll, betrifft in erster Linie das Innenleben der Staaten. Ganz Schwarzafrika soll unter die Drohung eines militärischen Eingreifens in die inneren Konflikte gestellt werden. Das ist die andere, die ‚ordnungspolitische‘ Methode für das Bedürfnis, das mit dem Verlangen nach ‚Demokratie‘ angemeldet ist. Durchsetzen sollen diese Aufsicht schon wieder die Afrikaner selber – unter berufenem Kommando, das Amerika sich vorbehält. Amerika bildet in mehreren Staaten Eliteeinheiten aus, die bei Bedarf als Kontingente dieser Eingreiftruppe fungieren sollen. Organisiert wird die Aufsicht also ganz nach dem Ideal eines von außen kommandierten Selbsthilfevereins für die ‚Eindämmung von Konflikten‘, der eigenes Eingreifen erübrigt. Daß die bestellten Ausführungsorgane selber die potentiellen Objekte sind und über eine verläßliche Gewalt gar nicht verfügen, darüber setzt sich Amerika hinweg. Washington sieht die Sache andersherum: Wenn die USA Staaten dieses Angebot zur Teilnahme an einer ordentlichen, von der Weltmacht kommandierten Aufsichtspolitik eröffnen und ihnen dafür auch gleich noch das Mittel an die Hand geben, dann ist das selber ein gar nicht zu unterschätzender Beitrag zur Festigung von deren Verhältnissen. So sollen Staaten für Ordnungsaufgaben eingespannt werden, denen der Status von handlungsfähigen Staatssubjekten nicht zugebilligt wird. Zu gewaltsamen Auseinandersetzungen untereinander haben sie kein Recht, aber zur amerikanisch geleiteten Beaufsichtigung gegen Dritte können sie ihr Scherflein beitragen. Angeknüpft wird damit an die Bemühungen, die afrikanische Länder selber allein oder in Gestalt afrikanischer ‚Friedenskontingente‘ unternehmen, immer wieder einmal in laufende Konflikte einzugreifen. Zugleich werden die als untauglich, als zu parteilich und zu machtlos, weil nicht unter der richtigen Oberleitung stehend kritisiert. Es ist eben ein Unterschied, ob Senegal ins Nachbarland Guinea-Bissau einmarschiert, um dessen gestürzten Präsidenten wieder an die Macht zu bringen und so Aufständischen im eigenen Land den Rückhalt zu entziehen, die dann prompt im Senegal wieder vormarschieren – oder ob Amerika mit senegalesischen und anderen Negerhilfstruppen solche Streitparteien zur Räson bringt.
Die meisten afrikanischen Länder sehen darin denn auch eine Chance, außenpolitische Macht zu gewinnen. So finden sich Malawi, Senegal, Uganda, Äthiopien und andere, die sonst nichts miteinander verbindet, in einem Projekt vereint, das eine gewisse Neuerung darstellt. Immerhin soll damit eine Art Aufsichtsmonopol ohne die Lasten imperialistischer Gewalt etabliert werden. Eine ganze Region voller unbefriedeter Staaten stellt der Imperialismus unter ein Ordnungsgebot, ohne selbst die Lasten einer Ordnungspolitik übernehmen zu wollen. Auch eine Art, zugleich den Bedarf an Aufsicht und die Gleichgültigkeit gegen die Objekte auszudrücken, bei denen keine antiamerikanische Unbotmäßigkeit wie im Sudan, sondern ‚Instabilität‘ bekämpft werden soll. Auf ihre Weise zeugt die Eingreiftruppe vom imperialistischen Ärger, daß diese Staaten, die selber gar nichts vermögen, gleichwohl lauter Störfälle produzieren. Unabhängig davon, ob ein „vitales“ imperialistisches Interesse verletzt ist, was zwingend Amerikas Eingreifen erfordert – der Fall liegt nicht vor –, wird das allgemeine Interesse an haltbarer Ordnung angemeldet, zugleich aber in einer Weise organisiert, die dem Prinzip der absoluten Aufwandsersparnis gehorcht.
V. Das neue Afrika
Die ökonomische und politische Funktionalität der afrikanischen Staaten wird zum Nulltarif verlangt. Darauf laufen die imperialistischen Begehren hinaus. Die angesprochenen Staaten stellen sich darauf ein, indem sie um die verbleibenden Geld- und Machtmittel um so heftiger konkurrieren. Das ist ihre heutige Alternative zu den erledigten Entwicklungsprogrammen. Wirkungen des neuen weltpolitischen Umgangs stellen sich darüber ein, freilich nicht die gewünschte Stabilisierung der Herrschaft, die das auswärtige Bedürfnis befriedigt, die Freiheit des geschäftlichen Zugriffs auf den Kontinent von den unhandlichen Verhältnissen dort mit politischer Gewalt zu trennen und von den Kosten der Herrschaft, die dafür sorgt, zu entlasten. Der Kontinent gerät einfach nicht aus den öffentlichen Schlagzeilen.
Kongo-Zaire: Mit imperialistischem Ordnungsbedarf den Verfall einer Herrschaft vorangebracht
1.
Im Kongo sei ein Wechsel fällig, meinten die USA. Die Gründe lagen für sie auf der Hand: Das Land immer weniger gefestigt; der Präsident nach dreißig Jahren an der Macht schwach, zugleich selbstherrlich; die Kupferminen verrottet und immer noch in Staatshand; eine Reihe Provinzen mehr oder weniger verselbständigt, Provinzfürsten, die in die eigene Tasche wirtschaften; nicht einmal mehr ein einheitliches Geld; der Osten des Landes durch Ruanda-Flüchtlinge, Hutu-Milizen sowie ansässige und hinzugekommene Tutsis aufgewühlt…
Für diese in ihren Augen unmöglichen Zustände hatten die USA eine einfache Erklärung. Das alles lag an dem Mann, der den Kongo seit 30 Jahren regierte. Er hatte nur in die eigene Tasche und das Land heruntergewirtschaftet; er verhinderte eine Befriedung der Region; er sträubte sich gegen jede Reform der Herrschaft. Also war Mobutu der Paradefall eines ‚überlebten Diktators‘. Es gab einfach keinen Grund mehr, sich weiterhin hinter diesen Mann zu stellen, den Amerika selber einmal an die Macht gebracht hatte, um den Kongo für den Westen zu sichern.
Warum Mobutu das Land so lange herunterwirtschaften konnte, dafür hatten die USA ebenfalls eine einfache Erklärung: Frankreich hatte ihm Rückhalt gewährt und den unfähigen Mann bloß aus eigenen Interessen an der Macht gehalten. Die amerikanische Regierung betrachtete den Kongo wie eine normale imperialistische Einflußzone, in der Frankreich einen Alleinvertretungsanspruch erhob und einseitige Parteigängerschaften organisierte. Die falsche Ordnungsadresse sollte dafür verantwortlich sein, daß die Ordnung vor Ort so zu wünschen übrig ließ. Die Weltmacht sah nämlich nach dem Ende der Sowjetunion auch keinen guten Grund mehr für eine französische Sonderrolle als regionale Aufsichtsmacht, eine Rolle, die unter den Ost-West-Verhältnissen dem ganzen Westen gedient hatte. Daß Frankreich immer noch mit eigenen Truppen in verschiedenen Staaten den Eingreifbedarf organisierte und die Region sicherte, das hielt die amerikanische Regierung inzwischen für eine falsche und schädliche Konzession:
„Der Kontinent gehört nicht mehr einer Macht allein.“ (der ehemalige amerikanische Außenminister Christopher)
Als ob er Frankreich ‚gehört‘ hätte!
Das amerikanische Besserungsprogramm für den Kongo stand damit fest: Ein anderer Mann mußte her, unter einer neuen, der amerikanischen Zuständigkeit. Der sollte alles in Ordnung bringen, was Amerika störte: Das Land wieder in den Griff kriegen, die Querelen mit den Provinzen beenden, Sicherheit im ganzen Land stiften, so daß man endlich wieder wußte, an wen und was man sich halten konnte; seine Neger befrieden und dafür sorgen, daß Prospektion und Geschäft in Ruhe ihren Gang gehen können; endlich die Minen privatisieren; und überhaupt mehr Wirtschaft auf die Beine stellen und US-Kapital für einen ordentlichen Aufschwung sorgen lassen; also: endlich richtig Staat machen; das würde dann schon, so die Auskunft, alle Probleme mit den elenden Massen erledigen und den Kongo voranbringen. Außerdem sollte der Mann zusammen mit der Tutsi-Mannschaft, die sich nach den Massakern in Ruanda durchgesetzt hatte, und gemeinsam mit Uganda für eine amerikanisch ausgerichtete Zone in Zentralafrika und damit für mehr Stabilität in der Region sorgen… Das war es also, das neue amerikanische Ordnungskonzept für den Kongo: Etwas anderes als ein Gefolgschaftswesen, das sich lokaler Stellvertreter, regionaler Stammesgegensätze und aller möglicher Machtambitionen bedient, kam dem Chef der Weltmacht nicht in den Sinn – ganz das Muster, mit dem afrikanische ‚Machthaber‘ ihr Land nach innen regieren. Andererseits knüpfte er daran aber die denkbar weitgehendsten Vorstellungen, was ein Gefolgsmann alles im Sinne Amerikas zustande bringen sollte.
Also unterstützte Washington einen alten Mobutu-Gegner, der im Gefolge des Durcheinanders im Osten des Landes mit verstärkter Mannschaft und frischem Elan unterwegs war, mit Logistik, Waffen und mit inoffiziellen Beziehungen. Mobutu verschwand, und Kabila wurde vom Rebellenführer zum Staatschef. Und so verschoben sich auch die Verhältnisse zwischen der unzufriedenen Weltmacht Amerika und der ‚traditionellen Aufsichtsmacht‘ Frankreich in Afrika etwas. Frankreich gab die Unterstützung Mobutus auf und griff statt dessen lieber bei nächster Gelegenheit im Nachbarland Kongo-Brazzaville wieder demonstrativ ein. Ein offizieller imperialistischer Konflikt wurde aus dem Kongo nicht – ein Beweis, daß er die Einflußzone Frankreichs gar nicht war, als die Amerika ihn sehen wollte.
2.
Kaum in Kinshasa, widmete Kabila sich dem Auftrag, im Kongo Ordnung durchzusetzen, auf seine Weise. Einerseits ging er daran, seinem Sieg Dauer zu verleihen und die Macht im ‚Riesenreich‘ Kongo zu sichern: seine Macht, was denn auch sonst; und mit den Methoden, mit denen er sich durchgesetzt hatte und ohne die unter solchen Verhältnissen gar nichts geht, mit welchen denn auch sonst. Seine Kommandogewalt sollte gelten im Land. Also hob er Familien-Mitglieder und Katanga-Vertraute ins Amt, berief sich auf die Stammesbeziehungen der echten Kongolesen, entließ seine Tutsi-Mitstreiter, erklärte sie zu Ausländern und verwies sie zusammen mit Hilfsfiguren aus Ruanda des Landes. Andererseits griff er die amerikanischen Forderungen an seine Adresse genau so auf, wie sie vorgebracht worden waren. So wie ihm ein ganzes Staatsprogramm angetragen wurde, so machte er dann auch seine Herrschaftsambitionen im und mit dem Land wie ein neues zukunftsweisendes Regierungskonzept für den Kongo vorstellig und definierte ganz wie ein ordentlicher Staatsmann, woran er bei gedeihlichen Beziehungen unter den neuen ‚Partnern‘ dachte: Wenn Marktwirtschaft und Demokratie im Kongo einziehen sollten, wenn er aus dem Kongo ein richtiges Staatswesen und eine blühende Landschaft für den Westen machen sollte, dann war der ihm aber auch ein richtiges Aufbauprogramm schuldig; dann sollte er die ‚Mobutu‘-Schulden streichen, dem Land eine Art ‚Marshall-Plan‘ stiften und dem Kongo mit seinem neuen Mann an der Spitze die gebührende Anerkennung leisten. Und die Objekte, die den Kongo interessant machen und die er als Staatschef zur freien Benutzung überlassen sollte und wollte, sollten Gegenstand der freien Konkurrenz der Multis werden; deswegen stornierte er die Vorverträge mit US-Firmen über Ölprospektion und verhandelte mit anderen, internationalen Konsortien über Öl, Kupfer sowie die Privatisierung der staatlichen Minengesellschaft. Außerdem pochte er mit dem Selbstbewußtsein eines frisch an die Macht gelangten Führers, dem der Westen zu Dank verpflichtet ist, auf Selbständigkeit.
Da war es allen klar. Der Mann drehte durch:
„War es einfach Naivität? Oder schon Unverfrorenheit?… So ist die heutige Führung in Kinshasa ganz offenbar von der Gewißheit durchdrungen, auf der richtigen Seite gestanden zu haben, während sich der Westen eigentlich schämen sollte.“
Die Öffentlichkeit wußte schlagartig, daß alles, was er wollte und machte, ein einziger Verstoß gegen Amerika und uns war. Die Differenz seiner Herrschaftsambitionen zu den imperialistischen Vorstellungen von Stabilität im Kongo war auf dem Tisch; und damit im Grunde die Unhaltbarkeit der Vorstellung, mit einer anderen, besseren Figur die Zustände in Ordnung zu bringen, die Amerikas Führung und auch Europas Zuständige störten. Alles, was an unliebsamen Umtrieben, Herrschaftsproblemen und allgemeinem Verfall des Landes unter Mobutu auswärts registriert und ihm angelastet wurde, war eben gar nicht seine Leistung, also auch mit ihm nicht zu beseitigen. An Kabilas politischem Aufstieg zeigte sich nur ein weiteres Mal, wie wenig sich die inkriminierten Zustände der ‚Willkürherrschaft‘ irgendeines besonders korrupten, besonders unfähigen Despoten verdankten.
Daß die Ansprüche, die an die Figur geknüpft wurden, überhaupt nicht zu solchen imperialistisch gestifteten Verhältnissen wie im Kongo, also auch zu den politischen Charaktermasken, die sie hervorbringen, paßten – so wollte es aber niemand auffassen. Man hatte nämlich längst eine Erklärung bereit. Genau die umgekehrte: Nicht Amerikas und Europas Erwartungen an den Mann waren anmaßend und stellten sich ignorant gegen die Zustände, sondern Kabila war anmaßend und stellte sich ignorant gegen alles, was sich für einen wie ihn gehörte.
3.
Es lag also schon wieder ausschließlich an dem Mann, den Amerika zum Garanten dafür erhoben hatte, daß im Kongo alles anders und besser werden sollte: Weil der nicht wollte, wandelten sich auch die Verhältnisse nicht zum Besseren. Dem neuen Mann wurde als Verrat vorgerechnet, daß er genau das machte, was unter solchen Verhältnissen Erwerb und Gebrauch der Macht gebieten; daß er nicht mehr und nicht weniger als ein Anwärter war, der mit seinem bewaffnetem Stammesanhang auf eine Koalition der Unzufriedenheit setzte, sich damit erfolgreich an die Macht kämpfte und dann mit seinem Klüngel die Machtpositionen besetzte. Er hatte sich ‚entlarvt‘ und war ‚bloß‘ schon wieder so ein Mobutu:
„Statt die politischen und sozialen Kräfte des ausgelaugten Riesenreiches in seine neue Herrschaft zu integrieren, tat Kabila das Gegenteil: Er versuchte, seine wacklige Position durch Ausschluß aller unter Mobutu vorhandenen Parteien zu stabilisieren, berief vornehmlich Exilanten ins Kabinett – und tauschte auch diese immer häufiger gegen Familienmitglieder und Vertraute aus seiner Heimatregion aus. Kabilas Regierung glich zu sehr dem Unrechtsregime Mobutus: Nepotismus, Korruption, Willkür der Sicherheitskräfte, aber kaum wirtschaftliche und soziale Verbesserungen für die Masse der Menschen.“ (SZ 18.8.)
So sah es die Presse; so sah es aber auch Amerika. Also wurde dem Mann bedeutet, daß er auf internationale Anerkennung nicht rechnen konnte und daß ihn die amerikanische Regierung und damit die Weltgemeinschaft mit anderem beauftragt hatte, als sie seinen Durchmarsch nach Kinshasa gefördert hatte. Festgemacht wurde der Gegensatz, in den er sich nach einhelliger Auffassung zu unseren berechtigten Forderungen gesetzt hatte, genau wie bei Mobutu, und wie überhaupt immer, an den Verfahrensweisen beim Umgang mit der Macht: an einer unzulässigen Art ihres Erwerbs und ihrer Ausübung. Statt, wie demokratisch geboten, die Opposition zuzulassen und schleunigst Wahlen zu veranstalten, hatte er das Gegenteil gemacht. Statt einen sauberen Krieg zu führen, hatte er sich das Gegenteil, Massaker und Menschenrechtsverletzungen bei seinem Marsch auf Kinshasa zuschulden kommen lassen. Kaum daß er Präsident war, wurde ihm also der Sittenkodex guten Regierens entgegengehalten, internationale Überprüfung seiner Vergehen verlangt und damit offiziell das Recht auf Herrschaft bestritten.
4.
Diese weltöffentliche Kritik beflügelte die Gegner Kabilas im Land. Bald regte sich ein ziemlich breiter und bunter Widerstand; so etwas wie eine große Koalition aller Enttäuschten im Lande. Enttäuschte Erwartungen gab es ja genug, die alle nicht auf Wahlen, sondern auf ihren Teil an den Segnungen der neu organisierten Machtverhältnisse zielten:
„Besonders heftig waren die Kämpfe in jüngster Zeit im Nord- und Süd-Kivu, im Osten des seit der Machtübernahme durch Kabila wieder als Demokratische Republik Kongo bezeichneten Landes. Widerstand wird aber auch in anderen Provinzen geleistet. Lokale, von Kabila enttäuschte Gruppen verbünden sich mit den Hutu-Milizen sowie mit Angehörigen der früheren Präsidentengarde Mobutus und mit Truppenteilen der früheren Zairischen Armee. Diese Einheiten haben sich nach dem Einmarsch Kabilas in Kinshasa zu Tausenden in das Nachbarland Kongo-Brazzaville, in die Zentralafrikanische Republik und andere Nachbarstaaten abgesetzt. Die Zeichen für eine Stabilisierung des Kongo stehen also nicht günstig, trotz Kabilas Versprechen, 1999 Wahlen abzuhalten.“ (SZ 7.2.98)
Ehemalige Mitstreiter wie alte Feinde machten sich auf den Marsch – genauso wie vor etwas mehr als einem Jahr Kabila und seine Kämpfer. Und sie boten sich natürlich, genau wie er damals, als besserer Ersatz an, der endlich ernst zu machen versprach mit einer neuen Ordnung für den Kongo; entsprechende Führungsfiguren mit internationaler Erfahrung und die Gründung einer „Demokratischen Bewegung“ standen dafür. So gerüstet kamen sie noch viel schneller voran als er im letzten Jahr.
5.
Vorangekommen ist mit all dem also auch der Zerfall des Kongo. Nach nur einem Jahr ist klar: Der neue Mann, dem schon wieder persönliche Machtwillkür angekreidet wird, besitzt gar keine ordentliche Macht. Ihm fehlt nämlich das, was unter Mobutu die Herrschaft letztlich noch zusammengehalten hat: die internationale Anerkennung und Unterstützung, durch die Aufstandsbewegungen und Lokalgewalten zu inneren Problemen einer letztlich dann doch immer noch vorhandenen Hoheit herabgesetzt wurden – bis Amerika sich hinter Kabila gestellt hat. Diese Anerkennung und Unterstützung wurde Kabila aber gleich wieder entzogen, bzw. er hat sie gar nicht erst richtig bekommen. Das hat ihn so schwach anfangen lassen, wie Mobutu aufgehört hat. Jetzt zerlegen die kämpfenden Parteien das Land; irgendwelche verläßlichen Einheitsperspektiven sind im Streit um Machtpositionen und Lokalherrschaften nicht auszumachen.
Diesmal melden sich aber auch die Nachbarländer und mischen sich nicht bloß unter der Hand ein, sondern kämpfen offiziell mit. Erst Ruanda und Uganda auf Seiten der neuen Rebellen. Dann Angola, Zimbabwe, Namibia auf Seiten Kabilas; die stellen dem Noch-Präsidenten die Gewalt zur Verfügung, die er nicht hat. Lauter unbefugte Länder sind in den Konflikt involviert; teils wegen ihrer eigenen Rebellenmannschaften, teils weil sie im Kongo politische Stammesgenossen oder Verbündete ausgemacht haben, teils weil sie sich glatt eine Rolle in der Region zutrauen. Lauter Ersatzgewalten mithin, die selber betroffen und ziemlich beschädigt, also unberechenbar sind:
„Erstmals in der Geschichte Afrikas kämpfen reguläre Truppen verschiedener Staaten gegeneinander“.
Damit ist er da, der viel beschworene ‚Flächenbrand‘ in der Region: Am Kongo findet jetzt der Übergang zum gesamtafrikanischen Kriegsszenario statt. Das sind jedenfalls nicht die Hilfsdienste, die die Weltaufseher den afrikanischen Ländern zugedacht haben. Daran hatte Amerika keinesfalls gedacht, als es den Kontinent zu einer Art Gemeineigentum erklärt hat.
Das einzige afrikanische Land, das nicht unter die üblichen Problemfälle afrikanischer Herrschaft fällt, Südafrika sieht sich herausgefordert. Es betrachtet Schwarzafrika als seine natürliche Einflußsphäre, und zwar seit dem Ende der Apartheid mit der Perspektive einer Macht, die nicht mehr lauter Feinde einzudämmen hat, sondern endlich zu einer eigenen Politik als anerkannte Ordnungsmacht in der erweiterten Region befreit ist. Ihren Führungsanspruch in Konkurrenz zur Aufsichtsmacht der USA und zu Europa untermauert es mit dem Angebot, unter seiner Regie könnte Schwarzafrika endlich für eine eigene, nicht von ‚außen‘ aufgenötigte Staatenordnung sorgen. Am ersten großen ‚Krisenfall‘, im Kongo, zeigen sich also die Schranken der südafrikanischen Ambitionen: Bei den angesprochenen Ländern besteht gar kein Bedarf nach einer solchen ‚Übereinkunft aus eigener Kraft‘.
6.
Es zeigt sich aber auch eine gewisse Verlegenheit der Mächte, die sich die entscheidende Kompetenz für internationalen Ordnungsaufgaben reservieren wollen. Allen voran die USA, aber eben auch Europa, haben erstens diesen Zerfall des Kongo und der bisher gültigen zwischenstaatlichen Gepflogenheiten nicht gewollt. Entsprechend lächerlich ist die Frage, ob sich hier Amerika durchgesetzt oder eher Frankreich im Nachhinein Recht behalten hat. Der amerikanischen Regierung ist es zwar ohne große Mühe gelungen, Frankreichs Zuständigkeitsanspruch im Kongo zu durchkreuzen. Aber die Erwartung, daß das zu einer Besserung der Lage, weil automatisch zu einer verläßlichen Gefolgschaft führen würde, hat sich nicht erfüllt. Daß hier nur eine unbefugte Aufsichtsmacht durch eine befugtere, die Weltmacht selber, ersetzt werden müßte, das ist eine Sicht der Dinge, mit der Amerika zwar ein Stück französischen Einfluß untergraben, aber nichts Verläßlicheres an die Stelle gesetzt hat. Es hat das Gegenteil bewirkt. Die politischen Zustände des Kongo, die der Weltmacht als unzumutbar erschienen sind und sie zum Handeln bewegten, gehen nämlich nicht auf einen zu großen Einfluß Frankreichs zurück.
Zweitens stellen sich Amerika und Europa jetzt gemeinsam die Frage, wie man den Aufruhr im Land unter Kontrolle bringt und die Nachbarn wieder ausmischt. So weit ist die Sache inzwischen jedenfalls längst gediehen, daß eine Einheit des Landes ohne gehörigen Gewaltaufwand von außen nicht mehr zu haben ist. Ein eigenes Eingreifen der Art, daß man sich selber zwischen die unberechenbaren Fronten stellt, war nicht vorgesehen, und daran ist jetzt schon gleich gar nicht mehr zu denken. Um so mehr widmen sich die Aufsichtsmächte der Frage, was für ‚Konfliktlösungen‘ der unübersichtlichen Lage, zu der Kongo jetzt endgültig geraten ist, denkbar und wünschbar wären. Die ‚Lösungen‘, an die gedacht wird, sind auf dem Feld der Herrschaftsrechte angesiedelt, über deren Verteilung man selber entscheiden will. Spekuliert wird inzwischen auch offiziell über eine Veränderung der politischen Landkarte: ob der „Kongo nicht viel zu groß ist, um regiert werden zu können“ und ob es mehrere verkleinerte Gebilde nicht eher täten. Trennung wird erwogen: Ein nützliches rohstoffreiches Katanga, ein an Ruanda orientiertes weit entferntes, ohnehin bedeutungloses Kivu; die richtige Auseinandersortierung von Banyamulenge- und Katanga-Negern… Indem man den Zerfall sanktioniert, soll wieder Festigkeit einkehren; indem man die gegensätzlichen Ansprüche stammesmäßig oder sonstwie auseinander dividiert und sie offiziell in den Status regionaler Herrschaftsrechte erhebt, sollen sie berechenbar, dem eigenen Einfluß wieder zugänglich werden. Ein solches Konzept bringt den selbstverständlichen Ordnungsanspruch ebenso zum Ausdruck wie die Verlegenheit, über kein Rezept zu verfügen, wie man ihm in diesem Fall Genüge tun kann. Die Bedenken werden gleich mitgeliefert: daß mit dem Eingreifen afrikanischer Nachbarn jetzt schon eine ganz entscheidende und von den Imperialisten beaufsichtigte Stütze der afrikanischen Verhältnisse ins Wanken zu geraten droht: die alten Kolonial-, d.h. die jetzigen Staatsgrenzen. Sich selber das Recht vorzubehalten, das Prinzip der festen Grenzziehungen außer Kraft zu setzen, macht daraus aber noch lange kein Stabilitätsprogramm.
7.
Und was macht das kongolesische Volk, das nach dem Willen des Westens eigentlich längst hätte zur Wahl gehen sollen? In der Hauptstadt massakriert es solche, die es für Rebellenanhänger hält; woanders andersherum. Zehntausende sind auf der Flucht. Vom Rest hört man nichts.
Angola: Ein verordneter Wiedervereinigungsprozeß und seine Folgen
In Angola ist es wieder so weit. Der ‚Bürgerkrieg‘ droht wieder auszubrechen und den Friedensprozeß zu untergraben, der mit der Entwaffnung der UNITA-Kämpfer, ihrer Eingliederung in Armee und Polizei und der Beteiligung ihres Chefs Savimbi an der Regierung angeblich kurz vor seinem erfolgreichen Ende stand. Der Mann will einfach nicht, hält immer noch 12000 Mann unter Waffen, ein ganzes Gebiet samt Diamantenmine unter seiner Gewalt, kauft sich von den ‚illegalen‘ Erlösen Waffen. Ein einziges Ärgernis.
Der Ärger gilt einem Stammeschef, den der vereinte Westen und Südafrika einmal zum Krieg gegen die MPLA-Mannschaft ermuntert und befähigt hat, die mit der Selbständigkeit an die Macht gekommen war und des Sozialismus verdächtigt wurde, weil sie sich bei ihrem Kampf um selbständige Macht von der Sowjetunion unterstützen ließ. Damals verlangte der Westen von den Nachbarländern, der UNITA als Aufmarsch- und Rückzugsgelände zur Verfügung zu stehen, Südafrika griff selber ein, und Angola konnte seine Erdölenklave Cabinda, ökonomisch vom Westen genutzt, nur mit cubanischen Soldaten unter Kontrolle halten – eine von allen Beobachtern immer wieder bemerkte Pikanterie im Kampf gegen das Vordringen des Weltkommunismus. Zwanzig Jahre hat der Bürgerkrieg gedauert, bis die Cubaner abzogen, sich die Sowjetunion auflöste, sich der Kommunismusverdacht gegen die Regierung damit erledigte und die internationale Staatengemeinschaft dem zerstörerischen Treiben in Angola nicht länger zusehen konnte und unter Aufsicht einer UNO-Truppe das in Gang leitete, was – wie immer – ‚Friedensprozeß‘ heißt.
Seitdem ging es nicht mehr um Destabilisierung, sondern um die Herstellung von Stabilität im Land. Die war schon deshalb geboten, weil auch während des Kampfs gegen den Kommunismus die Ölkonzerne nicht untätig waren und inzwischen zusätzliche Ölvorkommen entdeckt haben; das hat das Bedürfnis nach einem verläßlichen Ansprechpartner vor Ort verstärkt. Damit hatten selbstverständlich auch die Kalkulationen der Kriegsparteien ihr Recht verloren, denn der Westen sah keinen Grund für Parteilichkeit mehr. Jetzt war Savimbi für seine ehemaligen Förderer wieder nur ein weiterer afrikanischer Stammesführer, dessen Ambitionen man nichts Brauchbares mehr abgewinnen kann; und auch auf der anderen Seite entdeckte man jetzt nichts mehr von sozialistischen Ideen, sondern das übliche afrikanische Patronagewesen einer Führungsfigur, die aber über entscheidenden Anhang im Land verfügt und entscheidende Positionen in der Hand hat. Also erging das Kommando, beide Seiten sollten sich jetzt gefälligst arrangieren, die verfeindeten Mannschaften irgendwie zu einer Staatsarmee zusammenwerfen, ihre Kampf- schleunigst in Parteiverbände umbilden und gemeinsam die Verantwortung tragen, so daß wieder Ordnung einkehrt und mit Angola ungestört kalkuliert werden kann. Im Friedensvertrag von Lusaka von 1994 haben beide Seiten dem äußeren Einigungsgebot zugestimmt. Seitdem geht die Einigung ihren Gang – und kommt einfach nicht zustande.
Einerseits gibt es dank der aktiven Bemühungen von außen inzwischen endlich eine überall im Ausland anerkannte Regierung. In einem den Kriegsparteien aufgenötigten Wahlakt hat sich vor ein paar Jahren die MPLA durchgesetzt, und zwar so gründlich, daß die auswärtigen Betreuer um des lieben Friedens willen dem Wahlsieger dringlich empfohlen haben, von seinem Sieg keinen Gebrauch zu machen, sondern die in der Wahlschlacht unterlegene UNITA als mitregierungsberechtigt anzuerkennen. Seitdem demonstriert die regierende Mannschaft unter internationalem Beifall ihren Willen, eine „Regierung der Einheit und nationalen Versöhnung“ zu bilden; schließlich garantiert ihr der Verzicht auf die volle Ausübung einer Regierungsgewalt, die sie ohnehin nicht im ganzen Land besitzt, internationale Anerkennung und damit einen entscheidenden Vorteil im Machtkampf. Deshalb hat sie die UNITA als offizielle Oppositionspartei anerkannt, Savimbi den Sitz des Regierungs-Vizepräsidenten angeboten und UNITA-Befehlshaber zu Regierungsverwaltern in den von ihnen beherrschten Regionen ernannt – als wäre damit die Wiedereingliederung dieser Landesteile in die zentrale Staatsverwaltung vollzogen. Die Feindschaft ist darüber nicht erloschen, aber die Regierung hat sich bisher mit Aktionen im Innern zurückgehalten. Dafür haben angolanische Truppen in Kongo-Zaire und in Kongo-Brazzaville in die Auseinandersetzungen eingegriffen, um den designierten angolanischen Vizepräsidenten mit seiner Partei von den ausländischen Nachschubbasen abzuschneiden.
Der ist nämlich weiterhin militärisch unterwegs, weigert sich, sein militärisches Hauptquartier in eine Parteizentrale zu verwandeln und diese in die Hauptstadt zu verlegen, und tritt sein Amt einfach nicht an. Er weiß schon warum. Die politische Berücksichtigung als zu befriedende Partei verdankt er allein der militärischen Gewalt, die er über einen Teil des Landes ausübt. Für die angebotene Machtbeteiligung soll er auf seine Machtbasis verzichten; und mit der Auflösung seiner eigenen Armee entmachtet er sich auch als politischer Konkurrent. Nichts für einen Mann, den seine Rolle als anerkannter Freiheitskämpfer des Westens zur Alternative in Angola hat werden lassen. Diese Rolle hat er verloren; um so mehr gilt es für ihn, sich selber als Alternative zu behaupten. Nach mehrjährigem Taktieren scheint Savimbi jetzt entschlossen, den offenen Kampf wieder aufzunehmen und bisherige Zugeständnisse – partielle Entwaffnung seiner Truppe, Beteiligung der UNITA am Parlament – zu widerrufen. Darüber sieht sich die Gegenseite dann auch zur Betätigung der Gewalt, über die sie verfügt, herausgefordert. So kommt der Krieg in Angola wieder auf die Tagesordnung; diesmal nicht wegen des westlichen Feldzugs gegen den Sozialismus, sondern aufgrund des imperialistischen Befriedungsprogramms, dem sich die verfeindeten Machthaber vor Ort unterordnen sollen. gleichgültig, ob sie dabei gewinnen oder verlieren.
Wie sich mit Eritrea und Äthiopien zwei afrikanische ‚Hoffnungsträger‘ bekriegen
[1] Im Rahmen dieses Programms will die amerikanische Regierung sich dafür einsetzen, daß mehr private Investitionen nach Afrika fließen
, und Infrastrukturinvestitionen
fördern; der Marktzugang für afrikanische Waren soll erleichtert werden, in absehbarer Zeit sollen Verhandlungen über Freihandelsabkommen aufgenommen werden; ferner ist ein begrenzter Schuldenerlaß in Aussicht gestellt; jährliche Treffen der Wirtschaftsminister sollen die neuen Beziehungen auf eine dauerhafte Grundlage stellen.
[2] Es gehört zur Ironie der politischen Ökonomie dieser Länder, daß ihre „Naturschätze“ noch in einem anderen, inzwischen nicht unwesentlichem Sinn zur Devisenquelle geworden sind – durch den Tourismus. Inzwischen gibt es neben den Zentren der Rohstoffproduktion und sorgfältig separiert vom Massenelend die Enklaven des Fremdenverkehrs einer mehr oder weniger gehobenen Klasse, der Afrikas „unberührte“ Natur, die Nationalparks, Reservate und Strände konsumiert.
[3] Deswegen blamiert sich auch regelmäßig die Zuordnung der Figuren zu einer der konkurrierenden imperialistischen Mächte. Die kundige Öffentlichkeit, die hinter allen Gewaltaffären ein nationales Interesse der befugten Imperialisten aufspürt, täuscht sich gründlich über den Charakter der Konkurrenz, wenn sie in den verschiedenen Affären der letzten Zeit in Afrika immerzu nach den Figuren fahndet, die das Interesse Frankreichs und Amerikas repräsentieren. Diese positive Zuordnung kommt nicht zustande. Zwar fördern die Aufsichtsmächte immer wieder den Austausch der Figuren und knüpfen daran die Erwartung, der Neue würde den Anforderungen deswegen besser genügen, weil man ihn zur bevorzugten Adresse der eigenen Ansprüche ernennt. Aber es gibt ihn nicht, den ‚Mann Frankreichs‘ oder ‚den Mann Amerikas‘, der ein verläßliches Instrument imperialistischen Einflusses wäre. Einerseits sind ohnehin alle Abhängigkeiten unabhängig von ihren inneren Auseinandersetzungen geregelt. Andererseits sind die Verwalter dieser Dienste mit ihren politischen Selbstbehauptungsanstrengungen überhaupt nicht geeignet für verläßliche Beziehungen; von den imperialistischen Mächten wird ihnen das Angebot ja auch gar nicht eröffnet, man stünde fördernd und nicht bloß fordernd hinter ihnen. Daß eine Ausrichtung an den Ordnungsinteressen der auswärtigen Mächte einfach nicht zuverlässig zustande kommt, das ist der bleibende Ärger – und der Stachel der Konkurrenz zwischen Frankreich und USA in Afrika.