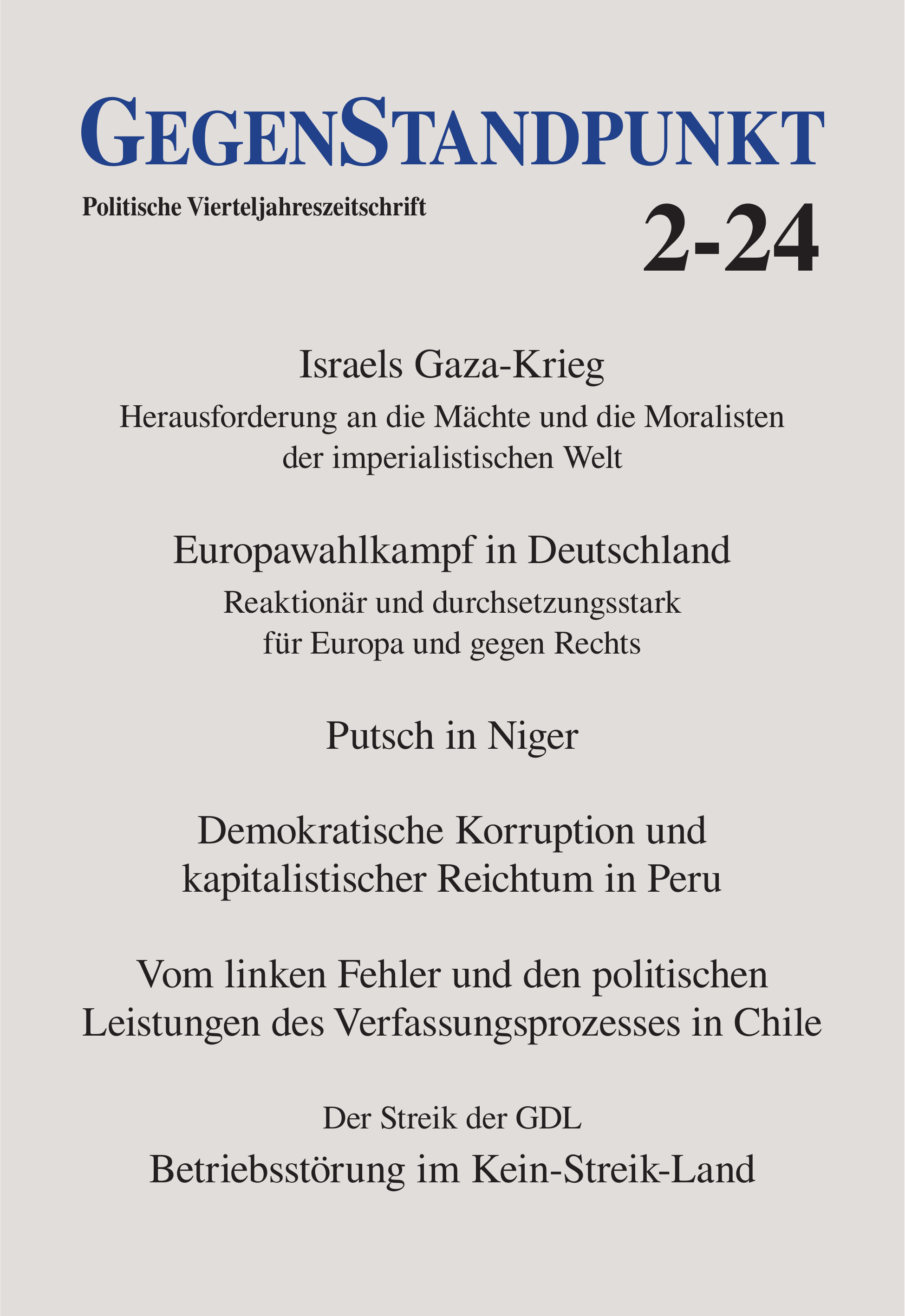Demokratische Korruption und kapitalistischer Reichtum in Peru
Vor gut einem Jahr wird in Peru wieder einmal der erst kurz zuvor gewählte Präsident, ein gewisser Pedro Castillo, ein indigener ehemaliger Dorfschullehrer, ein Linker irgendwie und Hoffnung verarmter Wählermassen, nicht nur abgesetzt, sondern wegen Vorwürfen der Korruption und des illegalen Vorgehens gegen das Parlament gleich ins Gefängnis gesteckt, so wie etliche seiner Vorgänger aller möglichen politischen Couleur. Hierzulande wird man darüber aufgeklärt, dass so etwas seit über 20 Jahren für Staatspräsidenten zu einem Berufsrisiko geworden ist, was seither zum insgesamt beklagenswerten Erscheinungsbild der peruanischen Demokratie beiträgt. Hinzu kommen zuletzt noch Berichte über die blutige Niederschlagung von Protesten der Anhänger des Abgesetzten, überwiegend bitterarme Leute aus dem peruanischen Hochland, unter dem Oberbefehl einer neuen Präsidentin, die das Vertrauen der USA genießt und wieder aus den Kreisen des mächtigen politischen Establishments kommt.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Gliederung
Demokratische Korruption und kapitalistischer Reichtum in Peru
Vor gut einem Jahr wird in Peru wieder einmal der erst kurz zuvor gewählte Präsident, ein gewisser Pedro Castillo, ein indigener ehemaliger Dorfschullehrer, ein Linker irgendwie und Hoffnung verarmter Wählermassen, nicht nur abgesetzt, sondern wegen Vorwürfen der Korruption und des illegalen Vorgehens gegen das Parlament gleich ins Gefängnis gesteckt, so wie etliche seiner Vorgänger aller möglichen politischen Couleur. [1] Hierzulande wird man darüber aufgeklärt, dass so etwas seit über 20 Jahren für Staatspräsidenten zu einem Berufsrisiko geworden ist, was seither zum insgesamt beklagenswerten Erscheinungsbild der peruanischen Demokratie beiträgt. [2] Hinzu kommen zuletzt noch Berichte über die blutige Niederschlagung von Protesten der Anhänger des Abgesetzten, überwiegend bitterarme Leute aus dem peruanischen Hochland, [3] unter dem Oberbefehl einer neuen Präsidentin, die das Vertrauen der USA genießt und wieder aus den Kreisen des mächtigen politischen Establishments kommt.
Während dieses volatile politische Geschehen professionelle Beobachter anhaltend irritiert, zeigen sich die maßgeblichen Kommentatorenund Analysten der ökonomischen Verfassung des Landes durchaus zufrieden, imponiert Peru auf diesem Gebiet doch mit im lateinamerikanischen Vergleich überdurchschnittlich guten wirtschaftlichen Kennziffern bei Wachstum oder Inflation. [4] Auf diejenigen, deren ökonomische Tätigkeiten damit erfasst werden und für die solche Analysen erstellt werden, kommt es auch an, schließlich haben sie die wichtigsten Geschäfte des Landes in der Hand. Und sie bleiben tatsächlich vom „politischen Tagesgeschehen“ weitgehend unbehelligt, sodass einschlägige Berichte immer wieder von einer erfreulichen „Entkopplung der Politik“ vom ökonomischen Erfolg des Landes künden. [5]
Perus Ökonomie und die Weltwirtschaft: beachtliche Reichtumsquellen und ihr Verhältnis zur nationalen Politik
Bei den wichtigsten Geschäften im Land handelt es sich um den Rohstoff- und Agrarexport. Perus „natürlicher Reichtum“, insbesondere Kupfer, Zink und Gold, wird von internationalen Konzernen im Land gefördert und auf dem Weltmarkt bzw. in den Händen der auswärtigen Käufer und Verwender zu kapitalistischem Reichtum.[6] In letzter Zeit wird auch von Projekten zur Exploration von Lithium berichtet, für die man sich in Peru aufgrund günstiger nationaler Konditionen gute Chancen bei der Konkurrenz um die Ausnutzung der steigenden weltweiten Nachfrage ausrechnet. [7] Dort nehmen internationale Konzerne die staatlich angebotenen Bedingungen wahr, um sich mit geschäftsdienlicher Rücksichtslosigkeit gegen Land und Leute und mit anhaltendem Erfolg an Abbau und Export dieser Bergbauprodukte zu bereichern. Und gerade mit derlei Rücksichtslosigkeit leisten die Konzerne einen Beitrag zur Fortschreibung ihres Geschäftserfolgs, soweit sie sich an der billigen Arbeitskraft der vertriebenen Landbevölkerung und freigeräumtem Land für die Erweiterung ihrer Gewerbe bedienen. Daneben entwickelt sich der peruanische Agrarsektor dank hohem Kapitaleinsatz und entsprechender Kapitalproduktivität der engagierten Lebensmittelkonzerne zu einer stetig wachsenden Branche, die die Subsistenzwirtschaft [8] der armen Landbevölkerung und die darüber hinausgehende Produktion für die lokalen Märkte verdrängt und mit ihrer besonderen Produktpalette vor allem auswärtige Märkte zunehmend erfolgreich zu nutzen versteht. [9]
Im Land selber kommt neben diesen erfolgreichen Exportbranchen außer auf dem Feld des Drogenhandels keine nennenswerte kapitalistische Akkumulation zustande. Die nationale Wirtschaft leidet vielmehr, soweit überhaupt vorhanden, unter dem internationalen Konkurrenzvergleich, dem die peruanischen Betriebe auf den inländischen Märkten aufgrund der liberalen Freihandelspolitik Perus ausgesetzt sind. Die soll den eigenen Export und die einschlägigen Einnahmen fördern, öffnet damit aber zugleich die einheimische Zahlungsfähigkeit einer zwar überwiegend armen, aber eben doch 33 Millionen starken Bevölkerung dem Zugriff ausländischer Importeure mit ihren konkurrenzfähigeren Produkten. [10] Ansonsten gibt es keine nennenswerten Ansätze zu einer inländischen Reichtumsproduktion, die auch relevante Teile des Volkes dafür gebrauchen und ihnen damit eine Einkommensmöglichkeit geben würde. An der Nützlichkeit für diese ökonomisch herrschenden Verhältnisse erfolgt die Sortierung des Volkes: Über ein einigermaßen reguläres Geldeinkommen verfügen die Beschäftigten der Bergbau- und Agrarkonzerne in deren großstädtischen Verwaltungszentren, während die Minen- und Feldarbeiter, erst recht in den zahlreichen illegalen Betriebsstätten, mit unregelmäßig bezahlten Hungerlöhnen auskommen müssen. In den Großstädten, vor allem in Lima, wo inzwischen etwa ein Drittel der Bevölkerung haust, hat sich eine Art städtisches Bürgertum gebildet. Das lebt von den Diensten, für die es als Mitarbeiter der ausländisch dominierten Exportindustrie, im Bereich des Handels, des Bankwesens oder der Verwaltung, auch als Polizisten, Zöllner und Militärs angeheuert wird. Diese Gehaltsempfänger umfassen – zusammen mit den Teilhabern an den Erträgen, die der in- und ausländische Tourismus des Andenlandes und das Drogengeschäft abwerfen – in etwa ein Drittel der arbeitenden Bevölkerung des Landes. In den Städten leben wiederum von deren Gehältern Massen von armen Leuten als Haushaltskräfte, Küchenhelfer in der Gastronomie, sonstige Dienstleister oder Kleinkriminelle der untersten Kategorie. Der verbleibende große Rest des Volkes steht den florierenden Geschäften eher im Weg und wird in den Armutsgebieten auf dem Land und in den Slums von Lima unter Aufsicht der bewaffneten Staatsmacht sich selbst und seinem Überlebenskampf überlassen.
Die Mehrung des maßgeblichen Reichtums in Peru findet also nicht durch kapitalistisch produktive Arbeit im Land statt. Er kommt zustande durch das Engagement der großen ausländischen Konzerne, durch deren Geschäft mit den dort extrahierten mineralischen oder agrarischen Produkten und Rohstoffen, die sie weltweit verkaufen, und mehrt sich in deren Hand. Aus der Sicht des Staates und derer, die den Standort nach seinen kapitalistischen Qualitäten beurteilen, sind sie die „zentralen Devisenbringer“, die in Peru „üblicherweise für einen Exportüberschuss sorgen“ (gtai.de, 23.12.22). Der staatliche Reichtumentstammt so hauptsächlich der Partizipation des peruanischen Staates an den Akkumulationserfolgen ebendieserKonzerne; sein Materialismus geht also zum größten Teil in der Teilhabe an deren Erfolgen auf. Als politisches Subjekt dieses Verhältnisses betätigt sich der peruanische Staat erstens darin, dass er sich als Preis für sein Angebot, die von ihm regierten Naturgegebenheiten zur Mehrung kapitalistischen Reichtums zu gebrauchen, seinen Anteil an diesem Reichtum verschafft – in Form von gesetzlichen Steuern, deren unveränderte Höhe den Unternehmen anfangs für 25 Jahre garantiert wurde, und in Form von durch die zuständigen Amtsträger ausgehandelten Konzessionsabgaben, die ebenfalls in den Kassen des Staates landen. Zweitens entscheidet die Politik per Erstellung eines staatlichen Haushalts dann auch souverän über die Verwendung dieser Gelder. Die in Peru ansässigen Exporteure, von denen es wegen des „stetigen Zustroms ausländischer Investoren“ (The Economist, 22.2.24), die solche Voraussetzungen für ihr Engagement schätzen, immer mehr gibt, zahlen ihre Steuern und Konzessionsgebühren sowie Löhne und alle möglichen Dienstleistungen in Landeswährung. Dafür kaufen sie aus ihren Weltmarkterlösen den peruanischen Sol – mit der Folge, dass sich bei der peruanischen Zentralbank Dollars und anderes gutes Geld ansammeln. „All dies hat es der Zentralbank ermöglicht, internationale Reserven in Höhe von 74 Mrd. USD anzuhäufen, was etwa 28 % des BIP entspricht und den höchsten Wert in der Region darstellt.“ (Ebd.) Das stiftet auf den Finanzmärkten Vertrauen in die peruanische Zahlungsfähigkeit und hält den Sol in Wert gegenüber den maßgeblichen Währungen, ohne dass man dafür dauernd Devisen aufwenden müsste: „Es genügt, dass der Markt weiß, dass wir intervenieren können, sagt Herr Velarde“, der Gouverneur der Zentralbank. (Ebd.)
Auf der Ausgabenseite halten sich die peruanischen Regierungen seit der Amtszeit des Präsidenten Fujimori in den 90er Jahren an die Leitlinie, dass es die Aufgabe der Wirtschaft und nicht der Politik sei, mit kapitalistischen Erfolgen das Land zu entwickeln und seinen Wohlstand zu mehren. [11] Im Gegensatz zu seinen unmittelbaren Vorgängern, die mittels verstaatlichter Betriebe und einer nationalen Kreditförderbank die Entwicklung der Ökonomie vorantreiben wollten, setzte Fujimori den Beschluss rigoros durch, dass sich der peruanische Staat derlei Ambitionen nicht leisten kann; er reprivatisierte die verstaatlichten Betriebe und löste die nationale Entwicklungsbank wieder auf. So hat sich Peru in der imperialistisch geordneten Welt neu eingerichtet, in der es sich behaupten will, und die Maßstäbe staatlichen Handelns entsprechend neu gesetzt: Die Staatsführung hat den Nutzen der Nation dadurch zu fördern, dass sie das freie Wirken des nationalen wie internationalen Kapitals fördert; sie hat für infrastrukturelle Geschäftsbedingungen zu sorgen, die möglichst selbst zu lohnenden Geschäftsobjekten werden sollen, wie etwa derzeit der Bau eines großen Pazifikhafens durch China, einer Metro in Lima [12] oder einer neuen Straßenverbindung zwischen Atlantik und Pazifik. [13] Der Ehrgeiz, ein nationales wirtschaftliches Wachstum mit öffentlichen Schulden zu inszenieren, ist vom Standpunkt dieser Räson aus per se verkehrt: Wären solche Projekte wirklich lohnend, würden sie gleich vom privaten Kapital in Angriff genommen. Eine Politik der nationalen Entwicklung durch den Einsatz von Staatskredit führt nur zur Anhäufung von Staatsschulden, denen kein entsprechendes kapitalistisches Wachstum gegenübersteht, am Ende sogar zum Ruin des nationalen Geldes. Genauso falsch ist es, ins nationale Humankapital zu investieren, das die Wirtschaft ohnehin nur dann zu vernünftigen Preisen mobilisiert, wenn sie es wirklich braucht. Deshalb hält sich der Staat bei der Bewirtschaftung des Volkes, auch bei Bildungs- und Gesundheitsausgaben – statistisch mit knappem Vorsprung vor Haiti – zurück und überlässt es wohltätigem kirchlichem Engagement oder kostenpflichtigen privaten Bildungsstätten, aus denen etwas zu machen, die es sich leisten können; und was für die Bildung recht, ist für die Krankenversicherung nur billig. So hält das heutige Peru haushalterisch sein Geld zusammen und pflegt das als erste Investitionsbedingung, die für das Land sprechen soll. Es senkt seine Staatsschuldenquote 2023 auf ca. 33,9 Prozent des BIP (de.statista.com; de.wikipedia.org) und glänzt unter dem Beifall der Öffentlichkeit mit 3 % Inflation.[14]
In demselben Sinn ist es dagegen eine schöne und lohnende Aufgabe der Politik, dafür zu sorgen, dass sich staatliche Ämtermacht und vorhandene Kapitalinteressen ausreichend kennenlernen, schließlich fällt der Staatsmaterialismus, den die dortigen Amtsinhaber zu befördern haben, mit der Freisetzung kapitalistischer Investoreninteressen gemäß der von der dominierenden politischen Elite geteilten Staatsräson zusammen. Zu diesem Zweck wurde schon 1994 das Peruanische Wirtschaftsinstitut mit finanzieller Unterstützung der Weltbank und der großen einheimischen Konzerne gegründet, das beispielhaft für die enge Kooperation von Politik und in- und ausländischen Wirtschaftsinteressen steht: ein „neoliberaler Thinktank“, der für Austausch und Durchlässigkeit zwischen Ministerien und Unternehmerinteressen und insgesamt für eine förderliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit sorgt. Das Institut wurde
„zum Vorzimmer der Macht, in dem Gesetze und Reformen geschmiedet wurden. So bildete das Fujimori-Regime ein staatlich-privates Konglomerat, das die Förderung der Wirtschaftselite institutionalisierte. Die Grenze zwischen öffentlicher Sphäre und privater Lobby löste sich auf.“ (Le Monde diplomatique, 7.1.21)
Kritische Beobachter sehen darin den „Nährboden für die Korruptionsskandale, die Peru bis heute erschüttern“ (ebd.).
Politisches Leben: Streit um die Betreuung des peruanischen Kapitalismus und um ehrlich verdiente Bestechungsgelder
Über die ökonomische Staatsräson Perus, die Fujimori einst mit Unterstützung des Militärs per Staatsstreich aus dem Präsidentenamt heraus – „autogolpe“ – inklusive der Entmachtung des Parlaments und der Renovierung der Verfassung durchgesetzt hat, besteht innerhalb der politisch herrschenden Klasse Konsens. Doch die erfolgreiche Auslieferung des peruanischen Standorts an das internationale Geschäft, die darauf beruhende Solidität des Staatskredits und die immer wieder gelungene brutale Niederwerfung von Aufständen der armen städtischen und ländlichen Massen stiften keine politische Stabilität innerhalb dieser Truppe. Deren Fraktionen – Parteien, Grüppchen, Individuen – bekämpfen sich erbittert in einer internen Machtkonkurrenz; die betrifft die konkrete Ausgestaltung staatlicher Maßnahmen, mit denen die Amtsinhaber die peruanische Staatsräson praktisch, d.h. rechtskräftig und ökonomisch wirksam machen. Dabei geht es zum einen um Fragen der Art, welche Firma zu welchen Lizenzgebühren, mit welchen Steuervorteilen in welcher Region, auf dem Boden welcher Gemeinde mit einem neuen Bergwerk wie viel Land zugesprochen bekommen soll, es vergiften und Leute vertreiben darf; zum anderen darum, welche und wie viele Investitionen in welche öffentlichen Projekte zugunsten welches privaten Auftragnehmers erfolgen sollen. Darüber herrscht überhaupt kein politischer Konsens, dafür umso mehr der Ehrgeiz, sich an der Amtstätigkeit privat zu bereichern. Mit der Konkurrenz um staatliche Posten, damit um die politische Entscheidungsgewalt im Lande, wird stets die Auseinandersetzung um die materielle Teilhabe eröffnet, um die partikulare Nutznießerschaft an dem ökonomischen Erfolg der Nation – als Partei, Bürgermeister, Abgeordneter und Präsident, der mit all seinen herausgehobenen Amtskompetenzen oberster Repräsentant peruanischer Staatlichkeit und zugleich Teilnehmer dieser Konkurrenz ist. [15] Das kostet peruanischen Politikern reihenweise ihre amtsbezogenen Privilegien, wie es entsprechend umgekehrt anderen neue Perspektiven eröffnet. [16]
Dafür, dass diese Machtkonkurrenz die bekannte unendliche Abfolge von Skandalen hervorbringt, ist der Umstand, dass die ganze Wirtschaftsweise und das politische Leben auch in Peru institutionell, formell, juristisch und moralisch den Maßstäben bürgerlicher Rechtsstaatlichkeit unterworfen sind, äußerst produktiv. „Korruption“, also Bestechlichkeit und persönliche Vorteilsnahme im Austausch für politische Entscheidungen, ist selbstverständlich verboten; es gibt sogar eine eigene Behörde, die sich um dieses Übel kümmert. Andererseits wird mit derartigen Bemühungen ausgerechnet der gewöhnliche und gewohnte Ablauf des staatlichen Lebens zum ständig mit Strafe bedrohten Sachverhalt, also eine politische Praxis grundsätzlich kriminalisiert, vermittels derer die alltägliche kapitalistische Vernutzung dieses Standortes und deren politische Begleitung und Betreuung exekutiert werden. Gerade darüber wird die Korruptionsbekämpfung selbst gleichzeitig in den Dienst der privaten Bereicherung gestellt. [17] So kommt es, dass die gleichen Rechtsformen und das gleiche Ethos der Korruptionsbekämpfung wie in den entwickelten imperialistischen Demokratien beim Aufeinandertreffen mit den politischen Gepflogenheiten des „Schwellenlandes“ Peru andere Wirkungen zeitigen als in den Heimatländern der Demokratie. In Peru geht das politische Leben mit seinem landesüblich konstruktiven Verhältnis zur heimischen Ökonomie – darin eingeschlossen sogar die entschieden illegalen Abteilungen der nationalen Wirtschaft [18] – gemäß der Stellenbeschreibung peruanischer Amtsmacht darin auf, durch die amtliche Lizenzierung und die staatliche Pflege ausländischer Benutzung des Landes jeweils angemessene Anteile des darüber erzielten Reichtums in peruanische staatliche Kassen zu bringen. [19] Dabei ist der Korruptionsvorwurf eine Waffe der politischen Konkurrenz – auf allen Feldern der politisch-ökonomischen Kooperation, eben eine Verlaufsform desselben Machtkampfs: Dessen Teilnehmer bedrohen sich wechselseitig und schalten sich im Bedarfsfall fortwährend auch aus, sofern es ihnen gelingt, die richtigen Richter, eine passende Mehrheit im Parlament und – vor allem bei größeren Aktionen wie der Absetzung des Präsidenten – die Unterstützung der Armee zu finden. Kommt die Waffe des Korruptionsvorwurfs juristisch erfolgreich zum Einsatz, dann wächst dem siegreichen Interesse Rechtsgültigkeit zu, der Gegner ist kriminalisiert und womöglich, wenn er nicht gleich längerfristig weggesperrt wird, mit Blick auf die nächsten allfälligen Wahlkämpfe zumindest politisch beschädigt.
Mitte des Jahres 2021 betritt mit dem Präsidenten Castillo die Ausnahme von alledem die politische Bühne Perus. Auch er ruft zwar einen Kampf gegen Korruption aus, verlässt damit jedoch den jahrelangen Konsens der herrschenden Demokraten, indem er eine Erhöhung des staatlichen Anteils am Kupferpreis fordert, um sein Versprechen von besseren Schulen [20] und mehr gesundheitlicher Versorgung für das Volk zu realisieren. Angesichts einer solchen Ausrichtung peruanischer Präsidentschaft mit ihrer zum handfesten Protest neigenden Anhängerschaft melden sich professionelle Bedenkenträger: Auch wenn „in den kommenden Jahren gewaltige Investitionen von knapp 54 Milliarden US‑Dollar“ vor allem im Kupfersektor erwartet werden, könnten „mittelfristig Wachstum und Investitionen“ wegen „politischer Instabilität“ gefährdet sein (gtai.de, 29.12.22). [21] Das haben die etablierten peruanischen Staatsmacher offenbar ähnlich gesehen: Sie verhaften den linken Präsidenten, schlagen die darauffolgenden Proteste nieder und sorgen so wieder für eine politisch stabile Koppelung von Gewalt und nationaler Ökonomie ganz im Sinn der gültigen wirtschaftspolitischen Orientierung der Nation.
Das Volk,
an das Castillo denkt und dessen Wohlfahrt mit der politischen Stabilität des peruanischen Staatswesens und dem Geschäftsleben dort so unvereinbar ist, ist an diesen Verhältnissen folgerichtig in lauter trostlosen Rollen beteiligt: etwa als Opfer der international anerkannten Erfolge der peruanischen Ökonomie, deren Hauptaktivisten rücksichtslos gegen Land und Leute ihre Gewerbe betreiben. Besonders betroffen von den Folgen des Bergbaugeschäfts ist die indigene und sonstige Landbevölkerung, die das Geschäft mit ihrer schieren Anwesenheit und erst recht dort stört, wo sich betroffene indigene Gemeinden gegen die Verheerungen durch das Geschäft wehren. Die Bewohner werden durch die politisch geförderte ständige Expansion der Bergbauunternehmungen entweder direkt von dem Land, von dem sie schlecht genug leben, verdrängt oder von den giftigen Abfallprodukten des Bergbaus in ihrem Trinkwasser und auf ihren Äckern verseucht. [22] Soweit sie als Arbeiter gebraucht werden, werden sie – darunter auch Kinder – im Goldbergbau vernutzt, als Kupferarbeiter mit Verträgen oder ohne beschäftigt, teils weit unter dem Mindestlohn, der getreulich im Gesetz steht, teils über längere Zeit gar nicht bezahlt. Sie werden ohne Arbeitsschutz geheuert und nach Unfällen gefeuert; nach ihren unvermeidlichen Protesten und Streiks, oft mit wochenlangen Sperrungen von großen Durchgangsstraßen, werden sie von Polizei, Militär, Werksschutz und gemieteten Schlägerbanden bedroht und straflos umgebracht. In vielen Fällen ist das Ergebnis die Flucht aus dem Hochland in die Elendsviertel der großen Städte. Mit ihrer entsprechend hohen Kriminalitätsrate und ihren Protesten gegen solche Verhältnisse werden sie als Ordnungsproblem behandelt, also der brutalen Gewalt von Polizei und Militär ausgesetzt.
Von den Kommandeuren dieser rücksichtslosen Ordnungsgewalt liegt dem Volk das alternativlose Angebot zur politischen Teilhabe an den für die Massen unerträglichen Verhältnissen vor: Es kann – es muss sogar – sich an periodischen Abstimmungen zur Ermächtigung neuer Abgeordneter, Gouverneure oder Präsidenten beteiligen, also als Wählerbasisder peruanischen Demokratie dienen. Für die jahrzehntelangen unerfreulichen Erfahrungen dieser Basis mit ihrem Herrschaftspersonal haben die Amtsbewerber ebenfalls seit Jahrzehnten im Grunde eine einzige Erklärung im Angebot: die Korruption der anderen. Die verhindert den Fortschritt für die Peruaner, und mit der muss endlich Schluss gemacht werden. Das glaubt angesichts der langen Tradition dieses Versprechens, seiner regelmäßigen Enttäuschung und der umfassenden Wechselseitigkeit der einschlägigen Beschuldigungen auch ein gutwilliger Wähler kaum mehr; was nicht heißt, dass nicht doch immer wieder, angesichts der verzweifelten Gegenwart, der glaubwürdigste Anbieter einer besseren Zukunft gewählt würde. Und wenn die dann wieder nicht kommt, wird das von den Enttäuschten mit der ohnmächtigen Aufforderung an die gesamte Politikermafia quittiert, sie solle sich am besten kollektiv verpissen: Que se vayan todos!
Wenn das Wahlvolk dann doch wieder einmal einen glaubwürdigeren Volksführer findet – wie Pedro Castillo mit seiner Herkunft aus armen und indigenen Verhältnissen –, dann soll es als geführtes Volk einmal mehr auf ein besseres Peru hoffen. Der neue Mann wirft den Widerspruch der peruanischen Staatsmacht, sich auf alle Peruaner besitzergreifend als ihr Staatsvolk zu beziehen, ohne es konsequent zum Nutzen der Nation bewirtschaften zu wollen, auf seine Weise neu auf: Während die vorherrschende politische Klasse einen übermäßigen Aufwand für Gesundheit, Bildung und Soziales als Grund für den Niedergang früherer Jahre kennen will, hält Castillo die Pflege des Volkes für eine Bedingung des nationalen Erfolges; die nötigen Finanzmittel wären auch jederzeit verfügbar, würden die neoliberalen Herren des Landes nicht die peruanischen Ressourcen zu Tiefstpreisen an das Ausland verschleudern. Castillo vertritt damit das alternative Ideal einer Staatsführung, unter der die auswärtige kapitalistische Benutzung des Landes keine Armut im Lande zur Folge haben müsste, wenn der Staat nur einmal ernsthaft seine Arbeit ordentlich machen würde. Deshalb beginnt gutes Regieren auch bei Castillo mit dem „frontalen Kampf gegen die Korruption“ (die folgenden Zitate aus Castillos Regierungsplan – Plan de Gobierno Perú al Bicentenario – Sin corrupción und aus Jacobin, 27.4.21), der erst „ein souveränes Heimatland mit Rechtssicherheit“ und eine bessere „Regie“ über die Nation möglich macht.
Die Mittel dafür sind vorhanden, man muss sie nur vermittels höherer Lizenzgebühren, die in „Verträgen mit den großen Unternehmen neu auszuhandeln“ sind, und „neuer Regeln über Steuern und Abgaben“ hereinholen, „damit mehr von den Gewinnen in Peru bleibt und den Menschen zugute kommt“. Sokann man „den Ausverkauf unseres Reichtums“ beenden – vielleicht muss man sogar „unseren Reichtum verstaatlichen“ – und dann „die Investitionen in Gesundheit und Bildung deutlich erhöhen“, den „Wandel herbeiführen, nach dem sich unser Volk sehnt“, und dafür sorgen, dass es „keine armen Menschen mehr in einem reichen Land“ gibt. Dieses wohlmeinende Regierungsprogramm spricht das arme Volk erstmals seit langem überhaupt wieder als investitionswürdige Ressource des Staates an, indem es seine Armut zu einem Hindernis bei der „Erneuerung des Landes“ erklärt und „fiskalische Nachhaltigkeit“ – die die Besteuerung der Exportunternehmen mit dem Verlauf der Weltmarktpreise verbinden will [23] – mit Armutsbekämpfung durch die Abschöpfung von nicht selbst erwirtschafteten, also „unverdienten“ Unternehmensgewinnen und einer Verfassungsreform zusammenbringt.
Dies erscheint einer knappen Mehrheit des Volkes als ein glaubwürdiges und in Anbetracht seiner verzweifelten Lebensumstände umwälzendes Versprechen eines Präsidenten aus ihren Reihen. Vom Standpunkt der herrschenden Elite im Parlament, die mit ihrer Kandidatin aus dem Fujimori-Clan knapp verloren hat, steht dieses Programm für die Rückkehr zu den schon mehrfach gescheiterten linken Entwicklungsidealen, die den kapitalistischen Fortschritt Perus, für sie die einzige legitime Erneuerung des Landes, kaputtmachen und den Staat samt seinem Geld in einen neuen Ruin treiben würden. Deshalb nutzen sie von Anfang an ihre Parlamentsmehrheit gegen den gewählten, aber nur von Minderheitsfraktionen unterstützten Präsidenten, schießen seine Minister gleich im Dutzend ab und überziehen ihn, „den zufälligen Präsidenten ohne politische Erfahrung und, wie es scheint, ohne jede Eignung für dieses Amt“ (The Economist, 29.9.23), und seine Familie und Unterstützer solange mit Korruptionsvorwürfen und staatsanwaltlichen Ermittlungsverfahren, bis er versucht, in einer Art autogolpe – allerdings ohne die Unterstützung des Militärs wie bei Fujimori in den 90ern – das feindliche Parlament aufzulösen. Daraufhin setzt ihn die Parlamentsmehrheit ab, wählt eine neue Präsidentin und lässt ihn ins Gefängnis sperren, wo er auf seinen Prozess wartet. Das Volk, das auf den falschen Führer gesetzt hat, das aber nicht gleich einsieht und in lange nicht dagewesenem Ausmaß protestiert, muss mit zahlreichen Toten bei der Niederschlagung der Aufstände und mit seiner Zurückverweisung auf den ihm gebührenden elenden Platz als Fußnote der peruanischen Erfolgsgeschichte für seinen Fehler büßen.
Fehlersuche, Lösungsvorschläge und eine klare Präferenz
In der Schweiz, wo man bekanntlich keine Probleme damit hat, „das Volk bei der Stange zu halten“, hat man Vorstellungen zu den Gründen der peruanischen Turbulenzen:
„Peru ist ein Lehrstück dafür, dass ein erfolgreiches Wirtschaftsmodell allein nicht genügt, um die Bevölkerung auf Dauer bei der Stange zu halten – und wie es zum Absturz kommen kann. Es kommt auch auf die Verteilung des Reichtums an... Bedeutende Teile der peruanischen Gesellschaft betrachten sich als zu kurz gekommen und sind deswegen unzufrieden.“ (NZZ, 10.6.22)
Angesichts der anhaltenden blutigen Unruhen beschwört die NZZ die Gefahr eines „Absturzes“ und propagiert mal wieder die nicht zu vernachlässigende Funktion sozialer Rücksicht für einen sozialen Frieden, in dem das arme Volk seine Lage ohne öffentliche Störung erträgt. Da bleibt es vorerst abzuwarten, ob die Macher des peruanischen Erfolgsmodells sich damit anfreunden können, dem Volk in Zukunft bei der Verteilung des Reichtums einen Zuschlag zuzugestehen, statt immerzu mehr Staatsgewalt aufzubieten .
Andere hätten da den kostengünstigeren Vorschlag, das unzufriedene Volk einfach wieder durch „die Ausrufung neuer allgemeiner Wahlen“ zu bedienen und so „das Land zu beruhigen“ (The Economist, 2.2.23). Diese Idee können aber zahlreiche Abgeordnete, deren Wiederwahl sehr unwahrscheinlich wäre und die im Parlament „Privilegien und Gehälter beziehen, von denen sie nie zu träumen gewagt hätten“ (NZZ, 13.12.22), gar nicht leiden – noch ein Zeugnis der zwar widersprüchlichen, aber zur besonderen kapitalistischen Verfasstheit des Landes passenden, eigentümlichen Leistung peruanischer Demokratie: Mit der Wahl neuer Machthaber erneuert der peruanische Staat nicht die Zustimmung des Volks zur Macht, die dadurch personell neu bestückt wird; für diese Zustimmung ist das ewig beklagte Ausmaß an polizeilicher und militärischer Gewalt schon nötig. Stattdessen wird in der Wahl der Machtkampf innerhalb der politischen Klasse um den Genuss amtsbezogener Privilegien immer wieder neu entschieden – also immer weiter fortgesetzt.
Auch die neue Präsidentin Boluarte möchte lieber noch im Amt bleiben und erst einen passenden Wahltermin suchen. Ihre Außenministerin hat nämlich zwischenzeitlich die – immerhin! – stellvertretende Außenministerin der USA treffen dürfen, die „die Unterstützung der USA für Peru und Präsidentin Boluarte und ihre Bemühungen, die peruanische Demokratie zu stärken und Frieden und Stabilität und die Einheit des peruanischen Volkes zu sichern“, bekräftigte und die Präsidentin ermutigte, „die Verantwortlichen für Gewalttaten“ – gemeint sind hier nicht Polizei und Militärs, sondern die Demonstranten aus dem Castillo-Lager – „zur Rechenschaft zu ziehen“ (amerika21.de, 6.2.23). So pochen die Präsidentin und das Parlament zusammen mit ihrem großen nordamerikanischen Verbündeten, der weiß, was er an einer stabilen Herrschaft in Peru und einem zuverlässigen, schrankenlos liberalen und kostengünstigen Lieferanten von Kupfer und Lithium hat, darauf, dass es jenseits von Verteilungsphantasien und demokratischen Wahlspielchen vor allem auf eines ankommt: die Durchsetzung der Staatsmacht, bei der man so verlässlichen Partnern wie den Peruanern zuallererst behilflich sein muss. [24]
[1] „Peru kommt nicht zur Ruhe. Am Mittwoch erreichten die politischen Wirren der vergangenen Jahre einen neuen Höhepunkt. Das Parlament stimmte mit grosser Mehrheit für die Absetzung des linken Präsidenten Pedro Castillo und setzte Vizepräsidentin Dina Boluarte als seine Nachfolgerin ein. Die 60-jährige Boluarte ist die erste Frau an der Spitze des südamerikanischen Landes und das sechste Staatsoberhaupt innerhalb von nur vier Jahren. Castillo wurde noch am Mittwochnachmittag (Ortszeit) festgenommen.“ (NZZ, 9.12.22)
[2] „Ein Blick auf die Präsidenten der vergangenen zwanzig Jahre macht das Ausmass sichtbar. Alejandro Toledo, Präsident von 2001 bis 2006, wartet in den USA auf seine Auslieferung an die peruanischen Behörden. Sein Nachfolger Alan García, der bereits von 1985 bis 1990 Präsident war und das Amt von 2006 bis 2011 erneut führte, entzog sich im April 2019 durch Selbstmord seiner Festnahme. Gegen Ollanta Humala (2011-2016) hat die Staatsanwaltschaft zwanzig Jahre Haft gefordert. Der Nachfolger Pedro Pablo Kuczynski trat 2018 angesichts schwerer Vorwürfe und eines drohenden Amtsenthebungsverfahrens zurück. Martín Vizcarra, der als Vizepräsident von Kuczynski nachrückte, galt dagegen als Hoffnungsträger. Doch seine Ankündigung, mit der Korruption aufzuräumen, brachte ihm einen Machtkampf mit dem Kongress ein. Er eskalierte im Herbst 2019 um die Besetzung von Richterposten am Verfassungstribunal. Das Kräftemessen gewann Vizcarra, weil sich das Militär hinter ihn stellte.“ (NZZ, 15.11.20)
„Am 16. November 2020, kurz nach Mitternacht, hatte die Mehrheit der peruanischen Nationalversammlung den konservativen Abgeordneten Francisco Sagasti zum Übergangspräsidenten gewählt. Er folgte auf den Konservativen Manuel Merino, der eine Woche zuvor das Amt übernommen hatte, nachdem der – ebenfalls konservative – Martín Vizcarra durch eine Intrige seiner eigenen Fraktion gestürzt worden war. Vizcarra war zwei Jahre zuvor an die Staatsspitze gelangt, nachdem der 2016 gewählte Präsident Pedro Pablo Kuczynski aufgrund eines Korruptionsskandals hatte zurücktreten müssen. Der Banker Kuczynski war ebenso wenig links wie seine Vorgänger Ollanta Humala (2011–2016), Alan García (2006-2011) und Alejandro Toledo (2001-2006).“ (Le Monde diplomatique, 7.1.21)
[3] „Die Protestierenden stammen vor allem aus den indigen geprägten Provinzen im Süden und Norden des Landes, wie Puno, Ayacucho und Apurímac. Bisher wurden bei den Protesten 60 Menschen getötet und über 1000 zum Teil schwer verletzt. Zahlreiche Videoaufnahmen und Zeugenaussagen belegen, dass die meisten Getöteten von den sogenannten Sicherheitskräften direkt erschossen wurden. Verantwortlich hierfür sind neben der Führung von Armee und Polizei auch Präsidentin Boluarte, sowie ihr Premierminister Alberto Otárola.“ (amerika21.de, 6.3.23)
[4] „Im Oktober 2015 tagten die Weltbank und der IMF in Lima. Auf diesen Anlass hin erstellte die Weltbank eine Analyse der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung des Landes, welches als Vorzeigeland bei Entwicklungsorganisationen gilt. So ist die Wirtschaft während der letzten zehn Jahre durchschnittlich um 6,4 % gewachsen, das zweitbeste Resultat aller Länder in Lateinamerika und der Karibik.“ (Wikipedia, s.v. Peru) „In diesem Jahrhundert hatte Peru die niedrigste Inflation unter den lateinamerikanischen Ländern mit eigener Währung... Nur noch 34 % der Bankeinlagen, 23 % der Bankkredite und 8 % der Hypotheken lauten auf Dollar.“ (Über das Vertrauen der Peruaner in ihren Sol, The Economist, 22.2.24)
[5] „... gelten die Politik und das wirtschaftliche Tagesgeschehen im Land weitgehend entkoppelt. Nach Castillos Putschversuch erholten sich die Finanzmärkte noch am selben Tag.“ (gtai.de, 23.12.22)
[6] „70 Prozent der Erzförderung wird von großen multinationalen Konzernen kontrolliert. Das größte Bergwerksunternehmen Perus ist Buenaventura, das die Goldvorkommen ausbeutet. Es hält auch Anteile an Yanacocha, das mehrheitlich zum US-Konzern Newmont gehört, und besitzt 19,85 Prozent an der Kupfermine Cerro Verde von Freeport-McMoran. Der Bergbau hatte 2016 ein Wachstum von 21,2 Prozent und damit die höchste Wachstumsrate in den letzten 25 Jahren. Er trägt 20 Prozent zu den Steuererlösen bei. Hauptexportprodukte des Bergbaus sind Kupfer, Zink und Gold. Metallische und nichtmetallische Bergbauprodukte erbringen 27 745 Millionen US-Dollar und haben einen Anteil an den Exporten von 61,8 Prozent.“ (Wikipedia, s.v. Wirtschaft Perus)
Diese besondere Bedeutung des Bergbaus in Peru hat in den letzten Jahren noch weiter zugenommen: „Peru ist zweitgrößter Kupferproduzent weltweit hinter Chile: Der Ausstoß lag 2021 bei rund 2,3 Millionen Tonnen. Die neue, hochmoderne Quellaveco-Mine treibt die Kupferproduktion in Peru zusätzlich voran. Bei Zink und Gold gehört das Andenland ebenfalls zur Weltspitze.“ (gtai.de, 23.12.22)
[7] „Der peruanische Wirtschaftsminister sagte am Donnerstag, dass ‚die Voraussetzungen geschaffen werden‘, um Lithium-Bergbauprojekte im Land zu entwickeln, eine Woche nachdem Chile einen Plan zur Stärkung der staatlichen Kontrolle über die Industrie gestartet hat. ‚Es hat sich ein Zeitfenster geöffnet, das wir nutzen wollen‘, sagte Wirtschaftsminister Alex Contreras. Es bestehe ‚großes Interesse‘ daran, die Entwicklung in Peru zu beschleunigen, da Entscheidungen in anderen Ländern die Investoren verschreckten.“ (marketscreener.com, 27.4.23)
Dass es bei der Konkurrenz der großen Wirtschaftsmächte um die neuen Energien auf die Sicherung des exklusiven Zugriffs auf reichliche Mengen Lithium ankommt, nährt Annahmen, dass insbesondere die USA hierbei die Entwicklungen in dieser Branche nur ungern dem demokratischen Zufall überlassen haben:
„Peru ist der zweitgrößte Kupferproduzent der Welt und verfügt derzeit über ein Lithiumexplorationsprojekt in der Region Puno an der Grenze zu Bolivien, das von Macusani Yellowcake, einer Tochtergesellschaft der kanadischen American Lithium Corp., betrieben wird. Es geht insbesondere um Uran und ganz zentral um Lithium. Die neuen Machthaber setzen jetzt unter Hinweis auf die Verstaatlichungen in Chile und Mexiko auf die Vergabe neuer Minenkonzessionen für nordamerikanische Konzerne zur Lithiumausbeutung. Dabei fällt immer wieder der Name Macusani Yellowcake, eine Tochter von American Lithium. In diesem Sinne kann man bei Peru auch von einem Lithiumputsch sprechen.“ (Die ehemalige Bundestagsabgeordnete der Linken Sevim Dağdelen in einem Interview nach einem Besuch beim inhaftierten Pedro Castillo, junge Welt, 6.5.23)
[8] „Aus Berechnungen der Volkszählungen bis 2019 ergibt sich, dass diejenigen, die 90 Prozent der 330 000 Hektar Kartoffelanbaufläche bewirtschaften, als arm eingestuft werden müssen. Sie produzieren das, was ihre Familien essen, und verkaufen, was übrig bleibt. Was eine einzelne Familie auf den lokalen Markt bringt, ist wenig, aber da sie 88 Prozent aller Bauern und Bäuerinnen in Peru ausmachen, ist die Gesamtmenge der von ihnen erzeugten Lebensmittel – neben Kartoffeln vor allem stärkehaltiger Mais, die beiden Grundnahrungsmittel der armen Familien im Land – ziemlich groß. Die Kleinbauern und -bäuerinnen in den Anden produzieren 70 Prozent der Nahrungsmittel derer, die in den großen Städten des Landes leben. Das Hauptanliegen der großen landwirtschaftlichen Betriebe dagegen ist nicht die Ernährung der peruanischen Bevölkerung, sondern der Export. Die verschiedenen Sorten einheimischer Kartoffeln werden also von Kleinbauern und -bäuerinnen produziert, die als arm eingestuft werden, und diese Kartoffeln werden auch zu einem ganz überwiegenden Teil von den ärmsten Menschen in den Städten verzehrt, von denen viele in den Armen- und Elendsvierteln leben.“ (ila 446, Juni 2021)
[9] Dies ist aus volkswirtschaftlicher Sicht auf „das Land“ und darauf, wovon es „profitiert“, ein reiner Segen, auch wenn der indigene (Ex-)Bauer seine eigenen Erfahrungen mit dem Trend zu gesunder Ernährung mit oder ohne Superfood macht.
„Auch im Agrarsektor zeichnet sich ein Trend zu moderneren Technologien ab. Automatisierung, Agrar 4.0 und der Einsatz von erneuerbaren Energien könnten die Branche prägen. Das Land möchte weiterhin vom globalen Trend zu gesünderer Ernährung und Superfoods profitieren. Mehr als ein Drittel der peruanischen Exporteentfällt bereits auf Produkte wie Blaubeeren, Trauben, Spargel, Avocados und Quinoa. Diese nicht-traditionellen Agrarrohstoffe bieten im Vergleich zu traditionellen wie Kaffee und Zucker höhere Margen. Darüber hinaus helfen sie dabei, Perus Abhängigkeit von mineralischen Rohstoffen zu mindern. Die Landwirtschaft wird laut Experten langfristig konstant wachsen.“ (gtai.de, 23.12.22)
[10] „Bei der Diversifizierung der Exporte profitiert das Andenland von seinen zahlreichen Handelsabkommen. Zum Wachstum der Branche wird voraussichtlich auch das Trans-Pacific Partnership Abkommen CPTPP beitragen, das die peruanische Regierung im Juli 2021 ratifizierte. Peru hat darüber hinaus Handelsabkommen mit der Europäischen Union, den USA, China, der Pazifikallianz, Japan, Südkorea, Kanada und dem Mercosur.“ (gtai.de, 23.12.22)
[11] Fujimori machte sich um sein Land nicht nur mit der machtvollen, vom Militär und dem IWF assistierten Durchsetzung einer radikal wirtschaftsliberalen Politik verdient, mit der er die in „Hyperinflationen“ geendeten Entwicklungsprojekte seiner ambitionierten Vorgängerregierungen abräumte. Nicht nur deren Vertreter ließ er verfolgen, sondern er erledigte vor allem die entschiedensten Verfechter eines alternativ volksfreundlich-linken Peru, die Guerilla „Leuchtender Pfad“. Die erfolgreiche Ausrottung dieser Truppe und die gewaltsame Niederhaltung jeglicher Opposition wurde ihm später von konkurrierenden Parteien als „Menschenrechtsverletzungen“ vorgeworfen, führten zu seiner Flucht aus dem Land und – eben auch bei diesem Ex-Präsidenten – zu seiner späteren Inhaftierung in Peru.
[12] Dieses Projekt wurde lang vor Fujimori in den 80er Jahren zu Zeiten des Präsidenten Alan García angeleiert, lag wegen Geldmangels lange brach und ist heute – finanziert, gebaut und betrieben von internationalen Kredit- und Baukonsortien – selbst ein florierendes Geschäft, das vom Bedarf des hauptstädtischen Arbeitsvolks nach Mobilität für seine Dienstgeber lebt.
[13] Die beiden letzteren Bauvorhaben wurden unter ‚verdächtigen‘ Umständen mit dem im größten Bestechungsskandal Lateinamerikas 2019 untergegangenen brasilianischen Baukonzern Odebrecht kontrahiert.
[14] The Economist (22.2.24) empfiehlt dem neuen Chef in Argentinien Peru als leuchtendes Beispiel.
[15] In Peru sind aktuell 130 Parlamentarier in ca. 16 Parteien oder Fraktionen organisiert, zwischen denen die gewählten Abgeordneten ständig und mehrfach wechseln und dabei immer neue Koalitionen mit- bzw. gegeneinander bilden. Zwischen ihnen herrscht kein haltbarer politisch begründeter Zusammenhalt vor. Bestimmend sind vielmehr die individuellen und sich laufend ändernden Kalkulationen der Politiker bezüglich ihrer eigenen Machtbeteiligung – gerade in Hinsicht auf den jeweils aktuell amtierenden Präsidenten und dessen spezielle Kompetenzen, insbesondere die Besetzung der Ministerien bis zu Regierungsentscheidungen per präsidialem Dekret.
„Es ist bezeichnend, dass die Abgeordneten mit der neuen Präsidentin die notwendigen Gesetzesänderungen für vorgezogene Neuwahlen nur im Gegenzug für ein Gesetzespaket akzeptieren wollen. Dabei geht es um ihr Recht auf Wiederwahl (zurzeit ist diese nicht möglich) und darum, wieder ein Zweikammersystem einzuführen für den Kongress, damit es wieder mehr lukrative Sitze im Senat gibt.“ (NZZ, 9.12.22)
[16] „In den letzten Jahren wurde gegen mehrere Ex-Präsidenten, gegen 21 von 25 Gouverneuren und gegen mehr als 1000 Bürgermeister und Bürgermeisterinnen wegen Korruptionsvorwürfen ermittelt oder Anklage erhoben.“ (ipg-journal, 16.12.22)
[17] „Bürgermeister und Regionalgouverneure kontrollieren zwei Drittel der öffentlichen Investitionen. Da die politischen Parteien kaum noch eine Rolle spielen, werden die meisten Wahlsieger unabhängige lokale Persönlichkeiten sein. Mehr als 600 von ihnen waren bereits in Strafverfahren verwickelt.“ (The Economist, 29.9.22)
[18] Das gilt neben dem verbreiteten illegalen Bergbau auch für die Geschäfte der Drogenmafia, der enge Verflechtungen zur Staatsgewalt nachgesagt werden. So eng, dass deren Konkurrenz nicht wie im Nachbarland Ecuador gewaltsam untereinander und gegen die Staatsgewalt, die dort um ihr Gewaltmonopol und ihre Souveränität kämpfen muss, ausgetragen wird. In Peru ist das Drogengeschäft demnach geduldet und die Konkurrenz um dessen Bedingungen und Erträge entscheidet sich u.a. über stille Geldflüsse zu den Amtsträgern. (Vgl. Página/12, 15.1.24)
[19] In den Heimatländern der Demokratie stellt sich das Verhältnis der Staatsmacht zu ihrer Ökonomie anders dar. Hier leistet die Staatsmacht ihren allgemeinen Dienst am Wachstum privater Geldmacht getrennt von den, d.h. souverän über die einzelnen Konkurrenten um das Wachstum des Geldes. Mit ihrer Wirtschafts-, Sozial- und sonstiger Politik sichert und fördert sie die Konkurrenz um Gelderwerb, um mit den Erfolgen, die die Konkurrenten darüber erwirtschaften, ihre eigene Machtbasis zu erweitern. Dass die private Vorteilsnahme durch Politiker, die auch in solchen kapitalistisch erfolgreichen Ländern stattfindet, hier mit dem Terminus „Korruption“ belegt und entsprechend kriminalisiert wird, ist durchaus adäquat: Dass sich politische Agenten der Konkurrenz als private Konkurrenten um Geld betätigen, widerspricht tatsächlich der Sache der Herrschaft, nämlich dem politischen Dienst an der Konkurrenzgesellschaft, von der die Nation mitsamt ihrem Staatsapparat wirklich lebt. Anders liegen die Dinge dort, wo die private Vorteilsnahme der Politik gar nicht die Abweichung von dem normalen Funktionieren der Politik, sondern selbst die Art und Weise ist, wie die Politik funktioniert. Da mag der Vorwurf des „korrupten“ Machtmissbrauchs und der „Bestechung“ zwar noch juristisch zutreffen, zur politischen Ökonomie des Landes passt er nicht.
[20] „‚Das Einstiegsgehalt eines Lehrers liegt bei rund 1.300 Soles, das sind knapp 400 US-Dollar und nur gut hundert US-Dollar mehr als der Mindestlohn. Das sagt viel über die Wertschätzung der Lehrer in Peru aus, und es steigert sicherlich nicht deren Engagement‘, sagt der ehemalige Rektor der päpstlichen, katholischenUniversität von Lima, Salomón Lerner. Während Nachbarländer wie Bolivien rund 6,5 Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts in die Bildung investieren, sind es in Peru gerade 3,7 Prozent.“ (taz, 30.9.18)
[21] So sehr die berufsmäßigen Geldbesitzer der Welt die Leistungen Perus für die Weltwirtschaft schätzen, so gerne problematisieren die Sachwalter der globalisierten demokratischen Kulturdie politischen Verhältnisse im Land mit ihren aus ihrer Sicht tiefgreifenden Mängeln. Trotz vieler Gelegenheiten kommen sie bei jedem neuen Präsidentensturz dann doch nicht über den Systemvergleich mit unseren gesegneten Umständen hinaus, in denen Gewalt und Volk, allgemeines Wohl und privates Interesse so vorzüglich sortiert sind, mit dem immer gleichen Ergebnis einer Fehlanzeige betreffend gefestigte Demokratie. Dabei hat die herrschende Klasse Perus mit ihrer schlecht beleumundeten Streitkultur in einem Land, das ganz vom ausländischen Geschäftsinteresse lebt und nicht vom flächendeckenden Erwerbsinteresse der Bürger aller Klassen, die mehrheitlich auf ihre kapitalistischen Erwerbsquellen festgelegt sind, ganz eigene Lösungen für diese Sortierung gefunden, in denen Eigennutz, nationale Reichtumsvermehrung ganz anderer Art und die Beherrschung eines des Öfteren lästigen Volkes dann doch zusammenkommen.
[22] Ein Beispiel unter vielen: „Die Gold-, Silber- und Kupfermine von Anabi treibt seit 2010 die Gewinnung der Edelmetalle voran. Die dadurch freigesetzten Schwermetalle verseuchen lebensnotwendige Wasservorräte. Das macht die Erde unfruchtbar und hat Auswirkungen auf die Gesundheit der Bevölkerung. Zusätzlich transportiert Anabi die gewonnenen Mineralien auf nicht ausgebauten Straßen durch Chumbivilcas. Der aufgewirbelte Staub verschmutzt so die örtlichen Böden und Gewässer. Die Mine liegt südlich der Metropole Cusco, im Norden der Provinz Chumbivilcas. Die Umrisse und das Ausmaß der Mine erkennt man auf Satellitenbildern deutlich. Anabi ist nur eine von zahlreichen Minen in der Region. Hinter dem peruanischen Bergbauunternehmen stehen die Konzerne MDH Performación Diamantina und die chinesische Bergbaufirma MMG, welche auch die nur wenige Kilometer nördlich gelegene Mine LaBambas unterhält. Der Konflikt zwischen Anabi und der streikenden Andenbevölkerung ist kein Einzelfall. Er reiht sich ein in eine Tradition von Bäuer:innen und Umweltaktivist:innen, die sich aufgrund von Wasserverschmutzung und Umweltschäden gegen Bergbauunternehmen und den Abbau von Edelmetallen einsetzen.“ (amerika21.de, 19.7.21)
[23] „Wir müssen die Investitionen in Bildung und Gesundheit deutlich erhöhen, und dazu müssen wir unseren Reichtum verstaatlichen, d.h. ihn in den Dienst der Peruaner stellen, mit neuen Regeln für Steuern und Abgaben, die heute sehr notwendig und relevant sind... Der Kupferpreis, der ein noch nie dagewesenes Niveau erreicht hat (4,70 $ pro Pfund), ist ein deutliches Beispiel. Die Produktionskosten für Kupfer gehören zu den niedrigsten der Welt. Die transnationalen Bergbaukonzerne machen Übergewinne, die nicht auf neue Investitionen oder Technologien zurückzuführen sind, sondern nur auf das Auf und Ab des internationalen Marktes. Es sei darauf hingewiesen, dass die chilenische Abgeordnetenkammer bereits eine neue Lizenzgebühr genehmigt hat, deren Satz 75 % erreicht, wenn der Preis 4,0 $ pro Pfundübersteigt, wie es heute der Fall ist.“ (Pedro Castillo in „Plan de Gobierno Perú al Becentario – Sin corrupcíon“)
[24] Peru trägt seinen Teil dazu bei und erlässt ein neues Gesetz. Diesem zufolge „dürfen US-Soldaten mit Waffen ins Land kommen, um Kooperations- und Ausbildungsmaßnahmen mit den Streitkräften und der Polizei Perus durchzuführen. Diese werden in den Regionen Lima, Callao, Loreto, San Martín, Huánuco, Ucayali, Pasco, Junín, Huancavelica, Cusco, Ayacucho, Iquitos, Pucusana und Apurímac stattfinden.“ (amerika21.de, 26.5.23)