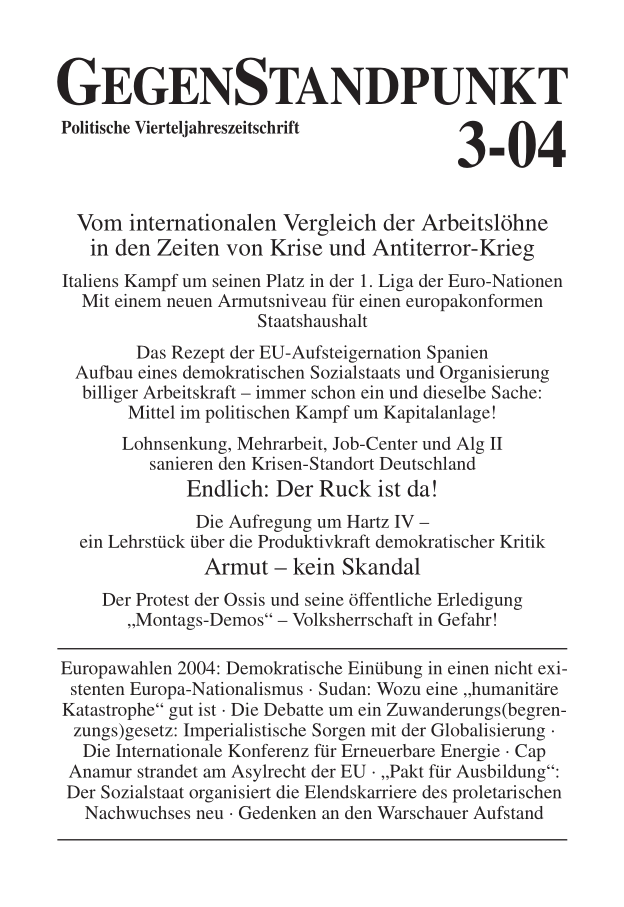Lohnsenkung, Mehrarbeit, Job-Center und Alg II sanieren den Krisen-Standort Deutschland
Endlich: Der Ruck ist da!
Deutsche Unternehmen „müssen“ ihre Belegschaften immer effektiver ausbeuten, weil man hierzulande „die Kosten der Arbeit“ in unerträgliche Höhen „getrieben“ hat. Damit deutsche Unternehmer wieder Wohlstand für alle schaffen können, auch für die Volksgenossen, die sie zielstrebig überflüssig gemacht haben, müssen besagte Kosten gesenkt werden. Und in der Frage, wie das zu machen geht, „setzt sich die Erkenntnis durch“: Einfach mit mehr Arbeit, verteilt auf Schultern, die weniger kosten.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Siehe auch
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Gliederung
- 1. Der letzte Schrei der Krisenkonkurrenz der Kapitalisten: Deutschlands Unternehmer kämpfen für den ‚absoluten Mehrwert‘
- 2. Das neueste Patentrezept des regierenden Wirtschaftsnationalismus: Der Standort D braucht Arbeitsplätze, also den totalen Schulterschluss der politischen Klasse mit der kapitalistischen
- 3. Politischer Klassenkampf, Abteilung 1: Weniger Lohn für mehr Arbeit – von der Krisenstrategie der Unternehmer zur gewaltsamen Durchsetzung einer nationalen Generallinie
- 4. Politischer Klassenkampf, Abteilung 2: Der Sozialstaat reorganisiert sein Subproletariat – durch mehr Armut in neuen Formen
- 5. Politischer Klassenkampf, Abteilung 3: Kampfansage an die Gewerkschaft und flankierende Erziehungsmaßnahmen zur Beförderung der neuen Sittlichkeit im Volk
- 6. Die bundesdeutsche Protestkultur: Ohnmachtserklärungen als Prinzip gewerkschaftlicher Gegenwehr, Drohungen mit alternativen Wählerlisten und Volksaufmärsche bei ‚Montagsdemonstrationen‘
- 7. Die Sanierung des deutschen Standorts – ein imperialistisches Aufbruchsprogramm
Lohnsenkung, Mehrarbeit, Job-Center und Alg II sanieren den Krisen-Standort Deutschland
Endlich: Der Ruck ist da!
Warum die Deutschen wieder mehr arbeiten müssen
, fragt ‚Der Spiegel‘ auf dem Titelblatt seiner Ausgabe Nr. 28/04, und Brechts lesender Arbeiter könnte sich bei der Antwort die Augen reiben. Das Hamburger Nachrichtenmagazin hat nämlich herausgefunden, dass das so recht gar keine Frage ist: Es muss einfach sein! In Deutschland, dem Schlaraffenland
, muss endlich Abschied vom Paradies
genommen werden, genauer: Abschied erstens von der Illusion, dass sich mit immer weniger Arbeit immer mehr Wohlstand schaffen lässt.
Fragen wir die Herrschaften besser nicht, ob sie es ihrem Nachwuchs durchgehen ließen, wenn der im Besinnungsaufsatz zum ‚technischen Fortschritt‘ den eine ‚Illusion‘ nennt. Sie haben ja auch selbst jede Menge Respekt vor unserer Hochproduktivitätsökonomie
. Aber Schattenseiten können sie einfach nicht leiden, und die sind ja unverkennbar: Mit ihren Rationalisierungen hat diese Ökonomie doch immer nur das so kostbare wie knappe Gut ‚Arbeitsplatz‘ teurer und knapper gemacht. Nahezu unaufhaltsam
stieg sie deswegen, die Arbeitslosigkeit
, und daher ist, was den Kampf gegen sie betrifft, zweitens auch endlich der Irrglauben
zu verabschieden, die Arbeit auf mehr Schultern zu verteilen
wäre eine Lösung: Den Schultern fehlen ja die Plätze zum Arbeiten. Fragen wir auch da besser nicht, wer denn den Zeitgeist der letzten 10 Jahre pünktlich zu jedem Montag mit der Ideologie von einer umzuverteilenden Arbeit bereichert hat. Die Hamburger Politökonomen jedenfalls haben seit jüngstem nicht nur an den Arbeitsplätzen, die fehlen, sondern gerade an denen, die es in unserem hochproduktiven Schlaraffia noch gibt, den Fehlweg
aufgedeckt, den man in Deutschland jahrzehntelang beschritten hat. Wenn sich nämlich in dem weltweiten Wettbewerb, ohne den heute in Sachen Wohlstand
bekanntlich gar nichts mehr geht, die deutschen Unternehmen gegen ausländische Konkurrenten behaupten, die zu ungleich günstigeren Konditionen produzieren
, dann ist das nicht gut, sondern zeigt Versäumnisse
auf, die die nationale Wirtschaft in eine veritable Zwangslage gebracht haben: Deutsche Unternehmen müssen
ihre Belegschaften immer effektiver ausbeuten, weil man hierzulande die Kosten der Arbeit
in unerträgliche Höhen getrieben
hat. Damit deutsche Unternehmer wieder Wohlstand für alle schaffen können, auch für die Volksgenossen, die sie zielstrebig überflüssig gemacht haben, müssen besagte Kosten gesenkt werden. Und in der Frage, wie das zu machen geht, setzt sich die Erkenntnis durch
: Einfach mit mehr Arbeit, verteilt auf Schultern, die weniger kosten.
Eine interessante ‚Erkenntnis‘. Auf ihre Einsicht in gewisse Notwendigkeiten, die im hiesigen Standort herrschen, geht jedenfalls nicht zurück, was die Redakteure des ‚Spiegel‘ da mit unverkennbarer Erleichterung als Notdurft einer längst fälligen Umkehr
in Deutschland vermelden. Im Gestus sachverständiger Aufklärung über ökonomische Fehlentwicklungen
macht sich da vielmehr die pure Parteilichkeit für alles Luft, was die im Standort D Verantwortlichen für ihren Umgang mit den ‚Kosten der Arbeit‘ schon seit geraumer Zeit für notwendig erachten. Die sind es, die mit ihren praktischen Interessen erst die ‚Tendenzen‘ und dann die Fakten setzen, denen der theoretisierende Sachverstand in Hamburg und anderswo dann die alle Mal guten, rechtfertigenden Gründe nachzureichen weiß. So käme Brechts lesender Arbeiter dann doch noch auf seine Kosten. Der ‚Spiegel‘ führt nämlich für seine ‚Erkenntnis‘ lauter unbestechliche Zeugen an, die bei der Frage, warum die Deutschen mehr arbeiten und weniger verdienen müssen, tatsächlich nichts mehr im Unklaren lassen; überhaupt bleibt kein öffentliches Organ einschlägige Informationen schuldig:
- Bund und Länder in ihrer Eigenschaft als öffentliche Arbeitgeber gehen mit gutem Beispiel voran. Nach dem Motto:
Wir müssen bereit sein, ein Stück mehr zu arbeiten
(Stoiber), erzwingt der Staat bei seinen Beamten die nötige Bereitschaft mit einem kleinen Gesetz und setzt die wöchentliche Arbeitszeit auf bis zu 42 Stunden herauf. Die Landesregierungen kündigen ihren Arbeitern und Angestellten die geltenden Arbeitszeittarife, um die neu Eingestellten 40 bis 42 Stunden antreten zu lassen. Warum sie das tun, sagen sie selbstverständlich dazu: um durch unbezahlte Mehrarbeit ihrer Bediensteten Geld und Stellen zu sparen. - Die Elite der deutschen Industrie macht ernst mit den Öffnungsklauseln in den Tarifverträgen, die sie jüngst mit den Gewerkschaften vereinbart hat. Die Unternehmensleitung der Weltfirma Siemens hat sich bei der Produktion ihrer Telefone
Kostennachteile
in Höhe von 30% zusammenrechnen lassen – keine Frage, an wem es da wie zu sparen gilt.Die Wahrheit ist: Wir müssen mehr arbeiten, wenn alles gut geht, ohne Lohneinbußen, also für das gleiche Geld
(Konzern-Chef Pierer). Und weil eben nicht immer alles gut gehen kann, setzt sich die Wahrheit dann praktisch aus unentgeltlicher Mehrarbeit und zusätzlichen Lohneinbußen zusammen. Die betriebliche Rechnungsführung der ‚Welt-AG‘ DaimlerChrysler vermeldet für den deutschen Unternehmenszweig Mercedes-Auto erfreuliche Gewinne. Man findet aber, dass diese durchaus höher ausfallen könnten. Erstensläuft es
in anderen Abteilungen mit dem Umsatz nicht so gut, zweitens ist beim Konkurrenten BMW die Umsatzrendite deutlich besser. Mit dem Vergleich wird die Rechnung recht übersichtlich: 8000 Mitarbeiter mehr, die man bezahlt, dividiert durch 1,1 Mio. Autos pro Jahr, die beide Firmen jeweils zusammenmontieren lassen, macht, dassMercedes um etwa 500 Euro pro Auto teurer produziert
(einProfessor
– ja, auch das braucht ein höchstproduktiver Standort –für Automobilwirtschaft
, lt. SZ, 24.7.); multipliziert mit den produzierten Autos macht das die 500 Mio. Euros, um die die eigene Belegschaft die Ertragsbilanz des Unternehmens verbessern muss. Dafür braucht es das entsprechendeSparpaket
; und mit einem Mix aus dauerhaften Lohnsenkungen für die Gesamtbelegschaft, zusätzlichdeutlichen Einschnitten
bei einigen ihrer Teile, mit Mehrarbeit für Dienstleistungsbeschäftigte und für die Abteilung Forschung & Entwicklung sowie der Verwandlung von Pinkelpausen in ‚Qualifizierungstage‘ ist es auch schon perfekt geschnürt.Die Einigung ist Steilvorlage für VW und Opel.
(HB, 26.7.) VW will nämlich sowieso am liebsten alle seine Mitarbeiter behalten –Das oberste Ziel ist der Erhalt der rund 170.000 Arbeitsplätze in Deutschland.
– und zu diesem Zweckdie Personalkosten bis 2011 um 30 Prozent senken
(FAZ, 23.7.). Opel-Chef Forster hält schon längsteine Senkung der Lohnstückkosten im zweistelligen Prozentbereich
fürnötig, um die deutschen Werke im europäischen Wettbewerb wieder konkurrenzfähig zu machen
; mit drei unbezahlten Arbeitsstunden pro Woche dürfendie Mitarbeiter im Bochumer Werk
schon mal den Anfang machen (HB, 16.7.) Die Firma Continental ist stolz auf das positive Konzernergebnis von 2003. Damit auch im laufenden Jahr – wenigstens in Deutschland; die Niederlassung in den USA wird abgewickelt – die Zahlen stimmen, arbeitet die Belegschaft 40 Stunden pro Woche; ohne Lohnausgleich, dafür mit der ‚Garantie‘, dies vorerst weiter tun zu dürfen. ThyssenKrupp kombiniert zum gleichen Zweck die unentgeltliche Mehrarbeit mit der zusätzlichen Streichung von Lohnteilen. Die Deutsche Bahn steht in Verhandlungen um die 40-Stunden-, die deutsche Bauindustrie um die 42-Stunden-Woche. Die Fluggesellschaft Condorhat sich ein ehrgeiziges Sparprogramm vorgenommen
, das auf den griffigen Namen30/15
hört:Bis zu 30 Prozent Mehrarbeit und bis zu 15 Prozent weniger Gehalt.
(FR, 21.6.) Über die mittelständischen Unternehmen in Deutschland wird ganz beiläufig bekannt, dass man in nicht wenigen von ihnen schon längst zu weit längeren als den tarifvertraglich vereinbarten wöchentlichen Arbeitszeitenzurückgekehrt
ist, Vati auch samstags wieder der Fabrik gehört, manchmal mit, viel öfter ohne Lohnausgleich. Und so geht es weiter, quer durch alle Branchen und Größenordnungen der Firmen im Standort.
1. Der letzte Schrei der Krisenkonkurrenz der Kapitalisten: Deutschlands Unternehmer kämpfen für den ‚absoluten Mehrwert‘
Warum all die Maßnahmen im Umgang mit Lohn und Arbeitszeit ihrer Belegschaften, die sie im Sinne ihrer Betriebsbilanz für angebracht halten, einfach unabweisbar sind, wissen die Konzernlenker dabei mit einem besonderen ‚Argument‘ zu begründen. Sie verweisen auf eine Alternative, die ihnen in ihrer Gier nach Profit im goldenen Zeitalter der ‚Globalisierung‘ immer offen steht: Wenn sich ihre kostbaren Arbeitsplätze in Deutschland für sie nicht rechnen, würden sie diese eben streichen bzw. dorthin verlagern, wo sie sich rentieren, insbesondere in die neuen EU-Länder im Osten.
Diese Drohung ist nicht übermäßig neu; in Tarifverhandlungen hat sie immer wieder einmal eine Rolle gespielt. So richtig praktisch ernst gemeint dürfte sie auch nicht immer sein; für die Verlagerung von Produktionskapazitäten in andere Länder werden alle Mal die gegebenenfalls anfallenden Investitionskosten berücksichtigt und noch etliche Kriterien, von denen die meisten auf den banalen kapitalistischen Opportunismus hinauslaufen, Geld nur dorthin zu tun, wo es bereits erfolgreich akkumuliert. Dass die Unternehmer derzeit aber auf den Vergleich zwischen deutschen und auswärtigen Löhnen und Arbeitszeiten ein besonderes Gewicht legen, ist nicht zu überhören und in mehrfacher Hinsicht aufschlussreich.
Tatsächlich sind sie sich der globalen Reichweite der Kommandomacht ihres Kapitals sicher und können das auch sein. Dank der weltpolitischen Vorleistungen ihrer Staatsgewalt sind Staatsgrenzen für sie kein Hindernis; nach Jahrzehnten erfolgreichen Außenhandels und Kapitalexports ist der Zugriff auf auswärtige Ressourcen, die menschlichen eingeschlossen, für deutsche Multis schon längst und für den sagenumwobenen ‚industriellen Mittelstand‘ deutscher Nation auch kein Abenteuer mehr, sondern bewährte Praxis. Die ist wiederum Grundlage für die Gewinnkalkulationen eines modernen Managements. Länderübergreifend vergleichen Unternehmer die Bedingungen, die ihnen für die Ausbeutung von Arbeitskräften zur Verfügung stehen, und rechnen die kalkulierten Vorteile gegen die Kosten einer Betriebsverlagerung durch. Nach den von ihnen gesetzten Standards in Sachen Lohn, Verfügbarkeit, ortsübliche Arbeitszeiten, Flexibilität
, Mobilität
usw. lassen sie die Arbeiterklassen verschiedener Nationalität ideell gegeneinander konkurrieren und bauen das Ergebnis dann praktisch in ihre Unternehmensstrategie ein. Der Umstand, dass Arbeiter anderswo billiger zu haben und ohne die in bundesdeutschen Gesetzen vorgeschriebenen und tarifvertraglich vereinbarten Einschränkungen zu benutzen sind, ist für sie umstandslos gleichbedeutend mit einem Wettbewerbsnachteil des Standorts Deutschland, der unbedingt durch Lohnsenkung und Arbeitszeitverlängerung ausgeglichen werden muss. Mit der entgegenkommenden Einschränkung, an chinesische oder ukrainische Lohnarbeitsverhältnisse sei selbstverständlich nicht gedacht, erklären sie Löhne und Arbeitszeiten, von denen sie anderswo schon profitieren oder demnächst profitieren könnten, zur Norm, der sich ihre heimischen Belegschaften unterwerfen müssen, sofern sie überhaupt noch benutzt werden wollen. Gerade die bundesdeutschen Premium-Unternehmen bestehen darauf so entschieden, als hingen Erfolg oder Untergang ihrer Weltfirmen von einem Plus an unbezahlter Arbeit ab.
Dabei ist es keineswegs so, dass ausgerechnet die Chefs der bundesdeutschen „Hochproduktivitätsökonomie“ vergessen hätten oder übersehen würden, wie sehr es für ihren Konkurrenzkampf auf den technischen Fortschritt ankommt. Auf dem Feld der produktivitätssteigernden Innovationen, der Neu- und Umorganisation des Arbeitsprozesses usw. lassen sie nach wie vor nichts anbrennen. Da war ihnen kaum je etwas zu teuer, und da setzen sie Maßstäbe wie eh und je; mit dem Resultat, dass sich die ‚reinen Personalkosten‘ neben dem Aufwand für Maschinerie und Material so geringfügig ausnehmen, dass mancher Sachkenner an dem wirklichen Gewicht des Lohnkosten-‚Arguments‘ zweifelt. Zu Unrecht freilich, denn auch wenn er relativ zu den anderen Posten der kapitalistischen Rechnung gering und immer geringer ausfällt: Um nichts anderes als um die Reduzierung dieses Kostenbestandteils geht es bei der Einführung neuer Technologien im Arbeitsprozess, um die Verringerung des Bruchteils vom Gesamtwert des Produkts, der an die ‚Mitarbeiter‘ weggezahlt werden muss: um die Senkung der Lohnstückkosten. Dabei hat der Gebrauch neuer Produktionsmittel und Arbeitsverfahren als Mittel, die Lohnkosten im Verhältnis zum produzierten und auf umkämpften Märkten zu realisierenden Warenwert zu mindern, alle Mal seinen guten Grund: Der Einsatz besserer Technik schafft eben den Konkurrenzvorteil, auf den alles ankommt; und er ist allein Sache des Eigentümers, unterliegt ganz dessen Verfügungsmacht und gibt einseitig und quasi objektiv das Maß vor, in dem die Belegschaft über ihre Lohnkosten hinaus Warenwert herstellt – bzw., dasselbe umgekehrt, in dem sie vom materiellen Reichtum, den sie herstellt, ausgeschlossen ist.[1]
Umso auffälliger ist es daher, dass diese Methode zur Steigerung des Unternehmens-Ertrags in der gegenwärtigen Kampagne der deutschen Unternehmerschaft gleich gar keine Rolle spielt. Deren konzentrierte Sorge und ganzer Einsatz gilt dem anderen Aspekt ihrer Kalkulation, der zweiten Methode, ihre Betriebe zu Kampfmaschinen in der Konkurrenz um Profit herzurichten: nicht die – mehr oder weniger – billigen Proleten produktiver, sondern die längst enorm produktiv gemachten Premium-Belegschaften billiger machen.[2] Ganz offensichtlich verlassen sich Deutschlands First-Class-Unternehmer darauf, für die Produktivität ihrer Arbeitsplätze alles getan, dabei ein Optimum erreicht und ihren Vorsprung vor dem Rest der globalen Unternehmenswelt ganz gut gesichert zu haben; dass sie den nicht preisgeben, versteht sich von selbst. Dringlichen Handlungsbedarf entdecken sie hingegen, gerade angesichts einer makellosen Bilanz in Sachen Rationalisierung, in Sachen Arbeitslohn und Arbeitszeit. Da sind nach ihrer Einschätzung untragbare Verhältnisse eingerissen: Da haben die Gewerkschaften Bedingungen herausgehandelt und die Politiker Entwicklungen zugelassen oder sogar gefördert, die den Vorteil gelungener Rationalisierungen glatt zunichte machen. Sich selbst müssen die Unternehmer den Vorwurf machen, solche ‚Fehlentwicklungen‘ nicht verhindert, die nötige Auseinandersetzung mit gegnerischen ‚gesellschaftlichen Kräften‘ gescheut, jedenfalls nicht die nötige Konsequenz an den Tag gelegt zu haben.
Diese kritische Diagnose ist für die Arbeitgeber die unabweisbare Schlussfolgerung aus dem Befund, dass ihre Geschäfte trotz weltrekordverdächtiger ‚Rationalisierungs‘-Erfolge zu wünschen übrig lassen: Wenn sie trotz produktivster Anlagen unter einer matten Konjunktur leiden, dann muss es an anderer Stelle bei den Ausbeutungsbedingungen fehlen. Den wirklichen politökonomischen Zusammenhang stellen sie als engagierte Manager ihres Kapitals damit freilich auf den Kopf. Ihr trotz
ist in Wahrheit ein wegen
: Unter Einsatz ihrer überlegenen Konkurrenzmittel haben sie Geld und immer mehr Geld verdient, ihre Unternehmen wachsen lassen – und damit schließlich die weltweite und vor allem die einheimische Zahlungsfähigkeit, auf die sie es mit ihrer so rentabel produzierten Ware abgesehen haben, überfordert. Sie haben zu viel produziert – nicht zu viele Güter für die vielen Bedürfnisse, die wegen Geldmangel unbefriedigt bleiben, sondern zu viel von ihrem ureigenen marktwirtschaftlichen Haupt- und Generalprodukt: zu viel Kapital, als dass es weiterhin seinem einzigen Daseinszweck nachkommen, nämlich weiter akkumulieren könnte.[3] Die allgemeine Geschäftslage gibt keine rechten Wachstumschancen mehr her; deswegen gibt es überflüssiges Kapital in all den Erscheinungsformen, die es für sein Wachstum annehmen muss: Sündteure, sau-produktive Anlagen sind nicht ausgelastet; Ware mit erstklassig durchkalkuliertem Produktionspreis ist nicht absetzbar; verfügbares Geldvermögen findet keine lohnende Anlage. Und die Belegschaften, in den Bilanzen ihrer Weltfirmen als ‚Kostenfaktor Arbeit‘ verbucht, sind schon gleich zu groß. Aus dieser absurden ökonomischen Katastrophe lernen deren erfolgreiche Urheber freilich nur eins – nämlich das, was die Logik ihres Geschäfts ihnen sowieso als ihre einzig maßgebliche Handlungsmaxime vorgibt: In der Konkurrenz gegen andere müssen sie sich noch mehr anstrengen, sprich: ihre ‚Mitarbeiter‘ noch weit mehr strapazieren als bisher, um sich Profit in der nötigen Größenordnung zu sichern. Wenn dazu die Ausstattung ihrer Betriebe mit den perfektesten Produktionsmitteln nicht genügt, dann muss es eben eine Korrektur an den „externen“, d.h. den von der Einrichtung des Produktionsprozesses unabhängigen Parametern der Rentabilität bringen: an Löhnen und Arbeitszeiten. Das schließt gegenüber neuerlichen ‚Rationalisierungs‘-Investitionen immerhin auch einen bedeutenden Vorteil ein: Diese Art, die Rendite zu steigern, funktioniert ohne zusätzlichen Kapitalaufwand, zum Nulltarif gewissermaßen.
Damit sie wirklich funktioniert, dürfen sich die Unternehmer allerdings auch in ihrer notorisch sozialfriedlichen deutschen Bundesrepublik nicht zu schade dafür sein, den politischen, nämlich einen tarifpolitischen wie einen allgemeinen wirtschafts- und sozialpolitischen Kampf für ihre gerechten Belange aufzunehmen. Und wie man sieht, lassen sie sich da nicht lumpen. Dass sie dabei die Arbeitslöhne und Arbeitszeiten an auswärtigen Standorten als Maßstab heranziehen, von denen nicht bloß ihre Konkurrenten, sondern auch sie selber bereits profitieren, ist eine passende Ironie der kapitalistischen Weltgeschichte: Nicht die Arbeiter, die Unternehmer fordern grenzüberschreitend gleichen Lohn für gleiche Arbeit und Angleichung der Arbeitsbedingungen – gleiche Ausbeutungsbedingungen eben an allen interessanten Standorten![4] Als Kampfmittel haben sie ihre privateigentümliche Verfügungsmacht, die sich ja keineswegs auf das tote Inventar ihrer Betriebe beschränkt. Sie, die Herren „der Wirtschaft“, haben freien Zugriff auf Arbeitskräfte in aller Welt so gut wie bei sich zu Hause; nicht bloß formell als staatlich ermächtigte Monopolisten der gesellschaftlichen Produktionsmittel, sondern auch in dem praktischen Sinn, dass ihnen überall ein großes Reservoir an nützlichen, aber ungenutzten Arbeitskräften zu Gebote steht: daheim nicht zuletzt dank eigener Rationalisierungs-Erfolge; neuerdings auch im nahen östlichen EU-Ausland infolge einer gelungenen Transformation realsozialistischer Produktivkräfte in überflüssiges Kapital und der entsprechenden Werktätigen in arbeitslose Lohnarbeiter. Vermöge dieser Machtposition machen sie den Lehrsatz wahr, dass massenhafte Arbeitslosigkeit den Preis der Arbeit drückt; nicht ohne zugleich klarzustellen, dass dieser systematische Zusammenhang keineswegs von selber wirkt, weder per ‚Angebot und Nachfrage‘ noch sonst ‚irgendwie‘: Er will per Erpressung, im Kräftemessen mit ohnmächtigen Lohnabhängigen bzw. deren entgegenkommenden Standesvertretern, sowie in einem konstruktiven Dialog mit ‚der Politik‘ erst praktisch durchgesetzt sein.
Dabei ist es Deutschlands Arbeitgebern unter vaterländischen Gesichtspunkten hoch anzurechnen – sie selber sehen es jedenfalls so –, dass sie sich der Mühe unterziehen, ihre heimischen Belegschaften mit Angeboten für ein die Rentabilität förderndes Verarmen zu drangsalieren und ihrer Berliner Regierung mit der Forderung nach Reformen zuzusetzen, die niemand falsch versteht, statt gleich jeder Einladung in ein nahes oder fernes Billiglohn-Ausland nachzulaufen. Ihnen liegt tatsächlich daran, den nationalen Standort, mit dessen menschlichen und sonstigen Ressourcen und unter dessen machtvoller politischer Protektion ihre Klitschen zu Weltfirmen herangewachsen sind und an dem sie nach wie vor in fast jeder Hinsicht perfekt bedient sind, nicht zu verlassen, sondern zu einer blühenden Billiglohn- und Maxi-Arbeitszeit-Landschaft weiterzuentwickeln. Für die reale Subsumtion von Land und Leuten unter die Konkurrenzbedürfnisse des global agierenden deutschen Kapitalismus ist immer wieder, und im Zeichen der tobenden Krisenkonkurrenz erst recht, noch viel zu tun. Die Kapitalisten, die wissen, was sie am deutschen Staat haben, beweisen Nationalbewusstsein und Vaterlandsliebe und packen es an.
2. Das neueste Patentrezept des regierenden Wirtschaftsnationalismus: Der Standort D braucht Arbeitsplätze, also den totalen Schulterschluss der politischen Klasse mit der kapitalistischen
Die Bundesregierung weiß den praktizierten Patriotismus ihrer Kapitalistenklasse zu schätzen; umso mehr, als sie mit den Konsequenzen der Krise, außerdem und zusätzlich mit ihrem Aufbau Ost
und überhaupt mit der internationalen Konkurrenzmacht ihrer Nation einen Haufen Probleme hat. Deren Lösung sucht und findet sie im engen Schulterschluss mit den Inhabern, Managern und Repräsentanten der Privatmacht des großen Geldes.
a) Weil der Aufschwung auf sich warten lässt, fehlen dem Staat auf allen seinen Ebenen Finanzmittel. Entlassene Arbeitnehmer zahlen keine Einkommenssteuer; die Konsumenten in ihrem Spar-Wahn bleiben Umsatzsteuern schuldig; die Unternehmen rechnen ihre zu versteuernden Gewinne ins Bodenlose herunter; die Steuernachlässe verfehlen ihren Zweck, die Binnenkonjunktur ‚anzukurbeln‘, und steigern bloß das nationale Haushaltsdefizit; das liegt schon wieder über den im Euro-Statut allenfalls erlaubten 3 Prozent vom Bruttosozialprodukt, das viel zu wenig, wenn überhaupt gewachsen ist. Den Kredit, den der Staat deswegen braucht, (ver)schafft er sich zwar alle Mal; um das ‚Ranking‘ seiner Anleihepapiere braucht er sich – noch – keine Sorgen zu machen, sie sind so gut wie Geld und kosten ihn derzeit noch nicht einmal viel Zinsen. Von einem Kapitalwachstum, das die Aufblähung der staatlichen Finanzmittel ökonomisch rechtfertigen würde, kann allerdings nicht die Rede sein. Statt kapitalistisch produktiv verwendet zu werden, versacken nationale Haushaltsmittel in der unproduktiven Alimentierung sei es ausgedienter, sei es überflüssig gemachter, auf jeden Fall kapitalistisch nutzloser Bevölkerungsteile. Das belastet und beeinträchtigt die Potenzen einer gedeihlichen nationalen Haushaltsführung durch den Staat.
Dessen verantwortliche Akteure kennen für alle diese Leiden einen ökonomischen Grund: Es fehlt an Arbeitsplätzen im Land. Mit der Diagnose kommen sie sich zum einen ausgesprochen sozial vor: Sie erklären sich solidarisch mit denjenigen Opfern des kapitalistischen Geschäftsgangs, die in dessen Erfolgsphase wegrationalisiert, im anschließenden Abschwung „abgespeckt“, so oder so jedenfalls in die Einkommenslosigkeit entlassen worden sind und denen das Gemeinwesen genau ein existenzielles Bedürfnis zuerkennt: den Notschrei nach einer Gelegenheit, sich für den Profit eines Arbeitgebers nützlich zu machen; diesen Wunsch können sozial eingestellte Politiker schon allein mit Blick auf ihre schlecht gefüllten und viel zu schnell geleerten Sozialkassen nur nachdrücklich unterstützen. Mit ihrem Befund über die letzte Ursache aller nationalen Mangelerscheinungen kommt die regierende Elite sich zugleich ökonomisch äußerst sachverständig vor – auch das zu recht. Denn ohne sich politökonomisch viel dabei zu denken, trifft sie in einer Hinsicht den Nagel auf den Kopf. Sie bekennt sich dazu, dass der Reichtum der Nation, so wie sie ihn kennt und braucht, der abstrakte geldförmige nämlich, „letztlich“ wohl doch keiner anderen Quelle entstammt als der Arbeit, die in der Gesellschaft verrichtet wird: weder den Luftblasen der Börsenspekulation noch dem unendlich verantwortungsvollen Einsatz des Manager-Standes, sondern der Arbeit, über die die einen disponieren und auf deren Erträge an der Börse spekuliert wird. Die kapitalistische Errungenschaft, dass die Einsparung von Arbeit als Arbeitsplatzverlust nicht bloß individuell, sondern auch in der Gesamtbilanz negativ zu Buche schlägt, dass also auch bei noch so gesteigertem Wirkungsgrad der Arbeit dann doch „irgendwie“ ausgerechnet deren Menge und Dauer für das Maß des gesellschaftlich produzierten abstrakten Reichtums den Ausschlag gibt, ist den Amtsträgern der Nation völlig geläufig. Dabei versteigen sie sich freilich nicht zu dem als populistisch geächteten Übergang, den wirklichen Herren der Arbeitsplätze, den kapitalistischen Arbeitgebern, den äußerst lückenhaften Gebrauch der national verfügbaren Arbeitskraft irgendwie zum Vorwurf zu machen. So selbstverständlich wie die Notwendigkeit möglichst vieler Arbeitsplätze und -stunden für den Reichtum der Nation ist ihnen die entscheidende Bedingung, die der Konkurrenzkampf der Kapitalisten dafür setzt: Spitzenmäßig rentabel muss die Arbeit sein, um echtes Geld zu produzieren. Und das schließt nun mal das ‚Sachgesetz‘ ein, dass die Unternehmer ihre Rendite aus immer weniger immer produktiverer Arbeit herausholen.
Deswegen pfuschen Deutschlands aufgeklärte Wirtschaftspolitiker den Profis der Arbeitgeberei auch nicht mit systemwidrigen Forderungen nach kapitalistischen Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen ins Handwerk. Ganz grundsätzlich mit einem Sozialversicherungswesen, ganz speziell mit maßgeschneiderten Sonderregelungen zu Frühverrentung, Vorruhestand und dergleichen nehmen sie im Gegenteil den Unternehmern die überflüssigen und verbrauchten Leute ab. Die ganze elende Hinterlassenschaft des Konkurrenzkampfes der Kapitalisten und die Opfer der Krise organisieren sie als sozialpolitisches Problem, mit dessen Bewältigung die Wirtschaft, die ohnehin nicht genug wächst, auf keinen Fall weiter belastet werden darf. Weil dadurch allerdings immer noch keine neuen profitträchtigen Arbeitsplätze entstehen, geschweige denn in nennenswerter Anzahl, mischen sich die politischen Chefs mit neuem Nachdruck ins Geschäft mit dem Arbeitgeben ein: Sie einigen sich mit den Unternehmenschefs über die allgemeinen, politisch zu regelnden Geschäftsbedingungen, die denen nach Maßgabe ihrer unternehmerischen Konkurrenzstrategien für eine gründliche Wiederbelebung ihres Wachstums am Standort Deutschland fehlen, und kümmern sich darum.
b) Eine quasi flächendeckende Fehlanzeige in Sachen Arbeitsplätze erstattet der „Gesprächskreis Ost“, von der Bundesregierung eigens mit der Beurteilung der ökonomischen Situation und den Perspektiven der Neuen Bundesländer beauftragt, über die Ostzone des wieder vereinigten Deutschland – ein zwar überhaupt nicht neues, niemanden überraschendes, in seiner Entschiedenheit dennoch als niederschmetternd empfundenes Fazit von anderthalb Jahrzehnten „Aufbau Ost“, den die Republik sich immerhin eineinviertel Billionen Euro hat kosten lassen. Selbstkritisch zurückblickend begutachtet die Nation einen Kraftakt, den die politische Klasse ihrem eigenen hoheitlichen Nationalismus schuldig war.
Der war es zum einen um ein starkes Stück kapitalistischen Staatsmaterialismus gegangen: Die Volkseigenen Betriebe des Realen Sozialismus wurden zur Gelegenheit und zum geeigneten Material für eine enorm erweiterte Kapitalakkumulation am Standort Deutschland umdeklariert; durch ihre Privatisierung, ihre Überantwortung an die bewährten Monopolisten des kapitalistischen Kommandos über produktiven Reichtum und gesellschaftliche Arbeit, sollte dem alt-bundesdeutschen Kapitalismus quasi eine komplette Nationalökonomie hinzugefügt werden. Mit der Übertragung der westdeutschen Rechtsordnung, der Einführung einer gescheiten Währung, einer treuhänderischen Interims-Verwaltung des produktiven Volksvermögens und mit Kredit für eine verbesserte Infrastruktur tat der Staat das Seine dazu. Ergänzend hat er sich zum andern einigen Aufwand für die sozialpolitisch unterfütterte Eingemeindung der Ex-DDR-Bürger ins westlich-kapitalistische Gemeinwesen geleistet. Mit der Umstellung aller privaten Versorgungs- und Besitzansprüche auf Anrechte und Verbindlichkeiten in harter Währung wurde der bundesdeutsche Geldpatriotismus in den Osten des Landes exportiert, und aus sozialistischen Werktätigen und Versorgungsempfängern wurden Lohnarbeiter, Sozialversicherungsfälle und angepasste Bundesbürger gemacht – eine ebenso vulgäre wie wirksame Nutzanwendung alter marxistischer Erkenntnisse über das „reale Gemeinwesen“, das Geld. Aus dieser doppelten Steilvorlage sollten die Akteure und Instanzen, die nunmehr auch „drüben“ „die Wirtschaft“ waren, einen Aufstieg der Nation in eine höhere Kategorie von Weltwirtschaftsmacht verfertigen.
Die haben dann allerdings das Ihre daraus gemacht. Und zwar zuerst und vor allem das Eine nicht: aus VEBs funktionstüchtige Profitmaschinen. Was ihnen zur Übernahme angeboten wurde, waren keine Unternehmen, die für eine Fusion, einen „Mega-Merger“ womöglich im Sinne der freundlichen oder feindlichen Übernahme einer florierenden AG durch eine andere, in Frage gekommen wären; dazu fehlte es in diesen Betrieben an durchorganisierter, in perfekten Produktionsmitteln vergegenständlichter Arbeitshetze, vor allem aber an einem interessanten neuen Markt, in den man sich durch eine solche Akquisition hätte einkaufen können. Zu kapitalistischen Goldgruben hätte man die VEBs erst machen müssen; mit Investitionen, die in den Wachstumsstrategien westlicher Konzerne erstens überhaupt nicht vorgesehen waren und zweitens schon gar nicht an einem Standort, der weder selber ein anständiges Stück Weltmarkt repräsentierte noch die Chance zur Okkupation eines erweiterten Weltmarkts bot. Nur ausnahmsweise und nur durch ganz viel Staatsgeld haben verantwortliche Manager sich zum Aufbau neuer Produktionskapazitäten verleiten lassen, ansonsten Betriebe übernommen, um sie „abzuwickeln“, und mit dem Krempel aus ihren durchrationalisierten, nun entsprechend besser ausgelasteten Stammwerken das Geld verdient, das in Deutschlands neuem Osten zu verdienen war und ist. Denn über die im Wesentlichen vom Staat gestiftete und aufrecht erhaltene Zahlungsfähigkeit haben sie sich hergemacht – und prompt eine kapitalistische Übertreibung mit anschließender Krise fertig gebracht: Handelsketten und Kreditinstitute sind auf ihre Kosten gekommen und beklagen schon wieder Überkapazitäten; die Baubranche hat einen Boom hingelegt, bis es gleich wieder ans „Gesundschrumpfen“ gegangen ist; das neu gestiftete Grundeigentum hat seine eigene, inzwischen geplatzte Spekulationsblase genährt. Ihre Qualitäten als kapitalistisch ausnutzbare Lohnarbeiter dürfen die Ex-DDR-Bürger hauptsächlich im alten Bundesgebiet unter Beweis stellen – das hat der gesamtdeutsche Kapitalismus auch noch geschafft, das brauchbare Menschenmaterial, das der Reale Sozialismus hinterlassen hat, mobil zu machen und auch darüber neue Maßstäbe für Flexibilität und Billigkeit des Faktors Arbeit in die nationale Arbeitswelt einzuführen.
Vom letzten Punkt abgesehen ist das alles nun nicht gerade das, was der regierungsamtliche Patriotismus sich von der Annexion der DDR versprochen hat. Doch auch das viele Geld, das der Staat aufgewandt hat, um die Wachstumsstrategien des Kapitals in eine gesamtdeutsch-vaterländische Richtung zu lenken, hat nichts genützt: Aus der Notwendigkeit, die Masse der Neubürger von Staats wegen zu beschäftigen oder sozialstaatlich zu alimentieren, ist die nach allen Regeln der kapitalistischen Kunst ‚deindustrialisierte‘ Ostzone nicht herausgewachsen. Unter die entsprechenden Bemühungen ziehen die Berliner Reformer nunmehr einen Schlussstrich. Sie sehen ein und akzeptieren es, dass das Kapital ein für alle Mal kein Entwicklungshelfer ist, auch nicht unter optimalen Geschäftsbedingungen im eigenen Land. Dementsprechend korrigieren sie nicht mehr mit Geld und Kredit die Kalkulationen der Geschäftswelt, sondern ihre nationale Anspruchshaltung. Aus dem „Aufbau Ost“ soll das werden, was der bundesdeutsche Kapitalismus daraus bereits gemacht hat: ein Vorbild für die sowieso unabweisbar nötige Neusortierung der gesamtdeutschen Klassengesellschaft.
c) Angesichts des katastrophalen Defizits an deutschen Arbeitsplätzen kann die Regierung eines allerdings überhaupt nicht leiden: Die Drohung wichtiger Unternehmen, Werke zu schließen und Arbeitsplätze ins Ausland zu verlagern, geht ihr dann doch zu sehr gegen ihren Standort-Nationalismus; auch dann, wenn sie „bloß“ als erpresserische Ansage an den Tarifpartner gemeint ist, denn womöglich wird sie dann doch wahr gemacht; und erst recht dann, wenn geschworene Feinde der rotgrünen Koalition noch nicht einmal aus soliden geschäftlichen, sondern – viel schlimmer! – aus pur parteipolitischen Gründen öffentlich zur Flucht aus der bundesdeutschen Kapitalisten-Hölle raten, auch wenn das nun wirklich kein verantwortlicher Manager ernst nimmt. So kommt es sogar zwischen der Schröder-Mannschaft und gewissen Arbeitgeber-Funktionären zu hässlichen Tönen; der SPD-Generalsekretär nimmt die Gelegenheit zu einem historischen Revanchefoul wahr und schimpft über „vaterlandslose Gesellen“ im Unternehmerlager. Ein Widerruf oder auch nur die zarteste Einschränkung der unternehmerischen Freiheit, Arbeitskräfte auszubeuten, wo immer es sich lohnt, stand allerdings nie zur Debatte. Solange die deutschen Unternehmer sich daran erinnern, was sie an ihrem Staat haben, der ihnen den Zugriff auf Geschäftsmittel und -gelegenheiten in aller Welt eröffnet und ein Maximum an Sicherheit dafür garantiert; solange sie eingedenk dieses gedeihlichen Verhältnisses die Ausbeutung fremdländischer Arbeitskraft ebenso wie die Ausnutzung auswärtiger Zahlungsfähigkeit und Warenangebote von ihrem deutschen Heimatstandort aus betreiben, hier und in hiesiger Währung ihr Kapital akkumulieren lassen und sogar die Steuern zahlen, die man ihnen noch nicht erlassen hat – so lange sind sich auch Deutschlands Politiker sicher, dass die Finanzmacht, über die sie verfügen, und die Position ihres Landes in der Konkurrenz der ökonomischen Weltmächte mit der globalen Bewegungsfreiheit der kapitalistischen Geschäftemacherei nicht bloß ganz gut vereinbar ist, sondern sehr einseitig und sehr entschieden davon profitiert. Staatlicher Wirtschaftspatriotismus und der kalkulierende Patriotismus „der Wirtschaft“ sind eben doch deckungsgleich.
Alle einschlägigen „Irritationen“ sind mittlerweile denn auch wieder ausgeräumt; dies freilich nicht bloß deswegen, weil alle Beteiligten sich wieder abgeregt haben. Die Warnung der unternehmerischen Elite der Nation, man könnte sich womöglich zu Betriebsverlagerungen in größerem Umfang genötigt sehen, ist von der Regierung als patriotischer Notruf aufgenommen worden: als Ausdruck tiefer Sorge um die Attraktivität des Standorts Deutschland überhaupt fürs Kapital, von dessen Zuspruch die deutsche Wirtschaftsmacht zehrt; insoweit als nachdrücklicher Hinweis auf die Konkurrenzlage, in der die Nation sich zu bewähren hat. Die Berliner Reformer erkennen in der Offensive der Arbeitgeber ihre eigene sorgenvolle Sicht der Dinge wieder. Auch sie verstehen die Folgen der kapitalistischen Krise, an denen sie mit ihrem Haushalt und mit ihren nationalen Arbeitsplatzproblemen herumlaborieren, als Niederlage in der Konkurrenz der Nationen um ihr ökonomisches Hauptnahrungsmittel: als Mangel an Kapital, und zwar als selbst verschuldeten, verschuldet durch notorische „Reformunfähigkeit“ – dies das Kunstwort für die Tatsache, dass die herrschenden Ausbeutungsbedingungen derzeit nicht automatisch schrankenlose Akkumulation garantieren. Wie ihre kämpferische Wirtschaftselite übersetzt die Regierung Überakkumulation und Krise in Wachstumsschwäche; und die nimmt sie nicht als Rezession, der bald wieder bessere Zeiten folgen, auf die leichte Schulter, sondern als praktische Auskunft über die Schärfe des internationalen Konkurrenzkampfes und über die Notwendigkeit einer gründlichen Neuaufstellung der deutschen Klassengesellschaft bitter ernst. Auch wenn es Schröder und seiner Mannschaft kaum jemand glauben mag – angeblich hat der Mann ja „keine Vision“! –: Das Gerede der Regierung von der Zukunft der Nation, die auf dem Spiel stünde, von einer historischen Wende, die längst überfällig wäre, und von Deutschlands Stellung in der Welt, die sich mit dem Erfolg ihrer Politik entscheiden würde, ist schon genau so gemeint. Die Radikalität ihres Vorgehens lässt daran jedenfalls keinen Zweifel.
3. Politischer Klassenkampf, Abteilung 1: Weniger Lohn für mehr Arbeit – von der Krisenstrategie der Unternehmer zur gewaltsamen Durchsetzung einer nationalen Generallinie
Mit der staatlichen Krisendiagnose steht fest, welche entscheidende Wachstumsbedingung
im deutschen Standort fehlt, und damit auch, nach welcher politischen Maxime die ökonomische Standortsanierung vonstatten zu gehen hat: Der Kampf um mehr Wachstum in Deutschland ist über die Verbilligung der Arbeit zu führen, und zwar so, dass im ganzen Standort der Lohn auf ein Niveau abgesenkt wird, das die kapitalistischen Geschäftemacher hier wie die im Rest der Welt gar nicht umhin können attraktiv
zu finden. Die Bundesregierung jedenfalls verordnet ihrem Land flächendeckend die Therapie, die ihrer Diagnose entspricht. Und da kehrt, was erst einmal den Osten der Republik betrifft, bei den Verwaltern des Gesamtstandorts ein selbstkritischer Realismus ein. Sie stellen sich dem Umstand, dass ihnen ihr Aufbauwerk gründlich missraten ist, aus den vielen Milliarden, mit denen sie den kapitalistischen Aufbau dieses Teils ihrer Republik vorfinanziert haben, noch immer keine ‚blühenden Landschaften‘ geworden sind, und halten als Bilanz ihrer über 15 Jahre aufgehäuften Schuldenberge fest, dass dann wohl sie sich in ihren diesbezüglichen Erwartungen vertan haben. Für sie jedenfalls ist nicht „die Wirtschaft“ dafür haftbar zu machen, dass das mit so viel finanziellem Aufwand aufbereitete produktive Inventar der neuen Länder nur so beschränkt geschäftlich genutzt wird: Die eigene politische Anspruchshaltung ist zu korrigieren, wonach findige Geschäftsleute unter Zuhilfenahme der reichlich gewährten Kredite aus Ganzdeutschland auch einen einzigen blühenden Kapitalstandort zu verfertigen hätten. Ab sofort hat sich die politische Förderung
des Ostens, die freilich weiter sein muss, ausschließlich auf das zu konzentrieren, was sich in Anbetracht des tatsächlich stattfindenden Geschäfts zu fördern auch wirklich lohnt, und das sind eben nur die Geschäfte, die dort stattfinden, weil sie sich lohnen. Wenn es die kapitalistische Erschließung der Zone nur zu ein paar Inseln der Produktivität
gebracht hat, dann sind die eben die Leuchttürme
, die aus einem Sumpf kapitalistisch unbrauchbarer stofflicher wie menschlicher Ressourcen herausragen. Die gilt es als – offenbar – einzig brauchbare Quellen von Wachstum im Osten instand zu halten, vielleicht noch die eine oder andere Region um sie herum, in denen sich Zulieferbetriebe für die Hand voll High-Tech-Vorzeigeunternehmen über Wasser halten können. Ansonsten aber ist Schluss mit Hilfen
, aus denen dort ersichtlich keiner etwas Produktives zu verfertigen versteht.
Gründlich zu revidieren hat die Politik auch alle anderen Vorstellungen von einer ‚Angleichung‘ der kapitalistischen Lebensverhältnisse zwischen Ost und West. Angesichts seiner dauerhaft ausbleibenden kapitalistischen Benutzung war es rückblickend betrachtet ein großer Fehler, dem frisch erworbenen ostdeutschen Volksteil die Eingemeindung in seine neue staatliche Heimat mit allerlei sozialpolitischen Rechten und Versorgungsansprüchen zu versüßen; und ein noch größerer Fehler war es, ihm mit der Perspektive zu winken, die ihm spendierten Renten, Löhne usw. würden sich irgendwann an westdeutsches Niveau angleichen. In Wahrheit, das weiß man in Berlin heute, hat es sich damit genau andersherum zu verhalten, und zwar in doppelter Hinsicht. Wenn Kapitalisten im Osten überhaupt etwas attraktiv
und für sich lohnend finden, dann sind es – sie zeigen es ja praktisch und sagen es auch selbst – die billigen Löhne dort sowie der Umstand, dass sie sich bei deren rentabler Verwertung von lästigen Rücksichtnahmen auch auf die übrigen tarifrechtlichen Gepflogenheiten des Westens erfolgreich befreit haben. Also ist erstens dieser ‚Standortvorteil‘ in den neuen Ländern nicht nur unbedingt zu wahren, sondern nach Möglichkeit in derselben Richtung weiter auszubauen, und was für den Osten gilt, hat zweitens im Westen Deutschlands erst recht zu gelten – hinkt der doch bei der Entwicklung der nach Sachlage einzig gebotenen Wachstumsbedingungen 15 Jahre hinterher.
Damit steht der Auftrag der Politik, die Krisenstrategie des Kapitals im Standort als festes Standbein und unverrückbare Bedingung seiner weltweiten Konkurrenz zu implantieren und das entsprechende gesamtdeutsche Billiglohnniveau herbeizuregieren, welches Investieren hier – auch für die ausländische Geschäftswelt – wieder vermehrt lohnend machen soll; und in diesem Sinn marschieren Deutschlands diverse Regierungen im Kampf um unentgeltliche Mehrarbeit dann voran. Sie verordnen ihren Bediensteten längere Dienstzeiten, und sagen gleich dazu, warum sie das tun: um an Stellen wie Geld zu sparen. Ohne jede Beschönigung exekutieren sie den Gegensatz zwischen Staatskasse und Lebensbedingungen des Personals, und verschweigen auch überhaupt nicht, dass das Prinzip, das sie gerade vollstrecken, nach ihrem Willen auch außerhalb ihres unmittelbaren Macht- und Wirkungsbereichs Platz zu greifen hat: Ausdrücklich Unterstützer wie Vorbildgeber für die entsprechende Politik der Unternehmer wollen die Herren der Beamten und des öffentlichen Dienstes sein. Und in der Tat: Indem sie es per Gesetz verfügen, sorgen sie dafür, dass das, was im Metall-Tarifvertrag zwischen den Tarifpartnern als Konzession vereinbart ist – und von den Unternehmern selbstverständlich in der Berechnung vereinbart wurde, aus einer von gewerkschaftlicher Seite konzedierten Ausnahme die Regel zu machen –, zu einer staatlich anerkannten neuen Selbstverständlichkeit bei der ‚Lohnfindung‘ in Deutschland wird: die Trennung des Entgelts von der damit bezahlten, in Stunden gemessenen Arbeitsleistung.[5] Mit dieser schöpferischen Fortschreibung des Arbeits- und Vertragsrechts werden alle überkommenen Prinzipien einer ‚Lohngerechtigkeit‘ einfach liquidiert, in deren Sicht – und schon auch von Rechts wegen – eines immer galt: Leistung ‚Lohn‘ und Gegenleistung ‚Arbeit‘ stehen zueinander in einem bezifferbaren Verhältnis; in welchem jeweils genau, machen die Kontrahenten des Vertrags in Bezug auf die Höhe des Entgelts einerseits, hinsichtlich der Dauer der Arbeit andererseits verbindlich untereinander aus, wenn ihre wechselseitige Erpressung zu einem Kompromiss geführt hat; Abweichungen vom Vereinbarten begründen daher neue Ansprüche, über die neu zu verhandeln ist. Ab sofort hat nach staatlichem Willen die neue Gerechtigkeit bei der Lohnfindung zu herrschen, deren Maß der Arbeitsplatz selbst ist: Der pure Umstand, an ihm Dienst tun zu dürfen, diktiert, was sein lohnarbeitender ‚Besitzer‘ alles an Verzicht dafür zu erbringen hat, dass er dies darf. Der Lohn wird regierungsamtlich definiert als Lebensunterhalt, und zwar als in jeder Höhe ausreichender, mit dessen Zahlung sich der Arbeitgeber ein nicht von vornherein zwingend eingeschränktes, vielmehr nach Betriebsbedarf exekutiertes Verfügungsrecht über die Arbeitskraft seiner Lohnempfänger erwirbt. Gerade so, als ob sich da Fachleute für eine bewusste Anwendung des Wertgesetzes
einmal ganz anders an den – seit dem Abgang der DDR ja verwaisten – Kommandohöhen
der Wirtschaft zu schaffen machen wollten, erinnert die Regierung Schröder ausdrücklich daran, worauf es bei der Lohnarbeit ökonomisch wirklich ankommt: Ganz banal darauf, die Reproduktionskosten knapp zu bemessen und die Arbeitszeit dafür so lang, dass der in Stunden bemessene Nutzen aus der angewandten Arbeit möglichst groß wird und exklusiv beim Arbeitgeber bleibt!
Mit dieser Maxime, meinen Schröder und Co. jedenfalls, wäre der Königsweg zu neuem Wachstum gefunden. Das ist – einerseits – ein böser Witz: Während das Kapital die einzig systemgemäße Form von „Arbeitszeit-Verkürzung“ praktiziert, nämlich per Rationalisierung, und im Zuge seiner Krisenkonkurrenz Arbeitsplätze streicht und Arbeitskräfte zu arbeitslosem Elend verurteilt, erklärt die Regierung eine Arbeitszeitverlängerung, mit der die Arbeitgeber sich noch mehr Personal und Personalkosten ersparen, zum Rezept gegen Wachstumskrise und Arbeitslosigkeit. Diese Gemeinheit ist – andererseits – sehr konsequent. Sie führt einfach stur die regierungsamtliche Diagnose weiter, wonach der Schwund
von Arbeitsplätzen nie und nimmer die Folge erfolgreichen Akkumulierens und Rationalisierens, und schon gleich nicht Resultat einer in die Krise geratenen Überakkumulation derartiger Erfolge sein kann. Vielmehr indiziert der Umstand, dass so viele brachliegende Arbeitskräfte von denen, die dies von Berufs wegen sowieso tun und in staatlichem Interesse schon gleich unbedingt tun sollten, einfach nicht nachgefragt werden, für Deutschlands Regierende glasklar, dass sich da die kapitalistischen Arbeitgeber zurückhalten – und es ist keine Frage, warum sie dies tun. Dass für sie die Bedingungen Erfolg versprechenden Geschäftemachens in Deutschland so schlecht sind, haben sie ja laut und oft genug wissen lassen, also wird schon auch etwas dran sein. Die Regierung jedenfalls verschließt sich deren Sicht der Dinge nicht. Dass der Kapitalstandort Deutschland zu wenig attraktiv
ist, überreguliert
und zu teuer
, und dass er deswegen vom internationalen Kapital gemieden und sogar vom eigenen verlassen
wird: Das leuchtet dem in Berlin regierenden politökonomischen Sachverstand unmittelbar ein – angesichts von deutschen Löhnen, die leicht viel niedriger, und von deutschen Arbeitszeiten, die gut und gerne viel länger sein könnten. Und vor allem deswegen, weil ihm ja in jedem Fall die Macht zu Gebote steht, die Attraktivität
seines Standorts gewaltsam herbeizuregulieren und aus der Welt zu schaffen, was er als den nationalen Standortnachteil in der Konkurrenz um Kapital ausgemacht hat. In genau diesem Sinn denken Experten der Opposition zum Stichwort ‚überreguliert‘ dann die Sache voran und laut vor sich hin: Ob nicht die Tarifautonomie gleich überhaupt abzuschaffen wäre, wo mit ihr doch bestenfalls nur immer richtige Schritte
in die richtige Richtung zu haben sind, keinesfalls aber ein richtiger Befreiungsschlag, der mit dem Unsinn endgültig aufräumt, der kapitalistischen Verfügung über die Arbeitskraft verbindliche Schranken setzen zu wollen. Ob aus demselben Grund nicht auch der Kündigungsschutz abgeschafft gehört, insofern der ein einziges Hindernis für ‚die Beschäftigung‘ ist, weil frei kalkulierende Unternehmer Arbeitskräfte nur dann einstellen, wenn sie sie wieder entlassen können, seine Abschaffung also ein einziger Anreiz für sie ist, mehr und öfter Arbeitskräfte in Anspruch zu nehmen. Nachgerechnet hat das zwar keiner genau, so unbedingt behaupten will es auch niemand, aber das ignoriert ein Fanatismus einfach, für den als Ersatz für mangelnde Geschäftsgelegenheiten eben ein durch nichts mehr beschränkter Zugriff auf Arbeit den kapitalistischen Geschäftserfolg garantieren soll.
4. Politischer Klassenkampf, Abteilung 2: Der Sozialstaat reorganisiert sein Subproletariat – durch mehr Armut in neuen Formen
Bei der Sanierung seines Standorts kommt der Staat auch um eine zweite Selbstkritik nicht herum, die in diesem Fall vor allem das westliche Stammland des kapitalistischen Wirtschaftswunders der Nachkriegszeit betrifft. In Gestalt der berühmten Lohn-Nebenkosten
zweigt er zwar nur einen Teil der gezahlten gesellschaftlichen Lohnsumme für eine Abteilung ‚Soziales‘ ab. Aber insofern diese faux frais der kapitalistischen Elendsbetreuung auf seine politische Entscheidungshoheit zurückgehen, steht er schon seit längerem im Zentrum der Beschwerden von Kapitalisten, die die Lohnkosten in Deutschland für eine standortspezifische Zumutung bei ihrer Rentabilitätsrechnung halten. Also sind für einen Staat, dessen Unternehmer über attraktivere Arbeitskosten ihr Vaterland als Anlagesphäre wieder lieb gewinnen sollen, Korrekturen verlangt, und zwar endlich einmal solche, die sich nicht nur an einem Herumdoktern an den Prozentzahlen der ‚Abzüge‘ vom ‚Bruttolohn‘ versuchen, mit denen er die Pegelstände seiner diversen sozialen Kassen reguliert; sondern solche, die das Übel an der Wurzel packen. Wenn es denn so ist, dass die Kosten des Unterhalts nicht mehr gebrauchter oder zu gebrauchender Leute die Unternehmer in der zupackenden Tatkraft lähmen, von der alles Wachstum abhängt, dann ist dieses Volk zu teuer. Dann müssen die Kosten, die sein Unterhalt verursacht, gesenkt werden. Und damit sie garantiert so und auch auf Dauer sinken, wie sie es sollen, macht sich die Regierung Schröder mit ziemlich durchgreifenden Reformen am Wirkungsbereich des Ministeriums für Arbeit & Soziales zu schaffen. Hatten deren Vorläufer sich noch mit Versuchen herumzuschlagen, angesichts verminderter Zuflüsse einerseits, vermehrter Ansprüche andererseits, Renten-, Gesundheits- und andere sozialen Kassen vor der Pleite zu retten und dabei auch noch die erwünschte Entlastung der Arbeitgeber
hinzubekommen, so packen die regierenden Sozialdemokraten die Sache gleich ein wenig grundsätzlicher an: Um den Standort ganz nach kapitalistischem Geschmack aufzumöbeln, ihre Lieblingsbürger zum Investieren anzureizen und so für das ersehnte Wachstum zu sorgen, bauen sie nicht nur den Sozialstaat um, sondern die bundesdeutsche Klassengesellschaft insgesamt. In deren unterer Abteilung schaffen sie neue Formen proletarischer Armut, konstruieren regelrecht eine neue Typologie des Elends in ihre Zivilgesellschaft hinein und ordnen der ihre kapitalistisch unbrauchbaren Volksteile zu – wobei ‚neu‘ daran selbstverständlich nicht das Elend ist: Diesbezüglich hat der Kapitalismus in seiner Tradition die allerbesten Referenzen vorzuzeigen, Pauperismus musste die Bundesregierung nicht erfinden. Neu im deutschen Klassenstaat sind dessen Formen und der Umstand, dass die ab sofort die Anerkennung als gesellschaftlicher Status genießen, der zum proletarischen Leben einfach dazugehört.[6] Ein kleiner Überblick:
Ein Heer von Arbeitslosen dem Kapital zum Angebot nutzbringender Verwendung zu machen, ist naturgemäß nicht leicht: Es hat ja augenscheinlich gerade keinen Bedarf nach Arbeitskräften. Der stellt sich erfahrungsgemäß auch darüber nicht ein, dass ein Arbeitsamt diese Klientel mit Lohn-Ersatzleistungen für den Fall ihrer eventuellen Benutzung bereithält und sie zur neuen Indienstnahme durch den einen oder anderen Kapitalisten drangsaliert. Also ist erst einmal der Spielraum ordentlich auszuschöpfen, den ein Sozialstaat hat, das Angebot an Arbeitskräften den Bedürfnissen der Nachfrager besser passend zu machen. Mit „Hartz I“ lassen sich zumindest manche Beschäftigungshindernisse
– Tariflöhne, Sozialabgaben, Kündigungsregeln… – wegräumen, die nach herrschender Auffassung ja die Unternehmer vom Zugriff auf Arbeitslose bislang abgehalten haben. Das macht aus denen dann „Kunden“, um die sich ein „Job-Center“ kümmert – erst einmal so, dass es ihnen jeden Irrtum praktisch austreibt, bei der Suche nach einem Arbeitsplatz
käme es irgendwie auf ihre Wünsche und Interessen an, darauf womöglich, nicht irgendwohin abzurutschen in der beruflichen Laufbahn. Der Lohnhöhe nach unten und Ansprüchen nach oben, die temporal wie lokal ihre „Flexibilität“ betreffen, sind jedenfalls bei ihren Bemühungen
um Beschäftigung
, zu denen sie mit der Drohung von empfindlichen Sanktionen motiviert
werden, keine Grenzen gesetzt. „Personal-Service-Agenturen“ nehmen die Vermarktung der auf dem ‚Arbeitsmarkt‘ Liegengebliebenen dann in ihre Hände, indem sie ihre arbeitslosen Kunden, die sich bei ihnen anstellen lassen müssen, zu höchst attraktiven Konditionen weiterzuverleihen versuchen: Ganz ohne die lästigen Lohn-Nebenkosten, zu ganz günstigen Preisen und jederzeit widerruflich können interessierte Unternehmer auf Arbeitskräfte zugreifen und sie verwenden, wo und wofür auch immer sie wollen. So finden die in die Kassen der Arbeitslosenversicherung abgeführten Zwangsbeiträge endlich eine gescheite Verwendung: Sie finanzieren keine Lohn-Ersatzleistungen mehr, überbrücken nicht mehr die nutzlose Zeit ohnehin hoffnungsloser Vermittlungsversuche von Arbeitsämtern, sondern sie finanzieren die Herrichtung der Arbeitslosen zu einer beliebig einsetzbaren kapitalistischen Manövriermasse.
Damit hat der Staat seine großen Korrekturmaßnahmen in Sachen erfolgreicher Vermarktung
unbenutzter und nicht mehr vermittelbarer Arbeitskräfte erledigt. Dass dieses organisierte und staatlich finanzierte Entgegenkommen gegenüber der kapitalistischen Rentabilitätsrechnung ein einziger Flop ist, überrascht in Berlin niemanden groß. Dass auch von den Kosten und Lasten des Arbeitgebens gründlich entlastete Arbeitgeber keinen wachsenden Bedarf nach Neueinstellungen entwickeln wollen, weil sie sich mit ihren billigen und flexiblen
Stammbelegschaften schon gut bedient sehen und deswegen das staatlich geförderte Sonderangebot weitgehend liegen bleibt, hat der Staat in weiser Voraussicht gleich mitkalkuliert. Unverdrossen hält man an der Sprachregelung von einer Wiedereingliederung
der Arbeitslosen in die regulären
Beschäftigungsverhältnisse eines ersten Arbeitsmarktes
fest – und bringt zeitgleich mit dieser ersten ‚Reform des Arbeitsmarktes‘ eine zweite namens „Hartz II“ auf den Weg, bei der die bisherigen Kostgänger der sozialen Kassen entlang der Scheidelinie ‚erwerbsfähig‘ oder ‚nicht erwerbsfähig‘ durchgeprüft und zu einem Personenkreis definiert werden, der Adressat noch nie da gewesener Beschäftigungsangebote
ist: Mit staatlich-sozialer Hilfe werden die Erwerbslosen, aber Erwerbsfähigen dazu animiert, sich definitiv jenseits aller geregelten Erwerbstätigkeit auf eigene Faust die Mittel ihrer Subsistenz zu erwirtschaften. Ihnen stehen „Mini-Jobs“ offen, von denen sie zwar nicht, aber eben doch auch irgendwie leben können, wenn sie sich von denen gleich mehrere unter den Nagel reißen. Als „Ich-AG“ können sie ihre von niemandem gebrauchte Arbeitskraft aus sich herausgründen und als eigener Arbeitgeber frei über sie verfügen: Dann haben sie endlich einen. Der Börsengang bleibt ihnen zwar verwehrt, aber sonst steht den staatlich bezuschussten Ein-Mann-Selbstverleihfirmen die Welt offen. Auf dem bislang von illegal werkelnden ungelernten Hilfs- und sonstigen Gelegenheitsarbeitern besetzten Markt für Schwarzarbeit
hätten sie gute Geschäftsgelegenheiten, und natürlich im Dienstleistungssektor
, der – nach öffentlichem Urteil – für den Beruf des Tagelöhners ein wahres Eldorado ist. Mit jedem dieser ‚Instrumente moderner Arbeitsmarktpolitik‘ zersetzt der Staat bisher im Umgang mit Lohn und Leistung gebräuchliche Praktiken – und schreibt mit jedem Schritt der Zersetzung der alten gleich die sozialen Lebenslagen derer neu fest, für die seine ‚moderne Arbeitswelt‘ gedacht ist: Sie sollen sich verdingen, gleichgültig, womit; und dass sie von dem Entgelt, das sie dafür erlangen, nicht leben können, steht ohnehin fest: „Working poor“ ist keine Schande, weder im reichsten Staat der Welt noch im zweitreichsten, sondern die anerkennende Würdigung des Umstands, dass die vielen im Zusammenspiel von Kapital und Sozialstaat geschaffenen Kreaturen ihr Elend in eigener Regie verwalten und dabei auch noch anständig bleiben. Wegen mangelnden kapitalistischen Bedarfs nach ihnen sind sie überflüssig, und genau diesen Status schreibt ihnen ihr sozialer Staat dann auch als ihr höchstpersönliches Lebensschicksal und positives Programm ihrer Lebensbewältigung zu: Inmitten einer auf höchstem produktiven Niveau wirtschaftenden Gesellschaft und mitten in einer mit allen erdenklichen Raffinessen des Kredits operierenden Geldwirtschaft, in den Randbezirken um den Großkomplex der normalen kapitalistischen Erwerbswelt herum und ohne jede Perspektive, in die jemals wieder zurückzukehren, dürfen und sollen sie sich eigenverantwortlich
um sich kümmern und sich eine 1-Mann-Subsistenzwirtschaft zusammenstricken. Wie sie mit deren Erträgen über die Runden kommen, steht dann unter der Rubrik ‚Selbständige‘ im jährlichen Armutsbericht. Oder eben unter der anderen Rubrik, in der diese Selbständigen auch noch als Bezieher von „Alg II“ zusammengefasst werden; denn auch in diesem sozialstaatlich sauber hinkonstruierten Souterrain des Pauperismus ist Schluss mit Gängelei und dürfen die Erwerbslosen ihr Schicksal in die eigenen Hände nehmen: Als Ersatz dafür, dass sie aus ihren eingezahlten Versicherungsbeiträgen nach 12 bzw. 18 Monaten ab sofort keine Rechte mehr ableiten dürfen, Zahlungen für ihren Unterhalt sich vielmehr allein an dem Bedarf
bemessen, der ihnen zugebilligt wird, können Arbeitslose die ihnen gewährte Sozialhilfe auch mit eigener Arbeitstätigkeit aufbessern
. 15-30% des dazu verdienten Einkommens dürfen sie ohne Anrechnung auf die Hilfszahlungen behalten, von der Aufwandsentschädigung
bei den „1-Euro-Jobs“ sogar die ganze stolze Summe; selbstverständlich wird darauf geachtet, dass der Lohn die Grenze zur Sittenwidrigkeit auch nach unten nicht überschreitet. Neben vielen Kommunen, Wohlfahrtsverbänden und privat wirtschaftenden Pflegeheimen hat dann sogar der Staat selbst wieder Interesse am Bodensatz seiner kapitalistischen Gesellschaft. Dann z. B., wenn Bedarf nach Kinderbetreuung zu decken wäre. Wir brauchen arbeitslose Kinderbetreuer
, wird von diesen Leuteschindern vermeldet – selbstverständlich nicht, um selbige dann auch als Kinderbetreuer anzustellen. Sondern um das Kinderbetreuen vom arbeitslosen Kinderbetreuer in einer dieser neuen sozialstaatlich geschöpften Dienstleistungsformen auf Abruf und zu Spottpreisen erledigen zu lassen. Oder eben auch von einem noch halbwegs in Schuss befindlichen und zivilisiert gebliebenen Empfänger der neuen Sozialhilfe.
Der Gesichtspunkt, bei der Finanzierung von Ausgaben für ‚Soziales‘ die Arbeitgeber zu entlasten
, beflügelt auch den Reformgeist in den übrigen Abteilungen, und auch da gilt der Grundsatz, dass für die Entlastung des Kapitals von den Lohnkosten, die unter ‚brutto‘ abgebucht werden, der Lohn gerade zu stehen hat, der ‚netto‘ ausbezahlt wird. Die angepeilte Reform des Gesundheitswesens beruht gleichfalls auf dem Prinzip, den Lohn in seiner Eigenschaft als private Einkommensquelle zur Finanzierung von Leistungen und zur Sanierung der entsprechenden Kassen heranzuziehen, und zwar gleichfalls nicht nur den aktuell verdienten Lohn, sondern auch den, den einer sich zu irgendeiner Sorte von Vermögen oder ‚Altersvorsorge‘ zusammengespart hat. Die ‚Bürgerversicherung‘ heißt so, weil jeder von seinem Gesamteinkommen – das umfasst Lohn, Gehalt, Mieteinnahmen, Zinsen usw. – einen Anteil an die Kassen abzuführen hat. Die hätten dann so viel Finanzmasse zur Verfügung, dass der hälftige Anteil, der bei Arbeitgebern noch anfiele, ausreichend klein dimensioniert werden könnte, und sogar so viel, dass nichterwerbstätige Familienmitglieder nichts zu bezahlen hätten. Das ist der Opposition, die an der Regierung bei allen Reformen regelmäßig die nötige Konsequenz
vermisst, nicht konsequent genug. Wenn schon das private Einkommen der Bürger für die Entlastung der Kapitalisten von den Kosten des Sozialen sorgen soll, dann bitteschön so: mit einem Festbetrag für jeden, Kinder und Niedrigverdiener erst einmal ausgeschlossen; anstelle von deren Beitrag gibt es Staatszuschüsse
, erst einmal; denn dann gibt es gleich drei Wege, die Zuschüsse
vom Volk wieder einzukassieren; die Frage dabei ist nur noch, welche Sorte von Steuer um welche Prozentpunkte erhöht werden soll. So führt auch da der Königsweg zur Attraktivitätssteigerung des Standorts, der im Wege der Senkung des nationalen Lohnniveaus – ‚brutto‘ wie ‚netto‘ -Wachstum
schaffen soll, zielstrebig hin zu weiteren Maßnahmen der Verarmung des Volkes. Das darf – will es weiter Leistungen wie Sozialhilfe und ein Gesundheitswesen in Anspruch nehmen – erstens mit seinen Mitteln die Kostenentlastung
der Unternehmer gegenfinanzieren
. Und zweitens gehört zur Verarmung an dieser Front schon auch dazu, dass für nicht wenige einiges aus dem Angebotskatalog des Gesundheitswesens einfach unerschwinglich wird, die Gesundung also wegen Geldmangel schlicht unterbleibt. Bedauerlich, aber allein schon wegen der vordringlich zu sichernden Attraktivität des deutschen Standorts für die einheimischen Pharma-Multis unvermeidlich.
5. Politischer Klassenkampf, Abteilung 3: Kampfansage an die Gewerkschaft und flankierende Erziehungsmaßnahmen zur Beförderung der neuen Sittlichkeit im Volk
Bei all dem, was sie da so an neuen Bedingungen für eine effektivere Ausbeutung der Arbeitskraft in den kapitalistischen Alltag einführt und an Maßnahmen zur Verarmung ihres Volkes für unerlässlich hält, will des Kanzlers Mannschaft in einer unendlich guten Absicht unterwegs sein: Das alles, so heißt die Generallinie der Agitation, müsse sein zur Rettung der Arbeitsplätze
. Das ist einfach grandios. Wo in seinem Kapitalismus einfach nur die brutale Grundgleichung exekutiert wird, dass es Arbeitsplätze nur dann und von denen nur solche gibt, an denen sich die Ausbeutung rentiert, der kapitalistische Ertrag der Zweck der Arbeit ist und der Arbeitsplatz das Mittel, ihn zu realisieren, dreht die Propaganda des Kanzlers diese Gleichung einfach um und verkündet, dass das kapitalistische Ausbeuten doch nur das Mittel für den Zweck wäre, Arbeitsplätze zu sichern
. Mehr Ausbeutung und mehr Freiheiten zur Ausbeutung sollen also die Plätze schaffen
oder doch zumindest sichern
, auf denen sie vonstatten geht. Steht dieser Schwachsinn als politökonomischer Lehrsatz erst einmal fest, darf er selbstverständlich kritisch hinterfragt werden. Dass im Grundsatz auch hier der gute Zweck die Mittel heiligt, gilt bei allen Sachverständigen, die sich in die öffentliche politische Diskussion einklinken, als ausgemachte Sache. Aber ob sie denn wirklich so funktionieren, die Mittel, wie sie es sollen, daran darf – je nach Parteilichkeit – gezweifelt werden. So hebt eine wunderschöne Debatte an: Wenn die Deutschen mehr arbeiten – schafft das die Plätze, auf denen sie es tun? Jobs durch Wachstum oder Wachstum durch Jobs? Kommt Wachstum, wenn die Jobs weniger kosten? Wenn sie noch weniger kosten? Bringt Alg II endlich Schwung in den Arbeitsmarkt? ‚Aber sicher doch!‘, sagen die einen, ‚höchst fraglich‘ die anderen und ‚möglicherweise‘ oder ‚vielleicht zum Teil‘ wieder andere. Einig sind sie sich dabei in einem: Sicherheit gibt es heute nicht mehr
(Unternehmensberater R. Berger, SZ, 13.7.). Ein Patentrezept
hat keiner, das kann es nach herrschender Auffassung auch gar nicht geben, und darüber schält sich dann gleich der nächste Konsens heraus: Wenn von keinem der politischen Mittel zur Rettung von Arbeitsplätzen feststeht, ob es greift
wie erwünscht, dann kann es jedenfalls nicht verkehrt sein, mit allen zusammen das Beste für den Zweck zu tun. Und so führt die heftige Problematisierung der möglichen Wirkungen, die die einzelnen Posten von Schröders großer Agenda haben könnten oder nicht, dazu, dass die schlichtesten Effekte kapitalistischer Ausbeutung zum Rätsel werden, dessen Auflösung in vergleichenden Statistiken gesucht – und wunschgemäß gefunden wird: Die einen leiten aus den Arbeitslosenziffern Dänemarks ab, dass abgeschaffter Kündigungsschutz neue Stellen schafft, die anderen aus den niederländischen Zahlen, dass auch ein durchlöcherter für ‚die Beschäftigung‘ wenig bringt. Das und so manch andere Erfahrungen anderswo führen zur gesicherten Erkenntnis, dass es jedenfalls kein Fehler sein kann, fürs Erste einmal alles zusammen zu probieren
– und sich von nichts etwas Gewisses zu versprechen. So reicht man die Posten der ‚Agenda‘ mit dem Auftrag an deren Erfinder zurück, sie gefälligst zügig abzuarbeiten.[7]
Der Staat allerdings tut zur praktischen Umsetzung seiner Vorhaben schon längst alles Nötige, und dazu gehört für ihn, auch von der Gewerkschaft, die ja schon seit längerem in den ‚Kampf um Arbeitsplätze‘ eingestiegen ist, die bedingungslose Anerkennung seiner Gleichung zu verlangen, wonach nur mehr Ausbeutung zu mehr Arbeitsplätzen führt, die Sicherung des Lebensunterhalts nur über die Preisgabe aller materiellen Interessen und Sicherheiten zu haben ist. Damit freilich trifft der Kanzler den Lebensnerv der Gewerkschaft und aller ihrer Kämpfe. Deren praktizierte Lebenslüge ist ja gerade, Lohnarbeit ließe sich letztlich doch immer noch mit Lebensunterhalt vereinbaren, die diversen Nöte, die kapitalistische Arbeitsplätze ihren Inhabern bescheren, würden daher kämpferisches Beharren auf erträglichen Arbeitsbedingungen erfordern und rechtfertigen. Diesbezüglich ergeht von der Bundesregierung ein schlichtes Verbot: Solchen gewerkschaftlichen Vorstellungen für einen ‚arbeitsplatzsichernden‘ Umgang mit Arbeitslohn und Arbeitszeit entzieht sie jeden Respekt.
- Dies tut sie praktisch erstens dort, wo sie es als gewerkschaftlicher Verhandlungspartner und öffentlicher Arbeitgeber mit Verdi & Co. zu tun bekommt. Da wird von Regierungen von Bund, Ländern und Gemeinden nicht verhandelt, sondern da werden die Fakten geschaffen, die sie haben wollen, und die entsprechenden Arbeitszeitverlängerungen auf dem Gesetzesweg verfügt. Das ist die feststehende Vorgabe für die Verhandlungen für den Rest des öffentlichen Dienstes, und wenn Verdi-Chef Bsirske weiterhin meint, sich quer legen zu müssen, gliedern die öffentlichen Arbeitgeber ihre Dienste eben in private Gesellschaften aus, die nicht dem öffentlichen Tarifrecht unterliegen:
Experten sind sich sicher: Entweder passen sich die öffentlichen Verträge über kurz oder lang den privaten an, oder Verdi wird nur noch über wenige Vereinbarungen zu verhandeln haben.
(Spiegel, Nr. 28/04) - Zweitens tut sie dies öffentlichkeitswirksam in eigens zu diesem Zweck einberufenen und entsprechend inszenierten
Kanzlerrunden
, in denen auf höchster Ebene zwischen den Regierungsparteien und Gewerkschaften einoffener Dialog
unterhalten wird. Dessen Quintessenz besteht in der bündigen Antwort, die der Kanzler allen gewerkschaftlichen Kritiken an seinem Kurs – arbeitspolitischgescheitert
(Bsirske),Kotau vor den Wirtschaftsverbänden
(Sommer),Hausaufgaben
nicht gemacht (Peters) – erteilt und die dann genauso bündig in den Zeitungen steht:Kanzler lehnt Kurswechsel bei Reformen ab
,wir wackeln nicht.
Selbstverständlich bleiben er und die Regierungsparteien dabei weiterhingesprächsbereit
, nämlich gerne dazu bereit, vorgebrachte Einwände und Bedenken der Gewerkschaft einfach für nicht befassungswürdig zu erklären:Ein Teil der Gewerkschaftsführung hat sich auf die absurde These verlegt, besser grundsätzlich nein zu sagen, als sich mit der Sache, also mit dem Inhalt der unverzichtbaren Reformen, zu befassen.
(SPD-Vize Beck, lt. FAZ, 28.6.) Die Sache, also der Inhalt der Reformen ist, dass sie unverzichtbar sind, und wer das nicht begreift und sich anders mit ihnen befasst, ist absurd. Sauschlau. - Und schließlich drittens praktisch und öffentlichkeitswirksam zusammen. Dass er sich mit seiner Agenda einfach nicht mehr an irgendwelchen Vorstellungen in Sachen ‚sozialer Gerechtigkeit‘ messen lassen will, diese selbst vielmehr sich ausschließlich an dem zu bemessen hat, was die unverzichtbaren Reformen praktisch ins Werk setzen, demonstriert der Kanzler mit einem Durchmarsch im Gesetzgebungsverfahren. Damit wird erst einmal juristisch bekräftigt, was ohnehin feststeht, nämlich dass Zweifel an der Regierungslinie, Bedenken gegen ihre sozialen Folgekosten und sonstige Einwände einfach unbeachtlich sind: Sie gelten nichts, weil eben jetzt gilt, was im Gesetz steht. Damit aber hat auch das sittliche Empfinden im Volk einen neuen Fixpunkt seiner Orientierung. Mit dem Recht und den Fakten, die seine Anwendung schafft, sind auch die neuen und für alle verbindlichen Maßstäbe der Beurteilung dessen in der Welt, was in der als normal zu gelten hat, gerecht ist und moralisch in Ordnung geht. Was früher manche als skandalös empfunden hätten und vielleicht einige noch immer empfinden, das ist dann, wenn die höchste Instanz von Moral und sittlichem Rechtsempfinden es von Rechts wegen zur Normalität erklärt, eben kein Skandal mehr – sondern einfach nur ein neuer gesellschaftlicher Sachverhalt, an den man sich zu gewöhnen hat wie an alles andere auch.
Selbstverständlich wird das Volk bei seiner sittlichen Erziehung in einer Demokratie wie der deutschen auch von allen anderen einschlägigen Bildungseinrichtungen nicht allein gelassen. Wie goldrichtig der Kampf gegen überlebte gewerkschaftliche Vorstellungen in Sachen ‚soziale Gerechtigkeit‘ und gegen den Standpunkt überhaupt ist, die fällige Renovierung des Standorts hätte noch auf irgendein partikulares Interesse seiner arbeitenden Insassen Rücksicht zu nehmen, erfährt die Menschheit auch noch überdeutlich von der Opposition, die es im Land gibt. Lediglich mangelnde Konsequenz in diesem Kampf wäre Schröder vorzuhalten, und angesichts der Palette an wüsten Vorstellungen und Modellen
, die dann zu einer konsequenten Fortführung des nur halbherzig
angegangenen Regierungskurses eingereicht werden, wollen sogar einige altgediente christdemokratische Haudegen an der sozialen Front ihre eigene Partei nicht mehr wieder erkennen. Außerdem kommt Publizistischer Sachverstand in Talk-Runden und Druckwerken ausgiebig zu Wort – und darf sich richtig schön auskotzen: Endlich handelt
da mal wer und sorgt bei dem mit 35-Stunden-Woche und überflüssigem sozialem Schmarren verwöhnten Pack für den Verzicht
und die empfindlichen Einschnitte
, über die Deutschland vorankommt. Ein Skandal, was da im Land an Urlaubszeit unproduktiv vergeudet wird; 50 Stunden pro Woche regelmäßig könnten es doch auch sein; nein, nicht unbedingt, besser immer nur genau so viel Mehrarbeit, wie gebraucht wird, die aber garantiert, usw. – lauter Zeugnisse, wie perfekt die unbestrittene Macht des herrschenden Interesses auch die Moral der Klassengesellschaft regiert. Im Rest der Öffentlichkeit wird gleichfalls nichts beschönigt. Man nimmt die sozialen Auswirkungen der Reformen zur Kenntnis und sagt, wie es ist: So geht es zu, das ist die Realität im Standort. Ganz besonders drastische Nebenwirkungen spießt man gerne auf, damit das Publikum auch über etwas skandalös
anmutende Auswüchse
– Alg II zwingt arbeitslosen Ingenieur zum Umzug in Plattenbau, Kinder haften für in Not geratene Eltern – die neuen Realitäten des Normalfalls anerkennt. Manchmal redet man auch über gar keinen speziellen Inhalt von irgendetwas, sondern findet den Aufbruch
gut, der da getan wird. Oder man findet, dass er eigentlich doch noch gar nicht so recht stattgefunden hat.
*
So wird in der bundesdeutschen Gesellschaft jedermann damit vertraut gemacht, welche Notwendigkeiten es sind, die den Reformkurs der Bundesregierung so absolut notwendig machen. Die Vertreter von Politik und Wirtschaft und mit ihnen die Choristen der öffentlichen Meinung bekennen sich in aller Offenheit zu den Grundsätzen ihres kapitalistischen Systems als Quintessenz aller demokratischen Regierungskunst. Ein ‚Allgemeinwohl‘, das über die gewaltsame Subsumtion aller Interessen unter das eine einzig maßgebliche, nämlich das an möglichst erfolgreicher privater Bereicherung von Kapitalisten zustande kommt, die gesellschaftliche Verrücktheit eines Reichtums, der unverträglich mit dem Lebensunterhalt seiner Produzenten ist: Das ist für sie generell ein fraglos hinzunehmender Sachzwang. Und dann, wenn Krise ist, Wachstum fehlt und Staat wie Kapital sich zu einer gemeinsamen Offensive in der Konkurrenz um den Reichtum der Welt zusammenschließen, ist es für sie erst recht nur ein sich von selbst verstehendes Gebot, diesem Sachzwang in gebotener Weise weiter zu dienen und ihn politisch in kapitalistisch-systemgemäßer Weise vorwärts zu treiben. Sie jedenfalls schließen zu dem, was sie sich vornehmen, Alternativen
explizit aus – und machen damit ihrem Volk eine einzige Alternative auf: Entweder mit derselben Grundsätzlichkeit auf dem eigenen materiellen Interesse gegen das System zu bestehen, mit dem es sich ersichtlich nicht verträgt; oder sich mit allem zu vertragen und weiter darauf zu setzen, als Manövriermasse der herrschenden Interessen über die Runden zu kommen – und dann aber auch die Schnauze zu halten. Doch der Protest, der sich in Deutschland gegen die Bundesregierung regt, zeigt glatt, dass es einen Mittelweg gibt – entsprechend bescheuert sieht er dann auch aus.
6. Die bundesdeutsche Protestkultur: Ohnmachtserklärungen als Prinzip gewerkschaftlicher Gegenwehr, Drohungen mit alternativen Wählerlisten und Volksaufmärsche bei ‚Montagsdemonstrationen‘
Natürlich hält die Gewerkschaft bei der Offensive von Staat und Kapital dagegen, und ihre Gegenwehr ist ein einziges Dokument des Fehlers ihres ‚Kampfes‘ und des Schadens, der mit ihm für ihre Klientel notwendig einhergeht.[8] In ihren Verhandlungen mit den Arbeitgebern setzt die Gewerkschaft deren Erpressungen den Versuch entgegen, durch Nachgiebigkeit in der Sache wenigstens die ideelle Anerkennung ihrer praktizierten Lebenslüge zu retten, die Arbeitsplätze des Kapitals wären mit existenzsichernden Arbeitsbedingungen zu vereinbaren. Nach einigem demonstrativen Hin und Her machen IG-Metall, Verdi usw. mit ihren Tarifpartnern im Wesentlichen aus, was die verlangen; als Gegenleistung für ihr Entgegenkommen können sie – wenn überhaupt – die großartige Wohltat verbuchen, dass irgendwo eine bedingte und befristete Garantie für den Erhalt von – kapitalgemäß wie verlangt optimierten – Arbeitsplätzen aufgeschrieben wird; damit hat die Gewerkschaft, wenigstens für sich selbst, ihre Unverzichtbarkeit und ihr Existenzrecht bewiesen: Wo Kapitalisten ihre Verfügungsmacht über den ‚Faktor Arbeit‘ unter Beweis stellen und demonstrieren, dass und wie der eine Variable ihrer Kostenrechnung ist, ist es der Gewerkschaft wieder einmal gelungen, diese Rechengröße als für die Arbeiter brauchbar hinzurechnen. Dass dieser Kampf um Arbeitsplätze
, den die Gewerkschafter führen, regelmäßig derart lächerliche Verlaufsformen annimmt und so unglaublich trostlose Ergebnisse zum Resultat hat, liegt allerdings nicht daran, dass sie ihn irgendwie doch nicht oder nicht entschlossen genug führen würden. Das liegt in dem Inhalt dieses Kampfes begründet und darin, dass der eine einzige Paradoxie ist: Wer für einen Arbeitsplatz kämpft, setzt erstens der kapitalistischen Erpressung überhaupt nichts entgegen. Wo ihm die Gegenseite praktisch aufmacht, was alles sie an verschlechterten Arbeitsbedingungen und Einbußen an seinem Lebensunterhalt zur Wahrung ihres Interesses vorsieht, führt er als Hauptinhalt seines Interesses und als sein einziges Kampfmittel nichts als die eigene Abhängigkeit von einem positiven Ausgang der unternehmerischen Kalkulation ins Feld. Weil die eben kein Mittel im Kampf, sondern dessen Gegenteil, die Erklärung eigener Ohnmacht ist, besteht der gewerkschaftliche Kampf deswegen zweitens darin, laut mit roten Trillerpfeifen zu protestieren, eineinhalb Mal schichtweise die Arbeit niederzulegen – und dann freiwillig anzubieten, was die Arbeitgeber alles an Maßnahmen zur Verbesserung ihrer Erträge wollen: Zu Lasten des Arbeiters umgestaltet, lässt er sich doch glatt retten, der Arbeitsplatz. Für all das, was im Zuge seiner Umgestaltung fällig ist, ist die Gewerkschaft dann in ganz spezieller Hinsicht ‚unentbehrlich‘. Die Freiheiten der unternehmerischen Kalkulation in eine tarifrechtliche Verhandlungsmaterie zu übersetzen, mit der Gegenseite auszumachen, wen genau welche Schäden in welchem Maße treffen, das Ganze dann rechtsförmlich verbindlich zu machen und so das Interesse an effektiverer Ausbeutung als „Tarif-Vereinbarung“ gesamtgesellschaftlich zu sanktionieren: Dafür braucht es die Gewerkschaft unbedingt. Drittens legen die Gewerkschaften so mit nichts Einspruch ein gegen auch nur irgendein Konkurrenzmanöver der Arbeitgeber. Was immer die bei der Durchkalkulierung der Rentabilität ihrer Arbeitsplätze an produktivitätsfördernden ‚Leistungsprofilen‘ der Arbeit und in Bezug auf die Dauer ihrer Verausgabung aushecken: Gegen nichts von alledem richtet sich der ‚Kampf um den Arbeitsplatz‘. Der zielt einfach nur darauf, dass sein noch tätiger Inhaber auch bitteschön weiterhin in den produktiven Diensten praktische Anerkennung erfahren soll, die er für die Rentabilitätsrechnung des Unternehmens verrichtet – dass er von seinen brav verrichteten Diensten weniger hat als vorher, nimmt er dafür nicht gerne, praktisch aber eben grundsätzlich und von vorneherein in Kauf. Viertens schließlich landet dieser Kampf mit Notwendigkeit bei der Groteske, dass sich die Betroffenen auf ihre Weise dann auch selbst der Standort-Konkurrenz anschließen, für die ihre Arbeitgeber sie antanzen lassen. Wenn die mit Abwanderung drohen, dann geht der Kampf der Belegschaft um deutsche Arbeitsplätze – statt welche anderswo –; dann kämpfen württembergische Proleten für die Schinderei in Sindelfingen – statt in Bremen, und auch in der Frage der Entlohnung kommt die gewerkschaftliche Solidarität im Standort Deutschland entsprechend in Fahrt: Wer an Arbeitsplätzen tut, was er soll, bei denen am Ende Autos der Marke ‚Premium‘ vom Band rollen, ist selber Spitze. Der hat ein ganz spezielles Anrecht auf Berücksichtigung und entsprechende Premium-Löhne
. Wer ‚Lupos‘ baut, ist selbst dran schuld und kriegt in seinen Lupo-Löhnen
die gerechte Quittung. So gibt es dank der deutschen Gewerkschaft im Standort neben der Hierarchie beim Lohn auch noch eine bei der Arschlöchrigkeit seiner Empfänger.
*
Der Regierung treten die Gewerkschaften erst mit großen Protesten und heftigen verbalen Anklagen entgegen. Mancher ihrer Spitzenfunktionäre riskiert dabei sogar, dass sein persönliches Verhältnis zum Duz-Freund
Kanzler Schaden nimmt. Wenn dann klar ist, dass sie mit ihren abweichenden Meinungen bei der Regierung auf Granit beißen, kehrt Realismus ein. Den Gesprächsfaden
, den man ihnen hinhält, will auch Verdi-Chef Bsirske, dieser unglaubliche Scharfmacher
, auf keinen Fall abreißen lassen; und Themen, über die man in vertrauter Runde gut reden kann, hat man ja auch im Angebot: Über die Einkommensgestaltung im unteren Bereich
, über Minijobs, Mindest- und Kombilöhne könne man mit den Vertretern von SPD und Regierung alle Mal ins Gespräch kommen, ohne dass dabei gleich böse Worte fallen müssten, und natürlich auch über die Folgen der Globalisierung
(alles FAZ, 28.6.), die ja so was von rätselhaft sind. Endgültig heruntergefahren wird die Lautstärke des Protestes, wenn dann gewerkschaftsinterner Streit darüber ausbricht, ob eine Standesvertretung der Arbeitnehmer sich überhaupt so bzw. überhaupt noch als Gegenmacht zur Regierung profilieren soll. Unangenehme Umfragen unter den eigenen Mitgliedern, die von einem Konfrontationskurs
gegen die Bundesregierung nichts halten; vernehmlich vermeldete Beschwerden von Betriebsräten, die schon längst eingesehen haben, dass die konstruktive Mitarbeit an den von den Unternehmern angesagten Erfordernissen zur kapitalistischen Effektivierung der Arbeitsplätze der einzig senkrechte Weg ihrer Rettung ist; und dann noch Wortmeldungen ranghoher Funktionäre, wonach die Gewerkschaften Gefahr liefen, ihre Gestaltungsmöglichkeiten und ihre Glaubwürdigkeit noch mehr zu verlieren
(IG-BCE-Vorsitzender Schmoldt, lt. FAZ, 29.6.): Das sind die Nachrichten aus der deutschen Welt der Arbeit, die dann doch mehr Eindruck auf die Gewerkschaftsführung machen als die Politik des Kanzlers. Zur Rettung der Möglichkeit von ‚Gestaltung‘ ist daher wieder sehr viel Kooperation
angesagt, und die deutschen Gewerkschaften präsentieren sich nach kurzer Entgleisung wieder als das, was sie sind, als demokratische Standesorganisation der Armen, die das Recht respektiert und Niederlagen konstruktiv hinzunehmen weiß. Nur konsequent daher, wenn derselbe Schmoldt die Rückzugsgefechte von Peters und Co. – sie bekräftigen
immer wieder mal ihre Kritik am Kurs der Regierung
– mit dem Bemerken quittiert, die Herren hätten wohl einen falsch verstandenen Gerechtigkeitsbegriff
(FAZ, 7.8.). Gerecht ist nämlich nicht nur alles, was die Herrschaft von Kapital und Staat in ihrem funktionellen Zusammenwirken dem Volk an Verelendung auferlegt. Zur Gerechtigkeit gehört alle Mal auch die sittliche Pflicht, den Respekt vor der Menschenwürde auch der Armen zu wahren, und die wird durch jede noch so windelweiche Form von Mitleid mit den Schwachen
nur erniedrigt. Vielmehr gehört es sich, die Kreaturen der staatlichen Elendsschöpfung erstens ausdrücklich wissen und zweitens ganz allein damit fertig werden zu lassen, dass sie wirklich nur wegen ihrer kapitalistischen Überflüssigkeit in der Klassengesellschaft sozialer Abfall sind, ihnen drittens aber auch den Weg zu weisen, dies erhobenen Hauptes sein zu können: Wollen wir wirklich Langzeitarbeitslose auf Dauer alimentieren und ihnen damit ihre Überflüssigkeit demonstrieren? Welche Demütigung muten wir den Menschen zu, um uns das gute Gewissen mit Transfers zu erkaufen. Wäre es nicht gerechter, ihnen den Zugang zum Arbeitsmarkt zu erleichtern?
(Ebd.) Wer nichts verdient, soll auch nichts essen: Das ist der sittliche Grundsatz, der dem Menschen seine Würde schenkt und dem mitmenschlichen Gewissen seine Güte. Leute einfach so durchzufüttern, weil sie sonst nichts haben? Was für ein Unrecht tut man ihnen damit an! Das vermittelt ihnen doch überhaupt erst den Eindruck, zu nichts mehr zu gebrauchen und auf Dauer überflüssig zu sein! Langzeitarbeitslos sind sie doch nur, weil ihnen so lange Zeit mit Alimenten der Zugang zu dem Markt zugeschüttet wurde, auf dem sie das Gegenteil ihrer Nichtsnutzigkeit demonstrieren können – nur sozial gerecht also, sie von all diesen demütigenden Hilfszahlungen zu entlasten und in Freiheit endlich zur Entfaltung ihrer Potenzen kommen zu lassen!
*
Was in Deutschland an Widerspruchsgeist sonst noch übrig ist, macht sich daran, sich zum ‚politischen Kampf‘ zu organisieren, zu einem absolut systemkonformen allerdings, nämlich zu einem demokratischen Kampf um Wählerstimmen. Das Verelendungsprogramm, das die Schröder-SPD mit ihrer Agenda durchsetzt, kontern frustrierte Anhänger der Regierungspartei, Gewerkschafter und andere mit alternativen Modellen von ‚Sozialpolitik‘.[9] Eisern halten sie daran fest, dass am Grund des Elends nichts, bei dessen politischer Betreuung auch im Jahr 2004 aber durchaus einiges besser zu machen wäre, und zwar ungefähr genau das und genau so, was bzw. wie es den Armen und Notleidenden im Kapitalismus vom politischen Ethos der Sozialdemokratie schon immer versprochen wurde: Immer darum bemüht, von Staats wegen insbesondere die ‚sozial Schwachen‘ vor den Härten des Kapitalismus zu schützen; im Rahmen des Möglichen freilich schon, und auch nur, solange es wirklich nötig ist; jedenfalls immer so, dass besagte Härten ‚leider nicht zu vermeiden‘ waren… Dass dieses Ethos nach wie vor zu praktizieren ginge, stellen sie mit alternativen Haushaltsrechnungen unter Beweis, die eindrucksvoll zeigen, dass so viel Elend doch gar nicht sein müsste – haben dabei aber überhaupt nicht vor, sich mit irgendeinem der herrschenden Interessen auseinander zu setzen oder gar anzulegen, die im Haushalt, wie ihn die Regierung beschließt, ihren Ausdruck finden. Mit dem kapitalistischen Grund und der staatlichen Logik der Volksverelendung befassen sie sich gar nicht erst. Umso mehr liegt ihnen daran, keine „Sektierer“ zu sein und bloß nicht mit einer PDS in Zusammenhang gebracht zu werden. Derart ‚profiliert‘ reden sie dann davon, beim Volk auf Stimmenfang zu gehen und die Wählerstimmen abzuholen, die Schröders SPD mit ihrem Kurs sich verscherzt hat: Das ist die Furcht erregende Drohung dieser ‚linken‘ Parteigründungs-Bürgerinitiative – für den Fall, dass der Kanzler seine Politik des Sozialabbaus
weiter so strikt verfolgt wie bisher.
Dennoch: Links von der SPD
Wähler ködern zu wollen – das gilt hierzulande schon als ultimative Radikalisierung eines Protests gegen die Regierung. Die professionellen Hüter der demokratischen Diskussionskultur fragen sich allen Ernstes besorgt, ob der Kanzler dieser unglaublichen Erpressung
wird widerstehen können, und atmen dann wieder auf, wenn er dem Protest in gebotener Weise Bescheid erteilt. Wer mit seiner abweichenden Meinung das moderne Erscheinungsbild einer Regierungspartei stört, die sich Großes für die Nation vorgenommen hat; wer die funktionierende Arbeitsteilung zwischen einem Kanzler mit seiner Entschlossenheit
auf der einen, einer Partei, die seinen Kurs geschlossen mitträgt
, auf der anderen Seite durcheinander zu bringen droht – der fliegt einfach raus. Und weil bei dieser ‚Initiative‘ zur Bewahrung des bewährten sozialdemokratischen Parteiprofils auch Gewerkschafter dabei sind, nimmt die Regierung den DGB in die politische Pflicht – mit Erfolg. Im Regierungslager wird mit Unmut vermerkt, dass ranghohe Funktionäre
den Linksabweichlern
gegenüber bislang kein deutliches Wort der Distanzierung
hätten vernehmen lassen, und prompt ergeht an die Adresse der umtriebigen Initiativler der Ukas, wonach im Namen gewerkschaftlicher Überparteilichkeit solcherlei SPD-schädlichen parteilichen Umtriebe zu ächten sind.
*
Während im Westen frustrierte Funktionäre sich zu Betreuern des Jammers heimatlos gewordener Wähler aufwerfen und nach dem Motto ‚Erst die Organisation, das Programm findet sich dann schon!‘ Sammelstellen für enttäuschte SPDler und empörte Gewerkschaftler einrichten, tragen im Osten der Republik tatsächlich verbitterte Bürger fast von allein ihren Protest auf die Straße. Der richtet sich dagegen, dass der Staat ihnen jede Chance schuldig bleibt, sich mit Lohnarbeit ihren Unterhalt zu verdienen, und ihnen nun auch noch, als wären sie selber an ihrer Lage schuld, den Lohnersatz wegnimmt. Nachdrücklich bekennen sie, dass sie nichts lieber wollen als anständige Lohnarbeiter werden; sie halten ihr 50stes Bewerbungsschreiben für einen Arbeitsplatz hoch, den es nicht gibt, nur um zu zeigen, dass sie wirklich jedes Opfer auf sich zu nehmen bereit sind; sogar für Hartz IV bekunden sie Verständnis unter der einzigen einschränkenden Bedingung, dass man ihnen irgendeine wie auch immer bezahlte Arbeitsstelle als Alternative dazu bieten müsste: Lohnarbeit ohne das notwendig dazugehörige rechtsförmig organisierte Elend, das wäre ihnen recht. Mit diesem Standpunkt wissen sie sich in Einklang mit dem nationalen Gemeinwohl im Allgemeinen und mit der dienenden Rolle im Besonderen, die ihnen darin zukommt; und zwar so vollkommen, dass sie jeden Verdacht eines bloß partikularen, parteilichen – womöglich, Gott bewahre, sozialistischen – Interesses gleich in der Parole von sich weisen, unter der sie sich versammeln und unter der sie vor eineinhalb Jahrzehnten gegen die antikapitalistische und anti-gesamtdeutsche Parteiherrschaft der SED aufbegehrt haben: Das Volk sind wir!
Nach wie vor will dieses Volk nichts anderes als gut regiert werden; nämlich so, wie es sich das von den imperialistischen Nutznießern des „Umbruchs“, den es mit seinen Montagsdemonstrationen seinerzeit so erfolgreich begleitet hat, fälschlicherweise versprochen hat.
Von seinen Adressaten wird dieser Protest sehr ungnädig aufgenommen. Für die Bezugnahme auf die Anti-SED-Demonstrationen von einst haben deutsche Demokraten überhaupt kein Verständnis. Da stößt das Recht zu protestieren zwar nicht gleich an seine ordnungspolizeilichen, aber sofort an seine moralischen Grenzen: Wer so protestiert, der kann den Ehrentitel „Volk“ jedenfalls nicht für sich in Anspruch nehmen; der ist nicht als Fußvolk des gemeinen nationalen Wohls unterwegs, sondern läuft Gefahr, von extremistischen Parteien missbraucht zu werden. Damit das nicht passiert, die wahlberechtigten Bürger sich vielmehr von den dazu befugten Parteien richtig gebrauchen lassen, wird dem Volk, so weit es eben doch zu seinen „Wut-Demos“ unterwegs ist, großzügig ein Recht auf Betroffenheit und insoweit auch auf Gejammer zugestanden. Recht hat es mit seinem Protest deswegen noch lange nicht; Betroffenheit ist kein Einwand gegen das, wovon die Leute betroffen sind. Immerhin, diese Klarstellung verspricht die Regierung ihren tendenziell abtrünnigen Wählern besser als bisher nahe zu bringen: Vermittlungsschwächen gibt sie zu, stellt dem demonstrierenden Wahlvolk damit ein wenig schmeichelhaftes Attest über seine Begriffsstutzigkeit aus und tut so schon einiges für den guten Eindruck, dass ihre Politik viel besser ist als der schlechte Eindruck, den sie mit ihrer Politik auf deren Opfer bisher gemacht hat. Andere Alternativen, Änderungen in der Sache womöglich kommen jedenfalls nicht in Frage: Unser Kurs ist richtig, wir lassen uns da überhaupt nicht aus dem Ruder bringen
(Müntefering) – schon gar nicht durch irregeleitete ostdeutsche Demonstranten. Denn Schröder ist gewählt; und der kann
, wie er selbst sagt, ohnehin keine andere Politik
.
7. Die Sanierung des deutschen Standorts – ein imperialistisches Aufbruchsprogramm
Mit der Intransigenz, mit der der Kanzler jede Bedenklichkeit gegen seinen Reformkurs
vom Tisch wischt, will er nicht nur beim Wähler
den Eindruck einer eisernen Führernatur machen, die sich aber auch gar keine Aufweichung
von dem gefallen lässt, was sie sich vorgenommen hat. Er unterstreicht mit seinem Imponiergehabe, worum es geht – ihm und der Nation, die er so regiert. Der Umbau der deutschen Klassengesellschaft, den er so demonstrativ entschlossen anpackt, ist eben kein Rettungsprogramm überforderter Sozialkassen, auch nicht ein bloßes Notprogramm zur Bewältigung der Krise, das mit dem Wiederanspringen der Konjunktur
vorbei wäre. Des Kanzlers Reformprogramm ist darauf angelegt, Deutschlands Position in der Konkurrenz der Nationen überhaupt und auf Dauer zu stärken und vor allem viel stärker als bisher zur Geltung zu bringen: Der unbedingte Wille, in der Staatenwelt von heute mehr zu gelten und mehr zu bewirken – und nicht eine zu überwindende Wachstumsschwäche
oder sonst irgendein banales Defizit in einer Kasse –, diktiert das Maß der angestrengten Stärkung der Nation und der Härte bei ihrer sozialen Erneuerung. Deshalb gehört auch zu dem Kampfprogramm im Innern eines nach außen, bei dem die Konkurrenz um Kapital, um Wachstumskräfte
aus dem Weltgeschäft, zusammengeht mit dem Ringen um wirksame Betätigung deutscher Macht und ihre respektvolle Anerkennung: Eines ist Mittel fürs andere, letzter Zweck aber ist die beanspruchte Autonomie in einer Welt, in der Schröders Deutschland nach eigenem Ermessen noch immer eine viel zu geringe Rolle spielt.
In Europa, Deutschlands großem Projekt, endlich über die wirtschaftlichen und strategischen Machtmittel zu verfügen, mit denen man einer Weltmacht Amerika wirksam entgegentreten kann, naturgemäß zuallererst. Da lässt man von Berlin aus die Kommission in Brüssel wissen, dass es auch für die nächsten Jahre bei der Auslegung
des Stabilitätspakts
zu bleiben hat, wonach Verstöße gegen ausgemachte Sorgfaltspflichten beim Umgang mit Geld selbstverständlich nach wie vor zu beanstanden sind, deutsche Defizite im Haushalt und Grenzüberschreitungen bei der Neuverschuldung aber in keinem Fall die Konsequenzen nach sich ziehen dürfen, die der ‚Pakt‘ dafür vorsieht. Das in der EU institutionalisierte Aufsichtsregime über die Haushalts- und Finanzpolitik der Nationen gleich ganz wegzuschmeißen, zieht man selbstverständlich gar nicht erst in Erwägung: Als Mittel der Kontrolle anderer Nationen war es von deutscher Seite gedacht und konzipiert, und in dieser Funktion ist und bleibt der ‚Pakt‘ für den Rest der Unionsmitglieder verbindlich. Woran das Wirtschaften im größten Binnenmarkt der Welt
vordringlich Maß zu nehmen hat, ist gleichfalls keine Frage. Die in Brüssel residierende Behörde jedenfalls treibt nach deutschem Geschmack wahlweise zu wenig oder eine zu schlechte Industriepolitik, in jedem Fall keine, mit der sich die Sonderinteressen des deutschen Kapitalstandorts gut bedient wissen könnten. Da erlässt die Kommission für die Konkurrenz zwischen den Nationen Auflagen
, die deutsches Kapital behindern
, Kapitalisten aus den Nachbarländern dafür eindeutig bevorzugen, meckert an staatlichen Subventionen herum, die für den deutschen Industriestandort und seine Konkurrenztüchtigkeit einfach unverzichtbar sind, hält sich aber bei Rettungsplänen
, die Nachbar Frankreich für einen in Not geratenen Kraftwerkskonzern finanziert, mit einem Verbot dieser eindeutigen Wettbewerbsverzerrung
unerklärlich lange zurück. Da muss dann von deutscher Seite im Interesse eines unverzerrten Wettbewerbs, der in diesem Fall dem deutschen Multi Siemens sehr von Vorteil wäre, wieder der Gegendruck
auf die EU-Kommission ausgeübt werden, der den massiven Druck der französischen Regierung
(FAZ, 21.5.) auf dieselbe Kommission bricht. Dabei bräuchte es diesen Aufwand im Grunde gar nicht erst. Dann nämlich, wenn europäische Industriepolitik endlich ‚aus einem Guss‘ gemacht wird, von einem deutschen ‚Superkommissar‘ für Wirtschaft zum Beispiel, der in der Kommission dann einfach das Konkurrenzinteresse Deutschlands für den gesamten Standort Europa als zu beachtende Konkurrenzregel verbindlich macht. Die bemerkenswerte Geradlinigkeit, mit der die Regierung in Berlin da klarstellt, dass und wie der europäische Wirtschaftsraum sich als Mittel zur Mehrung exklusiv deutscher Wirtschaftsmacht zu bewähren hat, bringt es mit sich, dass auch im wirtschafts- und sonstigen diplomatischen Verkehr mit dem Allianz-Partner
Frankreich der Abstimmungsbedarf wächst. In Bezug auf die Sonderfreiheiten, die sich die beiden Nation im Umgang mit ihren Staatsfinanzen wechselseitig genehmigen und dann gegenüber der EU-Kommission gemeinsam herausnehmen, steht die Allianz. Daneben aber zieht sich der französische Partner mit seinem Wirtschafts-Nationalismus ein ums andere Mal mehr den Verdacht zu, sich trotz offener Grenzen und freien Handels unliebsame Konkurrenz aus dem europäischen Ausland vom Leibe zu halten
. Auch wenn es in dem vom ‚Spiegel‘ kolportierten Fall nur um drei lächerliche Gummiboote einer deutschen Traditionsfirma
geht: Der Fall steht fürs Prinzip, nämlich für den widerrechtlichen Protektionismus
, den der Partner Frankreich dann betreibt, wenn er auf die Geschäfte in seinem Standort achtet und darüber deutsche Kapitalisten zu wenig auf ihre Rechnung kommen.
Vorhaltungen von deutscher Seite müssen sich auch die neuen EU-Mitglieder im Osten gefallen lassen. Als Billiglohn- und Niedrigsteuerländer werden sie zwar als Expansionssphäre deutschen Kapitals geschätzt und genutzt, zugleich aber auch wegen ihrer billigen Löhne und niedrigen Steuern als illegitime Standort-Konkurrenten angegangen. Dass diese Länder sich ihr Armutsniveau nicht bestellt haben, ihnen tatsächlich das Kapital, das sie für ihre ‚nationale Entwicklung‘ wollen, fehlt, weil das bereits tätige EU-Kapital Land und Leute nicht flächendeckend entwickelt
, sondern hart sortiert: Das ignoriert man in Berlin einfach. Stattdessen wird jeder Versuch dieser Länder, ganz systemkonform gegenzusteuern und Kapital zu attrahieren, als Lohn-
bzw. Steuer-Dumping
denunziert und mit der Drohung gekontert, einem Land, das sich Mittel der eigenen Infrastruktur nicht selbst und ‚aus eigener Kraft‘ verschafft, auch keine über den EU-Haushalt zu spendieren. So bekommen die neuen Mitglieder von der europäischen Vormacht den Status mitgeteilt, der für sie in der Union allenfalls vorgesehen ist. Politische Souveräne mögen sie ja sein; dass sie sich zur Stärkung deutscher Wirtschaftsmacht zur Verfügung stellen, geht gleichfalls in Ordnung; aber dass sie aus beidem für sich ein Recht ableiten wollen, kommt nicht in Frage. Für Deutschland sind diese Staaten dazu ausersehen, Europas Besitzstand in politisch-strategischer Hinsicht zu mehren; und für wen sie da Verfügungsmasse sind und wessen ‚Führungsrolle‘ sie sich entsprechend unterzuordnen haben, wird ihnen auf diesem Wege mitgeteilt. Dass zu den Adressaten dieser Mitteilung auch die Staaten rechnen, die sich aufgrund der Perspektiven des eigenen nationalen Fortkommens und ihrer entsprechenden Berechnungen lieber der US-Koalition der Willigen
als dem imperialistischen Ehrgeiz von Deutschen und Franzosen unterwerfen, unterstreicht genau diese Stoßrichtung der deutschen Außenpolitik in und mit Europa.
Gleichzeitig wirbt der deutsche Außenminister überall, wo er sich potentiell mitentscheidenden Zuspruch erhofft – Indien, Pakistan, … – für eine deutsche Dauerpräsenz im UN-Sicherheitsrat, und macht so auf dem Feld der Diplomatie die Perspektive klar: Deutschland will mehr Weltmacht. Ob der interne Umbau des Landes in jedem Punkt dafür zweckmäßig ist, kann dahingestellt bleiben. Der Zweck steht auf alle Fälle fest: Das Land konkurrenztüchtiger machen, um in der Konkurrenz um imperialistische Machtentfaltung zu gewinnen!
[1] Ausgerechnet dieser Effekt, dass dem Unternehmen zu geringeren Lohnstückkosten mehr zu verkaufendes Wertprodukt gehört, wird gern als „Verteilungsspielraum“ interpretiert; vor allem von den Gewerkschaften, die in der BRD traditionell mit wie auch immer ausgerechneten Produktivitätsgewinnen ihre Lohnforderungen rechtfertigen. Dabei zeugt ihre Forderung selbst davon, dass der Zuwachs allein dem Kapital gehört und dass diesem jeder Anteil am wachsenden materiellen Reichtum der Gesellschaft erst abgerungen werden muss. Die Begründung zeugt außerdem von großer Bescheidenheit, bekundet nämlich die Bereitschaft der Arbeiter, sich im Ringen um Teilhabe am geschaffenen Güterberg auf Anteile am zusätzlichen Überschuss zu beschränken, der aus ihnen herausgewirtschaftet worden ist; dabei werden sogar noch die Ex-Kollegen außer Acht gelassen, die im Zuge des ‚Arbeit sparenden Fortschritts‘ gleich selber eingespart worden sind. Insofern liegt der ‚Spiegel‘ also durchaus richtig, wenn er den Glauben, im Kapitalismus ließe sich die Steigerung der Produktion durch immer perfektere technische Mittel mit mehr Wohlstand und Freizeit für die arbeitenden Massen vereinbaren, als Illusion ‚entlarvt‘ – auch wenn seine Begründung, die sich mit dem schlichten Verweis auf die tatsächlichen negativen Effekte des technischen Fortschritts begnügt, von Dummheit und zynischer Parteilichkeit zeugt. Denn so ganz selbstverständlich und über jeden kritischen Gedanken erhaben ist es ja nicht, dass nach den ehernen Regeln der kapitalistischen Geldwirtschaft die Einsparung von Arbeitsmühe durch technische Errungenschaften sich nicht in mehr Freizeit und Bequemlichkeit für alle, stattdessen als Verelendung innerhalb der Klasse der Lohnabhängigen auswirkt. Der Grund liegt in dem ökonomischen Zweck, den die Privateigentümer der Produktionsmittel mit dem Einsatz zunehmend wirkungskräftiger Herstellungstechniken verfolgen: Sie reduzieren zielstrebig die Lohnkosten pro Produkt – lassen sich diesen Effekt auch durchaus größere Investitionssummen kosten –, um mit abgesenkten Gesamtproduktionskosten pro Ware Konkurrenten unterbieten und vom Markt verdrängen zu können und gleichwohl mehr zu verdienen. Die Steigerung des Output der angewandten Arbeit dient deren vergrößerter Rentabilität sogar bei gleichzeitiger Absenkung der Verkaufspreise. Dieses Kriterium verknüpft unauflöslich gesteigerte Produktivität mit gesteigerter Armut der benötigten Arbeitskräfte – von den nicht mehr benötigten ganz zu schweigen –: Im Verhältnis zum geschaffenen Wert und mit jeder Entlassung auch absolut wird die Geldsumme verkürzt, von der die Lohnabhängigen ihren Lebensunterhalt bestreiten müssen. Der gesamte „Verteilungsspielraum“ gehört dem Kapital und dient dessen beschleunigter Akkumulation – Überakkumulation inklusive, von der im Folgenden noch die Rede sein muss.
[2] In der freien Marktwirtschaft gilt das Absurdeste als normal; deswegen dasselbe noch einmal so: Den Wirkungsgrad der Arbeit steigern, die Verausgabung menschlicher Arbeitskraft, die für die Herstellung nützlicher Güter notwendig ist, immer weiter reduzieren, in vielen Bereichen auf die bloße Einrichtung und Kontrolle automatisierter Produktionsprozesse – das hat im Kapitalismus denselben Zweck und Effekt wie: die Arbeitskräfte schlechter bezahlen und länger arbeiten lassen. Das sagt alles über diese Produktionsweise (die Langfassung ist in der Marx’schen ‚Arbeitswertlehre‘ enthalten). Und dass deren Akteure das „irgendwie“ völlig normal finden, sagt mehr über deren falsches Bewusstsein als alle Pisa-Studien.
[3] Dieser periodisch auftretende Effekt wird nicht dadurch weniger absurd, dass sich die in der kapitalistischen Produktionsweise eingehauste Menschheit unter Titeln wie ‚Rezession‘ oder ‚Konjunkturflaute‘ sogar daran gewöhnt hat und nichts weiter dabei findet. Immerhin ist das „Phänomen“ eines periodisch auftretenden Übermaßes an Reichtum die denkbar drastischste praktische Demonstration der Tatsache, dass es in dieser Ökonomie jedenfalls nicht um vernünftige Arbeitsteilung und die ökonomische Selbstversorgung der Gesellschaft geht, dass im Gegenteil der herrschende Zweck in Widerspruch steht zu der Benutzung des materiellen Reichtums als Mittel eines allgemeinen Wohlstands.
[4] Umgekehrt – dies allerdings mehr eine Peinlichkeit als eine Ironie der Geschichte der Arbeiterbewegung – verfallen leibhaftige Arbeitnehmervertreter, die Betriebsräte der zwei mit Abwicklung und Transfer der Produktion nach Ungarn bedrohten Siemens-Werke in NRW in dem Fall, auf die komplementäre Idee, das Rationalisierungspotential
, das in der Handy-Produktion am deutschen Standort noch steckt, auf eigene Faust durchkalkulieren zu lassen: Dessen Ausschöpfung könnte den Konzern vielleicht doch noch davon überzeugen, dass er weder längere Arbeitszeiten noch billigere Löhne und schon gleich nicht einen Ortswechsel nach Ungarn braucht. Ausgerechnet die Opfer der betrieblichen Rechnungsführung lassen sich als Kostenbestandteile durchkalkulieren und meinen, mit einem überzeugenden Plädoyer für die eine, ihrer Auffassung nach effektivere
Methode ihrer eigenen Ausbeutung von den Nachteilen der anderen verschont zu bleiben. Blöd nur, dass die Sachverständigen von der Fa. Ernst & Young zwar durchaus nicht vor der neuen Erfahrung zurückschrecken, für ihre eher nicht so arbeiterfreundlichen Dienste einmal von der Gewerkschaft bezahlt zu werden, dann aber doch nicht mit dem passenden Gutachten aufwarten: Am Ertrag der Ausbeutung von Billigstarbeitern gemessen, die im Auftrag von Siemens in Ungarn schon jetzt Handys im Akkord zusammenlöten, lohnt sich die Alternative einfach nicht, mit mehr Investitionen zur ‚Modernisierung‘ der Arbeitsabläufe die Lohnkost zu senken, die für die Produktion hierzulande in Rechnung zu stellen ist. Immerhin, jetzt hat es die Siemens-Belegschaft exakt ausgerechnet schwarz auf weiß, dass sie einfach zu teuer ist.
[5] Das ist ein einziger Hohn auf die Ideologie der „Leistungsgerechtigkeit“ und aller dummen Sprüche, dass sich in Deutschland „Leistung wieder mehr lohnen“ soll – aber eben auch eine Klarstellung über deren wahre Bedeutung: Leistungsgerecht ist stets genau der Lohn, den der Unternehmer für das bezahlt, was er von der Leistung hat.
[6] Ausgesprochen politisch ist die Ökonomie des Kapitals also nicht nur dort, wo es darum geht, angesichts eines Angebotsüberhangs von Arbeitskräften im Vergleich zur nachgefragten Menge den gerechten Lohn zu ermitteln. Sie ist es auch bei der Produktion des massenhaften Elends, das zum Kapitalismus gehört und dessen Herkommen in folgendem ökonomischen Gesetz seinen Grund hat: „Je größer der gesellschaftliche Reichtum, das funktionierende Kapital, Umfang und Energie seines Wachstums, also auch die absolute Größe des Proletariats und die Produktivkraft seiner Arbeit, desto größer die industrielle Reservearmee. … Je größer aber diese Reservearmee im Verhältnis zur aktiven Arbeiterarmee, desto massenhafter die konsolidierte Überbevölkerung, deren Elend im umgekehrten Verhältnis zu ihrer Arbeitsqual steht. Je größer endlich die Lazarusschichte der Arbeiterklasse und die industrielle Reservearmee, desto größer der offizielle Pauperismus. Dies ist das absolute, allgemeine Gesetz der kapitalistischen Akkumulation.“ (Karl Marx, Das Kapital, Bd. I, MEW 23, S.673f.) Auch da will die Armut gerecht verteilt sein, und verwirklicht wird dieses Gesetz durch die politische Gewalt, die zusammen mit dem Wachstum des Reichtums der Gesellschaft auch das Wachstum der Armut seiner Produzenten unter ihrer Aufsicht hat: Sie schreibt mit der Macht ihrer sozialen und sonstigen Gesetzgebung das jeweilige Elendsniveau der Schichten und Abteilungen der überflüssigen Bevölkerung fest und definiert damit höchst offiziell den Pauperismus in der bürgerlichen Gesellschaft.
[7] Bedenken gegen das Rezept, mit mehr Armut mehr Wachstum zu schaffen, gibt es auch: Die „Kaufkraft“ der Arbeiter würde auf diese Weise allzu sehr beschnitten. Gemeint ist mit dem ‚Argument‘ freilich nicht die proletarische Notlage, mit weniger Geld durchs Leben kommen zu müssen. Auch nicht gemeint mit ihm ist MEW 25, S. 254, wo bei Marx etwas von einem „Gesetz für die kapitalistische Produktion“ steht, die Konsumtionskraft der Gesellschaft auf ein Minimum zu reduzieren. Vielmehr steht das ‚Argument‘ in einer Reihe mit dem Gejammer über die lahmende
Binnen-Nachfrage in Deutschland, die doch so dringend einen Impuls
bräuchte, und gerade der bliebe noch länger aus, wenn die Lohneinkommen derart reduziert würden. Das ist zwar, so rein kaufkraftmäßig betrachtet, verkehrt, denn das Geld, das die Proleten nicht kriegen und daher nicht ausgeben können, wird deswegen ja nicht nicht verdient und ausgegeben; nur eben von ihnen nicht; sie werden vermehrt vom geschaffenen Reichtum ausgeschlossen, an dem sich ihre Arbeitgeber vermehrt bereichern. Aber die Vertreter dieses ‚Arguments‘ wollen mit ihm wohl auch nur den Hinweis auf eine volkswirtschaftlich höchst angenehme Eigenschaft der proletarischen Kaufkultur losgebracht haben: Proleten leben doch tatsächlich von dem Geld, das sie verdienen! Sie horten es nicht, sondern geben es viel umstandsloser aus als andere und haben praktisch keine Sparquote
in ihrem Portefeuille – das macht ihre Kaufkraft so interessant, als Massenkaufkraft
schon gleich! Dass ausgerechnet diese Klientel deswegen dazu auserkoren wäre, den Markt von ‚Phaetons‘ und anderen Premium-Waren leer zu räumen, will man deswegen zwar nicht gleich behauptet haben. Aber wer in einer kapitalistischen Volkswirtschaft für wen da zu sein hat, die Wirtschaft fürs Volk oder das Volk für die Wirtschaft: Das lässt sich auch so mal wieder eindeutig beantworten.
[8] Zu den seiner Logik ganz entsprechenden historischen Etappen und Verlaufsformen dieses Kampfes vgl. den Artikel in GegenStandpunkt 2-93, S.26: „‚Der Kampf um Arbeitsplätze‘ – das logische Ende eines Gewerkschaftsschlagers“
[9] Siehe dazu ausführlich den Artikel in GegenStandpunkt 2-04, S.121: „Eine neu aufgelegte Sozialdemokratie – das hat gerade noch gefehlt“.