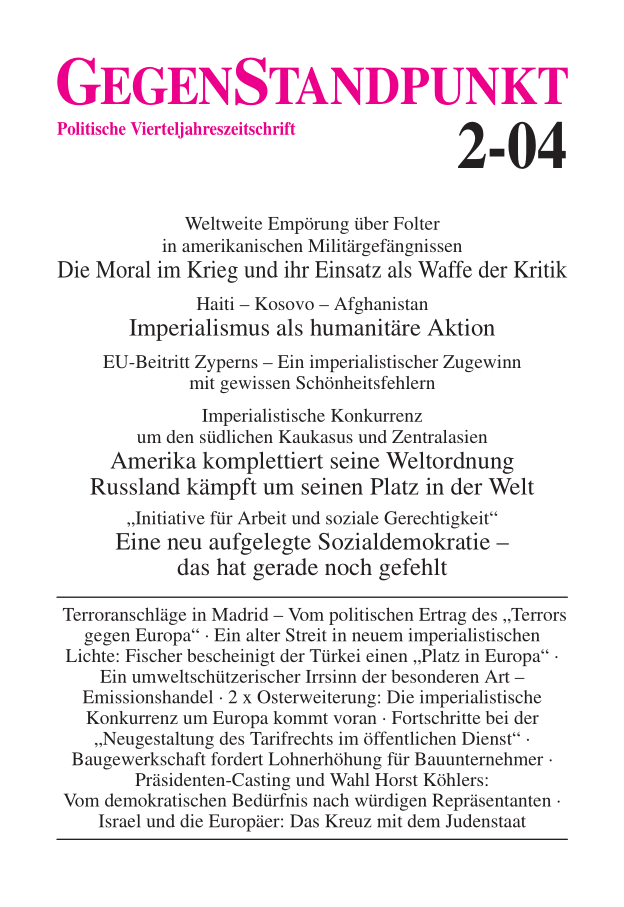„Initiative für Arbeit und soziale Gerechtigkeit“
Eine neu aufgelegte Sozialdemokratie – das hat gerade noch gefehlt
Einige unzufriedene SPDler und Gewerkschaftler haben sich im März 2004 zu einer „Initiative für Arbeit und soziale Gerechtigkeit“ zusammengeschlossen. Der Reformagenda des Kanzlers Schröder machen die Abweichler den Vorwurf, ihre gute alte SPD mit ihren „Grundsätzen“, ihren „Wahlversprechen“ und ihrer Manier, „als eine Alternative“ zu „erscheinen“, wäre darin nicht mehr wiederzuerkennen.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Gliederung
- 1. Kritik im Namen gemeinsamer Tradition – die Mär vom Verrat regierender Sozialdemokraten an ihren eigenen Grundsätzen
- 2. Die Aufklärung über das gültige SPD-Staatsprogramm: Eine theoretische Entgleisung!
- 3. Die vorgestellte Alternative: Ganz einfach besser regieren!
- 4. Das schlagendste Argument alternativ-sozialdemokratischen Wirkens: Das Wählervertrauen erhalten!
- 5. Die ‚Initiative‘ gegen die ‚Schröder-SPD‘: Der ewige sozialdemokratische ‚Kampf zweier Linien‘ in zeitgemäßem Gewand
„Initiative für Arbeit und soziale Gerechtigkeit“
Eine neu aufgelegte Sozialdemokratie – das hat gerade noch gefehlt
Die Bundesregierung verordnet dem deutschen Volk harte Zeiten. Sie tut dies mit dem besten Gewissen, für das Wohl der deutschen Nation, die ökonomisch auf Vordermann gebracht sein will, um ihren Erfolgsweg als europäische Führungsmacht fortzusetzen. Die SPD als maßgebliche Regierungspartei hat deshalb schon vor einiger Zeit beschlossen, nicht nur den Sozialstaat gründlich zu ‚reformieren‘, sondern ihr altes Image als Partei, die mit sozialen Reformen für gesellschaftlichen Ausgleich und mehr Gerechtigkeit sorgt, gleich mit wegzuwerfen. Sie will nicht mehr beim Wahlvolk mit Sprüchen auf Stimmenfang gehen, die diesem ein ganz irriges Bild der Maßnahmen vermitteln könnten, die die Regierung für sie auf dem Programm hat. Hart und schonungslos wird dem Volk nun mitgeteilt, dass es sich sein ‚Besitzstandsdenken‘ abzuschminken und sich auf bescheidenere Lebensumstände einzustellen hat, wenn es mit Deutschland wieder aufwärts gehen soll. Dass es gerade die sozialdemokratische Partei ist, die dieses durchgreifende soziale Abrissprojekt in Angriff nimmt, soll nach dem Willen der SPD-Führungsriege nur noch eines beweisen: Wie absolut notwendig und unumgänglich die Volksverarmung ist, die sie ihrer Klientel verpasst. Dafür wollen Schröder und Co. nun gewählt werden: dass sie als Partei, der das Los der Minderbemittelten ganz besonders am Herzen liegt, genau wissen, was sie diesen zumuten, und deshalb als Regierungspartei das allergrößte Vertrauen der Wähler verdienen.
Diese Logik leuchtet nicht allen Parteimitgliedern ein, zumal sie auch dem Wähler nur bedingt einzuleuchten scheint. So jedenfalls interpretiert die SPD-Führung selbst die jüngsten Wahlergebnisse. Sie will sich aber durch das Wählervotum in ihrem aufopferungsvollen Kampf um deutsches Wachstum und deutsche Macht nicht beirren lassen. Der murrenden Basis kommt sie mit dem Geschenk eines neuen Vorsitzenden entgegen; der verspricht, haargenau dasselbe Programm zu vertreten wie Schröder, aber mit einer volksnäheren Ausstrahlung und insofern mehr Glaubwürdigkeit.
Dieses Manöver besänftigt die innerparteiliche Kritik jedoch nur teilweise und manche Parteigenossen überhaupt nicht. Einige von diesen Unzufriedenen haben sich im März dieses Jahres zu einer „Initiative für Arbeit und soziale Gerechtigkeit“ zusammengeschlossen. Eines der Gründungsmitglieder begründet diesen Schritt so:
„Es geht jetzt erst einmal darum, möglichst viele vom Sozialabbau der Bundesregierung frustrierte Menschen nicht nur in der SPD zu sammeln, um Druck auf die Koalition auszuüben. Dann wird man die Reaktion der SPD abwarten. Sollte sich unsere Partei jedoch nicht bewegen und die Agenda 2010 einstampfen, rückt eine Partei der Enttäuschten näher. Diese Option halten wir uns ausdrücklich offen.“ (SZ, 20.3.)
1. Kritik im Namen gemeinsamer Tradition – die Mär vom Verrat regierender Sozialdemokraten an ihren eigenen Grundsätzen
In ihrem Gründungsaufruf gehen die Initiativler mit ihrer Partei hart ins Gericht:
„Die SPD hat sich von ihren Grundsätzen verabschiedet. Entgegen ihren Wahlversprechen von 1998 und 2002, die sie als eine Alternative zur neoliberalen Politik der Vorgängerregierungen erschienen ließen, hat sie sich zur Hauptakteurin des Sozialabbaus und der Umverteilung von unten nach oben entwickelt. Niemand von uns hätte erwartet, dass eine Partei mit so großer sozialer Tradition in so kurzer Zeit zum Kanzlerwahlverein mutiert, dessen aktuelle Politikziele nahezu alles negieren, wofür die Partei in über hundert Jahren stand.“ (Zitate aus: ‚Aufruf der Initiative Arbeit & soziale Gerechtigkeit‘)
Das geäußerte Erstaunen über die ‚plötzliche Mutation‘ der SPD ist selber einigermaßen erstaunlich. Dafür, dass die SPD „zum Kanzlerwahlverein mutiert“, braucht es bei dieser Partei mit ihrer „großen Tradition“ im Regieren wie Opponieren nämlich nur eins: Sie muss den Kanzler stellen. Dann geht alles in denkbar „kurzer Zeit“. Die Führung tut, wonach es sie schon immer drängt: Sie stellt ihre Regierungsfähigkeit praktisch unter Beweis. Das Wort fasst erschöpfend zusammen, worum es da geht: Was die Regierung einer kapitalistisch marktwirtschaftenden, weltpolitisch ambitionierten Nation zu tun hat, steht in den Grundzügen sowieso und unter den jeweils ‚gegebenen Umständen‘ auch ziemlich detailliert ohnehin fest; Sache demokratischer, auch sozialdemokratischer Wahlsieger ist es, sich – ungeachtet dessen, was sie vielleicht sonst noch an „Grundsätzen“ und „Wahlversprechen“ in ihr Parteiprogramm hineingeschrieben haben – diesem Aufgabenkatalog gewachsen zu zeigen, für jeden Posten eine respektable Besetzung bereit zu halten und die fällige ‚Agenda‘ abzuarbeiten. Was die Partei mit der „so großen sozialen Tradition“ von anderen demokratischen Wettbewerbern – solchen insbesondere, die sich ‚bürgerlich‘ nennen – allenfalls unterscheidet, ist der Umstand, dass sie sich nach jedem errungenen Wahlsieg – speziell dann, wenn sie vorher lange in der Opposition war – stets von neuem genötigt sieht, ihre Regierungsfähigkeit zu beweisen, so als wäre die ihr eigentlich nicht zuzutrauen. Das liegt, wie jeder weiß, an dem Eindruck, den die Sozialdemokratie traditionell erweckt und auch pflegt: Sie hätte der Staatsräson ihres Gemeinwesens Wunder was für eine ‚soziale Dimension‘ immer erst noch hinzuzufügen, die ihm sonst zu seinem eigenen Schaden abgehen würde; und sie würde die ‚kleinen Leute‘ mit den gesellschaftlichen Verhältnissen und den Belangen der Nation auf eine Weise versöhnen, wie es jene anderen Parteien nie und nimmer hinkriegen würden, die von vornherein gar nichts anderes versprechen als so zu regieren, wie es sich gehört, und dass sie es
am besten könnten. Sozialdemokraten wollen dasselbe es
noch viel besser können, weil sie anders als andere dabei immer noch ein besonderes Gespür für die Nöte und Bedürfnisse des ‚einfachen Volkes‘ hätten. Letzteres brauchen sie dann, wenn sie glücklich regieren dürfen, nicht mehr unter Beweis zu stellen; wohl aber, dass ihre spezielle ‚soziale Ausrichtung‘ ganz sicher kein unsachgemäßes Abweichen von den Anforderungen an eine erfolgreiche nationale Standortverwaltung bedeutet und jeder diesbezügliche Verdacht ihrer Konkurrenten und Gegner völlig daneben liegt.
Um in dem Gesamtkunstwerk des modernen Sozialstaats auf Elemente zu stoßen, die die SPD – sei es als Regierungspartei, sei es als konstruktive ‚starke Opposition‘ – als unverwechselbaren Eigenbeitrag zum einschlägigen Aufgabenkatalog hinzugefügt hat, muss man daher schon ziemlich weit zurück und ins Detail gehen. Das schmälert freilich nicht die enormen Verdienste, die deutsche Sozialdemokraten sich in den „über 100 Jahren“ seit Bismarck – vom Kampf um eine einwandfreie Finanzierung des 1. Weltkriegs über die Niederschlagung der Arbeiteraufstände nach dessen Ende bis zur Verankerung des ‚Modells Deutschland‘ im atomkriegsbereiten westlichen Bündnis – um Deutschland und um die Vereinnahmung der lohnarbeitenden Massen für die Sache der Nation erworben haben. Mit eben diesen Verdiensten verbietet sich aber jede Verwunderung über Schröders ‚Agenda 2010‘-Politik und erst recht die Behauptung, damit würde „nahezu alles negiert, wofür die Partei“ zeit ihres Lebens „stand“. Empfehlenswert wäre stattdessen eine ehrliche Befassung mit den „Grundsätzen“, von denen die SPD sich angeblich „verabschiedet“ hat.
Unerschütterlich eingestanden ist die Partei nämlich immer für das gemeine Wohl der deutschen Nation, in dem das Bedürfnis des Kapitals und des Staates, der fürs Kapital unbedingt attraktiv sein und immer attraktiver werden will, nach einer optimal funktionierenden Arbeiterklasse zusammenfällt mit dem sachzwanghaft aufgenötigten Bedürfnis der lohnabhängigen Bevölkerungsmehrheit nach einer Gelegenheit, sich für fremden Reichtum nützlich zu machen und mit dem dabei Verdienten über die Runden zu kommen. Ihre erste und grundsätzlichste Sorge ist seit jeher, dass es mit der kapitalistischen Geschäftemacherei auf deutschem Heimatboden flott und erfolgreich vorangeht, weil davon ‚irgendwie‘ alles abhängt, nicht zuletzt die ‚kleinen Leute‘, die ohne die andern, die in der gesellschaftlichen Hierarchie „oben“ stehen, bekanntlich aufgeschmissen sind. Nichts ist Sozialdemokraten selbstverständlicher als die Unterordnung der arbeitenden Menschheit unter ihre kapitaldienliche und staatsnützliche Funktion, die Abhängigkeit ihres Lebensunterhalts vom Wachstum des kapitalistischen Eigentums, die systematische Kombination also von bedingungsloser Dienstbarkeit mit relativer Armut der ‚kleinen Leute‘. In den glorreichen Aufbauzeiten des modernen Sozialstaats, als noch das Überleben des Proletariats auf dem Spiel stand, haben sie mit eben diesem Standpunkt dem Klassenstaat die Einsicht in die Notwendigkeit abgerungen, mit sozialversicherungspolitischen Eingriffen in die Verwendung des national gezahlten Arbeitsentgelts ein lebenslanges Auskommen mit dem Lohneinkommen überhaupt möglich zu machen. In anderen Phasen der kapitalistischen Erfolgsgeschichte der Nation hat eine SPD-Regierung z.B. den Bedarf weltmarktbeherrschender Unternehmen an einer größeren Menge gut ausgebildeter Arbeitskraft erkannt und im Namen des seinerzeit so getauften ‚human capital‘ bedient; dies auch wieder unter Beachtung der allein systemgemäßen Prioritäten, nämlich der Abhängigkeit des mit einer Bildungsreform beglückten gesellschaftlichen Nachwuchses von den gebieterischen Erfordernissen eines weltrekordmäßigen nationalen Kapitalwachstums.
An diesem Standpunkt, für den die SPD in solchen Episoden ihrer hundertjährigen Erfolgsgeschichte unverwüstlich „stand“, ändert sich überhaupt nichts, wenn die Schröder-Regierung sich nun den sozialpolitischen Aufgaben widmet, die sie, wieder ganz traditionsgemäß im Interesse des nationalen Kapitalstandorts und seines weltweiten Konkurrenzerfolgs, aus den neuesten Fortschritten des kapitalistischen Wachstums und seinen Krisen ableitet. Wenn z.B. die Zahl der lohnend einsetzbaren tarifentlohnten Arbeitskräfte in nationalem Maßstab stärker schrumpft als die Lebenserwartung der Rentner, die nach der sinnreichen Logik der Rentenkasse von einem Bruchteil der aktuell ausgezahlten nationalen Gesamtlohnsumme mit durchgezogen werden müssen, so dass der Sozialversicherung absehbarerweise die Mittel ausgehen; oder wenn der Anteil der Unnützen und Ausrangierten an der Gesamtzahl der Lohnabhängigen dauerhaft den Prozentsatz übersteigt, den der Sozialstaat in besseren Zeiten noch locker aus den Abgaben vom Arbeitsentgelt für die Arbeitslosenkasse miternähren lassen konnte, dann wissen sozialdemokratische Politiker, was sie im Sinne ihrer Parteitradition zu tun haben. Sie stellen sich solchen Konsequenzen des Konkurrenzkampfs der kapitalistischen Nationen und nehmen die Herausforderung an, die Attraktivität ihres Standorts für noch mehr und wieder deutlich erfolgreichere kapitalistische Geschäftemacherei gründlich aufzumöbeln. Die Versöhnung des Proletariats mit den „Sachzwängen“ des Kapitals und des Staatshaushalts, für die sie als Sozialdemokraten nach wie vor einstehen, sieht unter derartigen Bedingungen und bei einer so klaren politischen Zielsetzung konsequenterweise so aus, dass der sozialstaatlich organisierte Lebensstandard der Arbeitnehmer und vor allem der nutzlosen Kostgänger des nationalen Reichtums so lange nach unten korrigiert wird, bis er sich mit der Bedingung, von der die Lohnabhängigen – und nicht nur sie, sondern noch weit wichtigere Dinge, die weltpolitische Macht der Nation z.B. – abhängen, wieder verträgt. Von ihren hundertjährigen „Politikzielen“ macht die SPD mit diesem konsequenten Fortschritt keine Abstriche.
Unter ihrem Vorsitzenden Schröder tut die Partei allerdings noch einen Schritt mehr. Sie distanziert sich von einer ideologischen Manier, von der man freilich zugeben muss, dass sie der Partei sehr lieb und, obwohl nie in irgendwelche systemwidrige Taten umgesetzt, auch einige berechnende Pflege wert war: Immer wollte sie so verstanden werden, dass es unter ihrer Führung darum ginge, den vielen ‚sozial Schwachen‘, den lohnabhängigen Arbeitnehmern in jeder ihrer wackligen Lebenslagen zu dem Ihren, nämlich zu ihrem guten Recht zu verhelfen. Auch wo sie praktisch auf der Unvereinbarkeit kapitalistischen Wirtschaftens mit den Lebensbedürfnissen der entsprechend bewirtschafteten Arbeitskräfte bestand, hielt sie theoretisch an dem Gegenteil fest und behauptete unverdrossen, beides, kapitalistisches Wachstum und proletarischer Wohlstand, würde unter ihrer Leitung im Prinzip ganz wunderbar zusammenpassen, allenfalls leider im Moment gerade nicht so ganz; und unter solchen dummen Ausnahmen, die sie eigentlich gar nicht will, die ihre Regierungsfähigkeit ihr aber abverlangt, würden die Partei selbst und vor allem ihre Verantwortlichen ganz furchtbar leiden, viel mehr jedenfalls als diejenigen, die davon bloß betroffen sind. Diesen Schwindel mag der SPD-Kanzler nicht länger vor sich her tragen. Von der Heuchelei, eigentlich wären ausgerechnet die ‚sozial Schwachen‘ unter seiner Regentschaft gut aufgehoben, lägen ihm jedenfalls vor allen anderen am Herzen, und seine Partei wäre die angestammte Heimat aller arm, aber redlich gebliebenen Leute, hat der Mann die Nase voll. Gerade als Sozialdemokrat will er nicht immerzu der Häuptling und auch nicht mehr die falsche Hoffnung aller Underdogs der Gesellschaft sein, sondern schlicht der Macher, der das Regieren am besten kann; und wenn Regieren nach seiner verbindlichen Erkenntnis schon darin besteht, den Lohnabhängigen ihr Leben schwer zu machen, weil es nur noch auf deutlich abgesenktem Niveau mit dem gemeinen Wohl der Nation zu vereinbaren ist, dann soll die SPD als maßgebliche Regierungspartei sich auch gefälligst ohne blöde Entschuldigungen, sondern offensiv zur Härte gegen die kapitalistisch gerechnet viel zu teuren Massen bekennen und als entschiedener Sachwalter der Unvereinbarkeit des Allgemeinwohls mit den bisher gewohnten Lohn- und Lebensverhältnissen auftreten. Um aufkommende Unzufriedenheit mundtot zu machen, langt demnach für Sozial- wie für alle regierenden Demokraten das Arbeitsplatz-‚Argument‘, und es taugt dazu auch viel besser; zumal eine Regierung es in der Hand hat, mit der Ausgestaltung der Arbeitslosigkeit, der immer drohenden Alternative zu einem wie auch immer definierten und entlohnten ‚Arbeitsplatz‘, praktisch für die nötige Überzeugungskraft dieses ‚Arguments‘ zu sorgen. Die Wirksamkeit dieser Überzeugungsarbeit kann nur leiden, wenn die Regierungspartei andauernd mit einem parteiamtlichen „Leider“ daherkommt und die Lage dementiert, die sie den Leuten einbrockt. Wenn die Sozialpolitiker es nur richtig anstellen, dann ist die Chance, bei abgesenktem Lebensstandard und vermehrtem Arbeitseinsatz irgendeine Arbeit zu kriegen, ganz zweifelsfrei allemal mehr wert als jedes Stück sozialstaatlicher Betreuung und Versorgung, das unter Beschwörung dieser Chance gestrichen wird; und dann bleibt den Betroffenen auch gar nicht viel anderes übrig, als die Sache auch so zu sehen. ‚Sozial ist, was Arbeit schafft!‘ – darin ist sich der SPD-Kanzler mit dem Genossen Stoiber von der CSU völlig einig; etwas anderes soll seine Partei nicht mehr behaupten oder versprechen.
In der Sache ist diese Gleichung, wie gesagt, sowieso nichts Neues, sondern die Quintessenz aller sozialdemokratischen Tradition: Wenn schon die Ausbeutung der Lohnarbeit keine Ausbeutung ist, sondern – sobald die SPD an der Macht ist – ein prachtvolles Lebensmittel für Lohnarbeiter, dann hat der Lohnabhängige sich von seinem SPD-regierten Gemeinwesen auch nicht mehr und nichts Besseres zu erwarten als einen Platz, an dem er sich ausbeuten lassen kann. Dann ist alles, was die Ausbeute aus seiner Benutzung vergrößert, in seinem ureigenen Interesse, auch wenn sein Lebensstandard dabei auf den Hund kommt. Dann sind Beschränkungen, welche die Regierung seinem Einkommen verordnet, um ‚die Wirtschaft‘ zu entlasten, und eine „Umverteilung von unten nach oben“ eine Wohltat für ihn, und zwar die größte und vor allem die einzig zweckmäßige, die eine fürsorgliche Regierung ihm erweisen kann. Das hat die Schröder-SPD zu ihrer Botschaft gemacht; sie will nicht mehr „als eine Alternative“ zu der Politik erscheinen
, die sie in aller sozialdemokratischen Prinzipientreue macht.
Dieser Parteilinie und der Reformagenda des Kanzlers machen die Abweichler den Vorwurf, ihre gute alte SPD mit ihren „Grundsätzen“, ihren „Wahlversprechen“ und ihrer Manier, „als eine Alternative“ zu „erscheinen“, wäre darin nicht mehr wiederzuerkennen. Mit diesem Vorwurf bekennen sie sich erst einmal als Nostalgiker, denen eine liebe Gewohnheit abhanden kommt, eine ‚gute Tradition‘ eben, nach deren guten Gründen man bekanntlich nicht fragt, sondern der man als einem Wert an und für sich fraglos ‚treu‘ bleibt.
2. Die Aufklärung über das gültige SPD-Staatsprogramm: Eine theoretische Entgleisung!
Aber die Kritiker wollen natürlich nicht bloß auf Traditionspflege in der Selbstdarstellung ihres Vereins hinaus. Sie finden es verwerflich, was die Führung ihrer Partei sozialpolitisch treibt, und werfen die Frage auf, warum die das eigentlich macht. Die Antwort, auf die sie verfallen, ist insofern interessant, als darin von einem (welt)wirtschaftspolitischen Zweck, den die Bundesregierung mit ihrer Verelendungspolitik verfolgt, von den aktuellen Politikzielen
, die sie im Auge hat – Stärkung des kapitalistischen Wachstums, der globalen Konkurrenzfähigkeit, der Standort-Qualitäten ihrer deutscher Nation –, gar nicht die Rede ist. Stattdessen entdecken die Kritiker als Beweggrund ihrer Parteioberen eine Ideologie und beschweren sich erbittert über die modern klingenden Worthülsen, mit denen die ihre Politik als alternativ rechtfertigen, so als hätten diese ungewohnten Sprachregelungen noch viel mehr als die damit gerechtfertigte Politik selbst ihr sozialdemokratisches Geschmacksempfinden verletzt. Darin steckt aber der sachliche Einwand, und auf den wollen sie natürlich auch hinaus, dass ihres Erachtens in Wirklichkeit das alles gar nicht nötig ist, was die Schröder-Mannschaft an sozialen Brutalitäten durchzieht: weder so alternativlos noch so zweckmäßig, wie die es verstanden haben will. Nach Ansicht der kritischen Initiative liegt da ein Fall von falscher Lagebeurteilung vor, die sie folgendermaßen geißelt:
„Die Grundlage für die reformpolitische Aktivität und beschäftigungspolitische Inaktivität (der SPD) ist ihr geradezu missionarisches Verständnis von gesellschaftlicher ‚Modernisierung‘ als Staatsaufgabe. Der Blick der Parteigranden auf die Gesellschaft (entdeckt) Verkrustungen, Reformstaus, regulative Entwicklungsbarrieren und gesellschaftliche Dinosaurier, so weit das Auge reicht. Aus dieser neoliberalen Sicht stagniert die Beschäftigung, weil die Arbeitslosen durch zu hohe soziale Unterstützung zu unflexibel geworden seien… Zu hohe Gewinnsteuern würden den Unternehmern das Investieren verleiden… ‚Zukunftsfähig‘ ist eine Gesellschaft im Zeitalter der Globalisierung und der schärferen internationalen Konkurrenz nach dieser Logik nur, wenn die diese ‚Entwicklungsblockaden‘ überwindet und ‚Reformstaus‘ auflöst.“
Statt der vergangenen sozialen Ausrichtung, die der SPD nach Meinung der Kritiker eigentlich anstünde, herrscht eine verhängnisvolle Blindheit und Desorientierung – nein, nicht der Partei, sondern erst einmal bloß ihrer Oberen: Das ist die ganze Erklärung für den inkriminierten Wandel der SPD. Was aber, wenn es gar nicht bloß um ein falsches Verständnis
, sondern um ein national geteiltes und befördertes kapitaldienliches Interesse geht, weil so und nicht anders das allseits erstrebte ‚nationale Wachstum‘, das Wachsen privater Geldvermehrung, vorangebracht wird?! Was, wenn gar nicht „die Beschäftigung stagniert“, sondern wenn es um rentable, fürs Kapital lohnende „Beschäftigung“ geht und von der zu wenig stattfindet, weil sich die Kosten nicht genügend rentieren?! Was, wenn die Besichtigung des nationalen Lohnniveaus als ‚beschäftigungshinderlicher Kostenfaktor‘ also nicht eine grundlose, einseitige und partikulare Auffassung, sondern der in seiner ganzen Einseitigkeit passende, allgemeingültige Standpunkt ist, weil die privaten Veranstalter der kapitalistischen Wachstumsfortschritte die Einsparung von Lohnkosten konsequent als Hebel ihrer Bewährung in der Konkurrenz handhaben und ihre öffentlichen Förderer diese Bewährung durch die gesamtnationale Senkung dieses Kostenfaktors unterstützen?! Offensichtlich undenkbar! Die Frage, ob nicht der Standpunkt der ‚Granden‘ irgendwie in den Prinzipien der staatlichen Bewirtschaftung eines kapitalistischen Standorts begründet ist, mögen sich die linken Parteikritiker einfach nicht stellen. Das alles ist für sie die Ausgeburt einer theoretischen Verbohrtheit, zu der sich die falsche Führung der Partei hat hinreißen lassen, gerade so, als handelte es sich bei der rücksichtslosen sozialstaatlichen Umbauveranstaltung ohne Ende um eine geistige Verwirrung, die durch eine zu eifrige Lektüre der falschen Ökonomielehrbücher hervorgebracht worden ist –, um eine sozial verwerfliche Fehlorientierung und eine national schädliche dazu.
Ihre Opposition besteht daher zunächst einmal in dem konstruktiven Bemühen, diesen Irrtum aufzuklären und den Nachweis zu führen, dass der behauptete Gegensatz von nationalem Wachstum und Bewahrung sozialstaatlicher Errungenschaften recht betrachtet gar keiner sein müsste, im Gegenteil: Eine Politik, die sich der ‚sozialen Tradition‘ verpflichtet weiß, löst ihrem Dafürhalten nach auch die nationalen Beschäftigungs- und Wachstumsprobleme besser oder überhaupt erst, die der missionarische ‚Neoliberalismus‘ zu bewältigen vorgibt, aber in Wirklichkeit gar nicht bewältigt.[1]
3. Die vorgestellte Alternative: Ganz einfach besser regieren!
In diesem Sinne stellt der Gründungsaufruf dem Regierungsprogramm eine Liste von Alternativvorschlägen entgegen:
„Die Regierungspolitik der SPD der letzten Monate ist gekennzeichnet durch:
- Eine Arbeitsmarktpolitik, die nahezu ausschließlich den Druck auf Arbeitslose erhöht und eine Ausweitung eines Billiglohnsektors ohne soziale Qualität forciert,
statt durch massive Investitionsprogramme und die Umverteilung von Arbeit in Normalarbeitsverhältnisse eine dauerhafte aktive Beschäftigungspolitik zu betreiben,- eine Steuerpolitik mit eindeutiger sozialer Schieflage und massiver Umverteilung von unten nach oben,
statt auch die Wohlhabenden und Unternehmen an der Finanzierung des Gemeinwesens angemessen zu beteiligen und für eine hinreichende Besteuerung von großen Vermögen und Erbschaften zu sorgen,- eine Rentenreform mit der bislang massivsten Beschädigung des paritätisch finanzierten Systems der sozialen Sicherung in Deutschland,
statt einen sozial gerechten Umbau unserer Sozialsysteme einzufordern,- eine Gesundheitspolitik zu Lasten der Patienten und sozial Schwachen,
statt die Spitzenverdiener unseres Gesundheitssystems zu belasten und die bewährte paritätische Finanzierung auf solide neue, breitere Grundlagen zu stellen,- eine Bildungspolitik der Eliteförderung bei gleichzeitiger Verarmung der meisten Universitäten,
statt durch eine bessere finanzielle Ausstattung aller unserer Bildungseinrichtungen Chancengleichheit und verbesserte Bildungsmöglichkeiten zu schaffen,- das lediglich ‚taktische‘ Bekenntnis zur Tarifautonomie und der Druck auf die Gewerkschaften, ihre tarifpolitischen Errungenschaften selbst zu demontieren,
statt das Streikrecht – wie 1998 angekündigt – zu sichern und sich zur Koalitionsfreiheit zu bekennen.“
Die Leute kennen sich aus in den Aufgaben, die eine deutsche Regierung im Innern, bei der Betreuung ihres Volkes, speziell der weniger gut betuchten Mehrheit, zu erledigen hat. Kaum fangen sie das kritische Nachdenken an, steht ihnen schon, ressortmäßig aufgegliedert, der ganze Katalog sozialer Notwendigkeiten vor Augen, denen die Schröder-Mannschaft mit so schlechten Rezepten begegnet und für deren Bewältigung sie viel bessere Mittel und Wege anzubieten hätten. Ganz genauso wie den amtierenden Sozial-, Bildungs-, Wirtschafts-, Finanz- usw. -Politikern ist ihnen also geläufig, wie es der Masse ihrer Mitbürger am Kapitalstandort Deutschland geht, wie die hierzulande herrschende Marktwirtschaft dem Normalverbraucher mitspielt und wie ein durchschnittlicher Lohnempfänger dasteht: von Arbeitslosigkeit und Verelendung bedroht, steuerlich geschröpft, für eine unsichere Existenz im Alter schon jetzt sehr belastet, im Krankheitsfall, gesetzliche Kasse hin oder her, ganz leicht ziemlich aufgeschmissen, von vielen Karrierechancen schon als Schulabsolvent praktisch ausgeschlossen, auf kollektive Gegenwehr der Arbeitnehmer gegen die Unternehmenswelt angewiesen, um überhaupt zu erträglichen Bedingungen einen Lebensunterhalt verdienen zu können… Und genau wie ihren regierenden Parteigenossen ist den kritischen SPDlern völlig klar, was daraus nur folgen kann: Die Politik muss sich um das alles kümmern. Betreuung von oben ist angesagt, ein Eingreifen der hoheitlichen Ordnungsmacht, wenn prekäre Lebenslagen und Verelendungstendenzen in breitem Umfang zum gesellschaftlichen Normalzustand gehören – damit die Sache, nämlich eben dieser Normalzustand, ordentlich weiterläuft. Mit all ihrer Enttäuschung über die Regierungspolitik bringen die Schröder-Kritiker, die der Parteibasis eine Stimme verleihen wollen, es nie mal dahin, in Gedanken vom Geschäft des Regierens zurückzutreten und die Lebensverhältnisse selber, mit denen die Masse der Leute sich herumzuschlagen hat und überhaupt nicht gut fertig wird, unvoreingenommen zu beurteilen – was freilich auch unweigerlich zur Kritik daran ausarten würde und nicht zu Ideen für ihre ordentliche Regulierung. Schon vor jedem Urteil steht der Standpunkt fest, von dem aus sie die Welt begutachten: Von ihrem ersten kritischen Gedanken an haben sie den Standpunkt des Regierens drauf, den Standpunkt der Amtsgewalt, die über die Lebensverhältnisse ihrer Gesellschaft Aufsicht führt, Probleme des ordentlichen Funktionierens entdeckt resp. definiert, im Sinne eines reibungslosen Fortgangs Lösungen ersinnt und dekretiert. Sie haben noch kaum einen kritischen Einfall zu Schröders Regierungspolitik gewagt, da fühlen diese Alternativ-Politiker sich bemüßigt, die Frage zu beantworten, wie sie denn Schröders Regierungs-Agenda besser abarbeiten würden. Und damit steht bereits fest: Ihre Alternative geht mit derselben Abgebrühtheit wie das Regierungskonzept davon aus, dass ein halbes Dutzend materielle Drangsale die Existenz der großen Masse der Bevölkerung bestimmen und dass diese Ungemütlichkeiten von Dauer sind und der Politik als Betreuungsobjekte erhalten bleiben – ein wie auch immer geartetes Interesse, diese Drangsale selber einmal anzugehen und aus der Welt zu schaffen, ist nicht bloß nicht ihre Sache; so etwas haben sie immer schon ganz grundsätzlich von sich gewiesen. Sie widmen sich dem Umgang mit jeglicher gesellschaftlichen Misere; die selbst ist damit affirmiert. Ganz entsprechend sieht ihre Alternative zu Schröders ‚Agenda 2010‘ daher auch aus: Wie ihr geschmähtes Vorbild, dem sie ihr tapferes statt
entgegenschmettern, enthält ihr Gegenkonzept lauter Vorschläge zur Fortschreibung, zur konservierenden Fortentwicklung genau der Verhältnisse, die besorgten Sozialpolitikern immer so viel zu betreuen geben. Dass sie sich überhaupt erkühnen, ihrer Parteiobrigkeit mit Einwänden zu kommen, und was sie an besserer Alternative vorzuschlagen haben, ist genau auf diesem Mist gewachsen: Was diese Schröder-Gegner treibt, ist die Sorge um die Macht, die diesen ganzen Laden von oben herunter zu regulieren hat, damit er dauerhaft funktioniert.
So zeugt die polemische Gegenüberstellung von derzeit praktizierter „Arbeitsmarktpolitik“ mit ihren ausgesuchten Härten für Arbeitslose und neue Billiglöhner auf der einen, einer wünschbaren „dauerhaften aktiven Beschäftigungspolitik“ auf der anderen Seite vor allem von sehr viel Einigkeit der Kritiker mit der Regierung. Genauso wenig wie alle nicht-alternativen, als „neoliberal“ geschmähten Sozialpolitiker, nämlich überhaupt keine Beachtung schenken sie der Sache, die hierzulande so nett und harmlos „Beschäftigung“ heißt. Lohnarbeit ist für sie unbesehen gleichbedeutend mit Lebensunterhalt und deswegen ganz grundsätzlich gut und in Ordnung. Dabei ist ihnen gar nicht unbekannt, dass das, was sie „Beschäftigung“ nennen, existenzielle Abhängigkeit bedeutet; dass Leute, deren materielle Existenz auf ihrer Indienstnahme für die Vermehrung fremden Eigentums beruht, ziemlich hilflos einem machtvollen Interesse an maximaler Geldausbeute aus ihrer Arbeit ausgeliefert sind – aber das gehört für sie unter die Rubrik ‚Arbeitsrecht‘, Abteilung „Tarifautonomie“, und gilt ihnen als zur Zufriedenheit bewältigt, wenn die Staatsgewalt den Gewerkschaften die Freiheit garantiert, sich mit den Vertretern der Privatmacht des kapitalistischen Eigentums fortwährend herumzuschlagen. Egal, was für die Lohnabhängigen dabei herauskommt – nicht viel Gutes, wie den anderen Aufgabenfeldern einer sozialen Politik für die Massen zu entnehmen ist –, und erst recht egal, dass Abhängigkeit und Dienstbarkeit auf die Art bloß festgeschrieben und verewigt werden: Vom Standpunkt der übergeordneten Ordnungsmacht aus ist die Sache damit geregelt, und das ist die Hauptsache. Von diesem Ordnungsstandpunkt aus treffen die Kritiker ihre Unterscheidung zwischen heuchlerischem – dem regierungsamtlichen – und ehrlichem – dem von der SPD eigentlich versprochenen – Engagement für die Freiheit der Arbeitnehmer, für ihre Löhne nicht bloß arbeiten zu müssen, sondern auch noch streiken zu dürfen. Ganz in diesem Sinn ordnen sie dann auch die Formen sozialer Bedürftigkeit ein, die sich im Gefolge des tarifpolitischen Kräftemessens zwischen Unternehmern und Gewerkschaften einstellen und den Sozialpolitikern der Nation ihren Arbeitsplatz sichern. Die Altersarmut ausgedienter Lohnarbeiter z.B., die mittlerweile fast schon mehr als diese selbst diejenigen trifft, die in jüngeren Jahren dafür vorzusorgen haben, ist für sie eine feststehende Tatsache, von der sie ausgehen, weil es daran nichts zu deuteln und schon gar nichts zu kritisieren gibt; ihre Kritik fängt dort an, wo ein zum Gerechtigkeitskriterium aufgeblasener Verrechnungsmodus beim staatlichen Zugriff auf die gezahlten Löhne, die „paritätische Finanzierung“, angetastet wird. Dabei wollen sie sich noch nicht einmal dem Imperativ verschließen, dass die ganze Art, die härtesten Mangelerscheinungen einer proletarischen Existenz per gesetzliche Einteilung der Gesamtlohnsumme zu bewältigen, gründlich „umgebaut“ werden muss, weil diese Summe tendenziell sinkt und das Benötigte auch dann nicht mehr hergibt, wenn die Versorgungsstandards immer weiter nach unten korrigiert werden; ihrer regierenden Parteiobrigkeit wollen sie in dem Punkt nicht mehr zumuten, als dass sie mehr Gerechtigkeit beim „Umbau“ – von wem eigentlich? – einfordern
sollte. Und so weiter.
Um auf ihr erstes und Hauptanliegen, die „Beschäftigungspolitik“, zurückzukommen: Völlig selbstverständlich ist den alternativen SPDlern – auch da kein Unterschied zu allen übrigen Sozial- und Wirtschaftspolitikern, ‚Neoliberale‘ eingeschlossen –, dass in ihrem marktwirtschaftlichen System der Zwang, sich mit produktiven Leistungen fürs Geldinteresse eines Arbeitgebers einen Lebensunterhalt zu verdienen, für Menschen ohne gescheites Eigentum universell und ausnahmslos gilt, die Gelegenheit, sich auch wirklich benutzen und dafür bezahlen zu lassen, aber überhaupt nicht gesichert ist: Millionen Arbeitslose stehen ohne ausbeuterische Benutzung ihrer Arbeitskraft völlig auf dem Schlauch. Auch das nimmt man in Kreisen der Schröder-kritischen SPD-Basis genauso bedauernd und genauso affirmativ als Gegebenheit zur Kenntnis wie überall, wo Sachwalter der gesellschaftlichen Ordnung besorgt auf die Überlebensnöte größerer Bevölkerungsteile herabsehen. Dieses ‚Phänomen‘ selbst aus der Welt schaffen zu wollen, kommt ihnen gar nicht in den Sinn. Von der Not der Arbeitslosen gehen sie aus; und mit ihrer Fürsorge setzen sie da an, wo zu der Not die zynische Konsequenz hinzukommt, dass Lohnabhängige ihre eigene Ausbeutung auch noch wollen müssen: Dem Anliegen können sie nur beipflichten. Und sie wissen auch prompt, was eine sozial pflichtbewusste Regierung da tun kann und zu tun hat: Sie muss die Bedingungen für eine kapitalistisch lohnende Ausbeutung von Arbeitskräften „massiv“ verbessern. Dabei wissen sie zu unterscheiden. Dass die regierungsamtliche „Arbeitsmarktpolitik“ diese Aufgabe von der Seite der Arbeits- und Entlohnungsbedingungen her anpackt, finden deren Kritiker nicht in Ordnung. Sie kennen und empfehlen als besseren Weg zum gleichen Ziel den Kunstgriff, „massive Investitionsprogramme“ aufzulegen, also von Staats wegen ganz viel Geld in ‚die Wirtschaft‘ hineinzutun, die Unternehmer ordentlich was verdienen zu lassen, bis die gar nicht mehr umhin können, die dafür benötigten Kräfte zu behalten und womöglich sogar zusätzlich Leute einzustellen. Mehr „Beschäftigung“ können sich eben auch diese alternativen Sozialdemokraten nur als Kollateralnutzen einer schwungvollen kapitalistischen Geschäftstätigkeit vorstellen: Wenn mit Finanzmitteln vom Staat Lohnabhängigen ohne Arbeit oder auf gefährdeten Arbeitsplätzen geholfen werden soll, dann gehören diese Gelder auf keinen Fall in deren Tasche – absolut unsinnig fänden sie das; systemwidrig wäre es in der Tat! –, sondern in die Hände ihrer prospektiven Anwender. Völlig klar: Um etwas für die systemeigene Armut zu tun, muss man die Vermehrung des kapitalistischen Reichtums fördern.
Im Zusammenhang mit diesem sturzvernünftigen Projekt fällt den Alternativ-Sozis in ihrer vorgestellten Position als verantwortliche Treuhänder des Gemeinwesens natürlich ein, dass das Haushaltsgeld, das der Staat u.a. zur Stimulierung der Geschäftstätigkeit im Land locker machen soll, aber auch sonst für gute Taten benötigt, irgendwo herkommen muss; und wie das unter ihrem Kanzler geregelt ist, finden sie schon wieder ungerecht. Dabei geben sie ganz unbefangen zu Protokoll, dass sie in ihrer Gesellschaft ein eindeutiges „unten“ und „oben“ kennen, mit vielen finanzschwachen Figuren „unten“ und etlichen „Wohlhabenden“ „oben“, und geben gleich zu verstehen, dass sie daran selbstverständlich überhaupt nichts auszusetzen haben. Ihr „Gemeinwesen“, das derlei Klassenunterschiede beherbergt, finden sie im Gegenteil schwer in Ordnung und wert, dass alle seine Insassen sich an seiner „Finanzierung“ „angemessen beteiligen“, natürlich auch die ganz „unten“. Nur ist ihres Erachtens nicht in Ordnung, dass die Masse der ‚kleinen Leute‘ für die Erhaltung und die Fortschritte des Ladens, der sie zu ‚kleinen Leuten‘ macht, überproportional zur Kasse gebeten werden. Einen gerechten Anteil sollte der Fiskus doch auch bei „großen Vermögen und Erbschaften“ holen: Dann wäre auch in der Frage der Einkommensdifferenzen und der Geldquelle für die nationale Kapitalstandortverwaltung die Welt in Ordnung.
Mit ihren Bedenken gegen eine steuerpolitisch „schiefliegende“ „Umverteilung von unten nach oben“ wollen die Schröder-Kritiker natürlich nichts gegen ihren eigenen glorreichen Einfall gesagt haben, zwecks „Beschäftigungspolitik“ wären staatliche Investitionsmittel[2] dorthin zu tun, wo über den Bedarf von Arbeitskräften fürs Wachstum des kapitalistischen Reichtums entschieden wird – also schon ziemlich weit nach „oben“. Im Gegenteil, da gehört die Staatsknete hin, wenn sie je die Massen mit der schönen Berufsqualifikation ‚Arbeitskraft‘ erreichen soll. Auf den tiefen Sinn der Kanzler-Weisheit, dass Politik, und Sozialpolitik schon gleich, ‚nicht gegen die Wirtschaft‘ zu machen ist, verstehen dessen innerparteiliche Gegner sich eben auch und akzeptieren damit die Grundsatzentscheidung ihrer deutschen Staatsmacht, ‚dem Kapital‘ – oder in systemkonformerer Ausdrucksweise: dem Unternehmergeist – das Monopol auf produktive Verwendung der gesellschaftlichen Arbeitskraft einzuräumen und davon auch dann nichts zurückzunehmen, wenn der kapitalistische Geschäftsgang es mal wieder zu ansehnlichen Arbeitslosenziffern und Verelendungsraten bringt. Damit erkennen sie freilich auch an, dass der „Beschäftigungs“-Effekt, den sie sich von ihren „massiven Investitionsprogrammen“ erwarten, völlig in den bewährten Händen derjenigen liegt, die in ihren „Beschäftigten“ einen Kostenfaktor sehen, den es zu minimieren gilt. Das behauptete soziale Anliegen, „aktiv“ und „dauerhaft“ mehr Leuten einen selbstverdienten Lebensunterhalt zu sichern, kürzt sich damit als Zweck der Angelegenheit aus ihren wohlmeinenden „Investitionsprogrammen“ heraus. Die taugen als Mittel nur für den Gebrauch, den die freie kapitalistische Unternehmenswelt davon macht. Und darin kommt „Beschäftigung“ ein für allemal nicht vor; wenn schon, dann der ausbeuterische Zugriff auf Arbeitskräfte; und selbst das keineswegs bedingungslos. Ihren Konkurrenzkampf führen kapitalistische Unternehmen nämlich hauptseitig mit „massiven Investitionen“ in einen technischen Fortschritt, der auf die Einsparung von Löhnen berechnet ist, ‚Mitarbeiter‘ überflüssig macht, so dass man sich von denen kostensparend ‚trennen‘ kann; den weiter benötigten Kräften bleibt deswegen keinerlei Arbeitsmühe erspart – lauter notwendige Konsequenzen eines Wirtschaftssystems, in dem gesteigerte Arbeitsproduktivität für die, die die produktivere Arbeit zu erledigen haben, ebenso wie für diejenigen, die jetzt entsprechend viel Freizeit haben, kein Glück, sondern ein Pech ist. Daran ändert sich auch dadurch nichts, dass die politischen Betreuer dieser Wirtschaftsweise weder von Ausbeutung im Allgemeinen etwas wissen wollen noch im Besonderen von den Absurditäten einer praktisch angewandten Grundrechnungsart, die den gesellschaftlichen Reichtum nicht an der Bequemlichkeit des Produzierens, sondern an dem Quantum notwendiger Arbeitszeit misst, deren Verringerung gleichzeitig als schärfste Waffe im Konkurrenzkampf der kapitalistischen Unternehmen zum Einsatz kommt. „Investitionsprogramme“, wie die unzufriedenen SPDler sie vorschlagen, bewirken jedenfalls genau das, was sie einzig und allein bewirken können, nämlich ein insoweit verbessertes Geschäft. Den derart geförderten Geschäftemachern bleibt anheim gestellt, wie sie nach Maßgabe ihrer Geschäftslage und im Interesse ihres Geschäftserfolgs mit dem Produktions- und Kosten-‚Faktor Arbeit‘ verfahren. Und das läuft regelmäßig auf eine Blamage der Hoffnung hinaus, mit Geldgeschenken an die Unternehmer wären die zu sozialen Großtaten in Sachen „Beschäftigung“ zu stimulieren – schließlich handelt es sich um dieselben, die nach ihrer unabänderlichen Grundrechnungsart neben weltrekordmäßiger Ausbeutung auch immer eine ansehnliche Menge Arbeitslose schaffen.
Doch so genau wollen die Protagonisten eines echt sozialdemokratischen Regierungsprogramms es gar nicht wissen. Mit ihrem wohlfeilen „statt“ wollen sie gar nicht zu einer Überprüfung ihres Ideals einer „dauerhaften aktiven Beschäftigungspolitik“ herausfordern oder gar zu einer Diskussion darüber, was ihr zweiter Vorschlag zu dem Thema „die Umverteilung von Arbeit in Normalarbeitsverhältnisse“ wert ist. Immerhin ist es ein Eingeständnis, dass Arbeitslose und Billiglöhner sich von einer ‚Ankurbelung der Wirtschaft‘ durch „massive Investitionsprogramme“ auch nichts kaufen können; ansonsten aber – um das historische Zitat des SPD-Genossen Bahr einmal mehr aus dem Zusammenhang zu reißen – handelt es sich um ‚eine Perversion des Denkens‘, des sozialen Gedankens in dem Fall: Da wird der systemeigene Zynismus, dass Lohnarbeiter ihre eigene Ausbeutung wie ein probates Lebensmittel wollen müssen, zu der affirmativen Idiotie aufgeblasen, Arbeit wäre quasi von Haus aus ein knappes Gut, für dessen passende Zuteilung an bedürftige Arbeitskräfte die Politik zu sorgen hätte. Dass diese Absurdität sich schon theoretisch und erst recht praktisch an dem Monopol kapitalistischer Arbeitgeber auf den Gebrauch von „Arbeitsverhältnissen“, normalen wie anderen, blamiert – für die ist Arbeit überhaupt kein knappes Gut, sondern dadurch Quelle ihrer Bereicherung, dass sie aus immer weniger und nach Möglichkeit immer schlechter bezahlter Arbeit immer mehr Bruttoerlös für ihre Firma herausquetschen –, geht die Anwälte einer durch und durch sozialen „Beschäftigungspolitik“ schon wieder nichts mehr an. Mit ihrem Kontrastprogramm zu Schröders untauglicher „Arbeitsmarktpolitik“ haben sie das Ihre getan, nämlich die Vorstellung von einer sozialdemokratischen Politik beschworen, die mit staatlichen Vorschriften von oben herunter dem Kapitalismus ein ‚menschliches Antlitz‘ verleihen würde, ohne sich an seine Prinzipien und notwendigen Konsequenzen zu vergreifen.
4. Das schlagendste Argument alternativ-sozialdemokratischen Wirkens: Das Wählervertrauen erhalten!
Dieses Konzept wollen sie hochhalten; und in dankenswerter Direktheit sagen sie auch gleich dazu, warum: So etwas braucht es einfach. Nicht, um den bundesdeutschen Kapitalismus auf ein neues – oder altes, jedenfalls – arbeiterfreundliches Gleis zu setzen; so vermessen wollen die Freunde der sozialdemokratischen Tradition gar nicht sein; sondern weil die vielen Austritte aus der SPD und die vielen Nichtwähler der vergangenen Wahlen aus dem sozialdemokratischen Spektrum zeigen: Viele Bürgerinnen und Bürger kehren der Politik den Rücken…
– und das darf auf keinen Fall sein. Denn dann leidet das gute deutsche „Gemeinwesen“; die Demokratie geht kaputt, wenn sozial gesinnte Menschen „aus dem sozialdemokratischen Spektrum“ sich, ihre Gesinnung, das Ethos, mit dem sie die Welt der materiellen Bedürftigkeit und des sozialen Elends von Staats und Kanzlers wegen hoheitlich betreut und behütet sehen wollen, in den Angeboten der herrschenden Parteien nicht mehr wiederentdecken können. Es ist gar kein sozialer Reformeifer, der diese Kritiker beflügelt, noch nicht einmal ein sozialdemokratisch verkehrter. Ihr soziales Alternativangebot ist nichts anderes und will nichts anderes sein als eine Grußadresse an den sozial verantwortlich denkenden ‚Citoyen‘: an den sozialdemokratischen Wähler, dem eine Repräsentanz seines sozialen Gewissens abgeht.
Noch einmal dieser gedankliche Übergang, der für die Retter der alten Sozialdemokratie gar keiner ist:
„Wir gehen diesen Weg nicht mehr mit. Die vielen Austritte aus der SPD und die vielen Nichtwähler der vergangenen Wahlen aus dem sozialdemokratischen Spektrum zeigen: Viele Bürgerinnen und Bürger kehren der Politik den Rücken, fühlen sich von der SPD getäuscht aber auch von keiner anderen Partei vertreten. Wir sehen darin eine Gefahr für die Stabilität unserer Demokratie. Nichtwählen und Rückzug in die innere Emigration ist nicht die Lösung. Gerade weil es durch den Kurswechsel der SPD keine relevante organisierte politische Gruppierung gibt, die einen Gegenpol zum neoliberalen Umbau unserer Gesellschaft darstellt, wollen wir uns politisch engagieren und für die Verteidigung dieses Sozialstaates arbeiten.“
So ist das also. Soziale Politik braucht es, um die Wähler bei der Stange zu halten. Das demokratische Gemeinwesen, das gelungene Zusammenspiel von unten und oben, den Staatsgehorsam des Volks, das alles sehen Schröders Kritiker gefährdet, wenn nicht eine Partei mit dem sozialen Programm einer ordentlichen SPD das Volk erfolgreich für sich einnimmt. Wenn Bürger aus Überdruss über die Politik am Wahltag zu Hause bleiben; wenn es auch Sozialdemokraten einfach nicht mehr gelingt, Volkes Unzufriedenheit in Stimmen für sich umzumünzen, wenn statt dessen enttäuschte Bürger die CDU wählen, dann steht den Initiativlern ein schreckliches Szenario vor Augen: Die SPD könnte in die politische Zweitrangigkeit absinken, und damit käme der deutschen Demokratie ein unverzichtbarer Teil ihrer politischen Kultur abhanden. Die braucht nämlich unbedingt eine politische Kraft, die als „Gegenpol“ gegen den „neoliberalen Umbau“ verhindert, dass Bürger „der Politik den Rücken“ kehren; ein Angebot, das dem „enttäuschten Wähler“ Gelegenheit bietet, sich vertreten zu fühlen. Nichts liegt den Parteikritikern ferner als der Gedanke, eine Absage der Massen an dieses politische Getriebe könnte gerechtfertigt sein; und von einer Kritik, die den Unzufriedenen ihre Lage erklärt, so dass am Ende womöglich mehr daraus wird als bloß die Verweigerung einer Wahlstimme, wollen sie schon gar nichts wissen. Sie denken umgekehrt; so nämlich, wie eben jede Partei denkt, die sich für die Wahlstimmen eines unzufriedenen Volkes interessiert: Ohne eine massenhafte Zustimmung, die sie zur Machtausübung im Namen des Volks befugt, ist Deutschland nicht in Ordnung; ohne ihre tragende Rolle im Machtgetriebe fehlt dem Volk nämlich das Entscheidende: dass es sich in diesem Staat zu Hause fühlen kann.
Dieses Argument macht aus ihrer Sicht endgültig Eindruck – beeindruckt also vor allem sie selber. Das Bedürfnis, die Massen auch und gerade in ‚harten Zeiten‘ mit dem Staat zu versöhnen, ist ganz offensichtlich eine unausrottbare Berufskrankheit linker Kritik; jedenfalls ist es der letzte und in ihren Augen offensichtlich schlagendste Einwand, mit dem die enttäuschten SPD-Linken antreten und für soziale Taten der Staatsmacht werben. Ihr vernichtender Vorwurf an den „Kanzler-Wahlverein“ heißt: So vergrault ihr die Grundlage einer SPD-Regierungsmacht, das Wählervertrauen. Die alte schlechte SPD-Gewohnheit, die Notlagen der Massen in einen Auftrag zum Regieren, also in ihr Recht auf Führung der Nation zu verwandeln, ist ihnen in Fleisch und Blut übergegangen. Diese Tradition möchten sie weiter pflegen und glaubwürdig erhalten – andernfalls sehen sie schwarz für die politische Kultur des Dafürseins, die das Vaterland maßgeblich der SPD zu verdanken hat. Also treten sie an, damit der Mensch auch in harten Zeiten eine politische Heimat hat; eine Instanz, die seine Sorgen anerkennt und sich ihrer annimmt; etwas Wählbares eben. Am besten, die SPD selbst erneuert ihre alte Masche und begleitet ihr Regierungsgeschäft, wenn es denn schon so hart sein muss, wie es ist, mit der trostreichen Versicherung, eigentlich ginge es ihr um viel mehr und viel Besseres als das, was sie gerade durchsetzt. Damit sie das tut, und für den Fall, das sie das nicht tut, stellen sie die furchtbarste Drohung in den Raum, die sie sich vorstellen können: Dann würden sie noch nicht einmal vor einer Abspaltung zurückschrecken!
5. Die ‚Initiative‘ gegen die ‚Schröder-SPD‘: Der ewige sozialdemokratische ‚Kampf zweier Linien‘ in zeitgemäßem Gewand
Damit legt diese Opposition die vorläufig letzte Runde im Dauerstreit zwischen Idealisten und Realisten sozialdemokratischen Wirkens auf, aus dem das innerparteiliche Leben der SPD seit jeher besteht. Dass die SPD ihre Ideale verraten hätte, die deswegen vor ihr gerettet werden müssten, gehört als Dauer-Vorwurf von Parteimitgliedern an die Partei zu deren Lebenslüge ebenso fest dazu wie der Konter der Gegenseite, mit ihren allzu idealistischen „Konzepten“ würden die Kritiker sich vom Machbaren verabschieden und überhaupt die Chancen der Partei auf Wählbarkeit verbaseln, bzw. das notwendige Regierungsgeschäft mit seinen unvermeidlichen ‚Abstrichen‘ vom ‚Wünschbaren‘ behindern. Auf diese Weise hat die Partei den Idealismus, sie würde die Regierungsgewalt über ihr kapitalistisches Gemeinwesen zuvörderst zu Nutz und Frommen der Opfer des Kapitals anstreben und ausüben, berechnend gepflegt und ihn zugleich immer auf den Platz verwiesen, der ihm im Rahmen einer „verantwortlichen Regierungspolitik“ und mit Blick auf ihre Wahlchancen als ‚Volkspartei‘ zukommt. Ihrer Gefolgschaft hat die SPD damit in Sachen politischer Moral einerseits ein Angebot gemacht, ihr andererseits Einiges zugemutet: Immerhin durfte und sollte man sogar an den Willen wie die Fähigkeit der SPD glauben, sie würde, einmal an der Staatsmacht, die Dinge zugunsten der armen Leute richten; immerzu blieb die wirkliche Politik dann doch den Beweis schuldig, dass sich an der Lebenslage der Massen Entscheidendes verbessern ließe; andererseits war man ja immerhin an der Macht und hatte die Chance zur Reform, was auf jeden Fall besser war als keine… Seit Beginn verfügt die Partei deshalb über eine feste Randerscheinung: linke Freunde und Sympathisanten, die an der versprochenen ‚Chancengleichheit‘ die wirkliche Gleichstellung von Arbeiterkindern, an der sozialdemokratischen ‚Frauenemanzipation‘ die wirklich egalitäre Teilhabe am Berufsaufstieg, am Staatshaushalt die wirklich gleichgewichtige soziale Ausrichtung, wirklich mehr Bildung statt Rüstung, usw., usw. – und an den Parteiführern die Ehrlichkeit im Bekenntnis zur Gesellschaftsveränderung vermissen. Das durften diese Figuren auch, solange sie nicht beanspruchten, die wirkliche Politik maßgeblich mitzubestimmen; und das durften sie regelmäßig nicht mehr, wenn sie sich zu einer ernstzunehmenden Störung im Beschlusswesen und Erscheinungsbild der Partei auszuwachsen drohten.
In diese Tradition reihen sich die Initiatoren der „Initiative Arbeit & soziale Gerechtigkeit“ würdig ein: Die regierende SPD verlangt von Mitgliedern wie Wählern die „Einsicht“, dass die Partei sich wegen der Ziele, die sie schon immer verfolgt, heute von der Not der ‚Schlechterverdienenden‘ auch ideologisch nicht mehr beeindrucken lassen darf – und wieder einmal steht eine Opposition auf der Matte, die nichts Besseres zu tun weiß, als ausgerechnet die alte Lebenslüge retten zu wollen. Und das genau so matt und in so bescheidener Fassung, wie das „Linke“ in der SPD schon immer tun und wie es zu Schröders SPD genauso passt wie die alten Jusos zu Helmut Schmidt.
[1] Dabei ficht es die Verfasser des Gründungsaufrufs nicht im mindesten an, dass der Geisterstreit zwischen bösem „Neoliberalismus“ und guter, nämlich „sozial verantwortlicher Politik“ in den kritischen Gazetten der Nation schon eine ganze Weile tobt, ohne dass die politisch Verantwortlichen sich bisher im mindesten davon haben beeindrucken lassen. Anscheinend lesen diese keine linken Zeitschriften…
[2] Wahrscheinlich denken die wirtschaftspolitisch gebildeten unter den enttäuschten SPD-Genossen in dem Zusammenhang auch gar nicht bloß an Steuergelder, sondern an Kreditmittel, die der Staat sich ganz ohne soziale „Schieflage“ bei seinen Banken und betuchteren Bürgern besorgt. In anderen Verlautbarungen als der hier durchgenommenen befinden sie jedenfalls Staatsschulden für ein höchst geeignetes Mittel, um einen Aufschwung und in dessen Gefolge einen zarten Abbau der Arbeitslosigkeit herbei zu manipulieren. Womöglich sehen sie sich mittlerweile sogar schon wieder ein Stück ins Recht gesetzt und mit ihrer Parteispitze versöhnt, weil die Regierung sich inzwischen ganz offiziell mehr Schulden genehmigt – auch wenn sie das gar nicht für ein „massives“ Beschäftigungsprogramm, sondern wegen konjunkturbedingter Steuerausfälle tut. Das fällige praktische Eingeständnis des Finanzministers, dass die Staatsschulden vermehrt werden müssen, weil in der Krise die Einnahmen wegbrechen, nehmen sie am Ende glatt als ersten Schritt zur Umkehr, als Aufbruch zu einem neuen Keynesianismus, der wieder Hoffnung auf die SPD nährt. Und wenn der neue Parteivorsitzende die Sprachregelung ausgibt, 3% mehr ‚Bildungsförderung‘ wären doch besser als die ‚blinde Erfüllung des 3%-Maastricht-Kriteriums‘, dann steht der Versöhnung von Leuten, die am bundesdeutschen Bildungswesen ausgerechnet die „Verarmung der meisten Universitäten“ beklagen, mit ihren Traditionsverein eigentlich nichts mehr im Wege…