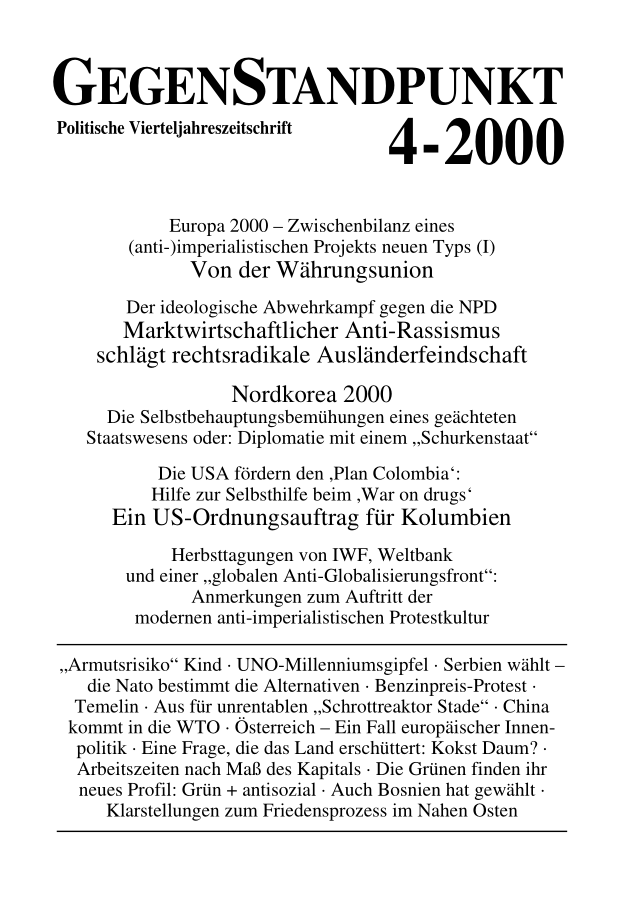Aus der Reihe „Chronik - kein Kommentar!“
Eine Nation wird mit Sanktionen belegt und von einem Weisenrat rehabilitiert:
Ein Fall europäischer Innenpolitik geht in die nächste Runde
Erst attestiert die EU der mitregierenden FPÖ Demokratie gefährdende Positionen und belegt ganz Österreich mit Sanktionen, um 6 Monate später der ganzen Mannschaft Europareife zu bescheinigen. Ein „Schmierentheater“ der EU? Von wegen: die EU demonstriert ihren Anspruch, eine schlagkräftige imperialistische Ordnungsmacht zu sein und will zwischen erlaubten und unerlaubten Nationalismen unterscheiden. Österreich hält mit einer Doppelstrategie aus Entgegenkommen und Drohungen dagegen, die EU mit ihrem Veto bei anfallenden Entscheidungen zu blockieren. Dabei ist Österreich sich im Klaren, dass es zu den nachrangigen Mächten in Europa zählt, und will eine weitere Abstufung in der Hierarchie der EU-Staaten verhindern.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Eine Nation wird mit Sanktionen belegt
und von einem Weisenrat rehabilitiert:
Ein Fall europäischer Innenpolitik
geht in die nächste Runde
Drei Weise ziehen durch das Alpenland, prüfen Worte und Taten der Regierung, der Exekutive, der Justiz und insbesondere einer der Koalitionsparteien, um nach drei Monaten den höchsten österreichischen Staatsorganen mit einigen kritischen Einschränkungen ihre Menschenrechtlichkeit und Europatauglichkeit zu bestätigen. Daraufhin hebt der EU-Ratspräsident die Sanktionen gegen Österreich auf und die europäische Regierungslizenz wird unter dem Hinweis auf „weitere genaue Beobachtung“ zurückerstattet.
Diese Vorgangsweise hat der EU von professionellen Kommentatoren aus allen Lagern und allen europäischen Nationen vorwiegend Schelte eingetragen. Von einem „Schmierentheater namens Sanktionspolitik“ und einem „selbstverschuldeten Gesichtsverlust der EU“ ist die Rede. Je nach Geschmack und Standpunkt werden die Sanktionen respektive der „kurze Atem europäischer Ordnungspolitik“ kritisiert. Im betroffenen Österreich wird die Aufhebung mehrheitlich als Beweis für die Unrechtmäßigkeit der erlittenen Sanktionen aufgenommen. Angesichts der nicht nur in Österreich und Dänemark aufgekommenen Besorgnis um die eigene Souveränität unter EU-Regime werden die Sanktionen als „kontraproduktiv“ für das europäische Einigungswerk und schlechte Bedingung für die weiteren Fortschritte des Bündnisses verdammt.
Davon kann bei nüchtern-unparteilicher Betrachtung der Sachlage nicht die Rede sein.
Ein europäischer Verfassungsschutz
Vor allem in der Ablöse der Sanktionen durch den
Weisenbericht und deren nachfolgende Aufhebung wollen
Journalisten eine Diskrepanz und ein
„Glaubwürdigkeitsproblem“ der EU entdeckt haben. Erst
attestiert man der FPÖ menschenverachtende,
ausländerfeindliche und demokratiegefährdende Positionen
und erklärt eine Regierung unter Beteiligung der
Freiheitlichen für untragbar, um sechs Monate später
derselben Mannschaft Europareife im Umgang mit Ausländern
und Minderheiten zu bescheinigen. Da kann es sich nur um
einen für die EU-Partner schmählichen Ausgang der
Causa Austria
(SZ-Kommentar,
zitiert von Die Presse vom 27.10.00) handeln, der
mit Tricks und „bestelltem Persilschein“ der EU weiteren
Gesichtsverlust ersparen soll.
„Die drei Weisen haben getan, was von ihnen erwartet wurde. Ihr Bericht über das Verhalten der österreichischen Regierung und die Entwicklung der FPÖ macht genau, was er sollte. Er stellt der Regierung aus ÖVP und FPÖ einen Persilschein aus, fordert insofern eine Aufhebung der Sanktionen der 14 EU-Staaten, formuliert aber genügend Bedenken gegenüber der FPÖ, um die Staatschefs nicht als völlig deppert dastehen zu lassen.“ (taz, 9.9.)
Es wird schon so sein, dass der Weisenbericht als „Ausstiegsszenario“ geplant war, ein europäischer Schwächeanfall oder gar ein „Kotau vor Österreich und Jörg Haider“ ist er deswegen noch lange nicht. Diese Sichtweise verrät nur das Ideal des Betrachters, der Europas Willen zur Maßregelung eines seiner Mitglieder nicht nur teilt, sondern geistig dermaßen überholt, dass er auch nur den Anschein eines Zugeständnisses als Mangel an imperialistischer Durchsetzungsfähigkeit der EU quittiert. Er will einfach nicht mehr gelten lassen, dass sich staatliche Gewaltmonopolisten nicht von einer höheren Instanz überprüfen, also den Kontrollbefugnissen anderer unterordnen lassen wollen – und sich schon gleich nicht eine Degradierung von denen bieten lassen können, mit denen sie gleichberechtigt in Europa und als Europa gegen den Rest der Welt konkurrieren.
Der Sache nach ist die Beaufsichtigung Österreichs durch einen europäischen Verfassungsschutz – in Ermangelung einer europäischen Verfassung samt Hütern wurden die drei Weisen bestellt – eine Fortschreibung des EU-Aufsichtsrechts mit anderen Mitteln, das im Vertrag von Amsterdam einstimmig als Rechtsanspruch der Union gegenüber den Mitgliedsstaaten festgeschrieben wurde und in den „Sanktionen der 14“ erstmals gegen ein Mitgliedsland wahrgenommen wurde. Damit ist eine neue Qualität im Verhältnis des supranationalen Bündnisses zu den beteiligten Nationalstaaten in der Welt: Es werden nicht mehr bloß die nationalen politischen Entscheidungen auf ihre EU-Kompatibilität überprüft. Mit dem Recht auf Supervision von Mitgliedsstaaten hinsichtlich ihrer Konformität in Sachen Menschenrechte und europäischer Wertehimmel behält sich Europa vor, ganz prinzipiell zwischen erlaubtem und unerlaubtem Nationalismus zu unterscheiden. Die Ermächtigung einer Regierung durch den Volkssouverän in freien und geheimen Wahlen sorgt durchaus weiterhin für deren demokratische Legitimität, doch steht die von Europa aus unter dem Vorbehalt, dass die gewählte Regierung den Europa bestimmenden Mächten auch genehm ist.
Dieses Bedürfnis, zwischen genehmen und nicht-genehmen Herrschaften zu sortieren, gründet im Widerspruch zwischen dem europäischen Anspruch, eine schlagkräftige imperialistische Ordnungsmacht zu sein, und der derzeitigen Verfasstheit des Bündnisses: Wenn der deutsche Außenminister die Zusammensetzung der österreichischen Bundesregierung zu einem „Fall europäischer Innenpolitik“ erklärt; wenn für den Kursverfall des Euro unter anderem die Vielzahl nationaler Wirtschafts- und Finanzhoheiten verantwortlich gemacht wird; wenn aus dem imperialistischen Großprojekt der EU-Osterweiterung die Notwendigkeit abgeleitet wird, die Stimmrechte der Mitglieder einzuschränken und die Mehrheitsentscheidungen auszuweiten; wenn allerorten die Forderung aufgestellt wird, dass zur Stärkung des Bündnisses statt des Chors formal gleichberechtigter Mitglieder „Europa künftig mit einer Stimme“ seine politischen Vorhaben ansagen muss: dann wird eingestanden, dass die nationale Souveränität der Mitglieder von den politischen Machern Europas zunehmend als Hindernis für ein schlagkräftiges Europa angesehen wird, und jeder weitere Fortschritt hin zu einer europäischen Weltmacht eine Frage der Unterordnung nationaler Souveränitäten ist.
Dummerweise existiert die europäische Gemeinschaft aber nach wie vor als Ensemble konkurrierender Nationalstaaten, die zwar alle gute Gründe für eine „Stärkung europäischer Führungskompetenz“ kennen, die sich aber gleichzeitig von der Haushalts-, Steuer- und Finanzpolitik über die gemeinsame Sicherheits- und Außenpolitik bis zur Osterweiterung auf alle europäischen Projekte vom Standpunkt ihrer nationalen Vorteilsrechnung beziehen, diese mehr oder weniger unterstützen, von Fall zu Fall vorantreiben oder auch mal bremsen. Das wissen auch Europavisionäre wie Joschka Fischer, weswegen er nicht will, was er nicht kann:
„Ich will die Nationalstaaten nicht abschaffen. Wohl aber gilt es nachzudenken, welche Rolle die Nationalstaaten in einem künftigen Europa spielen, welche Entscheidungskompetenz bei den Mitgliedstaaten bleibt und was künftig auf europäischer Ebene geregelt werden muss.“ (Fischer in der ORF-Nachrichtensendung Zeit im Bild.)
Vorerst bringt der Fortschritt Europas in Richtung auf eine die Nationen unterordnende Union jedenfalls schon jetzt lauter Gesichtspunkte auf die Tagesordnung, die auf eine Überprüfung der Unterordnungsbereitschaft der politischen Akteure in den EU-Staaten hinauslaufen. Mehr oder weniger gewichtige nationalistische oder separatistische Figuren der nationalen Politszenen geraten als Störpotentiale für die weitere europäische ‚Integration‘ ins Visier – Figuren, die es in praktisch jedem Mitgliedsland gibt, weil sich in allen Heimatländern des Bündnisses euro-skeptische bis euro-kritische Verteidiger der eigenen nationalen Souveränität herausgefordert sehen und auf die Forderung versteifen, die bereits stattgefundene Entmachtung ihrer Heimatstaaten rückgängig zu machen bzw. künftige Kompetenzverluste abzuwehren, die für „eine einheitliche europäische Führungsstruktur“ unabdingbar sind. In Österreich gerät so die FPÖ ins Visier, die sich durch ein Anti-Euro-Volksbegehren, durch Maastricht-kritische Einlassungen und massive Kritik an der Osterweiterung als EU-skeptische Kraft profiliert. Die Aufwertung ihres notorisch anti-europäischen Ressentiments zu einem Bestandteil österreichischer Regierungspolitik erscheint den für Europa verantwortlichen Hauptmächten einfach nicht hinnehmbar. Daher statuieren sie an Österreich ein Exempel. Sie schreiten zur Ausgrenzung der politischen Störquelle, und für die kommt es ihnen wie gerufen, dass der inkriminierte nationalistische Standpunkt der Haider-Partei sich bereits mehrfach gegen die in Europas Demokratien geltenden polit-moralischen Anstandsregeln vergangen hat. Seine gezielten Verstöße gegen die europäischen Sprachregelungen für die Verurteilung des Nationalsozialismus sind für die EU-Führungsmächte ein gefundenes Fressen, die fällige Ächtung des sie störenden Nationalismus zu einem regierungsamtlichen „antifaschistischen Kampf“ aufzubereiten. Indem sie an Haiders Kritik an den Fortschritten der Union zielstrebig die Nähe zum Faschismus, also zu einem in jeder Hinsicht diskreditierten Nationalismus, feststellen und entsprechend moralisch geißeln, verleihen sie ihrem eigenen multinationalen Großmachtprojekt die höheren Weihen, nur die Notwendigkeiten zu vollziehen, die aus allerhöchsten sittlichen Verpflichtungen herrühren.
Allerdings: So sehr sie sich in ihrem Willen zur Unterordnung Österreichs auf ihr Werk, ihr gemeinsames Europa, berufen, so sehr ist den Betreibern der Sanktionen klar, dass diese nicht von der Europäischen Union in toto, sondern nur von den übrigen EU-Staaten ausgesprochen werden können; und zwar nicht deswegen, weil es dafür noch kein geeignetes europäisches Rechtsinstrument gibt, wie journalistische Beckmesser zu Protokoll geben. Dass sich die 14 nicht von solchen Kleinigkeiten behindern lassen, zeigen sie ja mit der kundigen Wahl einer anderen Rechtsform zur Durchsetzung ihres Interesses. Und die hat für sie erst einmal den Vorteil, auf die wenig aussichtsreiche Überbeanspruchung alpenländischer Europabegeisterung von Haus aus verzichten zu können; es wäre ja auch wirklich ein bisserl viel von Österreich verlangt, im Konzert mit den anderen Mitgliedsstaaten gegen sich selbst Strafen zu erlassen.[1]
Doch zeigt sich daran von Anfang an eben auch die Dialektik der Affäre: Den Widerspruch, den die 14 mit ihrem Beschluss zur Unterordnung des 15. Mitgliedslandes unter so etwas wie eine höhere europäische Bündnisräson in ihrem Sinne vorwärtsweisend entscheiden wollen, treiben sie gerade so auf die Spitze. Ihr Bedürfnis, das eine Europa im Wege der Unterordnung seiner Mitgliedsländer zu regieren, hat sich gegen das Land, das sich so ohne weiteres nicht unterordnen will, erst einmal durchzusetzen. Und da zeichnet sich für alle Beteiligten, so, wie Europa gegenwärtig noch verfasst ist, keine befriedigende Lösung ab.
Immerhin hängt der Erfolg der von ihnen ergriffenen Maßnahme nach Lage der Dinge immer noch entscheidend davon ab, dass Österreich sich beugt, sich die Beendigung der Sanktionen und damit die Anerkennung seiner Bündnispartner durch die tätige Einsicht in die Untragbarkeit der eigenen, per Wahlen ermächtigten Regierung verdient. Und für die EU stehen für den Fall einer Weigerung der österreichischen Regierung, nachzugeben, auch nur zwei wenig begeisternde Perspektiven in Aussicht: eine dauerhafte Brüskierung ihrer Aufsichtskompetenz durch ein aufsässiges Österreich oder eine Verschärfung des diplomatischen Konflikts bis hin zum Ausschluss Österreichs aus der europäischen Staatengemeinschaft. Da keineswegs der Ausschluss der Alpenrepublik bezweckt, sondern die ganze Chose der demonstrativen, beispielgebenden Ein- und Unterordnung eines unbotmäßigen Nationalismus gewidmet ist, wird das ursprüngliche Vorgehen für zwar berechtigt, mittlerweile aber „kontraproduktiv“ erklärt und eine Art Vergleich mit dem moralisch ins Abseits gestellten Partner angesagt.
Der ultimativen Forderung nach Rücknahme des unerwünschten Ergebnisses freier, demokratischer Wahlen wird ein Verfahren der Überprüfung beigesellt, die herausfinden soll, inwieweit die inkriminierte österreichische Nomenklatura die Vorwürfe zu entkräften vermag. Bei – durchaus beabsichtigtem – positivem Ausgang wird die Rücknahme der Sanktionspolitik und die Absolution durch die EU in Aussicht gestellt. Diese zwischenstaatlich einmalige Verfahrensweise hat gegenüber dem vorangegangenen Diktat den entscheidenden Vorteil, Österreich die Unterordnung unter das europäische Aufsichtswesen in der Form des „Angebots“ anzutragen, es könne durch demonstratives Wohlverhalten die europäische Anerkennung wiedergewinnen. Insofern halten die 14 beim Wechsel von der Sanktionspolitik zum Weisenrat einerseits am Supervisionsrecht fest, andererseits geben sie die selbstkritische Einsicht zu Protokoll, dass die Diskriminierung des Bündnispartners Österreich für die Durchsetzung des Anspruchs auf Unterordnung unter einen „europäischen Verfassungsbogen“, der noch seiner Institutionalisierung harrt, doch nur wenig taugt.
Österreich: Anpassung und ein bisserl Gegen-Erpressung zur Bewältigung der „Causa prima“
Dieses „Angebot“ hat Österreich in der Hoffnung auf einen „gerechten Freispruch“ (Schüssel) angenommen und damit den ersten Teil der Prüfung bestanden, weil es sich der Suprematie der „Unrechtsetzer von Europa“ (Haider) beugte.
Die Natur des zu erbringenden Beweises ist freilich einigermaßen heikel. Schließlich wird ja nicht bloß die Korrektur des einen oder anderen Fehlverhaltens abverlangt. Der Vorwurf des unrechtmäßigen Nationalismus halst Österreich die Beweislast auf, im Verfahren am Material von Rechtsstaatlichkeit, Ausländer- und Minderheitenproblematik und political correctness seine Linientreue und Botmäßigkeit gegenüber den europäischen Anklägern zu beweisen. Und vor allem: Die Beweiswürdigung liegt ganz bei den Anklägern.
Die vom Bundespräsidenten Klestil verweigerte Angelobung zweier einschlägig punzierter FPÖ-Ministerkandidaten, vor allem aber der Rücktritt Haiders als Parteiobmann sind als erster Test gedacht, inwieweit weitergehende Anpassungsschritte notwendig und lohnend sind. Nachdem auch eine Präambel zur Regierungserklärung, in der die österreichische Bundesregierung versichert, ihre Regierungstätigkeit ausschließlich nach den von der EU eingeforderten Prinzipien von Menschenrechten und Demokratie auszuüben, und damit das Einspruchsrecht der EU explizit bestätigt, keine Wirkung zeigt, folgen umgehend die nächsten vertrauensbildenden Maßnahmen. Die Verhandlungen mit den USA über die Entschädigung der Zwangsarbeiter werden „nach deutschem Vorbild“ angegangen und 50 Jahre nach Kriegsende einer raschen Klärung zugeführt. Das „Problem des arisierten Vermögens“ wird vom „ersten Opfer der nationalsozialistischen Aggression“ erstmals als bilateraler Verhandlungsgegenstand akzeptiert; Verhandlungen mit Vertretern der Opfer werden unter Federführung der USA begonnen. Der kroatischen Minderheit werden 45 Jahre nach Abschluss des Staatsvertrags gemäß dem dort verankerten Minderheitenschutz zweisprachige Ortstafeln aufgestellt und eine Unterstützung kroatischer Kulturvereine zugesichert. An diesen und ähnlichen Maßnahmen zeigt sich die Zweischneidigkeit und Verrücktheit des Beweisverfahrens, die Anerkennung als gleichwertiges Mitglied durch Unterordnung unter den europäischen Sittenkodex zurückzugewinnen. Damit gesteht Österreich nämlich ein Stück weit die Unrechtmäßigkeit seiner bisherigen politischen Praxis ein und bestätigt prinzipiell die Berechtigung der EU-Aufsicht, nicht, um ihr Recht zu geben, sondern um sie ex post zu entkräften und darüber ins Unrecht zu setzen. Dieser Widerspruch wird auch nicht dadurch ausgeräumt, dass die politischen Würdenträger ständig betonen, sie hätten die Maßnahmen aus freien Stücken und ganz unabhängig vom Streit mit der EU initiiert.
Sogar der Sparhaushaltskurs („Nullbudget ab 2002“) und die Beteiligung an einem künftigen Eurokorps („kalte Abschaffung der Neutralität“, van der Bellen, Grüne), die wirklich unabhängig vom gegenwärtigen Streit von Österreich beschlossen worden sind, werden als Beweise dargeboten, dass man sich bei elementaren Europaprojekten wie Eurosanierung und gemeinsamer Sicherheitspolitik auf Österreich voll verlassen könne. Und nach Meinung der österreichischen Bundesregierung hat sie sich schon allein für ihren pfleglichen rechtsstaatlichen Umgang mit den regierungskritischen Demonstranten („Die polizeilichen Einsatzkräfte sorgen sowohl für den Schutz des Demonstrationsrechts als auch für die friedliche und ordnungsgemäße Abwicklung der Demonstrationen“, Innenminister Strasser) eine wohlwollendere Behandlung durch die EU verdient.
Den österreichischen Verantwortlichen ist freilich von vornherein klar gewesen, dass es mit dem demonstrativen Nachweis der Europakonformität Österreichs nicht getan ist. Politiker wissen, dass das entscheidende Durchsetzungsmittel unter Gewaltmonopolisten die erfolgreiche Drohung ist. Zumindest darin besteht bei den verfeindeten europäischen Brüdern Konsens. Schüssel und Co. – „stilles Dulden ist vorbei“ (A. Khol, Klubobmann der ÖVP) – ergänzen daher ihre Politik der Zugeständnisse um den Hinweis, dass Österreich bei Fortsetzung des EU-Boykotts durch Wahrnehmung des Vetorechts bzw. durch Verzögerung von einstimmig zu fällenden Entscheidungen das Projekt Europa auch einigermaßen durcheinanderbringen könne – eine deutliche Warnung an die EU-14, dass die Sanktionen statt der gewünschten nationalen Botmäßigkeit nur den unbotmäßigen Nationalismus ihres Mitglieds anstachelten.
Für diese Doppelstrategie aus Entgegenkommen und Drohung,
die freilich immer auch gleich wieder dementiert wird,
tut der innerösterreichische Streit mit Jörg Haider
durchaus gute Dienste. Wie europafeindlich Haider seinen
selbstbewussten Nationalismus im letzten definiert,
bleibt bei all den harten Ansagen und Verbalinjurien
gegen die europäischen Brandstifter
– das ist
keine selbstbewusste Nation, die so agiert. Ich verlange,
dass die Österreicher nicht unterwürfig sind und die
Politiker nicht jammervoll in die Knie gehen.
(Jörg Haider, 27.4.2000.) –
im Dunkeln. Einen Austritt aus der Europäischen
Gemeinschaft hat der Kärntner Landeshauptmann jedenfalls
nicht öffentlich erwogen. Eines steht allerdings fest:
Alle patriotische Erregung im Lande stärkt Haider nicht,
den Verdacht der Mitschuld am österreichischen Schicksal
kann er nicht zuletzt aufgrund seiner rotzfrechen Ansagen
gegen Chirac – „Westentaschennapoleon“ –, Schröder –
„Feigling“ – und Co. – „Lügner“ – nicht entkräften. Mehr
noch: Da die Koalition von ÖVP und FPÖ die nationale
Perspektive zu jedem Zeitpunkt untrennbar an die
EU-Mitgliedschaft geknüpft hat, empfinden selbst die
Regierungsmitglieder seiner eigenen Partei die
Haiderschen Absonderungen zunehmend als Behinderung ihres
eigenen politischen Erfolgs.
Daher werden die Drohgebärden aus Kärnten
regierungsoffiziell – wenn auch etwas lauwarm –
zurückgewiesen. Diplomatisch benutzt werden sie aber
auch: als Hinweis an die EU, was die sich mit der
Aufrechterhaltung ihrer Sanktionspolitik für einen
unberechenbaren Nationalismus einhandelt. Und das nicht
nur in Österreich: Neben dem tätigen Beweis ihrer
Europakonformität entwickelt die Wiener Diplomatie als
zweite Hauptkampflinie die Gegenklage, dass recht
eigentlich die EU-14 mit ihrem Verhalten Europa entzweit
– natürlich hat auch das Verhalten der EU gegen
Österreich den bedauerlichen Entscheid der dänischen
Bürger gegen den Euro maßgeblich beeinflusst
(A. Khol) – und die Akzeptanz
der Union bei den europäischen Staatsbürgern gefährdet
hätten. Schärfstes Mittel dieser Widerklage ist die
Androhung eines Volksentscheids, bei dem das Volk zur
Stellungnahme für einen respektvollen Umgang mit
Nationalstaaten, insbesondere dem eigenen, und
gegen eine „selbstherrliche europäische
Dominanz“ aufgefordert werden würde. Auch dabei wird der
EU-Austritt erst gar nicht zur Alternative gestellt.
Vielmehr wird den EU-14 mit einer demokratischen
Demonstration gedroht, wie sehr ein Mitgliedsvolk unter
dem Joch europäischer Erpressung im Ernstfall für seinen
Staat einstehen und von Europa abfallen könnte. Zugleich
droht die österreichische Bundesregierung, sich mit der
Volksbefragung zu einer künftigen Veto- und
Obstruktionspolitik Österreichs ermächtigen zu lassen.
Mit diesem „letzten Mittel“ positioniert sich die
Bundesregierung eindeutig: Entweder es wird eine
„ehrenvolle Rückkehr“ Österreichs in den Kreis der
EU-Mitglieder ermöglicht oder es droht ein
unberechenbarer Kantonist, wie ihn die EU mit ihrer
Erpressungspolitik gerade verhindern will.
Die Bewältigung des europäischen Angriffes kann nicht ohne Folgen für das
Innenleben der Paria-Nation
bleiben. Die jüngere Vergangenheit vor dem Sündenfall war von der innenpolitischen Kardinalfrage beherrscht, ob und inwieweit Österreich mit seiner „verkrusteten Großen Koalition“ und seiner „populistischen Opposition“, seinem Kammerwesen, Beamtenstaat und Proporz, seinem „Reformstau“ und unzeitgemäßen „wohlerworbenen Rechten“ überhaupt „zukunfts- und reformfähig“ sei – sprich: die Innenansicht der Nation war vollständig mit den notwendigen Umwälzungen, Kosten und Opfern für die Herrichtung zum erfolgreichen, konkurrenzfähigen Europastandort beschäftigt. Die Medien übernahmen von der Politik den Maßstab der Europa- und Globalisierungsreife, um die Kraft der Kritik der Überprüfung jeder politischen Figur auf ihre Reformbereitschaft zu widmen, die eben diese politische Klasse auf die Tagesordnung gesetzt hatte.
Mit der Definition zum europäischen Paria wird diese Selbstbeschau schlagartig von der geistig-moralischen Bewältigung der Causa prima verdrängt. Zunächst muss eine das nationale Ehrgefühl befriedigende Antwort auf die Frage gefunden werden: Wie kann das ausgerechnet „uns“ passieren? Dass es nicht an „uns Österreichern“ liegen kann, die „wir“ so brav unsere europäischen Hausaufgaben machen, war zu jedem Zeitpunkt gefestigter patriotischer Konsens. Die EU und ihr supranationales Einmischungsrecht in innerstaatliche Angelegenheiten eignet sich ebensowenig als Schuldiger, weil Österreich auch weiterhin dem Verein angehören und die Einmischungstitel gegen andere weiterhin benutzen will. Also wird der – durchaus beispielhaft – ausgetragene Gegensatz zwischen dem Projekt Europa und seinen nationalen Souveränitäten in eine, je nach Geschmack ausgestaltete Verschwörungstheorie umgedichtet, wonach die Großmächte (Frankreich, Deutschland) aus falsch verstandenem Führungsanspruch oder die Sozialistische Internationale aus Ärger über die rechtsbürgerliche Koalition das kleine Österreich vorführen.
Dementsprechend müssen die Protagonisten der europäischen „Breschnew-Doktrin“ ausgemacht und ihre Glaubwürdigkeit angezweifelt werden. Die öffentliche Abwatschung von Chirac und Co. überlässt man aus Staatsraison dem in seiner Ehre gekränkten Haider.
Die innenpolitische Konkurrenz war schon bei der Konstituierung der neuen Koalition von der Sorge um negative Auswirkungen einer FP-Regierungsbeteiligung auf die Stellung Österreichs im europäischen Bündnis beherrscht. Der ausgebootete SP-Kanzlerverein hat noch vor den EU-Sanktionen den Hinweis auf eine drohende Isolation Österreichs als besonders schlagkräftiges Argument für seinen Machtverbleib und gegen eine Koalition mit FP-Beteiligung ins Treffen geführt, was der SPÖ allerdings nicht gut bekam. Schließlich ist es geradezu patriotische Pflicht und in Österreich seit der Präsidentschaft Kurt Waldheims („Wir Österreicher wählen unseren Präsidenten selber“) quasi politischer Kult, vom Ausland angefeindete Politiker „jetzt erst recht“ bedingungslos zu unterstützen.
Die schwarz-blaue Koalition macht sich daher konsequenterweise und liebevoll um die Ausgestaltung des patriotischen Dogmas verdient, wonach bei einer Einmischung durch einen äußeren Feind der nationale Schulterschluss die erste Bürger- und Politikerpflicht ist, das Aufstöbern von Verrätern im Inneren die zweite. Die Wiener Regierung geriert sich als charakterfeste Verteidigerin der österreichischen Selbstbestimmung und macht in den Reihen der politischen Konkurrenten lauter „Vernaderer“ aus. Dabei ist es „überzeugten Europäern“ selbstverständlich, dass eine Kritik an der österreichischen Bundesregierung im Namen des europäischen Menschenrechtskodex eindeutig den Tatbestand des Vaterlandverrats darstellt. Das Staatsoberhaupt wird als Verräter entlarvt, weil es vor den europäischen Konsequenzen einer blau-schwarzen Regierung gewarnt hat und solcherart dem angriffigen Feind in die Hände spielt. Die Opposition hat demnach die Heimat verraten, weil der frühere Bundeskanzler Klima und sein Nachfolger als SPÖ-Bundesvorsitzender Gusenbauer beim „Champagnisieren“ mit den „französischen Brandstiftern“ erwischt wurden und weil eine grüne Frontfrau „im Ausland“ (!) gegen die eigene Regierung demonstrierte. Haider bringt die Frage der nationalen Ehre wieder einmal am konsequentesten vor und denkt laut über strafrechtliche Konsequenzen für parlamentarische Nestbeschmutzer nach. Die Opposition wehrt sich wiederum mit dem Verweis, dass ohne die populistischen Verfehlungen der Haider-Partei und den „hemmungslosen Machttrieb“ eines Wolfgang Schüssel „Österreich gar nicht in diese schreckliche Situation gekommen wäre“ (van der Bellen). Ungeachtet der deftigen wechselseitigen Schuldzuweisungen eint die Kontrahenten und ganz Österreich der nationale Konsens, dass die EU-Sanktionen so rasch wie möglich weg gehören. Und nach Beendigung der nationalen „Schande“ will natürlich jeder für deren Entsorgung verantwortlich gewesen sein.
Gemessen am Zweck der Maßnahmen der 14 EU-Staaten präsentiert sich das politische Innenleben des mehrmonatig sanktionierten Österreichs in einem eher verheerenden Zustand. Von einer stilvollen, politisch-korrekten Befürwortung des gemeinsamen Europa und seiner ehrgeizigen Pläne ist eher nichts zu merken. Dafür wird eine nationale Perspektive angestachelt, die die Europäische Union vor allem als ein Hegemonieinstrument der Schröders und Chiracs wahrnimmt, vor dem es die Heimat zu schützen gilt. Gemessen an der veröffentlichten und abgefragten Volksmeinung erweist sich die so heftig angegriffene schwarz-blaue Koalition in ihrem „trotz aller Enttäuschungen“ unbeirrten Festhalten am Projekt Europa fast schon wieder als vertrauenswürdiger Partner.
Nach dem Ende der Sanktionen: Europäisches Aufsichtsrecht geht in die nächste Runde
Nach Beendigung der Sanktionen ist die Freude und Erleichterung in Österreich enden wollend. Zwar fühlt man sich durch die Aufhebung der Sanktionen bestätigt, dass Österreich europäisches Unrecht angetan wurde. Zugleich beherrscht die illusionslose Einschätzung die politischen Kommentare, dass trotz rückerstatteter formeller Anerkennung als gleichwertiges, ordentliches Mitglied die Chancen Österreichs in der EU nicht zum besten stehen. Einig ist man sich, dass sich die Startbedingungen bei der anstehenden Umgestaltung Europas verschlechtert haben.
„Von der Beteiligung am künftigen Kerneuropa ist Österreich auch nach dem Sanktionsende meilenweit entfernt.“ (Standard)
Vor allem Deutschland und Frankreich beweisen mit „frostiger Diplomatie“, dass sie auf den prinzipiellen Vorbehalt gegen Österreich nicht verzichten wollen und die Supervision fortgesetzt wird. Während Österreich noch seine Exkulpation feiert, stellen Paris und Berlin bereits klar, dass der geänderte Respekt und die Zurückstufung Österreichs zum Aufsichtsobjekt aufrecht erhalten bleibt. Und für kommende Rangordnungsstreitigkeiten liegen die Titel zur Zurückweisung unbotmäßiger Nationalismen bereit.
Dennoch werden auch die Subjekte der Sanktionspolitik über die Abwicklung des „Falles Österreich“ nicht recht froh. Die Methode der Diskriminierung eines unbotmäßigen Nationalismus hat jedenfalls nicht die geforderte Unterordnung gebracht. Für die angestrebte, freiwillige Einsortierung der Nationalstaaten unter einen europäischen Supranationalismus hat sich die „Causa Austria“ nach mehrheitlicher Einschätzung der EU-Verantwortlichen als kontraproduktiv erwiesen. Nach deren vorläufiger Beendigung ist nicht die Befürwortung des europäischen Supranationalismus, sondern die Befürchtung etlicher Mitglieder gewachsen, selbst einmal dessen „Opfer“ zu werden. Insofern existiert das europäische Aufsichtsrecht auch nach seiner ersten praktischen Bewährung weiterhin, vielleicht sogar mehr als zuvor als Desiderat, dessen Verwirklichung seine nächste Bewährungsprobe bei der angepeilten EU-Organisationsreform erfährt.
Bundeskanzler Schüssel und Außenministerin Ferrero-Waldner starten derweil eine „Normalisierungsphase“, bereisen die nun für sie wieder offenen EU-Hauptstädte, veranstalten „Symposien“ und „open embassies“ und geben damit zu Protokoll, dass Österreich die Botschaft verstanden hat und auch weiterhin um seinen Status kämpfen muss. Bei einer herzig-ohnmächtigen „Charmeoffensive“ will man es freilich nicht bewenden lassen. Am Ballhausplatz sortiert man genau zwischen europäischen Rädelsführern und Staaten wie etwa Irland, die angeblich eher unwillig an dem Bannverfahren mitmachten. Man erhofft sich – wenn schon kein Bündnis, so zumindest – Absprachen zwischen den Staaten, die sich bei den angedachten Reformen zu den künftigen Verlierern zählen. Denn obwohl die derzeit verhandelte „Neuordnung der europäischen Führungsstruktur“ das allgemeine Verhältnis von Bündnishoheit und Nationalstaatssouveränität zum Thema hat: Seit die beiden wuchtigsten Nationen Frankreich und Deutschland bei dem anstehenden inneren Reformwerk in eine Führungskooperation eingetreten sind und damit das künftige Kerneuropa auch schon ein wenig vorwegnehmen, herrscht nicht nur in Wien Besorgnis darüber, dass die vorbereitete Zurückstufung des Nationalismus eine neue Hierarchie von Subjekten und Objekten der europäischen Einheit zum Ergebnis hat. Da Österreich sich im Klaren darüber ist, dass es zu den minderen Mächten in Europa zählt, bemüht es sich darum, bei der Neugestaltung der europäischen Hausordnung nicht degradiert zu werden. Gegen die drohende Bevormundung durch die großen Staaten, strebt es eine Koalition mit den anderen Kleinstaaten an, um eine „europäische Zweiklassengesellschaft“ zu verhindern.
So ist bereits eine neue Runde Rangordnungskonkurrenz unter der verschärften Bedingung einer Stärkung des supranationalen Europa eröffnet. Dass die europäischen „Brandstifter“ und die österreichischen Parias wieder in Verhandlungen eintreten, ist weder lächerlich, noch liegt ein „Schwächeanfall“ eines der Kontrahenten vor. Genau so funktionieren die Fortschritte des europäischen Bündnisses. Und für den europäischen Verfassungsschutz bleibt auch einiges zu tun: Die FPÖ hat bereits für den Wiener Wahlkampf 2001 angekündigt, den „Kampf um den Gemeindebau“ mit publikumswirksamer Aufbereitung des Ausländerthemas zu bestreiten. Und Jörg Haider bastelt für den kommenden Europawahlkampf an einer übernationalen Plattform zur Verteidigung nationaler Souveränitätsrechte und regionaler Eigenständigkeit.
[1] Die Österreicher
waren und sind auch nach den Sanktionen vehemente
Befürworter europäischer Einmischungstitel, die sie z.
B. gerne zum Ausbau ihrer Mitspracherechte und
Einmischungsbefugnisse im „Gravitationszentrum
Mitteleuropa“ – so heißen in Österreich auf
neueuropäisch die Länder der ehemaligen Donaumonarchie
– benutzen; für die erhöhte Wirkkraft der eigenen
Nation hat man sich die supranationale Ermächtigung
gewünscht, die Staaten und Regierungen auf ihre
Europareife zu überprüfen und unter diesem Titel die
Erfüllung eigener Ansprüche einzufordern. Ständig hat
Wien beklagt, dass es noch keinen europäischen
Rechtskodex zur Einmischung gibt. Was nicht heißt, dass
Österreich sich bei seiner aktiven Einmischungspolitik
etwa am Balkan durch das bedauerliche Fehlen eines
solchen hätte bremsen lassen. Warum auch – schließlich
wußte der damalige Außenminister Schüssel beim
kriegerischen Angriff auf die Souveränität Jugoslawiens
sogar den lieben Gott auf seiner Seite. „Nach meinem
Verständnis als Christdemokrat läßt sich die Position
(Krieg gegen Jugoslawien) auch auf der Grundlage der –
von der Kirche entwickelten – Lehre vom bellum
iustum
vertreten, an die offenbar auch der
Sozialdemokrat (und praktizierende anglikanische
Christ) Tony Blair anknüpft.“ (Schüssel, Informationes Theologiae Europae,
Jahrgang 8, 1999) Dass sich das europäische
Einmischungsrecht auch einmal gegen den braven
Bündnispartner richtet, hätte sich der Wolfi nicht
träumen lassen.