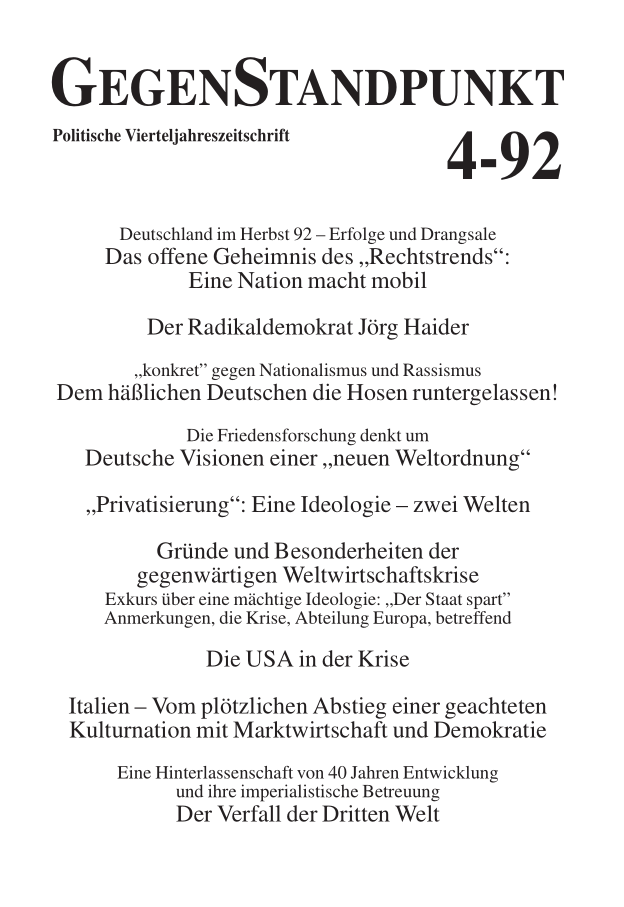Eine Hinterlassenschaft von 40 Jahren Entwicklung und ihre imperialistische Betreuung
Der Verfall der Dritten Welt
Unser heilloser „Problemfall Dritte Welt“ ist das Ergebnis von Weltmarkt und Entwicklungspolitik unter der alten Weltordnung. Der Verlust ihrer weltpolitischen Rolle und ökonomischen Benutzbarkeit führt zu einem selbstzerstörerischen Machtkampf der ortsansässigen Potentaten um die Hinterlassenschaften. Darauf richtet sich der imperialistische Anspruch auf „Demokratie und Frieden“, der sich in die Forderung nach funktionsloser Ruhe und Ordnung auflöst.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Gliederung
- I. Unser heilloser Problemfall Afrika & Co
- II. Das Ergebnis von Weltmarkt und Entwicklungspolitik unter der alten Weltordnung: erledigte Staatsprojekte in Afrika und anderswo
- III. Die Vollstreckung des Zerfalls: Der selbstzerstörerische Machtkampf der Drittwelt-Eliten
- IV. Der freiheitliche Umgang mit der Drittwelt-Hinterlassenschaft: Gleichgültigkeit und abstrakte Ordnungsansprüche
Eine Hinterlassenschaft von 40 Jahren Entwicklung und ihre imperialistische Betreuung
Der Verfall der Dritten Welt
I. Unser heilloser Problemfall Afrika & Co
Die hiesige Öffentlichkeit gibt nichts mehr auf eine Entwicklung der Länder, die sich ehemals durch hoffnungsvolle Ansätze von „Entwicklung“ – der politischen Verhältnisse, der Wirtschaft, der zivilisatorischen Umstände – auszeichnen sollten. Sie macht keinen Hehl daraus, daß sie ein solches Ansinnen inzwischen sogar für verfehlt und schädlich hält. Statt dessen tut diesen Ländern Beschränkung not, wie die Süddeutsche Zeitung stellvertretend in ihrer Serie „Zeitbombe Mensch“ ausbreitet. Sie leben nämlich längst „über ihre Verhältnisse“; nicht weil sie sich zuviel Luxus, sondern weil sie sich zuviel Bevölkerung leisten – zuviel für ihre unentwickelte Produktionsweise; zuviel für ihre kargen Landstriche; zuviel für ein Wirtschaftswachstum, für das Neger lieber „ihr Geld“ sparen, statt Kinder werfen müßten; zuviel für Staatshaushalte, die sich vornehmlich um Schuldenbedienung kümmern müssen; zuviel für die knappen Ressourcen und „unsere“ globale Umwelt.
Der Vorwurf der Verantwortungslosigkeit ist ebenso unüberhörbar wie das Verlangen, diese Länder mit ihrem Inventar hätten sich Zurückhaltung aufzuerlegen, weil sie mit ihren Massen für nichts gut sind. Umstandslos werden ganze Abteilungen der internationalen Staatenwelt mit ihren Völkerschaften unter die Rubrik Umweltbelastung eingestuft. Ausgerechnet die Millionen Slumbewohner, Hungerleider und Flüchtlinge, die in jeder Hinsicht hilflosen Betroffenen der „Weltordnung“, zählen nämlich gar nicht als Opfer, sondern als Problem und Gefahr: als Gefahr für eine globale Ordnung, deren Sachwalter in deutschen Redaktionsstuben beheimatet sind. Das zitierte Elend bebildert bloß den Standpunkt, daß Millionen nicht brauchbar, deswegen hoffnungslos zuviel und daher überflüssig und störend sind. Die gültigen Maßstäbe, an denen sich diese Elendsgestalten mit ihren nutzlosen Überlebensbemühungen blamieren, kommen allerdings nicht zur Sprache. Statt dessen werden ihre armseligen Lebensbedingungen, die so eigentümlich mit dem Reichtum kontrastieren, der anderswo beheimatet ist, wie ein Stück beschränkter Natur behandelt, dem sie sich anzupassen hätten. Dennoch, die Botschaft ist unüberhörbar: „Wohlstand“ ist ein Monopol, das den Nationen zusteht, die dazu befähigt sind; der Rest soll sich auf den Status von Armenhäusern einstellen und sich nur soviel (Menschen) leisten, wie der naturgegebene Gang unserer Weltordnung und die Rolle, die solche Landstriche darin spielen, verträgt.
Die Frankfurter Rundschau, früher einmal Anwalt eines Aufbruchs der Dritten Welt, weiß auch das Rezept, den „Teufelskreis der Armut“ zu durchbrechen: „Strenge Auflagen und Kontrollen für alle Hilfsprojekte und Zuwendungen bis hin zu einem koordinierten Eingreifen der Weltgemeinschaft“ – „einschließlich militärischer Intervention“ – „erscheinen immer mehr als einzige Alternative zu der ebenfalls vertretenen – und recht gefährlichen – Ansicht, daß man Afrika am besten völlig sich selber überläßt… Das Dogma der nationalen Souveränität und Selbstbestimmung ist damit kaum mehr zu halten.“ Furcht vor dem Vorwurf des „Neokolonialismus“ scheint der FR nicht angebracht, weil „schon jetzt Afrika zum Teil ein Protektorat der großen Geberländer, der UN und des Internationalen Währungsfonds ist, die bis zu den Details der Budgetgestaltung und der Wahlordnung die eigentlichen Entscheidungen für viele Regierungen treffen.“ Daß die Zustände dort dann wohl auch das Werk dieser weltpolitischen Aufsichtsinstanzen und nicht das Resultat von lauter Unterlassungen sind, erscheint der FR dagegen abwegig. Statt dessen führt sie Hunger und Massensterben ausgerechnet auf zuviel Respekt vor der Staatlichkeit dort zurück und plädiert mit dem Hinweis auf die imperialistische Abhängigkeit für mehr gewaltsame Aufsicht ohne Rücksicht vor nationalen Grenzen dort unten – aber mit strikter Grenzziehung hier gegen die Armenflut, die angeblich über das Mittelmeer drängt. Die einschlägigen Weltgegenden zählen nur noch als ein Stück „Umwelt“, an dem die dortigen „Menschen“ sich vergehen und dessen Schutz selbstverständlich in die Verantwortung der reichen Nationen fällt. An die ergeht der Auftrag, die Überflüssigen an die Stätten des Elends zu fesseln und die Verhältnisse dort zu überwachen.
So wird gegenwärtig in der demokratisch entwickelten Öffentlichkeit verantwortlich über das „Elend in der Dritten Welt“ nachgedacht. Und in diesem Standpunkt spiegelt sich der Erfolg von 40 Jahren Entwicklung: Eine Unzahl von Staaten, die einmal erwartungsvoll in die Unabhängigkeit aufgebrochen sind, sind zu weltpolitisch bedeutungslosen globalen Elendsvierteln geworden und werden von den unbestrittenen Machern der weltpolitischen und Weltmarkts-Entwicklung als solche betreut.
II. Das Ergebnis von Weltmarkt und Entwicklungspolitik unter der alten Weltordnung: erledigte Staatsprojekte in Afrika und anderswo
Überall das gleiche Bild: In Somalia, Mosambik, Angola, Sudan, Äthiopien, Liberia, Malawi, Ruanda, Kamerun, Afghanistan, Kambodscha… verhungern Millionen, Millionen sind auf der Flucht; bewaffnete Banden haben das Heft in der Hand; „Befreiungsfronten“ bekämpfen sich ohne Rücksicht auf die Bevölkerung; Friedensabmachungen werden ständig mißachtet; Wahlen provozieren nur neue Kämpfe; militärische Horden lassen sich nicht entwaffnen, sondern marodieren, schlachten feindliche Stammesangehörige ab, legen Städte in Schutt und Asche und verwüsten das Land; politische Führer schachern und kämpfen mit bewaffnetem Anhang um Machtpositionen in zerstörten Gebieten; das alles unter Beteiligung von auswärtigen „Friedenstruppen“, unter Betreuung durch UN-Missionen, begleitet von internationalen Friedenskonferenzen und Hungerhilfsaktionen. Mehr und mehr Mitglieder der internationalen Staatengemeinschaft mit Sitz in der UNO, einem Konto beim IWF, diplomatischen Vertretern im Ausland, Teilnehmer von Lomè- und Rohstoff-Abkommen, EG-Assoziierte und GATT-Beteiligte erfüllen nicht einmal mehr die Mindestanforderungen an Staatlichkeit: das Gewaltmonopol nach innen und ein nach außen gesichertes Territorium. Es fehlt nicht bloß an den Mitteln, sondern überhaupt am einheitlichen politischen Willen dazu. Eine auf eine nationale Politik verpflichtete anerkannte Führung, die sich zum Dienst am Staat aufgerufen fühlt, gibt es nicht. Eine politische Konkurrenz, die sich um die Verwaltung eines verbindlichen Staatszwecks dreht, sich dessen Gelingen verschreibt und dadurch die Politik voranbringt, findet nicht statt. Von einem Staatsvolk, das sich selbstbewußt auf seine Obrigkeit bezieht, weil die den rechtlich-politischen Rahmen seiner ökonomischen Betätigungen festlegt und garantiert, kann keine Rede sein: Weder ist ein Proletariat vorhanden, das geschäftsnützliche Dienste verrichtet, noch Bürger, die ihr Privateigentum „arbeiten“ lassen, noch eine Bauernschaft, die nicht bloß ackert, sondern verkäufliche Überschüsse produziert. Weil eine kapitalistische Klassengesellschaft fehlt, existiert auch kein auf Geldvermehrung ausgerichtetes nationales Wirtschaftsleben, das einen Staatshaushalt begründet.
30 Jahre nach der Entkolonialisierung ist damit erstens die einmal gepflegte Vorstellung, mit der Erreichung der politischen Unabhängigkeit hätten sich Länder auf den hoffnungsvollen Weg zu staatlichen und wirtschaftlichen Fortschritten begeben, vollständig blamiert. Das Programm, dem Vorbild der westlichen oder realsozialistischen Nationen nachzueifern, sich weltpolitisch im Rahmen der internationalen Institutionen Geltung zu verschaffen, einheimische Reichtumsquellen zu erschließen, eine nationale Industrie und heimische Märkte zu fördern und die Bevölkerung zu einem Staatsvolk zu machen, ist umfassend gescheitert. Gegenüber ihrer gegenwärtigen Lage erscheinen die Kolonialverhältnisse als vergleichsweise geordnet.
Aber nicht nur das: Eine wachsende Zahl von Ländern fällt mehr und mehr hinter den Status zurück, den sie schon einmal gehabt haben und auf den sich ihr Aufbruchidealismus gegründet hat: eine politische Zentralgewalt, die mit auswärtigem Kapital und Kredit Rohstoffvorkommen erschließen und landwirtschaftliche Produktion für den Weltmarkt fördern läßt; Städte-, Straßen- und andere Baumaßnahmen, landwirtschaftliche Aufbauprojekte, die Ausstattung einer Armee mit Waffen, der Aufbau eines Verwaltungsapparats; ein wenn auch bescheidenes Gesundheits- und Erziehungswesen; irgendwie geordnete Staatseinnahmen; ein wenn auch untergeordnetes Mitspracherecht im Kreis der Blockfreien. Was es in diese Richtung an Anstrengungen und Erfolgen zu einem staatlichen Leben gegeben haben mag, zerfällt. Und bei Ländern, die es nie soweit gebracht haben, ist ein Fortschritt in diese Richtung weniger denn je abzusehen. Statt dessen herrscht das, was bürgerliche Gemüter als „Chaos“ zu bezeichnen pflegen – die Abwesenheit von staatlicher Ordnung –, und sämtliche Lebensbedingungen werden zunehmend ruiniert.
Nach offizieller Auffassung liegt das vor allem an diesen Ländern selber. Die öffentlichen Begutachter messen diese Zustände nämlich noch immer an ihren Vorstellung von ordentlichen staatlichen Verhältnissen und blamieren sie daran: Sie machen eine verantwortliche „Elite“ aus, die den Staatswillen repräsentiert, um sie dann generell zum korrupten Haufen zu erklären, als fehlte es an deren Willen und Charaktereigenschaften und nicht an den Mitteln, die genau solche Charaktere hierzulande zu fähigen Führungspersönlichkeiten machen. Sie unterscheiden krampfhaft zwischen „rückständigen“ und „fortschrittlicheren“ Kräften und stellen dann doch meist bei beiden keine rechte nationale Verantwortung fest. Sie begrüßen demokratische Fortschritte durch Wahlen, um sie umgehend als Farce und Betrug zu entlarven. Sie machen „Rebellen“ und „Regierungen“, „reguläre Armeen“ und „bewaffnete Aufständische“ aus, und entdecken dann bei beiden keine wesentlichen Unterschiede mehr. Sie bilanzieren ein „ständig sinkendes Bruttosozialprodukt“, um dann bei lauter Hunger und Elend das Fehlen eines ordentlichen Staatshaushalts zu beklagen. Sie begutachten die „staatliche Ordnung“ und stoßen allenthalben nur auf Anarchie. Kurz: Diese Staaten vergehen sich an allen Anforderungen, die hiesige Staatspropagandisten für vernünftig und passend halten. Immer weiß die hiesige Öffentlichkeit Schuldige vor Ort, die dafür verantwortlich sind: nicht selten Diktatoren; nicht selten fehlt aber auch eine starke Hand. Zur Erklärung der chaotischen Zustände bemüht sie dann eher die längst überholte Vorgeschichte dieser Länder und den unverbesserlichen Charakter ihrer Völkerschaften als die wirklich bestimmende Geschichte ihrer imperialistischen Umwälzung.
Dabei liegt die Wahrheit umgekehrt. Wenn jedes Moment von Staatlichkeit, ja selbst jeder Anschein eines irgendwie geordneten politischen Gemeinwesens so gründlich zerfällt, dann gab es die nationalstaatlich funktionierenden Herrschaftsverhältnisse nie, an denen sie gemessen werden; dann waren diese Länder auch nie auf dem Weg dahin. Ihre Souveränität war bloß formell und bildete gar nicht die wahre Grundlage für ihre staatlichen Ambitionen und was daraus geworden ist. Das, was sich dort an Staatsräson und politischem Leben ausgebildet hat, was sich an Geld und Kredit angesammelt hat oder ausgegeben wurde, was an politischer Stabilität oder Instabilität geherrscht hat, und was an politischen Figuren und Programmen hervorgetreten ist, ist durch die Rolle bestimmt, die diese Länder für auswärtige Kredit- und Waffengeber und deren Berechnungen gespielt haben. Die haben gründlich dafür gesorgt, daß diese Länder erst gar nicht die Chance bekommen haben, sich zu fertigen Staatswesen hinzuentwickeln. Deren wirkliche Geschichte ist die ihrer Abhängigkeit von politischen und ökonomischen Interessen auswärtiger Mächte. Das ist auch der Grund für ihren Zerfall. Ihre Rolle hat sich geändert und garantiert ihnen nicht einmal mehr die elementarste staatliche Ausstattung. Das liegt erstens nicht an einem Mangel an Entwicklung, sondern daran, daß ihre Entwicklung zuende ist. Das liegt zweitens nicht an einem Mangel an Demokratie und Marktwirtschaft, sondern am Verschwinden der weltpolitischen Alternative Realer Sozialismus.
Die fertige Entwicklung der Drittwelt zu einem Anhängsel der Weltmarktnationen
Die Dritte Welt ist fertig, fertig eingerichtet für ökonomische Zuträgerdienste für eine nationale Akkumulation von Reichtum anderswo. Fertig auch mit der Entwurzelung und Verelendung ihrer Bevölkerungsmehrheit, die zu diesen Diensten gar nichts beiträgt, sondern – vom Standpunkt eines nationalen Haushalts aus betrachtet – größtenteils eine pure ökonomische Belastung ist. Mit Staatskrediten, dem Kapitaleinsatz von Multis und entsprechenden Importregelungen hat der Westen in diesen Ländern die agrarische Produktion und die Rohstoffgewinnung entwickelt, die der Weltmarkt braucht und für die diese Länder qua Natur geeignet, aber aus eigener Kraft gar nicht fähig waren. Der Mangel an weltmarktfähigen Angeboten und Alternativen hat diese souverän gewordenen Länder für ihre Einnahmen und Ausgaben ganz auf den Anbau von Kaffee, Nüssen, Tee, Kakao, Ölsaaten, Kautschuk oder den Abbau von Kupfer und anderen zufällig vorhandenen Rohstoffen verwiesen. Mit auswärtigen Krediten, Firmen und Beteiligungen sind die Plantagen und Förderstätten samt den notwendigen Infrastrukturen auf- und ausgebaut und soweit erforderlich die Landstriche umgekrempelt worden, so daß solche Ländern vollständig davon abhängig sind, welches Angebot sie damit für das industrielle Wachstum andernorts darstellen. Umgekehrt haben sich die Nachfrager, die mit Kapital und Kredit selber für das Zustandekommen des Angebots gesorgt haben, durch die Diversifikation der Anbieterländer, durch die reichliche Erschließung von Vorkommen und die Ausweitung der monokulturellen Produktion von bestimmten nationalen Lieferanten unabhängig gemacht. Alles Erforderliche an Grundstoffen für die Konjunkturbedürfnisse kapitalistischer Industrie und Lebensmittelherstellung ist reichlich vorhanden samt Transportwegen und anderer Infrastruktur.
Den Anbietern hat diese Entwicklung das Druckmittel genommen, ihr Angebot für sich zu nutzen und lohnende Preise durchzusetzen. Die Preise für die stets zu reichlich angebotenen Güter sind gefallen, und die Exporteure sind laufend gezwungen, ihr Angebot zu vermehren und damit die Preise weiter zu verderben. Es sei denn, sie verzichten auf Einnahmen, um den Preis durch ein knapperes Angebot zu halten. Das ist allerdings für Staaten, die ihre Wirtschaftseinkünfte zu 90% und mehr aus solchen Exporten bestreiten, keine frei handhabbare Alternative. Diverse Abkommen, in denen die Preise stabilisiert und Angebotsmengen geregelt werden sollen, beweisen die Notwendigkeit einer politischen Korrektur dieses Weltmarktgesetzes, damit es überhaupt dauerhaft wirken kann; die laufende Neuverhandlung, Umgehung und das Scheitern solcher Abkommen zeigen andererseits die Grenzen, die diesen Korrekturen gezogen sind. Selbst die OPEC, der Ausnahmefall eines Rohstoffkartells für einen wachsend nachgefragten elementaren Grundstoff jeder industriellen Produktion, ist ein einziger Kampf um eine Begrenzung der Fördermengen, die dann doch immer nicht wirklich gelingt. Erst recht die mit weniger nachgefragten Gütern ausgestatteten Rohstoff- und Agrarländer merken an den beschränkten und tendentiell immer sinkenden Erträgen, daß ihr Staatsreichtum sich nur aus unbeeinflußbaren Anteilen am Erfolg kapitalistischer Produktion woanders und den dafür unternommenen auswärtigen Anstrengungen speist und keine ausreichende Grundlage für die Finanzierung selbst ihrer bescheidenen Staatsnotwendigkeiten und -vorhaben ist. Über das, was sie sich leisten können, entscheidet in erster Linie der Zufall, welches Angebot ihnen die Laune der Natur und des Klimas beschert hat und wieviel an überzähligen Massen sich unter den weltmarktorientierten Umstellungen im Land noch durchschlagen. In zweiter Linie entscheidet das Marktgesetz, daß da, wo der Nachfrager das Angebot bestimmt, der Preis sinkt.
Eine ganze Zeit hat sich freilich das Interesse der weltwirtschaftlichen Hauptmächte mit den Entwicklungsambitionen einheimischer Politiker trügerisch getroffen. Solange der Westen diese Staaten für die Bereitstellung von Akkumulationsvoraussetzungen erst noch befähigen mußte, wurden die entsprechenden Projekte, Kredite und politischen Kontakte mit viel Respekt vor den Entwicklungszielen der „Drittwelt-Partnerstaaten“ garniert, auch wenn beides von Anfang an gar nicht zusammenpaßte. Während die Geldgeber aus den Heimatländern des Kapitals mit der Errichtung von Hafenanlagen, Stromwerken und Straßen, mit der Vorfinanzierung von Preisstabilisierungsfonds und sonstiger finanzieller und militärischer Unterstützung diese Länder zu verläßlichen Rohstofflieferanten ausbauten, versuchten die dortigen Politiker daraus ein Stück nachholender Industrialisierung und allgemeiner nationaler Wirtschaftsentwicklung und damit Souveränität zu schmieden, die sie an ihren Vorbildern aus dem Norden bewunderten. Manchen besonders begünstigten Ländern ist zwar die Errichtung von Stahlwerken und einigen anderen Weiterverarbeitungsbetrieben gelungen, nicht aber die Herstellung von Profit. Mit ihrer Entwicklung sind statt ihrer Reichtumsquellen nur ihre Schulden gewachsen, so daß eine Menge Länder mit ihren paar Angeboten im Grund vollständig verpfändet sind und ihre Einnahmen größtenteils im Schuldendienst aufzehren. Das zeigt, daß die Kredite schon als Kapital taugen, bloß nicht bei ihnen, sondern bei ihren Gebern. Für sie selber haben alle Vorhaben nur die Abhängigkeit von den paar weltmarktfähigen Rohprodukten verschärft. Mit dem Fortschritt dieser eigentümlichen Partnerschaft stellen sich für die Entwicklungsländer Investitionen und Kredite mehr und mehr als eine Existenznotwendigkeit dar, um auch nur das elementarste politische Leben aufrechtzuerhalten und die Lasten zu bewältigen, zu denen sich ihre Aufbauvorhaben und die überzählige Bevölkerung mit ihren negativ veränderten Lebensbedingungen ausgewachsen haben. Mehr und mehr tritt daher auch für die begünstigteren Länder an die Stelle großartiger Entwicklungsprojekte der pure Raubbau am eigenen Land und die verzweifelte Suche nach einer Nachfrage – für Müllablagerung, Tourismus und anderes –, die sie bedienen könnten. Eine Großzahl von Ländern ist wegen des Mangels an brauchbaren Naturstoffen von Haus aus nicht in den Genuß einer solchen Entwicklung gekommen, sondern hat sich – in die Selbständigkeit entlassen – von dem finanzieren müssen, was ihre politische Betreuung dem Westen oder auch dem Osten an Waffen- und anderen -„hilfen“ wert war.
Für die andere Seite dagegen stellen sich Investitionen und Aufbaukredite in der Dritten Welt immer mehr als überflüssig und nicht lohnend dar. Weltwirtschaftlich gesehen wären sie reine Fehlinvestitionen, da von diesen Handelspartnern kein weiterer lohnender Beitrag zum Wirtschaftswachstum zu erwarten ist. Selten erreichen sie die ersten Stufen der Weiterverarbeitung ihrer Naturprodukte, noch seltener sind sie konkurrenzfähige Landwirtschaftsexporteure, geschweige denn als solche zugelassen; und sowenig wie eh und je verfügen sie über einen inneren Markt, auf dem die Exporteure der kapitalistischen Länder wachsende Warenberge absetzen und versilbern könnten. Dabei sind die Umstände, auf die es dem Westen ankommt, allemal gesichert: die Rohstoffbörsen, die sowieso nicht dort, sondern in den Zentren des Weltmarkts angesiedelt sind, werden reichlich beliefert. Seit das feststeht, haben auch die „Entwicklungshilfe“kredite ihren Charakter geändert: Sie dienen nur noch der Aufrechterhaltung dieser geregelten Abhängigkeiten, zur laufenden Prolongierung des Schuldendienstes und zur mehr symbolischen Unterstützung der paar Projekte, irgendeinen Ersatz für die längst zerstörte Subsistenzwirtschaft der einheimischen Bevölkerung zu schaffen. Deswegen nehmen im Gegensatz zu den Schulden die „Entwicklungshilfen“ ab, so daß der Schuldendienst inzwischen das übersteigt, was diese Länder an Neukrediten erhalten.
Seitdem die Weltwirtschaftsnationen den Entwicklungsambitionen keine Funktion mehr für sich zubilligen, entdecken sie den Gegensatz zwischen dem selbstsüchtigen und verschwenderischen Gebaren einer korrupten Führungsschicht und den berechtigten Ansprüchen von Völkern auf ein, wenn auch bescheidenes Allgemeinwohl in Form ihres Überlebens. Auf einmal bekommt die alte linke Kritik an den „Kompradoren-Regimen“, die heute gar nicht mehr vertreten wird, vom CSU-Entwicklungshilfe-Minister recht, der wie eh und je vor Ort mit den Führungsfiguren diplomatisch verkehrt: Dort, wo Investitionen nicht zu Exporterfolgen und Staatseinkünften führen, dienen sie nur als Pfründe der Mächtigen und zur Bestechung ihres Anhangs; Reichtum ist nur dort ein Dienst an den Armen, wo er sich kapitalistisch vermehrt, dort aber immer!
Der Mann hat gut reden. Dort, in den weltwirtschaftlichen Vorbildnationen ist es zwar auch so, daß der Besitz der Macht Zugang zum privaten Reichtum eröffnet; aber das ist dort rechtens und kein bißchen anrüchig, schon gar nicht wegen der Armen im Lande – dort rechtfertigt der Staatserfolg die private Teilhabe. Wo aber der Staatsapparat gar keine international lohnenden Privatgeschäfte in Bewegung setzt, da sieht es auch mit dem Verhältnis zwischen staatlichem und Privatinteresse der Machthaber anders aus: Einerseits lassen sie sich nicht voneinander trennen; andererseits rechtfertigt sich der private Zugriff deshalb auch nie durch die Erfolge nationalen Wachstums und staatlicher Macht. Die private Bereicherung ist nämlich gar kein – letztlich bescheidener – Anteil an der Vermehrung des öffentlichen Reichtums, sondern persönlicher Zugriff auf die begrenzten und gar nicht vermehrungsfähigen Staatseinkünfte, die gar nicht geeignet sind, einen ganzen Staat oder auch nur all seine Träger standesgemäß zu erhalten. Ausgerechnet diese Verhältnisse, die so überhaupt nicht zu den Grundsätzen eines demokratischen Rechtsstaats bezüglich der erlaubten, geduldeten und verbotenen Einkünfte seiner Staatsdiener passen, werden von den Kritikern völlig unter den hierzulande gültigen Verhaltenskodex subsumiert: Sie entdecken da, wo von einer funktionierenden Trennung von Amt und Person und von einer mit reichlichen Haupt- und Nebeneinkünften gesicherten Loyalität gegenüber den höheren Aufgaben keine Rede sein kann, lauter Mißbrauch der Ämter für staatsschädigende Privatinteressen, also allgemeine Korruption. Eine Anklage wird aus dem Vorwurf der Korruption allerdings erst, seitdem die Gläubiger aus dem Norden keine Notwendigkeit mehr sehen, die Dienste vor Ort zu sichern – nicht zuletzt mit goldenen Badewannen und anderem Staatsluxus für die örtlichen Herrschaftsfiguren. Die Wahrheit ist, daß sich jetzt, nachdem das Interesse der westlichen Kreditgeber erloschen ist, zeigt, wie wenig die Funktion der Drittweltländer für den Weltmarkt dafür taugt, das Bedürfnis nach Staatlichkeit zu befriedigen. Einmal hergestellt, bleiben für diese Länder nur ein ständig wachsendes Mißverhältnis von Einnahmen und Schulden, die mehr oder weniger ersatzlose Zerschlagung der alten naturverhafteten Mittel der Reproduktion der Massen – und lauter unbefriedigte politische Ambitionen und Ansprüche auf den mageren Reichtum an Geld und Waffen, der an den politischen Funktionen hängt und hängen bleibt.
Die Dritte Welt ohne die Zweite: Der Verlust einer zwiespältigen weltpolitischen Rolle
Mit der Abdankung der alternativen Weltmacht ist auch die politische Bedeutung der Dritten Welt verlorengegangen und damit eine Entwicklung zuendegegangen. Die Auseinandersetzung der weltpolitischen Blöcke um politische und strategische Positionen auf dem ganzen Globus war für das Regime mancher Drittweltstaaten, auch wenn sie sonst gar nichts zu bieten hatten, eine gewisse Überlebensgrundlage; für die Verwalter bedeutsamer Ressourcen sogar ein Stück größerer Freiheit beim Beanspruchen von Kredithilfen und Waffenunterstützung. Der Westen wollte auch ökonomisch völlig uninteressante Regionen durch ihm passende Herrschaften gesichert wissen: Ein verläßliches Regime sollte sich dort halten gegen alle – letztlich von der feindlichen Weltmacht ausgerüsteten – inneren Gegner und Nachbarn. Wenn sonst für nichts, so war das dafür gut, daß sich die Russen dort keine Stützpunkte bilden konnten. Und weil diese Regime von sich aus die Potenzen für ihre Behauptung gar nicht mitbrachten, galt es, sie, was Armee und Waffen angeht, zu „entwickeln“.
Das jetzt vielbeklagte Somalia z.B. wurde vom Westen für den Frontwechsel geschätzt, den Siad Barre – nicht zuletzt im Rahmen deutscher Terrorismusbekämpfung in Mogadischu – vollzog. Daß am strategisch wichtigen Horn von Afrika neben dem zur Sowjetunion umgeschwenkten Äthiopien ein vorher unter Moskauer Einfluß stehendes Land sich postwendend zum Statthalter westlicher strategischer Interessen entwickelte, war die ganze materielle Basis der Barre-Herrschaft. Solange er am Eingang des Roten Meeres ein strategisches Gegengewicht gegen sowjetische Stützpunkte bildete, war es nicht weiter störend, wie er im eigenen Land regierte, daß er sich nur auf seine Sippe stützte, andere Stämme von öffentlichen Ämtern und Pfründen fernhielt und sich nur durch den Terror an der Macht hielt, den ihm die westliche Unterstützung erlaubte. Kaum war nach dem Ende der Sowjetunion das Interesse an dieser weltpolitischen Aufgabe erloschen, blieben auch die Mittel aus, mit denen Barre sich behauptet hatte. An den jetzigen Kämpfen der verschiedensten Stämme und Banden und am Massenelend zeigt sich seitdem in aller Brutalität, daß dieser weltpolitische Dienst das Land nicht gefestigt und das Überleben der Bevölkerung in keiner Weise gesichert hat. Er hat bloß jahrelang die Auseinandersetzungen in eine Richtung hin entschieden und ein Stück Gewaltmonopol von außen aufrechterhalten. Mehr war vom Westen auch nicht beabsichtigt.
Umgekehrt, umgekehrt. Die Konsolidierung von Staaten, die sich in der Ost-West-Konkurrenz, egal aus welchen Gründen, von der Anlehnung an den Osten mehr Selbständigkeit erhofften, wurde zielstrebig von außen torpediert. In zahlreichen Fällen hat der freie Westen für dauerhafte „Bürgerkriege“ gegen eine ihm nicht genehme politische Führung gesorgt. Nicht genehm, weil sie durch ihre Beziehungen zu Moskau und Cuba dem westlichen Anspruch auf eine von ihm abhängige, antisowjetische Drittwelt widersprach. Jetzt, wo die Sowjetunion abgetreten ist, zeigt sich, daß das westliche Interesse an den diversen „Befreiungsbewegungen“ rein negativ auf die Zerstörung jedes Ansatzes von staatlichem Leben gerichtet war. Die an Moskau orientierten nationalen Bewegungen waren nämlich letztlich die einzigen, die sich nationale Unabhängigkeit, den Aufbau eines Staatswesens, dessen Tätigwerden im Dienste der Bevölkerung in Form von Schulen, Gesundheitsdienst, Rechten für Frauen usw. und damit die Verwandlung der vorstaatlichen Massen in ein nationales Volk zum Programm gemacht hatten. Mit all dem wußten sie sich sehr zurecht bei Moskau besser aufgehoben. In Afghanistan, Mosambik, Angola, Äthiopien und Kambodscha, um nur die aktuell verhandelten „Problemfälle“ zu nennen, hat der Westen gegen solche Bemühungen gerichtete Aufstände aufgestachelt, ausgestattet und für seinen Kampf gegen die sowjetische Weltmachtposition instrumentalisiert ohne irgendein Interesse an den eigenen Zielen und Programmen dieser „Freiheitskämpfer“. Es ging nicht um die Etablierung einer anderen oder überhaupt einer Staatsräson, sondern darum, die angestrebte Ordnung nicht aufkommen zu lassen.
Das hat der Westen nur zu gut erreicht. Überall fanden sich dafür die passenden Generäle, enttäuschten Stammesführer, abgehalfterten Exilfiguren mit irgendwelchen Machtansprüchen und die mit wenig Ausstattung kriegs- und begeisterungsfähigen Anhängerscharen, die sich dem Versuch gewaltsam widersetzten, so etwas wie eine einheitliche Herrschaft mit einem Staatsvolk durchzusetzen. Das hat die sozialistischen oder auch bloß gesamtstaatlich denkenden Regierungen in einen endlosen und dank des auswärtigen Nachschubs nicht gewinnbaren Überlebenskampf gezwungen und nicht nur jeden Ansatz zum normalen Regieren sondern ihre Länder vollständig ruiniert. Mit dem ganz woanders errungenen Sieg des Westens sind diese Aufgaben und damit die westliche Unterstützung hinfällig geworden. Ihre verheerenden Wirkungen sind es nicht.
III. Die Vollstreckung des Zerfalls: Der selbstzerstörerische Machtkampf der Drittwelt-Eliten
Was gegenwärtig Anlaß für die öffentlichen Klagen über die Unvernunft solcher Länder und die Unhaltbarkeit der jetzigen Zustände ist, ist also einerseits nur die Hinterlassenschaft von vierzig Jahren erfolgreicher Weltmarkteinbindung und erfolgreicher Unterordnung unter westliche Weltpolitik. Die Züge von Elend und Gewalt sind so neu ja auch gar nicht. Der rückblickende Schein, als sei der Weltmarkt und das strategische Interesse eine Chance gewesen, täuscht. Jetzt erfahren alle, Rohstofflieferanten wie totale Habenichtse, immer schon verbündete oder längst verständigungswillige Länder, Regierungen und Rebellen, daß sich für keinen seine Rolle wirklich ausgezahlt hat. Die einen sind mit ihren Weltmarktsangeboten nicht reich, sondern abhängig und immer unwichtiger geworden. Die anderen hatten in diese Richtung erst gar nichts vorzuweisen. Die einen haben sich als strategische Posten keine Sicherheit erworben, die anderen ließ man erst gar nicht zur Ruhe kommen. Und alle bekommen jetzt zusätzlich den Entzug an westlicher Aufmerksamkeit – finanziell, militärisch und politisch – zu spüren, den die inzwischen gesicherten Weltmarktdienste und die erledigte weltpolitische Konkurrenz mit sich bringt. Was neu ist, das ist also die Funktionslosigkeit dieser Zustände für die Weltmarkts- und Weltordnungsmacher.
Das läßt diese Länder nicht zur Ruhe kommen, sondern befördert ihren weiteren Zerfall – und zwar völlig unabhängig von den positiven oder negativen Rechnungen, die der Westen bisher mit ihnen angestellt hat. In Afghanistan, Äthiopien, Angola, Mosambik, Kambodscha gehen nun die Auseinandersetzungen und Kämpfe ohne „kommunistischen“ Gegner zwischen den Stämmen, Führungsfiguren und ihren Milizen und Armeen umso erbitterter weiter. In Somalia, Liberia und anderswo wird mit wechselnden Koalitionen und jeder gegen jeden gleich ganz ohne irgendeine antiwestliche Erblast gestritten. So wenig es noch um irgendeine weltpolitische oder ideologische Ausrichtung geht, so wenig allerdings auch um eine einheitliche politische Souveränität über das Land. Es geht um die Kontrolle von Machtpositionen, von möglichst viel Gelände, Lebensmitteln und Waffen, mit denen sich Anhang und Position halten lassen und verhindert werden kann, daß sich irgendeine gegnerische Mannschaft durchsetzt. Die Zielgerichtetheit eines Kampfs um die Hoheit über Land und Leute, deren friedliche Verwaltung dann einen Staat erhält und voranbringt, ist nicht zu entdecken. Statt dessen ist das, was bei normalen Kriegen Begleitumstand oder Mittel zum Zweck ist – Zerstörung, Raub, Plünderung, Terrorisierung und Vertreibung der Bevölkerung –, schon der halbe Zweck: Vernichtung der feindlichen Konkurrenten und ihres Anhangs.
Dadurch werden alle Bemühungen, eine gefestigte politische Einheit herzustellen und auf loyale Staatsbürger zu gründen, endgültig zunichte gemacht. Jetzt bricht sich bei den Kämpfenden ein Fanatismus Bahn, der sich auf alte Stammesbande und ähnliche vorstaatliche Zusammenhänge stützt. Beseitigt und überwunden waren die nämlich nie wirklich, obwohl sie weder zum Programm noch zum Ehrgeiz der Aufbruchpolitiker gepaßt haben. Die haben mit Einheitsparteien und Erziehungsprogrammen ein nationales politisches Leben und Denken zu stiften versucht. Sie haben nationale Traditionen und Grundsätze erfunden und propagiert, die der nach ganz anderen Gesichtspunkten organisierten und denkenden Bevölkerung den selbständig gewordenen Staat nahebringen sollten, auch wenn durch den keine einzige entscheidende Bedingung ihres materiellen Lebens geregelt und gesichert worden ist und umgekehrt mit ihrer produktiven Betätigung gar kein Staatsreichtum zustandezubringen war. Jetzt stellt sich heraus, daß das Vorhaben, bisherige vorstaatliche Lebens- und Denkweisen zugunsten eines Gesamtstaates zu ersetzen, nie darüber hinausgekommen ist, diese überkommenen Interessen und Anschauungen zu relativieren und für ein nationalstaatliches Gründungsprogramm notdürftig zu instrumentalisieren. Das ist nie ohne größere Auseinandersetzungen und Konkurrenz unter den politischen Anwärtern und ohne Halbheiten und Gleichgültigkeit gegenüber den Vorstellungen und Verhaltensweisen der Bevölkerung abgegangen. Die Einheitsparteien waren meistens doch mehr oder weniger stammesmäßig sortiert, die Führungen haben sich auf bestimmte ethnische Gruppen als ihre bevorzugte Basis gestützt, sie dementsprechend agitiert und alternative Stammesansprüche entweder bekämpft oder ein Stück weit in den Herrschaftsapparat eingebaut und damit doch nur halbwegs zufriedengestellt. In dem Augenblick, wo diese aus den Zeiten des Aufbruchs stammenden Anstrengungen und Ansätze wegen der immer schwierigeren Lage dieser Länder mehr und mehr unterbleiben und zerbrechen, treten auch die nie überwundenen Züge ihrer traditionellen „Bindungen“ und „Eigentümlichkeiten“ mit aller Gewalt neu hervor.
Mit einem Rückfall in die atavistischen Bräuche vormoderner Stammeskämpfe sind die aktuellen Szenarien von Gewalt und Zerstörung gleichwohl nicht zu erklären. Das vernichtende Urteil, daß Afrika und ähnliche unzivilisierte Landstriche letztlich doch nicht für unsere Demokratie reif sind, fällt der Öffentlichkeit ja auch erst ein, seit sie bei den (vormaligen „Freiheits“-)Kämpfern die für unsere Weltordnungsanstrengungen nützlichen Aspekte nicht mehr entdecken kann. Dabei tragen diese seitdem „sinnlosen“ Streitigkeiten alle Züge einer zivilisatorischen Errungenschaft, allerdings rein negativ:
– Das Erbe der jüngsten Vergangenheit besteht in reichlich Material aus den Waffenfabriken der zivilisierten Nationen. Sie verschaffen den Auseinandersetzungen eine mit früher unvergleichliche Durchschlags- und Zerstörungskraft. Ein Vorwurf an die eigene Adresse wird aus der öffentlichen Feststellung, daß da mehrheitlich vom Westen gesponsorte und ausgerüstete Mannschaften sich abschlachten, nicht. Vielmehr der Antrag, daß solches Gerät unter die Kontrolle der Lieferanten gehört.
– Das staatliche Gewaltmonopol ist stets präsent, wenn auch meist nur noch in der Form, daß sich stets genug Streitparteien gegen die gerade stärkste finden, um dafür zu sorgen, daß es sich nicht unbestritten etabliert. In Afghanistan kämpfen wechselnde Koalitionen um die „Hauptstadt“ Kabul nicht, um von dort das ganze Land wieder einer einheitsstiftenden Staatsräson zu unterwerfen, sondern um eine Vormachtstellung zu erringen und die Konkurrenten zu erledigen. Anderswo gehen die verschiedenen Gruppen in der gleichen gewalttätigen Weise gegeneinander vor und schlachten sich nach Kräften ab, um die feindlichen Stämme und Sippen nach Möglichkeit zu dezimieren und mit gebührendem Terror kleinzumachen. Dabei wird manche „alte Rechnung“ beglichen; „althergebracht“ ist dieser Machtkampf dennoch nicht. Es sind eben nicht mehr nomadisierende Sippen und Stammesverbände, die an ihren traditionellen Grenzen aufeinander losgehen – mögen sich auch Verbände und Führer nach solchen Gesichtspunkten sortieren; es sind Militärverbände und bewaffnete Banden, die sich um die Herrschaft über wichtige Städte und über möglichst umfangreiche Gebiete schlagen, in denen sie dann das Sagen haben. Wenn es geht, möchten sie darüber allerdings schon konkurrenzlos werden. Schließlich wissen sie nur zu gut, daß die Eroberung staatlicher Machtpositionen am ehesten den Zugang zu ihrem entscheidenden Konkurrenzmittel, den Waffen, eröffnet.
– Weltpolitische Perspektiven haben sie nämlich durchaus. Als gelehrige Schüler der erfolgreichen Mächte wissen sie, worauf es ankommt. Die Anerkennung durch die Staatenwelt wollen sich die Mächtigeren unter ihnen sichern, auch wenn sie alles andere als Staat machen wollen. Sie suchen durch die Eroberung des Landes den Status nationaler Repräsentanten zu erringen, weil ihnen das unabhängig von ihren inneren Verhältnissen einen gewissen auswärtigen Rückhalt sichert.
– Um modernen Reichtum geht es auch: um den Zugriff der eigenen Mannschaft auf die Reste des von außen kommenden Reichtums – sei es auch nur in der Form von Hungerhilfe und Waffen. Weil die Zuwendungen in den meisten Fällen nicht mehr oder sowieso nie ausreichen, um eine Monopolgewalt aufrechtzuerhalten, kommt allerdings selten mehr zustande, als daß sich die verschiedenen Anwärter umso erbitterter bekriegen und darauf angewiesen sind, sich durch Plündern, durch Umwidmen von Hilfslieferungen oder durch die Unterstützung angrenzender Staaten zu „finanzieren“. Produziert wird schließlich weniger denn je, schon gar keine Überschüsse.
– Auch das ist nämlich ein durchaus zeitgemäßer Zug, daß die Gebiete, in denen jetzt Machtkämpfe wüten, längst ihrer alten Lebensform und Lebensmittel beraubt sind. Und das nicht nur dort, wo der westlich gesponsorte Kampf „Freiheit statt Sozialismus“ keinen Stein auf dem anderen gelassen hat, sondern auch in manchen Vorbildern friedlicher Entkolonialisierung nach westlichem Idealzuschnitt. Z.B. in der schwarzdemokratisch verwalteten Kautschukplantage Liberia, die nach dem weitgehenden Versiegen ihrer Einnahmequelle prompt in „Anarchie“ verfällt. Mit der Not der politischen Konkurrenten wächst auch die Rücksichtslosigkeit gegenüber den Massen. Das ergibt das ganz und gar zeitgemäße Szenario von Massakern, Hungersnöten und Flüchtlingströmen nie gekannten Ausmaßes, die in Afrika und auch anderswo dermaßen zur Normalität geworden sind, daß nicht einmal mehr die Moralisten im Westen die üblichen Gewissensbisse kriegen. Die Frage, warum im Zugriffsbereich von Weltwirtschaft und Weltpolitik und mit tatkräftiger Beteiligung ihrer alten Protegès solche Dauer„katastrophen“ an der Tagesordnung sind, kommt nicht auf. Vielmehr wird darauf gedrungen, endlich für Ordnung zu sorgen, als ob es nicht längst „unsere“ Ordnung wäre, die sich da unten austobt.
IV. Der freiheitliche Umgang mit der Drittwelt-Hinterlassenschaft: Gleichgültigkeit und abstrakte Ordnungsansprüche
Dabei stellen diese Verhältnisse entgegen allen anderslautenden Beschwerden über drohende Katastrophen und zunehmende Anarchie gar kein dringliches Weltordnungsproblem dar. Schon gar nicht die hungernden Massen. Die haben sowieso noch nie weiter gestört, weil sie keine Rolle im Nutzenkalkül des Westens gespielt haben; die Belastungen, die sie allenfalls darstellen, fallen mit der errungenen Selbständigkeit in die örtliche Zuständigkeit und bleiben dort auch territorialisiert. Der Westen läßt sich für ihre Betreuung höchstens vom UN-Generalsekretär wie jetzt in Somalia zu symbolischen Gesten der Verantwortung aufrufen und schickt Hilfskonvois oder wirft Pakete ab, wobei ihm der Verbleib solcher Hilfe schon wieder ziemlich gleichgültig ist. Die Massen im benachbarten Sudan und zehn anderen ähnlich gelagerten Fällen werden gleichzeitig ungerührt ihrem Schicksal überlassen. Es fehlt nämlich der Stachel der weltpolitischen Konkurrenzlage, der humanitäre Aktionen einmal zu brauchbaren politischen Systemdemonstrationen und sogar Eingreifinstrumenten gemacht hat – gegenüber moskaufreundlichen Armenhäusern, die man oft vorher selber mit der Unterstützung von Befreiungskämpfern zu solchen gemacht hatte; oder gegenüber Elendsregionen des eigenen Lagers, denen man Betreuung zukommen ließ, um die eigene Zuständigkeit zu bekräftigen und dem anderen System keine Handhabe zu bieten. Jetzt hat diese Hilfe, die nie satt gemacht, geschweige denn die Ernährungsbedingungen verbessert hat, nur noch einen abstrakten symbolischen Charakter – und fällt entsprechend willkürlich aus: Die Weltgemeinschaft der entscheidenden Staaten unterstreicht, daß ihr unter dem Gesichtspunkt geordneter Verhältnisse überall die Millionen, die nicht einmal mehr dahinvegetieren können, nicht gleichgültig sind. Damit sind sie es dann endgültig. Sie bringen keine regionale Ordnung durcheinander, auf die es ankäme. Nützlich für die Vorführung der eigenen Allzuständigkeit sind sie auch nicht mehr, weil die sowieso feststeht.
Auch der Zerfall der Staatsprojekte läßt den Westen erst einmal unberührt. Mehr denn je zeigt sich, daß das Projekt Staat in der Dritten Welt einerseits rein auf dem Willen einer politischen Minderheit vor Ort beruht hat; daß andererseits das Interesse des Westen an einer quasistaatlichen Ordnung nur soweit reicht, wie es auf die Einrichtung und Garantie verläßlicher Dienste ankommt. Wo diese Dienste gesichert sind – im dringlichen Fall mit eigener Präsenz an strategischen Stellen, mit eigener Ersatzhoheit über Ölfelder, mit der Sicherung von Bahnlinien durch lokale Stellvertreter usw. –, oder wo diese Dienste nicht oder nicht mehr gefragt sind, weil ein berücksichtigenswerter alternativer Einfluß nicht droht, braucht es nicht einmal mehr sichere Ansprechpartner vor Ort; geschweige denn ein Gewaltmonopol, das doch nur mit westlichen Anstrengungen gegen alle Beteiligten aufrechtzuerhalten ginge. Insofern stehen die Wächter der Weltordnung den ehemaligen Funktionsträgern und deren konkurrierenden Ansprüchen, die unter der neuen westlichen Enthaltsamkeit leiden, ebenfalls ziemlich gleichgültig gegenüber.
Der Ruf nach Demokratie und Frieden…
Das heißt aber nicht, daß sie sie auf sich beruhen ließen. Seit neuestem setzt der Westen die Drittweltländer unter den Anspruch, sie müßten demokratische Verhältnisse einführen und inneren Frieden schließen. Das betrifft vor allem die sich bekriegenden Mannschaften, aber auch fest regierende Figuren, die die freie Welt mit ihren Gepflogenheiten, Unruhen und Konkurrenz zu unterdrücken und das Land mit einer „Einparteien“-Regierung im Griff zu halten, ewig nicht gestört haben. Man gibt sich heute erleichtert, auf einen gewissen „Opportunismus“ im Umgang mit solchen Figuren, die auch von der Gegenseite umworben wurden, nicht mehr angewiesen zu sein und endlich auf den ureigensten Herrschaftsprinzipien beharren zu können – immerhin ein schönes Eingeständnis über die Reihenfolge von Gefolgschaftstreue und Regierungsweise.
Einerseits ist dieses Verlangen reine ideologische Propaganda: Sie wirft den gescheiterten Staatsprojekten vor, daß sie nicht auf Zustimmung, sondern nur auf die Gewalt von Polizei und Militär sowie auf einen eigenen Klüngel gegründet waren. Der Korruptionsvorwurf wird damit prinzipiell und herrschaftsmethodisch. Dabei paßt der Ruf nach Demokratie weder zum bisherigen Umgang des Westens mit solchen Ländern noch zu den Verhältnissen dort. Abgesehen davon, daß hungernde Massen andere Sorgen haben als auf Kommando und unter Drohungen ihr Kreuz an die richtige Stelle zu malen. Da, wo der Ruf nach Staatlichkeit von ihnen nur Loyalität ohne ein einziges glaubwürdiges Versprechen verlangt, für sie würde sich darüber irgendetwas verbessern, gibt es vorn und hinten keinen Grund, sich für „geordnetere“ Herrschaftsverhältnisse zu engagieren. Wo die Grundlage, daß die Herrschaft auch die gültigen Lebensbedingungen schafft und sichert, fehlt, da ist das, was es an Ordnung und Loyalität gibt, letztlich nur auf unmittelbare Gewalt gegründet oder auf alle möglichen vorstaatlichen Zusammenhänge. Da stabilisiert Demokratie deshalb auch nicht die Herrschaft, indem sie dafür sorgt, daß Bürger ihrer staatlichen Obrigkeit, die die private Betätigung im Rahmen ihrer Ordnung regelt und ermöglicht, selbstbewußt zustimmen. Sie organisiert nicht die Konkurrenz politischer Anwärter um Regierungsgeschäfte mit feststehenden nationalen Aufgaben und Zwecken. Die Erlaubnis zu einer politischen Konkurrenz, die mit Beteiligung des Volks entschieden werden soll, macht da, wo die gefestigte Herrschaft und ihre staatsgemäß eingerichtete gesellschaftliche Basis fehlt, nur alle Ansätze in eine solche Richtung zunichte: Sie setzt die prinzipiell miteinander unverträglichen Ansprüche politischer Gegner und damit die alten, nie erledigten Manieren wieder frei, die Massen für die persönliche Macht „ihrer“ (Stammes-)Führer einzunehmen und zum Kampf gegen ihre Feinde zu mobilisieren. Regierende Politiker setzten sich daher gegen den westlichen Anspruch zur Wehr: „Die Zerstörung unserer Einheitspartei und Parteienpluralismus bedeuten für Kenia Stammeskrieg.“ (Präsident Arap Moi)
Mit der Ideologie, es fehle diesen Ländern an Demokratie, begründen die westlichen Staaten ihr Enthaltsamkeit bei der Vergabe von Krediten. Die westliche Zahlungsbereitschaft wird offiziell an Fortschritte bei der Demokratisierung geknüpft. Wer will, darf ruhig daran glauben, daß wegen des Demokratiedefizits korrupter Führungen „unsere Hilfe“ unnütz, ja schädlich ist, und er darf es für den Ausweis von westlicher Prinzipientreue halten, wenn immer weniger Kredite in solche Länder fließen. Die Wahrheit über die neuen Enthaltsamkeit ist es aber nicht, wenn neuerdings behauptet wird, diese Länder wären gar nicht durch Kredite, sondern nur durch demokratische Entwicklung zu „stabilisieren“ und müßten daher erst einmal bei sich entsprechende politische Voraussetzungen für „sinnvolle Hilfen“ schaffen. Erstens ist es nur die Umkehrung der alten „Entwicklungshilfe“logik, wonach wir sie beim Aufbau der Grundlagen für ordentliches Regieren unterstützen. Zweitens folgt dem Anspruch, sie hätten sich Kredite erst mit politischen Fortschritten zu verdienen, regelmäßig die gespielte Enttäuschung auf dem Fuß, daß davon nichts zu sehen ist. Drittens bleibt vom behaupteten Zusammenhang von Demokratisierung und westlicher Unterstützung deswegen auch nur der Irrealis übrig: Wenn sie endlich geordnete Verhältnisse hätten, dann wären auch Kredite wieder nützlich. Was wie eine Bedingung daherkommt, ist nur die wohlfeile Begründung für die beschlossenen internationalen Sparprogramme. Mit dem Entzug von finanziellen Mitteln läßt sich ja auch schwerlich ein gesellschaftlicher und politischer Fortschritt beflügeln, dem alle eigenen Voraussetzungen fehlen.
In Wirklichkeit ist es umgekehrt: Mit dem „Zwang zur Demokratisierung“, den die finanzielle Zurückhaltung des Westens ausüben soll, unterminiert er höchstens den Stand der herrschenden Regime ein Stück weiter. Diese Ländern bekommen nicht, weil sie so zerrüttet sind, keine „Hilfen“ mehr, sondern weil die Mittel versiegen, von denen sie abhängen, schreitet auch der politische Zerfall voran.
Das, was an Krediten noch vergeben wird, wird sowieso gar nicht von Wahlen und ähnlichen demokratischen Verfahrensweisen abhängig gemacht. Die wirklichen Kreditauflagen sind handfesterer Natur und stammen aus dem Arsenal des IWF. Sie laufen unter dem Titel „Übergang zur Marktwirtschaft“ und enthalten den Auftrag, die „Staatsausgaben“ einzuschränken und die „Bedingungen für Investitionen“ zu verbessern. Da, wo eigentlich gar nichts zu sparen und kaum noch lohnend zu investieren geht, wird mit entsprechenden Kreditbedingungen auf Kostenersparnis bei der internationalen Betreuung der Schulden gedrungen. Das entlastet zwar nicht die Schuldner und beflügelt kaum ein Geschäft; die Auflagen reichen aber allemal, den Ländern ihre Massen als pure Staatskost vor Augen zu führen, sie zur Streichung von Lebensmittelsubventionen zu zwingen, die Reste von Gesundheits- und Schulwesen zu ruinieren und den Haushalt vollständig der Schuldenbedienung unterzuordnen.
… und sein imperialistischer Kern
Andererseits kommt in dem Verlangen nach Demokratie, das sich ja auch in von außen durchgesetzten und betreuten Wahlen und Friedensabkommen betätigt, durchaus ein neues Bedürfnis zum Ausdruck. Ein Ordnungsbedürfnis der Weltbeaufsichtiger, das sich nicht auf die Massen und eine Veränderung ihres Status, sondern allein auf die streitenden Parteien richtet. „Demokratie“ steht für den Anspruch, sie sollten sich schiedlich um Ausgleich ihrer Interessen an der Macht bemühen, ungeachtet dessen, daß die rudimentären Staatsmittel und die inneren Verhältnisse für einen solchen Ausgleich gar nicht taugen und der Charakter der Macht und Machtaspiranten ein gemeinschaftliches Regieren und eine friedliche Konkurrenz um diese Aufgabe gar nicht zuläßt. Von den Anwärtern auf die mageren Privilegien und Mittel, die die Macht dort gewährt, wird verlangt, ihre jeweiligen Ambitionen aufzugeben und sich mit dem zu bescheiden, was ohne gewaltsame Auseinandersetzung zustandekommt. Mannschaften, die sich jahrelang wechselseitig abgeschlachtet haben; Führer, die wissen, daß sie sich nur mit Gewalt behaupten können, Schlächterfiguren, die jahrelang vom Westen ausgestattet wurden, Sozialisten, die bis gestern noch um einen volksdienlichen Nationalstaat gekämpft haben – sie alle sollen das jetzt freiwillig aufgeben und ihre Position davon abhängig machen, wem gerade zufällig das Recht aufs Regieren zufällt. Wo der höhere westliche Zweck fehlt, sollen sich die politischen Kontrahenten vor Ort ihre eigenen Ambitionen abschminken und dem Westen ihre Streitigkeiten ersparen. Demokratie und Frieden sind die Titel und Verfahrensweisen, diesem Verlangen Genüge zu tun, auch wenn außer dem luxuriösen Bedürfnis des Westens, daß auch noch in den hinterletzten Ecken Zustände herrschen sollen, um die man sich überhaupt nicht mehr kümmern muß, kaum einem Interesse Genüge getan wird.
Wer wie in diesen Ländern regiert, ist dabei mehr oder weniger gleichgültig. Jede weitergehende Rücksicht auf die lokalen Machtbedürfnisse und -schwierigkeiten unterbleibt. Die politischen Kreise sollen statt dessen die Ansprüche, um deretwegen sie sich streiten, dem Sparsamkeits- und Ordnungsstandpunkt unterwerfen, mit dem der Westen diese Hinterlassenschaft seiner erfolgreichen Weltkonkurrenz als überflüssige Belastung betrachtet. An die Politiker solcher Länder ergeht die Maßregel, sich gefälligst nicht mehr wie Bürgerkriegsparteien, sondern wie Teilnehmer an einem gemeinschaftlichen Staatsprogramm aufzuführen, dessen einziger Zweck „innere Ordnung“ heißt. Sie sollen ihren jahrelang Streit ad acta legen, die Mannschaften entwaffnen und Teile davon zu einer gemeinsamen Armee zusammenwürfeln, als hätte es die wechselseitigen Schlächtereien nie gegeben. Kurz: Sie sollen ohne jeden guten Grund in ihren eigenen Verhältnissen sich dem Standpunkt einer gemeinsamen Ordnung unterwerfen, auch wenn dabei alles auf der Strecke bleibt, wofür sie erbittert gekämpft haben. Der Wunsch nach Frieden ist nämlich nur bei den Aufsichtsmächten beheimatet, die bis gestern alles getan haben, keinen zustandekommen zu lassen und alle Selbständigkeitsbestrebungen zu unterbinden. Jetzt formulieren die Zersetzer von gestern den Anspruch, die ruinierten Länder hätten ab sofort ohne geeignete Mittel und ohne ein nationales Programm, das alle eint, dem Imperativ „innerer Friede“ zu gehorchen. Das imperialistische Ideal bei der Befriedung und Demokratisierung dieser Regionen ist also die störungsfreie Botmäßigkeit, die aus der Vorstellung entspringt, eine Alleinregierung irgendeiner Mannschaft stelle schon zuviel Eigenständigkeit dar, der ständige gewaltsame Streit aber zuviel Durcheinander und Unberechenbarkeit. Von bisher mit Gewalt nach innen herrschenden Figuren, vor allem aber von den Streitparteien in umstrittenen Herrschaftsgebieten wird verlangt, mit ihrer politischen Selbstaufgabe die ökonomischen und politischen Unkosten zu senken, die der Westen ihren Machtkämpfen zuschreibt, als wäre er an denen völlig unbeteiligt gewesen. Die Wahrheit ist das nicht. Gleichwohl wird der Standpunkt praktiziert, die verfeindeten Fraktionen hätten sich durch innere Friedensschlüsse und die Unterwerfung unter demokratische Prozeduren als lästiger Störfall selber zu erledigen.
Dabei kümmert es die Aufsichtsmächte wenig, daß die von außen aufgemachten „demokratischen Friedens“maßregeln dort, wo die Länder nicht schon zerfallen sind, eher zersetzend als konsolidierend wirken. Die streitenden Parteien lassen sich ja nur unter Zwang auf Verfahrensregeln für ihre Konkurrenz festlegen und nehmen jede Gelegenheit wahr, um sich ihnen zu entziehen oder sie in ihrem Sinne auszulegen. Von einem über allen Parteien stehenden Interesse, das Rahmen, Inhalt und Maß ihrer Streitigkeiten vorgibt, kann keine Rede sein. Die unter neue gewaltfreie Verfahrensregeln gesetzte Konkurrenz um Machtpositionen löst daher nur die mit Gewalt zusammengehaltene Staatsprojekte auf. Frieden bedeutet das Ende aller einheitlichen staatlichen Ambitionen und Verwaltungsansätze. Für die streitenden Parteien bedeutet er die Aufgabe eigener Machtpositionen und Machtansprüche und hat deswegen auch wenig gesicherte Zukunftsaussichten. Das zeigen die überall gleichermaßen mühseligen und fruchtlosen Versuche, die erschöpften, aber nicht geschlagenen Gruppen zu einer friedlichen Übereinkunft über die Modalitäten einer „Machtbeteiligung“ aller Anwärter zu bewegen. Die westlichen „Vermittler“ stehen diesen ständigen Rückschlägen erst einmal mit der Bequemlichkeit und Gleichgültigkeit von Aufsichtsmächten gegenüber, denen letztlich auch egal ist, wie und ob das Ergebnis zustandekommt – auf Wahlergebnisse und Abmachungen wird ernsthaft gar nicht bestanden –, weil und soweit die Streitparteien weltpolitisch sowieso keine Perspektive und kein spezielles machtvolles Interesse ernstlich durcheinanderbringen. Die schiedsrichtermäßige Betrachtung des funktionslosen Durcheinanders schließt die Freiheit ein, es ohne irgendeinen Schaden auch bis auf weiteres sich selbst zu überlassen und nur aufzupassen, daß sich keine falsche regionale Konkurrenzmacht seiner zu sehr annimmt.
Daher werden solche Fälle, auf die sich kein spezieller Ordnungsanspruch richtet, auch mit Vorliebe der UNO zur geflissentlichen Behandlung übertragen. Die, oder man selber schickt das für die Demonstration des Ordnungsbedarfs passende Personal – zum Beispiel zum Verteilen von Hungerrationen, für die symbolische Trennung der Kampfparteien, für die Betreuung der Wahlveranstaltungen und Friedensbedingungen, für die diplomatische Bewältigung der mit ihnen aufkommenden Streitereien… Der Aufwand für die Regelung der Hinterlassenschaften ist gering und fällt ganz in die freie Berechnung. So ist das matte Bemühen um Frieden, Demokratisierung und Hilfsaktionen, das eine Nebenabteilung der Weltdiplomatie bildet, die passende Weise, diese Länder bis auf weiteres abzuschreiben – nicht ohne den Anspruch, sie hätten das gefälligst an sich selber zu vollziehen. Was an Staatlichkeit Bestand hat, ist erst einmal nur die Territorialisierung des Elends und das ausweglose Bedürfnis politischer Anwärter nach auswärtiger Anerkennung. An den auswärtigen Mächten liegt es daher auch einzig und allein, was aus dem jetzt bloß diplomatisch betreuten Chaos weiter wird, d.h. wieviel Aufwand man auf dem Feld diplomatischer Erpressung und militärischer Gewalt für die Befriedung dieser Armenhäuser der Staatenwelt zu treiben bereit ist. Etwas anderes kommt sowieso nicht in Betracht, darin sind sich hiesige Politik und Öffentlichkeit längst einig.