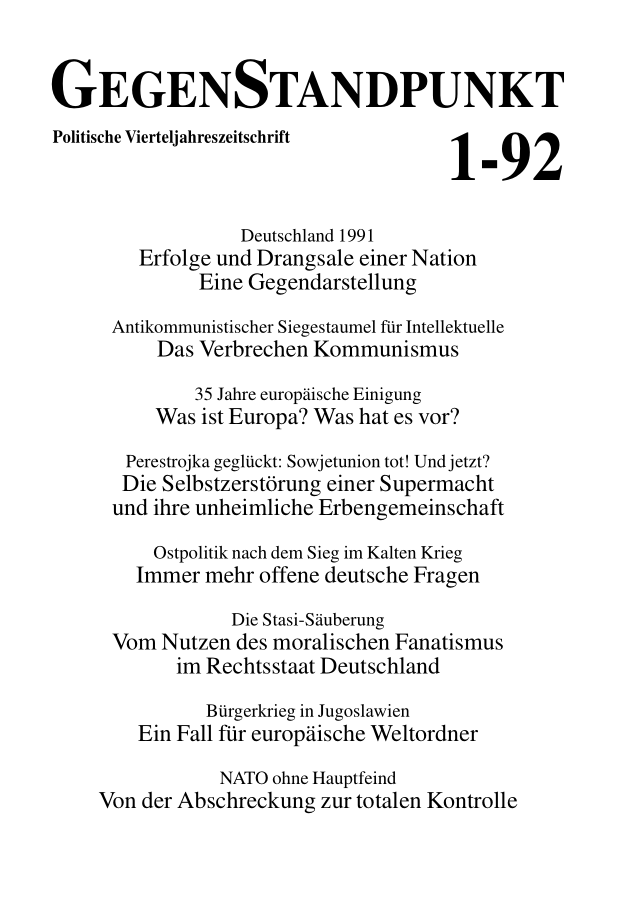Bürgerkrieg in Jugoslawien
Ein Fall für europäische Weltordner
Das Ende des „Ostblocks“ beendet den jugoslawischen „Dritten Weg“: Mit seinem Nutzen für den Imperialismus verliert Jugoslawien seinen Kredit. Jugoslawische Nationalisten streiten sich, wer den Schaden zu tragen hat. Die Bruder-Nationalisten von gestern werden ausgemacht als Ursache des Schadens von heute. Separation und der Kampf um die eigene Nation als Kampf um Staatsgebiet und -volk: Staatsgründungskriege. Die europäischen Imperialisten entdecken die jugoslawische Sezession als Fall ihrer gewaltsamen Weltordnungsaufsicht – und als Material des Streites um Führung in Europa.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Gliederung
- Nationaler Staatsgründungsfanatismus erledigt eine Staatsgröße
- Nationen schaffen sich ihren Staat
- Der jugoslawische Bürgerkrieg: Ein Fall für Zwölf
- Der europäische Weltordnungsfall Jugoslawien: Eine Chance für Deutschland
- Vorläufige Bilanz von Schlächterei und Schlichtung auf dem Balkan:Zwei neue Staaten und ein Schritt in Richtung auf eine Weltmacht Europa nach deutschem Plan
Bürgerkrieg in Jugoslawien
Ein Fall für europäische
Weltordner
Die einstmals stolze „Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien“ verschwindet von der politischen Landkarte. Daß sich eine ganze Staatsgewalt einfach zersetzt, wird in der deutschen Öffentlichkeit mit Selbstverständlichkeit registriert. Die „Frieden und Freiheit“ genannte Weltordnung, die woanders das Prinzip der Unantastbarkeit von Grenzen, also der genehmen Völkerrechtssubjekte hochhält, sieht hier keinen Handlungsbedarf für „untaugliche“ Rettungsversuche.
Der Erfolg, daß die einstige feindliche Weltmacht sich selbst aufgegeben hat, stiftet Durchblick: Allein der faktische Untergang des jugoslawischen Staates – ehemals ein Bollwerk gegen den Stalinismus – beweist jetzt dessen Zugehörigkeit zum falschen System. Die verflossene SFRJ ist nurmehr ein weiterer Beleg für den „unvermeidlichen Sieg der Geschichte“, vor der jeder kommunistische Staat zum „Untergang verurteilt“ ist. Dieselben Politiker, die neulich noch die besten Beziehungen zu den jugoslawischen Staatsführern pflegten – immerhin hatten die sich schon längst an die EG assoziieren lassen, ließen sich ihre Wirtschaftspolitik vom IWF entwerfen und haben ihren Dinar an die gute DM gebunden –, entdecken schlagartig in ihren Partnern von gestern Repräsentanten eines „stalinistischen Panzerkommunismus“. Jetzt entlarvt sich der Staatsgründer Tito, dessen mustergültige „Unabhängigkeit“ und herrlich „undogmatischer Sozialismus“ zeit seines Lebens gefeiert wurde, als ein kommunistischer Diktator, der seine Völker mit harter Hand geknechtet und unterdrückt hat. Selbst den einstigen Linken, die einmal die jugoslawische „Arbeiterselbstverwaltung“ als die gesellschaftliche Alternative sowohl zum Kapitalismus wie zum Staatssozialismus gepriesen hatten, ist heute kein Nachruf auf das „gescheiterte Modell“ mehr zu entlocken. Das neue Dogma, daß der Zusammenbruch des Kommunismus, weil faktisch, gleich auch noch notwendig und gerecht sein muß, tobt sich auch an Jugoslawien aus, so daß alle vorgestern noch bekannten, weil politisch gewürdigten und ausgenützten Gegensätze zum Ostblock vom Elementarfeindbild erschlagen werden. Aber warum soll man sich auch die Genugtuung durch die Erinnerung an frühere Komplimente und gute Beziehungen stören lassen, wenn die Dienste, die dieser Staat einmal geleistet hat, angesichts der heutigen Weltlage gegenstandslos geworden sind.
Da stellt sich natürlich erst gar nicht die Frage, warum denn die politische Klasse eines anerkannten Staatswesens mitten in Europa überhaupt darauf verfällt, ihr eigenes Staatswesen zu zerschlagen und in absehbar ohnmächtige Kleinststaaten zu zerlegen. So übermäßig selbstverständlich ist es nämlich gar nicht, daß Serben und Kroaten im Jahre 1991 entdecken, daß sie partout keinen gemeinsamen Staat bilden können, während Bayern und Preußen das nicht nur können, sondern sich auch noch mit Sachsen und Mecklenburgern zusammengelegt haben.
Nationaler Staatsgründungsfanatismus erledigt eine Staatsgröße
Ganz von alleine sind die Jugo-Politiker allerdings auch nicht darauf verfallen. In ihrer glanzvollen Unabhängigkeit sind nämlich auch sie Produkt und Opfer des Ost-West-Gegensatzes, den sie zur Grundlage für ihren „Dritten Weg“ benützt haben. Dem verdanken sie den Erfolg ihres Staatswesens ebenso wie dessen Mißerfolg, der sie so grundsätzlich unzufrieden gemacht hat.
Weltpolitisch interessant geworden war Jugoslawien überhaupt nur durch seine frühe Abspaltung vom Ostblock, ironischerweise verursacht durch Streitigkeiten um den wahren kommunistischen Weg, die den legendären Staatsgründer Tito gegen Stalin aufgebracht hatten. Der Tatsache, daß die jugoslawischen Partisanen Hitler ohne entscheidende Hilfe weder durch die Alliierten noch durch die Rote Armee vom Balkan vertrieben hatten, entnahm Tito das Recht auf kommunistische Führerschaft und, nach dem Zerwürfnis, auf einen unabhängigen Weg. Das Angebot des Westens, einfach das Lager zu wechseln, widersprach aber auch der sozialistischen Staatsidee Titos, so daß die jugoslawische Unabhängigkeit von beiden Seiten „umworben“, d.h. dafür bestochen wurde, nicht mitsamt ihrer interessanten strategischen Lage mitten in der Hauptfront in eines der Lager überzulaufen.
Unbestrittener Höhepunkt dieser Staatskarriere war die jugoslawische Führung in einem veritablen Block der „Blockfreien“, versehen mit der dazugehörigen diplomatischen Würdigung durch beide Lager – ein Erfolg, der dann leider durchs Verschwinden der Blockfreien sein Ende nahm. In der Regel verloren die an diesem Bündnis beteiligten Staaten nämlich die Lust an einer solchen Neutralität, weil die Angebote des Westens in Sachen staatlicher Ausrüstung einfach attraktiver waren. Seitdem schließlich Gorbatschow sich um die einseitige Beendigung des Ost-West-Gegensatzes verdient gemacht hat, ist die Geschäftsgrundlage der jugoslawischen Unabhängigkeit ganz grundsätzlich entfallen, was sich den Tito-Nachfolgern als ärgerlicher Mangel an Berücksichtigung und vor allem an wirtschaftlichem Entgegenkommen bemerkbar gemacht hat.
Der jugoslawische „Dritte Weg“ hatte nämlich die berühmte Unabhängigkeit in Sachen Ökonomie so begriffen, daß man sich die Vorteile beider Lager zunutze machen könnte: als assoziiertes Mitglied im RGW mit geregelten Rohstoff- und Energielieferungen auf Verrechnungsbasis und als Teilnehmer am Weltmarkt, speziell an dem von der EG bestimmten, auf dem man per Kredit fortschrittliche Industrien einkaufen konnte. Der schlagende Erfolg dieser Geschäftsbeziehungen ist bekannt: Jugoslawien war, solange es noch existierte, zum ökonomischen Anhängsel und Hinterland der EG geworden, seine Politiker beschäftigten sich seit Beginn der 80er Jahre mit ihrer „Krise“, die sie in immer neue Anläufe zu marktwirtschaftlichen Reformen umsetzten. Und dabei bekamen sie dann den westlichen Unwillen zu spüren, weiterhin die jugoslawische unabhängige Rolle mit großzügigen Kreditkonditionen zu belohnen. Stattdessen fanden sie sich auf einmal in der Position eines ziemlich drittklassigen Industrielands mit einem Schuldenberg unter Aufsicht des IWF wieder, dessen haushalts- und währungspolitische Auflagen immer mehr die Finanzierung ihres inneren ausgeklügelten Selbstverwaltungswesens, d.h. vor allem die finanztechnische Bedienung des Vielvölkerausgleichs verunmöglichte.
An ökonomischer Abhängigkeit und politischer Ohnmacht, am Verlust einst vorhandener nationaler Größe allein ist noch keine Staatsgewalt zugrunde gegangen. Auf den hinteren Rängen der Staatenwelt tummeln sich nur Subjekte, die ähnliche Staatsnotlagen verwalten. Damit solche Dauerkrisen als zwingender Grund zur Auflösung des Staats begriffen werden, müssen die Zuständigen schon die Zentralgewalt selbst als den Fehler und das Hindernis für politischen Erfolg begreifen – und das hatten die jugoslawischen Staatsmacher im alten Bundesstaat nur zu gut gelernt. Entgegen dem Gerücht von einer brutalen Unterdrückung der Nationen hatte der Tito-Staat die nämlich so wenig unterdrückt, geschweige denn kritisiert, stattdessen so bitter ernst genommen, daß der gesamte Staatsaufbau nicht nur den Werktätigen und Jugoslawen, sondern denselben auch noch in der Rolle von Völkern und Völkerschaften beweisen sollte, daß sich das Zusammenleben in der Eigenschaft als viele Völker lohnte. In Gestalt eigener Republiken und autonomer Regionen mit eigenen Regierungen und Bilanzen durften die vielen Völker immer schon ihren Erfolg als ausgiebigen Streit miteinander und mitden Bundesinstanzen um Zuteilung und Abtreten von Mitteln betreiben, d.h. weniger die Völker, die auch in Jugoslawien hauptsächlich mit Arbeiten beschäftigt waren, als deren Führer.
In der nationalen Optik, die die jugoslawische Vielvölker-Staatsraison ihren Unterabteilungen gründlich beigebracht hatte, nahm sich der Mißerfolg des Gesamtstaates wie eine schlechte Behandlung, Bevormundung oder Behinderung der Unterabteilungen durch die Zentrale aus, so daß sich lauter erprobte Funktionäre der alten Staatspartei binnen kurzem zu echten nationalen Führern herausgemacht haben. Deren Streitigkeiten um den gerechten Anteil ihrer Republik verwandelten sich im Zeichen der Schuldenkrise in den Streit, wer den Schaden zu tragen hatte. Die Auseinandersetzungen dieses Typs, als Vorwurf an die Nachbarrepubliken gerichtet, daß sich die eigene Sache ihrer Unzulänglichkeiten wegen nicht mehr lohne, leiteten die Zersetzung ein. Der Auftakt zur heutigen Lage bestand in der Weigerung Sloweniens, den gesetzlich vorgesehenen Anteil „seiner“ Deviseneinnahmen in den Bundesfonds zugunsten der südlichen „Armenhäuser“ abzutreten. Damit hatten die Albaner im Kosovo neue gute Gründe erhalten, gegen die Unterdrückung aus Belgrad zu rebellieren, was die dortige serbische Regierung wiederum zum Anlaß nahm, die autonomen Regionen unter ihre Aufsicht zu stellen. Die gemeinsame Vergangenheit im Bund der Kommunisten hat Milošević, Tudjman und Kućan gleichermaßen zu Demokratie und Marktwirtschaft und zu der Überzeugung „Slowenien den Slowenen, Kroatien den Kroaten und Serbien den Serben“ bekehrt. Für den Bund der Kommunisten, der den Staatszusammenhang repäsentiert und verwaltet hatte, gab es damit keinen Verwendungszweck mehr. Er löste sich in allen Republiken sang- und klanglos in echt nationale Parteien auf. Seitdem das föderative Band der Staatsgemeinschaft nur noch im Streit der Republiken darum bestand, die ökonomischen und politischen Mittel des Staates zu monopolisieren und sich darüber wechselseitig zu schädigen, wurden die jeweiligen Völker gründlich darüber unterrichtet, daß sie ihr zunehmendes Elend serbischer Vorherrschaft oder slowenischen Alleingängen, auf jeden Fall der Belgrader Zentrale verdankten. Als brave Staatsbürger entdeckten auch sie immer mehr ihre Teil-Volksnatur als ihren eigentlichen Daseinszweck und befanden es für überaus logisch, sich von schlecht versorgten selbstverwalteten Werktätigen auf den Beruf von Milizionären umzustellen.
Jetzt stehen sich nur noch Nationalisten im Weg, die als Führer ihrer Nation mit Mehrheiten gewählt wurden, deren sich kein sozialistischer Staatsmann aus alten Tagen hätte zu schämen brauchen, und kommen sich über den Nachlaß ihrer verflossenen gemeinsamen Jahre ins Gehege. Alle wollen von der alten Staatsmacht nur noch deren Verbrechen an ihrer Nation kennen, wobei Serbien von deren Machtmitteln noch einiges unter Belgrader Hoheit retten möchte. Dieser Unterschied verschafft den aufstrebenden Kroaten und Slowenen einerseits und den Serben andererseits den neuen Feind, der die nationale „Identität“ erst recht stiftet.
Dem deutschen öffentlich-rechtlichen Lob auf bislang gänzlich unbekannte Völkerschaften, deren Unabhängigkeitsdrang das beste Zeugnis ausgestellt wird, sollte man sich lieber nicht anschließen. An Jugoslawien – und nicht nur dort – kann man sehen, welch schönen Verhältnissen die herzliche Anteilnahme gilt: nichts Geringerem als Mord und Totschlag, Hunger und Vertreibung. Das ist weder Zufall noch Ausdruck unzivilisierter Manieren von Balkanvölkern.
Anders als durch Krieg und Gewalt läßt sich nun einmal kein Staat begründen. Untertanen fix und fertiger Staaten können sich den Glauben an die friedliche Natur ihrer Herrschaft nur leisten und sie als Chance zum eigenen Zurechtkommen (miß-)verstehen, weil ihre Staatsgewalt den Automatismus der Abhängigkeiten längst eingerichtet hat, unter denen das staatsbürgerliche Leben abläuft – die sind der „innere Frieden“, den die Staatsgewalt bloß schützt. Dahin wollen die jugoslawischen Staatsgründer erst kommen. Nicht dümmer als die Politiker, die soliden Staatswesen vorstehen, wissen sie, daß die Schaffung der staatlichen Gewaltgrundlage jedem höheren Zweck staatlicher Machtausübung vorausgeht. Dafür, und das ist der elementare Sinn von „Unabhängigkeit“ und „nationaler Selbstbestimmung“, wird in Jugoslawien geschossen und gestorben. Als einziger Lohn winkt den Serben und Kroaten, die aufeinander losgehen, daß sie künftig in einem „eigenen“ Staat leben, in heimischer Währung bezahlen und ihre traditionelle Stammesfahne verehren dürfen. Mehr wird ihnen von ihren führenden Nationalisten nicht versprochen.
Nationen schaffen sich ihren Staat
Jede Staatsgewalt gebietet über ihr
Volk,
das ausschließlich ihr verfügbare Material für alle Ansprüche, die die Verantwortlichen der Nation für unerläßlich erachten. Diese innige Beziehung stiftet in fertigen Staaten der Paß, mit dem der Inhaber seine prägende Charaktereigenschaft, Staatsangehöriger und Mitglied der Volksgemeinschaft zu sein, aufgestempelt bekommt. Dieser Verwaltungsakt macht sich nicht abhängig vom Nachweis deutsch-nationaler Gesinnung oder reinrassischer Herkunft des Paßinhabers. Des weiteren sorgen die staatliche Rechtsgewalt und das durch sie garantierte nationale Geschäftsleben von selbst dafür, daß kein Mitglied der Nation umhinkommt, seinen Beitrag zum nationalen Ganzen zu liefern.
Dieses Band, das oben und unten automatisch verknüpft, geht den jugoslawischen Teilrepubliken, die unbedingt nationale Staaten werden wollen, ab. Mangels Sicherheit stiftender Bindungen, die mit dem Staat auch schon das ihm zugehörige Volk definieren, sind sie beim Akt der Staatsgründung auf die Abkunft und das Bekenntnis derer zur nationalen Rasse verwiesen, denen sie Pässe ausstellen. Die Einbürgerung aller, denen die nationale Staatsehre zuteil werden soll, bedeutet umgekehrt die Ausbürgerung all derer, denen dieser rassische Vorzug nicht zukommt; zumindest in der Form, daß sie unter die Kategorie minderwertiger, unzuverlässiger Volksteile fallen und entsprechend behandelt werden. Wenn es erst noch gilt, das passende Staatsvolk zu schaffen, ist nicht Verwaltungsroutine, sondern Sortierung gefragt.
Auf dem Gebiet des alten jugoslawischen Staatswesens, das den nationalen Wahn seiner Völkerschaften nicht bekämpfen, sondern versöhnen wollte, steht da entschiedenes Aufräumen an. Unter dem sozialistischen Regime sind albanische, muslimische, serbische und kroatische Jugoslawen munter von einem Landesteil in den anderen gezogen und haben quer durcheinander geheiratet, ohne daß es ein Wort für Mischehe gab. Den Angehörigen der Hauptbevölkerung einer Republik, die in anderen Landesteilen hausten, hatte der Vielvölkerstaat überall die gleichen Rechte, die zahllosen Selbstverwaltungsorgane und eine penibel beachtete gleiche Berücksichtigung von „Völkern und Völkerschaften“ garantiert.
Mit dieser laschen Praxis – jetzt als Diktatur der kommunistischen Zentrale entlarvt – wird überall Schluß gemacht. Serbien ist vorausgegangen und hat den Autonomiestatus und die politische Selbstverwaltung der Vojvodina und des vorwiegend von Albanern bewohnten Kosovo aufgehoben. Mit diesem Akt waren diese Gebiete zur natürlichen Heimat aller Serben geworden. Die Albaner, die auf dem Amselfeld, der historischen Stätte serbischer Größe, wohnen, sind von einem Tag auf den anderen störendes Inventar, das der geborenen Staatsrasse die Häuser, die Arbeit und die staatlichen Verwaltungsstellen wegnimmt; entsprechend werden sie behandelt.
Das neue Grundgesetz des unabhängigen Kroatien macht die serbische Minderheit zu Staatsbürgern 2. Klasse. Als rassisches Anhängsel der Republik, mit der sich Kroatien im Krieg befindet, unterliegen sie automatisch dem Verdacht, sich als geborene Staatsfeinde im Kroatien herumzutreiben. Wenn sich die Betroffenen wehren, wobei ihnen auch nichts anderes einfällt, als sich ihrerseits für unabhängig zu erklären oder sich ihrer größeren Heimat Serbien anschließen zu wollen, dann sind sie „Terroristen“, an die Verhandlungsangebote verschwendet sind. Diese neue Staatsmaxime sieht dann auch das Volk ein. In den jugoslawischen Dörfern, in denen bisher getrennt gebetet und gemeinsam gefeiert wurde, zünden sich jetzt die Nachbarn die Häuser an.
Als erstes stellen die nationalen Staatsgründer Grenzschilder auf. Ein dem Zugriff anderer entzogenes
Territorium
gibt dem Staatstraum erst den nötigen Halt. Gedacht ist bei den eigenen Grenzen weniger an nationale Abschottung als an Machtmittel, die dem eigenen Projekt unbedingt zustehen, so daß einiges an Staatsboden über die alte Republikeinteilung hinaus beansprucht wird. Das lebhafte Interesse, sich wirklicher Grenzen zu versichern, läßt die feindlichen Brüder ein weiteres Verbrechen des alten Regimes entdecken: Es hätte die Republiken durch willkürliche und un-nationale „Verwaltungsgrenzen“ eingeschränkt – ganz so, als gäbe es irgendwo auf der Welt „natürliche“ Grenzen. Republikführer entsinnen sich ihrer nationalen Brüder außerhalb, die heim ins Reich müssen, was nur durch die Unterstellung des Bodens, auf dem sie leben, unter die eigene Staatshoheit geht, oder eines nationalen Bodens, der ebenso heim ins Reich gehört, auch wenn auf ihm die Falschen wohnen. Oder sie entdecken, wie Slowenien, die Ungerechtigkeit, keinen brauchbaren Zugang zur Adria zu besitzen, den Kroatien jetzt abtreten soll.
Mit diesem Kampfprogramm gehen sie aufeinander los – so daß es auch ausnahmsweise Übereinstimmung unter den größten Feinden gibt:
„Die Teilung Bosniens ist die beste Lösung. Er (Tudjman) stimme mit Milošević überein, daß eine Grenzziehung zwischen Serbien und Kroatien sowie eine Lösung des Muslimproblems im Mittelpunkt einer friedlichen Beilegung des Konflikts (in Bosnien-Herzegowina) stehen.“ (SZ 15.7.91)
Die freundliche Überzeugung, daß gute Deutsche auswärtigen Freunden nur dabei helfen, „ihre Grenzen zu verteidigen“, liegt also einigermaßen schief – in Jugoslawien sollen Grenzen überhaupt erst gezogen werden, das macht die Unversöhnlichkeit der streitenden Parteien aus. „Eroberung“ oder „Verteidigung“ läßt sich da nur mit blinder Parteilichkeit unterscheiden, objektiv vorhanden ist nur der Unterschied an verfügbaren Gewaltmitteln – der macht aus der einen Republik noch keinen Täter und aus der anderen noch kein Opfer. Daß der beiderseitige Anspruch auf eine echt nationale Grenzziehung so schön unvereinbar ist, stiftet schließlich überhaupt erst den Anlaß dafür, daß sich die Deutschen mit ihrer notorischen Vorliebe für Friedensprozesse einschalten können.
Der Krieg reduziert die Träume von einem serbischen oder kroatischen (Groß-)Reich, das alle Volksgenossen in sich vereint, auf ein praktisches Normalmaß. In ihm kommt es darauf an, den Gegner zu schwächen, den Staatsboden zu behalten und dem anderen abzunehmen, ohne sich sklavisch an eine Bevölkerungsstatistik zu halten. Im übrigen werden die alten Heimatrechte von den Kriegsparteien, die sich auf sie berufen, selbst gründlich umgepflügt. Hunderttausende verlassen ihre bisherigen Wohnorte und folgen den veränderten Grenzen und wechselnden Kampflinien. So leistet die Kriegsführung immerhin ihren Beitrag zur Entmischung der unordentlich beheimateten Volksteile.
Zur Grundausstattung jedes Staates gehört ein Personal, das sich aufs Regieren versteht. Nach dem Vorbild erfolgreicher Staaten hat sich in allen jugoslawischen Republiken die Bestallungsmethode der
Demokratie
und ihrer freien Wahlen eingebürgert. Gewählt wurde das Lebensrecht der unabhängigen Nation und Führer, die diesen Anspruch ohne Kompromiß durchzusetzen versprachen. Dementsprechend müssen sich die Machtinhaber von der überall vorhandenen Opposition befragen lassen, wie ernsthaft sie dieses Staatsziel im Auge haben. Dabei gehen die Oppositionsparteien von der nationalen Geschichte aus und blamieren Tudjman und Milošević entweder mit der Einheit Kroatiens unter dem faschistischen Ustascha-Regime oder mit der Größe des einstigen serbischen Königreichs, und flugs entlarven sich die verantwortlichen Politiker als Feiglinge und als Landesverräter. In Serbien hat sich auch noch der alte Bundesstaat als Maßstab erhalten, so daß Milošević auch damit kritisiert wird, daß er durch verkehrten Nationalismus die anderen Nationen gegen die Führungsnation Serbien aufgebracht hätte. Mitten im Krieg ruft dort die Demokratische Partei öffentlich zur Wehrdienstverweigerung auf, weil der Krieg Serbien nur schaden soll. Aber das paßt nicht ins deutsche Bild vom serbischen Panzerkommunismus.
So gut gemeint diese vaterländische Kritik auch ist, sie fällt in den Augen der Regierungspartei unter Verbrechen an der Nation. Den Spaltern der Volkseinheit werden Demonstrationen untersagt, und einzelne Funktionäre werden in Schutzhaft genommen. Da der anspruchsvolle Maßstab, was die Ehre der Nation alles gebietet und erfüllen soll, immer nur unvollkommen eingelöst wird, machen sich die nationalen Führer auf die Suche nach Volksverrätern, die das Vorankommen der Nation sabotieren. Kaum fällt das kroatische Vukovar, steckt Tudjman den militärischen Ortskommandanten ins Gefängnis. Aus dem Nationalhelden ist von einem Tag auf den anderen ein Agent des serbischen Geheimdienstes geworden. Wo die Nation einen ganzen Staat stiften soll, bekommt die demokratische Kontrolle auch sonst alle Hände voll zu tun. Je mehr sich die Nation zusammenschart, desto auffälliger werden die nicht dazugehörigen fremden Minderheiten, deren politische Führer verfolgt, gejagt oder in Haft genommen werden.
Wie jeder anständige Staat bilanzieren die neuen Souveräne
die ökonomischen Mittel
und stoßen dabei auf eine erschreckend einfache Bilanz. Das Geld, das den Wert allen heimischen Produzierens ausmacht und zum nationalen Reichtum zusammenaddiert, erweist sich durch seine Beschriftung als Eigentum eines fremden Staates, durch den sich die Nation der Früchte ihres Fleißes beraubt sieht. Abhilfe läßt sich schaffen: Die neue nationale Währung hat freilich mit wirklicher Produktion vorerst nur vermittelt über die Arbeit, die auch das Bedrucken von Papierbögen erfordert, zu tun.
Als ideeller Beweis, daß die Nation bisher von der staatlichen Zentrale und den anderen Republiken ausgeplündert, mindestens jedoch ungerecht entlohnt wurde, wiegt der slowenische Tolar umso schwerer. Dieser Befund wird jetzt exekutiert. Die Republiken unterbinden ihren bisherigen Waren-, Handels- und Geldverkehr. Die Hinterlassenschaft der bundesstaatlichen Wirtschaft wird vor allem der nützlichen Verwendung zugeführt, die Nachbarn zu schädigen: Jugoslawische Zölle werden in Slowenien einbehalten, gemeinsame Ölleitungen unterbrochen, dem Bundesstaat gehörige Betriebe in Kroatien enteignet, kroatische Raffinerien bombardiert und gegenseitige Zahlungsverpflichtungen ignoriert. So kommt auch die umgekehrte Seite der Tatsache, daß die Produktion jeder Republik Teil einer übergreifenden Arbeitsteilung war, zum Zug. Überall stellen Fabriken ihre Produktion ein, da die benötigten Rohstoffe und Halbprodukte aus anderen jugoslawischen Regionen nicht mehr eintreffen. Der Stolz Sloweniens, „seine“ devisenverdienende Industrie, die diesen „modernen“ Volksschlag vor anderen faulen Balkanvölkern auszeichnete, ist schlagartig gesundgeschrumpft.
Dafür zieht überall die „Marktwirtschaft“ ein, vorerst freilich nur durch die Beseitigung der alten Planwirtschaft und ihrer Garantien. Die künftige Nation macht sich bei ihren Anhängern bis auf weiteres durch Versorgungsmängel, Hunger und unbezahlbare Preise geltend.
Die Abwesenheit von so etwas wie einer Nationalökonomie beunruhigt die neuen Staatsgründer jedoch nicht im geringsten. Sie wissen, daß es beim Staat zuallererst auf die Elementarform seiner Gewalt, auf
die militärische Ausstattung
ankommt. Den neuen Staatsbürgern wird als erstes der Militärdienst zur Verteidigung der Heimat anvertraut. Die separatistischen Landesteile verweigern der Bundesarmee die Rekruten, bis die auf eine serbische Armee reduziert ist; aufgebrachte Mütter beschimpfen deren Offiziere als Mörder ihrer Kinder, damit die Kinder dann zu Hause den richtigen Dienst tun. Dort werden die Garnisonen der Armee belagert, damit die Kinder auch ordentliches Gerät zum Kämpfen bekommen. Die Unabhängigkeitsfeier fällt mit der feierlichen Rekrutenvereidigung zusammen.
Alle verfügbaren Devisen werden für den Kauf von Waffen und für die Ausrüstung der nationalen Kampfverbände eingesetzt. Dafür werfen die Republiken – ebenso wie die Belgrader Regierung für die Volksarmee – die Notenpresse an. Die Scheidung zwischen Militär und Zivilbevölkerung wird hinfällig. Aus Dubrovnik nach Zagreb geflohene Bewohner werden auf kroatischen Schiffen postwendend zurückverfrachtet. Vor Ort beweisen sie glaubwürdiger das Verbrechen der Volksarmee, auf kroatisches Leben zu schießen, vor allem wenn italienische Politiker vorbeischauen.
Hierzulande gebietet die öffentliche Moral, die Befreiung der jugoslawischen Völker vom kommunistischen Einheitsstaat als humanitäre Leistung zu würdigen. Dem sollte man sich lieber nicht anschließen. Die praktische Inanspruchnahme der Völker für das Recht auf einen eigenständigen Staat reduziert die Lebensbedingungen auf pure Kriegswirtschaft. Dadurch werden die Lebensmittel nicht mehr. Vom künftigen Staat haben die neuen Staatsbürger erst einmal und auf längere Dauer nur eines: seine Existenz. Das mag ein nationales Gemüt befriedigen, satt wird es davon nicht.
Weil die potentiellen Staaten keine Macht haben, sondern dadurch erobern wollen, daß sie sie sich wechselseitig bestreiten, machen sie sich auch nur als politisches Material für das Aufsichtsrecht und die Einmischungspflicht anderer Staaten zurecht. Aus Anlaß des nationalen Wahns, der sich in Jugoslawien austobt, gelangt der Balkan zur Ehre, zum „Krisenherd“ und zur „Konfliktzone“ ernannt zu werden. Mit dieser Kennzeichnung sehen sich Staaten, auf die es wirklich in der Welt ankommt, veranlaßt, dieser Gegend ihre Aufsicht und Kontrolle angedeihen zu lassen.
Der jugoslawische Bürgerkrieg: Ein Fall für Zwölf
1.
Die EG-Staaten haben den Streit in Jugoslawien zur Krise erklärt, die sie nicht ungerührt lassen kann; die nach einer Lösung ruft, welche von Bonn und Paris ausgeht. Ohne Zögern haben europäische Politiker die Zuständigkeit für das kriegerische Geschehen übernommen. Ihr Grund: weil sich diese blutige Unruhe „mitten in Europa“ abspielt, „vor der eigenen Haustür“. Was will uns diese Begründung wohl sagen? Etwa, daß demokratische Weltpolitiker kein Blut sehen können – so aus der Nähe? Die Täuschung konnte kaum aufkommen. Unerträglich am jugoslawischen Bürgerkrieg und besonders verwerflich daran ist, daß er sich in direkter Reichweite des politischen Einflusses abspielt, der von den EG-Metropolen ausgeht. Hier ist man „betroffen“, „zutiefst“ betroffen, weil ein ökonomisches Anhängsel der europäischen Wirtschaftsmacht, ein Transitland für den innereuropäischen Geschäftsverkehr, ein Abstellplatz für erholungsbedürftige Massen, ein Staat in gefestigter politischer Abhängigkeit, also: ein Musterfall von „Hinterhof“, wie man ihn den Amerikanern in Mittelamerika nachsagt, in unerlaubte Unordnung und Verfall gerät.
2.
Europa mischt sich also ein. Und zwar so, daß es sich auf gar keinen Fall zum bloßen Unterstützer einer der Parteien herabwürdigt, die auf dem Balkan gegeneinander kämpfen. Die EG hat sich ja auch weder die Auflösung Jugoslawiens in Einzelteile bestellt, noch bei der dortigen Armee die nationale Wiedervereinigung der Republiken in Auftrag gegeben. Die Anliegen der Kriegsgegner sind keine Anliegen der EG oder eines ihrer Mitglieder; umgekehrt wüßte weder die Gemeinschaft noch einer ihrer Mitgliedsstaaten ein eigenes materielles Interesse anzugeben, das die eine oder die andere Kriegspartei besser bedienen würde oder nach dem alle sich richten sollten. Angesichts des Bürgerkriegs ergreift Europa ganz entschieden Partei für seine Regelungskompetenz, der sich kein Kriegsgegner entziehen können soll. Tudjman und Milošević werden nach Den Haag einbestellt, damit sie dort ihr europäisches Aufsichtspersonal kennenlernen; also um klarzustellen, wer die übergeordnete Schiedsstelle für ihre Streitigkeiten ist. Jugoslawien wird zum Fall für ein Prinzip gemacht, das es vorher so noch gar nicht gegeben hat, das an diesem Fall aber durchgesetzt werden soll: für europäische Ordnungsstiftung.
Also ein Fall von selbstloser Vermittlungstätigkeit? Von purer Friedensverantwortung? So sieht es die europäische Öffentlichkeit und hat sogar einen Beweis: Weit und breit nichts zu sehen von nationaler Berechnung, von Parteilichkeit und materieller Vorteilssuche, wie sie doch sonst immer durchscheint. Ein wenig scheint allerdings auch hier die Berechnung durch, wenn Europas betonte Überparteilichkeit gar so sehr als denkbar bester Grund für um so härteres und wirksameres Ein- und Durchgreifen begrüßt wird. Denn darum wird es dann ja wohl gehen: um das Recht der EG, über Staaten „vor ihrer Haustür“ maßgeblich zu entscheiden, bei den Nachbarn auftretende Machtfragen hoheitlich zu beantworten. Also nicht bloß das eine oder andere Interesse durchzusetzen, sondern die Souveränität gewisser „souveräner Staaten“ überhaupt außer Kraft zu setzen, wenn deren innere Ordnung oder Unordnung mißfällt. Ob dadurch Friede einkehrt oder die Streitigkeiten und Schlächtereien nur schlimmer werden, ist schwer die Frage, aber gar kein Kriterium: Die wüsten Verhältnisse in einem Staat, über den die EG die Aufsicht führt, bekommen dadurch einen tieferen politischen Sinn. Sie sind nicht mehr bloß Sache der zerstrittenen Parteien vor Ort, die fürs Kriegführen ihre Gründe haben, sondern Mittel, um der übergeordneten europäischen Kontrollmacht Geltung zu verschaffen. Sie stellen das „politische Machtvakuum“ her, das die Aufsichtsorgane der EG diagnostizieren, weil sie darauf scharf sind, es auszufüllen. Zu einer Politik, die materielle Staatsinteressen anderswo durchzusetzen versucht, verhält sich dieser Anspruch auf Oberhoheit wie die Methode zur Sache, wie das Prinzip zum Anwendungsfall – von wegen „selbstlos“!
3.
Deswegen folgen aus der Überparteilichkeit der EG auch zunehmend klare und parteiische Unterscheidungen zwischen den unterschiedlichen Kriegsparteien. Zu Anfang, im Juni 91, beschloß sogar noch der deutsche Bundestag mit den Stimmen aller Parteien,
„daß für einen stabilen Zustand des Friedens in Europa auch politische Stabilität auf dem Balkan, und für diese wiederum politische Stabilität in Jugoslawien erforderlich ist, weil dies im Interesse der europäischen Staatengemeinschaft sicherstellen würde, daß die sechs Republiken miteinander verbunden bleiben.“
Am Ende machen alle EG-Staaten bei der Anerkennung der abtrünnigen Republiken Slowenien und Kroatien als selbständiger Staaten mit. Warum? Etwa, weil ein anständiger Staaten immer für die Kleinen und Schwachen ist und sie gegen die Großen in Schutz nimmt? Da gäbe es viel zu schützen; die neuen kleinen Serben-Republiken im bisherigen Kroatien zum Beispiel; aber die heißen „selbsternannt“ und sind damit schon unten durch. Oder weil die Bundesarmee blutiger zu Werk geht? Das wäre ja das allerneueste Kriterium für die unvoreingenommene Beurteilung eines Krieges – nachdem man doch gerade gelernt hat, daß im Krieg der Erfolg die brutalsten Mittel heiligt. Oder werden die Spalter des alten Staates ganz überparteilich dafür belohnt, daß sie nach Marktwirtschaft und Demokratie lechzen, während die Serben … – was bleiben die eigentlich schuldig? Aufs freie Wählen verstehen sie sich wie alle anderen Völker, und für den marktwirtschaftlichen Neuaufbau setzen sie auf die EG nicht anders als ihre Nachbarn. Das Schreckensbild vom „serbischen Panzerkommunismus“ mag ja zur Erbauung eines Publikums, das Kommunismus schon immer für eine Sache von geborenen Untermenschen gehalten hat, ganz nützlich sein; wahr ist es deshalb noch lange nicht. Ein reichlich verlogener öffentlicher Moralismus hat da das Seine getan, den politischen Entscheidungen zu entsprechen und sie anzustacheln.
Daß die alte Zentralmacht, insbesondere ihre Armee, sowie die Republik Serbien, die sich immer dahintergestellt hat, so rasch und eindeutig zum Bösewicht geworden ist, das ist von der Konstellation her vorgezeichnet. Die Zentralregierung und ihre Hintermänner maßen sich eine Ordnungsbefugnis an, eine Entscheidungshoheit über Erhalt oder Zerfall des „Vielvölkerstaats“, welche die EG-Instanzen für sich in Anspruch nehmen. Und weil ein hoheitliches Gewaltmonopol nun einmal unteilbar ist, bleibt an der Bundesarmee und an Serbien als Makel hängen, daß sie überhaupt nach eigenen Vorstellungen ein neues Jugoslawien gestalten wollen und auch noch ein paar Gewaltmittel dafür haben und die sogar ein Stück weit einsetzen. Umgekehrt liegt das entscheidende Plus der abtrünnigen Republiken und ihrer separatistischen Machthaber schlicht darin, daß ihre Souveränität gar nichts anderes ist als eine Schöpfung der EG, ein Produkt ihrer Kontrolle. Deswegen ist immer klar und bedarf nicht erst ausführlicher, unbestechlicher Recherchen und Nachweise, daß Bundesarmee und -regierung und ihre serbischen „Drahtzieher“ jeden EG-Friedensplan hintertreiben, wohingegen in Slowenien und Kroatien die Friedensliebe zuhause ist. Letztere sind Geschöpfe des europäischen Anspruchs auf Oberhoheit über den Balkan, wie er schon aus der noch pro-gesamtjugoslawischen Bundestags-Resolution spricht, erstere konkurrieren damit – keine Frage, wer da besser den EG-Vermittlungsvorschlägen entspricht.
4.
Damit kürzt sich die EG-Intervention keineswegs wieder auf eine platte Parteilichkeit zusammen, so daß man sich doch auf die Suche nach materiellen oder sonstwie bestimmten Vorteilen des slowenischen und kroatischen Nationalismus für den Gemeinsamen Markt begeben müßte. Hier entsteht Parteilichkeit aus dem Willen, den Standpunkt der übergeordneten, alleinzuständigen Ordnungsmacht geltend zu machen; Partei genommen wird für Gebilde, deren staatliches Lebensrecht mit der in Brüssel – oder Den Haag oder Lissabon, jedenfalls in Bonn und Paris – beschlossenen Anerkennung zusammenfällt. Die EG schafft sich so eine politische Einflußzone, die ihr in noch anderer Weise verpflichtet ist als die Regionen, die die Gemeinschaft längst zum Anhängsel ihrer Wirtschaftsmacht hergerichtet hat, wie das ja mit dem alten Jugoslawien auch schon weitgehend der Fall war. Aus den Trümmern untergegangener Staaten neue Souveräne erschaffen, das begründet Satelliten-Verhältnisse der besseren Art. Und so etwas will die EG im Rest des Kontinents, nach dem sie ihre Gemeinschaft benannt hat, einrichten.
5.
Daß sie sich damit in eine gewisse Konkurrenz mit anderen altehrwürdigen Organen zur Aufrechterhaltung einer internationalen Hausordnung begibt, ist bekannt und beabsichtigt.
„Es muß ausgeschlossen werden, daß innereuropäische Krisenherde wie Jugoslawien plötzlich vor den UNO-Sicherheitsrat gelangen, weil es keine europäische Vermittlung gibt“,
meinte der große deutsche Sozialdemokrat, für den Frieden schon immer dasselbe wie europäische Alleinzuständigkeit war, Nobelpreisträger Willy Brandt im Mai 91. Und das Echo aus New York war nicht einmal ablehnend:
„Da sich die Europäer schon engagiert haben, ist jede Doppelgleisigkeit zu vermeiden“,
hieß es aus dem Generalsekretariat der Vereinten Nationen, die doch durch ihre Rolle im Irak-Krieg so entscheidend aufgewertet worden sein sollen, zum entscheidenden Welt-Kontrollorgan. Die organisierte Völkerfamilie nahm damit die gleiche Haltung ein wie ihr führendes Mitglied; welche auch sonst. Die USA bemerken nämlich auch, daß die Europäer sich auf dem Balkan an einer Alternative versuchen; und zwar nicht bloß zu den diplomatischen Institutionen, die für „Krisenherde“ zuständig sind, sondern zu der Macht selber, die sich durch Krisen in aller Welt zum Ordnen herausgefordert sieht, zur amerikanischen Weltmacht. Sie halten den Konkurrenzwillen der Europäer aber für nicht so bedeutsam, daß sie ihm eine Abfuhr erteilen müßten; erstens, weil sie sich ihrer Konkurrenzlosigkeit in Weltordnungsangelegenheiten noch immer oder wieder sehr sicher sind -
„Der Auftrieb der USA nach dem Golfkrieg schiebt den europäischen Ehrgeiz aufs Nebengleis“ (International Herald Tribune im Juni 91) –,
zweitens, weil sie den Erfolg der europäischen Bemühungen nicht sehr hoch veranschlagen:
„Die jugoslawische Krise hat nur zu überzeugend bewiesen, daß Europa weit davon entfernt ist, zu einer politischen Macht zu werden, die seinem ökonomischen und militärischen Gewicht, das es besitzt, entspricht“ (dasselbe Blatt im September 91).
Gleichgültig, wieviel an dieser Diagnose stimmt – dazu später –: Die politische Absicht der EG-Staaten ist eindeutig, und daß sie fortwährend betonen, ihre Friedensmission sei als ein weiterer Beitrag im Rahmen und zum Nutzen des westlichen Bündnisses zu verstehen, ist verräterisch. Tatsächlich haben sie in ihrem Ehrgeiz außer ihrem großen Verbündeten keinen Gegner mehr. Im Juli, vor dem „Putsch“, hat die Sowjetunion sich zum letzten Mal mit einer höflichen Warnung vernehmen lassen:
„Die Position einer Reihe westlicher Politiker hat die Führung Sloweniens und Kroatiens zu den extremen Schritten ermutigt, die heute die Welt so alarmieren.“ (Prawda, 1.7.91).
Mittlerweile sind ihre Nachfolgestaaten selber „Fälle“, und zwar für genau den Regelungsbedarf, den die EG in Jugoslawien erkannt und zu ihrer Sache gemacht hat. Den Bezug stellen die europäischen Politiker selber her, indem sie für die Betreuung der GUS und ihrer erwartungsvoll begutachteten internen Konflikte denselben KSZE-Konfliktregelungsmechanismus ins Spiel bringen wie für den kriegerischen Zerfall Jugoslawiens. Dieser „Mechanismus“ ist zwar für sich genommen kein übermäßiges Machtmittel; aber darauf kommt es auch gar nicht so sehr an. Er verbrieft immerhin als Recht, was die EG-Staaten im Fall Jugoslawien praktiziert haben, nämlich die neue europäische Doktrin von der begrenzten Souveränität unordentlicher Nachbarn: ein Eingriffsrecht im Interesse der richtigen Ordnung, gegen die der betroffene Staat kein Veto-Recht haben soll.
6.
Am Fall Jugoslawien übernimmt Europa – das organisierte, westliche – selbstbewußt die schwere Bürde, sich zur alternativen Weltordnungsmacht aufzubauen, deren Wille der restlichen Staatenwelt grundsätzlich und methodisch übergeordnet ist; und es ist kein Geheimnis, zu wem sie die Alternative sein will. Sie entnimmt ihr anspruchsvolles Vorhaben dem Vergleich mit der Führungsmacht der westlichen Welt. Die kann es sich herausnehmen, das politische Treiben anderer Staaten streng nach seiner grundsätzlichen Übereinstimmung mit ihren Aufsichtsinteressen zu kontrollieren – und das will die EG auch. An der Neugestaltung des Balkan will sie ihre Kompetenz beweisen. Das – und nicht das Sterben von Serben und Kroaten oder der nationalistische Wahn, für den sie geopfert werden – macht die weltpolitische Bedeutung des jugoslawischen Bürgerkriegs aus.
Der europäische Weltordnungsfall Jugoslawien: Eine Chance für Deutschland
Ihren gemeinsamen Standpunkt hat die EG in derselben Weise herausgebildet, wie sie noch alle ihre politischen Fortschritte geschafft hat: im Streit. Deutschland auf der einen, Frankreich und Großbritannien auf der andern, die niederländische Ratspräsidentschaft auf der dritten Seite waren sich herzlich uneinig. Aber worüber?
1.
Das Material für internen Ärger geben natürlich die Kampfparteien in Jugoslawien her: Bekanntlich sind die Deutschen schon viel länger und viel mehr für ein selbständiges Slowenien und Kroatien als die andern; Frankreich hat irgendwie noch immer was für ein Gesamtjugoslawien übrig. Aber so ist es gerade nicht, daß ein jeder „seine“ Partei im Bürgerkrieg unterstützt und schaut, daß sie gewinnt. Ganz jenseits der Frage, was in Jugoslawien für oder gegen wen läuft, streiten die EG-Partner miteinander um ihre Einigkeit in der Jugoslawien-Affäre. Sie gehen nicht auseinander und treiben nationale Sonderinteressen auf dem Balkan voran, sondern bemühen sich in erbitterter Konfrontation um die gemeinsame europäische Linie. Der Inhalt dieses Streits sind also gar nicht die Kampfparteien und was aus ihnen wird, sondern die interne Konkurrenz der großen EG-Partner um die für sie viel entscheidendere Frage der Federführung beim gemeinsamen Ordnungsprojekt. Die Serben und Kroaten können jedenfalls am allerwenigsten dafür, daß es hier neue Kräfteverhältnisse und Prioritäten auszufechten gibt.
Die Nettigkeiten, die die EG-Parteien einander um die Ohren hauen, lassen an diesem Inhalt und tieferen Sinn ihres Streits keinen Zweifel.
2.
Die alten Siegermächte – und zwar beider Weltkriege! – Frankreich und Großbritannien entdecken den Einbruch der vergangenen Geschichte des Kontinents in die heile Welt der EG, so als wäre ihr eigener Entschluß für Europa und die gemeinsame Absage an jenen Nationalismus, der diesen Erdteil einst in „verhängnisvolle Kriege“ gestürzt hat, ein bloßes Gerücht gewesen. Kaum ist der gemeinsame Feind im Osten und der Zwang, gegen ihn gemeinsame Sache zu machen, weggefallen, gilt es auf den alten neuen Gegner in den eigenen Reihen aufzumerken:
„Eine Art von intellektuellem Terrorismus, der aus dem Kalten Krieg stammt, verbietet bis jetzt, daß man die Folgen einer deutschen Vormacht im Herzen Europas, das Verschwinden jeder soliden Macht im Osten und einer allgemeinen Grenzrevision erwähnt, die auf die Dauer auch die Verlierer von 1945 begünstigen könnten.“ (Libération, nach FAZ vom 11.10.91)
Die schöne innereuropäische Kompetenzverteilung, die zwar nie die Wahrheit über die EG war, an die man aber jenseits des Rheins gern geglaubt hat, ist schlagartig kaputt, und gute Europäer finden ihr eigenes Argument für Europa nicht wieder:
„Der letzte Gipfel von Maastricht hat gezeigt, daß Europa angesichts der großen Auflösung des Ostens wie ein robuster Pfeiler der Stabilität zu erscheinen wünscht. Das verhindert nicht, daß alle sich einer neuen Gegebenheit bewußt sind: des Anspruchs Deutschlands, eine bedeutende Rolle sowohl innerhalb der EG wie in Europa und auf der Welt zu spielen. … Damit ist ein stillschweigendes Übereinkommen aufgekündigt: Die politische Bestimmung (der EG) war irgendwie die Sache Frankreichs; Deutschland bildete den ökonomischen Motor. Diese Konstruktion ist in Gefahr. Deutschland, das heute 80 Millionen Menschen zählt, hat keinen Feind im Osten mehr. Für Deutschland ist die Nachkriegszeit vorbei und damit auch seine politische Unterlegenheit. Seine ökonomischen Ziele sind so hoch gesteckt – trotz der Kosten für die alte DDR –, daß selbst der französische Franc zum Gefangenen der DM-Zone wird …“ (Le monde diplomatique 1/92)
Nachträglich gehen den Partnern Deutschlands die Augen darüber auf, was sie früher alles übersehen haben:
„Nachdem Deutschland seine Einheit und Souveränität wiedergefunden hat, will es jetzt ohne Komplexe eine größere Rolle in der Region spielen, mit der es immer enge Beziehungen unterhalten hat… (Es folgt die Erinnerung an die von Strauß begründete Staatengemeinschaft „Alpenregion“:) …eine friedliche Möglichkeit, einen Keil nach Jugoslawien zu treiben, von der die Deutschen nicht viel Aufhebens gemacht haben.“ (Le Monde, 4.7.91)
So wird der Europäischen Gemeinschaft geradezu die neue Bedeutung angetragen, die Deutschen in Schach zu halten:
„Wenn die Gemeinschaft verdünnt wird, wird Deutschland Europa beherrschen. Die Deutschen erstreben selbst keine Vormachtposition. Aber wenn man die Tschechoslowakei, Slowenien, Kroatien und Ungarn nimmt, dann sieht man, daß eine deutsche Welt, ein barockes Europa sehr wohl existieren.“ (der ehemalige französische Außenminister François-Poncet in der Süddeutschen Zeitung vom 18.10.91)
Bei allem Unsinn doch eine klare Aussage darüber, welche prinzipiellen, wieder gewissermaßen methodischen Fragen des innereuropäischen Kräfteverhältnisses das deutsche Engagement in der Jugoslawien-Krise für die Partner aufwirft, gerade weil sie von Europa als ihrem nationalen Projekt nicht lassen wollen.
3.
Hierzulande werden „antideutsche Ressentiments“ aus dem Rest Europas gemeldet und für absurd befunden. Mit Empörung wird aus serbischen Zeitungen zitiert, die ihren Vorwurf einer deutschen Großmachtpolitik – „Viertes Reich“ – mit einer Blütenlese aus amerikanischen, französischen und englischen Quellen untermauern. Ansonsten nehmen deutsche Politiker jedoch den Ärger des Auslands als neidische Anerkennung, die ihnen da vom Ausland gezollt wird.
Und die ihnen auch zusteht. Wg. „Wiedervereinigung“ nämlich. Von wegen, hier hätte eine große nationale Familie endlich wieder zusammenfinden dürfen. Deutsche Politiker im Jahr der Jugoslawien-Krise reden Klartext darüber, was dieses zwischenmenschliche Großereignis wirklich bewirkt und ihnen gebracht hat: das Ende der Nachkriegszeit und der „Bonner Bescheidenheit“, neue europäische Machtverhältnisse und eine Weltlage mit neuen Eingriffsmöglichkeiten und -rechten für sie. Ein Erfolg ihrer nationalen Macht, der gebieterisch seine Fortsetzung fordert. Darauf stehen die Deutschen und können nicht anders:
„Die Deutschen hätten schon im Grundgesetz klargestellt, daß sie ihre Einheit zusammen mit der Einheit Europas sähen. Dabei werde es bleiben. Wenn trotzdem Sorge aufkomme, die Deutschen würden zu stark, müsse man dem weltoffen begegnen und ansonsten damit leben. Wer immer nur beliebt sein wolle, werde nichts bewegen und am Ende allein dastehen.“ (Bundeskanzler Kohl nach Süddeutscher Zeitung vom 11.1.92)
Die deutsche Gier nach weltpolitischer Stärke wird nicht mehr dementiert; das käme den starken Männern in Bonn selbst unglaubwürdig und unwürdig vor. Sie versprechen ihren Nachbarn dafür hoheitsvoll, ihnen nicht groß übelzunehmen, wenn sie darunter leiden:
„Unser Land ist weltoffen und solidarisch. Wir sind Nummer Eins, aber wir ordnen uns ein. Mit der deutschen Wiedervereinigung ist deutsche Außenpolitik schwieriger geworden, weil wir jetzt überall Einfluß haben. Ressentiments aus der Geschichte kommen hoch und Neid auf Deutschland. Deutsche Außenpolitik muß deshalb taktvoll sein.“ (derselbe im ARD-Interview am 15.1.92)
Das haben die Partner eben nicht geschafft: Sich aus der Konkursmasse des Sozialistischen Lagers gleich einen ganzen Staat einzuverleiben. Und egal was sonst noch aus Deutschlands neuer Ostzone wird: Ein enormer Zuwachs an „weltpolitischer Verantwortung“ ist sie auf alle Fälle. Das berechtigt nicht nur dazu, in diesem Sinne weiterzumachen und in Europa einiges zu „bewegen“: Europa umzuräumen ist deutsche Pflicht. Schon aus Dankbarkeit für den nationalen Erfolg müssen die Deutschen sich konsequent einmischen und neue Staaten gründen:
„Wir können anderen nicht verwehren, was wir für unser Volk erfolgreich in Anspruch genommen haben. Logischerweise muß, was gerade gestern für die baltischen Staaten galt, heute für die Slowenen und Kroaten gelten.“ (Engholm laut Frankfurter Rundschau vom 14.10.91)
Diese Heuchelei, Deutschlands Schritt zur „Nummer Eins“ wäre im Prinzip dasselbe wie die Einrichtung von machtlosen Staatsgeschöpfen mit geschenkter Souveränität, ist nicht zufällig dem SPD-Vorsitzenden eingefallen: Der ist selbst so gerührt, wenn ihm zum deutschen Imperialismus, den er fordert, eine idealistische Phrase eingefallen ist, die den Fortschritt deutscher Macht zum selbstlosen Dienst am Guten stilisiert, daß er beinahe daran glaubt. Auf den fordernden imperialistischen Gehalt anerkannter menschenrechtlicher Höchstwerte verstehen sich die regierenden Christen aber genauso gut:
„Gerade Deutschland ist nach seiner Vereinigung gefordert, den Völkern in dieser Region zu helfen, ihr Selbstbestimmungsrecht durchzusetzen.“ (Erklärung der CSU, Süddeutsche Zeitung vom 30.9.91)
Sie kriegen damit sogar, wenn schon nicht in der Sache, so doch für die Zwecke ihrer Parteienkonkurrenz, eine Differenz zum dicken Inbegriff deutscher Verantwortung für den Rest der Welt her:
„Der Fehler deutscher Außenpolitik ist, daß sie der gewachsenen Verantwortung Deutschlands nicht ausreichend Rechnung getragen habe. Nach Lage der Dinge könne die deutsche Position gar nicht anders sein, als das Schwergewicht unserer Argumentation und unserer Politik auf das freie Selbstbestimmungsrecht der Völker zu legen.“ (Lamers, außenpolitischer Sprecher der CDU, Süddeutsche Zeitung vom 4.7.91)
Noch schöner der christliche Einfall, deutsches Auftrumpfen aus Deutschlands unseliger Vergangenheit zu begründen, für die wir alle uns noch immer in Grund und Boden schämen. Die Heuchelei, die schon beim Golfkrieg so gut geklappt hat, läßt sich natürlich im Fall Jugoslawien wieder neu auflegen, gerade weil Hitler dort auch schon mal aufgeräumt hat: Sich herauszuhalten
„schüfe ein gefährliches Irrlicht moralischer Indifferenz, das wir uns angesichts unserer unseligen Vergangenheit nicht leisten können.“ (der bayrische Innenminister Stoiber, Süddeutsche Zeitung vom 24.7.91)
Nur merkwürdig, daß man das in anderen zivilisierten Ländern nicht so sieht. Dort ist man eher der Meinung, daß durch die freizügige Inanspruchnahme des Menschenrechts auf „Selbstbestimmung der Völker“ einiges an schätzenswerter politischer Ordnung zu Bruch geht. Das neue Völkerrecht, das deutsche Politiker so glühend vertreten – freilich auch in Maßen: sie mögen schon noch darüber entscheiden, wer „Volk“ im Sinne deutscher Völkerrechtspflege ist; irgendwelche Serben in Kroatien sind es z.B. nicht –, geht Amerikanern und Franzosen eher gegen den Strich:
„Separatismus ist Chaos und Anarchie“(Eagleburger); „Der negative Nationalismus wie in Jugoslawien artet, wie dieses Beispiel zeigt, in einen blutigen Krieg aus“(US-Präsident Bush nach Süddeutscher Zeitung, 11.11.91); „Ich bin nicht der Meinung, daß das Feinste vom Feinsten des menschlichen Fortschritts darin besteht, das Mosaik der Stämme wiederherzustellen… Selbstbestimmung ja, aber eine wilde Selbstbestimmung in alle Richtungen – nein!“ (Frankreichs Präsident Mitterrand, Süddeutsche Zeitung, 20.9.91)
4.
Mit Jugoslawien und den dortigen Bürgerkriegsparteien haben diese kulturvollen Einwände gegen ein ungezügeltes völkisches „Selbstbestimmungsrecht“ genauso viel oder wenig zu tun wie der deutsche Völkerrechts-Moralismus. Was wirklich bemerkt und bemängelt wird, das ist der unübersehbare Wille des größeren Deutschland, mit den nationalistischen Separationswünschen slowenischer und kroatischer Politiker samt Fußvolk Politik zu machen, nämlich – so stimmt ja die Anknüpfung an das „Vorbild“ der deutschen Einigung! – seine Politik der Neuordnung Europas weiterzutreiben und dafür schon wieder einen bestens eingeführten souveränen Staat aufzulösen. Frankreich muß gar kein Parteigänger der altjugoslawischen oder serbischen Sache werden, um zu erkennen, daß hier ein Produkt der von der Grande Nation mitgestalteten Staatenwelt abgeräumt wird:
„Jugoslawien ist eine wohl überlegte und nicht improvisierte Schöpfung Frankreichs und seiner Verbündeten nach dem 1. Weltkrieg. … Sind diese Tatsachen derart aus unserem Gedächtnis entschwunden, daß wir uns beeilen könnten, die Sache Jugoslawiens aufzugeben und – unter europäischem Vorwand – Deutschland zu folgen, das mit Italien, dessen Regierung Sehnsucht nach der Achse Berlin-Rom zu haben scheint, das Ende des jugoslawischen Staates und die Anerkennung eines kroatischen Staates will?“ (Debrè, ehemaliger französischer Ministerpräsident, in Le Figaro, 9.10.91)
Die nostalgische Einkleidung kann man gleich weglassen, denn das Argument ist klar genug: Der Ordnungsanspruch deutscher Balkan- und überhaupt Europapolitik, das begreifen die auswärtigen Weltordnungspolitiker sofort, ist darauf angelegt, die bisherigen Verhältnisse in der Staatenwelt aufzulockern, disponibel zu machen und so umzugestalten, daß am Ende keines der gewohnten Kräfteverhältnisse, auch innerhalb des vereinigten Westens, mehr stimmt. Das muß man nämlich schon wollen, um so wie die Deutschen auf den innerjugoslawischen Separatismus einzusteigen und ihm, als der Krieg noch gar nicht recht in Gang gekommen ist, das schöne Ziel vor Augen zu stellen: „Mit jedem Schuß rückt die staatliche Unabhängigkeit Kroatiens näher!“ – was Kroaten sich von einem deutschen Außenminister nicht zweimal sagen lassen; die verstehen dieses goldene Genscher-Wort nicht miß, als Aufruf zur Mäßigung, sondern ganz richtig als Verheißung für unerbittliches Durchhalten um jeden Preis. Jedenfalls schlagen sie sich für ihr Staatsprojekt und tun damit, egal was sonst noch herauskommt, dem deutschen Außenminister den Gefallen, Jugoslawien zum Material für seine Neueinteilungspolitik zu machen. Wie über herrenloses Gelände wird darüber verfügt – wer dabei welche Drecksarbeit erledigt und ob am Ende die UNO eine Ordnungstruppe schickt, ist daneben gar nicht von so überragender Wichtigkeit.
5.
Kein Wunder, daß diese entschlossene deutsche Politik den Anrainern Jugoslawiens Eindruck macht. Österreich entdeckt seine alte, mit dem jähen, wenn auch schon länger zurückliegenden Untergang des Habsburgerreiches unterbrochene Liebe zu den Slowenen wieder, und manche Landespolitiker können sich ein 10. Bundesland vorstellen. Der italienische Außenminister erwägt die Revision des einst mit Tito abgeschlossenen Grenzvertrages; Politiker Norditaliens würden es sich zur Ehre anrechnen, ein italienisches Istrien in ihren Reihen begrüßen zu dürfen. Ungarn erinnert sich an den ungerechten Trianon-Vertrag, in dem diesem Staat, der sich jetzt doch voll Europa zugewandt hat, vor 70 Jahren die Vojvodina abgenommen wurde. Griechenland nimmt Partei für die Serben, weil es keinen unabhängigen Mazedonenstamm kennen will, also auch keine Nachbarrepublik dieses Namens. Bulgarien sieht dieselbe Sache andersherum und ist für eine Abspaltung dieser Republik, um ihr beste brüderliche Bande antragen zu können. Selbst die demokratisierten albanischen Politiker finden neben der Einleitung der Marktwirtschaft, um deren Opfer sich ja die italienische Marine rührend kümmert, noch Zeit, sich um den staatlichen Verbleib der Kosovo-Albaner zu sorgen. Die politischen Vertreter der jugoslawischen Muslime sind in der Türkei gern gesehene Gäste. Offensichtlich erleben nicht bloß Kroaten und Serben einen Aufbruch nationaler Gefühle.
6.
An den deutschen Standpunkt reicht diese allgemein auflebende Lust auf Beute allerdings gar nicht heran. Deutschlands Neueinteilungs-Bedürfnis ist gar nicht auf neue Provinzen oder Kolonien auf dem Balkan aus, deswegen damit auch gar nicht zu befriedigen. Die Bonner Politik will am Fall Jugoslawien eine weltpolitische Linie festlegen, die sich zuerst die EG-Partner unbedingt zueigen machen sollen – gerade dieser Anspruch auf Gefolgschaft, und nicht irgendwelche „Alleingänge“ des einen oder anderen Partners, heizt ja den EG-internen Streit so heftig an. Inhalt dieser europäischen Leitlinie ist ein Revisionismus von ziemlich grundsätzlicher Art: der Wille, zunächst in Europa, aber nicht auf Europa beschränkt, die Verhältnisse in der Staatenwelt zu revidieren. Die „wiedervereinigte“ „Nummer Eins“ stellt den Antrag, das internationale Kräfteverhältnis neu, und zwar auf sich zuschneiden zu dürfen, und vereinnahmt dafür als erstes seine Euro-Partner. Denen müßte nach deutscher Rechnung ebenso an einer Generalrevision aller unter dem Ost-West-Gegensatz entstandenen und „verkrusteten“ weltpolitischen Zuordnungen, Zuständigkeiten usw. gelegen sein. Und wenn nicht ebenso, weil manche Nachbarn die Staatenwelt, wie sie ist, mit größerem Recht als ihr Werk betrachten können als die erst jetzt in den Vollbesitz ihrer Kräfte gelangte Verlierernation, dann eben ein bißchen weniger: Deutschland übernimmt schon die Führung.
7.
Was sie da betreibt, setzt die deutsche Politik selbst gern in eine Beziehung zum Golfkrieg. So wie die USA am Golf, so müßte Europa in Jugoslawien – und unabsehbaren ähnlich gelagerten Fällen – zu Werk gehen können. Rüstungsbedarf wird angemeldet und der Rest von Staats-Pazifismus zertrümmert, der jahrzehntelang als deutsche Wiederbewaffnungs- und Nato-Ideologie vom nicht zu führenden, sondern zu verhindernden Krieg gute Dienste geleistet hat:
„Jugoslawien ist ein Beispiel für eine Aufgabenstellung, die sich künftig häufiger ergeben könnte. Das gilt auch für die Einbindung deutscher Streitkräfte in die europäische Struktur der Gemeinschaft bzw. der WEU. Das jugoslawische Beispiel zeigt, daß die bisherige deutsche Haltung unmöglich noch längere Zeit aufrechterhalten werden kann.“ (Lamers von der CDU, FAZ vom 26.7.91)
Das alles läuft unter dem ideologischen Stichwort „Konfliktlösung“:
„Eine europäische Friedenstruppe läßt sich binnen 14 Tagen auf die Beine stellen. Wir müssen nicht gerade in der vordersten Linie stehen, aber – anders als im Golfkrieg – an Ort und Stelle an der Konfliktlösung beteiligt sein.“ (derselbe in der Süddeutschen Zeitung vom 18.9.91)
Der besondere Reiz dieses Stichworts liegt nicht bloß in seiner Leistung, Gewalt moralisch zu rechtfertigen. Bemerkenswert ist die Sichtweise, wonach der Bürgerkrieg in Jugoslawien ungefähr dasselbe sein soll wie der Überfall des Irak auf Kuwait, nämlich ein zweifelsfreier Eingriffstatbestand für Mächte mit weltpolitischer „Verantwortung“. Noch bemerkenswerter, daß mit dem Etikett „Lösung“ das amerikanische Eingreifen gezielt in einen Topf geworfen wird mit der deutschen Einmischung auf dem Balkan, so als läge in beiden Fällen dasselbe Ordnungsinteresse vor, nur eben an einem anderen Objekt. In Wahrheit ist nämlich das Gegenteil der Fall.
Wofür auch immer die USA am Golf Krieg geführt haben: für eine Aufmischung wohl eingerichteter Kräfteverhältnisse ganz sicher nicht. Die allgemeine Zielangabe hat zwar „neue Weltordnung“ gelautet; das Neue daran ist aber erklärtermaßen, daß auch nach dem Ende des alles übergreifenden „Ost-West-Konflikts“ der alte Monopolanspruch der USA auf wirksame Kontrolle über die Staatenwelt und fällige Korrekturen Bestand haben, sogar mehr denn je wirksam werden soll. Eingerichtete, funktionierende Verhältnisse werden nicht gestört, schon gar nicht durch aufstrebende Nationalstaaten, die ihren Tabellenplatz im Weltgeschehen unbedingt verbessern wollen: Das ist die Lehre, die die USA mit ihrem Krieg am Golf erteilen und verankern wollten.
Und das ist nun eben so ungefähr das Gegenteil von dem, was Deutschland im Jugoslawien-Konflikt treibt und betreibt. Deutschland ergreift da die Gelegenheit für eine Revision der politischen Landkarte; und wenn alle Verantwortlichen mit größter Sicherheit davon ausgehen, daß gleichartige Fälle sich wiederholen, dann geben sie weniger ihrer Sorge Ausdruck, daß die Erhaltung wünschbarer Zustände noch viel Mühe kosten wird; dann drücken sie vielmehr die hoffnungsvolle Erwartung aus, daß die Zukunft mit ihren absehbaren nationalistischen Konflikten noch ganz viele Gelegenheiten bieten wird, ganz neue politische Landkarten zu zeichnen. Indem es den jugoslawischen Bürgerkrieg erstens zu einem Krisenfall erklärt, der zweitens nach europäischer Regelung ruft, die drittens einen Staat kaputtmacht und einige neue stiftet, tritt Deutschland in prinzipiellen Gegensatz zum Konservativismus der amerikanischen Weltordnungspolitik. Und es ist schon eine Spitzenleistung deutscher diplomatischer Heuchelei – aber mit der hat sich der „Genscherismus“ ja ohnehin längst in aller Welt bestens eingeführt –, diesen Gegensatz als überfällige Pflichterfüllung gegenüber der amerikanischen Führungsmacht hinzustellen, als Einlösung aller Forderungen, die die USA beim Golfkrieg an ihre Verbündeten gestellt, und aller Versprechungen, die die Deutschen ihnen gegeben hätten.
8.
Die skeptische Frage nach den Mitteln einer solchen Weltpolitik des Umräumens und Neu-Einrichtens lassen deutsche Politiker sich gerne stellen, weil sie nur zustimmen können, daß es daran noch sehr fehlt – verglichen mit der Größe des Vorhabens. Sie lassen solche Fragen aber nicht als Einwand gegen ihren Standpunkt gelten. Das haben sie im Zuge der EG-Krisenbewältigungspolitik klargestellt, als der niederländische Ratspräsident dem ewigen deutschen Genörgel, man sollte mehr und direkter eingreifen, die Erkundigung entgegensetzte, ob Deutschland denn seine Bundeswehr für diesen edlen Zweck abstellen wollte. So beim Wort genommen, besannen sich die deutschen Politiker doch lieber wieder auf ihr Grundgesetz, von dem sie sich bislang ein weiterreichendes militärisches Engagement untersagen lassen. Die aufgeregte Öffentlichkeit mochte das überhaupt nicht schlucken; der Moralismus des Golfkriegs-Vergleichs hat ihr so gut gefallen, und nun doch wieder „Drückebergerei“! Dabei paßt die Zurückweisung des Ansinnens, vor Ort für Ordnung zu sorgen, genau zum politischen Zweck. Es geht den Deutschen eben überhaupt nicht um Waffenbrüderschaft mit irgendeiner Partei vor Ort, um militärische Stationierungsrechte in Kroatien oder gar um die Aufgabe, innerhalb des ehemaligen Jugoslawien Grenzen zu überwachen und wildgewordene Nationalisten in Schach zu halten. Das alles anderen überlassen, die damit deutschen Neuordnungsvorstellungen Genüge tun; die gewünschten Neueinteilungen in europäischer Solidarität und durch die UNO abgesegnet von deren Blauhelmen vornehmen lassen; also: keine Alleingänge unternehmen, sondern eine politische Linie verallgemeinern, dadurch daß andere sie durchsetzen: Das ist europäische Weltpolitik, wie Deutschland sie versteht.
Vorläufige Bilanz von Schlächterei
und Schlichtung auf dem Balkan:
Zwei neue Staaten und ein Schritt in
Richtung auf eine Weltmacht Europa nach deutschem
Plan
1.
Seit die Regionalpolitiker des alten Jugoslawien ihren Streit um nationale Autonomie in Gang gebracht haben, ist der Meinungspluralismus im demokratischen Europa um eine feste Rubrik reicher. Der eintönige Inhalt: Europa blamiert sich.
Das ist also gleich klar und allgemein akzeptiert, daß das Bündnis der Zwölf zuständig ist und herausgefordert, wenn auf dem Balkan gestritten wird. Und damit ist sofort auch schon eine Forderung auf dem Tisch, die nie mehr in Frage gestellt wird, sondern als fraglos gültiger Gesichtspunkt in jede Betrachtung des Geschehens eingeht: Wo die EG zuständig ist, da hat jeder andere Anspruch sein Recht verloren; da wird pariert, ohne Wenn und Aber. Und wenn nicht? Dann gehört durchgegriffen, und zwar bedingungslos, sofort und mit Erfolg.
Den Maßstab muß man nämlich schon anlegen, um sich über eine schmähliche Niederlage der Europäer im Jugoslawien-Streit aufzuregen; um Ohnmacht zu registrieren, wo Parteien, die um ihre Sache immerhin Krieg führen, nicht auf einen diplomatischen Wink hin ihre Sache aufgeben; und nicht bloß das: um diese Ohnmacht gleich auch noch als zutiefst ungehörig zu empfinden. Es ist das Anspruchsniveau, das so empfindlich macht. Die guten Europäer wollen ihre Gemeinschafts-Obrigkeit offenkundig im Besitz eines unbestrittenen, von allen anderen Staaten anerkannten Gewaltmonopols in Europa sehen; darunter tun sie’s nicht und fühlen sich beschämt.
Eine recht totalitäre Sicht der politischen Beziehungen in Europa liegt da vor. Wer sich zur EG zählt, der sieht sich im Verhältnis zu Dritten gar nicht mehr als Partei, die um ihre Ansprüche streiten müßte. So als wäre diese großartige Gemeinschaft schon gar kein Konkurrent unter anderen mehr, sondern konkurrenzloses Aufsichtsorgan über alle anderen, quasi hoheitlich über alle politischen und sogar nationalen Interessen erhaben, die sich aneinander abkämpfen. Nur dieser Standpunkt sieht sich angegriffen, wenn Europas Regelungsanspruch nicht umgehend Erfolg hat, fordert Bestrafung und hält es nicht aus, wenn das Hineinregieren in fremde Länder doch immer noch etwas anderes ist und anders aussieht als Verbrechensbekämpfung.
Dabei übertreibt die europäische öffentliche Meinung gar nicht einmal besonders. Sie saugt sich diesen Standpunkt ja auch nicht selbständig aus den Fingern. Sie macht sich nur auf ihre brutal-moralische Art den Anspruch zueigen, den die Vermittler mit ihren Waffenstillstandsplänen durchaus praktisch aufmachen. Die bestehen ja darauf, daß eine von ihnen betreute Verhandlung und von ihnen ausgesprochene diplomatische Ermahnung dasselbe sein soll wie die Erledigung eines Streits, bei dem es den Parteien um alles geht. Imperialismus vom Feinsten – keine Frage, wo die Europäer das her haben und wem sie damit Konkurrenz machen wollen.
2.
Dieser unmittelbare, schlagende Erfolg ist in Jugoslawien nicht zu haben. Wie auch. Den Parteien dort geht es schließlich um etwas; daß sie darum Krieg führen, zeigt, daß es ihnen um „alles oder nichts“ geht; nämlich immerhin um Sein oder Nicht-Sein des Allerhöchsten, was es für Staatsmänner und Befehlshaber gibt: einer souveränen Staatlichkeit. Dieses Ziel – neue Staaten zu gründen bzw. den alten zu retten – haben die Machthaber sich ganz autonom selbst gesetzt; nicht in einem fremden Auftrag, an dem ihr Vorhaben sich relativieren würde. Entsprechend „totalitär“, will sagen: ohne irgendwelche anderen Gesichtspunkte gelten zu lassen, gehen sie zur Sache. Völlig fehl am Platze daher solche zivilen Ermahnungen, wie sie der seinerzeitige gesamtjugoslawische Ministerpräsident vor Beginn der „heißen Phase“ noch ausgesprochen hat:
„Marković ruft zur Einheit auf, weil nur so die finanzielle Unterstützung des Westens zu erhalten sei.“ (Süddeutsche Zeitung, 1.6.91)
Kalkulationen mit den Überlebensbedingungen einer Nationalökonomie verlieren ihr Recht, wenn die Nation selbst in Frage steht, um deren Ökonomie sich da jemand sorgen will. Staatengründer oder -retter lassen sich unmöglich von einer Kostenrechnung beeindrucken, die allenfalls den zweckmäßigen Gebrauch der erst einmal zu gründenden oder zu rettenden Staatsgewalt betrifft.
Genau das ist die Schranke, auf die die Vermittlungsversuche der EG gestoßen sind. Mit Erpressungen wurde da ja nicht gespart; auch Wirtschaftssanktionen sind verhängt worden. Solche Instrumente der internationalen Ordnungsstiftung setzen allerdings souveräne Staaten voraus, deren Regierungen einen berechnenden Umgang mit den materiellen Grundlagen ihrer nationalen Macht pflegen. Denen ist die Einsicht vertraut, daß sie das Beste für ihre heimische Wirtschaft und für ihr politisches Ansehen tun, wenn sie sich brauchbar für auswärtige Mächte erhalten, diplomatischen Abmahnungen nach- oder besser noch zuvorkommen – eben „Kooperationsbereitschaft“ zeigen. Nationalisten, die sich einen eigenen Staat erst erkämpfen respektive vor dem Untergang retten wollen, mit dem sie dann darum streiten und feilschen können, welche anderen Souveräne sich etwas sagen lassen müssen und von welchen man sich was sagen lassen muß, sind für solche erpresserischen Berechnungen unempfänglich und für diplomatischen Druck unempfindlich.
Da hilft nichts als hingehen und gewaltsam erzwingen, was man durchsetzen will. Und daß für die Ordnungspolitik der EG dieser Übergang zur Militanz ansteht, wenn sie ab sofort nicht bloß berechenbare Souveräne erpressen, sondern zu allem entschlossene Staatsgründer oder -retter unter ihre Kontrolle bringen können will, diese „Lehre aus dem jugoslawischen Bürgerkrieg“ ist nun wirklich ausgiebig breitgetreten worden. Für eine vorläufige Bilanz ist das überhaupt als erstes zukunftsweisendes Ergebnis festzuhalten: Die EG-Staaten definieren es als außenpolitische Notlage, daß sie noch keine gemeinsamen Weltordnungs-Streitkräfte besitzen, haben sich also einen Auftrag erteilt; auf ihrer politischen Tagesordnung steht endlich die Frage, wie, mit welchen Konsequenzen für ihr Verhältnis untereinander, mit welcher Kompetenz- und Lastenverteilung, in welchem Verhältnis zum ganz neu aufgelebten Militärbündnis, das sie schon haben, zur Nato, mit wieviel Truppen und unter welchem Oberbefehl sie ihre Aufgabe erfüllen sollen. Ihre demokratische Öffentlichkeit haben sie längst soweit, daß der das alles bloß viel zu langsam geht.
Jugoslawien ist zum „Fall“ für den Übergang noch nicht geworden. Daher das Gerücht von der Ohnmacht der europäischen Friedensmission, das die engagierten Missionare selbst zielstrebig in Umlauf gebracht haben.
3.
Daß die EG-Häuptlinge mit ihrer wohlmeinenden Einmischung auf einen autonomen Kriegswillen stoßen und daran ihre Schranke finden, ist allerdings bloß die halbe Wahrheit, und zwar erst die zweite Hälfte. Daß sie es mit einem Krieg um Staats-Neugründungen zu tun haben, war nämlich nicht von Anfang an ausgemacht. Sie selber haben es ganz entscheidend mit dahin gebracht.
Die ersten Einsätze der jugoslawischen Bundesarmee waren darauf gerichtet, es zu einer solchen kriegerischen Streitfrage gar nicht kommen zu lassen. Der Separatismus konkurrierender Regionalpolitiker ist zunächst allemal nicht mehr als ein staatsinterner Verfassungskonflikt, der mit den Mitteln des Notstandsrechts behandelt wird; und genau so, als Anschlag auf die staatliche und gesellschaftliche Ordnung, haben auch in Belgrad die obersten Befehlshaber ihre Staatskrise gesehen – was ihnen hierzulande freilich nicht das gute Image von Terrorismus-Bekämpfern, sondern das schlechte von unverbesserlichen Panzerkommunisten eingebracht hat:
„Die Armee befindet sich in einem aufgezwungenen Kriegszustand und muß die Grundlage Jugoslawiens verteidigen, die Erfolge der sozialistischen Entwicklung und die Interessen aller Völker in Jugoslawien. Das Mehrparteiensystem hat Zwietracht unter der Bevölkerung gesät und hat radikale Gegner der Einheit Jugoslawiens an die Macht gebracht, die, ohne Grenzen zu kennen, versuchen, das gegenwärtige System zu vernichten und den klassischen Kapitalismus in seiner schlimmsten Form einzuführen.“ (General Adžić im Corriere della Sera vom 8.7.91)
Vielleicht darf man ja auch ganz ohne Parteilichkeit daran erinnern, daß die Bundesarmee in Kroatien angefangen hat, um sich zu schlagen, als sie von der Republikführung als Besatzungsarmee definiert und in ihren Kasernen eingeschlossen und ausgehungert wurde: Sehr lange hat sie um ihren Status als Bundesorgan und insofern für den Vorrang des Bundesrechts vor dem Landesrecht der Republiken gekämpft; insofern auch darum, die zivile Staatsräson Jugoslawiens und seinen Platz in der europäischen Staatenordnung zu erhalten. Der Zusammenhang, den die serbische Zeitung Borba hergestellt hat, ist nicht einfach absurd:
„Wenn irgendjemand uns noch die zugesagten 5-Milliarden-Kredite der EG retten kann, dann nur die Bundesarmee.“ (10.6.91)
Verrechnet hat sich die jugoslawische Zentrale in der EG. Wie sollte man aber auch in Belgrad gleich mitkriegen, daß für Europas Führer gar nicht mehr der gewöhnliche Geschäftsgang mit dem altbekannten und wohl berechenbaren Partner Jugoslawien anstand, gar nicht mehr der zivile Verkehr mit Krediten und Exporten – nach offizieller jugoslawischer Staatsmeinung alles andere als „Kapitalismus in seiner schlimmsten Form“! –, auch mit ein paar politischen Erpressungen, sondern die totale Kündigung? Die EG selbst hat sich ja erst nach und nach zu diesem neuen Standpunkt hingearbeitet.
Von Anfang an hat sie dabei nie bloß nachvollzogen, was der innerjugoslawische Streit jeweils schon an „Fakten geschaffen“ hatte; Fakten in dem Sinn, daß durch Todesopfer darüber entschieden wäre, ob sie wegen unberechtigtem Zentralismus oder rechtlosem Provinz-Separatismus anfallen und ob eine auswärtige Macht zum alten Souverän oder zu neuen Machthabern halten soll, gibt es sowieso nicht. Das Umgekehrte gibt es schon eher: daß die Klärung der Frage, ob es bei einer Schlächterei um Notstandsübungen eines unbestritten souveränen Staates oder um berechtigte Abspaltungen neuer Souveräne geht, bei den Todesopfern und anderen Fakten einige Wirkung entfaltet. Und da ist durchaus eine produktive Leistung der EG zu verzeichnen. Mit ihrem Dazwischentreten haben die Vermittler aus dem großen Europa nämlich die Lage definiert: Ab da ist Erhalt oder Zerfall Jugoslawiens keine innerjugoslawische Frage mehr; die Bundeskompetenz, über solche letzten Fragen zu entscheiden, ist zum bloßen Parteistandpunkt herabgesetzt, der auswärtiger Beurteilung und Entscheidung unterliegt; der Krieg ist kein jugoslawischer Bürgerkrieg mehr, der mit irgendeiner inneren „Lösung“ endet, sondern die Auseinandersetzung zwischen Kräften, die als gleichberechtigte Verhandlungs-Gegner und insoweit als gleichrangige Völkerrechtssubjekte anerkannt sind.
4.
Mag sein, die Bundesgewalt in Belgrad und ihre Armee hätten sich auch darüber hinwegsetzen und den alten Staatsverband retten können – nebenbei: Ob das den Viel-Völkern schlechter bekommen wäre, sollten nicht ausgerechnet die für ausgemacht halten, die das „Selbstbestimmungsrecht der Völker“ preisen und da auch nicht fragen, was dessen Klartext, ein militanter Separatismus, den damit Beglückten bringt. Man sollte sich also lieber überhaupt von der Lust am moralischen Aufrechnen trennen und den sachlichen Fortschritt im jugoslawischen Kriegsszenario würdigen, der mit dem Brioni-Abkommen im Sommer 91 erreicht war. Da hat sich nämlich die Bundesarmee auf die Rolle der einen Konfliktpartei festlegen lassen, die den Kampf für ihr Kriegsziel, die staatliche Einheit, einstellt, wenn dafür die Gegenpartei, Slowenien und Kroatien, ihr Ziel der staatlichen Souveränität nicht etwa aufgeben, sondern um drei Monate vertagen. Für die abtrünnigen Provinzen ist dies der entscheidende Schritt zu ihrer Anerkennung als eigenständige politische Subjekte neben der Zentralgewalt; der Vertrag behandelt sie bereits als entstehende Staaten. Für die Armee und ihre Oberbefehlshaber ist die Grenze festgelegt, bis zu der ihre souveräne Zuständigkeit noch reicht: auf Kroatien und Slowenien erstreckt sie sich nicht mehr.
Natürlich blieb es Slowenen und Kroaten überlassen, diese vertragliche Festlegung praktisch wirksam zu machen und die Bundesarmee aus ihrem Land hinauszuwerfen; mit so etwas haben sich die EG-Unterhändler nicht die Finger schmutzig gemacht; sie haben ja bloß vermittelt. Immerhin haben sie aber mit ihrer Vermittlung den Preis festgesetzt, den Slowenen und Kroaten seither bei jeder Kriegsaktion unmittelbar vor sich sehen dürfen: die Loslösung von Belgrad. Slowenien hat das Abkommen denn auch als De-facto-Anerkennung verstanden und die dazu passenden Fakten geschaffen, nämlich die Armee in ihren Stellungen, vor allem an der Staatsgrenze, angegriffen; die Armeeführung wollte sich nicht mit der EG anlegen und hat ihre Truppen abgezogen. Kroatien versucht dasselbe, mit wechselndem Erfolg an der Front, auf alle Fälle aber mit dem einen entscheidenden politischen Erfolg: Mit jedem Kriegstag mehr wird aus dem Aufstand gegen die Zentralgewalt auch faktisch ein Krieg zwischen Kroatien und Serbien. Direkt so war das Brioni-Abkommen zwar nicht gemeint, so wie es ja auch nicht der Freibrief für Slowenien war, als welchen es die dortige Führung genommen hat. Genau so ist das Abkommen aber praktisch „ausgefüllt“ worden, und zwar mehr und mehr von beiden Seiten: Die Bundesarmee verkörpert immer weniger den politischen Willen, die Einheit des jugoslawischen Gesamtstaats zu erhalten, weil dieser Wille selber sich mit dem Fortgang des Kampfes verflüchtigt. Der Weggang der Kroaten und Slowenen aus den zentralen Institutionen des Gesamtstaats überläßt diese dem serbischen Nationalinteresse. Der Auszug von Slowenen und Kroaten aus der Armee läßt diese als serbische Körperschaft zurück; ihr Auftrag reduziert sich darauf, vom serbischen Standpunkt aus genau dieselbe Nationalitätenfrage aufzuwerfen, die die abtrünnigen Republiken mit ihrem Anspruch auf ein eigenes Staatsvolk gestellt haben, nämlich alle die Serben „heimzuholen“, denen ihre bisherige gesamtjugoslawische Heimat mit ihrer Viel-Völker-Gemütlichkeit abhanden gekommen ist. Auf der anderen Seite wird aus separatistischem Unrecht immer mehr ein nationales Recht.
Jeder neue Vermittlungsversuch der EG bestätigt diese Entwicklung. Jede Waffenstillstandsvereinbarung degradiert die Bundesarmee mehr zum bloßen Instrument serbischer Nationalinteressen; bekräftigt auf der anderen Seite den Status der kroatischen Republik als anerkannte Macht, die weniger gegen eine souveräne Zentrale um ihre Autonomie kämpft als gegen einen Nachbarn, der sein Staatsvolk sammeln will, um ihre legitimen Grenzen. Jeder neue Bruch eines Waffenstillstands bekommt so gleichfalls für beide Seiten einen Sinn: Serbien sucht seine Chance, national verkehrte Grenzziehungen des alten Gesamtstaats zu korrigieren; Kroatien verhindert Kompromißlösungen, die die Republik auf einen „Erfolg“ unterhalb der vollen Souveränität, also auf einen Mißerfolg festlegen und darin festhalten könnten. Mit jedem Waffenstillstand sind eben die Gegner erneut auf ihre Kriegsmittel verwiesen, wollen sie selbst noch etwas dazu tun, daß sie für die Neugliederung der politischen Landschaft bei den entscheidenden Organen im Gespräch bleiben. Kein Wunder, daß unbestechliche Beobachter nie ausmachen konnten, welche Seite jeweils mehr Verstöße gegen die vielen Waffenstillstände auf dem Gewissen hat.
So haben sich die Parteien mit ihrer Kriegführung darauf eingestellt, daß über den politischen Ertrag ihrer völlig autonomen Gemetzel ganz woanders entschieden wird. Sie haben auch versucht, an der entscheidenden Stelle den Ertrag einzuklagen, den sie sich wünschen, und dafür an die Konkurrenz ihrer Aufsichtsmächte zu rühren, die ihnen ja auch nicht verborgen geblieben ist:
„Die Kroaten fühlen sich als Opfer des Mißtrauens der anderen EG-Staaten gegenüber Deutschlands, weil dieses insbesondere von Frankreich und Holland verdächtigt werden, nach der Wiedervereinigung eine Sonderrolle in Europa zu spielen.“ (FAZ, 11.10.91)
„Europa dürfe nicht schweigen, wenn auf seinem Boden mögliche Interessenzonen eingerichtet werden.“ (der serbische Ministerpräsident Mitrović laut Süddeutscher Zeitung vom 9.7.91)
Die Entscheidung war allerdings schon in dem Moment gefallen, als die EG-Mächte mit ihrem vermittelnden Eingreifen der Zentralmacht ihre Souveränität über das Geschehen bestritten. Ab da mußte Kroatiens Präsident Tudjman den Krieg im Grunde nur in Gang halten, um seinem Ziel näherzukommen und Genschers Prophezeiung von der mit jedem Schuß näherrückenden Souveränität wahrzumachen – vielleicht haben die deutschen Politiker ja an diesen Sachzusammenhang gedacht, wenn sie den Standpunkt vertreten haben, mit der Anerkennung der neuen Souveräne käme der Krieg zum Erliegen: Zumindest entfällt der erste kroatische Kriegsgrund, „halbe Lösungen“ zu verhindern. Dafür gibt es jetzt den andern: die Grenzen wiederherstellen, die der serbische Gegner verschoben hat. Und das ist für eine erste Bilanz auch festzuhalten: Aus dem Bürgerkrieg, der mit zutiefst verbotenen Waffenlieferungen aus dem großen ausländischen Freundeskreis eines unabhängig-nationalistischen Kroatien hinreichend in Gang gehalten werden konnte, ist durch konsequente Ausfüllung des von der EG vorgegebenen Kampfrahmens ein Grenzkrieg zwischen unfertigen neuen Nationalstaaten geworden, an dem vorerst die UNO-Blauhelme ihre Freude haben.
5.
Jugoslawien ist also kaputt. Die Volkstums-Nationalisten vor Ort haben es zerstört; die EG hat es gebilligt. Oder genauer: sie hat den Zerfall betreut, die Erfolgsbedingungen für Separatisten definiert, dem Krieg so ein realistisches europäisches Ziel verpaßt. Dessen erste Stufe ist erreicht: Zwei neue Kleinstaaten sind auf der Welt.
Kaputt ist natürlich auch so ziemlich alles, womit das alte Jugoslawien der EG und ihrer Geschäftswelt dienlich war; von bedeutenderen Mächten gebraucht zu werden, ist für einen Staat eben offensichtlich keine Existenzgarantie, weil brauchen da allemal benutzen, nicht benötigen heißt. Ob aus den Nachfolgestaaten etwas annähernd ähnlich Brauchbares wird, ist noch völlig offen. Eine politische Ökonomie nach dem Katastrophenmodell des slowenischen Wirtschaftsministers Muncinger dürfte besonnene Kapitalisten jedenfalls eher skeptisch stimmen:
„Der Krieg könnte die Möglichkeit bieten, den Wirtschaftsaufbau auf moderner Basis zu bewerkstelligen, wie in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg.“ (kein Scherz in Erinnerung an einen betagten Farbfilm mit Peter Sellers, sondern ernsthaft zum Besten gegeben in der Süddeutschen Zeitung vom 11.11.91)
Offenbar kommt es darauf aber auch nicht an. Nicht nur für die engagierten Nationalisten, auch für die auswärtigen Betreuer ist der Wert von Staats-Neugründungen nicht in Geschäftsbeziehungen zu messen – zumal die sich ohnehin ergeben: So abwegig es ist, einen deutschen Drang zu einem quasi-eigenen Adria-Hafen als „Hintergrund“ für Deutschlands tatkräftiges Eintreten für Sloweniens und Kroatiens Autonomie auszumachen, so fest steht natürlich, daß alles, was in diesen Ländern geschäftlich läuft, deutschem Zugriff offensteht oder überhaupt von da inszeniert wird. Der besondere Reiz der neuen europäischen Staatsgeschöpfe liegt aber schlicht darin, daß sie Geschöpfe der europäischen Führungsmächte sind.
Dabei ist es gar nicht so, als ob solche Kreaturen ihren Schöpfern nichts als Freude machen würden. In Kroatien müssen die Mentoren aus Bonn auf alles aufpassen: Vor der offiziellen Anerkennung mißfiel ihnen, daß sich Anhänger der Privatarmee, die die Hauptlast des Krieges trägt, gerne mit Hakenkreuzen und Ustascha-Symbolen aus der faschistischen Vergangenheit des Landes öffentlich präsentieren und so der serbischen Propaganda Recht geben; sie sorgten dafür, daß der Führer, Paraga, auf Befehl des Präsidenten aus dem Verkehr gezogen wurde. Nach der Anerkennung müssen sie den Präsidenten selbst auf die vorschriftsmäßige Friedenslinie hintrimmen und daran hindern, daß er die UNO-Pläne zur Blauhelm-Stationierung, kaum akzeptiert, gleich wieder in einen Freibrief für die Rückeroberung serbischer Gebiete innerhalb der aus jugoslawischer Zeit überkommenen kroatischen Grenzen umdeutet. Der Mann kapiert offenbar nicht, daß Deutschlands Sorge nicht dahin geht, kroatischen Ambitionen zum Erfolg zu verhelfen, sondern die deutsche Politik der Anerkennung der neuen Republiken weltweit durchzudrücken.
Denn um den Erfolg geht es: An den neuen Grenzen auf ehemals jugoslawischem Gebiet beweist Europa, geführt durch Deutschland, seine Staatsgründungsmacht. Unter seinem Zugriff emanzipieren sich nicht bloß die Separatisten der ersten Stunde; auch die andern Republiken erklären sich für unabhängig, um auf sich als interessante Objekte europäischen Interesses aufmerksam zu machen, und lassen sich folgsam aus Brüssel die Bedingungen diktieren, unter denen sie ihr Anerkennungsgesuch einreichen dürfen. Wenn man dort ein Referendum in Bosnien-Herzegowina wünscht, wird es veranstaltet, auch wenn den Veranstaltern selbst klar ist, daß etliche Volksteile das als Kampfansage betrachten und versprochen haben, es entsprechend zu beantworten. Von den alten staatlichen Strukturen bleibt nichts übrig; ganz offen, was aus Serbiens Versuch wird, gemeinsam mit Montenegro eine Art Nachfolgestaat aufzumachen. Europa nimmt sich Kompetenzen heraus wie eine Siegermacht nach einem Krieg – geführt haben den zwar andere vor Ort; aber damit ist deren entscheidende Rolle auch schon definiert und erledigt. Sie sind bloß Instrumente für die weltpolitische Rolle, die die EG-Staaten in Jugoslawien exemplarisch übernehmen und gleich auf den anderen, ungleich größeren zerfallenen Vielvölkerstaat im Osten ausgedehnt wissen wollen. „Sieg im Kalten Krieg“ ist für die verbündeten Europäer und die wiedervereinigten Deutschen an ihrer Spitze eben keine Metapher, sondern ein blutig ernst genommener Standpunkt: Als weltpolitische Siegermacht stellen sie sich auf.
6.
Mit welchem Erfolg?
Die Bilanz der Macher in Europas Hauptstädten fällt zwiespältig aus. Zwar haben sie einiges bewegt, aber doch noch viel zu wenig ordnungsstiftende Macht auf den Balkan „projizieren“ können. Für diesen Mangel kennen sie zwei Gründe. Erstens haben sie für ihre Bedürfnisse zu wenig Machtmittel. Die politischen Gelegenheiten, „Verantwortung“ zu übernehmen, sind nach dem Ende des Ostblocks größer als ihre Fähigkeit, sie auszunutzen und ihrer „Verantwortung“ gerecht zu werden. Diese mangelhafte Fähigkeit ist nach ihrer Einschätzung auch ein militärisches Problem, dessen Lösung eine sachgerechte Neueinteilung der Streitkräfte nebst passender Ausrüstung erfordert. Vor allem ist sie aber eine Folge mangelnder Einigkeit untereinander. Viel mehr gemeinsame Außenpolitik, letztlich die Politische Union muß kommen, um den „Herausforderungen“ gewachsen zu sein, sprich: um die Chancen wirkungsvoll wahrnehmen zu können, die die Kapitulation der Sowjetmacht und der Neuordnungsbedarf ihres alten Machtbereichs den Europäern bieten.
Weil sie sich darin einig sind, hat jeder europäische Regierungschef seine eigene nationale (Miß-)Erfolgsbilanz. Denn für jeden europatreuen Verantwortungsträger besteht die gewünschte Einigkeit darin, daß die andern mit ihm einig werden. Und diese Rechnung kann nie für alle gleichermaßen aufgehen. Am ehesten zufrieden zeigen sich die Deutschen. Kohl und Genscher haben in aller Freiheit den Slowenen und Kroaten die staatliche Anerkennung „noch vor Weihnachten“ versprochen und dies ihren zögernden Partnern als politischen Sachzwang erklärt, dem die sich gleichfalls unterwerfen müßten, um einen deutschen Alleingang zu verhindern. Demonstrativ unbeeindruckt haben sie sich gezeigt von den dringlichen Warnungen von UNO-Vertretern und US-Politikern vor einer einseitigen Anerkennung der abtrünnigen Republiken. Einen Kompromiß haben sie gewährt: den Aufschub der offiziellen Anerkennung um einen Monat und ein vorheriges neutrales Gutachten über die Anerkennungswürdigkeit der neuen Staaten nach den vom deutschen Außenamt formulierten EG-Anstandsregeln für Souveränitäts-Kandidaten – und haben ihn sofort über den Haufen geworfen: Die Anerkennung wurde doch sofort ausgesprochen, das Prüfungsergebnis gleich für unverbindlich erklärt, der Botschafteraustausch vorgenommen, obwohl das Ergebnis gegen Kroatien ausfiel. Für diesen Sieg ließ sich Kohl auf dem CDU-Parteitag mit stehenden Ovationen feiern. Getrübt wird er nur dadurch, daß die wichtigen europäischen Verbündeten zwar nichts verhindert, aber auch nicht hundertprozentig mitgezogen haben: Gegen die ausschließliche EG-Zuständigkeit, wie Deutschland sie will, haben sie die UNO-Kompetenzen herausgekehrt, die sie Deutschland voraushaben; und Botschafter aus Großbritannien und Frankreich sind in Zagreb und Ljubljana Mitte Februar noch immer nicht eingelaufen.
Diese Staaten sind eben nicht so glücklich darüber, daß Deutschland eine Linie vorgegeben hat, der sie sich anschließen mußten; nach Bremsungsversuchen, die sie am Ende dann doch lieber aufgegeben haben. Ein interessantes Dilemma: Deutschland macht ihnen die Politik des selbstbewußten Umräumens der politischen Landschaft vor, die sie selber so sehr wollen, daß sie gar nicht richtig dazu kommen, darin eigene nationale Bedingungen einzubringen. Also versagen sie sich der Einigkeit – in mehr symbolischen Nebendingen.
So kehrt für alle beteiligten Europäer am Ende die alte Frage wieder, ob per Saldo die politische Einigkeit, die sie alle für unerläßlich und dringlich halten, vorangekommen ist oder unter dem Nationalismus der andern gelitten hat.
7.
In diesen Streit unter europawilligen Nationalisten sollte man sich besser nicht einmischen. Schon aus theoretischen Gründen ist es eher schädlich, sich dem Problembewußtsein von Machthabern anschließen zu wollen. So bleibt man nämlich unter Garantie in den nationalen Alternativen eines erfolgreichen Imperialismus befangen.
Für eine objektive Zwischenbilanz der Fortschritte, die Europa am „Fall“ Jugoslawien gemacht hat, gibt die zwiespältige Zufriedenheit der Macher ein paar Hinweise. Sie verrät erstens, daß die EG-Staaten Weltordnungsmacht sein wollen, daß sie sich bewußt in diesem Sinn betätigen, daß sie ihre Erfolge und Mißerfolge an diesem Vorhaben bemessen und daß sie in Jugoslawien vorangekommen, ihre Ansprüche aber gleichfalls gewachsen sind. Zweitens brauchen sie für diese Politik die Macht ihrer Partner. Gerade ihr Streit und ihre bedingte Zufriedenheit miteinander zeigen, daß sie alle nicht bloß national operieren, notfalls ohne oder gegeneinander, sondern Dinge betreiben, denen sie sich, allein auf sich gestellt, gar nicht gewachsen sehen. Drittens ist der Streit ums Wie ihrer gemeinsamen Weltpolitik im wesentlichen einer ums Wer: um die Frage der nationalen Federführung im übernationalen Kollektiv. Das ist zwar ein wenig paradox; denn in dem Maße, wie ihnen das Zusammenlegen ihrer nationalen Potenzen gelingt und tatsächlich ein europäischer Imperialismus betrieben wird, kürzt sich die Frage nach dem nationalen Wer heraus. Viertens ist dieser Standpunkt aber offensichtlich noch nicht erreicht. Die Hauptmächte Europas bewahren sich neben ihrem Auftreten als kollektives Subjekt einer neu zugeschnittenen Weltordnung die Freiheit des national berechnenden Umgangs mit ihrer gemeinsamen Macht.
Daß das Ganze einen Widerspruch darstellt, hindert die Macher Europas nicht im geringsten daran, offensiv in der Welt herumzufuhrwerken. Das ist das fünfte Fazit der EG-Politik zur Zertrümmerung Jugoslawiens und Neuordnung der Erbmasse.