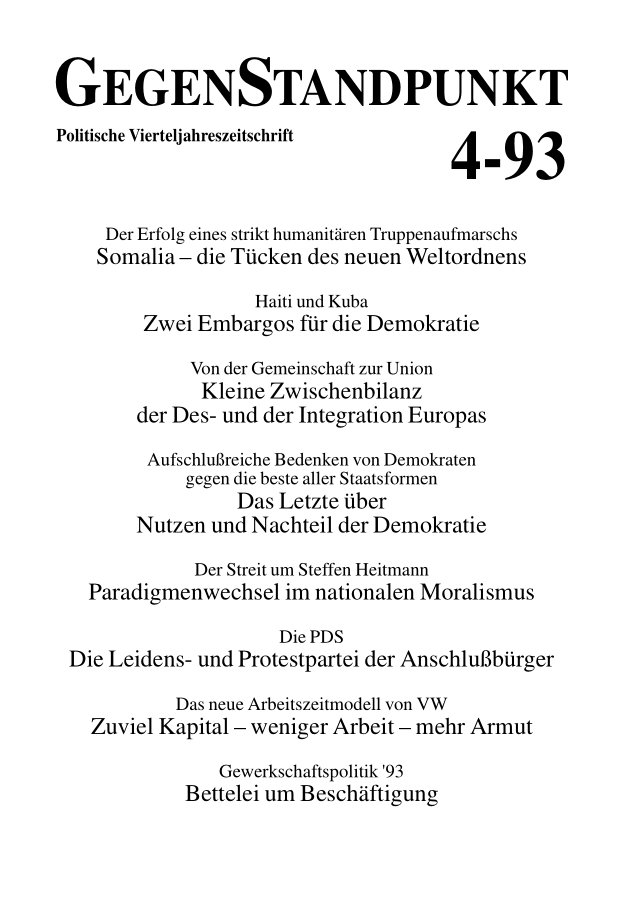Der Erfolg eines strikt humanitären Truppenaufmarschs – warum die Auftraggeber die Lust an ihren guten Taten verloren haben.
Somalia – die Tücken des neuen Weltordnens
Am zerfallenden Somalia wollen die USA mittels UNO-Intervention unter ‚humanitärem‘ Titel exemplarisch demonstrieren, dass die UNO Instrument der unbestrittenen Führerschaft der USA zu sein hat. Angesichts zunehmender Widerspenstigkeit der dortigen Bürgerkriegsparteien und Kritik ihrer ‚Partner`gerät ihnen Somalia für obige Beweisabsicht zum untauglichen Objekt. Der Schuldvorwurf an die UNO ist eine Absage an die Einmischung der Partner in die Zweckbestimmung dieser Organisation. Das beteiligte Deutschland pflegt neben dem Stolz auf seine Beteiligung das Leiden an seiner Unmaßgeblichkeit.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Der Erfolg eines strikt humanitären
Truppenaufmarschs – warum die Auftraggeber die Lust an
ihren guten Taten verloren haben.
Somalia – die Tücken des neuen
Weltordnens
1.
Soviel hat die offizielle US-Kritik an der Somalia-Mission jetzt klargestellt – der Hunger in Somalia war es nicht, der die USA dazu bewogen hat, ihre Truppen dorthinzuschicken.
Daß man dem Elend dort einfach nicht länger zusehen dürfte, so sollte man sich zu Beginn den Grund für die Unternehmung mit dem ergreifenden Titel „Restore Hope“ zurechtlegen. Wenn sich jetzt aber die amerikanische Politik fragt, was sie dort eigentlich verloren hat, ob dabei amerikanische Interessen noch zum Zug kommen, ja, ob es überhaupt welche an dieser Mission gibt, dann gibt man damit immerhin offiziell die eigene Verständnislosigkeit für das humanitäre Getue von neulich zu Protokoll. Sowie die Klarstellung, daß amerikanische Interessen von reichlich anderer Natur sind und Anliegen wie die Bekämpfung des Hungers irgendwo auf der Welt nicht darunter fallen. Da hätte die US-Politik, wie verständnislose Kritiker schon zu Beginn anmerkten, im übrigen auch in ihrem Land genug zu tun. Ein solcher Titel gibt bestenfalls einen Vorwand für Absichten anderer Natur ab. Mit der kritischen Bilanz der Somalia-Mission nimmt man Abstand von einer offiziell als solcher gekennzeichneten Heuchelei.
2.
Es war auch nicht ordinärer Hunger, von dem sich der noch amtierende Präsident Bush zu seinem Beschluß herausgefordert gesehen hat; da wären Soldaten ja auch nicht ganz die passende Antwort gewesen. Es war vielmehr die Störung der UN-Hungerhilfe durch „bewaffnete Banden“, auf die die USA mit einem militärischen Aufmarsch im Auftrag der UNO reagieren wollten.
Und auch das ist nicht die ganze Wahrheit über Grund und Zweck der Aktion. Denn während sich die USA mittlerweile nach dem Sinn ihres Manövers fragen, gibt es immer noch dieselben Banden, die ursprünglich als der Grund galten, hinzugehen. US-Politiker nennen sie nur inzwischen einerseits „politische Kräfte“ und äußern sich andererseits ziemlich illusionslos darüber, mit welcher Wahrscheinlichkeit in Somalia genau dieselben Zustände wieder einreißen, die sie im Dezember 92 für ganz unerträglich befunden hatten:
„Der vorzeitige Abzug der Vereinigten Staaten (würde) beinahe mit Sicherheit zu einem erneuten Bürgerkrieg und damit erneut zu Anarchie und Hungersnot führen.“ (Bericht des Weißen Hauses an den Kongreß, Amerika Dienst, 20.10.93)
Und außerdem erörterte die kritisch mitdenkende US-Öffentlichkeit schon vor einem Jahr ganz unbefangen, daß eine solche Lage, die Kombination von hungernder Bevölkerung und bewaffneten Banden viel zu häufig vorkommt, als daß für amerikanisches Eingreifen nicht noch ein besonderer guter Grund vorliegen müßte. Nachdem man sich erst einmal Bush’s „rein humanitäre Aktion“ hatte einleuchten lassen, beantwortete man sich selbst die einschlägige Frage:
„Aber warum dann in Somalia und nicht in Bosnien? Oder Liberia oder Sudan?
Die kurze Antwort heißt, weil Somalia machbar ist, wie der Präsident gerne sagt.“ (Time Magazine, 14.12.92)
Wie wenig es bei der ganzen Sache um die bedauernswerte Bevölkerung vor Ort gegangen ist, beweist die Aufgeklärtheit, mit der der weltpolitische Sachverstand Fälle für amerikanisches Eingreifen vergleicht – anhand ihrer Handhabbarkeit für US-Interessen.
Daß Time Magazine bei seinen Vergleichen sofort Liberia
und der Sudan einfallen als im Prinzip genauso gelagerte
Fälle wie Somalia, liegt nicht daran, daß auch da
gehungert wird und die Bevölkerung sonstige
Widerwärtigkeiten zu ertragen hat; da wäre die Liste ganz
anders ausgefallen. Das allein ist es nicht, was
irgendwelchen Gegenden die Aufmerksamkeit der Welt und
ihrer Führungsnation verschafft. Die Ordnungswidrigkeit,
die da wahrgenommen wird, ist anderer Natur: Dank der
imperialistischen Benützung oder strategischen
Neubewertung ist ganzen Staaten so gründlich jede
Geschäftsgrundlage abhanden gekommen, daß sie zerfallen.
Elemente des alten Staats konkurrieren um die Überreste
von Gewalt und Reichtum, so daß vor Ort kein
Gewaltmonopol, keine zuverlässige Kontrollmacht
mehr anzutreffen ist. Und das ist ein ernster Verstoß
gegen das fundamentale Menschenrecht einer
Weltordnung, sei sie alt oder neu, daß jeder
Flecken Erde von einem Gewaltapparat beaufsichtigt, seine
Bevölkerung zusammengehalten wird und somit für
allfällige Bedürfnisse der wichtigen Nationen zur
Verfügung steht. Insoweit begreift der imperialistische
Verstand diese Zustände, obwohl zumeist nur vor Ort
verhungert und herumgemetzelt wird, sehr sachgerecht als
eine Bedrohung seiner Interessen, nämlich als
Bedrohung der neuen Weltordnung
. Diese Länder
verletzen deren grundsätzliches Prinzip, die weltweite
Einrichtung zuverlässiger Gewaltverhältnisse, ein
Unrecht, das laut Beschluß der USA die UNO auf den Plan
rufen soll:
„Der Präsident bekräftigt ein wichtiges Prinzip: Wenn ein Land völlig seine Fähigkeit verliert, sich selbst zu regieren, verliert es auch seinen Anspruch auf Souveränität und sollte unter die Aufsicht der Vereinten Nationen gestellt werden. … Der logische und notwendige nächste Schritt wird darin bestehen müssen, daß die UNO hingeht und Somalia verwaltet, bis es dort wieder eine funktionierende Regierung gibt.“ (Strobe Talbott in Time Magazine, 14.12.92)
Insofern ist Somalia ein Fall; deshalb kommen die Hungerneger dort in den Genuß imperialistischer Betreuung, und zwar erstens als Demonstrationsobjekt für das Recht der UNO, in Fällen zusammengebrochener Souveränität die Aufsicht zu übernehmen.
Zweitens aber zeichnet sich Somalia vor den anderen, gleichartigen Fällen – heute wären noch zu ergänzen Afghanistan, Angola, Mozambique, Burundi, Zaire –, die als passende Objekte UNO-organisierter militärischer Ordnungsstiftung gewürdigt werden könnten, durch eine besonders nützliche Eigenschaft aus: „doability“. Unter dem Gesichtspunkt ist Somalia dann auch dasselbe wie Jugoslawien und besser geeignet. Ein Vertreter des amerikanischen Außenministeriums:
„Die Situation in Bosnien zu befrieden, um die Hilfslieferungen zu sichern, ist im Grunde genommen unmöglich und würde einen enormen Truppeneinsatz erfordern. In Somalia kann man eine Operation planen, die wirkungsvoll sein wird.“ (Time Magazine)
Das US-Kriterium, mit dem Somalia von den vielzähligen ähnlichen Fällen unterschieden wurde, hieß: gut dazu geeignet, einen Beweis glanzvoll, d.h. effektiv und kurzfristig zu liefern, wie nach der Vorstellung der USA die neue Weltordnung nur funktionieren kann, nämlich als eine unter ihrer Führung vereinigte konzertierte Aktion der Nationen, eine Kooperation im Rahmen der UNO. Eine Kooperation, die deswegen funktioniert, weil – im Unterschied zu Jugoslawien – die USA ein klar definiertes Ziel vorgeben und weil – im Unterschied zu Jugoslawien – die USA mit ihrer überwältigenden Militärmacht die Sache praktisch in die Hand nehmen, so daß für alle anderen Beteiligten widerspruchsloses Mitmachen und Einordnen angesagt ist. Es ging um den Einsatz der UNO als Instrument der US-Weltordnung[1], und dafür bot sich Somalia als genau der passende „Testfall“ (Time Magazine) an.
Zum erstenmal wurde das Recht auf eine internationale Militärintervention, auf Einmischung in einem unabhängigen Land, ohne jeden noch so fadenscheinigen völkerrechtlichen Hilferuf von dessen Seite, zum Recht der UNO erklärt, auf Antrag der USA. Die Rechtstitel „Hunger“ bzw. die verloren gegangene „Fähigkeit, sich selbst zu regieren,“ verliehen dieser Expedition den Charakter einer wohltätigen Ordnungsstiftung, wohltätig sogar noch für das Land, das auf diese Weise überfallen wird. Die USA setzten den Beweis, wie sehr die Weltordnung auf ihre Führung angewiesen ist, wie einen Dienst an der Weltgemeinschaft in Szene. Beabsichtigt war die Demonstration, daß die USA, wenn sie im Interesse einer „UNO-zentrierten Weltordnung“ andere Nationen zur Unterordnung aufrufen, selbstlos, ohne jedes materielle Interesse, agieren. Und schließlich erschien Somalia auch noch für die Darstellung ihrer Führungsfähigkeit als geeignetes Objekt, weil man in einem solchen Land wohl kaum auf nennenswerte Hindernisse für den angestrebten Beweis treffen würde. Das Land war vorgesehen für ein regelrechtes Exempel:
„Wenn es eine UN-zentrierte Weltordnung geben soll, dann müssen auch die Vereinigten Staaten bereit sein, ihre Soldaten für humanitäre Aufgaben einzusetzen ebenso wie für solche im Dienst nationaler Interessen wie bei Desert Storm. Damit aber diese Art militärischer Intervention zugunsten einer leidenden Bevölkerung zum anerkannten Handlungsmuster in der Weltgemeinschaft wird, muß der Testfall gelingen. Wenn die USA sich in die anarchischen Zustände Somalias verwickeln lassen oder fluchtartig abziehen und neuerliches Chaos und Hunger zurücklassen, werden solche von Prinzipien geleiteten Aktionen in Zukunft viel weniger akzeptabel aussehen.“ (Time Magazine, 14.12.92)
Die Rolle der Somalis bei diesem Exempel: Hungerbäuche und Szenerie für erschütternde Bildberichte, die nach Hilfe und Eingreifen schreien, so daß die Frage gänzlich vernachlässigt werden kann, ob und wieviel die Anlandung von US-Truppen mit einer Bekämpfung des Hungers zu tun hat.
3.
Im Januar führen US-Truppen eine generalstabsmäßige Invasion durch, bei der sie weniger von widerspenstigen Einheimischen als von den eigenen Fernsehteams gestört werden. Mogadischu und die anderen Teile des Landes werden Zug um Zug besetzt, die ganze Welt bekommt die Bilder vorgeführt, wie US-Boys die Lebensmittelverteilung überwachen und Negerkinder streicheln. Daneben kommt es aber immer wieder zu Zusammenstößen. Statt daß durch den machtvollen Aufmarsch Ordnung im Land einkehrt, hat sich nämlich die UNO in den in Somalia verbliebenen politischen Subjekten neue Gegner geschaffen, für ganz neue „Unordnung“ gesorgt. Sie stört die Geschäfte der lokalen Clans mit der Lebensmittelverteilung, behindert und durchkreuzt deren lokale Machtentfaltung. Die setzen sich mit ihren Mitteln zur Wehr. Von Beginn an wird unter den Aufsichtsmächten darüber gestritten, daß es nicht nur darum gehen könne, durch den eigenen Aufmarsch befriedete Gebiete zu schaffen, vielmehr müßten die einheimischen Banden entwaffnet werden. Der UNO-Auftrag wird dementsprechend erweitert, und die Lage eskaliert. 24 pakistanische Blauhelme werden erschossen, die UNO-Truppen schießen zurück, unter den Opfern sind Frauen und Kinder. Die anderen Mächte lassen sich die Gelegenheit nicht entgehen, jetzt wiederum die Gewalttätigkeit der US-Methoden zu kritisieren: Man sei doch nach Somalia gegangen, um der hungerleidenden Bevölkerung zu helfen, und nicht, um sie zu erschießen…
Die Konkurrenz um Zweckbestimmung und Führung der Mission setzt sich fort. Die anderen Aufsichtsmächte lassen sich auch nicht vor Ort als US-Hilfstruppen einteilen. Vor allem die ehemalige Kolonialmacht Italien setzt sich an die Spitze und kritisiert die „Rambo-Methoden“ der USA, beantragt die Führung, droht, nachdem sie sich nicht durchsetzen kann, mit gänzlichem Abzug und zieht sich dann in den Norden des Landes zurück. Frankreich kündigt den Abzug seiner Truppen an, weil es seine Aufgabe in Jugoslawien für bedeutsamer erachtet. Die USA ihrerseits bestehen darauf, daß sich die UNO, d.h. sie selbst, die auf diese Organisationsweise Wert legen, Widersetzlichkeit seitens ihrer Pflegefälle nicht bieten lassen dürfen, und eskalieren: Die UNO-Blauhelme überfallen Stadtviertel und durchkämmen sie nach Waffenlagern, Menschenansammlungen werden als Kombattanten definiert, auf die geschossen werden darf, inkl. Frauen und Kinder. Die USA setzen im Sicherheitsrat den Beschluß durch, Aidid als Verantwortlichen für die 24 toten Pakistani einzufangen und ihm einen Kriegsverbrecherprozeß zu machen. Dessen Anhänger in Mogadischu nehmen das nicht ohne Grund als feindlichen Akt, demonstrieren gegen die USA und die UNO als Besatzungsmächte. So gerät die „strikt humanitäre Aktion“ (Bush) schließlich zu einem regelrechten Kleinkrieg in Mogadischu mit dem Höhepunkt, daß es den Aidid-Leuten gelingt, US-Hubschrauber abzuschießen. Tote US-Soldaten werden von einer begeisterten Menschenmenge durch Mogadischu geschleift.
Anfang September gibt der US-Verteidigungsminister noch folgenden Erfolgsbericht:
„Im Verlauf unseres Engagements konnten unsere Ziele in vier Kategorien eingeteilt werden: Nahrungsmittel, Sicherheit, Wirtschaft und politischer Wiederaufbau. Was haben wir geleistet? Im Hinblick auf die Nahrungsmittelsituation haben wir gut abgeschnitten… Im Bereich der Sicherheit haben wir Fortschritte erzielt. Das Banditentum konnte in ganz Somalia beträchtlich verringert und an einigen Orten vollständig beseitigt werden. Somalia ist im großen und ganzen friedlich, abgesehen von Süd-Mogadischu… Für die amerikanischen Kampftruppen stehen aus meiner Sicht drei Punkte auf der Checkliste. Erstens muß die Sicherheitsfrage in Süd-Mogadischu geregelt werden. Zweitens müssen wir echte Fortschritte bei der Entwaffnung der Kriegsherren erzielen. Drittens muß ein glaubwürdiger Polizeiapparat in den größeren Siedlungsgebieten eingerichtet werden…“ (Amerika Dienst, 1.9.93)
Einen Monat später ist sich die US-Politik einig, daß man sich ganz falsche Ziele gesetzt hat:
„Außenminister Christopher sagte, das Ziel der Vereinigten Staaten sei es nicht länger, in Somalia eine stabile Regierung aufzubauen.“ (FAZ, 12.10.93)
Die USA beschließen ihren Abzug.
4.
Die USA sind nicht an ein paar aufsässigen Negern gescheitert, wie es schadenfrohe Kommentare von seiten der „Partner“-Nationen ausgemalt haben. Zwischen dem feierlichen Auftakt vor einem Jahr und den heutigen Abzugsplanungen steht auch nur die Tatsache, daß die US-Politik darauf gestoßen worden ist, daß die angenommene „doability“ so gar nicht gegeben war. Die Zweckbestimmung der Unternehmung, die Definition der „Lage“ und ihrer „Bereinigung“, wie sie die USA vorgenommen hatten, haben nicht zu ihrem Betreuungsobjekt gepaßt. Der „Testfall“ war für das vorgesehene Exempel nicht geeignet.
Der Auftrag, die Autorität der UNO gegen Lebensmittelplünderer durchzusetzen, ist eben etwas anderes, als eine neue Ordnung zu installieren. An den wechselnden politischen Optionen, mit denen die UNO-Einmischung versehen wurde – einmal sollte es um die militärische Kontrolle des Landes zur Sicherung der Lebensmitteltransporte gehen, dann darum, wichtige Posten zu besetzen, „Kriegsherren“ sollten entwaffnet und „eine glaubwürdige, neutrale Polizei“ aufgebaut werden (Aspin) –, hat sich etwas viel Grundsätzlicheres bemerkbar gemacht: Die wechselnden Ansprüche an Kontrolle und Regierbarkeit stoßen darauf, daß in diesem Land auf keine der gewohnten Funktionen einer Staatsgewalt zu rechnen ist. Und um auch nur die UNO-Mission ihrer Zweckbestimmung gemäß abschließen zu können, nämlich Zustände zu hinterlassen, die sich von denen vor dem Eingriff unterscheiden, wäre eine solche Ordnung herzustellen gewesen.
Nun ist die Weltmacht USA zwar mit Militär vor Ort erschienen, aber eben nicht mit dem Programm, eine neue Herrschaft zu installieren.[2] Es war nicht die Entscheidung, dort wie eine Kolonialmacht aufzutreten; das wäre den USA wie ein Rückfall in überwundene Unsitten und wie eine unnötige Belastung vorgekommen:
„Eine Schwierigkeit bei treuhänderischer Verwaltung ist der Begriff selber. Besonders in Afrika riecht das nach der berühmten Bürde des Weißen Mannes… Zur Ersetzung des Begriffs einen Euphemismus zu erfinden, ist noch der leichteste Teil der Aufgabe. Die Kosten und Risiken sind hoch.“ (Strobe Talbott, Time Magazine)
Militärisch eskaliert wurde aufgrund der Beschlußfassung, daß sich die UNO etliches nicht gefallen lassen darf, aber nicht in dem Interesse und mit dem Programm, dort eine neue Herrschaft zu etablieren. Dann hätte man selbst das Personal für die Herrschaft festlegen müssen und nicht die Clanchefs dazu aufgerufen, sich untereinander zu einigen. Dann wäre auch nicht Ent-, sondern Bewaffnen, und zwar einer ausgesuchten Truppe, angesagt gewesen. So etwas hat aber keine der imperialistischen Aufsichtsmächte ins Auge gefaßt. Folglich führt der Einsatz von Gewalt auch nicht zu einer imperialistischen „Lösung“ in dem Sinne, daß etwas „geregelt“ würde und der Einsatz als erfolgreich beendet abgehakt werden könnte.[3]
Die Rolle der Somalis: Zuvor noch sollten sie alle Welt zum Mitleid nötigen, und jetzt hat man es mit lauter Rebellen zu tun – bloß wogegen?! Einen somalischen Staat, gegen den sich rebellieren ließe, gibt es ja anerkanntermaßen gar nicht mehr. Ein US-Senator muß empört feststellen, daß diejenigen, die den US-Soldaten herumschleifen, gar nicht verhungert aussehen. Wahrscheinlich war der Hunger getürkt, nur um Amerikaner ins Land zu locken und dann auf ihnen herumzutrampeln.
5.
Jetzt wollen die USA eine „schwierige Lage“ in Somalia vor sich haben, der die UNO mit ihrem militärischen Aufmarsch nicht gerecht geworden ist, weil „politische Lösungen“ gefragt sind. Dabei hat sich an den Rivalitäten der Clans und den Hungerleidern vor Ort gar nichts geändert. Die neue Lagebestimmung stellt auch nur die ideologische Auskunft darüber dar, daß die USA ihr Ziel nicht erreicht haben.
Genauso plötzlich wie die USA vor einem Jahr beschlossen haben, daß die neue Weltordnung die Intervention in Somalia braucht, haben sie nun beschlossen, daß es dieser Fall nicht wert ist, weiterhin US-Leben aufs Spiel zu setzen. Dabei hätten sie durchaus im Namen der Autorität der UNO, die auf dem Spiel steht, im Namen ihrer neuen Weltordnung die militärische Eskalation fortsetzen und Mogadischu in Schutt und Asche legen können. Ihre Rangers hätten sicher auch irgendwann einmal Aidid einfangen können. Aber nun handelt es sich dabei nicht einmal um einen von US-Interessen aus definierten Feind. Und vor allem: Die eigentliche Beweisabsicht ist schon als mißlungen bewertet worden. Vergleiche mit dem Vietnam-Krieg – man hätte sich schon einmal auf dieselbe Weise in eine unberechenbare, langandauernde Eskalation hineinverwickelt und erst mit einem schmählichen Abzug wieder herausziehen können – stehen für die Bilanz, daß die Führungsrolle der USA in diesem Fall und an diesem Objekt einfach nicht so zu exekutieren geht, wie es beabsichtigt war. Wegen der Widerspenstigkeit des Betreuungsobjekts mußte die Aktion auf jeden Fall umdefiniert werden; daß die US-Politik sie nach Abwägung aller Gesichtspunkte dann aber lieber gleich ganz beenden will, zeigt, wie sehr es ihr auf das „wie“ ihrer Expedition angekommen ist und wer der eigentliche und wesentliche Adressat des geplanten Exempels ist. Als vorbildliche militärische Blitzaktion im Namen eines unbestreitbaren humanitären Ziels ist die Expedition mißlungen; gescheitert ist sie also daran, daß sie nur als ein Konkurrenzmittel im Kampf der Aufsichtsmächte um Ordnungskompetenz gewollt war. Wenn sie dazu nicht taugt, verliert sie aber jeden Sinn für die Weltmacht.
Die Zuständigen hatten sich eine eindrucksvolle internationale Koalition, nach dem Muster des Golfkriegs, unter US-Führung, vorgestellt. Aspin:
„Die Vereinigten Staaten boten ihre Führungsrolle bei militärischen Bestrebungen an, ausreichende Sicherheitsvorkehrungen zur Bewältigung der Hungersnot zu schaffen, und die Vereinten Nationen verabschiedeten am 3.12.92 Resolution 794 des UN-Sicherheitsrats.“ (Amerika Dienst, 1.9.93)
Stattdessen sehen sich die USA mit Widerstand der Einheimischen und mit Kritik ihrer „Partner“ konfrontiert. Die weigern sich auch, unter Berufung auf den anderslautenden Auftrag und die häßlichen Szenen in Mogadischu, sich einer einheitlichen Linie zu unterwerfen, und praktizieren in den von ihnen besetzten Gebieten demonstrativ andere Umgangsweisen mit den Clanchefs. Die Weltöffentlichkeit breitet genüßlich die Beweise amerikanischen Mißerfolgs aus:
„Die Ranger hatten Spott auf sich gezogen, als sie in nächtlichen Aktionen, sich von Hubschraubern abseilend und Türen grundsätzlich mit den Stiefeln eintretend, mehrfach in die falschen Häuser eindrangen und Mitarbeiter ausländischer Hilfsorganisationen sowie deren somalische Angestellte zu fesseln und mitzunehmen schienen.“ (FAZ, 23.10.93)
Darauf folgt der Beschluß zum Abzug: Die Weltmacht USA hat es nicht nötig, sich den Spott der Welt gefallen zu lassen, weil sie sich mit einem unwürdigen Objekt herumschlägt.
6.
Die angekündigte Beendigung der Mission seitens der USA hat einigen Ansprüchen zu genügen, die eine gewisse Verlegenheit der Weltmacht dokumentieren, aber eine auf ziemlich hohem Niveau. Selbst wenn man die Mission als mißglückt abbucht, kann man es sich nicht leisten, einfach einen klaren Mißerfolg zu Protokoll und damit zuzugeben, daß die US-Führungsmacht in diesem Fall versagt hat. Dafür müssen noch etliche Somalis erschossen werden.
„Die Vereinigten Staaten dürfen Somalia nicht auf eine Art und Weise verlassen, die die Gefahr für Amerikaner auf der Welt erhöht, die substantiellen Errungenschaften der amerikanischen Streitkräfte in Somalia unterminiert oder die Aussichten auf internationale Lastenteilung in der Zukunft schwer beeinträchtigt.“ (Bericht des Weißen Hauses an den Kongreß, Amerika Dienst, 20.10.93)
Die „substantiellen Errungenschaften“ in Somalia selbst, die nicht aufs Spiel gesetzt werden dürften, sind zwar ziemlich erlogen. Aber sie stehen auch nur für den geforderten Respekt vor der Führungsrolle der USA, der nicht darunter leiden darf, daß die Somalia-Operation einfach als mißlungen abgehakt wird. Die andere Bedingung für den Rückzug, daß die „Gefahr für die Amerikaner in der Welt“ dadurch nicht erhöht werden dürfe, ist ein eindrucksvoller Beleg dafür, wie ausgreifend und empfindlich „amerikanische Interessen“ beschaffen sein können, wenn sie für hauseigene Kritiker einmal definiert werden müssen:
„Ein überstürzter Rückzug aus Somalia würde folgende Risiken beinhalten:…
Jagd auf Amerikaner. Wenn wir uns zurückziehen würden, nachdem es Opfer unter den Amerikanern gegeben hat, käme dies einer Einladung an unsere Gegner, Terroristen und Verbrecher auf der ganzen Welt gleich, um einer Änderung der amerikanischen Politik willen amerikanische Staatsbürger umzubringen. Auf einer Welt, in der Amerikaner in einer potentiell feindlichen Umgebung operieren müssen und viele uns nichts Gutes wünschen und nicht vor der Anwendung von Gewalt zurückschrecken, dürfen wir nicht eine solche Botschaft aussenden.“
Unschuldige Amerikaner „müssen“ aber nun einmal überall auf der Welt in einer potentiell feindlichen Umgebung operieren und sind wahrscheinlich deshalb gleich mit Flugzeugträgern, AWACs und U-Boot-Flotten unterwegs. Und wenn die US-Politik das so sehen will, daß an einer Stelle der Welt erschossene US-Soldaten zum Auftakt zu einer weltweiten „Jagd auf Amerikaner“ zu werden drohen, dann werden die USA diese feindliche Welt wohl mit genau der Logik konfrontieren müssen, die sie ihr entnehmen wollen: Dann „müssen“ die USA den „Gegnern, Terroristen und Verbrechern auf der ganzen Welt“ den Beweis präsentieren, daß man mit toten Amerikanern keine Änderung der amerikanischen Politik erreicht, d.h., mit der Androhung von Toten auf der Seite der „Gegner“ dafür sorgen, daß die ihre Politik ändern.
Tote Amerikaner verlangen also zwingend nach einem solchen Souveränitätsbeweis, weswegen die US-Blauhelme zumindest ein paar Tage lang so etwas wie einen totalen Luftkrieg über Mogadischu inszeniert haben. Auch nach der amerikanischen Gesamtbilanz, in der der UNO die Schuld für verfehltes, nämlich „militärisches“ Vorgehen in Somalia zugeteilt worden ist, verlangen die Kriterien eines „ehrenvollen Abzugs“, daß sich weder US- noch UNO-Truppen Schüsse gefallen lassen können. Zu dem Zweck veranstalten sie demonstrative Aufmärsche in Mogadischu und schießen auch immer wieder „zurück“.
Andererseits wird eine „politische Lösung“ angesetzt als Beweis dafür, daß der Fall geregelt worden ist. Nachdem aber die zu „politischen Kräften“ aufgestiegenen ehemaligen Bandenchefs wenig Neigung zeigen, sich zur Wiedererrichtung einer somalischen Staatsgewalt zusammenzutun und sich dafür selbst zu entmachten, sondern die bekanntgegebenen Abzugspläne als Perspektive begrüßen, sich dann erst recht zu etablieren, ventilieren die USA eine Ersatzlösung: Andere Staaten in die Verantwortung für den vergeigten Fall hineinziehen. Christopher:
„Die Vereinigten Staaten tragen in Somalia die größte Last. Jetzt bitten wir bestimmte andere Länder, die Zahl ihrer Streitkräfte dort zu erhöhen, um die Arbeit zu beenden“… Obwohl der amerikanische Part der humanitären Aufgabe in Somalia „äußerst erfolgreich“ durchgeführt wurde, „ist die Zeit gekommen, die Last mit anderen zu teilen. Der Präsident ist entschlossen, anderen die größtmögliche Gelegenheit zur Teilnahme an diesem Unternehmen zu geben, und aus diesem Grund ziehen wir unsere Truppen nicht sofort ab. Wir wollen das Land auf verantwortungsbewußte Weise verlassen“. (Amerika Dienst, 13.10.93)
„Vielmehr begrenze sich jetzt die Aufgabe darauf, gemeinsam mit den Vereinten Nationen Ruhe und Ordnung herzustellen und die politische Stabilisierung und Regierungsbildung einer afrikanischen Kommission zu überlassen.“ (FAZ, 12.10.93)
Letztlich ist es eben auch nur eine Definitionsfrage, was Ruhe und Ordnung auf somalisch heißt. Derselbe Aidid, der auf Antrag der USA im Sicherheitsrat zum Kriegsverbrecher erklärt worden ist, ist nun von denselben USA im Sicherheitsrat von der Fahndungsliste abgesetzt und zur politischen Kraft in Somalia aufgewertet worden. Und die US-Botschafterin bei der UNO delegiert die Aufgabe, für einen somalischen Staat zu sorgen, an die Bürgerkriegsparteien zurück, die ihn beerdigt haben:
„Das somalische Volk müsse nun den Willen und den Mut zur nationalen Aussöhnung beweisen – sonst könne ihm die Weltorganisation auch nicht helfen.“ (SZ, 20.11.93)
Die Rolle der Somalis dabei: Hindernis für „politische Lösungen“, also ein Scheißvolk, das ungeeignet für unsere Zivilisation ist. Nach ausgiebiger Kritik an den tölpelhaften Amis mit ihren Rambo-Methoden weiß auch die deutsch-nationalistische Öffentlichkeit passende Gründe für den Rückzug: Mit Kenntnissen über die dortige Volksnatur ausstaffiert, muß schließlich auch die Frage erlaubt sein, ob man diesem Volk überhaupt mit solchen westlichen Vorstellungen kommen und es nicht lieber seinem landesüblichen Räuberwesen überlassen sollte.
„Nichts spricht dafür, daß sich ausgerechnet die Somalis, individualistischer als jedes andere afrikanische Volk, politisch bevormunden lassen. Trifft eine Nomadengruppe auf eine andere und fürchtet sie um ihr Wasser und ihre Weide, greift man zur Waffe. Früher war das der Speer oder das Schwert, heute die Kalaschnikow. Schon immer zogen außerdem kleine und größere Räuberbanden umher, die früher Karawanen angriffen und heute eben Autos überfallen. Da ist nichts zu befrieden.“ (FAZ, 20.10.93)
7.
Die Unzufriedenheit mit dem mißlungenen Testfall Somalia hat in der amerikanischen Politik – vorgetragen von Kissinger und ähnlichen Denkern – zu der interessanten Kritik an der Mission geführt, daß es dabei gar nicht oder zu wenig um amerikanische Interessen gegangen wäre. Als ob der humanitäre Titel auch schon der wirkliche Zweck gewesen wäre. Die Kritiker haben es auch wohlweislich unterlassen zu definieren, wie amerikanische Interessen aussehen, und die Kriterien für lohnende US-Auswärtsspiele beim Namen zu nennen. So bescheiden, daß Amerika auswärts nur dann aktiv werden soll, wenn es um Öl und ähnliche handfeste Dinge geht, sind sie schließlich nicht. Die Forderung, daß amerikanische Außenpolitik sich in Zukunft streng an amerikanischen Interessen zu orientieren hätte, ebenso wie die wieder einmal thematisierte Drohung mit einem amerikanischen Isolationismus sind nicht mißzuverstehen als Antrag auf Rückzug aus der Weltpolitik. Schließlich will die Kritik an der gelaufenen Aktion wissen, daß sie deshalb mißlungen ist, weil sich die USA zu sehr für fremde Interessen hätten einspannen lassen. Somalia wird als unbrauchbarer Fall abgehakt; aber die USA wollen daraus Konsequenzen für die zukünftige Politik ziehen. Sie üben Kritik an der UNO, und das ist unüberhörbar eine Kritik an den imperialistischen Mitmachern, die auf eine Änderung der Geschäftsbedingungen dringt.
Die USA üben Selbstkritik, an ihrer eigenen, viel zu guten Absicht:
„Clinton hat Fehler in der Außenpolitik eingeräumt… Die Vereinigten Staaten seien zwar die einzige Supermacht, könnten aber nicht jedes Problem in der Welt lösen und das Elend vieler Menschen nicht lindern.“ (SZ, 23.10.93)
Sie haben ja schließlich auch – siehe oben – andere Probleme, mit der feindlichen Welt, die in erster Linie Amis überfallen will. Die USA üben Kritik, nämlich an der viel zu schlechten Ausführung der gemeinsamen Sache durch die anderen:
„Clinton wies darauf hin, daß sich die Situation in Mogadischu seit der Übernahme der Operation durch die Vereinten Nationen eindeutig verschlimmert habe. „Solche Dinge sind nicht passiert, als wir 28 000 Mann dort hatten und die Sache unter Kontrolle hatten.“ Er sei zwar sicher, daß die anderen Kontingente das Bestmögliche versuchten, doch wollten sie offenbar nur in dem ihnen jeweils zugewiesenen Gebiet operieren und folgten nicht genau den Anweisungen des türkischen Generals, der jetzt das Oberkommando innehabe.“ (SZ, 7.10.93)
Alle falschen, d.h. erfolglosen Befehle und Maßnahmen in Somalia sollen neuerdings von der UNO verursacht worden sein. Das ist zwar einerseits albern; immerhin haben die USA noch jeden Somalia betreffenden Beschluß im Sicherheitsrat durchgesetzt; von den US-Truppen haben überhaupt nur Transporteinheiten unter dem Kommando der UNO gestanden, und schließlich ist auch noch der UNO-Chef vor Ort ehemaliger Ami-General. Aber andererseits erledigt es die Schuldfrage und zwar nicht nur retrospektiv. Die USA bilanzieren ihren Mißerfolg im Hantieren mit der UNO als Instrument ihrer neuen Weltordnung als Untauglichkeit der UNO.
Ausgerechnet die USA, die Somalia zum Fall für die UNO erklärt und im Namen der UNO, deren Autorität dort zu verteidigen wäre, alle Welt auf die Teilnahme an dieser Expedition verpflichtet haben, werfen der UNO vor, daß sie sich immer um alles kümmern will:
„Die Vereinten Nationen können sich einfach nicht in jedem Konflikt der Welt engagieren. Wenn das amerikanische Volk Ja zur UN-Friedenssicherung sagen soll, müssen die Vereinten Nationen auch Nein sagen können.“ (Clinton vor der UNO, Amerika Dienst, 29.9.93)
Und sie formulieren sogenannte „Bedingungen“ für künftige UNO-Einsätze:
„Er nannte dann vier Hauptkriterien, die vor einem Interventionsentscheid zu prüfen seien: eine „reale Bedrohung“ der internationalen Sicherheit, ein klares Ziel der Operation, ausreichende Finanzierung und ein absehbares Ende.“ (FAZ, 28.9.93)
Einerseits ist diese UNO-Kritik nicht viel mehr als der nachträgliche Bescheid, daß Somalia nur der falsche Fall war, nämlich keine „reale Bedrohung der internationalen Sicherheit“, und die bequeme Erledigung der Schuldfrage dadurch, daß auf die UNO als Auftraggeber verwiesen wird. Andererseits kündigen die USA mit ihren neuen Bedingungen an, daß sie weiterhin auf ihrem Recht bestehen, Exempel im Sinn ihrer neuen Weltordnung nach ihren Maßstäben vorzunehmen und erfolgreich abzuwickeln. Sie verlangen, daß die Eindeutigkeit und Unbestrittenheit ihrer Führungsrolle gewährleistet sein muß. In Zukunft wollen sie selbst bestimmen, was fällig ist. Das haben sie zwar auch im Fall Somalia getan, auch ein „klares Ziel“ hat es dort gegeben; aber das soll nach der amerikanischen Kritik durch die UNO mit ihrem „Multilateralismus“ verdorben worden sein. Damit ist gesagt: Die Einmischung der anderen in die Zweckbestimmung und deren Konkurrenz in der Durchführung solcher Maßnahmen hat zu unterbleiben. Das Muster einer militärisch durchgeplanten Operation mit einem „klaren Ziel“, „ausreichender Finanzierung“ und einem „absehbaren Ende“ weist den imperialistischen Konkurrenten die Rolle zu, sich mit finanziellen Beiträgen und militärischer Disziplin unter US-Führung einzureihen und eigene nationale Rechnungen zu unterlassen. Nur bei einer eindeutigen und klar abgesteckten Unterordnung der anderen Nationen wollen die USA in Zukunft die UNO als geeignetes Instrument würdigen. Mit dieser Linie einer künftigen „internationalen Lastenteilung“ bringt die US-Politik dann allerdings die Frage aufs Tapet, ob bei einer solchen Mitwirkung die „Partner“ ihre nationalen Interessen noch wiedererkennen können.
Auch die anderen Nationen wissen, wovon die Rede ist, wenn in den USA das Thema „Isolationismus“ hochkommt; sie zeigen sich gar nicht zufrieden mit der Aussicht, daß ihnen damit eventuell mehr an „Verantwortung“ zufallen könnte, wie die Deutschen die Sache so gerne nennen. Sie befürchten vielmehr sehr zurecht eine Einseitigkeit und Unberechenbarkeit der US-Politik, die ihre Mitmacher nicht mehr konsultiert, sondern mit fertigen Beschlüssen und ihrer Potenz konfrontiert, als unbestrittene Militärmacht keine Rücksicht nehmen zu müssen.
8.
Den USA ist es zwar nicht gelungen, im Fall Somalia unter ihrem Kommando eine exemplarische Ordnungsaktion zu veranstalten. Aber mit ihrem Abzug gelingt ihnen der intendierte Beweis – auf negative Weise: Ohne die Beteiligung von US-Truppen verspürt keine der Konkurrenznationen das Bedürfnis, die Aufsicht über die dortigen Verhältnisse zu übernehmen. Alle sehen sich dazu genötigt, die peinliche Abhängigkeit von der US-Militärmacht zuzugeben und im Gefolge der USA ebenfalls ihre Truppen abzuziehen. Die UNO, von der Kinkel ein ums andere Mal verlangt, sie müßte ein „neues Konzept“ vorlegen, bringt so etwas nicht einmal dem Schein nach zustande; schließlich sind die Entscheidungen ihres Exekutivorgans, des Sicherheitsrats, gar nichts anderes als die kombinierten Berechnungen der konkurrierenden Partner.
Auch die Deutschen, die die Bequemlichkeit eines Seiteneinstiegs in der Rolle friedensfördernder Blauhelme ausnützen wollten, um sich als international agierende Militärmacht ins Geschäft zu bringen, sehen sich gezwungen, die neue Lage in Rechnung zu stellen.
Bis neulich noch konnte man den gebührenden Stolz auf unsere Jungs in Belet Huen mit täglichen Zustandsberichten pflegen und daneben das Leiden der Nation an der Bedeutung ihres Beitrags, das Problem mit den Indern hin- und herwälzen. Da konnte man sich zwar mit den vielen guten Taten trösten, die unsere Jungs vor Ort verrichten, aber dann kamen auch immer Fragen auf, warum es dazu die Bundeswehr braucht bzw. ob es für unsere Truppe nicht ein bißchen peinlich ist, ausgerechnet nur für die Verpflegung irgendwelcher Inder eingesetzt zu werden.
Die Sorte Problematisiererei ist jetzt aber zu Ende, jetzt leidet die Nation ganz anders, an ihrer Abhängigkeit von den USA, die sie peinlich zu spüren bekommt. Da sind sich Außenminister und Verteidigungsminister erst einmal einig und Aussprüche schuldig, daß wir uns von denen doch nichts diktieren lassen…
„Wir sind keine Nichts-wie-weg-Armee.“ (Spiegel, 11.10.93)
„Kinkel… Rühe… Deutschland werde sich dem Abzug der amerikanischen Truppen aus Somalia nicht automatisch anschließen. „Wir sind kein Reflex der Amerikaner“, sagte Rühe…“
Andererseits, Rühe:
„Wir werden nicht diejenigen sein, die als letzte in Somalia das Licht ausknipsen.“ (FAZ, 16.10.93)
Es ist nämlich leider doch noch so, daß die USA die Sachlage in Somalia maßgeblich bestimmen und die Bundeswehr lange noch nicht so weit ist, sich dabei konkurrierend einzumischen. Und die FAZ sagt es in ihrem Ärger offen heraus, worum es bei dem so überaus selbstlosen und humanitären Bundeswehreinsatz der Sache nach gegangen ist: um die Eroberung von Zuständigkeiten für die deutsche Politik.
„Das ist die Konsequenz daraus, daß Bonn diesen von Bedingungen und Vorbehalten begrenzten deutschen Einsatz deutscher Soldaten im Ausland weniger nach eigener Einsicht und in souveräner Entscheidung beschlossen hat als vielmehr aus dem Bedürfnis, bei einer internationalen Aktion nicht abseits zu stehen. Da waren die Mitbestimmungsmöglichkeiten von vornherein gering; man hat sich abhängig gemacht von Beschlüssen, die in anderen Hauptstädten gefaßt werden – nur um dabei zu sein.“ (FAZ, 28.10.93)
Gerade neulich wurde die Nation noch darüber instruiert, daß die Deutschen einfach dabeisein müßten, nicht immer abseits stehen dürften bei internationalen guten Werken. Und nun wird im Namen des wirklichen Zwecks Beschwerde geführt: Bloßes Dabeisein ist nämlich nichts wert, wenn man damit nicht Rechte und Kompetenzen, selber zu bestimmen, erkaufen kann. Eine dankenswert deutliche Klarstellung, wie die Sprüche von neulich gemeint waren, daß die Deutschen Verantwortung ganz bestimmt „nur“ im Rahmen der Weltgemeinschaft und nie wieder allein tragen wollen. Und der Außenminister teilt mittlerweile ohne jeden Schnörkel mit, daß er mit dem Somalia-Einsatz um den Sitz im Sicherheitsrat schachert – das ist also der wirkliche Gehalt der humanitären Motive der Deutschen.
Der Streit zwischen Kinkel und Rühe wurde vorgeblich darum geführt, ob die deutschen Truppen dableiben oder abziehen sollen. Dabei ist der Abzug auch für die Deutschen beschlossene Sache, nachdem eine europäische Allianz schnell ausgeschlossen werden mußte. Daß dieser Streit dennoch einige Wochen hingezerrt wurde, hat viel mehr mit dem Bedürfnis zu tun, gegen den offenkundigen Beweis der Unselbständigkeit des deutschen Militäreinsatzes um den Schein zu kämpfen, daß deutsche Politik ganz autonom mit „der UNO“ berät und ihre „Verantwortung“ souverän wahrnimmt. Kinkel:
„… erwartet das Auswärtige Amt eine Stellungnahme der Vereinten Nationen über die weitere Strategie der Weltorganisation in Somalia und die speziellen Wünsche an Bonn.“ (SZ, 26.10.93)
„Zwar sei der deutsche Einsatz logistisch mit dem Befriedungseinsatz der amerikanischen Truppen in Somalia verbunden, aber das dürfe nicht überbewertet werden. Deutschland dürfe sich nicht allein mit seinem humanitären Auftrag vom Befriedungsauftrag der amerikanischen Truppen abhängig machen.“ (FAZ, 26.10.93)
„Erst will man in engen Konsultationen mit dem UN-Generalsekretariat, ohne die Vereinten Nationen unter Druck zu setzen, an einem Konzept zur Klärung der politischen Lage in Somalia arbeiten… Nachdem Deutschland Verantwortung übernommen habe, werde es dazu stehen.“ (FAZ, 28.10.93)
Dagegen reitet der Verteidigungsminister darauf herum, daß die Ausgangsbedingungen entfallen, nach denen der Einsatz der Deutschen auf „befriedetes Gebiet“ beschränkt ist und der Nachschub durch nicht befriedetes Gebiet durch die Amis geregelt ist. Das Mißverständnis ist zwar beabsichtigt, daß er im Unterschied zum Außenminister in erster Linie um Leib und Leben seiner Soldaten besorgt ist. Der Verteidigungsminister denkt aber vorwärtsweisend an die Bedingungen, die für künftige deutsche Militäreinsätze gegeben sein müssen. Auch aus einem mißglückten Fall lassen sich die richtigen Schlußfolgerungen für die Zukunft ziehen. Die Peinlichkeit mit den Indern läßt sich auch ganz gut der UNO und ihrer schlechten Planung zur Last legen:
„Wenn die Amerikaner weg sind, kriegen wir nichts mehr von ihnen, mit dem wir den nicht vorhandenen indischen Großverband versorgen können.“ (SZ, 20.11.93)
Der Einsatz der Bundeswehr hat in Zukunft gefälligst auch ihrer Bedeutung zu entsprechen:
„Der Somalia-Einsatz habe gezeigt, daß die Bundeswehr künftig nur noch gemeinsam mit anderen Nato-Ländern UN-Einsätze übernehmen sollte, weil nur in diesem Fall die für eine Zusammenarbeit erforderliche Übereinstimmung von Strukturen und Ausrüstung gegeben sei. Man solle sich zur Regel machen, gemeinsam zu kommen und gemeinsam zu gehen.“ (FAZ, 28.10.93)
Und schließlich ist der Nation ausgiebig genug vorgeführt worden, daß Blauhelmeinsätze der Bundeswehr letztlich ohne einen regelrechten Kampfauftrag nicht zu haben und einfach unvernünftig sind.
Die Rolle der Somalis in dieser Hinsicht: Immerhin können wir uns nicht oft genug bestätigen lassen, daß die Somalis uns Deutsche so ganz besonders lieben. Eine schöne Dialektik: Gerade weil deutsche Soldaten bloß den Onkel Doktor spielen, Brunnen bohren usw., finden die somalischen Clanchefs, daß das liebe und nützliche Weiße sind – und mit diesem Vertrauensbeweis lassen wir unsere deutsche Truppe zum nächsten Einsatz rufen, der garantiert nicht mehr unter den Beschränkungen des blauen Helms leidet.
[1] Zur Rolle der UNO im Rahmen der neuen Weltordnung und den Kalkulationen ihrer führenden Mitglieder „Die UNO der 90er Jahre. Fortschritte des Imperialismus unter der Losung seiner Überwindung“ in GegenStandpunkt 1-93, S.15
[2] Der Widerspruch
zwischen der US-Planung einer zeitlich befristeten
machtvollen Blitzaktion und der Sachlage, die damit
geregelt werden sollte, war zwar keineswegs unbekannt:
Somalia ist ein Land ohne eine funktionierende
Wirtschaft, ohne Polizeikräfte, ohne Regierung. Wenn
nicht ein Kontingent von peacemakers lange genug bleibt
– und das könnte Jahre dauern –, um irgendeine Sorte
von nationaler Autorität wiederherzustellen, werden
sich die Ursachen des jetzigen Chaos immer wieder
geltend machen…
(Time
Magazine, 14.12.92) Es war bekannt, daß ein
Erfolg in diesem Testfall nichts Geringeres als die
Neugründung einer Staatsgewalt verlangte, und zwar
unter der Aufsicht und Kontrolle auswärtiger Mächte,
ganz nach dem Muster des alten Kolonialismus, an den
sich ein Fachmann der US-Außenpolitik sofort erinnert
fühlt: „Der Umgang mit Un-Staaten
(anti-countries)… Aber sogar dann, wenn die
Hungerhilfe gesichert werden kann, wird Somalia immer
noch ein Un-Staat bleiben: Die Opfer der Kriegsherren
werden nur besser ernährt. Der logische und notwendige
nächste Schritt wird darin bestehen müssen, daß die UNO
Somalia solange verwaltet, bis es einmal wieder eine
funktionierende Regierung gibt.“ (Strobe Talbott in Time Magazine,
14.12.92) Als Einwand wurde diese Feststellung
damals aber gerade nicht gelten gelassen, woran zu
sehen ist, wie sehr die USA einerseits glaubten, den
angestrebten Beweis nötig zu haben. Andererseits lassen
sie sich von den lächerlichen Dimensionen des Gegners
darin bestärken, daß das vorgestellte Problem letzlich
keines sein kann: Die Situation dort ist ein
Paradigma der Stammesfehden, die sich als der Fluch der
Ära nach dem Kalten Krieg herausstellen, und eine
Herausforderung an unsere Fähigkeit, mit ähnlichen
Situationen an anderer Stelle fertigzuwerden… In
Bosnien müßten UN-Friedenskräfte gegen serbische Panzer
und schwere Artillerie antreten. Im Gegensatz dazu
besteht der Gegner in Somalia hauptsächlich aus
bewaffneten Halbwüchsigen auf Toyota Landrovern. Wenn
die Vereinten Nationen nicht in der Lage sind, diese
Bedrohung der neuen Weltordnung zu besiegen, wird es
keine solche Ordnung geben.
Und einmal in
Erinnerung gerufen, daß Weltordnung sowieso nur ein
anderes Wort dafür ist, überall Aufsicht und
Zuständigkeit anzumelden, findet sich in Somalia auch
der Trost, daß die Schwierigkeiten eines Eingriffs zu
bewältigen sind.
[3] Nicht einmal die UNO-Resolution, Aidid zu fangen und für die 24 toten Pakistani zur Rechenschaft zu ziehen, hat sich durchsetzen lassen. Newsweek belustigt sich über die CIA, die es nicht schafft, Aidid zu fangen, weil nämlich mangels Staat nicht einmal so gewöhnliche Elemente einer Staatsmacht wie bestechliche Beamte und abhörbare Telefone, auf denen die CIA-Arbeit woanders beruht, in Somalia vorhanden sind: „Wenn der Bösewicht kein Telefon zum Abhören hat… Warum kann Mohammed Farah Aidid nicht gefangen werden? Washingtons übliche Tricks klappen nicht. Normalerweise spioniert die CIA in der Dritten Welt, indem sie Regierungsbeamte schmiert. Die NSA sammelt Erkenntnisse, indem sie Telefone abhört. Aber in Somalia gibt es keine Regierungsbeamten und wenig Telefone.“ (18.10.93)