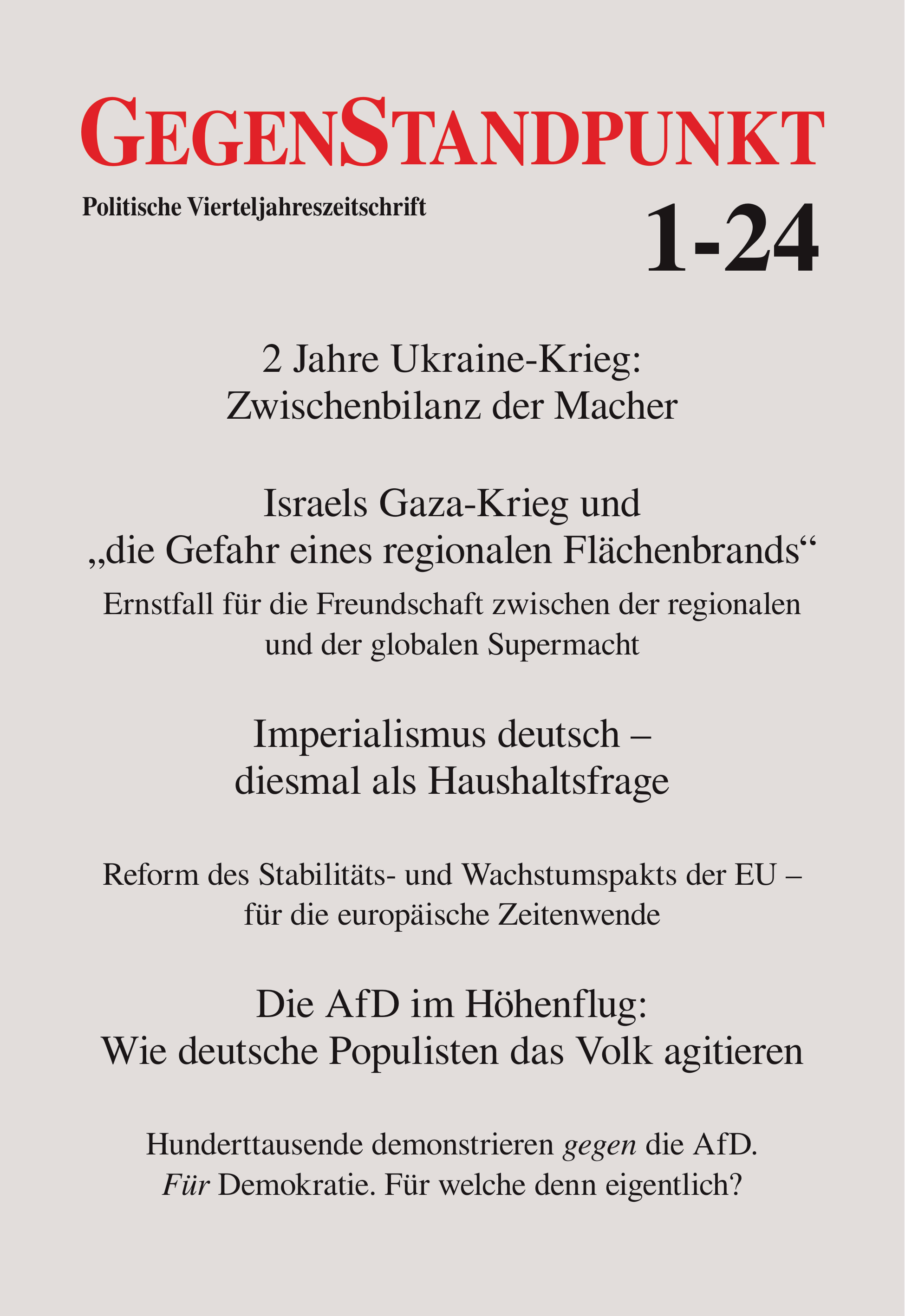EU-Staatschefs beschließen neue Osterweiterung
Die Ukraine und Moldau sind ab sofort künftiger Besitzstand der EU
Auf dem EU-Gipfel im Dezember 2023 beschließt das oberste EU-Gremium, förmliche Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine und Moldawien zu eröffnen. Die Ukraine reibt im Abnutzungskrieg gegen Russland zunehmend die Substanz ihrer menschlichen Basis wie ihrer Ökonomie auf, Moldawien ist ein zwischen der auf Russland ausgerichteten Minderheit und der westorientierten Mehrheit intern verfeindetes Elendsquartier. Diese Verfassung der nunmehr zu offiziellen Beitrittsverhandlungen zugelassenen Kandidaten steht in krassem Kontrast zu den bisher gültigen Voraussetzungen dafür, dass ein Staat zum Beitrittskandidaten ernannt, sprich: von der EU für so nützlich befunden wird, zur vollständigen Anpassung an ihr supranationales Rechtssystem und dadurch zur Perspektive der Mitbestimmung über die vergemeinschaftete Machtausübung zugelassen zu werden.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
EU-Staatschefs beschließen neue Osterweiterung
Die Ukraine und Moldau sind ab sofort künftiger Besitzstand der EU
Auf dem EU-Gipfel am 14./15. Dezember 2023 beschließt das oberste EU-Gremium, förmliche Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine und Moldawien zu eröffnen. Die Ukraine reibt im Abnutzungskrieg gegen Russland zunehmend die Substanz ihrer menschlichen Basis wie ihrer Ökonomie auf, Moldawien ist ein zwischen der auf Russland ausgerichteten Minderheit und der westorientierten Mehrheit intern verfeindetes Elendsquartier. Diese Verfassung der nunmehr zu offiziellen Beitrittsverhandlungen zugelassenen Kandidaten steht in krassem Kontrast zu den bisher gültigen Voraussetzungen dafür, dass ein Staat zum Beitrittskandidaten ernannt, sprich: von der EU für so nützlich befunden wird, zur vollständigen Anpassung an ihr supranationales Rechtssystem [1] und dadurch zur Perspektive der Mitbestimmung über die vergemeinschaftete Machtausübung zugelassen zu werden. [2] Der nunmehr eröffnete Beitrittsprozess ist denn auch nur formell dasselbe wie die abermalige Durchführung des im EU-Rechtssystem vorgesehenen Aufnahmeverfahrens; seinem politischen Inhalt nach ist er ein beispielloser Beschluss, gerade weil die Beitrittsabsicht von allen Beteiligten ernst genommen wird.
1. Die nunmehr offiziell als künftiger EU-Besitzstand eingestuften Staaten sind – wie die baltischen Staaten – ehemalige Mitgliedsländer der UdSSR, stellen aber im Unterschied zu diesen in politischer, ökonomischer und strategischer Hinsicht frühere Kernbestandteile der Sowjetunion dar, auf welche die Russische Föderation den Rechtsanspruch erhebt, dass sie als ihr ‚nahes Ausland‘ zum Sicherheitskordon von befreundeten Staaten gehören müssen. Seit mehr als zwei Jahren führt Russland einen Krieg in der und um die Ukraine, mit dem Zweck, auf diesem Schlachtfeld der NATO den geforderten Respekt vor ihrer Sicherheitspolitik aufzuzwingen; umgekehrt dient dieses Land der NATO als Stellvertreter in einem Krieg, den sie erklärtermaßen mit dem gar nicht auf die Ukraine beschränkten Ziel führen lässt, Russlands Fähigkeiten zum militärischen Geltendmachen autonomer Machtansprüche entscheidend zu schwächen. [3] Wenn die EU durch ihr oberstes Beschlussorgan den ersten verbindlichen Schritt zur Eingemeindung von Ukraine und Moldawien in ihren Staatenbund vollzieht, dann legt sie sich in aller Form darauf fest, dass die Einverleibung dieser umkämpften Länder in ihr politisches, ökonomisches und Rechtssystem nur noch von dem von ihr autonom gestalteten Beitrittsprozess abhängen soll.
2. Die beschlossene Eingemeindung der beiden Länder ist ein aktueller Beitrag zum Krieg in der Ukraine; zwar ein symbolischer, vom aktuellen Kriegsverlauf erst einmal abgehobener Akt, aber von grundsätzlicher Bedeutung für den Krieg. Vor zwei Jahren hat Russland mit seinem Einmarsch in die Ukraine die Methode des EU-Imperialismus, das russische Vorfeld auf dem Wege der friedlichen Eroberung an sich zu binden und dadurch die Russische Föderation in eine EU-bestimmte europäische Friedensordnung einzupassen, durch militärische Gewalt beendet. Darauf gibt die EU eine offensive Antwort, von Anfang an durch den Wirtschaftskrieg gegen Russland [4] und durch die materielle Ausstattung der ukrainischen Kriegführung, nunmehr zukunftsweisend durch das in aller Form ergangene Bekenntnis zu einem speziellen EU-Kriegsziel, wonach die politische Einverleibung von Russlands strategischem Umfeld, dessen Transformation in einen exklusiven Besitzstand der EU, damit die Zurückweisung russischer Sicherheitsinteressen und die Unterordnung Russlands unter den Ordnungsanspruch der EU ein unverzichtbarer Zweck dieser Staatengemeinschaft ist. [5] Dabei bleibt Europa sich treu: Es formuliert sein Kriegsziel als Vorgriff auf einen Friedenszustand und seine Einmischung in den laufenden Krieg als notwendige und sinnvolle Hervorbringung dieses Friedens, bei der die EU der Ukraine mit all ihren Mitteln beistehen will. Diese Heuchelei soll nichts verbergen, sondern mitten im keineswegs entschiedenen militärischen Kampf klarstellen: Mit dem EU-Kandidatenstatus für die Ukraine bekennt die EU sich nicht nur als Interessent an einer russischen Niederlage, sondern als Partei, die mit ihrem Engagement ein für sie lohnendes Ziel dieses Krieges herbeiführen will, mithin als ein aus eigenen Stücken agierender Kriegsgegner Russlands.
3. Diese Eskalation der Einmischung in den Ukraine-Krieg bezieht die strategische Militärmacht Russlands in ein kühnes Kalkül ein. Die EU-Regierungen und die Brüsseler Kommission lassen sich durch die russischen Drohungen, jede direkte Kriegsbeteiligung von NATO-Staaten mit der Wucht ihrer strategischen Waffen zu bestrafen, nicht von der substanziellen Ausweitung ihres Engagements für die militärische und zivile Selbstbehauptung der Ukraine abschrecken. Sie setzen darauf, dass Russland weiterhin die Überschreitung seiner „roten Linien“ durch den Westen aus seinem eigenen Interesse an der Regionalisierung des Krieges mit der NATO – ausgedrückt in der von beiden Seiten aufrechterhaltenen Lesart, dass dieser Krieg nur zwischen der Russischen Föderation und der Ukraine stattfinde und letztere von der NATO nur von außen unterstützt werde – jedes Mal mit der Eskalation seines Einsatzes auf dem ukrainischen Kriegsschauplatz beantwortet; mit der Konsequenz zunehmender Verwüstung der Ukraine. Diesem Vorgehen Russlands begegnet die EU mit einer diplomatischen Gegenoffensive: Der Beschluss zur Eröffnung von Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine erweitert die bisherige Unterstützung durch die formelle Erklärung des gemeinsamen Willens der EU, sich das große Land an der russischen Westgrenze langfristig einzuverleiben – als großen, von Russland nicht zu überwindenden Einspruch gegen dessen Macht – und es in dieser Rolle gegenwärtig zu stabilisieren. Europa ist sich darin einig geworden, in einem weiteren Schritt die strategische Abschreckungsmacht Russlands durch militärische wie durch diplomatische Eskalation herauszufordern, als wäre sie ein vom Westen beherrschtes und nach den eigenen Zielen handhabbares Risiko.
4. Kühn ist dieser Vorgriff der EU auf einen Siegfrieden über Russland auch in einer zweiten Hinsicht: Anerkanntermaßen sind die europäischen Mächte für sich allein der Russischen Föderation auf keiner Ebene der Kriegführung militärisch gewachsen; Europa verfügt nicht über die militärischen Mittel, die vorweggenommene Eingemeindung der Ukraine und Moldawiens selber herbeizuführen. Wie mit ihrer gesamten Kriegsbeteiligung agiert die EU auch mit ihrem Erweiterungsbeschluss als Mitsubjekt der westlichen Kriegskoalition der NATO. Zu deren Führungsmacht stellt sich der Beschluss der EU, ihren Mitgliederbestand demnächst um zwei Nachbarstaaten Russlands zu erweitern, in ein doppeltes Verhältnis.
Einerseits handelt sie im Sinn der USA, indem sie mit der Verleihung des Kandidatenstatus an die Ukraine mitten im Krieg mehr „Verantwortung“ mit einem gesteigerten Grad an Verbindlichkeit übernimmt, nicht nur für die Bewaffnung, [6] sondern auch für die zivile Basis der kämpfenden Nation. Schließlich bekundet sie ein sehr grundsätzliches Interesse an der staatlichen Existenz und ökonomischen Zukunftsfähigkeit des Staates, der jetzt das Schlachtfeld und die Kämpfer für den Westen stellt und künftig das dauerhafte regionale Sicherheitsproblem für Russland werden soll. Dieses Ziel bestimmt das Maß für die jeweils fällige politökonomische und militärische Unterstützung der Ukraine; ein Maß, das nicht mit einer notdürftigen Ergänzung anderer Hilfen verwechselt werden will, sondern aus eigenen europäischen Stücken darauf zugeschnitten wird, dass die Ukraine über das verfügt, was die EU zur jeweils angesagten Eindämmung russischer Macht für nötig hält. [7] Dass die EU dafür nicht nur, aber eben auch nicht zuletzt ihren finanziellen Einsatz erhöhen muss, ist allen Beteiligten klar; der Beschluss, wie viel Geld das aktuell heißt, wird auf die erste Sitzung des Rates im neuen Jahr vertagt.
Andererseits und im gleichen Zug versucht sich die EU in „Führung“ – nämlich darin, den amerikanischen Kriegswillen, dessen bisherige Fassung in den USA zunehmend umstritten ist, konstruktiv zu bestärken: Die europäischen Verbündeten der USA legen sich kollektiv auf die Kriegsperspektive fest, die jedem amerikanischen Politiker recht sein muss – Moskau muss aufgrund der Schäden, die seiner militärischen Potenz im Ukraine-Krieg zugefügt wurden, dulden und akzeptieren, dass das russische Kriegsziel, die Anerkennung seiner autonom definierten Sicherheitsinteressen, nicht zu erreichen ist. So versucht die EU, in den USA auf die Fortsetzung des Krieges hinzuwirken, den sie will, aber allein nicht führen kann: Sie stellt der Führungsmacht ein eigeninitiatives Engagement in Aussicht, das Europa als gewichtige Machtausweist, die dadurch unverzichtbar ist, dass die Kooperation sichfür die USA lohnt.
5. Der Beschluss zur Eröffnung der Beitrittsverhandlungen wird im Dezember 2023 gefasst. Der einzige Quertreiber Orbán bereichert die journalistischen Chroniken der entscheidenden Ratssitzung um die schräge Anekdote von der 10-Milliarden-Kaffeetasse, sodass die Entscheidung einstimmig fällt. Auf das darin liegende Signal kam es den Staats- und Regierungschefs offenbar an: Die europäischen Regierungen verbinden sich einmütig und uneingeschränkt zu dem gemeinsamen Willen, mit dem Krieg in der Ukraine die Bestimmungsmacht der Europäischen Union definitiv auf den gesamten Kontinent westlich der Russischen Föderation auszudehnen. Für diesen großen Zweck haben sie am 13./14.12.2023 ihre Konkurrenz untereinander ausgesetzt und die Machtfragen, welche die jüngste Fortentwicklung ihrer Gemeinschaft für sie aufwirft, auf 2024 vertagt.
[1] „Acquis communautaire [frz.: gemeinschaftlicher Besitzstand] umfasst alle Rechte und Pflichten, die für jedes EU-Mitglied verbindlich sind. Dazu gehören die Ziele und Grundsätze der Verträge, die auf dieser Grundlage erlassenen Rechtsvorschriften (‚EU-Recht‘, wie etwa Richtlinien und Verordnungen) einschließlich der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH), die im Rahmen der EU angenommenen Erklärungen und Entschließungen, die Rechtsakte der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik und der ‚polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit‘ sowie die von der Gemeinschaft unterzeichneten internationalen Abkommen. Der A. umfasst inzwischen mehr als 100 000 Gesetzesakte (EuGH-Urteile und internationale Verträge der EU nicht eingerechnet) und wird ständig fortentwickelt (Stand 2019).“ (Bundeszentrale für politische Bildung: Das Europalexikon, s.v. Acquis communautaire, zitiert nach bpb.de)
[2] Nach den eigenen EU-Regeln können Beitrittsverhandlungen nur eröffnet werden, wenn der Kandidat nicht in offene Grenzkonflikte und nicht in einen militärischen Konflikt verwickelt ist. Der Hinweis auf diese Bedingung wurde in der anfänglichen Debatte über die schon früh geäußerten Forderungen nach Aufnahme der Ukraine in die EU auch vorgebracht, gilt mittlerweile aber nicht mehr als Einwand. Offenbar gibt es ein höheres gemeinsames Interesse, das die EU sich nicht durch Selbstfesselung vermasseln will.
[3] Dieses Kriegsziel teilt die EU. Auf dem gleichen Gipfeltreffen, auf dem der Beschluss zur Eröffnung von Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine fällt, bekräftigen die Staats- und Regierungschefs ihre diesbezügliche Position folgendermaßen: „Die Europäische Union ist entschlossen, in enger Zusammenarbeit mit Partnern und Verbündeten die Fähigkeit Russlands zur Führung seines Angriffskriegs weiter zu schwächen, einschließlich durch die weitere Verschärfung der Sanktionen und durch deren vollständige und wirksame Umsetzung und die Verhinderung ihrer Umgehung, insbesondere im Fall von Hochrisikogütern. Der Europäische Rat begrüßt die Annahme des 12. Sanktionspakets. Er begrüßt ferner die Einigung über die Richtlinie zur Definition von Straftatbeständen und Sanktionen bei Verstoß gegen restriktive Maßnahmen der Union.“ (Schlussfolgerungen des Europäischen Rates zu den Themen Ukraine, Erweiterung und Reformen, Pressemitteilung vom 14.12.23)
[4] Auch diese Art der Kriegführung wird auf dem Treffen der Staats- und Regierungschefs durch weitere Beschlüsse verschärft (vgl. Fußnote 3).
[5] „‚Die Menschen in der Ukraine gehören zur europäischen Familie‘, kommentierte Außenministerin Annalena Baerbock die Empfehlung der EU-Kommission auf X. Der Beginn der EU-Beitrittsgespräche sei der nächste Schritt, ‚den wir gemeinsam gehen sollten. Denn eine stärkere, größere und geschlossene EU ist die geopolitische Antwort auf Russlands Angriffskrieg‘.“ (tagesschau.de, 8.11.23) Die deutsche Außenministerin stellt die Zielprojektion ihrer imperialistischen Kampfposition als vorausgesetzte quasinatürliche Gegebenheit hin, die von sich aus auf Realisierung drängt, und gibt die feindlichen Maßnahmen zum Erreichen dieses Ziels als so notwendige wie legitime Reaktion auf illegitime Widerstände aus.
[6] „Eine Beistandsgarantie der EU nach Artikel 42.7 des Vertrags von Lissabon würde dem Land künftig Schutz und einen sicherheitspolitischen Rahmen bieten, ähnlich der Beistandsklausel nach Artikel 5 des NATO-Vertrags.“ (Infoportal östliches Europa der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg, osteuropa.lpb-bw.de)
[7] Zum Jahreswechsel 2023/24 formuliert die EU das aktuelle Unterstützungsziel so: „Die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten werden sich weiterhin mit dem dringenden militärischen Bedarf und Verteidigungsbedarf der Ukraine befassen. Der Europäische Rat unterstreicht insbesondere die Bedeutung einer rechtzeitigen, vorhersehbaren und nachhaltigen militärischen Unterstützung für die Ukraine, vor allem durch die Europäische Friedensfazilität und die militärische Unterstützungsmission der EU sowie durch unmittelbare bilaterale Hilfe von Mitgliedstaaten.“ (Schlussfolgerungen des Europäischen Rates zu den Themen Ukraine, Erweiterung und Reformen, Pressemitteilung vom 14.12.23)