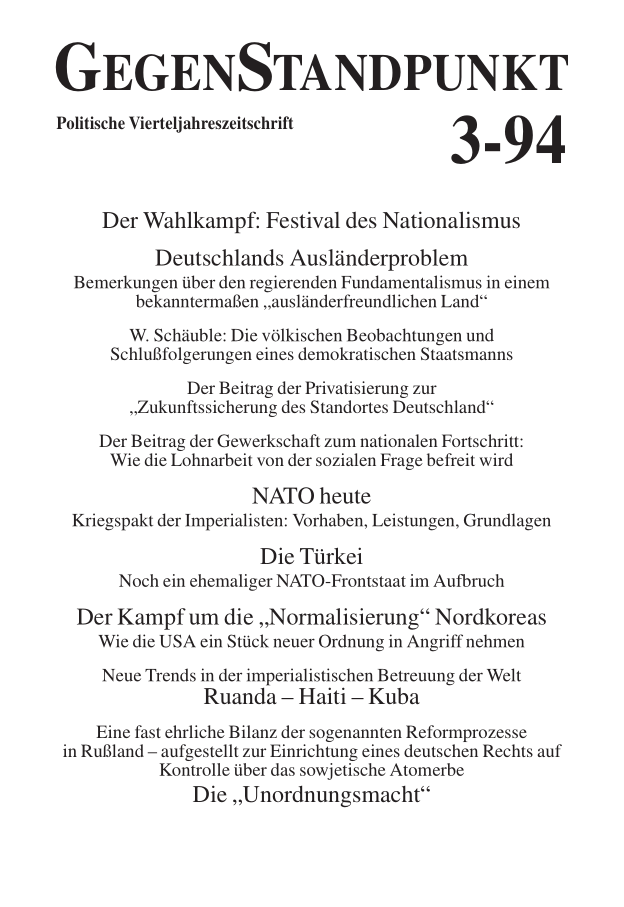Der Beitrag der Gewerkschaft zum nationalen Fortschritt:
Wie die Lohnarbeit von der sozialen Frage befreit wird
Der Tarifstreit bei Post und Druck
Öffentliche Klarstellungen zum sachgemäßen Gebrauch eingetragener Vereinsrechte
Die Post GW segnet die Privatisierung der Post ab; die IG Medien zieht ihre sozialen Verbesserungsforderungen zurück. Beschäftigungssicherung gegen Lohnprozente und Öffnung der ausgehandelten Verträge für betriebliche Gegebenheiten. Das stärkt die Bedeutung der Betriebsräte, erhöht die Freiheit der Unternehmen bei der Gestaltung der betrieblichen Arbeitsbedingungen und verschafft der GW eine neue Perspektive: den Kampf um ihre eigene Selbstbehauptung.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Gliederung
- „Die Gewerkschaften bleiben im Spiel“ – bloß wie
- Was mit der Anpassung an die aktuellen politischen Vorgaben unterschrieben ist: Neue Maßstäbe für gewerkschaftliches Wohlverhalten
- Die Sache mit der „Beschäftigungssicherung“: Wie mit den Mitteln der Tarifpolitik ein (angeblicher) Staatsnotstand bekämpft wird
- Das gewerkschaftliche Angebot: Tausche Bindewirkung der Tarifverträge gegen Stammplatz als Tarifpartner
- Die verbleibende Perspektive: Ein Kampf um Selbstbehauptung
Der Beitrag der Gewerkschaft zum
nationalen Fortschritt: Wie die Lohnarbeit von der
sozialen Frage befreit wird
Der Tarifstreit bei Post und
Druck
Öffentliche Klarstellungen zum
sachgemäßen Gebrauch eingetragener Vereinsrechte
„Das Kampfmittel des Streiks wurde von beiden Gewerkschaften mißbraucht, im einen Fall, um die Post-Privatisierung politisch, wenn nicht zu verhindern, so doch zu verzögern, im anderen, um völlig überzogene Ausgangsforderungen durchzusetzen… Auch wenn am Ende des ungleichen Kampfes akzeptable Kompromisse stehen – die Druckindustrie bekommt vor allem die bitter nötige Flexibilisierung der Arbeitszeit –, kann den Gewerkschaftschefs Hensche und van Haaren der Vorwurf nicht erspart werden: Sie haben dem Ansehen der Tarifautonomie geschadet.“ (Handelsblatt)
Man merkt schon: Die schlichte Frage danach, was die angesprochenen Gewerkschaften eigentlich hätten tun sollen, um für das „Ansehen der Tarifautonomie“ Ehre einzulegen, stellt sich erst gar nicht. Dem Kommentar des „Handelsblatts“ – und ähnlich geifernd waren so gut wie alle bundesdeutschen Medien im Fall dieser beiden Tarifstreitigkeiten – ist nämlich zu entnehmen, daß es die kritisierten Arbeitervereine der hiesigen Öffentlichkeit gar nicht recht machen können. Außer natürlich sie stellen sich überhaupt nicht erst auf und geben den Arbeitgebern gleich ihre Unterschrift dazu, was diese an „bitter nötigen“ Korrekturen der geltenden Tarifverträge vorsehen. „Anspruchsdenken“ bei der Festlegung der Konditionen deutscher Lohnarbeit – das ist spätestens mit dem Ablauf der diesjährigen Tarifstreitigkeiten klargestellt[1] – steht ausschließlich denjenigen zu, die unter der Ehrenbezeichnung „Beschäftigungsgeber“ den lohnabhängigen Menschen die Wohltat zukommen lassen, überhaupt einer Arbeit nachgehen zu dürfen. Deswegen brauchte die öffentliche Hetze an den beiden gewerkschaftlichen Nachhutgefechten nicht groß eine Abweichung von der ansonsten so gut benoteten Tariflinie der übrigen DGB-Gewerkschaften aufzuspüren. Es war genau umgekehrt: Weil von dem Beschluß ausgegangen wurde, daß sich jeder Anschein eines gewerkschaftlichen Forderns verbietet, wurde der gewerkschaftliche Gebrauch der Tarifautonomie als ein einziger Mißbrauch identifiziert.
Nehmen wir den Fall des Tarifstreits bei der Post, weil sich hier Staat und Öffentlichkeit in ganz besonderer Weise herausgefordert sahen. Kaum hatte die Postgewerkschaft kundgetan, ganz vorschriftsgemäß ihr im Bürgerlichen Gesetzbuch verbrieftes Mitbestimmungsrecht für den Fall eines geplanten „Betriebsübergangs“ in Anspruch nehmen zu wollen – unter den diesbezüglichen BGB-Paragraphen fällt das mit der Privatisierung der Post bezweckte Staatsvorhaben, seinen Postunternehmen Anlagesphären außerhalb der Landesgrenzen zu erschließen[2] –, war für die versammelte öffentliche Meinung sofort klar: Dies ist ein „Kampf um den Besitzstand alter Privilegien“, der einem Anschlag auf das staatliche Umstellungsprogramm gleichkommt. Daß es bei der Inanspruchnahme besagten Gewerkschaftsrechts, über den Fortbestand laufender Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen zu verhandeln, der Sache nach bloß um die Modi der Beseitigung bestehender Ansprüche der Beschäftigten geht[3], hat die Meinungsführer nicht im mindesten irritiert. Ihnen kam es auf eine prinzipielle Klarstellung über den angemessenen Umgang mit der „Sozialen Frage“ an. Und wie der auszufallen hat, darüber ist heutzutage alles gesagt, wenn die paar armseligen sozialen Rechte der Postler – als da sind: ein Hitzezuschlag in Form eines „täglichen Kaltgetränkes“, ein Zuschuß zur Berufskleidung, ein „Kranzgeld“ für den Sterbefall sowie ein „Wohnrecht“ für eine Minderheit der Beschäftigten – mit der „Absicherung der Beschäftigten in den früheren DDR-Kombinaten“ verglichen werden, mit der dieser Staat schließlich auch erfolgreich aufgeräumt hat. Für einen Sozialtarifvertrag, den sich die alte Bundesrepublik geleistet hat, um die vergleichsweise Unter-Bezahlung der Postler ein wenig zu kompensieren, ist kein Platz mehr im neuen Deutschland, das sein Post- und Kommunikationswesen zu einer ergiebigen nationalen Reichtumsquelle „reformieren“ will:
„Die Liberalisierung und der Wettbewerb für die Post in Europa werden kommen. Dann geht es nicht mehr um Kleinigkeiten in einem Sozialtarifvertrag, sondern um Arbeitsplätze im Wettbewerb. Der Spielraum der Verhandlungen ist sehr gering.“ (Postminister Boetsch)
Genau genommen hat sich mit „Verhandlungsspielraum“ gar nichts geschoben, denn die Postgewerkschaft durfte kein Stück mehr an „Besitzstand“ sichern als das, was der Staat in sein Gesetz reingeschrieben hat. Mit Ausnahme des „Wohnrechts“ – bei dem es einfach noch andere, mit der Änderung von Tarifverträgen kollidierende, staatliche Vorschriften, das Kündigungswesen betreffend, gibt – läuft der gesamte Sozialtarifvertrag zum 1. Juni 1996 aus. Einschließlich der existierenden „Eingruppierung bei den Einkommen“, weil den neu geschaffenen Unternehmen schon jetzt das Recht gesichert werden soll, dafür zu sorgen, daß die „Arbeitsplätze im Wettbewerb“ – der auch nicht einfach „kommt“, sondern gerade initiiert wird – eines garantiert nicht sind: ein „sozialer Besitzstand“, der das große Vorhaben belastet.
„Die Gewerkschaften bleiben im Spiel“ – bloß wie
Wenn die Postgewerkschaft auch vertraglich zugesichert bekommen und das auch gleich als ihren Erfolg genommen hat, daß sich die neuen Postunternehmen mit ihr als „Tarifpartner“ weiter ins Benehmen setzen, so ist doch nicht zu übersehen, daß sich das Ergebnis ihres Tarifstreits gänzlich darauf zusammenzieht, von der Gegenseite bloß noch formell als Mit-Regelungsinstanz anerkannt zu sein. Schließlich ist mit dem von ihr unterschriebenen Vertrag zugleich ihr gesamter bisheriger Status aufgekündigt, mit dem sie als Gewerkschaft im Staatsdienst, ohne sich groß gegenüber ihrem staatlichen Tarifpartner aufführen zu müssen, auf die aus überkommenen sozialstaatlichen Berechnungen gewährten tariflichen Zusatzleistungen als gewerkschaftliche Errungenschaften verweisen konnte, um sich mit denen ihrer Mitgliedschaft als unverzichtbarer Bestandteil eines Post-Arbeitslebens anzudienen. Damit ist es nun endgültig vorbei. Nicht zuletzt deshalb, weil diese Gewerkschaft mit ihren Streikaktionen ersichtlich gar nicht erst den Versuch unternommen hat, das bundesdeutsche Transport- und Kommunikationswesen wirksam zu behindern, um damit die noch amtierenden staatlichen Arbeitgeber so zur Rücksichtnahme auf die „Sozialen Frage“ zu erpressen.[4] Denn ganz im Gegensatz dazu, was diesem deutschen Arbeiterverein von der fanatisierten nationalen Öffentlichkeit nachgesagt wurde, ist die DPG mit ihren Arbeitskampfmaßnahmen nicht auf eine „Verhinderung der Postreform“ aus gewesen, sondern erklärtermaßen für die deutsche Post-Offensive, hat folglich auch ihr Einverständnis dazu gegeben, daß diese auf Kosten ihrer Mitglieder durchgeführt wird. Der mit dem gewerkschaftsüblichen „Aber-nicht-um-jeden-Preis“ bezweckte Test darauf, ob den Post-Arbeitgebern das „bewährte Einvernehmen“ mit ihrem „Tarifpartner“ nicht auch ein Zugeständnis in Form einer gewissen Schadensmilderung wert wäre, ist wie gesagt gründlich in die Hose gegangen. Und es kann schon bezweifelt werden, ob diese Gewerkschaft davon überhaupt etwas mitgekriegt hat, wenn ihr Verhandlungsführer zusammen mit dem aus dem Arbeitgeberlager das ausgehandelte Tarifergebnis in der Öffentlichkeit als Geschenkpaket – „fein säuberlich mit rotem Band und Schleife verziert“ – präsentiert. Symbolträchtig war das allemal: die gesetzlich vorgesehene Schonfrist bei der Abwicklung sozialer Ansprüche als Gnadengeschenk des Staates, das die Gewerkschaft – und damit hat sich ihre Mitbestimmung – höchstverantwortlich mit einwickeln darf.
Wie sehr sich das „soziale Klima“ hierzulande verändert hat, durfte im übrigen auch die IG Medien erfahren. Sie stieß mit ihrem Antrag, ein paar soziale Verbesserungen im Manteltarifvertrag zu vereinbaren – dabei ging es um so etwas wie eine „Vorruhestandsregelung für Nachtschichtarbeiter“, „mehr Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz“ etc. –, von vornherein auf einen tarifpolitischen Kontrahenten, der solche Änderungsanträge erst gar nicht für verhandlungsfähig erklärte. Also kam auch kein Ergebnis in dieser Angelegenheit zustande, und die IG Medien durfte unterschreiben, daß der von ihr gekündigte Manteltarifvertrag rückwirkend wieder in Kraft zu setzen ist. Dabei mag es durchaus so sein, daß sich die Gewerkschaft – wie ihr Vorsitzender Hensche nachträglich erklärte – in der Beurteilung der „Lage“, sprich: der Kompromißlosigkeit, auf die sie gestoßen ist, ein wenig getäuscht hat:
„Wir haben die Lage wohl falsch eingeschätzt und nicht bedacht, wie quer zum Zeitgeist unsere Themen gewesen sind, wo sich doch alles nur noch für Ökonomie interessiert, nicht für mehr Gesundheitsschutz und nicht für die Gleichstellung der Frau…Der Druck reicht nicht mehr aus.“
Nicht zu übersehen ist jedoch vor allem, daß sich diese Gewerkschaft vor dieser „Lage“ verantworten will. Deswegen ist für sie bloß was „drin“, wenn der „Zeitgeist“, diese für die nationalen Interessen parteiliche Instanz, für das Soziale etwas übrig hat. Wenn sich der „Tarifpartner“ nicht mit einer Streiktaktik der „Nadelstiche“ für gewerkschaftliche Themen interessieren läßt, dann geht eben gar nichts mehr für diesen Verein. Dann stellt er sich auf die neue „Lage“ ein, auch wenn die „quer“ steht zu seinen „Themen“.
Was mit der Anpassung an die aktuellen politischen Vorgaben unterschrieben ist: Neue Maßstäbe für gewerkschaftliches Wohlverhalten
An der strikten Uniformität der in diesem Jahr vereinbarten Reallohnsenkungen – die IG Medien ließ sich die angesagten 2% (inclusive ein paar Nullmonate) gleich bis ins Jahr 1996 in den Tarifvertrag reinschreiben, was von der Öffentlichkeit sturzzufrieden mit: „Friedenspflicht bis mindestens Frühjahr 1996“ kommentiert wurde –, läßt sich ablesen, daß sich die Gewerkschaften von der früher üblichen Praxis emanzipiert haben, aus dem Geschäftsgang in den jeweiligen Branchen die „Spielräume“ für das Aufstellen ihrer Tarifforderungen zu „errechnen“. Das „Handelsblatt“, das sich unter der Überschrift „Von Differenzierung keine Spur“ schon ein wenig verwundert darüber gezeigt hat, daß sich in den Tarifabschlüssen dieses Jahres die „glänzenden Geschäftsaussichten“ der einen oder anderen Branche mit keinem Prozentpünktchen niedergeschlagen haben, konnte die Gewerkschaften zu ihrem Prozent-Gleichmarsch nur beglückwünschen:
„So kann dem Tarifexperten der IG Bau-Steine-Erden nur zugestimmt werden, wenn er feststellt, der Tarifabschluß spiegele zwar nicht die reale Lage am Bau wider, passe aber in die gegenwärtige politische Landschaft.“
Genau genommen war die gängige gewerkschaftliche Praxis, mit ihren Tarifabschlüssen die „reale Lage“ in den jeweiligen Branchen „widerzuspiegeln“ – das hieß dann: Wenn es mit den Gewinnen nur so brummte, war auch mal ein satter 4,5-Prozenter drin –, schon immer der „politischen Landschaft“ angepaßt. Darin nämlich, daß die stets „wirtschaftsverträglichen“ Tarifergebnisse immer auch das probate Mittel für das politische Programm waren, den „Wiederaufstieg“ der Nation erfolgreich voranzubringen. Jetzt aber, wo alle zuständigen staatlichen Stellen eine sehr prinzipielle Unzufriedenheit mit ihrer ökonomischen Basis kundtun, weil sie von deren Erträgen die Weltmachtambitionen des größer gewordenen Deutschland nur schlecht bedient sehen[5], definiert sich auch die nationale Verantwortung ein wenig anders, der sich die bundesdeutschen Arbeitervereine noch nie entziehen wollten. Aus positiven Geschäftsentwicklungen Lohnforderungen zu rechtfertigen, gehört sich für sie nicht mehr, seit ihr Beitrag zur „Sicherung des Wirtschaftsstandorts“ gefordert ist. Dabei kriegen sie natürlich auch mit, daß mit diesem Anspruch auch die bislang eingerichteten Formen ihrer gewerkschaftlichen Mitverwaltung in die Schußlinie kommen. Und wenn es inzwischen in der öffentlichen Begutachtung der diesjährigen Tarifergebnisse gewissermaßen ein Gemeinplatz ist, daß sich „durch eine einzige erfolgreiche Tarifrunde jahrelange Fehlentwicklungen nicht beseitigen“ lassen (Arbeitgeber-Präsident Murmann), dann ist ihnen sehr unmißverständlich bedeutet, daß es noch einiges mehr von dem zu kappen gilt, was einem Kapitalismus made in Germany einmal den Ruf einer „sozialen Marktwirtschaft“ eingetragen hat. Nur: Gewerkschaften, die ihre Existenzberechtigung schon längst nicht mehr aus einem Auftrag ihrer Basis, sondern aus dem übergeordneten politischen Mandat einer dem nationalen Interesse verpflichteten Vertretung von Arbeitnehmerinteressen begründen[6], kommen ganz folgerichtig auch dann nicht auf den Gedanken, ihre weitere Mitarbeit an dem nationalen Projekt namens „Standortsicherung“ in Frage zu stellen, wenn dieses Projekt für die vertretenen sozialen Belange keinen Raum mehr läßt. Die ausgegebene staatliche Direktive, daß der Staat sich und seiner Kapitalistenklasse den Lebensunterhalt des deutschen Proletariats dauerhaft weniger kosten läßt, ist dann die neue Geschäftsgrundlage, auf der die deutschen Arbeiterrechtsinstitute ihre Tätigkeit weiterhin verantwortlich entfalten wollen:
„Die IG Metall kann und will den Zwang zur Kostensenkung nicht ignorieren. Wir wollen aber die Wege und Ziele der Kostensenkung beeinflussen, wir wollen schützen und gestalten.“ (Walter Riester von der IGM)
Man mag diesen Herrn Arbeitervertreter gar nicht daran erinnern, daß besagtes „Schützen und Gestalten“ der Sache nach ohne ein wenig Kostenhebung für die Unternehmer nicht zu haben ist, daß sich folglich mit der Parteinahme für das Programm einer Kostensenkung jedes gewerkschaftliche „Aber“ rauskürzt. Die deutschen Arbeitervereine ficht das nicht an. Sie haben nämlich schon längst einen Weg gefunden, wie man – ganz staatsprogrammgemäß – das einheimische Arbeitsvolk darauf verpflichtet, für den ihm zugedachten „Schutz“ ganz solidarisch selber aufzukommen.
Die Sache mit der „Beschäftigungssicherung“: Wie mit den Mitteln der Tarifpolitik ein (angeblicher) Staatsnotstand bekämpft wird
Die hiesigen Gewerkschaften haben sich immer dagegen verwahrt – und das war von ihrem Standpunkt aus nur konsequent –, mit ihrer Tarifpolitik das kompensieren zu wollen, was die deutsche Politik mit ihren „Sparmaßnahmen“ an Schmälerung der Lohneinkommen herbeiregiert hat. Das lag deshalb „nicht in ihrer Macht“, weil sie ihrem politischen Auftraggeber nicht die Absichten bestreiten wollten, die der mit dem Schröpfen der Masseneinkommen voranbringen wollte. Und irgendwie wird es ja wohl auch zusammengehen, wenn sich die deutschen Gewerkschaften an der Front, an der sie etwas ausrichten könnten, für unzuständig erklären, um sich auf einem Feld, auf dem sie objektiv machtlos sind, einen dicken Handlungsauftrag zu erteilen. Gemeint ist das gewerkschaftliche Programm zur „Bekämpfung der Arbeitslosigkeit“, das mit der Kampagne um die „Einführung der 35-Stunden-Woche“ begonnen und inzwischen mit der tarifpolitischen Forderung nach einer „Beschäftigungssicherung“ seinen konsequenten Endpunkt erreicht hat.
Denn von der Sache her ist eine Gewerkschaft am Ende ihrer Weisheit, wenn ihre Mitglieder aus dem Dienst fürs Kapital entlassen worden sind. Deren Lebensinteressen sind auf den Verkauf ihrer Arbeitskraft festgelegt, und wenn die von „der Wirtschaft“ nicht gebraucht wird, verfügt die arbeitslos gemachte Menschheit über kein gesellschaftlich gültiges Interesse mehr, mit dem sich Ansprüche stellen ließen. Tarifpolitisch läßt sich da nichts mehr drehen, außer eben durch eine Tarifpolitik, die ihren eigenen Standpunkt, daß sich das Fordern an den wirtschaftlichen Notwendigkeiten, die die Gegenseite exekutiert, zu bemessen hat, selbstkritisch gegen sich wendet und angesichts der Arbeitslosigkeit zu der Einsicht kommt, daß das von der Gewerkschaft mitzuverantwortende Lohnniveau für die Wirtschaft zu hoch ist.
So kam der Beschluß zustande, die Unternehmer für das Programm „Bekämpfung der Arbeitslosigkeit“ durch „Arbeitszeitverkürzung“ zu gewinnen und zwar mit dem tarifpolitischen Angebot, ihnen durch ein Absenken des nationalen Lohnniveaus das Geschäft mit der Lohnarbeit ganz grundsätzlich zu erleichtern. Was mit der Durchsetzung der „Jahrhundertforderung“ anfangs „bloß“ über den Weg der „Verrechnung“ bislang üblicher Lohnzuwächse tarifiert wurde, war schon damals das Rezept der Gewerkschaften, auf Kosten der Lohnansprüche ihrer Mitglieder deren möglichst zahlreiche Verwendung zu erreichen. Dazu bekennen sich ihre Vertreter inzwischen demonstrativ:
„Bei allen Parolen, die wir in Sachen voller Lohnausgleich nach außen (!) gemacht haben, haben wir die Arbeitszeitverkürzung seit 1984 stets innerhalb des Verteilungsvolumens bezahlt, meiner Meinung nach sogar überbezahlt. Hätten wir den Schwerpunkt Arbeitszeit nicht gewählt und hätten wir heute immer noch die 40-Stunden-Woche, dann müßten sich die Unternehmer vorrechnen lassen, daß das Lohn- und Gehaltsniveau in der Metall- und Elektroindustrie derzeit etwa um 10 bis 14 Prozent höher läge.“ (W. Riester)
Mit dem aktuellen Programm einer „Beschäftigungssicherung“ haben die deutschen Gewerkschaften konsequent noch eins draufgesetzt. Haben sie bei der „Einführung der 35-Stunden-Woche“ unter der Parole „Mit vollem Lohnausgleich“ den Anspruch noch bedingt aufrechterhalten, bei der beabsichtigten Senkung des Lohnniveaus auf einen Zusammenhang von Normalarbeitswoche und Normallohn zu achten, so haben sie mittlerweile in den mit den Unternehmern vereinbarten „Beschäftigungsmodellen“ das Verkürzen der Arbeitszeit von jeder Rücksichtnahme auf das Interesse ihrer Mitglieder befreit, mit dem verkürzten Lohn noch irgendwie über die Runden zu kommen. Mit Zustimmung ihrer Gewerkschaften werden die „Beschäftigten“ darauf verpflichtet, eine je nach „Modell“ flexibel wechselnde Teilzeitarbeitslosigkeit auf sich zu nehmen, um so aus gewerkschaftlich verordneter „Solidarität mit den arbeitslosen Kollegen“ mit ihrem Lohn dafür herzuhalten, der staatlichen Arbeitslosenverwaltung nicht auf der Tasche zu liegen.[7]
Mit ihrem Beitrag zur „Bekämpfung der Arbeitslosigkeit“ machen sich die Gewerkschaften zum Büttel eines lupenreinen Staatsanliegens, nämlich dem, eine für kapitalistische Verwendung brauchbare Arbeiterklasse zu haben und zu erhalten, dafür die nationale Arbeitskraft für die Standortkonkurrenz zu verbilligen und angesichts der Folgen der einschlägigen Kapitalpraktiken – Massenentlassungen – die bisherigen sozialstaatlichen Regelungen für unfinanzierbar zu erklären, um sie aus der Welt zu schaffen.
Genau genommen haben auch die Gewerkschaften noch nie etwas anderes getan, als sich um eine brauchbare Arbeiterklasse zu kümmern – allerdings von ihrem Gründungsanliegen her mit einem kleinen, nicht ganz unerheblichen Unterschied: Wo das früher einmal das systemerhaltende Resultat ihrer Bemühung war, gegen die Unternehmer auf einem Ertrag der Arbeit zu bestehen, von dem die von ihr vertretene Klasse auch leben kann – und auch das ging, weil auf den Klassen-Durchschnitt bezogen, immer schon auf Kosten vieler einzelner Lohnarbeiter –, so ist heutzutage mit dem Programm der „Beschäftigungssicherung“ die Sorge um die Staatsnützlichkeit des Arbeiterklasse der Dreh- und Angelpunkt gewerkschaftlichen Wirkens, so daß sich die Berücksichtigung proletarischer Lebensinteressen gründlich herauskürzt. Wenn Gewerkschafter so gerne über die „neue Qualität“ ihrer Tarifpolitik schwadronieren – im Unterschied zu einer, die „bloß quantitativ“, d.h. irgendwie noch an der Lohnhöhe orientiert ist –, dann sind sie stolz darauf, als selbsternannte Sozialpolitiker ihre vom Staat verliehenen Regelungsbefugnisse in der Welt der Lohnarbeit dafür zu benutzen, die bislang aufgewendeten Kosten für den Erhalt einer brauchbaren Klasse um ein gutes Stück zu senken.
Daß der Staat in Sachen „Bekämpfung der Arbeitslosigkeit“ nicht sonderlich aktiv wird, sondern seine vom Kapital überflüssig gemachte Bevölkerung sehr entschieden zum bleibenden Ausschuß erklärt und damit einen in dieser Republik noch nicht dagewesenen Umfang an Pauperismus verordnet, das wollen die Gewerkschaften heute dem Staat nicht länger verübeln. Sie teilen nämlich die Lüge von den „leeren Kassen“; nicht, weil sie darauf reinfallen, sondern weil sie die darin enthaltene Botschaft respektieren, für wen und zu welchem Zweck keine Staatsgelder verpulvert werden sollen.[8] Dabei mögen sie vom Staat nach wie vor milliardenschwere „Beschäftigungsprogramme“ fordern, aber mit diesen letzten Relikten eines sozialstaatlichen Idealismus die Politiker noch irgendwie belästigen, das wollen die Gewerkschaften erklärtermaßen nicht mehr. Sie haben sich nämlich hauptseitig dazu entschieden, dem Staat durch solidarische Selbsthilfe unter die Arme zu greifen:
„Wir können doch nicht ewig nörgeln und fordern, der Herr Rexroth möge eine andere Wirtschaftspolitik betreiben…Das wirkt unehrlich. Ich bin der Meinung, daß wir als Tarifvertragspartei gefordert sind.“ (D. Hensche)
So ein moderner deutscher Druck-Gewerkschaftsführer kriegt es offenbar ganz gut unter einen Hut, auf der einen Seite seinen Verein mit dem sozialen Gesichtspunkt ins Spiel zu bringen, um andererseits – und zwar hauptkampfmäßig – diesem Standpunkt eine gründliche Absage zu erteilen. Denn ganz gleich, wie alternativ Kapitalisten im Unterschied zu ihren üblichen Gepflogenheiten bei Annahme eines gewerkschaftlichen „Beschäftigungsmodells“ rechnen, feststeht, daß in ihren Rechnungen nur ein Sozialprogramm vorgesehen ist: rentable Arbeit.
Das gewerkschaftliche Angebot: Tausche Bindewirkung der Tarifverträge gegen Stammplatz als Tarifpartner
Sonderlich viel war es nicht mehr, was die Gewerkschaften in der diesjährigen Tarifrunde im Angebot hatten, weil sich die Unternehmer schon von Haus aus das ganze Arbeitszeitverkürzungswesen mit der Tarifierung der neuen Freiheit versüßen ließen, die beschäftigten Arbeitskräfte flexibler, also ganz nach ihrem Bedarf einsetzen zu dürfen. Und von irgendeiner Sorte Äquivalententausch kann schon gleich nicht die Rede sein, wenn die Gewerkschaften auf Antrag von Kapital und Staat nun gänzlich ihre „Vormundschaft über die Regelung der betrieblichen Arbeitsbeziehungen preisgeben“ (Handelsblatt), um sich so überhaupt noch weiter als „Tarifpartner“ aufführen zu können. Mit der Entscheidung, das gesamte, früher einmal als „unverzichtbare soziale Errungenschaft“ ausgegebene Rahmentarifvertragswesen nun als einen einzigen Selbstbedienungsladen weiterführen zu wollen, aus dem sich jeder Unternehmer je nach seinen betrieblichen Sonderinteressen das Passende aussuchen kann, kommt bei Gewerkschaftern dann allerdings schon mal die Sinnfrage auf. In der Weise nämlich, ob ihr Verein überhaupt noch über einen erkennbaren eigenen Standpunkt verfügt, den er in der Welt der Lohnarbeit geltend zu machen hätte. Dies ist entschieden nicht der Fall – so jedenfalls hat es der kürzlich verblichene DGB-Vorsitzende Meyer seine Organisation wissen lassen –, wenn sich das Maß an „sozialer Gerechtigkeit“, das Gewerkschaften einzuklagen haben, definitiv daraus abzuleiten hat, was der politische Auftraggeber und der von ihm sollizitierte Nationalismus der Bevölkerung als national-verträglich vorgeben:
„Gewerkschaften müssen ihre Maßstäbe für soziale Gerechtigkeit, die sich auf die Interessen und Meinungen ihrer Mitglieder beziehen, zu dem in Bezug setzen, was zumindest eine deutliche Mehrheit der Bevölkerung für sozial gerecht hält. Zumindest die teilweise Übereinstimmung der von den Gewerkschaften vertretenen Interessen der Arbeitnehmer mit dem Gemeinwohl ist notwendig, um gewerkschaftliche Politik überhaupt durchsetzungsfähig zu machen.“
Also entdeckt dieser Ober-Gewerkschafter nur lauter gute Gründe dafür, daß sich mit einem eigenen Auftrag für seinen Verein nichts zu schieben hat. Ihm stellt sich ganz grundsätzlich die Frage, ob nicht auch die moderne deutsche Tarifpolitik noch traditionelle Restbestände einer überkommenen gewerkschaftlichen Zielsetzung mit sich herumschleppt, mit dem sich die Gewerkschaften unbeliebt machen. Der ganze Standpunkt, in der Welt der Arbeit mit Einwänden in Erscheinung zu treten, kommt ihm antiquiert vor:
„Ein Strang der bisherigen gewerkschaftlichen Programmatik hat die negativen Seiten der Arbeit unterstrichen und von dort den Schutzauftrag der Gewerkschaft begründet…Aber es stellt sich immer mehr die Aufgabe, auch die Chancen zu nutzen, die für eine humane Arbeitsgestaltung vorhanden sind.“
Und letzteren „Strang“ haben die praktizierenden Tarifpolitiker sämtlicher Einzelgewerkschaften des DGB ausgesprochen wirksam verfolgt. Einen in der bundesdeutschen Arbeitswelt geltend gemachten „Schutzauftrag“ dieser Vereine gibt es endgültig bloß noch der Form nach, weil mit dem ganzen so exzessiv vereinbarten Ausnahme- und Öffnungsklauselwesen für einen Inhalt der Tarifverträge gesorgt ist, mit dem die hiesige Arbeitermannschaft zielstrebig wieder den Umständen ausgeliefert ist, die die Gewerkschaften früher einmal als „ruinöse Willkür“ kritisiert haben und mit gewissen sozialen Auflagen zu beschränken suchten. Wenn sie diese Auflagen heute unter das Verdikt einer unzeitgemäß gewordenen gewerkschaftlichen Programmatik stellen, dann deswegen, weil sie bestrebt sind, allen betrieblichen Anträgen auf die Auflösung beschränkender Auflagen nachzukommen. Und so ist das „einfache Mitglied“ dank dieser „Einsicht“ seiner Interessenorganisation in allen Fragen seines Zurechtkommens auf den innerbetrieblichen Instanzenweg – Meister, Personalabteilung – verwiesen. Bei einer eventuellen Erkundigung nach seinen Rechten macht es dann allerdings gleich wieder mit seiner Organisation Bekanntschaft, die ihre „Chancen“ darin erkannt hat, bei der „Arbeitsgestaltung“ mitzumachen, und mit ihrem Regelungswahn den unterschiedlichsten betrieblichen Sonderwünschen Rechnung trägt[9]. Daß die betriebsspezifischen „Arbeitsmodelle“ rechtlich in Ordnung gehen, dafür sorgt vor Ort die nun tarifvertraglich aufgemöbelte Instanz namens Betriebsrat, die sich schon immer wg. „Verpflichtung zu vertrauensvoller Zusammenarbeit mit dem Betrieb“ als dessen Transmissionsriemen bestens bewährt hat.[10]
Daß die Gewerkschaften damit ausgerechnet eine Instanz zur „inhaltlichen Füllung“ ihres Tarifvertragswesens bestimmen, die über das Gewerkschaftsrecht nicht verfügt – vom Mittel des Arbeitskampfes Gebrauch machen zu dürfen –, ist wegen des intendierten Gehalts der „Rahmentarifvereinbarungen“ nur konsequent: Wo diese bloß noch die Freiheiten des Betriebs regeln, den Einsatz der Arbeitskraft der eigenen Interessenslage entsprechend zu gestalten, da hat der gewerkschaftliche Arbeitskampf seine Daseinsberechtigung endgültig verloren.[11]
***
So hat es die moderne deutsche Gewerkschaftsbewegung mit ihrem gründlich politisierten Verfahren, Arbeiterinteressen zu vertreten, schlußendlich dazu gebracht, ihre Mitglieder wieder in die Lage zu versetzen, die einmal den Grund dafür abgegeben hat, sich gewerkschaftlich zu organisieren. Daß vom Begriff dieser Arbeitervereinigung her – mit der Gründung einer Gewerkschaft reagieren Lohnabhängige darauf, daß der Dienst am Kapital ihrem Interesse, von diesem Dienst zu leben, widerspricht, um sich ausgerechnet in diesem Lohnsystem qua Gewerkschaft ein Auskommen sichern zu wollen – Grund und Zweck ihres Einsatzes ersichtlich auseinandertreten, das ist die eine Auskunft über die Tauglichkeit dieser Organisation der arbeitenden Klasse. Wenn diese sich darüber hinaus entschließt – und das ist seit der von ihr gewünschten Verrechtlichung durch den demokratischen Staat der Fall –, ihre Zwecksetzung ganz aus der staatlich dekretierten Verpflichtung auf das Gemeinwohl abzuleiten, dann macht sie sich in der Vertretung von Arbeiterinteressen gänzlich abhängig davon, was die zuständigen politischen Instanzen in ihrem Interesse an „sozialer Berücksichtigung“ der arbeitenden Menschen für erforderlich halten. Und dann kann und will diese Gewerkschaft sich auch einer politischen Auftragslage nicht entziehen, die mit dem verordneten Generalangriff auf sämtliche eingerichteten Sozial- und Lebensstandards der arbeitenden Klasse für sie bloß noch die eine Zwecksetzung vorsieht: exakt das zu unterschreiben, was die Arbeitnehmer hierzulande auch ohne Gewerkschaft auszuhalten haben.
Die verbleibende Perspektive: Ein Kampf um Selbstbehauptung
Der wird ganz notwendig zur Hauptkampflinie der Gewerkschaften, weil es die Lage zu bewältigen gilt, in die sie sich mit ihrer Tarifpolitik selbst gebracht haben. Sie haben ihre Kompetenz als mitverantwortliche Rechtsinstanz im bundesdeutschen Arbeitsleben erfolgreich „dereguliert“ und kriegen jetzt, wo Form und Inhalt ihrer Tarifverträge so sichtbar auseinanderfallen, zu spüren, daß sich ihre Bedeutung als anerkannte „Tarifpartner“ nun einmal nicht davon trennen läßt, in der Sache, die sie mit den Unternehmern regeln, noch ein verpflichtendes Wörtchen mitreden zu wollen. Denn nur solange, wie es ihr tarifpolitischer Job ist, mit den Unternehmern verbindliche Rahmenvereinbarungen über das Verhältnis von Lohn und Leistung zu treffen, gibt es für die Gegenseite auch die Notwendigkeit, sich mit einer Gewerkschaft berechnend ins Benehmen zu setzen, also die „gleichberechtigte Partnerschaft von Arbeit und Kapital“ ein wenig zu pflegen, auf die die deutschen Arbeitervereine immer so stolz waren.
Aufgrund der getroffenen Entscheidung, die ausgehandelten Verträge ganz grundsätzlich „für die betrieblichen Gegebenheiten zu öffnen“, sind die Gewerkschaften aktuell nicht bloß damit konfrontiert, daß so gut wie alles an ihnen vorbeiläuft, weil jeder Unternehmer in Gestalt des Betriebsrats nun seinen eigenen „Tarifpartner“ vor Ort hat, mit dem er seine Angelegenheiten „vertrauensvoll“ regeln kann. Auch dort, wo die Gewerkschaft selbst noch als die übergeordnete Tarifpartei in Amt und Würden ist, ist keine sonderliche Rücksichtnahme mehr auf sie zu nehmen. Sie wird von den Unternehmern ganz einfach beim Wort genommen, keinen störenden tarifpolitischen Einfluß mehr geltend machen zu wollen. Und so kommen nicht nur lauter neue Anträge auf die Tagesordnung, die existenten Rahmentarifvereinbarungen mit „noch mehr Spielraum“ für die betrieblichen Interessen auszustatten, auch der Umgangston, in dem sich diese Ansprüche vortragen, wird zwangsläufig etwas rüder, wenn unterstellt ist, daß es mit den Gewerkschaften heutzutage eigentlich nichts mehr zum Verhandeln gibt.
Folglich ist die neue „tarifpartnerschaftliche“ Rollenverteilung ziemlich eindeutig: Die Unternehmer sind die, die fordern, und die Gewerkschaften stehen ganz unmißverständlich in der Pflicht, allen an sie gestellten Ansprüchen umstandslos nachzukommen. Doch ganz gleich, ob irgendein Gesamtmetall-Chef einen „Tarifrabatt von 30%“[12] oder ein Wirtschaftsminister die „Tarifierung einer 60-Stunden-Woche“ von den Gewerkschaften einfordern, die von diesen Vereinen beschworene „Schmerzgrenze“, die „jetzt aber wirklich“ und dann doch immer nie „erreicht“ ist, bezieht sich garantiert nicht auf die soziale Lage ihrer Mitglieder. Besagte „Schmerzgrenze“ ist eine der Gewerkschaften selbst, die an solchen „ohne jede Absprache mit ihnen“ gemachten Vorstößen das geschwundene Maß an Anerkennung registrieren, das ihnen zuteil wird. Also ist auch bei einer Sozialkritik wie der folgenden jede Verwechslung ausgeschlossen:
„Was wir jetzt erleben, ist der Rollback des Manchester-Kapitalismus, es fängt eine offenbar geduldete Kannibalisierung der Sozialsysteme an.“ (F. Steinkühler)
Das Blöde ist nur, daß stramme Gewerkschafter wie Steinkühler die neuen Zustände nicht nur „offenbar geduldet“, sondern höchst aktiv mit herbeigeführt haben, so daß die Lohnabhängigen die Rücksichtslosigkeiten, die immer dem bösen „Manchester-Kapitalismus“ nachgesagt werden, heute im Rahmen ihrer gewerkschaftlich abgesicherten Rechte zu spüren bekommen. Daß bei der mitverantworteten Durchsetzung dieses „Rollbacks“ die staatstragende Bedeutung der Arbeiterrechtsvereine selbst ein Stück weit unter die Räder kommt, das ist das Unschöne, was den beleidigten Gewerkschaftsmann so radikale Sprüche tun läßt.
Es sind also lauter Ehrenfragen, die die deutschen Gewerkschaften umtreiben, mit denen sie allerdings im Unterschied zu früher auch keinem herrschenden Interesse mehr auf den Geist gehen wollen, um nicht gänzlich ins gesellschaftliche Abseits zu geraten. Schließlich gibt es mittlerweile nicht wenige Unternehmer, die sich durch Austritt aus ihren Verbänden schlicht und einfach der gewerkschaftlichen „Tarifpartnerschaft“ für ihren Laden entledigen, und auch bei den Politikern ist man sich nicht so sicher, wie weit diese noch auf die von den DGB-Vereinen angepriesene „bewährte Sozialpartnerschaft“ setzen.[13]
Wenn Gewerkschaftsfunktionäre inzwischen von Leuten der Presse schon etwas mitleidig daraufhin angesprochen werden, ob sie bei der Bewältigung ihrer „Angst vor einem Bedeutungsverlust“ auch wirklich gut beraten sind, „zu sehr die Gemeinsamkeiten mit den Unternehmern zu suchen“, dann gibt die Antwort eines Herrn Rappe von der IG Chemie: „Auch Good-will kann Profil sein.“ beredt Auskunft darüber, daß sich die deutschen Arbeitervertreter entschieden davon abhängig machen wollen – und von ihrem Standpunkt aus auch müssen –, von denen, die hierzulande das Sagen haben, ungemein sympathisch gefunden zu werden.[14] So kommt heutzutage einem Kanzler-Auftritt auf dem nationalen DGB-Kongreß – wie neulich geschehen – eine ganz besondere Bedeutung zu, weil es hier vom obersten Dienstherrn persönlich zu erfahren gilt, wie es dieser in Zukunft mit seinen Arbeitervereinen zu halten gedenkt[15]. Da durften die versammelten Delegierten mit Genugtuung zur Kenntnis nehmen, daß ihre verantwortliche Tätigkeit in diesem Staat auch weiterhin vorgesehen ist. Was sollte der Kanzler auch gegen eine Gewerkschaft haben, die vertraglich sicherstellt, daß über Lohn und Leistung im neuen Groß-Deutschland diejenigen frei nach ihren Bedürfnissen entscheiden können, die Arbeitskräfte anwenden. Wenn Gewerkschaften sich so aufführen, dann wünscht sich auch ein deutscher Kanzler starke Gewerkschaften:
„Wir alle wissen, daß nur starke Gewerkschaften die Interessen ihrer Mitgliedschaft erfolgreich vertreten können. Und es liegt im gesamtstaatlichen Interesse, daß Gewerkschaften Tarifverträge abschließen können und daß sie sie auch durchsetzen.“
Man kann das auch für Spott halten. Den DGB ehrt es.
***
Daß der DGB kein Staatsinstitut, sondern doch bloß eine Mitgliederorganisation ist, das kriegt er zur Zeit auch in einer anderen Hinsicht zu spüren: Die Basis tritt massenhaft aus diesem Verein aus. Folglich sind die DGB-Gewerkschaften auch nach innen um Bestandssicherung bemüht. Denn ohne Mitglieder schiebt sich nun einmal nichts mit ihrem politischen Mandat. Als Geldquelle sind sie für die autorisierten Sachwalter von Arbeiterinteressen genauso unverzichtbar wie als Berufungsinstanz. Insofern brauchen die Gewerkschaften auch die Gründe nicht zu interessieren, aus denen heraus ihnen ihre Mitglieder von der Fahne gehen. Sie wollen sie ja bloß bei der Stange halten. Für den Zweck hat der DGB die Aktion „Mehr Mitgliedernähe!“ ins Leben gerufen. Außerdem überrascht er sie derzeit auch mit einer Erinnerung an ihre Interessen, wenn er von einer „spürbaren Einkommensverbesserung“ im Jahre 1995 spricht. Die soll es zwar nicht geben, aber der DGB kann sich gut vorstellen, daß es schön wäre, wenn es sie gäbe. Auch das ist sehr „mitgliedernah“.
Wenn die Mitglieder aus einem solchen Laden austreten, dann ist das irgendwie ziemlich naheliegend. Wo ihnen dieser Verein schon nichts erspart, ersparen sie sich wenigstens diesen Verein. Das Dumme ist bloß: Sie ersparen sich eben nur den – und sonst leider gar nichts.
[1] Siehe dazu GegenStandpunkt 2-94, S.77: Bilanz der Tarifrunde 1994
[2] Das Nähere hierzu ist nachzulesen in dem Artikel „Der Beitrag der Privatisierung zur ‚Zukunftssicherung des Standorts Deutschland‘“ (GegenStandpunkt 3-94, S.76).
[3] In dem einschlägigen Paragraphen des BGB hat der Staat ausdrücklich das Interesse des neuen Arbeitgebers ins Recht gesetzt, sich – falls gewünscht – der geltenden Vereinbarungen zu entledigen. Allerdings mit der Einschränkung, daß bestehende Verträge erst nach Ablauf einer Frist von einem Jahr gekündigt und neu verhandelt werden können, um so den abhängig Beschäftigten Gelegenheit zu geben, sich auf die anstehenden Verschlechterungen – wie immer das gehen soll – einzustellen.
[4] Die sich notwendigerweise aufdrängende Frage, warum die hiesigen Gewerkschaften überhaupt noch zum Mittel des Arbeitskampfes greifen, wenn sie ihren Kontrahenten zu nichts nötigen wollen, ist nur über den Zweck solcher Aktionen zu erklären. Die deutschen Arbeitervereine denken und handeln so sehr nach Maßgabe der politischen Intention des Streikrechts, daß sie die damit verbundene Pflicht, auf Einigung mit der überlegenen Macht ihres Kontrahenten aus sein zu müssen, sich gleich so zu Herzen nehmen, daß Streiken überhaupt nur dann angesagt ist, wenn die Gegenseite nach ihrer Ansicht die nötige „Verhandlungs-“, also Einigungsbereitschaft vermissen läßt. Folglich sind die Gewerkschaften nur negativ zum Arbeitskampf bereit, und das ist diesem insofern anzusehen, daß der ausgeübte Druck zugleich den erklärten Willen zu präsentieren hat, von sich aus jederzeit zu einer Übereinkunft mit dem Kontrahenten bereit zu sein. Das bezeichnende Bekenntnis: „Wenn es nach uns ginge, bräuchte es gar nicht zum Streik zu kommen“, gibt eine eindeutige Auskunft darüber, daß die Gewerkschaften in der sozialen Lage ihrer Mitglieder jedenfalls entschieden keinen Streikgrund ausmachen können.
[5] Siehe dazu GegenStandpunkt 3-93, S.3: Standort-Pflege brutal
[6] Daß eine inzwischen gänzlich durchpolitisierte deutsche Gewerkschaft alles daransetzt, das Vertreten von Arbeiterrechten als ein Mittel des nationalen Fortschritts zu praktizieren, ist eine Sache. Andererseits aber beruht die behauptete Übereinstimmung auch eines verrechtlichten Arbeiterinteresses mit dem Anliegen der Nation auf einer puren Einbildung, da die staatliche Gewährung von Arbeiterrechten auf den berechnenden Umgang mit einem zu seiner Wirtschaft gegensätzlichen Interesse – und um ein solches handelt es sich beim Lohninteresse der Arbeiterschaft allemal – zielt, um dieses gerade so auf einen förderlichen Beitrag zum gedeihlichen Zusammenwirken der wirklich übereinstimmenden Interessen zu verpflichten: denen von Geschäft und Gewalt. Die gewerkschaftlich eingebildete Deckungsgleichheit zwischen dem Arbeiterrecht und der dieses Recht begründenden Staatsgewalt existiert daher in Wirklichkeit nur so: als bedingungsloses Angebot von ihrer Seite aus.
[7] Siehe dazu die Ausführungen im GegenStandpunkt 4-93, S.91: Das neue Arbeitszeitmodell bei VW: zuviel Kapital – weniger Arbeit – mehr Armut
[8] Daß sich in den „leeren Kassen“ justament während des Tarifstreits bei der Post 3,5 Mrd. DM für eine Beteiligung der Telekom an einem US-Konzern gefunden haben, das sorgte außer im Wirtschaftsteil der Zeitung für keinerlei Aufsehen, ging also auch für die Gewerkschaft voll in Ordnung.
[9] So durften laut Bericht der IGM-Zeitung „metall“ die Werktätigen eines mit einer „Auffanglösung“ bedachten Pleite-Betriebes in Worms erfahren, daß die für sie vorgesehenen Sozialplan-Gelder dank Mithilfe ihrer Gewerkschaft einem neuen Verwendungszweck zugeführt worden sind: Sie dienen einer neu zu gründenden Kapitalgesellschaft als „Investitionsfonds“.
[10] Die
„Wirtschaftswoche“ zeigt sich hellauf begeistert von
dieser „Entwicklung hin zu einer betriebsnahen
Tarifpolitik“, weil sich die Betriebsräte jetzt – mit
ganz neuen Kompetenzen ausgestattet – noch effizienter
als bisher als nützliche Idioten der Firmenleitung
aufspielen dürfen: Früher beschäftigten die
Arbeitnehmervertreter sich in erster Linie mit sozialen
Fragen: vom Kantinenessen über die Schichtzulagen bis
hin zum Sozialplan. Heute setzen sich die
Belegschaftsvertreter – im Rahmen einer ‚strategischen
Betriebsratsarbeit‘ – zusätzlich mit
Arbeitszeitmodellen, Controlling, Produktpolitik und
Verkaufsstrategien auseinander. Dahinter verbirgt sich
die Erkenntnis, meint Henry Finke,
Betriebsratsvorsitzender in Hannover, daß
Entscheidungen im operativen Geschäft immer auch
Folgewirkungen für unsere Klientel haben.
Und gegen
diese „Folgewirkungen“ tritt man am besten dadurch an,
daß man das Arbeiterrecht Nr. 1 im Betrieb zur
Anwendung bringt: Das Geschäft des Unternehmens möge
gut gelingen! Was in derlei Betriebsberatungswesen auch
immer an Einbildung über die wirklichen Kompetenzen
dieses „Co-Managements“ enthalten ist, auf alle Fälle
ist jetzt das, was Betriebsräte immer schon irgendwie
gemacht haben, zu der Gewerkschaftslinie in
der deutschen Arbeitswelt avanciert: Das Leitmotiv
unserer Tarifpolitik bilden nicht
Besitzstandssicherungskonzepte (!), sondern Initiativen
zum zukunftsorientierten Wandel.
(W. Riester).
[11] Mit dem Rechtsinstitut des Betriebsrats läßt der Staat die den Arbeitern gewährten Rechte im Betrieb so ausüben, daß sie vor ihrem gewerkschaftlichen „Mißbrauch“ geschützt sind. Passend dazu, daß genauestens geregelt ist, wie und zu welchem Zweck eine Gewerkschaft Ansprüche anmelden darf, sollen die Arbeiter im normalen Arbeitsalltag auf die „Einhaltung des Betriebsfriedens“ verpflichtet werden, damit die gewußterweise anfallenden Gründe zur Unzufriedenheit sich nicht als Behinderung des Betriebsablaufs geltend machen. Diesem politischen Anliegen fühlen sich die Gewerkschaften, die bei Einführung der „Betriebsverfassung“ mal darüber Klage geführt haben, daß sie damit aus den Betrieben „herausgehalten“ werden sollen, heutzutage voll und ganz verpflichtet.
[12] Es ist schon
erstaunlich, was einem Journalisten der „Frankfurter
Rundschau“ einfällt, um einen Einwand gegen besagte
Arbeitgeber-Offensive in Sachen untertarifliche
Bezahlung loszuwerden: Auf jeden Fall ist es ein
genialer Einfall: Der Untertarif per Tarifvertrag. Nur,
eigentlich gibt es das alles schon. Es nennt sich halt
etwas anders, nämlich Lohngruppen-System. Wenn heute
eine Firma einen Facharbeiter nimmt, der in seiner
Leistung gemindert ist, stuft sie ihn entsprechend
niedriger (zum Beispiel als Hilfsarbeiter) ein
. Der
Einfall ist nicht schlecht. Abgesehen von der Ideologie
einer „geminderten“ Leistung als „Grund“ eines
niedrigeren Lohnes hat dieser Mann irgendwie doch
mitgekriegt, was die Unternehmer in dem mit der
Gewerkschaft vereinbarten Lohngruppen-System – in
Anwendung des Tarifvertrags – für ein erstklassiges
Mittel in der Hand haben, den Lohn zu senken.
Nur: Er ist dafür.
[13] Es ist schon süß,
wie der DGB das registriert. So spürt er z.B.
in folgenden Ausführungen eines Wolfgang Schäuble eine
„Kampfansage an die organisierte Arbeitnehmerschaft“
auf: Er empfiehlt das
Unternehmer-Deregulierungsprogramm aus der Mottenkiste:
Niedrigere Einstiegslöhne für Arbeitslose,
Öffnungsklauseln für Tarifverträge, Absenkung von
Sozialleistungen.
Zeitpunkt dieser
Gewerkschaftsveröffentlichung: Juli 1994.
[14] Diesen
Gewerkschaften steht vom Prinzip her nur das eine
Argument zur Verfügung, daß die Gegenseite
etwas zu verspielen hätte, wenn sie es an
„Sozialpartnerschaft“ missen läßt. So wie jüngst im
Fall der Chemieindustrie, als die Konzerne Hoechst,
Bayer und BASF gemeinsam der Gewerkschaft die
Mitteilung zukommen ließen, kurzerhand die
überbetrieblichen Lohnbestandteile streichen zu wollen.
Darauf die IG Chemie: Diese Maßnahme ist der größte
zwischenmenschliche Vorfall in der Geschichte von
Hoechst.
Wie man sieht: Bei diesen
gewerkschaftlichen Betriebsnudeln können
Kapitalisten überhaupt nichts verspielen.
[15] Entgegen seiner koketten Bemerkung auf diesem Kongreß, „kein Heimspiel“ zu haben, hatte der Kanzler natürlich selbiges. Ganz im Unterschied zu einem Mann der Opposition namens Gregor Gysi, bei dessen Vortrag die Delegierten massenhaft den Saal verließen, um gegen dessen „Mitverantwortung bei der Beschneidung von Arbeitnehmerrechten in der DDR“ zu protestieren. Wie gut, daß die „Arbeitnehmerrechte“ hierzulande vom DGB mitbestimmt sind. Der macht deren „Beschneidung“ glatt überflüssig.