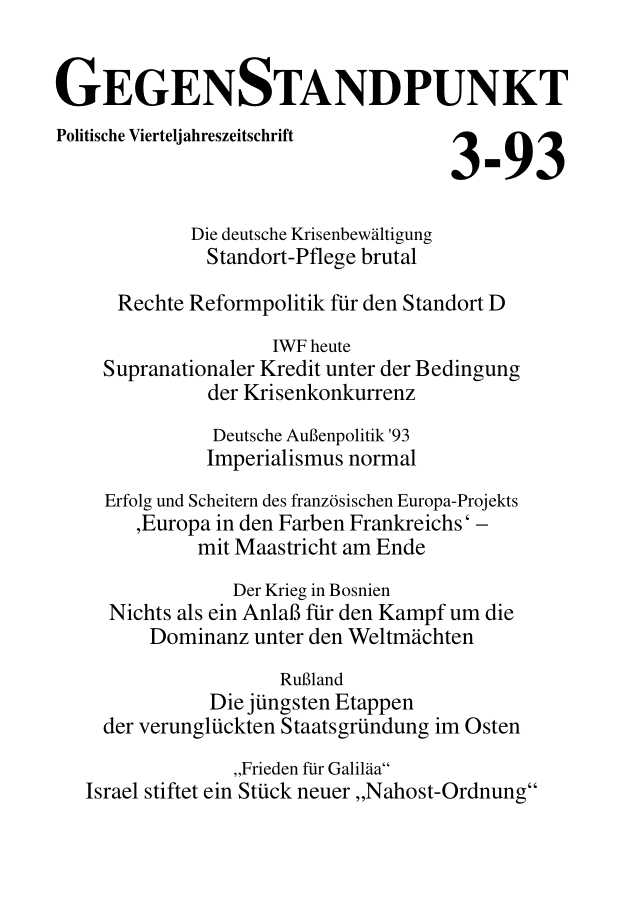Die deutsche Krisenbewältigung
Standort-Pflege brutal
Angesichts der Krise erklärt die Politik die DM zu ihrem Schutzobjekt Nr. 1, deren Härte, wenn schon nicht (mehr) erwirtschaftet, durch Korrekturen der in- und ausländischen Konkurrenzbedingungen herbeizuregieren ist. In diesem Auftrag betriebene Geldpolitik, sozialstaatliche Reformen, Privatisierung und Diplomatie zeitigen Wirkungen, sind aber keine verlässlichen Instrumente für das In-Gang-Setzen des bezweckten Wachstums.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Die deutsche
Krisenbewältigung
Standort-Pflege brutal
1. Solange die Wirtschaft ihr Wachstum voranbringt, legt sich die Politik ihren guten Ruf zu. Ihr Programm „Demokratie und Marktwirtschaft“ ist nicht nur das Markenzeichen eines erfolgreichen Staates; es verhilft auch dem Personal, das sich der Ausübung der Staatsgewalt widmet, zu erheblicher Wertschätzung – lauter gute Werke werden da zwischen geachtetem Wohlstand, Beschäftigung und hartem Geld als Leistung der Regierenden verbucht. Wer mit diesen Leistungen unzufrieden ist, weil sein persönlicher Ertrag eine rundum positive Würdigung staatlicher Behandlung seiner Interessen nicht zuläßt, wird einerseits auf „Sachzwänge“ verwiesen, andererseits mit zwei Vergleichen traktiert. Im Unterschied zu anderen Bürgern, die mehr aus ihren gleichen Chancen gemacht haben, sind die Unzufriedenen wohl nicht tüchtig genug gewesen. Und im Unterschied zu den Hungerleidern, die es sonst auf der Welt noch gibt, stehen sie so gut da, daß sich jede Klage schon beim bloßen Hinsehen blamiert. Auf der soliden Grundlage solch eindrucksvollen demokratischen Dialogs einigen sich die zur Ordnung Gerufenen dann mit den Nutznießern und Repräsentanten des nationalen Erfolgs darauf, daß es an diesem Erfolg letztlich nichts auszusetzen gibt. Der Konsens bietet allen Beteiligten das erhebende Gefühl, im richtigen Staat und im einzig senkrechten System zu leben; und er isoliert ziemlich eindeutig jene Zeitgenossen, die Marktwirtschaft für Kapitalismus halten und die demokratische Ausübung der politischen Macht für die Betreuung der Kapitalvermehrung. Wer in den mannigfaltigen Maßnahmen des Staates, in deren Gefolge sich Freiheit und Notwendigkeit, Reichtum und Armut so merkwürdig auf die Bürger verteilen, nicht bedauerliche Pflichtverletzungen und Versäumnisse der Regierenden entdeckt; wer der Kunst des Regierens nicht zugute hält, daß es eben schwer sei, „es“ allen recht zu machen, sondern bemerkt, worauf es der Politik eines Industrie-, Rechts-, Sozial- und Wohlfahrtsstaates ankommt, hat im Getümmel der freien Meinungen keinen Platz. Daß die Beherzigung aller Verfassungsgrundsätze und der hoheitliche Respekt vor sämtlichen „Sachzwängen“ auf den Gebrauch der politischen Macht hinauslaufen, der die ganze Gesellschaft vom Wachstum des Kapitals abhängig macht – eine solche Auffassung fällt als ewiggestrige Systemkritik aus dem Spektrum der demokratisch erlaubten Meinungen heraus; wer sich bei der Betrachtung der Entscheidungen, die der Gesetzgeber und die ausführenden Organe treffen, um das Wohl des deutschen Volkes zu mehren, über die eigenartige Definition des Allgemeinwohls wundert, die Demokraten ein ums andere Mal in Kraft setzen, macht sich als Feind der freiheitlich-demokratischen Grundordnung verdächtig. Und der Beweis, daß der Staat sein Gewaltmonopol dazu verwendet, Land und Leute für lauter Dienste an der Mehrung privaten Eigentums zuzurichten, daß die öffentliche Gewalt diese Sorte „Wirtschaftswachstum“ als die Quelle ihrer Macht behandelt, so daß alle anderen Interessen und Bedürfnisse nur zählen, soweit sie sich in den Dienst am Kapital stellen, ist die geächtete Entgleisung von Kommunisten.
2. Sobald es die Wirtschaft an Wachstum fehlen läßt, leidet der gute Ruf der Politik. Und zwar bei ihren Anhängern. In den Parteien, den alten und neuen, wie beim Publikum läßt man sich mit einem Male Sachen einleuchten, die zuvor nur in den angeblichen Wahnvorstellungen von realitätsfernen und böswilligen Systemgegnern vorgekommen sind. Was letztere vom demokratischen Staat behaupten und als Einwand gegen ihn geltend machen, kommt als Katalog von Forderungen an die Politik daher. Minister und Manager, Bankiers und Journalisten führen sich als Fanatiker der Sorte Staat auf, die sie im demokratischen Dialog der guten Konjunktur als gemeines Zerrbild zurückweisen. Der prekäre Zustand des nationalen Geschäftslebens ist der Anlaß, daß der Sachverstand von der Politik all die Leistungen einklagt, die er gerade vermißt; und das sind lauter Dienste an der kapitalistischen Gewinnrechnung; wobei in erstaunlicher Offenheit erzählt wird, wer wie für den Weg aus der Krise geradezustehen hat.
Die Systemgegner haben davon nichts. Wenn die Lenker des Staates und seiner Wirtschaft der Regierung das als ihre Haupt- und Generalaufgabe zuschreiben, was sie ansonsten gerne leugnen, weil sie sich gerne allerlei menschenfreundliche Leistungen andichten; wenn sie auf genau den Funktionen der öffentlichen Macht bestehen, die ihr gewöhnlich nur in marxistischen Traktaten und Polemiken nachgesagt werden, dann geht es nicht um ideologische Zugeständnisse. Vielmehr um das offensive Bekenntnis zu einem Handlungsbedarf, den die Agenturen des Kapitalwachstums verspüren, weil dieses gerade nicht stattfindet. Dann finden Korrekturen statt an den überkommenen Geschäftsgrundlagen der Nation, weil die den erwünschten Erfolg nicht mehr garantieren.
Die deutsche Regierung führt gegenwärtig vor, welche Schlüsse eine Staatsführung aus der Kritik zieht, unter ihr wäre das Wachstum zum Erliegen gekommen. Erstens stimmt sie selbstkritisch in den Vorwurf ein und erhebt ihn zur allgemein gültigen Diagnose über die Lage der Nation. Sie bekennt sich zu der Aufgabe, ihre hoheitlichen Befugnisse darauf zu verwenden, die Bedingungen für eine erneute Kapitalakkumulation herzustellen. Die sind nämlich aufgrund einer „Kette von Fehlentwicklungen“ kaputtgegangen, so daß der Staat für brauchbare Geschäftsmittel sorgt: Er reformiert den Standort Deutschland, der ihm untersteht. Dabei anerkennt er ausdrücklich die Kalkulation der Unternehmen, die auf dem von ihm verwalteten Geschäftsplatz tätig sind und momentan eine Einschränkung ihrer Gewinne und Investitionen hinnehmen müssen. Statt die „Wirtschaft“ mit Beschuldigungen oder Appellen zu behelligen, entnimmt die Politik zweitens der Krise den Beweis, daß sie die Staatsaufgaben, die das Wachstum gewährleisten sollen, denkbar schlecht versieht. So wie die deutsche Staatsgewalt den Standort betreut – die Rede ist von jahrzehntelang bewährten und gepriesenen Rezepten deutscher Wirtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik –, kann sie dessen Leistungen nicht mehr garantieren und befördern. Die Fortsetzung der Politik mit dem überkommenen Instrumentarium würde zu einer riesigen Gefährdung des Standorts Deutschland ausarten.
3. Die Herkunft dieses Reformwillens ist kein Geheimnis. Jedenfalls hat das Kabinett nicht die Funktion all der staatlichen Einrichtungen für das Wachstum im Lande geprüft, die es gegenwärtig für hinderlich bis überflüssig hält. Welche Dienste die bisherige Organisation von Bahn und Post, des Universitätsstudiums oder das Ladenschlußgesetz, die Vorschriften des Chemikaliengesetzes oder die Umschulungsmaßnahmen für die deutsche Wirtschaft erfüllt oder versagt haben, war gar nicht der Ausgangspunkt für das große Werk der „Zukunftssicherung des Wirtschaftsstandortes Deutschland“. Nicht das, was die staatlichen Veranstaltungen an tatsächlichen oder eingebildeten Beiträgen zum Florieren deutschen Geschäfts leisten, stand zur Debatte – sie sind schließlich allesamt ins Leben gerufen und ausgeweitet worden, weil sie den Regierenden als erforderliche und nützliche Maßnahme für den Fortschritt der nationalen Ökonomie erschienen. (Sogar der Ausbau des Hochschulwesens wurde seinerzeit mit dem Gedeihen der deutschen Wirtschaftsmacht begründet, der – wegen „Bildungskatastrophe“ – ihr Untergang gedroht haben soll!) Vielmehr sind die aktuellen Eingriffe in die disparatesten Felder staatlicher Hege der Marktwirtschaft nur aufgrund einer Frage, die die Regierenden auf die Tagesordnung gebracht haben, fällig geworden: Kann und will sich der Staat diese Veranstaltungen noch leisten? Deswegen geht die ganze Initiative auch vom Finanzminister aus.
Die Not, aus der nun sämtliche Ressorts eine Tugend zu machen haben, ist eine der Staatsfinanzen. Sie wird mit reichlich volkswirtschaftlichem Sachverstand umschrieben: Der „Staatsanteil“ am von der ganzen Nation zustandegebrachten Umsatz sei zu hoch; immer mehr Bestandteile von privaten Einkommen würden beim Staat landen, statt in der Wirtschaft ihr gutes Werk zu tun; so würde sich der Staat inzwischen zu einer einzigen Belastung des Wirtschaftslebens entwickeln, dem er zu viel Kosten bereitet, so daß die Lust und Fähigkeit zum Gewinnemachen schwindet. Solche Diagnosen finden dann schnell ihren gebündelten Ausdruck in Schlagworten, die das Leiden der Nation stenographisch verständlich machen. Die Wirtschaft steckt in einer „Kosten- und Abgabenkrise“; und weil das von dem Übermaß an Staatstätigkeiten und -einmischungen herrührt, welche sich hierzulande die Politik ziemlich marktwidrig herausnimmt, muß Deutschland aus seiner „Überregulierungskrise“ herausgeführt werden. Das kann natürlich nur der Staat regeln – indem er seine Tätigkeiten neu ordnet und seine Einmischung in die Wirtschaft um ein paar neue Gesetze ergänzt…
So sehr sich solche Erläuterungen um ein Einfühlen in die prekäre „Problemlage“ der Regierung bemühen, so konsequent sie die Definition der Not mit Hilfe der Tugenden vornehmen, deren sich die Regierung befleißigt – die Klagen über das Mißverhältnis zwischen Staat und Kapital, das es zu bereinigen gilt, reduzieren sich auf ein Übel: Vom Standpunkt der rentablen Anwendung von Kapital aus betrachtet, erfüllt die staatliche Beschaffung und Verwendung von Geld den Tatbestand von faux frais. Von diesen Kosten, die dem Wachstum entgegenstehen, gibt es zu viel.
4. Daß die Regierung in den letzten Jahren „über ihre Verhältnisse gelebt“ hat, daß sie für diverse Staatsaktionen mehr Geld ausgegeben hat, als die nationale Wirtschaft hergibt, wird durchaus zugegeben, wenngleich meist in der volkstümlichen Lesart, „wir alle“ hätten uns da an der ökonomischen Vernunft versündigt. Einen ernsten Fehler in dem Sinn will sie sich aber nicht vorhalten lassen – die Finanzierung jener plötzlichen Erweiterung des Standorts Deutschland um die DDR jedenfalls hält die schwarz-rot-goldene Führung nicht für einen Verstoß gegen solide Haushaltsführung. Dergleichen fällt für sie unter die Abteilung „historisches Ereignis“, dem sich die Regierung nur unter Schimpf und Schande hätte verweigern können. Nun hat sich aber herausgestellt, daß der Zugewinn an Land und Leuten, statt zu einer zusätzlichen Quelle deutscher Wirtschaftskraft zu werden, eine auf ca. 800 Mrd. DM bezifferte Belastung der staatlichen Schuldenkonten darstellt. Und diese Vermehrung des nationalen Kredits hat Folgen, bei denen die „guten Gründe“ für die außerordentliche Aufgabe der „Wiedervereinigung“ nichts zählen.
Dasselbe gilt für die Kredite, welche Deutschland für die Einheit Europas lockergemacht hat. Diese Mission, auf deren Vollendung mit den Vereinbarungen von Maastricht gedrungen wurde, war darauf berechnet, aus Europa einen Kapitalstandort zu machen, der einer ihn betreuenden Macht zu ökonomischen Potenzen verhilft, die an den Dimensionen der Weltmacht Nr.1 Maß nehmen – und dereinst das internationale Kräfteverhältnis aufzumischen gestatten. Der mit Maastricht unter deutscher Regie ergangene Imperativ, die europäischen Partner sollten für das Gelingen des Projekts, im Interesse eines soliden gemeinsamen Geldes eine Inventur ihres nationalen Kreditwesens durchführen und selbiges reduzieren, hat zur europäischen Währungskrise geführt. Und Deutschland war im Zuge der Verpflichtungen, die das EWS gebietet, gehalten, durch Stützungskäufe gegen die Demontage des Kreditgeldes seiner Partnerländer vorzugehen. Auch diese Vermehrung des nationalen Kredits zeitigt Folgen, denen mit dem Wälzen von Schuldfragen („Spekulation“) ebensowenig beizukommen ist wie mit Lobreden auf die solide Mark der unabhängigen Bundesbank.
Die Wahrnehmung der Krise, zu der sich die leitenden Angestellten des wiedervereinigten Deutschland herbeilassen, konzentriert sich auf eben diese Folgen. Daß die Entscheidungen der BRD-Politiker zur Gefährdung der Stabilität der DM geführt haben, daß sie binnen zwei Jahren die Verschuldung der Nation in einem Maße betrieben haben, das durch die Bedürfnisse des Geschäfts nie erreicht worden wäre, geht sie nichts an. Sie behandeln die Inflation, in der sie ein Übel sehen, als ein Phänomen, mit dem sie als Hüter einer eigentlich grundsoliden Geldware durch allerlei Umstände konfrontiert worden sind. Wenn 1993 daheim und auswärts die vom deutschen Staat garantierten DM-Eigentumstitel in erheblich gesteigerten Mengen vorhanden sind, ohne daß mit ihnen das Grundrecht allen Eigentums – sich zu vermehren – eingelöst werden kann, dann registrieren sie einen Schwund ihrer nationalen Macht. Denn die besteht in der Fähigkeit des Staates, Schulden in die Welt zu setzen, die als Geld und Kapital taugen.
5. Diesen Ausweis nationaler Wirtschaftskraft hat Deutschland jahrzehntelang erbracht. Der Staat hat seine Infrastruktur, die Agrarsubventionen, die Transitgebühren an die DDR und die Bundeswehr nämlich nicht mit dem Geld bezahlt, das er per Steuern dem privaten Vermögen seiner Bürger entzogen hat. Für die Finanzierung seines Haushalts war das zu wenig, so daß er seine Kasse durch eine stets wachsende Verschuldung aufgestockt hat. Die stolze Rede von der „harten Mark“ betraf die Solidität seiner Schulden, die sich auf gar nicht rätselhafte Weise einstellte. Die ständige Vermehrung von staatlich garantierten Umlaufmitteln und DM-Eigentumstiteln diente Geschäftsleuten mit und ohne deutschen Paß als Grundlage für eine Produktion, die sich im internationalen Handel bewährte. Von deutschem Boden aus wurden Rekordbilanzen gegenüber dem Ausland erwirtschaftet, deutsche Kosten und Überschüsse wurden mit DM bezahlt, die zuvor auf den internationalen Geldmärkten gekauft werden mußten. Die Nachfrage nach deutschem Geld, die gemäß den eigentümlichen Gesetzen des Geldmarkts den Preis der gehandelten Ware – des nationalen Kreditgeldes – bestimmt und damit auch die Zahlungsfähigkeit dessen, der über das Zeug verfügt, hat ihre Wirkung getan. Die Erfolge des DM-Kapitals auf dem Weltmarkt statteten das deutsche Geld mit einer anderen Währungen – die ebenfalls auf dem Kredit ihrer nationalen Wärter beruhen – überlegenen Kaufkraft aus. Zur Nachfrage, die der Handel stiftete, gesellte sich die von Geldanlegern, Geschäfts- und Nationalbanken, die ihrem Vermögen einen sicheren Bestand verschaffen wollten. Und in Europa wurde Deutschland zum Hüter einer „Ankerwährung“, mit der es die Zahlungs(un)fähigkeit seiner Partner mit betreute, darüber die Kontinuität des europäischen Handels garantierte, der den Zustrom von Reichtum nach Deutschland sicherte. Das waren die „guten Jahre“, von denen der Kanzler weiß, daß sie jetzt vorbei sind; in denen Deutschland für alle Projekte, die ihm nützlich vorkamen, Schulden auflegte…
Die politische Behandlung der ökonomischen Gegensätze, welche die Krise ausmachen, bezeugt nicht nur, wie wenig Respekt die staatlichen Doktrinäre der „Marktwirtschaft“ vor den „Kräften des Marktes“ haben. Zwar nehmen sie die Kalkulationen der Kapitalisten bedauernd-ohnmächtig zur Kenntnis, wenn diese Rechnungen ergeben, daß sich mit den schönen akkumulierten Überschüssen der „fetten Jahre“ gegenwärtig nichts mehr verdienen läßt und deshalb die Produktion der Qualitätsartikel eingeschränkt wird. Die Wirkung, die von den Stockungen des Marktes und der Entwertung von Kapital auf den Haushalt und das Geschäftsmittel der Nation ausgeht, läßt sich die Staatsführung aber nicht einfach gefallen. Sie besteht darauf, daß das deutsche Geld auch unabhängig von den aktuellen Leistungen des Standorts Deutschland seine Vorzugsstellung behält. Auf dem Felde der Ökonomie macht die Bundesregierung zu allererst ernst mit ihren Sprüchen vom „größeren Gewicht“ des vergrößerten Deutschland – indem sie die Stabilität der DM zum unverzichtbaren Instrument der Nation erklärt; und zwar ausdrücklich nicht zu einem Hebel des Erfolgs, der dem Land aufgrund der internationalen Konkurrenz der Kapitale zu Gebote steht – vielmehr will Deutschland sein Recht auf die unanfechtbare Härte seines Kreditgeldes herbeiregieren, weil diese sich weder aus dem Gang der Geschäfte noch aus seiner Verschuldungspraxis ergibt.
6. Einerseits vermelden täglich die Konzerne, die das deutsche Geld durch ihre Beteiligung am Weltmarkt berühmt gemacht haben, rote Zahlen. Der vielgepriesene Mittelstand steht ihnen da bei. Die Klage über mangelnde Nachfrage bzw. Zahlungsfähigkeit seitens des Auslands stellt denselben Tatbestand fest – in deutschen Betrieben ist zu viel Kapital angelegt. Die Anlagen, mit denen nichts zu verdienen geht, sind nichts mehr wert. Und die Zahlen, die in den Büchern stehen, stimmen mit einem Male nicht mehr. Kapital und Kredit entwerten sich, und die Arbeitskraft von immer mehr Leuten lohnt ihre Anwendung nicht mehr. Statt Wachstum ist Schrumpfen des Eigentums in allen Varianten angesagt, die Quote der Staatsbeteiligung an privaten Einkommen sinkt entsprechend, der vom Staat durch Verschuldung in die Zirkulation geworfene Kredit taugt nicht als Geld.
Andererseits vermeldet der Staat täglich, daß er sparen muß, weil seine Schulden wachsen. Dies nicht, weil er sich zu einem Konjunkturförderungsprogramm entschlossen hätte. Sondern wegen der Finanzierung der Verschuldung, die er sich bereits geleistet hat – eine Verweigerung der einschlägigen Dienste, der Zinsen, die dem Steuerzahler der Bild-Zeitung immer mehr von jeder Mark rauben, käme dem Eingeständnis gleich, daß die BRD ihr Geld nicht mehr hoheitlich garantieren kann. Das will sie aber, ebenso wie die Finanzierung des „Beitrittsgebiets“, das erschlossen werden muß, auch wenn sich dort nichts rentiert.
Der Schluß, den die deutsche Regierung aus diesem von ihr selbst entscheidend mitgestalteten Szenario zieht, ist denkbar einfach: Diese Krise läuft auf den Test auch der Haltbarkeit ihres Kredits hinaus; ihr Standort ist nicht nur in bezug auf die eine Branche oder die andere Exportquote „betroffen“, sondern insgesamt und prinzipiell. Das nationale Geld, in dem sich der private und öffentliche Reichtum des Standorts mißt und darstellt, mit dem dieser Standort gegen andere konkurriert und nützlich kooperiert, die Bedingung und Waffe für unseren Erfolg auf dem Weltmarkt steht in Frage.
Die erste Lehre, welche die deutsche Regierung daraus zieht, lautet: Die DM, mit der der Standort Deutschland steht und fällt, ist das Schutzobjekt Nr. 1 der Politik. Sie muß im Unterschied und Gegensatz zu anderen Nationalkrediten davor bewahrt werden, ihre Qualität als internationales Wertmaß und verläßliches Zahlungsmittel einzubüßen.
Mit diesem Entschluß hat die BRD ein supranationales Engagement aufgekündigt, das bis dato als unverzichtbarer Programmpunkt und Credo deutscher Politik gehandelt wurde. Die Entscheidung „DM zuerst!“ ist als Absage an die europäische Gemeinschaft in die Welt gebracht worden, näher: als Kündigung der gemeinsamen Betreuung der Haushalte und Bilanzen der EG-Staaten. Mit der selbst bürgerlichen Journalisten unglaubwürdigen Behauptung, das EWS sei „gerettet“, hat der deutsche Finanzminister das Ergebnis einer Sonderkonferenz bekanntgegeben, in der die Ära der gemeinsamen Haftung für die Kreditnöte der Mitgliedsländer ihr Ende fand. Deutschland hatte die Fortführung der alten Technik als Last definiert, die zu tragen es weder fähig noch willens sei. Und für sich und sein Geld eine Sonderstellung reklamiert, die es – begleitet von heftigen Bekenntnissen zu Europa – nun einzulösen gedenkt.
7. Diese Revision der Haltung, mit der die BRD auf die ersten Währungsturbulenzen reagierte – es wurde gemäß den Regeln des EWS gestützt und die Einhaltung des „Fahrplans“ der Maastrichter Verträge bekräftigt –, setzt in einer Hinsicht die Berechnungen fort, die der Konstruktion von Maastricht zugrunde lagen und zur Formulierung der Beitrittsbedingungen zur Währungsunion führten: Unsolide nationale Kredite, damals definiert durch ihre Relation zum Bruttosozialprodukt, sollten heruntergefahren werden. Der Zutritt zur einheitlichen Wirtschaftsmacht Europa war durch eine Selbstbeschränkung der Kandidaten zu erkaufen; sie hatten die Freiheit zur Verschuldung, die durch die EG und ihr EWS vergrößert worden war, aufzugeben, um mit ihrem Haushalt nicht als Last, sondern als Stärkung für das europäische Geld der Zukunft bereitzustehen.
Festgehalten hat Deutschland an dem Anspruch, daß der überschüssige und unsolide Kredit gewissen Nationen zuzurechnen sei, anderen dagegen nicht. Es dringt auf die lokale Unterscheidbarkeit zwischen gutem und schlechtem Geld und läßt das im eigenen Land zutage getretene Mißverhältnis zwischen Wachstum und Schulden nicht „gelten“ – als Grund für fällige Entwertungsverluste. Als könnten sie die gewaltigen Dimensionen, die die deutsche Staatsverschuldung in drei Jahren angenommen hat, ungeschehen machen, beharren deutsche Finanzpolitiker erneut auf der Geldqualität des Kredits, den sie in Umlauf gebracht haben. Als glaubten sie endgültig an die ökonomische Wirkung ihrer Buchungstechniken – die Erklärung der finanziellen Ausstattung der Zone zu „Sonderhaushalten“, die das solide deutsche Wirtschaftsgefüge nicht tangieren –, werden sie auf eigenartige Weise mutig: In ihrer Hand, an ihren (finanz-)politischen Entschlüssen soll es liegen, ob die DM die Bewährungsprobe besteht, der sie auch in ihren Augen ausgesetzt ist!
Dabei beruht der Entschluß, mitten in der Krise die eigene Währung zu „retten“, ihre Qualität als unantastbare internationale Zahlungsfähigkeit polemisch gegen das Geld anderer Nationen zu erhalten, auf einer Voraussetzung, die sich der geballten „Handlungsbereitschaft“ der DM-Politiker entzieht. Der positive Ausgangspunkt, auf den sich ihre nationalistische Entschlossenheit stützen kann, ist die Anerkennung, die deutschen Kreditzetteln gegenwärtig zuteil wird. Das BRD-Geld wird relativ zu den EG-Partnerwährungen gut notiert, es zehrt dabei von den früheren Leistungen des Standorts Deutschland und den Einbrüchen, die andere Nationen in der ersten Phase der Krise zu verzeichnen hatten. Die Freude darüber hält sich allerdings in Grenzen, weil die Verantwortlichen wissen, aus welcher Quelle die Nachfrage stammt, die da täglich der DM ihre Brauchbarkeit attestiert. Und weil sie bemerken, daß diese Brauchbarkeit nicht die ist, die sie meinen. Da werden nicht DM verdient, sondern es wird an der DM verdient – nämlich mit den abgeschmackten Operationen, welche der Geldmarkt für Anleger bereithält, die nach der relativ besten Besitzstandswahrung trachten.
So fällt den Fachleuten des nationalen Erfolgs plötzlich in der Krise auf, welch windigen und sogar gefährlichen Geschäftszweig sich die beliebte Marktwirtschaft mit ihrem Finanzkapital leistet. Einerseits werden die Resultate des Geld- und Papierhandels, die nach wie vor der DM das in Preisen anderer Gelder gewichtete Kompliment erstatten, daß sie eine internationale Kaufkraft besitzt, ihrer Bedeutungslosigkeit überführt: Dergleichen mindert weder die Staatsschulden noch steigert es das Wachstum! Wenn ein Devisenkurs sich aufgrund der Manipulationen ehrbarer Geldhändler für den Geschmack der Währungspolitiker zu sehr verschlechtert, heißt der Berufsstand schon einmal abfällig „Spekulanten“. Umgekehrt ist man in Bonn keineswegs zufrieden, wenn die DM zulegt und interessierte Kreise im Ausland auch noch eine amtlich vollzogene Aufwertung fordern – das verhindert sogar den Aufschwung, weil es den Export bremst…
An solchen Entdeckungen, die das Verhältnis von wirklichem Wachstum und Geldkapital betreffen, könnte allen DM-Patrioten freilich noch etwas ganz anderes klar werden.
Mit dem Beschluß, ab sofort die DM gegen den Rest der
Welt zu sichern, weigern sich die Regierenden, die
Abhängigkeit ihrer Finanzen und des freien Umgangs
mit ihnen vom Gang der Profitproduktion zu akzeptieren.
Sie betreiben eine Nicht-Anerkennungs-Politik
gegenüber den Sachzwängen
des Marktes, die sie so
gern im Mund führen; sie stellen sich im Interesse
des nationalen Ertrags gegen die Konkurrenz, die
ihnen Beschränkungen ins Haus wirtschaftet und deswegen
überhaupt nicht „frei“ zu sein verdient. Der Krise und
ihren Folgen wollen sie sich nicht ohnmächtig beugen,
auch wenn sie jede Mitwirkung leugnen und sagen, sie wäre
ihnen ins Haus geschneit. Die Resultate der Konkurrenz,
die die Bilanz der Nation versauen, sind für sie der
beste Grund, ihre politische Macht zur Korrektur am
nationalen und internationalen Markt einzusetzen.
Sie entschließen sich zur Berichtigung der
Konkurrenzbedingungen, deren Festlegung ihnen
zusteht. Das ist das eine.
Solch großes Werk gehen sie an – und wollen sich dabei des „business as usual“ bedienen, das sich in der Sphäre des Geldhandels abspielt. Sie nehmen mit ihren finanzpolitischen Diagnosen und Prognosen Maß an den Daten, die der weltweite Geldhandel setzt. Sie verlassen sich darauf, daß dieser Markt mit seinen Vergleichen zwischen Zinsen und Kursen das Maß ermittelt, in dem sie über gutes Geld gebieten. Als Fanatiker des inter-nationalen Vergleichs, der Konkurrenz von Staaten um die Erträge von Kapital, die ihnen die Exekutierung der Gleichung „Staatsschuld = Weltgeld“ gestatten, überantworten sie diesen Vergleich den Geld- und Papiermärkten. Auf denen sind Personen und Institute in der Krise ausdrücklich damit zugange, nicht auf erzielte Gewinne zu spekulieren, sondern ohne sie; dieses Gewerbe verdient auch ohne Wachstum, es schafft sich getrennt von Produktion und Handel seine eigenen Zuwächse oder Verluste. So daß sich der stabilitätsbeflissene Finanzminister und die Bundesbank an den Ergebnissen dieses auch grenzüberschreitenden Geschäfts kundig machen, wie es mit der Geldmenge, den Devisenreserven, den Bankeinlagen und eben der Währung insgesamt steht. Das ist das andere.
Aber noch lange nicht alles. Der auffällige Gegensatz zwischen der staatlichen Ankündigung, Schulden und Wachstum wieder in jenen effektiven Einklang zu bringen, der in dem Kürzel „Stabilität der DM“ zusammengefaßt wird, und dem Respekt vor den Geldmärkten, ihrer Funktionsweise und täglich erneuerten Zwischenbilanzen hat es nämlich in sich. Er bringt nicht nur Risiken mit sich, was das Gelingen der staatlich kontrollierten Stabilität angeht, sondern bringt ein Risiko der höheren Art auf die Tagesordnung.
a) Immerhin muß die Spekulation von Geldhändlern und -anlegern in der Krise auf ein Kriterium für ihre Entscheidungen verzichten; daß die Konzerne, deren Aktien im Angebot sind, wegen ihrer Gewinne eine feine Anlage darstellen, kann angesichts roter Zahlen niemand in Betracht ziehen. Und „in das Geld“ einer Nation kann man nicht wegen flotter Wachstumsziffern „gehen“, wenn die Statistik die Bilanzen ein ums andere Mal nach Minus korrigiert. Gekauft und hineingegangen wird aber trotzdem, und zwar ausschließlich nach Erwägungen, die sich nicht auf ökonomische Fakten gründen, sondern auf den Vergleich von Erwartungen. Daraus ergeben sich dann veränderte Verhältnisse von Angebot und Nachfrage, welche Preise und Kurse bestimmen. Diese von der Spekulation selbst erzeugten Fakten bilden – als Tendenz interpretiert, die sich aus dem Unterschied von „vorher“ und „nachher“ ergibt – den Ausgangspunkt für die erneute Zuteilung von Vertrauen, das sich in Nachfrage und Angebot niederschlägt…
Daß im Selbstlauf dieser Sphäre die Entscheidungen der Akteure, die da mit Milliarden um sich werfen, letztlich auf Psychologie zurückgehen, gilt Börsenkommentatoren als ausgemacht. Daran gewöhnt, ökonomische Daten nur als Anhaltspunkte für das Marktverhalten zu zitieren, das sich bei den einen nur einstellt, weil sie bei den anderen damit rechnen, verwechseln sie ihren Durchblick auch nicht mit Systemkritik. Nicht einmal Bedenken bezüglich der Verläßlichkeit der Einschätzungen, an denen so viel hängt, sind üblich. Die Weltwirtschaftskrise 1929 ff. gehört für sie in die Katastrophenbibliothek, auch wenn sie zeigt, daß das Management des Finanzkapitals mit seiner „Psychologie“ Arbeitsplätze und Ersparnisse, Betriebe und ganze Volkswirtschaften kaputt machen kann. Die Angst vor einer Neuauflage dieser Leistung ist aber nicht nur den im Geldhandel befangenen Agenten und Beobachtern fremd, die nur an den Abschlüssen und den Durchschnitten interessiert sind und registrieren, wovon wieviel läuft. Auch die übrige Elite der Nation findet nichts dabei, daß gegenwärtig Produktion und Handel zurückgehen und gleichzeitig ein fröhlich Spekulieren seinen Gang geht, dessen erfüllte und unerfüllte Gewinnerwartungen eine ganz aparte „Wirtschaftslage“ herbeiführen; daß in dieser Sphäre nicht nur Unsummen gewinnbringend verschoben werden, sondern sich auch die Haltbarkeit von Bankeinlagen, die Kaufkraft gewöhnlicher Geldbeutel und das in „unserer DM“ verkörperte Schicksal der Nation entscheiden per Vertrauen. Das kommt daher, daß das Wirken des Finanzkapitals, vom Devisenhandel bis zur Börse, nicht danach beurteilt wird, was es tut und warum; vielmehr wird es – Massenentlassungen hin, Betriebsschließungen her – allen Ernstes als zuverlässiger Gradmesser des Vertrauens genommen, das „die Wirtschaft“ verdient.
Wie gesagt, dieser Befund läßt sich nicht im geringsten dadurch irritieren, daß er für den Fall des Falles – in dem Geldanleger das Vertrauen in ihre Anlagen verlieren – ebenfalls gilt; daß dann die hinfällig gewordenen „Erwartungen“ von Spekulanten das ganze gewöhnliche Wirtschaften der Gesellschaft der Untauglichkeit überführen. Eher schon wird der „gute Grund“ ausfindig gemacht, der jenseits der Welt, in der die Auftragsbücher leer sind und Konkurse abgewickelt werden, vorliegt, wenn das Wechseln zwischen Geldsorten, Kursen und Titeln vertrauensvoll weitergetrieben wird. Dieser Grund ist einerseits sehr schlichter Natur, andererseits nur für Zeitgenossen ein guter, die von Berufs wegen an Zirkelschlüsse gewöhnt sind. Er lautet schlicht: „Die Geschäftsgrundlagen für unser Gewerbe bestehen unverändert fort!“ Denn die Krise ändert schließlich nichts daran, daß Eigentümer von Werttiteln und Verwalter von Devisenkonten nach der besten Anlageform ihres Vermögens suchen können und im eigenen Interesse auch müssen. Der Handel mit dem Zeug eröffnet werktäglich pünktlich wie eh und je (in der aktuellen Krise wurde nur einmal höheren Orts mit dem Gedanken gespielt, eine Abteilung zu schließen!), und der rechtlich geregelte freie Umgang mit dem zinstragenden Stoff ist gewährleistet, was seine Gültigkeit verbürgt und seine Bewertung dazu… So zieht sich die Rücksichtslosigkeit, mit der die Geld- und Kapitalmärkte gegenüber der Krise des reellen Wachstums einfach weitermachen, einerseits auf eine Banalität zusammen, die aus der Optik der Beteiligten eine praktische Notwendigkeit darstellt: Selbst wer Zweifel an der Haltbarkeit seiner Vermögensform hat, verfügt über keine Alternativen außer denen, die diese Sphäre bereithält. Und um die muß er sich gemäß den Regeln des Gewerbes bemühen. Andererseits zeugt die muntere Fortsetzung dieses Geschäfts davon, daß es mit seiner Freiheit zum Spekulieren, das auch einmal schiefgehen kann, von den maßgeblichen Instanzen der krisengeschüttelten „Industrieländer“ als nützliche Sphäre und als Instrument behandelt wird. Die „Industrie“ kalkuliert mit den Devisenkursen, der grenzüberschreitende Geldhandel ist die Bedingung für den Export und Import. Im Aktienhandel verschafft sie sich Kapital, wodurch sie sich in Sachen Betriebsgröße – einer bekannten Waffe der Konkurrenz – vom Ausmaß des Eigentums einer Privatperson emanzipiert. Und wenn sie aufgrund schlechten Geschäftsgangs oder von zu viel „Liquidität“ das Vermögen anderer nicht benötigt, wird sie selbst in der Branche des Finanzkapitals tätig, um ihren Besitzstand zu wahren. Die Personalidentität zwischen den Herren von Industrie und Banken geht von daher auch in Ordnung. Dieser Auffassung sind stets auch die politischen Vorstände, die für den Rahmen und die Ordnung ihrer „Marktwirtschaft“ zuständig sind. Unzufrieden sind sie höchstens mit den Leistungen ihres famosen Systems, dessen Regeln sie schließlich selbst aufstellen und überwachen, also auch respektieren. Dem Risiko, das sich der Staat mit den bisweilen erratischen Entscheidungen der Geld- und Kapitalmärkte einhandelt, begegnet er auf seine Weise.
b) Die Klage über gewisse Märkte und Spekulanten, wie sie aus anderen europäischen Ländern zu vernehmen war, bildete nicht den Ausgangspunkt für die Hüter der DM, als sie ihr Programm zur Rettung der DM initiierten. Eher schon wollten sie „den Märkten“ gleich jede Gelegenheit verbauen, dem deutschen Geld dasselbe anzutun wie der Lira, dem Pfund und anderen. Das Argument dafür, mit den Stützungskäufen nicht fortzufahren und den „zeitweiligen“ Austritt einiger Nationen aus dem EWS zu beschließen, war denkbar einfach gestrickt: Erstens hält es den Verfall der lädierten Währungen nicht auf, zweitens bringt die Auffüllung des deutschen Staatsschatzes mit verfallenden Devisen bei gleichzeitiger Vermehrung der Menge deutschen Geldes die Ankerwährung selbst in Gefahr. Auch diese angesichts der damaligen „Lage“ so plausible Begründung für die (gemeinsamen) Beschlüsse enthielt bereits einge gewisse Klarstellung bezüglich der ökonomischen Hierarchie in der EG – die DM erhielt ein Sonderrecht auf „Verschonung“ vor der gerade angelaufenen Entwertungswelle in Europa zugesprochen. Und einer gewissen Beschönigung entbehrte diese Klarstellung auch nicht – es wurde so getan, als müßte der deutsche Kredit für das Gelingen des Einigungswerks vor den Risiken einer rapiden Inflation bewahrt werden. Dabei hatte die BRD gerade mit der Finanzierung der Wiedervereinigung ihren Kredit erheblich strapaziert und damit ihre stolze „Ankerwährung“ eindeutig umgewidmet; die in der Gemeinschaft erworbene Wucht des deutschen Geldes war dazu benützt worden, die Fähigkeit zur Verschuldung für ein speziell deutsches Projekt einzusetzen. So daß die deutschen Unterhändler der Gemeinschaft einen „objektiven Sachzwang“ präsentieren konnten, der es verbot, die Zahlungsfähigkeit Europas aufs Spiel zu setzen. Das wurde akzeptiert, zumal damals die BRD von der Vereinbarkeit beider Projekte noch überzeugt war.
Inzwischen ist man in Bonn zu der Auffassung gelangt, daß der Verlauf der Krise und das Scheitern einer Kapitalisierung der DDR, die aus dem neuen Bundesgebiet eine zusätzliche Quelle machen sollte, zu einem „Umdenken“ zwingt. In der Geldpolitik kamen die Verwalter des Haushalts und die Frankfurter Währungshüter dahin überein, daß der stetige Zwang zur Neuverschuldung langsam aber sicher den Unterschied zwischen dem soliden deutschen Geld und dem der Nachbarn zu verwischen drohte. Kurzzeitig sorgten die Märkte dafür, daß der von Deutschland mehrfach gestützte Franc als die stabilere Währung galt; der Indikator der „Inflation“ hatte gegen die DM gesprochen und den Verwesern des deutschen Geldwesens klar gemacht, daß das Vertrauen der Sphäre, die den internationalen Vergleich abwickelt, nicht mehr automatisch bei ihnen landet. Und diesem Urteil des Geldhandels, das mit dem Befund drohte, daß auf einmal privates und öffentliches DM-Vermögen weniger wert sein sollte auf der Welt – sogar bürgerliche Journalisten redeten plötzlich von „Wert“ und „Entwertung“ –, wollte sich die BRD nicht beugen. Vorübergehend wurde nun auch auf deutsch „bloße Spekulation“ für diesen unverdienten Angriff auf den unschlagbaren deutschen Reichtum verantwortlich gemacht. Dabei ist es aber nicht geblieben.
Die Bundesregierung selbst hat auf ihre Weise den „Märkten“ recht gegeben und beschlossen, die DM zum Pflegefall Nr. 1 ihrer Politik auszurufen. Damit ist zwar, was die relative Tauglichkeit nationaler Gelder anlangt, überhaupt nichts verändert, aber schon einmal eine Botschaft an alle Spekulanten ergangen. Für die gehört nämlich ein Regierungsbeschluß, und beträfe er auch nur ein halbes Prozent Zinssenkung oder -erhöhung, allemal ein „Signal“. Wenn eine Wirtschaftsmacht vom Kaliber der BRD ankündigt, daß sie sich im Umgang mit ihrem Geld umstellt, so ist das für diese Szene eben der Hinweis darauf, daß hier ein Währungshüter – und das ist ein Lieferant des Stoffes, mit dem gehandelt wird – etwas für die Qualität seiner Ware tut. (Wie prompt solche Annoncen ihre Wirkung tun, ohne daß der Erfolg des angekündigten Programms auch nur im mindesten garantiert wäre, läßt sich an den Reaktionen der Geld- und Kapitalmärkte auf die seinerzeitigen Ansagen von Reagan und Thatcher studieren!) Wenn sie gar dazu übergeht, ihre Verpflichtung, Kredit für supranationale Geldbetreuungsaufgaben bereitzustellen, aufzuheben, also Taten sprechen läßt – dann schlägt die Botschaft umso sicherer an. Immerhin erfährt der Geldhandel mit der faktischen Stillegung des EWS, daß sich „wegen Europa“ die Umlaufsmenge deutschen Kreditgeldes nicht mehr erhöht; stattdessen ergeht der zusätzliche Bescheid, daß deutsche Geldschöpfung künftig für die Zurichtung des Standorts Deutschland reserviert bleibt.
Das sitzt. Eine Nation, die erklärtermaßen ihre ökonomische Potenz aus der EG und mit dieser aus dem Weltmarkt bezieht, setzt Daten, die gemäß den immanenten Gepflogenheiten des Geldmarkts eine Bevorzugung ihres Geldes sollizitieren. Dabei „besticht“ sie nicht mit einer kostenträchtigen Hochzinspolitik, sondern durch eine Absage: Sie teilt mit, daß sich nach ihrer Rechnung die Kosten für die Betreuung gesamteuropäischer Zahlungsfähigkeit nicht mehr lohnen, weil ihr Weltmarktstatus damit nicht gefördert wird. Und sie will diese Rechnung durch die notorisch vaterlandslosen Gesellen des Finanzmarktes bestätigt haben; indem die Bundesregierung mit ihrem „DM zuerst!“-Beschluß die Geschäftsgrundlagen der internationalen Währungs- und Finanzpolitik verändert und die Stabilität ihres Geldes der von anderen Nationalkrediten gegenüberstellt, verlangt sie mitten in der Krise die Anerkennung einer Hierarchie, die sich erst einmal in der ungebrochenen Wertschätzung der DM ausdrückt. Mit dieser polemischen Politisierung des Geldmarkts befragt sie freilich nicht nur Spekulanten nach ihrer Stellung zur DM und zum von ihr definierten Standort, sondern auch die anderen Währungshüter.
Und darin liegt das Risiko, das Deutschland mit seiner Kampfansage heraufbeschwört. Es ist nämlich eine Kampfansage, wenn eine Nation der Konkurrenz in einer Krise mitteilt, daß sie ihren Standort jedenfalls als überlegenen aus der Krise herausführt; wenn sie zu diesem Zweck überkommene Formen der Organisation der Konkurrenz kündigt, bewußt und offen auf die Schwächung auswärtigen Kredits setzt und darauf dringt, daß sich die Partner von gestern alle neuen Wege gefallen lassen.
8. Darauf, daß die Bewegung des Geldkapitals die DM hochhält und ihren Verwaltern und Besitzern den Genuß bereitet, über ein – im Vergleich zu den übrigen weltmarkttauglichen Geldern – stabiles Vermögen und Geschäftsmittel zu verfügen, ist in mehrerer Hinsicht kein Verlaß.
Erstens sind die „Signale“ der Bundesregierung für die Agenten des Geldmarktes keine Diktate, sondern eben Signale, die sie in ihre spekulativen Gewinnrechnungen einbeziehen. Die Geld- und Papierhändler vergleichen sie mit den Verheißungen und Risiken, die von anderen Signalen ausgehen; und sie vollziehen von Tag zu Tag den Test darauf, ob der deutsche Kredit hält, was er verspricht. Das Maß seiner Ausweitung – die ist als erzwungene ebenso vorgesehen wie für die ausgiebige Betreuung des Standorts – kommt da sowieso ins Spiel, desgleichen das Verhältnis zu den Leistungen deutschen Geschäfts, aber auch so delikate Fragen wie die Stabilität in den Chefetagen der politischen Macht.
Zweitens stehen dem Umgang der BRD mit ihrer DM die Aktionen konkurrierender Staaten gegenüber, die es mit ihrer Stabilität zu tun haben und sich nicht mit Geld- und anderen Märkten abfinden, welche ihre Unterordnung unter die ökonomische Macht Deutschlands aushandeln. Der lauthals verkündete Bedarf Deutschlands nach ökonomischer Macht, die auf ihre Kosten geht, provoziert sie geradezu: Das Recht, die Märkte in ihrem Sinn unter Regie zu nehmen, ist da herausgefordert und garantiert manche Wirkung auf den freien Verkehr von Ware, Geld und Kapital.
Drittens steht die Bestätigung der DM als vorzügliche Geldware nur aus einem Grund zur Debatte: Sie taugt gegenwärtig nicht als Geschäftsmittel der Nation, soll es aber bleiben. Daß sie es wieder wird, kann allerdings auch ihre erfolgreiche Bestätigung als prima Handelsobjekt der Geldmärkte nicht gewährleisten. So ärgerlich es für die DM-Hüter wäre, wenn sich an der Notierung der DM auf den Devisenmärkten zeigen würde, daß die Besitzer dieses Geldes gar nicht über die internationale Zahlungsfähigkeit verfügen, die sie ihrem Kontostand zuschreiben – am anderen Extrem einer „starken“, weil aufgewerteten Mark veranschaulichen sie sich und anderen immer wieder, welch kontraproduktive Wirkung dies auf das Wachstum hätte. Deswegen trägt die Bundesregierung dem Mißverhältnis von Staatsschulden und Wachstum auch auf seiner anderen Seite Rechnung. Die „Zukunftssicherung des Wirtschaftsstandortes Deutschland“ dreht sich um den Auftrag der Regierung, Land und Leute so zuzurichten, daß sich das Kapital wieder rentiert. Die Erfüllung dieses Auftrags wird mit einem Programm angegangen, das sich zum Leitfaden die Marx’sche Bestimmung des bürgerlichen Staates als „ideeller Gesamtkapitalist“ gewählt hat; das alle beschönigenden Auskünfte über das „Wachstum“ auf den Müllhaufen unbrauchbarer Ideologien wirft und es korrekt mit dem Verhältnis von Kosten : Profit identifiziert, das, im Preis deutscher Waren sorgfältig verpackt, den wirtschaftlichen Erfolg der Nation verbürgt.
Solch wohlverstandene Mobilisierung der Quellen des Reichtums, auf den es hierzulande ankommt, setzt die Krise, an der die Nation laboriert, gleich mit dem Ausbleiben von Profit. Die Frage, woran das liegt, beantwortet die Staatsführung mit der tautologieverdächtigen Auskunft, daß die Produktion von Profit behindert wird. Diese Antwort bildet die Grundlage einer radikalen Gesellschaftskritik, deren theoretische Qualität so uninteressant ist, weil sie von keinem Geringeren als von der öffentlichen Gewalt praktisch wahr gemacht wird. Von Interesse ist nicht einmal, daß der Kapitalgewinn, vom Staat als Maßstab an Land und Leute angelegt, weil er gerade vermißt wird, die bisweilige Verwechslung mit einem „Motiv“, einer Einstellung zum Verschwinden bringt; einer Einstellung, an der sich Moralisten ihr wertebeflissenes Mütchen kühlen, wenn sie einen Kapitalisten ausfindig machen, der „bloß wegen des Profits“, nach dem ihn verlangt, Schaden anrichtet. Wenn der Staat darauf besteht, daß die Nation profittauglich zu sein hat, dann ist die Moral auf der Seite seines Maßstabs, der ein objektives Erfordernis darstellt, dem die gesamte Gesellschaft zu entsprechen hat. Daß sie es in der Krise nicht tut, gerät da zum empörten Vorwurf von Kanzler und Ministern, den sie dann mit ihrer Regierungsmacht an den Bürgern vollstrecken. Die Darbietung ihrer Maßnahmen als Korrektur ihrer Amtsausübung liegt einerseits an der professionellen Heuchelei, der zweiten Natur aller Politiker, andererseits in der Logik der Sache – sie selbst haben es schließlich in der Hand, ihren Untertanen wachstumswidriges Benehmen zu genehmigen oder zu verbieten.
a) Die verbreitetste Untergrabung des Profits findet – wie sollte es bei diesem ökonomischen Verhältnis anders sein – bei den Kosten statt. Der Staat trägt insofern daran Schuld, als er sich eine Abteilung Soziales leistet, die er sich nicht leisten kann (mit seinen Schulden wird er selbst glatt zur Last!), durch die er aber vor allem die Lohnarbeit zu teuer für das Kapital gemacht hat. Diese Kosten will er nun nicht mehr verursachen, was ihm durch einen gesetzgeberisch verordneten Pauperismus gelingen soll, der vor allem die betrifft, die das Kapital ohnehin nicht mehr braucht. Die anderen, die mit ihrer Arbeit am Profit beteiligt sind, beschränken diesen aber auch in jeder, also zweierlei Hinsicht. Sie kosten zu viel und tun zu wenig – wofür die Regierung ebenfalls verantwortlich zeichnet. Deshalb befassen sich jetzt die hohen Herrschaften mit der Arbeitswelt in einer Weise, die ob ihres Sachverstandes staunen macht: Kohl kennt sich plötzlich mit „Maschinenlaufzeiten“ aus, als hätte er von Marx den 3. Band über „Das Kapital“ gelesen; Waigel und Rexrodt wollen in Japan erfahren haben, wieviel Freizeit von Arbeitern der Profit allenfalls verträgt – und alle wissen zusammen mit Blüm, daß „Arbeitsproduktivität“ ein anderes Wort für Profitrate ist und deshalb bei der Errechnung des Lohnes zugrundeliegen muß, daß in Deutschland (im Ostteil schon gleich) dieses Gesetz aber sträflich vernachlässigt wird. Deshalb macht die Regierung jetzt neue Gesetze, die alle den Geist der „Zukunftssicherung“ atmen, der dem des früheren Manchester gleicht, wohin alle Fanatiker des deutschen Kapitalismus dessen Kritiker abstellten, solange sich der Sozialstaat für den Profit und die Staatskasse ausgezahlt hat. Von Klassen mag da niemand mehr reden, wenn die Regierung auf dem Verordnungsweg gerade das neue Maß festlegt, in dem in Deutschland Arbeit und Armut zusammengehören; und „Klassenkampf von oben“ wäre ein böser, aber schiefer Ausdruck für das verantwortungsbewußte Vorgehen der Herren des Standorts. Die Kapitalisten kämpfen nicht, sondern entlassen und probieren das „Gesundschrumpfen“, schreiten zu Fusionen mit anderen und verlangen bessere Garantien für den Profit; die Politiker kämpfen auch nicht, sondern erklären die Lebensart der Mehrheit ihrer Untertanen – einschließlich der Gesundheit – zur Last, die den Profit, das Lebensmittel der Nation, einschränkt.[1]
b) Der Staat verursacht nicht nur Kosten, die in Gestalt von überbezahlten Leistungsverweigerern und ebenso nutzlosen wie kostspieligen Sozialfällen die Krise des Profits hervorgerufen haben. Er selbst ist eine Ansammlung von Kosten, die der Zukunft des Standorts abträglich sind. Das wird zwar bis zu seinem Lebensende so bleiben, weil Minister, Soldaten, Polizisten und Richter nun einmal keinen Profit abwerfen. Unter dem Gesichtspunkt, daß der Staatshaushalt erstens die DM und damit zweitens den Geschäftsgang belastet, werden deutsche Führer 1993 aber fündig. Sie machen Staatsschulden aus, die sich einem Fehler verdanken – der Staat hat Aufgaben an sich gezogen, die gar nicht die seinen zu sein bräuchten. Und weil er sie erledigt, bringen sie keinen Gewinn; statt sie geschäftsmäßig zu betreiben, also Kosten nur zu tätigen, damit und wenn sie einen Überschuß erbringen, unterhält er sie in Form eines Zuschußbetriebs der öffentlichen Hand. Er, die Aufsichtsbehörde der freien Marktwirtschaft, entzieht ganze Abteilungen und Gewerbe der einzig senkrechten Zweckbestimmung – der Plusmacherei. Und in der liegt die Zukunft des Standorts Deutschland.
Der Ruf nach Privatisierung macht Ernst mit der fanatischen Gegenüberstellung von produktiver und unproduktiver Arbeit – der Unterschied hat nichts mit der Leistung eines Werktätigen und ihrem Nutzen zu tun. Die Kritik an den „Privilegien“, die der Staat, „gefesselt“ durch sein Beamtenrecht, den Bediensteten der Post, Bahn und Forstwirtschaft gewähren muß, besagt allemal auch: Die Nützlichkeit dessen, was die Leute für ihr Geld zu tun haben, bemißt sich daran, ob es Gewinn bringt für den, der ihn bezahlt! Von daher ist ein bißchen Kündigungsschutz ein einziger Verstoß gegen die Grundrechnungsart des Kapitalismus, die der deutsche Staat jahrzehntelang vernachlässigt hat. Insofern ist jede Privatisierungsaktion auch ein erklärtermaßen beabsichtigter Beitrag zur sozialen Frage, wie sie die Standortverweser heute buchstabieren.
In den durchaus verschieden gelagerten Fällen, die die Verwandlung von Teilen des Staatshaushalts in Kapital betrifft, kommt noch manch anderer guter Grund zur Sprache, nach dem die Unhaltbarkeit des status quo ermittelt wird: Das Verbrechen der Subvention, wo Profit gemacht gehört, ist zu bekämpfen zum Wohle des Standorts, der unter den faux frais seiner Staatsgewalt mächtig leidet. Unter die aufgeregte Darbietung dieser Botschaft, die sicher all denen zusagt, die schon immer den kapitalistischen Staat verdammten, weil er die Beamten faulenzen läßt und auch sonst bevorzugt, mischen sich bisweilen andere Töne. Da muß die Privatisierung der Telekom auch deswegen sein, weil ihr als Staatsbetrieb, dem die Spezies „Steuerzahler“ zu seinem Vermögen verholfen hat, die Beteiligung an der internationalen Konkurrenz versagt ist. Die muß aber stattfinden, weil gerade mit einem Konzern von dieser Größe, der im Inland nicht von schädlicher Konkurrenz behelligt wird – das ist ein kleiner Trostpreis, den das „Subventionieren“ von gestern übrig läßt –, viele DM in und am Ausland verdient werden können.
c) Das Standort-Papier des Wirtschaftsministers wäre keines, wenn in ihm nicht der Anspruch formuliert würde, daß sich Deutschland seinen Profit auch nach der Krise in der ganzen Welt erwirtschaftet. Es ist aber ein Standort-Papier, das die Zukunft der Nation in der Fähigkeit erblickt, der auswärtigen Konkurrenz überlegene Mittel entgegenzusetzen; deshalb widmet es sich nicht nur der Bereinigung der Kosten, die nach Auffassung der Führung den Profit ungebührlich beschränken. Es befaßt sich mit allen Hindernissen, die der überkommene Standort Deutschland dem Kapital so in den Weg legt oder noch nicht beseitigt hat – daheim und auswärts. Als hätte es für diesen Staat nie einen Grund dafür gegeben, das eine oder andere Geschäft auf seine „Nebenwirkungen“ hin zu überprüfen und nur unter gewissen Auflagen zuzulassen, wimmelt es im deutschen Zukunftsentwurf nur so von „Deregulierungs“anträgen: Auf gut deutsch heißt das dann „Vereinfachung für Genehmigungsanforderungen“, „Aufhebung von Prüfungspflichten“ („nach dem Chemikaliengesetz“), „Verkürzung der Genehmigung“ („für gentechnische Arbeiten“), „Abschaffung besonderer restriktiver staatlicher Genehmigungsvorbehalte“ („bei Leitungen und Kraftwerken“) – und auch die „Aufhebung des Ladenschlußgesetzes“ ist ein mutiger Akt des Staates, der niemanden mehr beim Gewinnemachen beschränken will.
Daß diese Regierung sich selbst im Besitz einer Staatsmacht wähnt, die über die Maßen Kosten bereitet und sich auch sonst geschäftsschädigend bemerkbar macht, heißt nicht, daß sie nicht auch noch andere Schranken deutschen Wachstums kennt. Auch die versteht das Rexrodt-Papier locker unter die Rubrik der Fehler einzuordnen, die schleunigst abgestellt gehören – auch wenn diese Schranken in Gestalt von konkurrierenden Geschäftsinteressen und Souveränen auftreten. Die ausdrücklich das Ausland betreffenden Punkte der deutschen Standortzukunft verwandeln den Imperialismus, der mit dem Recht auf DM-Profit seinen Erfolg als Weg aus der Krise anmeldet, in diplomatische Versäumnisse. Da ist die Rede von der „internationalen Zusammenarbeit, um Energiebezüge aus dem Ausland zu sichern“, vom „erfolgreichen Abschluß der Uruguay-Runde des GATT“ – und ohne den „flächendeckenden Ausbau des Netzes der Außenhandelskammern im südost-asiatischen Raum“ geht die Zukunft Deutschlands schon gar nicht.
9. Der Radikalismus, mit dem die Bundesregierung den Umbau der „sozialen Marktwirtschaft“ vornimmt, die zuvor von allen Kanzlern und Sozialkundebüchern als das Modell eines ebenso geläuterten wie erfolgreichen Kapitalismus gepriesen wurde, verdankt sich einem Umkehrschluß. Von jahrzehntelangen Erfolgen verwöhnt und daran gewöhnt, daß die Bedürfnisse und Erträge des Geschäfts aufs Erfreulichste mit den Anliegen der Staatsführung zusammengehen, weil sie ihnen immerzu Mittel der politischen Macht erwirtschaften, leiten Politiker in der Krise ihr unverbrüchliches Recht auf die staatsdienlichen Leistungen des „Marktes“ ab. In ihren DM-Bilanzen, in der mit ihnen eröffneten Freiheit zur Finanzierung aller Staatsvorhaben, im durch sie gewachsenen „Gewicht“ in der Staatenwelt fanden sie die Bestätigung dafür, daß sie gut regiert hatten. Die „Härte“ und „Stabilität“ der DM – das ist zum Inbegriff der Leistungen geworden, die den Standort Deutschland auszeichnen. Und soviel stimmt ja auch daran: Im soliden Geldwesen, dem Produkt der gelungenen Akkumulation, faßt sich die ökonomische Potenz der Nation zusammen. Das Umgekehrte allerdings stimmt nicht. Die „Konsolidierung“ des Staatshaushalts, das Sparen der einen Ausgaben, die Umverteilung anderer und die Bereitstellung „unproduktiver“ Staatsausgaben für das Geschäft sind kein verläßliches Instrument, das erwünschte Wachstum herbeizuführen.
Einige nicht zu übersehende Wirkungen hat der neue Umgang des Staates mit seinem Geld schon – mit den Absichten der Regierung sind sie jedoch nicht zu verwechseln.
a) Mit der „Rettung des Sozialstaats“ und der Senkung des Lohnniveaus in der ganzen Nation schafft es diese Regierung ganz bestimmt, ganz vielen Leuten ein ärmliches Dasein aufzuerlegen. Es mag sogar sein, daß die Bereitschaft, für einen Hungerlohn jeden Dienst zu verrichten, zunimmt – was aber wenig nützt, solange keine Gelegenheit dazu besteht. Ein niedriger Preis der Arbeit ist sicher eine bessere Bedingung für den Profit, aber noch lange kein Grund, massenhaft billige Arbeitskräfte anzuheuern und loszulegen. Die Rechnungen der Kapitalisten gehen doch etwas anders, und während die Regierung ein geschlagenes Jahr vom Beginn des Aufschwungs redet, wickelt die Geschäftswelt ihre Kapitalentwertung ab, zelebriert Massenentlassungen und weist auch die Regierung darauf hin, daß es zu einer Wiederverwendung der meisten auch dereinst im Aufschwung nicht kommen wird. Am Zuwachs von Sozialfällen wird dem Staat schon jetzt außer dem Zwang zum Sparen in dieser Abteilung seines Haushalts nichts klar. Die Wahrnehmung der anderen Konsequenz der Krise – wenn es wieder ein Wachstum gibt, wird es sich in niedrigerem Umfang abspielen als zuvor – steht noch an.
b) Vorerst geht man in Regierungskreisen davon aus, die Masse tätigen Kapitals durch die Privatisierung vermehren zu können. Dabei wird ohne Umschweife eingestanden, daß die Schulden der „Zuschußunternehmen“ natürlich nicht den Eigentümer wechseln, sondern vom Staat behalten werden – und ein bißchen vermehrt dazu. Denn ihm obliegt es, die „Wirtschaftlichkeit“ der Unternehmen herzustellen, die bisherige Staatsfunktionen mit Gewinn verrichten sollen. Daß der Gewinn des öfteren in Konflikt mit der Funktion gerät, wie sie von der übrigen Geschäftswelt gebraucht und vom Staat gewünscht wird, ist bekannt und kostet manche Milliarde, die dann aber einen Profit subventioniert. Gehen tut da sicher alles – nur bringt es keine „Konsolidierung“ der Staatsfinanzen zustande. Das „Duale System Deutschland“ – im Vergleich zur Bundesbahn eine klein dimensionierte Affäre – ist so ein Fall der „marktwirtschaftlichen Erledigung“ von Aufgaben, an denen dem Staat gelegen ist.
c) Dieselbe Rücksichtslosigkeit gegen die Gründe, die die Bereitstellung allgemeiner Produktionsbedingungen wie des Verkehrswesens durch die öffentliche Hand bewirkt haben, zeitigt der abstrakte Standpunkt des staatlichen Geldwesens auf dem Feld der Aufsicht – über eine Geschäftswelt, die wegen ihrer Kalkulationen manches zerstört, was gebraucht wird. Daß aus der „Umwelt“ entweder ein Geschäftszweig wird oder eine Behinderung des Profits, bildet das Grunddogma einer Regierung, die sich vom ökologischen Gemurmel immerhin die Einsicht abgeholt hat, daß bisweilen im Interesse des Funktionierens ihres Ladens etwas Schadensbegrenzung nottut. Katastrophenangst jedenfalls lassen sich die Zukunftssicherer des Standorts nicht nachsagen, wenn sie ihr Genehmigungswesen für eine unerträgliche Sünde wider die Natur des Kapitals halten.
Die Beseitigung der Schranken, die der Rest der Welt seiner Benützung durch den Standort Deutschland entgegensetzt, ist ein Programmpunkt, der dieselbe Entschlossenheit erkennen läßt. Mitten in der Krise, die das deutsche Geld – die Waffe des Standorts in der internationalen Konkurrenz – für die Verantwortlichen zum Sorgeobjekt Nr.1 werden läßt, setzt die Regierung auf die Erweiterung der Reichtumsquelle Weltmarkt. Unter Berufung auf die Verdienste vergangener Jahre, auf den Bestand an ökonomischer Macht, über den er verfügt, meldet dieser Staat sein Recht auf Außenhandelserfolge des Kalibers „gesicherte Energieversorgung“ an; er ist darauf aus, „auf einen Abbau von Marktzugangshemmnissen für Ausfuhren und Investitionen hinzuwirken“; mit der größten Selbstverständlichkeit beschließt er, mit seinem Standort nicht bloß die Konkurrenz auf dem (krisenbedingt kontrahierten) Weltmarkt bestehen zu wollen – er will auch bei der Festlegung der Konkurrenzbedingungen mitmischen. Und daß solche Leistungen nicht gerade durch die Überzeugungskraft des Arguments „Wir festigen gerade daheim die DM“ zustandekommen, wissen die Standortverwalter auch noch. Daß sich der Status Deutschlands „an der Außenpolitik“ entscheidet, sagt der Kanzler locker in einer Haushaltsdebatte auf – und spielt dabei auf die Bemühungen an, die Deutschland auf seinem Weg zur Weltmacht neben der Geldpolitik und für sie unternimmt.[2] Mit wem er sich da mit welchen Ansprüchen anlegt, sagt er nicht. Genausowenig rät sein Standort-Minister Rexrodt zur Vorsicht, wenn er deklamiert: „Das Rennen der Konkurrenz gegen uns ist noch nicht gelaufen.“
10. Bleiben noch rhetorische Fragen. Was stellt diese Nation an, wenn sie bemerkt, daß sie zwar den Standort Deutschland zu einer ziemlich unwirtlichen Gegend hinregieren kann, aber die Macht der DM ihren Dienst versagt? Überlebt bei einem Scheitern dieser Strategie der Krisenbewältigung der Fanatismus der Profitproduktion in Regierungskreisen? Hält sich die Überzeugung, daß international tätiges Kapital dem Standort Deutschland dient? Kann Demokratie noch mehr wagen?
[1] Dazu in diesem Heft der Artikel „Rechte Reformpolitik für den Standort Deutschland“
[2] Dazu in diesem Heft der Artikel „Imperialismus normal“.