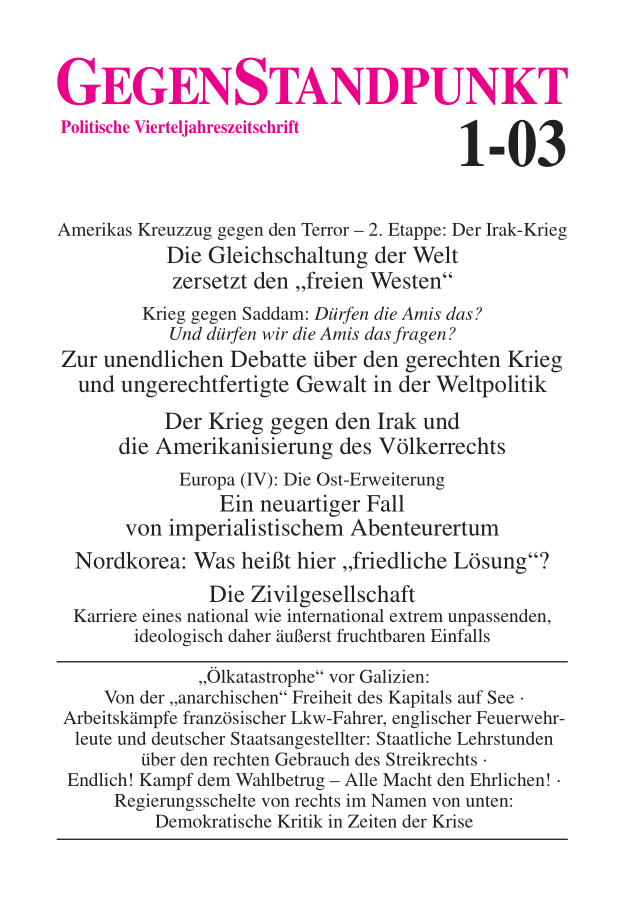Aus der Reihe „Chronik - kein Kommentar!“
Arbeitskämpfe französischer Lkw-Fahrer, englischer Feuerwehrleute und deutscher Staatsangestellter:
Staatliche Lehrstunden über den rechten Gebrauch des Streikrechts
Wenn die französischen Fahrer 9% mehr Lohn für die nächsten drei Jahre und ein dreizehntes Monatsgehalt als kleine Kompensation der gelaufenen Preiserhöhungen verlangen, vermag die Grande Nation daran absolut nichts Positives für sich zu entdecken. Wenn die britischen Feuerwehrleute aus den erbrachten Leistungen ein Argument für sich zu machen suchen und glatt 39% mehr Lohn anpeilen, dann kann auch der englische Staat sie überhaupt nicht mehr leiden. Der deutsche Staat ist mit seinen Beamten und Angestellten im Öffentlichen Dienst nicht erst dann unzufrieden, wenn sie lohnfordernd und warnstreikend unterwegs sind.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Arbeitskämpfe französischer
Lkw-Fahrer, englischer Feuerwehrleute und deutscher
Staatsangestellter:
Staatliche Lehrstunden über den
rechten Gebrauch des Streikrechts
„Der Streik darf nicht gegen das Prinzip der fairen Kampfführung verstoßen, zu dem insbesondere das Unterbleiben von Gewaltandrohungen und -anwendungen gehört.“ (Gablers Wirtschaftslexikon, 1988, S.1795)
Frankreich: Ein tolerierter Streik – eine verbotene Blockade
So mag der französische Staat seine Lkw-Fahrer: Wenn sie unterwegs auf den Straßen sind und just in time anliefern und abholen, was das produzierende kapitalistische Gewerbe so alles für seinen möglichst stockungsfreien Produktions- und Verwertungsprozess braucht. Damit sie dabei auch die LKW ihrer Unternehmer ordentlich – möglichst rund um die Uhr – auslasten, achtet er mit Regelungen in Bezug auf Fahrzeit und Ruhepausen auf ihre Gesundheit, und wenn dann die Kapitäne der Landstraße ihren Sekundenschlaf so hinkriegen, dass sich ihre Unfallstatistik im Rahmen des leider nun mal Unvermeidlichen hält, haben sie ihren Beitrag zum nationalen Wirtschaftswachstum geleistet. So kommen auch die etwas raubeinigen Routiers in den Rang eines ehrenwerten und geschätzten nationalen Berufsstandes.
Auch in Lohnfragen kann der französische Staat seine
Fahrer gut leiden. Mit ihrem Einkommen, bei dem
zwischen der höchsten Lohnstufe und dem gesetzlichen
Mindestlohn Smic ein Abstand von 10% besteht
(Libération, 25.11.), sind
sie nicht nur für ihre kapitalistischen Anwender eine
Kost, die sich für sie lohnt. Von ihrem Verdienten führen
sie auch brav Steuern und Beiträge an die staatlichen
Renten-, Krankenversicherungs- usw. -kassen ab, und mit
dem Rest, der ihnen dann noch bleibt, gelingt es dieser
Berufsgruppe glatt noch, ein standesgemäßes Leben etwas
über dem Existenzminimum zu führen, ohne dem Staat als
arbeitende Sozialfälle lästig auf der Tasche zu liegen.
Dafür verdienen die Brummi-Chauffeure allen staatlichen
Respekt.
Deswegen hat der französische Staat gar kein Verständnis dafür, wenn sie, vertreten durch ihre Gewerkschaften, an diesem Verhältnis von Lohn und Leistung, das für alle national-ökonomischen Belange so zufriedenstellend geregelt ist, etwas zu ihren eigenen Gunsten verschieben wollen. Wenn die Fahrer 9% mehr Lohn für die nächsten drei Jahre und ein dreizehntes Monatsgehalt als kleine Kompensation der gelaufenen Preiserhöhungen verlangen, vermag die Grande Nation daran absolut nichts Positives für sich zu entdecken. Für sich nicht, und schon gleich nicht für ihre im Transportgewerbe tätigen Kapitalisten, denen die bescheidene Anhebung des Lebensstandards ihrer Routiers doch nur überflüssige Zusatzkosten beschert – wo sie es doch schon schwer genug haben, sich mit den Billig-Löhnen ihres fahrenden Personals auf dem europäischen Transportmarkt zu behaupten.
Doch auch wenn die französische Staatsgewalt der Lohnforderung nichts abgewinnen kann: Die Fahrer haben, wie alle abhängig Beschäftigten, ein Recht, ihrer Forderung auch mit Arbeitskampfmaßnahmen Nachdruck zu verleihen. Das ist staatlich verbrieft, und daran hält sich die Politik auch in diesem Fall. Sie setzt dabei auf die Produktivkraft ihres Streikrechts, nämlich darauf, dass das Kräfteverhältnis zwischen beiden Parteien die Tarifauseinandersetzung schon zügig und mit eindeutigem Ausgang beenden wird, stehen sich doch in der zwei sehr ungleiche Partner gegenüber: Auf der einen Seite die, die vom Steuern von Lkws ihren Lebensunterhalt bestreiten müssen; und auf der anderen die, denen die Fahrzeuge gehören und die von der erpresserischen Wucht ihres Eigentums nötigenfalls auch mit der Auswechslung ihres streikenden Personals Gebrauch machen können.
Mit der staatlichen Duldung der Arbeitsniederlegung ist
es aber ganz schnell vorbei, wenn sich die
Fahrergewerkschaften ihrerseits als Macht aufstellen,
sich anschicken, den Verkehr an zentralen nationalen
Autobahndrehkreuzen lahm zu legen und die nationale
Spritversorgung durch Blockaden der großen Raffinerien
und Benzindepots auszutrocknen. Dafür ist das Streikrecht
definitiv nicht vorgesehen. Wo die Fahrer sich zu einer
kollektiven Macht aufbauen wollen und zur Blockade des
gesamten nationalen Transport- und Verkehrswesens
übergehen, wird von Staats wegen klargestellt, was beim
Streiken erlaubt und was verboten ist: Streik ja,
Blockade nein!
, heißt die hoheitliche Scheidelinie,
mit der die Regierung klarstellt, dass ein Streik im Land
nichts groß durcheinander zu bringen hat. Das nachhaltige
Sperren strategischer Punkte
wird unter Strafe
gestellt, die Fahrergewerkschaften erhalten die Auflage,
die Autobahnen allenfalls einspurig, am besten gleich am
Straßenrand zu bestreiken. Vorübergehend den Dienst am
fremden Eigentum einstellen dürfen sie, das ist gleichsam
ihre Privatsache. Aber den Konflikt mit ihren
Arbeitgebern zu verallgemeinern; den Klassengegensatz,
auf dem er beruht, einmal andersherum zur öffentlichen
Angelegenheit zu machen und ihre Macht zur Behinderung
des gewohnten kapitalistischen Geschäftslebens in der
Nation zur Durchsetzung ihres Interesses verwenden: Das
dürfen sie nicht. Da muss die Staatsmacht ihnen gegenüber
schon darauf bestehen, dass die Anliegen der
Allgemeinheit, die im allerhöchsten staatlich-rechtlichen
Schutzobjekt der ‚öffentlichen Ordnung‘ zusammengefasst
sind, ein wenig höher zu bewerten sind als ihr privates
Interesse an einem etwas besseren Leben. Ihre
‚Ordnung‘ sieht die Staatsmacht in Verkehrsblockaden
gestört, von den Streikenden also unmittelbar
selbst betroffen und dazu herausgefordert, für
ein störungsfreies öffentliches Leben auch bei
Arbeitskämpfen zu sorgen. Eine gelungene Unterscheidung,
auf der die fürs „Allgemeinwohl“ Zuständigen da bestehen:
Die organisierte Interessenvertretung der kollektiven
Gewerkschaftsmacht gegen das Kapital soll erlaubt sein
und bleiben, darf aber die Belange der Allgemeinheit
nicht stören. Das dürfte in einer Gesellschaft, deren
allgemeine Belange ein einziges Anhängsel des
Geschäftserfolgs ihrer Kapitalisten sind, schwer zu haben
sein. Aber mit Gewalt durchsetzen lässt sich diese feine
Unterscheidung bei Bedarf allemal, und den Respekt vor
der öffentlichen Ordnung bringt der französische Staat
dann dem streikenden Fuhrpersonal entsprechend bei – und
bricht damit der gewerkschaftlichen Gegenmacht gegen die
des Kapitals von vorneherein die Spitze. Zu der Einsicht,
dass Routiers beim Streiken allenfalls das Recht auf
Demonstration ihrer Unzufriedenheit genießen, und auch
das nur, wenn die sich in einem belanglosen Verkehrsstau
kundtut, verhilft die demonstrative Mobilisierung des
staatlichen Gewaltapparats: Das Transportministerium
postiert Räumfahrzeuge an den strategischen
Autobahnkreuzen, die Polizei kratzt uneinsichtigen
Brummi-Fahrern die TÜV-Plaketten ab und kassiert ihre
Führerscheine. Das entfaltet schnell die angestrebte
erzieherische Wirkung und spaltet die Gewerkschaften. Die
vier kleineren akzeptieren das Angebot der Unternehmer –
2 ½ Prozent über dem Mindestlohn –, der Arbeitskampf
bricht zusammen, und eine geschichtsbewusste
Öffentlichkeit weiß von einer historischen
Tarifunterschrift
zu berichten. Denn die kommt
wundersamer Weise zustande, ohne dass auch
nur einen einzigen Tag
gestreikt wird. (Libération, 25.11.).
England: Arbeitskampf ja – politischer Streik nein!
Auch die britische Regierung lässt auf ihre proletarische
Klasse nichts kommen. Ihre Feuerwehrleute stehen im
nationalen Dienst, passen rund um die Uhr darauf auf,
dass im Vereinigten Königreich nichts groß anbrennt. Sie
sind flexibel einsetzbar, passen sich willig den
Arbeitsumständen an und machen aus allem das Beste –
zwischen den Schichten gibt es lange Freizeiten, die
etliche Feuerwehrleute nutzen, um sich als Taxifahrer
oder Handwerker ein Zubrot zu verdienen
. (FAZ, 23.11.) Ihr Lohn, von dem niemand
behaupten mag, man könne mit ihm große Sprünge machen –
es ist unmöglich, von den durchschnittlichen 21.500 £
der Feuerwehrleute in London zu leben
(Guardian 3.12.) –, belastet die Städte-
und Gemeindekassen nicht übermäßig, und dennoch ist auf
das Ethos dieser Feuerlöscher – Motto: Trust the
Professionals
– unbedingt Verlass:
Verantwortungsbewusst und professionell haben sie eine in
den letzten zwei Jahrzehnten ums Doppelte gewachsene Zahl
von Notrufen mit einer verringerten Zahl von
Beschäftigten bewältigt und seit 25 Jahren keinen
Lohnkampf mehr geführt. So mag der staatliche Arbeitgeber
sein Personal.
Wenn allerdings die Feuerwehrleute den Spieß umdrehen, aus den erbrachten Leistungen ein Argument für sich zu machen suchen und glatt 39% mehr Lohn anpeilen – „den Feuerwehrleuten und den Beschäftigten in den Notrufzentralen sollte ein beträchtlicher Lohnzuwachs zuerkannt werden in Anerkennung der substantiellen Modernisierung (so höflich sind sie zu den duldsam hingenommen Rationalisierungen der letzten 25 Jahre!), die schon stattgefunden hat“ (www.fbu.org.uk 5.12.) –, dann kann der Staat sie überhaupt nicht mehr leiden. Es mag ja noch angehen, dass die Feuerwehr ein bisschen mehr Lohn will – aber gleich 39 Prozent! Dafür sind Lohnrunden nicht gedacht. Den Antrag, für die professionelle Verhinderung und Bewältigung von Feuer und Notfällen so viel mehr zahlen zu sollen, hält der öffentliche Arbeitgeber für unsittlich – und schon gleich, wenn die Feuerwehrleute ihn auch noch unter Druck setzen und den nationalen Schutzdienst für Land, Leute und Eigentum, für den sie angestellt sind, in einem Warnstreik in Frage stellen: Das setzt ihrer Verantwortungslosigkeit die Krone auf!
Es nützt den guten Feuerwehrleuten überhaupt nichts, dass
sie noch im Streik ihrem Dienstverständnis treu bleiben
und wegen möglicher Opfer moralische Skrupel hegen –
viele Feuerwehrleute unterbrachen in Notfällen ihren
Streik in der vergangenen Woche
(FAZ, 23.11.). Was die Unversehrtheit von
Person und Eigentum betrifft, ist ihr Staat um einiges
risikofreudiger als sie – und eskaliert die
Streiksituation. Er macht ein wenig mobil,
zwangsverpflichtet Teilzeitkräfte der Feuerwehren,
Fachkräfte für Kellerüberschwemmungen u.Ä., kommandiert
seine militärischen Feuerwehreinheiten zum zivilen
Löschen ab und verschafft sich so mit seinen hoheitlichen
Mitteln die Streikbrecher, die den gewerkschaftlichen
Ausstand wirkungslos machen. So bekommen die
Feuerwehrleute vorgeführt, wie wenig das auch vom
englischen Staat gewährte Streikrecht als Waffe im Kampf
um Lohn taugt: Der staatliche Arbeitgeber, den sie mit
ihrer Arbeitsniederlegung beeindrucken müssen, dreht den
Spieß um und setzt sie mit einem kleinen Griff ins
Arsenal der ihm zu Gebote stehenden Machtmittel unter
Druck. Dem beugt sich die Fire Brigade Union dann auch
und schließt mit den kommunalen Arbeitgeber eine 16%
Lohnerhöhung für zwei Jahre ab.
Damit ist der Fall aber nicht erledigt. Über das Ende des
Streiks und seinen moderaten Abschluss kommt an politisch
maßgeblicher Stelle keine Freude auf. Im Gegenteil, man
ist hochgradig empört, denn ebenso wenig wie fordernde
und streikende Feuerwehrleute kann die staatliche
Zentralgewalt untere Behörden leiden, die sich in
Lohnauseinandersetzungen mit der FBU viel zu schnell
arrangieren. Also wird der Abschluss von höherer Stelle
wieder kassiert, und Blair, der eben mal – neben der
laufenden Kriegsvorbereitung im Irak – 19.000 Soldaten
und 1000 Löschfahrzeuge zum Streikbrechen abkommandiert
hat, erklärt sich und seinen Staat zum Opfer
eines gar nicht mehr zu fassenden Unrechts: Wenn diese
Leute glauben, dass die Regierung und das Land durch
einen Streik in Geiselhaft genommen werden können und
durch unbezahlbare, unausgegorene nächtliche
Vorschläge
– gemeint sind die 16% – erschüttert
werden können, die nichts oder nur wenig an
Modernisierung beinhalten – Vorschläge, die auf den
ersten Blick das Finanzministerium Hunderte von Millionen
Pfund kosten –, dann leben sie nicht in der wirklichen
Welt
(Sunday Times,
24.11.).
Offen bekennt sich der englische Klassenstaat dazu, dass
das seiner working class gewährte Recht, Lohn fordern und
zur Durchsetzung der Forderung auch streiken zu dürfen,
wieder aus dem Verkehr gezogen wird, wenn es ihm opportun
erscheint. Er führt seinen Feuerwehrleuten vor, was es
heißt, ökonomisch von einem Arbeitgeber abhängig zu sein,
der die Mittel einer Staatsgewalt hat: Wenn er es so
will, dann ist ein Streik einfach nicht aus der
wirklichen Welt
. Wenn er am Lohn seiner
Dienstleute zu einem radikalen Schnitt entschlossen ist,
haben die ihr Recht verwirkt, mit Streik mehr Lohn zu
erpressen – das Recht zur Erpressung steht nur einer
Seite zu, nämlich dem Staat: 11% Gehaltssteigerung für 3
Jahre setzt die Regierung fest, und das auch nur dann,
wenn die Gewerkschaft der Gehaltskürzung von ein paar
Tausenden Entlassener sowie der Verschärfung der
Schichtarbeitsbedingungen zustimmt. Dieser Rigorismus der
Regierungspartei ist richtungsweisend, und die
konservative Opposition schlägt präventiv gleich generell
ein Streikverbot für Feuerwehrleute vor – nur so würde
aus einer Idiotenbande
und Schande für unser
Land
(so der Sprecher der
Konservativen) wieder ein ehrenwerter nationaler
Berufsstand.
Deutsche Tarifauseinandersetzung: Eine „Nullrunde“ und eine „3 vor dem Komma“ ergeben den Kompromiss von 4,4% mehr Lohn.
Mit seinen Beamten und Angestellten im Öffentlichen Dienst ist der deutsche Staat nicht erst dann unzufrieden, wenn sie lohnfordernd und warnstreikend unterwegs sind. Sein Missvergnügen an ihnen beginnt bereits, wenn er an ihre Arbeitsleistung denkt. Gerade mal durchschnittlich 38,5 Stunden im Westen und 40 im Osten stehen sie ihm zur Verfügung, was einfach viel zu kurz ist, wie auch die Arbeitszeitregelungen viel zu starr, zu unflexibel – kurz: einfach unzeitgemäß und extrem reformbedürftig sind. Zudem kosten die Staatsdiener auch noch entschieden zu viel. Auf 80 Milliarden beziffern sich die Personalausgaben von Bund, Ländern und Gemeinden, und allein schon diese Summe überzeugt ganze Talkshows davon, dass der öffentliche Dienst ein unhaltbarer Zustand in der Nation ist und der menschliche Faktor in der staatlichen Verwaltung gründlich verbilligt gehört. Und was dem Fass den Boden ausschlägt: All diese unhaltbaren Zustände sind auch noch geltendes (Tarif)Recht, also in einem Rechtsstaat nicht einfach abzuschaffen, binden betrüblicherweise nicht nur die Beschäftigten, sondern tatsächlich auch den staatlichen Dienstherren.
Deswegen kann der Staat es schon gleich nicht leiden,
wenn die für die öffentlichen Dienstleute zuständige
Gewerkschaft Verdi eine tarifliche Lohnerhöhung anstrebt,
wie sie sich die Beschäftigten in fast allen anderen
Branchen schon im Frühjahr und Sommer erkämpft haben –
deutlich mehr als drei Prozent
, sich für die
längst überfällige Angleichung der Ostlöhne und
-einkommen an das Westniveau bis 2007
(verdi-publik.de, 18.12.) stark macht und
dafür auch noch Warnstreiks organisiert. Das ist für den
herrschenden politischen Zeitgeist schlicht unerhört. Die
‚leeren Kassen‘, auf die der Staat verweist, sollen ja
nicht zur Nachfrage ermuntern, wer die denn
leert und wozu – der Staat ist es ja schon
selbst, der in den Angelegenheiten seiner
Haushaltsführung hoheitlich beschließt,
wofür er seine Mittel einnimmt und ausgibt. Der
allerdings beruft sich auf seine krisenbedingt knappen
Mittel, um aus ihnen den unbedingten ‚Sachzwang‘ zur
steuerlichen Pflege des kapitalistischen Wachstums
herzuleiten – und umgekehrt das genauso unbedingte Gebot,
seine Haushalte auf Kosten aller sog. ‚unproduktiven‘,
also sozialen Ausgaben zu sanieren. Und da ausgerechnet
fordern seine Angestellten, an denen er zuallererst zu
sparen gedenkt, mehr Lohn – sie, die einen
gesicherten, quasi unkündbaren Arbeitsplatz beim Staat,
also gar kein Recht auf eine Lohnerhöhung haben,
weil sie ja schon mit der Gnade, überhaupt einen
Lohn zu haben, mehr als gut genug bedient sind.
Andererseits weiß der Staat schon, was er an einer
Gewerkschaft wie Verdi hat. Klar, verglichen mit einer
Nullrunde sind 3% exakt 3% zu viel, aber ein gewisses
Augenmaß ist der Forderung ja auch nicht abzusprechen:
Wirklich nur mit dem, was in der Privatwirtschaft an
Tarifabschlüssen am Ende herausgekommen ist, steigt Verdi
als Forderung in die Tarifverhandlungen ein, und nicht
nur das. Der gewerkschaftliche „Realismus“, der auf
das übliche Ritual verzichtet und eine ehrliche
Lohnforderung auf den Tisch gelegt
hat (Homepage Verdi, 17.12.), gibt nicht nur
zu verstehen, was die vielen gewerkschaftlichen
Berechtigungstitel für einen fälligen Lohnzuwachs –
‚Massenkaufkraft‘, ‚Produktivitätszuwachs‘,
‚Preissteigerungsrate‘… – schon immer waren:
Verzichtbares Beiwerk eines Rituals
. Wenn sie
jetzt ganz offiziell für überflüssig erklärt und aus dem
Verkehr gezogen werden, dann stellt die Gewerkschaft
damit auch klar, dass sie bei ihren Lohnverhandlungen
nicht mehr als Vertreter von Ansprüchen
unterwegs ist: Ehrliche
Lohnforderungen sind
solche, die die Titel einer höheren Berechtigung
für ein wenig mehr Entgelt nicht mehr zu strapazieren
brauchen, weil sie sich erfolgreich von der Auffassung
verabschiedet haben, von denen, die vom Lohn zu leben
haben, hätte irgendeiner ein irgendwie begründbares
Anrecht auf mehr Lohn. Stattdessen herrscht
zwischen den Partnern des Tarifvertrags Konsens darüber,
dass eine Erhöhung von Lohnzahlungen das Recht auf
Maßnahmen einer erfolgreichen Gegenfinanzierung
begründet, es den Arbeitgeber also nichts kosten
darf, wenn er seinen Dienstkräften mehr Geld
überweist, und diese neue tarifpolitische Vernunft
entgeht dem Kontrahenten von Verdi nicht. Der staatliche
Arbeitgeber lässt sich zum Verhandeln herbei, nicht ohne
auch das noch als ein einziges Zugeständnis zu
deklarieren: Nach seinem Verständnis ist die Gewerkschaft
ihm einfach nur unbedingten Respekt vor den Nöten seines
Haushalts schuldig und hat allenfalls mit ihm um eine
Null vor dem Komma zu verhandeln. Und so kommt es zu echt
substantiellen Verhandlungen
wie aus dem
Sozialkunde-Lehrbuch: Jede Seite tritt mit ihren
Forderungen an – die Nullrunde
steht gegen die
3%-Forderung
–, bei denen man in harten
Nachtsitzungen, scheiternden Gesprächen und
Schlichterspruch die gerechte Mitte sucht und schließlich
einen genialen Abschluss findet, der ein echter
Kompromiss ist und beiden Seiten Recht gibt: Verdi
bekommt nicht nur die geforderten 3%, nein, die
Gewerkschaft darf sich öffentlich und vom staatlichen
Verhandlungsführer unwidersprochen 4,4 Prozent als ihren
Erfolg gut schreiben. So viel Entgegenkommen bei der
gewerkschaftlichen Selbstdarstellung ist dem obersten
staatlichen Verhandlungsführer Schily der Tarifabschluss
allemal wert. Die große Zahl erschlägt nämlich ziemlich
gründlich jedes Bedürfnis nach einer Gegenprobe für die
wundersame Rechnung, bei der sich 2,4% mehr Lohn für
dieses Jahr, ein Prozent mehr für ein halbes nächstes
Jahr und nochmals ein Prozent bis zum 31. 1. 2005 zu 4,4%
Lohnsteigerung addieren. Und sie deckt auch erfolgreich
zu, was sich der staatliche Arbeitgeber an erfolgreicher
‚Gegenfinanzierung‘ hat genehmigen lassen: Die
öffentlichen Arbeitgeber haben mit einer fast
zweieinhalbjährigen Laufzeit „Planungssicherheit“ – also
alle nötigen Freiheiten ihres kalkulatorischen Umgangs
mit ihren Beschäftigten. In den Genuss der 2,4% für 2003
gelangen nur die unteren Lohngruppen ab Januar – für alle
anderen beginnt der Zuwachs ab April. Zuwendungen bleiben
bis 2005 eingefroren
. Bei Aufstieg in die nächste
Lebensalter- oder Lohnstufe fällig werdende
Zusatzzahlungen werden für die Dauer eines Jahres
halbiert, Bezüge generell ab sofort erst am Ende des
Monats ausbezahlt. Die Tarifangleichung des Ostens
erfolgt erst bis Ende 2009, Einzahlungspflicht in die
Versicherungskassen besteht für die Arbeitnehmer dort
allerdings ab sofort – für je 1% Anpassung 0,2% des
Bruttoentgelts, usw. Und auch was die Arbeitszeit
betrifft, kann der Abschluss sich sehen lassen: Die
unerträglich kurze wöchentliche Regelarbeitszeit kann
bleiben, dafür arbeiten ab sofort alle 1 Tag im Jahr mehr
für Vater Staat.
Das sind schon neue Sitten bei Tarifverhandlungen. Der Tarifpartner Staat setzt durch, dass ein Lohnabschluss ihn im Resultat nicht nur keinen zusätzlichen Euro kosten darf, sondern auch noch eine Kostenentlastung staatlicher Haushalte garantieren muss. Der Lohn, den er seinen Beschäftigten zahlt, ist für ihn nicht das Entgelt für empfangene Arbeitsleistungen, sondern eine Geldausgabe, für die ihm die Kostgänger der Nation finanzielle Einsparungen schuldig sind, und das sieht nicht nur er so, sondern auch der Verein, der für die Vertretung der Interessen der Staatsdiener zuständig ist. So wäscht eine öffentliche Hand die andere.
*
Dass es um die ‚soziale Lage‘ französischer Lkw-Fahrer,
englischer Feuerwehren oder deutscher Staatsbediensteter
irgendwie gut bestellt wäre, will in der jeweiligen
demokratischen Öffentlichkeit niemand behaupten. Im
Gegenteil: Es hat sich eingebürgert, mit ausgiebiger
Berichterstattung ganz verständnisvoll auf die besonders
schweren Lebensumstände einzugehen, die diese Abteilungen
des europäischen Proletariats zu ertragen haben, und dass
sie da – sogar mit Streik! – ein wenig auf Abhilfe
sinnen, kann man durchaus nachempfinden. Und genau diese
einfühlende Tour, mit der man für die Belange besonders
Betroffener ein wenig Verständnis entwickelt, ist eine
einzige Absage an alle Formen einer proletarischen
Gegenwehr. Die Einfühlung in die Nöte, die man als
abhängig Beschäftigter in diesen Branchen auszuhalten
hat, will ja von deren im Beschäftigungsverhältnis
selbst beschlossenen Notwendigkeit nichts
wissen: Um Abweichungen vom Regelfall, um Fälle nur
besonderer proletarischer Betroffenheit soll es sich
dabei handeln. Entsprechend gilt das Verständnis für ein
bisschen Aufbegehren auch nicht dem Interesse an
Verbesserung einer Lebenslage in ihrer Allgemeinheit –
die ist so allgemein, branchen- und
berufsgruppenübergreifend, weil in jedem einzelnen Fall
nur Resultat einer Kalkulation der Arbeitskraft nach dem
Gesichtspunkt ihrer lohnenden Anwendung –, sondern auch
nur in diesem speziellen Fall: Verstehen mag man allein
die Probleme, die ganz spezielle Minderheiten unter den
Lohnempfängern mit ihrem Lebensunterhalt haben,
Lkw-Fahrer in Frankreich, Feuerwehrleute in London,
Krankenschwestern und Polizisten in deutschen Großstädten
eben. Die haben es schwer – im Unterschied wohl
zu allen anderen, die deren besondere Notlagen
nicht und daher auch keinen Grund zu
Klagen haben! Daher sind diese proletarischen Sonderfälle
mitsamt ihrem Elend auch kein Thema mehr, wenn sich
alles, was sie an Maßnahmen zur Verbesserung ihrer Lage
probieren, sang- und klanglos in Nichts auflöst. Der so
mitfühlenden europäischen Öffentlichkeit zeigt das
keineswegs, dass im Kapitalismus der Lebensunterhalt der
arbeitenden Klasse eben eine pure Machtfrage und
sonst nichts ist, die arbeitende Klasse, wenn sie sich
ein wenig besser stellen will, ihre Dienste eben
aufkündigen und die Machtprobe gegen ihren Gegner für
sich entscheiden muss. Nein, an den Streikbemühungen und
deren kläglichem Scheitern bewahrheitet sich nur, dass es
hoffnungslose Minderheiten sind und bleiben, die sich da
aufzustellen versucht haben, und Streiken außer ‚Schaden
für alle‘ nichts bringt. So führt das Mitleid, das ihrer
schweren Lage
gilt, zielstrebig zu der Einsicht,
dass an der nichts zu ändern ist, und ihre ohnmächtigen
Versuche, dies dennoch zu tun, bekräftigen bloß die
Ohnmacht, die zu ihrer Lebenslage nun einmal dazu gehört.