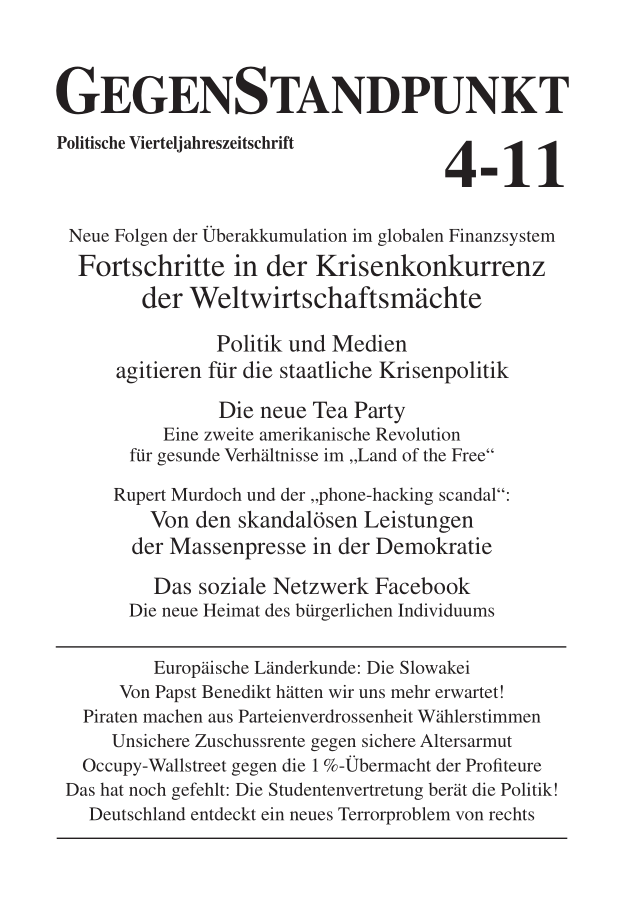Das soziale Netzwerk Facebook
Die neue Heimat des bürgerlichen Individuums
Mitten in der Krise boomt dagegen das soziale Netzwerk Facebook. Bei seinen Mitgliedern extrem beliebt, von der Finanzwelt als Unternehmen auf 100 Milliarden wertgeschätzt, wird diesem privaten Kommunikationswesen sogar höchst politische Wirksamkeit zugute gehalten: Die ‚Facebook-Generation‘ soll gleichnamige Revolutionen im arabischen Raum angezettelt und so die Demokratie in der Welt vorangebracht haben. Aufklärung über das ‚Phänomen‘ Facebook ist also am Platz.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Siehe auch
Systematischer Katalog
Gliederung
Das soziale Netzwerk Facebook
Die neue Heimat des bürgerlichen Individuums
Bei seinen Mitgliedern ist das soziale Netzwerk Facebook extrem beliebt: 800 Millionen weltweit registrierte User hacken sich die Finger wund und machen die Website zu einer der meistbesuchten im Netz. Nicht weniger gefragt ist das Unternehmen Facebook bei der Finanzwelt: Hoffnungsvoll erwartet sie seinen Börsengang und schätzt seinen Wert schon mal auf 100 Milliarden US-Dollar.
Aber auch kritische Stimmen sind zu vernehmen: Politik und Öffentlichkeit prangern mangelnden Datenschutz an. Die deutsche Verbraucherschutzministerin löscht empört ihren Account, nicht ohne die User gleichzeitig zu einem verantwortungsvolleren Umgang mit ihren Datensätzen zu ermahnen.
Währenddessen soll die „Facebook-Generation“ gleichnamige Revolutionen im arabischen Raum angezettelt und so die Demokratie in der Welt ein gutes Stück weit vorangebracht haben. Dazu gratulieren die Piraten, die deutsche Netzpartei.
I. Der User als öffentliche Person: die real existierende Überzeichnung des bürgerlichen Konkurrenzsubjekts und Marktteilnehmers
1.
Zu welchem Zweck man die von Facebook im Netz installierte Plattform verwendet, bleibt im Prinzip ihrem Nutzer überlassen. Man kann sich ihrer als bloßes Medium der privaten Kommunikation bedienen oder als Mittel dafür, ein gemeinsames Interesse mit Gleichgesinnten zu pflegen. Ein so harmloser Ge–brauch der Website grenzt allerdings an ihren Missbrauch: Von den Facebook-Machern konzipiert und ausgestaltet ist sie für eine Veranstaltung anderer Art; und für die wird sie – von ihren Nutzern genau richtig verstanden – tagtäglich zigmillionenfach aufgerufen:
Schon mit der Erstellung seines Profils macht sich der User, Privatmensch, der er ist, programmatisch zur öffentlichen Person: Er nimmt sich die Freiheit, sich der Welt zu präsentieren. Er teilt mit, was immer er zur Darstellung seiner selbst für mitteilenswert hält: Alter, Beruf, Beziehungsstatus, familiäre Verhältnisse, Hobbies, Vorlieben, Abneigungen usw. Er ist so frei, all das von sich kundzutun, was nach seiner Einschätzung zur Herausarbeitung seiner Individualität beiträgt. Mit der gleichen Freiheit legt er fest, welchen Kreis seine Welt im Netz umfasst: die bereits gewonnen oder noch hinzukommenden virtuellen friends oder gleich die ganze, den Erdball umspannende community? Nach Lage der Dinge letztere: Man will ja publik werden. So ist man, kaum dass man sich angemeldet hat, Teil des großen virtuellen Facebook-Universums. Allein die Möglichkeit, dass das Profil des Users von Millionen von Surfern angeklickt werden kann, ehrt seine Person – in denkbar abstrakter Form.
Dabei bleibt es nicht: Die öffentlich präparierte Individualität will betätigt und gewürdigt sein. Kommunikation steht an mit näheren und ferneren Bekannten in der virtuellen Gemeinde: Facebook ermöglicht es dir, mit den Menschen in deinem Leben in Verbindung zu treten und Inhalte mit diesen zu teilen.
(http://de-de.facebook.com). Genau darum geht es: auf der eigenen wie auf den Seiten anderer members werden Mitteilungen gepinnt, Meinungen und Standpunkte gepostet, Bildchen hoch geladen, events bekannt gemacht, die community zu Kommentaren zu alledem angeregt, Meldungen anderer geshared, ihrerseits mit einem like versehen oder mit Missfallen quittiert usf. Wo „Inhalte teilen“ Programm ist, kommt es auf den Inhalt des Mitgeteilten in dem Sinn nicht an: die – extrem beliebte – Bekanntgabe alltäglicher Nichtigkeiten hat für den User denselben Stellenwert wie die Kommentierung eines Promifehltritts oder einer AKW-Explosion; alles und jedes ist gleichermaßen dafür gut, beim virtuellen Publikum Aufmerksamkeit für sich zu erregen und ein feedback der community zu erzeugen; alles ist auf Adressatenseite dafür gut, als interessant goutiert oder wie auch immer kommentiert zu werden, also dafür, dem Mitteiler eine Würdigung zuteilwerden zu lassen. Der User hat es in der Hand zu bestimmen, was er der Welt aus seinem Leben mitteilt: es gibt kein privates Moment an ihm und keine öffentliche, von ihm zu der seinen gemachte Angelegenheit, die nicht für mitteilenswert gehalten werden könnte. Alle Interessen, Tätigkeiten, Befindlichkeiten und Meinungen haben in ihrer Beliebigkeit eine Qualität: sie sind Mittel dafür, das Ich abzubilden. Es geht um die öffentliche Ausarbeitung, Pflege und Würdigung von Persönlichkeit.
Dementsprechend nimmt der User die objektive Welt zur Kenntnis: Sie ist das Material seiner Selbstdarstellung und gilt ihm – von der Markteinführung eines neuen Turnschuhs bis zum letzten Merkel-Auftritt – als facettenreiches Angebot, zu dem sich zu stellen er sich immer wieder von Neuem die Freiheit nimmt. Daraus ergibt sich in aller Willkür, was überhaupt in sein Blickfeld gelangt und was unter welchem Aspekt für ihn von Bedeutung ist. Mit der Bekanntgabe, Zurkenntnisnahme und Kommentierung von allem, was der Netzwerker aus dem gesamten öffentlichen Raum für mitteilenswert und beurteilungswürdig hält, definiert er selbst den Umkreis seiner äußeren Welt und schafft sich zugleich unter tätiger Mithilfe all seiner Netzkollegen eine eigene, auf ihn und seinen Kosmos gemünzte Öffentlichkeit. Wo öffentliche Ereignisse aller Art zur Kennzeichnung der Person des Users dienen, kommen die sie beurteilenden statements und feedbacks über die Ebene des persönlichen Geschmacks nicht hinaus. Gut, dass Facebook dafür die passenden Kommunikationsformen bereithält. Am einfachsten ist es, mit einem like
bekannt zu geben, dass dieses oder jenes öffentliche Geschehen erstens für einen selbst bedeutsam ist und zweitens gefällt. Oder aber der User postet einen eindeutig kritischen Zweizeiler. Für die Pflege des Bewusstseins, Mittelpunkt der eigenen, selbst definierten Welt zu sein, reicht beides.
Das Bild, das man von sich im Netz kreiert, will nicht nur im dauerhaften Netzgeplapper gewürdigt sein. Nachzählbare Anerkennung erfährt man durch das gelungene Einwerben von friends. Auf potentielle Kandidaten stößt man beim Netz-Austausch mit seinesgleichen zur Genüge; oder man lässt sie sich nach höchstpersönlichen Kriterien von den Rechnern der Plattform vorschlagen. Hält man einen Netzkollegen für würdig, trägt man ihm die Freundschaft an; nimmt der das Angebot an, wird dem User zuteil, worauf sein ganzer Auftritt im Netz zielt: er wird praktisch als das gewürdigt, als was er sich begreift und darstellt: als Persönlichkeit. Vice versa freut sich sein Gegenüber darüber, der neuen Bande für wert befunden worden zu sein. Wenn sie wollen, können alle Beteiligten ihren Erfolg in Sachen Würdigung durch die community an einem höchst angemessenen Gradmesser ablesen: der an prominenter Stelle im Profil verzeichneten Anzahl von Freunden. Der Begriff von Freundschaft ist auf den Kopf gestellt: Nicht die Bewirtschaftung eines gemeinsamen Anliegens begründet sie; Facebook-Freunde macht der Zweck, Freunde sein zu wollen, zu solchen; darin besteht ihre Gemeinsamkeit. Diese Paradoxie wird bei Facebook programmatisch durchexerziert und angestachelt. Der Grund für dieses Bedürfnis ist dort nicht zu finden. Um das Werben um zwischenmenschliche Verbundenheit in solch abstrakter Form geht es von jeher, wenn Leute im Privaten nach Anerkennung verlangen. Ihr Umfeld wird für sie zum Publikum, dem man seine – wie auch immer – vortreffliche Persönlichkeit präsentiert, um es für sich zu gewinnen. Für diese Konkurrenz des bürgerlichen Individuums um Anerkennung liefert Facebook die perfekt rationalisierte, weltweite virtuelle Plattform. Und die Betreiber des Netzwerks werden in diesem Sinne nicht müde, immer angemessenere, also absurdere Formen der Kommunikation zwischen ihren Mitgliedern zu erfinden: Auf sich aufmerksam zu machen, geht auch über die regelmäßige Bekanntgabe der Koordinaten des höchstpersönlichen aktuellen Standorts auf dem Globus; oder durch poken – das virtuelle Anstupsen. Das ICH meldet seinen friends: „Ich bin’s, mich gibt’s, genau hier!“ Das hat ein „Echt cool!“ als Antwort verdient, immerhin wurde die Wortmeldung ja nicht irgendwem mitgeteilt...
Eine Schaltfläche verweigern die Facebook-Konstrukteure ihren Usern aber nach wie vor: den dislike
-Button. Der passe nicht zum grundguten Image des Netzwerks, das ein ausschließlich positives Lebensgefühl vermitteln will. Was die tatsächliche Nutzung ihrer Website angeht, liegen sie mit ihrem Harmonieideal freilich daneben: davon zeugen nicht nur die Millionen Mitglieder, die – natürlich auf der extra dafür eingerichteten Facebook-Seite – vehement die Einführung des „Bäh!“-Knopfes einfordern, sondern der total gängige Austausch gehässiger Kommentare über wen oder was auch immer bis hin zum programmatischen Fertigmachen anderer User durch massenhaftes posting und sharing herabwürdigender Inhalte
. Dabei handelt es sich nicht um unerklärliche Ausrutscher; Äußerungen solcher Art gehören in die Welt von Facebook: Am effektivsten kann man sich immer noch mit dem Herziehen über die Geschmacksverirrung oder Fehlleistung dieses Promis oder jenes Mitschülers wichtig machen – vorzugsweise in Gemeinschaft mit Gleichgesinnten. Es passt zusammen, dem einen Anerkennung zu spendieren und dem anderen die Ehre abzuschneiden: Dem Wettstreit um Respekt sind diese beiden Seiten eigen. Auch diese Konkurrenz kennt Gewinner und Verlierer.
Die Pflege des Bildes der eigenen, die Begutachtung und Würdigung der jeweils anderen Persönlichkeit, dieser Zirkel gegenseitiger Anerkennung eint die User zur community. Die Teilhabe an ihr kann man praktisch wahr und wirksam machen – nicht nur vor dem Bildschirm! Das Bedürfnis danach findet in seiner ganzen Abstraktheit die passende Form: Aktion, programmatisch ohne Sinn und Zweck: Die Beteiligten tauchen am vereinbarten Ort zur vereinbarten Zeit auf, um dort kurz und für die unwissenden Passanten völlig überraschend einer gänzlich sinn- und inhaltslosen Tätigkeit nachzugehen.
(http://de.wikipedia.org/wiki). So fährt der flashmob U-Bahn zwischen zwei Stationen, bis die Polizei kommt. Für den wechselseitigen Beweis, dass es die Gemeinde gibt, von der man ein Teil sein will, taugt das allemal. Die Identität des Users ist vollendet. Aber nur fürs Erste.
2.
Die zur Schau gestellte Privatheit hat ein Pendant, das durch Facebook nicht minder bis zur Kenntlichkeit verzerrt wird: den Marktteilnehmer.
Die Gelegenheit, sich als Persönlichkeit auf Facebook bis zum Gehtnichtmehr zu profilieren, gibt es gar nicht wegen des verbreiteten Drangs zur Selbstoffenbarung. Dass der User das überhaupt kann, verdankt sich einem ganz anderen Interesse an ihm: als potentieller Kunde, als Repräsentant von Zahlungsfähigkeit, die man auf sich ziehen will, ist er selbst, genauer: sind seine Daten, das Objekt der Begierde all derer, die ihre Waren an den Mann bringen und so ihren Profit einfahren wollen. Denen macht Facebook ein verlockendes Angebot. Mit der Verfügung über die Daten der Zigmillionen members und deren Verarbeitung und Nutzung können sich die Warenverkäufer rund um den Globus, wenn schon nicht die Garantie, so doch beste Voraussetzungen dafür verschaffen, ihren Absatz zu steigern. Für ihre Werbezwecke müssen sie sich nicht damit begnügen, bei Facebook Namen, Geburtsdaten oder Adressen einzukaufen. Dessen Ge–schäftsmodell beruht auf der vollständigen Subsumtion nicht nur der Profile, sondern aller auf der Plattform je getätigten Regungen aller Mitglieder unter die Kategorie Kunde. Darin liegt das milliardenschwere Bindeglied zwischen privatem Gequatsche und dem großen Geschäft des Warenhandels. Der User mag sich zum Interesse der Werber an ihm stellen, wie er will – in der Regel erst mal gar nicht; falsch machen im Sinne des Kommerzes kann er nach dem Einloggen jedenfalls nichts mehr: Er hat ohnehin nichts anderes im Sinn als sich mit seinen Bedürfnissen, Neigungen und Vorlieben öffentlich zu machen. So sehr gilt ihm als Nachfrager mit der marktwirtschaftlichen Bestimmung, sich das Geld aus der Tasche ziehen zu lassen, das Interesse der Geschäftswelt, dass noch jedes posting, jede Textzeile im chat und jede Info auf dem pinboard von Bedeutung ist: Datentechnisch durchgefiltert und aufbereitet fügen diese Datensätze dem persönlichen, immer weiter verfeinerten Werbeprofil des potentiellen Kunden weitere Mosaiksteine hinzu. Das braucht man dann nur noch zu nutzen, vom personalisierten Bildschirm-Werbebanner des Brautkleidgeschäfts um die Ecke bis zur Weltkampagne des Turnschuhherstellers, an der garantiert kein Facebook-Teenie vorbeikommt. Die Konkurrenz um Absatz erhebt die sich in aller Regel durch Einteilungskünste auszeichnende Figur des Verbrauchers zum begehrten Datenlieferanten für seine eigene Belämmerung mit auf ihn zugeschnittener Werbung.
Dafür können überhaupt nicht genug Daten der User erhoben werden, feilen Softwareentwickler an immer neuen, natürlich benutzerfreundlichen Möglichkeiten, um sich outen zu können, speichert Facebook auch alle bereits gelöschten Daten in seinen Archiven, zeichnet das komplette Surfverhalten seiner Mitglieder und auch von deren netzwerkfremden Gästen auf usw. usf. Auf der (Daten-) Grundlage fordert Mark Zuckerberg die Warenhändler dieser Welt auf: Be part of the conversation!
Die lassen sich das nicht zweimal sagen, werden selber Mitglieder der community, machen ihre Aufwartung auf den Seiten ihrer käuflich erworbenen Zielgruppen, schalten dort Anwendungsprogramme, heißen auf ihren fanpages ihre Anhänger willkommen und quatschen einfach mit, bis die Selbstdarsteller und zahlungsfähigen Nachfrager selber nicht mehr wissen, welcher der beiden Charaktere jetzt der ihre ist. Und zugleich hat Facebook ihnen damit eine weitere Rolle zugeschrieben: Als interaktive Konsumenten der Werbung werden sie selbst zu deren Kommunikatoren.
In jeder Hinsicht macht sich das herrschende ökonomische Interesse den User zurecht: als perfekt ausnutzbares Objekt seines Profitmachens.
3.
Die geschäftliche Kooperation von Facebook und der Werbeindustrie hat ihre solide Grundlage in der kapitalistischen Identität des bürgerlichen Menschen: Der kann sich Bedürfnisse nur dann erfüllen, wenn er zuvor als Käufer das Ge–schäft der Warenbesitzer, die um seine Kaufkraft buhlen, realisiert hat, weil alle stofflichen Dinge, die er ge- und verbraucht, Waren und damit seinem Zugriff entzogen sind. Kaum theoretisiert er über seine Vorlieben, befindet er sich ideell in der Warenwelt, die ihm vorausgesetzt ist, die immer neue Moden erfindet und neue Bedürfnisse weckt, um seine Zahlungsfähigkeit abzuschöpfen, die also selber die Vorlieben und Neigungen des Konsumenten prägt und erzeugt. Von daher geht es marktwirtschaftlich gesehen total in Ordnung, wenn das Geschäft von Facebook darin besteht, die vor der Hand so disparaten Charaktere des sich zur öffentlichen Person stilisierenden Selbstdarstellers und des Kunden kongenial miteinander zu verknüpfen. Die gehören nämlich von Haus aus zusammen.
Damit ist die überwiegende Mehrzahl der User ganz zufrieden: Sie sehen sich gut bedient. Abwegig fänden sie die These, sie seien das Mittel des Geschäfts. Umgekehrt: Endlich werden ihnen aus der unüberschaubaren Warenwelt genau die Angebote unterbreitet, die zu ihnen passen. Das werbende Geschäftsinteresse an ihnen übersetzen sie in ihre Freiheit, sich in ihrer Warenwelt tummeln und zumindest ideell über all die ihnen offerierten Produkte verfügen zu können, die letztlich wegen ihnen und für sie hergestellt werden. Wer will denn da über Werbung meckern, wenn die genau den eigenen Geschmack und Lebensstil abbildet. Selbstbewusst leben sie – in ihrer Bedürfnisstruktur von den Werbeabteilungen der großen und kleinen Marken für deren Absatzinteresse zurecht gemacht – ihre Einbildung, sie hätten ihren Lifestyle selbst erfunden und würden sich für dessen Pflege beim Geschäft bedienen.
Artet das Ganze aus, kann König Kunde auch kritisch werden: zu viel Werbung, die falsche Werbung! Dann heißt es, mehr interagieren, gleich selber auf den Seiten seiner brands vorstellig werden und dort den „like“-Button bearbeiten... Die Kritik kann aber auch grundsätzlicher werden. Eine überschaubare Minderheit sieht ihre Freiheit im Netz beschädigt. Sie beharrt darauf, dass das soziale Netzwerk ihr Tummelplatz ist, auf dem ausgerechnet das Geschäft, das ihn ge–schaffen hat und unterhält, sie nicht zum bloßen Objekt degradieren darf. Leicht widersprüchlich verweisen sie darauf, dass es noch immer ihre Daten sind, die sie selbst in aller Freizügigkeit öffentlich machen. Sie suchen nach dem rechten Verhältnis von Netzfreiheit für alle und Datenschutz; dabei lässt sie Ilse Aigner nicht allein.
II. Alles für den User: Neues Recht und Volkserziehung
Die Kommunikation in sozialen Netzwerken wirft lauter Rechtsfragen auf. Solche überkommener Art: Beleidigung und üble Nachrede gehören polizeilich verfolgt, schon gleich, wenn sie in Mobbing
ausarten. Aber in weit größerem Umfang solche neueren Typs, die der kommerziellen Nutzung des endlosen Datenstroms im Netzwerk entspringen. Die Mitglieder der community hacken nämlich nicht einfach nur in ihre Tastatur, ihnen ist dabei – ob sie das wollen oder nicht – ein eigentumsähnliches Recht an ihren Daten gegenüber ihresgleichen, also allen anderen Konkurrenzsubjekten – hier: gegenüber dem Netzwerkbetreiber und dessen Kunden – zugesprochen.
Diese Rechtsposition sieht der staatliche Hüter der Konkurrenzordnung in Gestalt seiner amtlich bestallten Daten- und Verbraucherschützer ganz generell tangiert, wenn solcherart neue Usancen in seiner Gesellschaft einreißen, dass Unmengen von persönlichen Daten aller Art im höchsten Maße vorsätzlich auf Plattformen wie Facebook öffentlich zur Schau gestellt und von den Netzwerkbetreibern angehäuft und als Geschäftsmittel genutzt werden. Das gibt ihm zu denken. Reicht es aus, geltendes Recht neu zu interpretieren und konsequent anzuwenden? Oder muss die Rechtslage geändert werden, wenn beträchtliche Volksteile mit einem schlichten Häkchen alle jetzt und zukünftig eingegebenen Daten für Kommerzzwecke freigeben? Soll ein solches Häkchen diesen Gestattungsakt überhaupt wirksam hervorrufen können? Sollte nicht zumindest deutlicher auf die Rechtsfolgen hingewiesen werden müssen, denen man zustimmt? Kann es angehen, dass im Netzwerk gelöschte Daten auf den Servern des Netzwerkbetreibers verbleiben und dass mit dem im gnadenlosen Kreuzfeuer der öffentlichen Kritik stehenden, über das gesamte Internet verteilten „like“-Button von Facebook auch Daten von Nichtmitgliedern erhoben werden? Kurz: Ist die dem User verliehene datenrechtliche Position, diese spezielle Ausformung des staatlich definierten Konkurrenzsubjekts, noch gewahrt oder nicht? Wird sein gesetzlich geschützter freier Wille geachtet oder nicht? Die Zuständigen haben ihre Zweifel und melden Handlungsbedarf an.
Der kommt wegen des unstillbaren Hungers der Datenkrake Facebook auf, ganz besonders aber wegen der beim User vorliegenden Eigentümlichkeit, dass dieser Inhaber eines Rechts von eben diesem einfach nichts wissen will. Statt – wie man es von ihnen gewohnt ist – auf ihrem Recht zu bestehen, konterkarieren die Leute es geradezu, wenn sie den ihnen eigenen Besitzstand an Daten permanent und ziemlich uferlos in die Netzwelt hinaus veröffentlichen. Der Staat macht die Privatsphäre des Bürgers zum Rechtsgut und der will einfach keine mehr haben, weil ihm die Darstellung seiner Persönlichkeit über alles geht.
Also heißt es für die Datenschützer und Frau Aigner nicht nur – wie es sich für Organe der Exekutive geziemt – auf Facebook loszugehen, auf die Einhaltung bestehender Gesetze und auf freiwillige Selbstbeschränkung zu dringen, mit der Verschärfung der Gesetzeslage zu drohen und gegebenenfalls eine solche in die Wege zu leiten. Daneben steht ein Stück Volkserziehung an: Die User sollen sich gefälligst vor Augen führen, dass sie bei allem posting und messaging immer noch als Rechtssubjekte in einer Konkurrenzgesellschaft unterwegs sind; dass der staatliche Hüter der Marktwirtschaft es nicht ohne Grund für regelungsbedürftig gehalten und geregelt hat, wer was wem gegenüber von sich preisgeben muss und was nicht; dass mit all dem Netzgelaber über Gott und die Welt und öffentlich ausgestellten Fotoalben nicht nur Einbrecher und Kinderschänder auf den Plan gerufen werden, sondern dass daraus in der nicht-virtuellen Welt des bürgerlichen Lebenskampfes mittelbar Rechtsfolgen erwachsen können: manchmal sollten Instanzen wie potentielle Arbeitgeber, Chefs, Lehrer, Vermieter oder die Krankenversicherung eben doch nicht alles wissen. Die Politik weist ihr Volk von Usern zurecht: Konkurriert gefälligst als die von uns definierten Rechtspersonen und begebt euch nicht gedankenlos der Rechte, mit denen wir eure Konkurrenzposition schützen! Rechte gewährt der Staat nicht aus Spaß an der Freud‘, die hat man bitte schön auch wahrzunehmen!
III. Auch das noch: Die „Facebook-Generation“ macht Revolution und verpasst der Demokratie eine Frischzellenkur
Zu einem Politikum ganz anderer, weit höherer Art hat es das digitale Zentralorgan für Selbstdarstellung und Kommerz dann auch noch gebracht: Das umfassende Kommunizieren, das es ermöglicht, soll den freiheitsliebenden, demokratischen Geist einer ganzen jungen Generation im arabischen Raum erzeugt und verbreitet haben, der sich mit seinen Aufständen und erfolgreichen Umstürzen Bahn bricht.
Allerdings – darf man daran erinnern? – ist die Erklärung keines Aufbegehrens, auch nicht in Ägypten und anderswo, in den Mitteln der Kommunikation zu finden, mit denen dieses Aufbegehren organisiert wird. Sicherlich hat sich die Unzufriedenheit der perspektivlosen Jugend
auf Facebook und anderen Plattformen im Internet gesammelt, wechselseitig bekräftigt und verallgemeinert. Für die Verbreitung der Abscheu gegen den ungerechten und korrupten Machthaber mitsamt seiner Herrschaftsclique und des Aufrufs to do something on Tahrir
taugt so ein Netzwerk allemal, zumal es für diese Art von Protest einer weitergehenden gemeinsamen politischen Willensbildung nicht bedarf. Als Transportmittel der Unzufriedenheit leistet das Internet seine Dienste. Dem Medium des Protests entspringt aber nicht dessen Inhalt; der ist immer noch in dem Reim zu finden, den die aufständischen arabischen Massen sich auf ihre kläglichen Lebensumstände machen. Ebenso wenig liegt der Grund für das Störpotential des Protests in seinem Verbreitungsweg über soziale Netzwerke. (Siehe dazu den Artikel „Volksaufstand in Ägypten: Viel Aufruhr – für nichts als einen Antrag auf bessere Herrschaft, den das Militär erhört“ in GegenStandpunkt 1-11) Und dafür, dass das Netz überhaupt zum tauglichen, weil dem Zugriff der Staatsmacht ganz oder zum Teil entzogenen Organisationsmittel der „Arabellion“ werden kann, bedarf es nebenbei auch weniger des Wirkens eines in ihm wesenden „freiheitlichen Geistes“ als vielmehr handfesterer Unterstützung: Ohne auswärtige Instanzen wie NGOs oder Geheimdienste, die mit Technik und Geld bereitstehen, um das Netz am Laufen zu halten, wären die Aufständischen am Ende glatt offline. Ganz abgesehen davon haben die westlichen Führungsmächte Facebook längst als Mittel ihrer Propaganda entdeckt: Sie unterrichten die Völker dieser Welt auf diesem allgemein zugänglichen Weg über immer neue Gründe für und die richtige Art der Unzufriedenheit, mit welcher sie sich gegen ihre Obrigkeiten wenden sollen.
Auf ein wirksames Transport- und Verbreitungsmittel von Meinungen und ein Medium der Verabredung wollen die Ideologen des www. in den Heimstätten der kapitalistischen Welt die sozialen Netzwerke aber keinesfalls reduziert sehen. Für sie belegt der Erfolg der Aufstände im arabischen Raum genau die Leistung, die sie den Netzwerken andichten. Sie adoptieren die Unruhen als „Facebook-Revolutionen“ und erklären sie zum Ausdruck des im Netz wesenden freiheitlichen und demokratischen Geistes, den die User weltweit schaffen und auf sich wirken lassen. Den arabischen Aufruhr zitieren sie als Beweis für die befreiende Macht umfassender Öffentlichkeit: Mit dem Internet im Allgemeinen und den sozialen Netzwerken im Besonderen als Mittel der unbeschränkten Kommunikation der Bürger untereinander und der Herstellung totaler Transparenz von Regierungshandeln könne jeder Obrigkeit die Möglichkeit zu geheimen, undemokratischen Machenschaften genommen und sie auf den Pfad wahrer Demokratie gedrängt werden.
Im Dunkeln bleibt freilich, wie mit der Möglichkeit kritischer Prüfung von Herrschaft schon deren Menschenfreundlichkeit garantiert sein soll. Dass hierzulande alle regierungsamtlich verordneten Härten für die Leute in der Öffentlichkeit breitgetreten werden, hat jedenfalls noch keinem ihrer Adressaten irgendetwas erspart. Die Notwendigkeit der Beurteilung politischer Herrschaft hat sich nicht damit erledigt, dass deren Wirken bekannt gemacht und zur Kenntnis genommen wird. Im arabischen Raum wie in den Heimatländern der Demokratie sind alle Kanäle öffentlicher und privater Kommunikation – und seien sie noch so autonom – für sich überhaupt nichts und ansonsten genau so viel wert wie das, was man über sie der Welt mitzuteilen weiß.