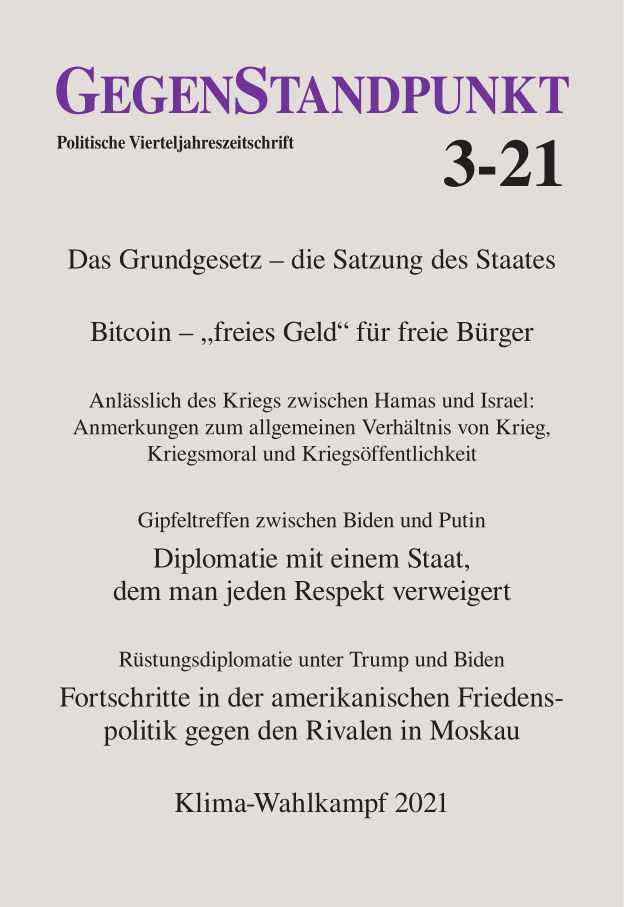Aus der Reihe „Was Deutschland bewegt“
Mindestlohn für häusliche Pflege
Manchmal kommt den sozial Schwachen ein Gericht zu Hilfe. Das höchste deutsche Arbeitsgericht schreitet gegen den „systematischen Gesetzesbruch“ in der geschäftlichen Sphäre der häuslichen Pflege ein. Und was vermelden dazu die öffentlichen Beobachter? Damit werde ein sozialstaatliches Modell infrage gestellt, bei dem alle Beteiligten nur gewinnen.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Mindestlohn für häusliche Pflege
Manchmal kommt den sozial Schwachen ein Gericht zu Hilfe. Das höchste deutsche Arbeitsgericht schreitet gegen den systematischen Gesetzesbruch
(Verdi) in der geschäftlichen Sphäre der häuslichen Pflege ein und gibt einer bulgarischen Pflegekraft Recht, die mit Unterstützung der Gewerkschaft auf Nachzahlung stattlicher Lohnbeträge klagt: Für ihre Rund-um-die-Uhr-Betreuung einer alten Dame hat sie nach dem Grundsatzurteil des Bundesarbeitsgerichts nachträglich einen Anspruch auf die Bezahlung sämtlicher, auch der Bereitschaftsstunden, und zwar in der Höhe des deutschen Mindeststundenlohns.
Und was vermelden dazu die öffentlichen Beobachter? Damit wird ein sozialstaatliches Modell infrage gestellt, bei dem alle Beteiligten nur gewinnen:
„Für Hunderttausende deutsche Familien ist eine osteuropäische Pflegekraft, die Senioren für kleines Geld in den eigenen vier Wänden versorgt, die Rettung: Oma und Opa müssen nicht ins Heim, die Pflegekraft verdient mehr als in der Heimat und der Staat hat ein Problem weniger.“ (FAZ, 25.6.21)
Ein Zynismus, der freilich nur bedingt auf das Konto der FAZ geht, der nämlich die sozialstaatlich geregelte Sache betrifft, um die es da geht:
Für die Abwicklung der hilfsbedürftigen Endphase eines bürgerlichen Lebens macht der Staat grundsätzlich die Familie haftbar und gewährt ihr dabei eine wohldosierte Unterstützung aus der Pflegekasse, die über Zwangsbeiträge aus dem Einkommen der Erwerbstätigen gefüllt wird. Der allgemeine öffentliche Haushalt ist zur Finanzierung der Altlasten der Benutzung des Volkes nicht da, so die erste Prämisse. Die zweite lautet, dass die Beiträge zur Pflegeversicherung mit dem Bedarf auf gar keinen Fall einfach wachsen dürfen; das ist der Arbeitgeberschaft nämlich nicht zuzumuten, bei der Löhne schließlich als Kosten anfallen.
Die Unterstützung der Familien aus der Pflegekasse ist unter diesen beiden Maßgaben eng bemessen, jedenfalls von vornherein nicht darauf berechnet, eine ‚Fremdvergabe‘ des Problems durch Heimunterbringung zu finanzieren. Sie mindert für die Betroffenen nur die Kosten, die anfallen.
Diese verbleibenden heftigen ‚Eigenleistungen‘ beleben – neben den Zuständen in den kostenbewusst geführten Pflegeeinrichtungen – die Bereitschaft der Angehörigen zur ‚häuslichen Pflege‘. Für die kann wiederum ein ambulanter Pflegedienst genutzt werden, dann geht der Zuschuss der Pflegekasse für eine durchaus überschaubare ‚Sachleistung‘ drauf und der größere Rest der Pflege bleibt unentgeltlich am privaten Umfeld hängen. Oder aber pflegende Angehörige erledigen alles selbst und können dafür aus der Pflegekasse ein wahrlich reichlich bemessenes Pflegegeld beziehen: Beim höchsten Pflegegrad 5, der komplette Hilflosigkeit voraussetzt, gibt es für die Arbeit der pflegenden Angehörigen stolze 901 € Bezahlung!
Diese privat zu leistende Pflege wächst sich allerdings auch bei niedrigeren Pflegegraden schnell zu einem Programm aus, das eine Erwerbstätigkeit mehr oder weniger ausschließt, es sei denn, die Betroffenen können sich eine private ‚Hilfestruktur‘ beschaffen, die den Pflegeaufwand für sie in Grenzen hält.
Womit sie beisammen wären, die sozialstaatlichen Rahmendaten für einen ganz speziellen Arbeitsmarkt für Pflegekräfte, auf dem sich drei Akteure tummeln:
Erstens die Familien, die sich und/oder ihren hilfsbedürftigen Angehörigen ein Pflegeheim ersparen möchten und auf helfende Hände angewiesen sind, weil ihr Arbeitsleben sie umfassend in Anspruch nimmt – die meisten gehören ja selbst zu den abhängig Beschäftigten, und deren Einkommen gibt die Nutzung von Dienstpersonal überhaupt nicht her.
Für diese Nachfrage nach Betreuungspersonal der billigen Art organisieren zweitens Vermittlungsagenturen ein Angebot für eine häusliche Rund-um-die-Uhr-Betreuung. Deren Geschäftsmodell ist einerseits zugeschnitten auf die Notlage sowie die geringe Zahlungskraft ihrer Kundschaft. Es lebt andererseits von der Notlage einer dritten Partei, der Arbeitsuchenden hauptsächlich aus Osteuropa eben, für die dank der marktwirtschaftlichen Befreiung ihrer Heimat zum Hinterland der EU jede Art von Billiglohn-Arbeit ein Angebot darstellt, das sie nicht ablehnen können.
Diese Arbeitskräfte werden von den einschlägigen Agenturen mehr oder weniger im oder jenseits des Graubereichs der Legalität vermittelt zu Löhnen weit unterhalb selbst des deutschen Mindestlohns und zu faktischen Einsatzzeiten jenseits jeder Arbeitszeitordnung. Die Notlage der zahlenden Kundschaft und der hilfreichen Damen, gelegentlich auch Herren aus dem Osten sowie der Geschäftssinn der Vermittler mobilisiert dabei auf allen Seiten die nötige Bereitschaft, darauf zu spekulieren, dass die Sache nicht vor den Kadi kommt.
Und das tut sie in der Regel auch nicht. Denn dieses Massengeschäft im Billiglohnsektor – erst zu Beginn der Corona-Krise, als Quarantäneregeln den üblichen Schichtwechsel der Pflegekräfte aus den Ostländern behinderten, wurde man mit den Ausmaßen vertraut gemacht – wird von den jeweils zuständigen staatlichen Instanzen normalerweise stillschweigend geduldet; funktionelle Beiträge dieses Marktes zur Abwicklung des ‚Pflegeproblems‘ sind schließlich politisch erwünscht.
Und dann das! Mit einem Urteil, das sich – ohne Rücksicht auf funktionelle sozialstaatliche Erwägungen – stur an die geltende Rechtslage hält, erkennt das Arbeitsgericht ein durch den deutschen Einsatzort gegebenes, gleiches Recht auf Bezahlung der geleisteten Arbeits- und Bereitschaftszeit an.
Prompt lassen die öffentlichen Beobachter das Publikum wissen, dass das Urteil in deutschen Haushalten einen Tsunami
(Focus, 24.6.21) auslösen werde, weil es eine häusliche Pflege tendenziell unbezahlbar mache:
„Würde das Urteil umgesetzt, würden sich die Löhne vervielfachen, was sich kaum jemand leisten könnte.“ Für eine Rundum-Betreuung müsste man nämlich „mindestens drei Betreuerinnen anstellen, um rechtlich auf der sicheren Seite zu sein. Das dürfte zwischen 12 000 und 15 000 Euro im Monat kosten.“ (FAZ, 9.8.21)
Für die FAZ selbstverständlich eine Absurdität! Sie gibt so auf ihre Art zu Protokoll, dass die unabdingbare Entlastung der pflegenden Familien, die sich bekanntlich auch noch anderweitig nützlich machen sollen, schlicht unvereinbar ist mit einem auch nur halbwegs auskömmlichen und erträglichen Arbeitseinsatz des pflegenden Personals. Dass also nach den maßgeblichen Interessen von Staat und Kapital an der Sphäre im Prinzip alles so bleiben muss, wie es ist.
Und die FAZ weiß auch Rat. Sie weiß erstens, dass ein Rechtsspruch und dessen Umsetzung zweierlei sind – dass es nämlich fraglich ist, ob sich die Betreuungskräfte trauen, die Forderungen gegenüber ihren ausländischen Vermittlungsagenturen durchzusetzen,
und dass sich das Urteil mit der vermehrten Anwendung der Rechtsform eines freien Gewerbetreibenden
oder arbeitnehmerähnlichen Selbständigen
umgehen lässt. Und sie weiß zweitens, dass grundsätzlich der Bedarf besteht, das Unvereinbare vereinbar zu machen:
„Seit Jahren verschließen die zuständigen Minister Jens Spahn und Hubertus Heil die Augen vor den unübersehbaren Missständen in der häuslichen Pflege, dabei hat ein höchstrichterliches Urteil jüngst auch dem letzten Realitätsverweigerer aufgezeigt, dass Pflegekräfte dort systematisch unterbezahlt werden. Dieses Problem muss gelöst werden, ohne die häusliche Pflege unbezahlbar zu machen. Es braucht einen rechtssicheren Mittelweg, der dem deutschen Arbeitsrecht, den Bedürfnissen osteuropäischer Betreuerinnen und den finanziellen Möglichkeiten der Familien gerecht wird.“ (FAZ, 9.8.21)
Was also ist zu tun? Die Politik muss einfach endlich handeln und die Lösung finden, die alle Seiten gut bedient!