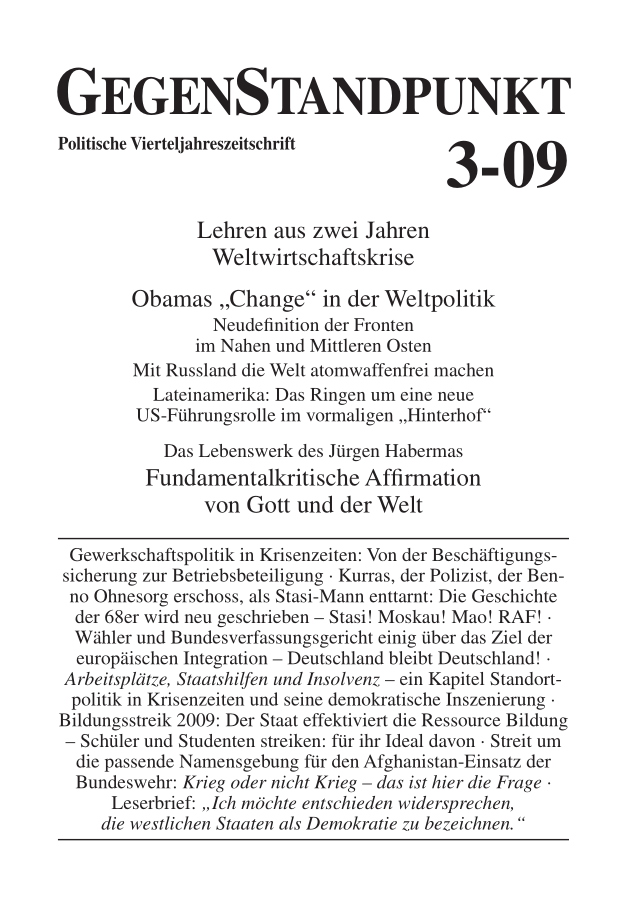Obamas „change“ in der Weltpolitik
Der neue amerikanische Präsident Barack Obama kommt aller Welt mit seinem Willen zum „change“. In großen Reden an wechselnde Adressaten verkündet er den Russen wie Muslimen, den hungernden Afrikanern wie den friedliebenden Europäern, ja selbst den Schurken des George Bush, dass die USA sich ab sofort für ein großes Einvernehmen mit und zwischen allen Staaten starkmachen, ihnen die offene Hand entgegenstrecken. Vorbei ist demzufolge die Zeit der Konfrontation und unilateralen Diktate aus dem Weißen Haus. Fast könnte man meinen – und die applaudierende Öffentlichkeit rund um den Globus, vor allem die begeisterte jugendliche Gefolgschaft des neuen Polit-Stars nimmt es tatsächlich so –, dass die kapitalistische Supermacht eine Politik der Selbstmäßigung beschlossen und einen großen Vereinbarkeitsbeschluss gefasst hat, demzufolge die USA künftig keine abweichenden und feindlichen Nationalinteressen mehr kennen.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Siehe auch
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Gliederung
- I. Neudefinition der Fronten im Nahen und Mittleren Osten
- II. Mit Russland die Welt atomwaffenfrei machen
- 1. „Den Kalten Krieg beenden“: Eine ganze Ebene der strategischen Konfrontation zwischen Russland und den USA aus dem Verkehr ziehen
- 2. „Die Vision einer atomwaffenfreien Welt verwirklichen“: Ein neues Nonproliferations-Regime über die Welt verhängen
- 3. Und überhaupt: Ein neues Arrangement mit Russland
- III. Lateinamerika: Das Ringen um eine neue US-Führungsrolle im vormaligen „Hinterhof“
- 1. Das Programm
- 2. Das praktische Ringen um Ordnung in der ‚Problemzone‘ Lateinamerika und um eine anerkannte amerikanische Vormachtstellung
- Diplomatische Gesten gegenüber den Linksregierungen
- Im Kampf gegen Drogenmafia und Gewalt: Mehr Kooperation und US-Militärpräsenz
- Eine neue Anti-Kuba Politik: Statt bedingungsloser Feindschaft Nachhilfe für einen radikalen ‚change‘ des ewigen Störenfrieds
- Die OAS als Bühne des diplomatischen Ringens um einen Kuba-Kompromiss nach Washingtons Geschmack
- Der Putsch in Honduras: Ein Präzedenzfall für die neue Führungsrolle der USA
Obamas „Change“ in der Weltpolitik
Wenn Weltpolitiker ihre weltpolitischen Vorhaben unter ein idealistisches Motto stellen, den Traum von einer besseren Welt oder eine Mission für die Menschheit verkünden, dann ist Vorsicht geboten. Verfehlt ist die untertänige Gewohnheit, die Führerpersönlichkeiten auf ihre Glaubwürdigkeit zu überprüfen: ob sie es denn ehrlich meinen und ob sie über die Mittel verfügen, ihre schönen Versprechen auch einzulösen. Wie hoffnungsfroh oder skeptisch, wie schnell und wie tief enttäuscht auch immer die staatsbürgerlichen Gemüter gestimmt sind – gutgläubig sind sie alle. Denn sie (über)nehmen das ihnen präsentierte politische Ideal als Messlatte für die Beurteilung herrschaftlicher Taten – als den guten Auftrag, denen Weltpolitiker zu dienen hätten. Dabei enthält die feierliche Berufung auf grenzüberschreitend gültige Werte, mit welcher mächtige Staatenlenker nicht nur ihr nationales Fußvolk vereinnahmen, sondern auch Ihresgleichen in die Pflicht nehmen, regelmäßig die klare Ansage harter imperialistischer Ansprüche. Dass es ihnen obliegt, die Welt zu zivilisieren, in der bekanntermaßen lauter konkurrierende Herrschaften ihre Rechte reklamieren, ist schließlich die Prämisse dieser Art politischer Botschaften. So stand die Parole „Freiheit oder Sozialismus“ für die epochale Kampfansage des vereinigten Westens gegen das falsche System der Sowjetunion, die sich und ihren Einflussbereich der Globalisierung des Kapitalismus verweigerte – eine Kampfansage, welche die Planung eines Atomkriegs einschloss. Anschließend, nach dem Fall des „Eisernen Vorhangs“, proklamierte US-Präsident George Bush Sr. die „Neue Weltordnung“; deren Auftakt war der Krieg gegen den Irak. Und die jüngste Demokratisierungs-Mission, die George Bush Jr. unter das Motto des„Antiterrorismus“ bzw. „Gut gegen Böse“ stellte, hat bekanntlich einen Mehrfrontenkrieg gegen missliebige Staaten begründet.
Der neue amerikanische Präsident Barack Obama kommt aller Welt mit seinem Willen zum „Change“. In großen Reden an wechselnde Adressaten verkündet er den Russen wie Muslimen, den hungernden Afrikanern wie den friedliebenden Europäern, ja selbst den Schurken des George Bush, dass die USA sich ab sofort für ein großes Einvernehmen mit und zwischen allen Staaten starkmachen, ihnen die offene Hand entgegenstrecken. Vorbei ist demzufolge die Zeit der Konfrontation und unilateralen Diktate aus dem Weißen Haus. Fast könnte man meinen – und die applaudierende Öffentlichkeit rund um den Globus, vor allem die begeisterte jugendliche Gefolgschaft des neuen Polit-Stars nimmt es tatsächlich so –, dass die kapitalistische Supermacht eine Politik der Selbstmäßigung beschlossen und einen großen Vereinbarkeitsbeschluss gefasst hat, demzufolge die USA künftig keine abweichenden und feindlichen Nationalinteressen mehr kennen.
Der Inhalt der Ankündigung eines weltpolitischen „Change“ sowie die gestartete diplomatische Vereinnahmungsoffensive des Barack Obama geben diese Deutung nicht her. Darin sind vielmehr zwei Klarstellungen enthalten:
Zum Ersten signalisiert die Agenda des schwarzen Präsidenten alles Andere als eine neue Bescheidenheit der amerikanischen Staatsgewalt. Gerade im emphatischen Insistieren darauf, dass die Staaten und Völker der Welt doch jenseits aller Differenzen hauptsächlich durch „gemeinsame Interessen und geteilte Werte“ verbunden sind, stellt die neue US-Regierung den Anspruch klar, dass sich die auswärtige Politik an den amerikanischen Interessen auszurichten hat. Sie buchstabiert der Welt die „globalen Herausforderungen“ vor, deren Bewältigung zum Wohle aller erforderlich ist. Sie präsentiert den Staaten ihre politischen Richtlinien und Aufträge als ureigene Interessen, denen sich doch wirklich keiner verweigern kann. So reklamiert sie – gestützt auf die überlegenen Machtmittel der eigenen Nation – ganz selbstverständlich die Befugnis für sich, den konkurrierenden Herrschaften in jeder Weltgegend die Rechte und Pflichten zuzuweisen, welche die Gleichung von amerikanischer und globaler Sicherheit garantieren. Es ist also das oberste Anliegen der USA, den souveränen Willen fremder Staaten unter ihre Kontrolle zu bringen. Da herrscht fraglos politische Kontinuität: Ein US-Präsident ist zuständig für die Weltordnung, oder er ist kein Präsident.
Zum Zweiten demonstriert der neue Führer aller Welt, ihren Obrigkeiten vor allem, dass er „es“ anders macht als Bush. Ein Witz plus Handschlag mit dem „Rebellen“ Hugo Chavez und Statements der Art, „das iranische Volk wählt seinen Präsidenten selber“ und Amerika „schreibt ihm nicht vor, wen es zu wählen hat“, stehen dafür, dass die Obama-Regierung die Freund-Feind-Fronten in Frage stellt, welche bis gestern gültige Politik der USA waren. Die allenthalben betonte Kooperationsbereitschaft soll keinen Zweifel daran lassen, dass Obama auf Distanz geht zu dem Aufgabenkatalog und den Strategien, welche der Vorgänger für zwingend hielt zur Durchsetzung des Führungsanspruchs in der Welt. Mit der Politik des George W. Bush ist ein Bruch angesagt.
Bush jr. wollte die ökonomische und militärische Schlagkraft der – nach einem heißen und einem kalten Krieg – „einzig verbliebenen Weltmacht“ für die Herstellung der „Neuen Weltordnung“ nutzen, ein endgültiges amerikanisches Regime über die Staatenwelt sicherstellen. Das Attentat al Kaidas vom 11. September 2001 bestätigte ihm den Verdacht, dass seine Vorgänger die Frontbildung gegen antiamerikanische Umtriebe aller Art haben schleifen lassen; und dass die Vollstreckung einer weltumspannenden amerikanischen Sicherheitsordnung, die keinen Widerstand mehr zulässt, nicht weniger als eine neue Art Weltkrieg erfordert. Sein „Global War on Terror“ exekutierte die Überzeugung, dass der Einsatz der überlegenen Kriegsmaschinerie das einzig Erfolg versprechende Mittel darstellt, die Feinde Amerikas zu vernichten und die Gleichschaltung der Staatenwelt zu erzwingen. Die Diplomatie der Bush-Politik, die wesentlich aus Imperativen, Drohungen und demonstrativer Ignoranz bestand, entsprach dem Programm, unbotmäßige Regime und störendes nationales Beharren auf eigenen statt zugewiesenen Rechten definitiv nicht mehr hinnehmen zu wollen.
Diese anti-terroristische Weltordnungspolitik ist dem neuen Präsidenten zufolge gescheitert.
Bei seiner Besichtigung der internationalen ‚Lage‘, in der sich die Konkurrenz der Nationen bilanziert, kommt er zu einem ziemlich verheerenden Befund: Der Terror ist unbesiegt; andere, zentrale Gefahren für die nationale Sicherheit, allen voran die Existenz atomarer Machtmittel in fremden Händen bzw. das Bedürfnis danach, sind nicht Erfolg versprechend angegangen, statt dessen wächst die nukleare Proliferation; der offene Verteilungskampf um Energieressourcen und die Klima-Unbilden gefährden Wachstum und Ordnung; Bündnispartner der USA gehen auf Distanz; alte und neue Großmächte drohen, zu Rivalen zu werden; die internationalen Aufsichtsorganisationen verlieren ihre Funktion für die Durchsetzung der gewünschten Konkurrenzordnung. Die Machtverhältnisse haben sich zu Ungunsten Amerikas verschoben. Der Status der USA als Führungsmacht ist angegriffen, ihre ‚natürliche Autorität‘, den Staaten der Welt den rechten Gebrauch der staatlichen Gewalt zu diktieren, wird zunehmend bestritten; die Glaubwürdigkeit ihres Militärs, Kriege als Lektionen zu veranstalten, dass Widerstand gegen Amerika sich niemals lohnt, ist schwer beschädigt; der freigiebige Einsatz der militärischen Gewalt erweist sich nicht als Produktivkraft für die Stiftung einer Amerika nützlichen Ordnung. Und zu alledem, was die Bush-Regierung vergeigt hat, untergräbt nun auch noch das aktuelle Krisendesaster das ökonomische Fundament der Weltmacht USA.
Die Korrektur dieser für Amerika bedrohlichen ‚internationalen Lage‘ ist jetzt das Programm. Die kritischen Bestandsaufnahmen des neu gewählten Präsidenten stellen zugleich in Grundzügen klar, wie er die angeschlagene Macht Amerikas restaurieren und sicherstellen will. Der Realismus
, den er sich und seiner Nation an Stelle des „ideologischen Dogmatismus“ der Bush-Regierung verordnet, setzt neue Prioritäten und setzt auf veränderte Rezepte:
Obama will nationale Eigeninteressen fremder Obrigkeiten darauf überprüfen, ob und wie sie mit den amerikanischen Ansprüchen vereinbar zu machen sind, statt die betreffenden „Regime“ gleich antiamerikanischer Umtriebe zu verdächtigen.
Er will alle Mittel, die der Weltmacht zu Gebote stehen, flexibel in Anschlag bringen, um die Ansprüche Amerikas durchzusetzen und Gefahren für Amerika zu vermeiden, statt die „beste Armee der Welt“ in vermeidbare Kriege zu schicken. „Smart power“ heißt die neue Formel.
Er setzt beim Ordnen der Welt verstärkt auf Kooperation, auf bewährte Alliierte wie neu zu gewinnende Partner, statt durch Alleingänge Freunde zu verprellen oder aufsteigende Konkurrenten in die Konfrontation zu zwingen. Wenn eine echte Bedrohung den Einsatz militärischer Gewalt erfordert, dann soll der auch effektiv und mit Hilfe von Verbündeten erfolgen.
Obama will dafür sorgen, dass Amerika endlich die Führung zurückerobert in allen „Zukunftsfragen“, welche die globalen Geschäftsbedingungen (Energiesicherheit, neue Technologien, Klimaschutz) betreffen, statt den Konkurrenten Zuständigkeit und Vorteile zu überlassen.
Und er will die Institutionen der „Internationalen Staatengemeinschaft“ wieder zu einem tauglichen Instrument des amerikanischen leadership machen.
Das alles fasst die Regierung Obama unter dem Leitmotiv zusammen, mit dem sie den „Staaten und Völkern der Welt“ ihren „Change“ als Chance für alle serviert: In der Weltpolitik der USA soll ab sofort die Diplomatie – als die Speerspitze der Außenpolitik
(H. Clinton) – wieder zu den Ehren kommen, die ihr im Verkehr der Nationen gebührt.[1] Die Botschaft zielt auf ein positives Echo. Ein solches haben Obama und die Weltmacht USA, die nun von ihm dirigiert wird, auch bekommen: Erleichterung darüber, dass sich die Bush-Linie demonstrativ verabschiedet, verknüpft mit der Hoffnung, die eigene Nation werde es nun leichter haben mit der Wahrung ihrer gegensätzlichen Interessen und Machtambitionen. Und selbst die warnenden Stimmen der Meinungsbildner, welche hier und anderswo darauf verweisen, dass neue Forderungen und erpresserische Angebote aus Washington nicht ausbleiben werden – schon wegen des „Drucks der konservativen Opposition“ –, leben von dieser politischen Entwarnung. Sie kritisieren ja nicht die Illusionen, die sich auf „gute“ Weltpolitik „glaubwürdiger“ Führer richten, sondern bereiten das Fußvolk der eigenen Herrschaft schon mal konstruktiv auf mögliche Enttäuschungen vor.
I. Neudefinition der Fronten im Nahen und Mittleren Osten
1. Review: Neubewertung der Bedrohungen
Obamas Bilanz des Antiterrorkriegs seines Vorgängers fällt vernichtend aus. Anstatt wie versprochen, Amerikas Sicherheit zu erhöhen und seinen weltweiten Führungsanspruch zu festigen, haben die Kriege in Afghanistan und Irak zwar die Schurkenregime gekippt, aber mehr als das ist positiv über sie nicht zu vermelden. Die angefangenen Kriege sind nicht siegreich zu Ende geführt, das amerikanische Militär zunehmend verschlissen und gebunden; und aufgrund der gescheiterten kriegerischen Unternehmungen ist Amerikas Abschreckungsfähigkeit in Frage gestellt und das weltweite Kräfteverhältnis zuungunsten Amerikas verschoben. Um sich den „wirklichen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts“ – die neue Regierung nennt als wichtigste die Atom- und die Klimafrage - zuwenden zu können, aber auch, um Kräfte frei zu bekommen für die Bewältigung potentieller Risiken,[2] soll im „Broader Middle East“ (BME) endlich für eine Ordnung gesorgt werden, aus der Amerika nicht ständig neue Gefahren und Sicherheitsprobleme erwachsen. Obama setzt daher zu Beginn seiner Amtszeit seine Beraterstäbe ein gutes Vierteljahr darauf an, eine Bestandsaufnahme und Überprüfung der bisherigen Nahostpolitik vorzunehmen, um darüber Aufklärung zu erhalten, wo hier die drängendsten Gefahren liegen und wo ihre Ursachen zu suchen sind, welche Probleme vorrangig der Behandlung bedürfen und welche zu vernachlässigen sind, welche Risiken gar nicht ins Blickfeld der Bush-Regierung gerieten und welche Bedrohungen Produkt der falschen Außenpolitik seines Vorgängers sind.
Die als Gesamtschau für diese Region betriebene Review ergibt nicht nur, dass hier „alles mit allem zusammenhängt“. Der Verdacht des Auftraggebers wird bekräftigt, dass hier die eigentlichen Gefahren für Amerika weder erkannt noch beseitigt wurden. Statt die Terroristen der al Kaida zu erledigen, wurde ein Krieg nach dem anderen angefangen oder mit ihm gedroht, und so ständig weiterer Antiamerikanismus und neue Feinde erzeugt. Es steht also eine Neu-Sortierung der Feinde Amerikas auf dem Programm: Das erste Thema, dem wir uns stellen müssen, ist gewalttätiger Extremismus in allen seinen Formen.
(Obama in Kairo, Amerikadienst, 04.06.09)
Dieser ist, weil er immer noch auf maximale Schädigung der USA und seiner Freunde sinnt, die Hauptgefahr für Amerika und die Welt, wird nicht geduldet und muss unschädlich gemacht werden. Antiamerikanismus, den sich Amerika mit seiner verfehlten Politik der letzten Jahre zum Gutteil selbst zuzuschreiben hat, ist zwar ein ärgerliches Phänomen, aber keine unmittelbare Bedrohung der Vereinigten Staaten, und schon gar nicht durch Krieg zu entschärfen oder zu beheben.
Damit ist der War on Terror aus dem Verkehr gezogen;[3] und mit ihm sein Begleitprogramm, die Demokratisierung des Mittleren Ostens. In Bezug auf die Terrorgruppen wird eruiert, welche Fraktionen als „militante Extremisten“ mit ihrer Feindschaft eine Bedrohung für Amerika darstellen: die sind zu bekämpfen – und welche Mannschaften nur aufgrund besonderer Umstände wie Armut oder nationalistische Empörung gegen US-Übergriffe zu Parteigängern der Terroristen wurden: die sollen dazu bewegt werden, sich von ihnen loszusagen. Diese „Redimensionierung“ des Terror-Problems bedeutet nicht zwangsläufig, dass weniger terroristische Formationen ins strategische Blickfeld geraten. Man sortiert neu, zwischen al Kaida und den Taliban, zwischen den Taliban der ersten und der zweiten und dritten Riege [4] letztere, die gesprächsbereit sein dürften, nachdem die 1. Kategorie schon ziemlich dezimiert ist, fallen aus dem Terrorschema raus; andere, wie die pakistanischen Islamisten, die für Attentate in Bombay oder Kabul verantwortlich zeichnen, sind eine Gefahr für Pakistan, seine Nachbarn, Westeuropa und die Welt und daher endlich zu bekämpfen; und bei den Parteien im Nahost-Konflikt wird unterschieden, ob sie auf einem Krieg gegen Israel, dem das Existenzrecht abgesprochen wird, bestehen oder ob lediglich politische Forderungen gegen den im Prinzip anerkannten Staat Israel erhoben werden. Durch die Einführung neuer Unterscheidungskriterien sollen Mitläufer abgespalten und eingebunden, die „Extremisten“ aber endlich besiegt werden.
Auch in Bezug auf die Staaten, die als Rückzugsräume, „safe havens“, oder Unterstützer, „terror sponsor states“,[5] für „den islamistischen Terror“ in Bushs Visier waren, soll differenziert werden: Handelt es sich wirklich um Feinde Amerikas: selbst dies ist wie im Fall Iran nicht ausgemacht und soll erst noch durch einen Test in Erfahrung gebracht werden – oder liegt da nur ein Fall von andersgeartetem Nationalismus vor, der sich zwar mit amerikanischen Interessen nicht unbedingt deckt, was aber kein Verbrechen ist und keine Bedrohung für die Sicherheit der Vereinigten Staaten darstellt?
Was Afghanistan angeht, so wird die Eröffnung des Kriegs für korrekt befunden, weil sich dort wirkliche Feinde der USA, al Kaida und ihre Mitstreiter, festgesetzt haben, die immer noch bzw. mittlerweile immer mehr eine ernste, wenn nicht die schlimmste Gefahr für Amerika bedeuten. Der strategische Auftrag, „klar und erreichbar“, lautet in diesem Fall: „disrupt, dismantle und defeat!“ Bushs Fehler bestand im wesentlichen darin, den Krieg in Afghanistan acht Jahre lang schleifen zu lassen, ihn weder zu beenden noch zum Sieg zu führen, und stattdessen das nächste Schlachtfeld im Irak aufzumachen.[6] Dadurch hat er dem sich über die afghanisch-pakistanische Grenze sich bis nach Pakistan ausweitenden Chaos viel zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt: die Gefahr eines failing states mit Atomwaffen ist von einem Kaliber, das mit einer Charter for Democracy.[7] nicht zu beheben ist. Ebenso sträflich ist es, sich nicht um die neuen safe havens zu kümmern, in die sich die Terroristen aufgrund der immer ungemütlicher werdenden Verhältnisse in Afghanistan mittlerweile abgesetzt haben: Jemen, Somalia, Tadschikistan… Diesen Gefahren muss sich Amerika stellen und die Feinde besiegen, failed oder failing states dürfen keine Rückzugsräume für amerikafeindliche gewalttätige Gruppierungen sein oder wieder werden.
Andere Fronten hingegen kann es sich sparen und den Truppenabzug in die Wege leiten. Der Krieg im Irak wird beendet, der von Anfang an ein „Fehler“ war. Auch wenn Obama begrüßt, dass hier ein Menschenschlächter und Diktator aus dem Verkehr gezogen wurde: „eine Verbindung“ Saddams zu al Kaida, also eine Rechtfertigung für einen Krieg, der Obama sich anschließen könnte, hat nie existiert. Und nachdem sich der Vorwurf, Saddam Hussein habe sich dem Verbot durch die internationale Gemeinschaft zum Trotz Massenvernichtungswaffen zugelegt, als „Fehleinschätzung“ der amerikanischen Geheimdienste erwies, hätte es nach Ansicht Obamas nicht eines Kriegs bedurft, um dem Diktator seine Ambitionen zur Verschiebung des Kräfteverhältnisses abzugewöhnen.
Weil Obama nationale Interessen, die andere Staaten verfolgen, nicht als Anti-Amerikanismus diffamieren und ahnden, sondern für Amerika einspannen will, erübrigt sich auch das Programm, das Bush nach dem Ausrufen der „mission accomplished“ für den Irak ausgerufen hat: Amerika braucht keine Vasallenstaaten, hat es nicht nötig, sich allein die ökonomische Benutzung von gewissen Landstrichen zu reservieren, die es dazu als Militärbastion ausbaut. Die Vereinigten Staaten sind nicht länger dafür zuständig, die inneren Verhältnisse anderer Staaten nach ihrem Muster umzumodeln. Abweichende nationale Ideologien auf freiheitlichen Kurs zu bringen, Demokratisierungsdefizite bei den arabischen Verbündeten oder in Pakistan zu beheben: das hat nicht Aufgabe einer US-Regierung sein. Bushs Intention, autoritäre Staaten durch Demokratisierung in die Front gegen die anti-amerikanischen und anti-israelischen Schurken einzureihen, ist nicht nur nicht aufgegangen, sondern hat nichts als Schaden bewirkt. Weder haben Bushs Erziehungsobjekte die undemokratische Ordnung ihres Innenlebens amerikanischen Herrschaftsvorstellungen angepasst, um Extremisten den Rückzugs-, Nachschub- und Aufwuchsraum zu nehmen und dem Anti-Amerikanismus den Boden zu entziehen, noch haben sie sich in eine feste Front gegen die Schurkenstaaten einbinden und gegen den Iran aufstellen lassen. Vielmehr präsentiert sich Obama nun eine politische Landschaft, in der von den „special allies“, deren Funktionalität einmal eine selbstverständliche Beigabe der „Freundschaft“ war, nicht viel übrig geblieben ist. Fast alle Nationen, in denen Anti-Amerikanismus mehr denn je gedeiht, zeigen sich amerikanischen Forderungen gegenüber sperrig, sind den USA entfremdet oder gar feindlich gesonnen und haben sich anderen Weltmächten zugewandt.
Schuld daran ist nach Ansicht Obamas auch der Nahostkonflikt - ein Problem, das sich die USA nicht länger leisten sollten. Nicht zuletzt Bushs Israel-Politik, die bedingungslos-parteilich deren kriegerisch gegen die Nachbarschaft durchgesetzten Ansprüche mitgetragen hat, gestattete es der israelischen Regierung, die berechtigten Interessen der Araber zu ignorieren und sich über die Regeln der internationalen Gemeinschaft zu erheben. So wurden „unnötige“ Feindschaften geschaffen, Iran und Syrien überflüssigerweise lauter Gründe für weitere Verhärtung und Feindschaft geliefert, den Terroristen ein Hauptvorwand für ihr Agieren geboten und somit lauter Vorbehalte nicht nur gegen Israel, sondern auch gegen die USA erzeugt, was nicht länger hingenommen werden kann. Auch Israel ist daher auf change zu verpflichten: Schluss damit, dass es den USA diktiert, wie weit die israelischen Sicherheitsinteressen reichen; ein Unding, dass hier ein Freund Amerikas alle Nachbarn mit Krieg bedroht, die Region aufwühlt, anstatt sie für die Übernahme von Diensten für die USA zurechtzumachen und zu stärken.
Mit dieser Sicht des nahöstlichen Krisenherds müssten sich auch die Beziehungen zu Iran und Syrien entschärfen lassen, wenn die sich dazu verstehen könnten, die Israel-Politik der Obama-Administration zu würdigen. Selbst an die von Bush als Schurkenstaaten titulierten Gegner Amerikas ergeht also die Anfrage, ob sie sich nicht dazu überreden lassen könnten, ihre Feindschaft sein zu lassen. Obama will seinerseits den Konfrontationskurs beerdigen, Regime-Change vergessen, sich vielmehr ganz auf die Beseitigung der Missstände konzentrieren, die er beim Iran als die „wirklichen Gefahren“ ausgemacht hat: die Israel-feindliche Regionalpolitik und das iranische Atomprogramm.
2. Die neue Strategie
Demontage des gewalttätigen Extremismus, ergänzt um Nation building, „redimensioniert“ auf die Verhinderung von safe havens
Mit der Sortierung der Gefahren ist ein effektiverer Einsatz amerikanischer Machtmittel angestrebt. Weil durch die Bush-Politik der ständig ausgeweiteten Feindschaftsansagen an die Schurken und ihre Hintermänner in aller Welt das letzte Mittel ziemlich stumpf geworden ist und auf der anderen Seite die zivileren Mittel in Vergessenheit geraten und nicht gebührend zur Wiedererstarkung der amerikanischen Führung zum Zug gekommen sind, verspricht die Obama-Regierung, sich der gesamten „Instrumentenpalette“ amerikanischer Potenzen zu bedienen – und Kriege nur zu führen, wenn die Sicherheit Amerikas auf dem Spiel steht und alle anderen Mittel ausgeschöpft wurden und versagt haben. [8]
Effektivere Kriegführung
sollte in Anwendung der aus der Review gewonnenen Maxime, sich nicht zu verzetteln und die US-Streitkräfte auf die „wesentlichen“ Aufgaben zu konzentrieren, keine Schwierigkeiten bereiten: „rationellerer“ Einsatz der militärischen Mittel und durchgreifenderes Vorgehen in den laufenden kriegerischen Missionen sind angesagt. Neue Prioritäten und Schwerpunkte sind mit der Erstellung der Review gesetzt, die strategischen Mittel werden neu eingeteilt und umgeschichtet, um der Bedrohungen Herr zu werden. Mit der Exitstrategie aus dem Irak, mit der, wie Clinton freimütig bekennt, Amerikas „übergeordneten Interessen besser gedient“[9] ist, werden militärische Kräfte frei für die Konzentration auf die beschlossene Hauptaufgabe Afpak. Aus diesem Schlamassel wiederum können die durch jahrelangen Einsatz strapazierten US-Soldaten nur siegreich hervorgehen, wenn ihre Truppenstärke angehoben wird; ihnen mehr Mittel, vor allem Drohnen, zur Verfügung gestellt werden; das Kampfgebiet ausgeweitet wird, so dass die Hauptnester der Taliban auch jenseits der afghanischen Grenze in den pakistanischen Stammesgebieten ausgeräuchert werden; und die errungenen Erfolge beim Ausschalten der „ersten Riege“ der Taliban durch „Halten“ der befreiten Gebiete gesichert werden – im Verein mit den inländischen Sicherheitskräften [10] bzw. wo die nicht zur Hand, mit Stammesmilizen. Diese Intensivierung des Kriegs und Ausweitung des Kriegstheaters auf den nächsten Staat wird schon wieder als Exitstrategie verkauft: alles sollte in einem zeitlich eng begrenzten Rahmen erledigt sein, am besten vor den Kongresswahlen im Herbst nächsten Jahres – und soll durch Kontrolle aller Akteure mit Hilfe neu erstellter und ständig – an sich vielleicht doch verschlechternde Lagen – anzupassenden Messkriterien für den Erfolg gewährleistet werden.
Die begrenzten oder wenn erforderlich auszuweitenden Militäreinsätze sind für sich allein zu wenig effektiv und werden in einem sog. zivil-militärischen Ansatz
ergänzt um Maßnahmen, die dem militärischen Vorgehen zum Erfolg verhelfen bzw. dessen Einsatz reduzieren helfen sollen. Den „militanten Extremisten“ soll ein entscheidender Schlag durch die Schwächung ihrer Finanzbasis versetzt werden, indem der Drogenschmuggel und die immer noch nicht gestoppte Finanzierung durch ausländische Sympathisanten hauptsächlich aus den Golfstaaten, die die Einkünfte aus dem Drogenhandel angeblich übersteigt, endlich unterbunden werden. Um den Taliban nicht weiteren Zulauf zu verschaffen, ist Sympathiewerbung für die Koalitionsstreitkräfte [11] und Minimierung der Kollateralschäden
angesagt – die ständig verbesserte Qualität der hochauflösenden Drohnen-Aufklärungsbilder sorgt für ziemlich „schonende“ Militäraktionen: außer den Extremistenführern werden allenfalls noch ihre Familien und Sippenmitglieder beschossen, für die anderen Opfer wird sich entschuldigt; und auch im Drogenkrieg wird, um das Aufkommen hässlicher Gefühle gegen die Besatzer in Grenzen zu halten, der Kampf gegen die Händler, Schmuggler und ihre Hintermänner in den Vordergrund gerückt, anstatt wie bisher mit der Vernichtung der Mohnfelder ganze Landstriche zu ruinieren, für die landwirtschaftliche Nutzung unbrauchbar zu machen und so der Bevölkerung die Lebensgrundlage zu entziehen.
Schließlich sollen zivile Aufbaumaßnahmen die Afghanen vergessen machen, dass gerade in ihrem Land Krieg geführt wird: die hierfür dem amerikanischen Militär unterstellten Gelder sind von vornherein nicht für den Staatsaufbau vorgesehen, sondern sind Werbekosten und Begleitmaßnahmen der Militäreinsätze, mit denen die afghanische Bevölkerung, ohne dass die GIs immer gleich schießen müssten, mit ein paar Brunnen oder ähnlich zivilen Errungenschaften den Taliban abspenstig gemacht werden soll.
Politische Betreuung
Damit sich die USA nach dem Abzug der Truppen nicht wieder vor dieselben Probleme gestellt sehen, wird an einer Stärkung der betroffenen Staaten gearbeitet. Diese Konsolidierung, an Aufbau der Staaten ist nicht gedacht, trägt eher minimalistische Züge: das amerikanische Exit-Interesse wird verfolgt über Vorbeugemaßnahmen gegen das Nachwachsen von Terror. Die unerfreulich instabilen Verhältnisse, die durch die jahrelange Terroristenjagd in den Ländern des BME herrschen, sollen mit einem Mindestmaß an innerer Ordnung unter Kontrolle gehalten werden. Unkomplizierte „mil-to-mil-contacts“ zwischen Alliierten und Einheimischen sind das Gebot der Stunde, um die Sicherheitskräfte des Irak, aber auch Afghanistans und Pakistans auszubilden und auszurüsten. Deren Militär und Polizei erledigen ihre Aufgaben unter der Kontrolle der Amerikaner, nehmen ihnen schrittweise Kampfaufgaben ab und werden zur Ausbildung der eigenen Leute befähigt – auch wenn’s nur ein Schnellkurs ist; sie kommen zum Einsatz im Kampf gegen Kriminalität und Drogenanbau und –schmuggel in Afghanistan, in Pakistan wird die Strafverfolgung der islamistischen Extremisten durch Polizei und für diesen Zweck zu schulende Juristen in die Wege geleitet…
Daneben wird die politische Betreuung der heruntergekommenen und unzuverlässigen staatlichen Subjekte in Angriff genommen, die differiert, je nachdem, welche Funktionen übertragen und kontrolliert werden, welche Gefahren in Bezug auf ihre Sicherheit die USA meinen abwehren zu müssen. So wird die irakische Botschaft, die größte US-Niederlassung in der Welt, abgebaut, weil nicht länger beabsichtigt ist, sich derart ausgreifend um das Land zu kümmern, dass alle Vorgaben in amerikanischen Botschaftsstuben erarbeitet werden müssten: mit der Umsetzung des Truppenabzugsabkommens soll der Irak seinen Laden im Prinzip selber organisieren. Auf der anderen Seite wird die Botschaft in Pakistan um 1000 Mann aufgestockt und zu einer Festung ausgebaut, in der auch die Marines Platz haben, damit US-Diplomaten vor Ort im Verein mit dem Sonderbotschafter für Afpak für den worst case gerüstet sind und darauf aufpassen, dass Pakistans Staatlichkeit nicht verloren geht oder in falsche Hände gerät. Auch wenn man in Washington schon mal über die Verletzung demokratischer Regeln in Krisengebieten hinwegsieht: bei der Verwendung der Hilfsgelder ist jetzt strikteste Überwachung angesagt. Die Overlooker sind zu der Ansicht gelangt, dass ohne amerikanische Kontrolle die Mittel nicht „effektiv verwandt“, also nicht hundertprozentig für die von Amerika vorgegebenen Ziele eingesetzt werden. Überhaupt sind Regierungen nur in seltenen Fällen ideale Ansprechpartner. Daher mobilisieren die USA über deren Köpfe hinweg alle „zivilgesellschaftlichen“ und anderen Kräfte – neben den schon erwähnten Militärs NGOs so gut wie Stammesvorstände und Milizen und wen sonst sie für die Bewältigung der Probleme in ihrem Sinn tauglich erachten. Holbrooke, dem Sonderbotschafter für Südostasien, obliegt es schließlich, die Zusammenarbeit „schwieriger“ Nachbarn zu organisieren, Nachbarn, die bis heute immer noch nicht auf der Höhe der kooperativen Zeit sind und ein eher feindliches Verhältnis pflegen.
Was Förderung der Selbständigkeit der vom Extremismus zu befreienden Staaten heutzutage bedeutet, zeigt auch ein Blick auf die Wahlen in Afghanistan. Der Volkswille wird an die Urnen gerufen, weil ein Nicht-Stattfinden der Wahlen einem Eingeständnis des Scheiterns der westlichen Kampagne gegen al Kaida und die Taliban gleichkäme. Was 2004/2005 der „erste Schritt auf dem Weg zur Demokratie“, ist jetzt unter den militärischen Aspekt subsumiert und nicht viel mehr als das Symbol, dass die Extremisten sich (wenigstens hier) nicht durchsetzen können, ihnen zumindest die Verhinderung der Wahlen nicht gelingt.
Das Spektrum der politischen Betreuungsaktionen ist weitgespannt, undogmatisch und den amerikanischen Bedürfnissen angepasst. Dazu zählen Wahlen in Afghanistan, mit deren Abhaltung der Sieg der extremistischen Kräfte dementiert werden soll, dazu gehört die Anleitung zu Verhandlungen mit abtrünnigen ehemaligen Sympathisanten der Extremisten, die wieder in den afghanischen „politischen mainstream“ zurückgeholt werden, um die Regierung zu stärken, ebenso wie das Verbot von Verhandlungen mit den pakistanischen Taliban, gegen die eine Offensive in Swat geführt werden muss; im Irak bedeutet der Sonderbotschafter den streitenden Parteien im wesentlichen, dass sie ihre Konflikte in Zukunft allein lösen müssen [12] – und um den Streit der Volksgruppen und ihrer Vertreter einzuhegen, kommt das progressiv-neuartige Mittel der Drohung mit komplettem beschleunigtem Abzug der US-Streitkräfte zum Einsatz; und was Pakistan angeht, müssen hier in die Sicherung des Staats und dessen Stützung ein paar Dollar mehr investiert werden.
Denn schließlich sorgen die USA auch noch für Wirtschaftshilfe, wenn die Ruinierung der ökonomischen Grundlage den Extremisten Aufschwung zu verschaffen droht. Durch die Kriegsjahre verlottert und die Krise untergraben sind eigentlich alle Ökonomien. Manche aber, wie im Irak, müssen nur von amerikanisch auferlegten Fesseln befreit werden, um über die Mittel zu verfügen, für sich selbst sorgen zu können; für andere wie Pakistan muss der Staatsbankrott verhindert und dauerhaft beträchtliche Zuschüsse vom Kongress bewilligt werden, die an strenge Auflagen der Fokussierung der Mittel auf die Terrorbekämpfung gebunden sind.
„Smart Power“ zur Entschärfung der Problemfälle im Nahen und Mittleren Osten
Die Obama-Regierung kritisiert die Bush-Administration, in ihrer Nahost Politik das Mittel Diplomatie zu wenig und dazu noch falsch eingesetzt zu haben. Gegenüber den arabischen Verbündeten bestand der Fehler darin, Diplomatie ausschließlich als Unterweisung verbunden mit Drohungen bei Nichtbefolgung zu praktizieren: fordernd wurde angeordnet, die Unterstützung, ja sogar sämtliche Kontakte zu antiamerikanischen/antiisraelischen Gruppierungen einzustellen, Kritik an Israel und seinem Antiterrorkampf zu unterlassen, sich in die Front gegen den Iran einzureihen und die Vorbehalte gegen die von den USA gestützte Maliki-Regierung im Irak zurückzunehmen. Weil die nationalen Interessen der befreundeten Staaten für die Bush-Regierung irrelevant waren, wurden Einwände gegen die Politik der USA oder Israels als Zeichen von Unzuverlässigkeit registriert und nährten den Verdacht, dass die Kritiker selber ein Problem seien. Die Golfstaaten hatten mit ihrem Ölreichtum für allen möglichen Finanzbedarf der US-Politik geradezustehen: Beteiligung an den Kosten des Antiterrorkriegs, Aufbau des Irak, Finanzierung der Palästinensischen Autonomiebehörde; was sie selbst an diplomatischen Aktivitäten unternahmen, wurde entweder de facto ignoriert wie die Saudi-Initiative [13] oder als Obstruktion eingestuft wie die Vermittlung zwischen Hizbullah und der Siniora-Regierung im Libanon oder die Versöhnungsversuche zwischen Hamas und Fatah seitens Katars und Ägyptens: das alles waren Verstöße gegen die US-Devise „Keine Verhandlungen mit Terroristen!“
Dem Beispiel Syrien und Iran entnimmt Obama den Fehler einer Politik, „Schurkenstaaten“ diplomatisch zu isolieren. Assad ist Hauptunterstützer von Hizbullah und Hamas geblieben und zeigt nach wie vor wenig Bereitschaft, das Einsickern von antiamerikanischen Kämpfern in den Irak wirksam zu verhindern. Durch den Abbruch der diplomatischen Beziehungen von Seiten der US-Regierung nach dem Mord am libanesischen Präsidenten Hariri 2005 ist Syrien schließlich in das Bündnis mit dem Iran getrieben worden. Was Teheran betrifft, stellt Frau Clinton fest:
„Wir wissen, dass die Weigerung, sich mit der Islamischen Republik zu befassen, nicht erfolgreich darin war, Iran von seinem Weg hin zu Atomwaffen abzuhalten, die iranische Unterstützung für Terrorismus zu verringern oder das Verhalten des Staates gegenüber seinen Bürgern zu verbessern.“ (Rede vor dem Council on Foreign Relations, Amerika Dienst, 15.70.09)
Der „Verzicht auf Diplomatie“ bringt die USA den eigenen Zielen nicht näher. Stattdessen ermöglicht er konkurrierenden Weltordnungsmächten, ihren Einfluss in diesen Ländern auszubauen. Russland sichert sich in Syrien einen Stützpunkt für seine Marine und betreibt mit Iran Atom- und Waffengeschäfte, und China steigt massiv ins Öl- und Gasgeschäft mit dem Iran ein. Die Islamische Republik hat trotz Sanktionen ihre ökonomische und militärische Macht ausgebaut, neue Bündnispartner gefunden und ihren Einfluss in der Region gestärkt.
Obama will „Zuhören“ als wichtigsten Bestandteil seines Verständnisses von Diplomatie gewürdigt wissen. Mit diesem „Approach“ werden andere Staaten prinzipiell als Souveräne mit eigenen Interessen behandelt. Wenn Amerika sie zur Veränderung ihres Verhaltens oder Mitarbeit an einem Projekt, das für die USA von Interesse ist, bewegen will, dann soll nicht von vornherein mit überlegener Gewalt gedroht, sondern Überzeugungsarbeit geleistet werden. Im Sinne dieser Linie vollzieht die derzeitige US-Administration die
Wiederbelebung des Nahost-Friedensprozesses
Seit Jahrzehnten sorgen die kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Israel und den Palästinensern, Syrien und Libanon für permanente Spannungen im Verhältnis der gesamten arabisch-islamischen Welt nicht nur zu Israel, sondern auch den USA. Die Expansionspolitik Israels ist eine bleibende Quelle des Antiamerikanismus bei den Muslimen und verschafft den gewalttätigen Islamisten Legitimation für ihre Taten und sichert ihnen beständig Zulauf.
Aus Sicht Obamas ist das Hauptproblem bei der Entschärfung des Nahost-Konflikts, dass sein Amtsvorgänger Israel erlaubt hat, die Rolle einer regionalen Supermacht zu spielen. Zwar will auch er nichts an Israels Sonderstellung in der Region ändern: der Judenstaat ist und bleibt der engste amerikanische Verbündete im Nahen Osten und regionale Vormacht, die dank Finanz- und Militärhilfe aus den USA allen ihren Nachbarn militärisch weit überlegen ist. Aber die vorbehaltlose Unterstützung von „Israels Antiterrorkampf“, der diversen Militäroffensiven gegen die Palästinenser im Gazastreifen und den Hizbullah im Libanon, des Bombenangriffs auf die syrische „Atomanlage“ und der Missachtung der Palästinensischen Autonomiebehörde haben die Lage in der Region ständig verschärft und auf Dauer unhaltbar gemacht. Durch Bushs ultimative Forderung, die Araber müssten „Israels Sicherheitsbedürfnisse“ akzeptieren und tatkräftig dabei mitwirken, die Infrastruktur des Terrors auszumerzen, wurden selbst langjährige treue Verbündete wie Saudi-Arabien und Ägypten derart vor den Kopf gestoßen, dass sie ihre Beziehungen zu Amerika deutlich abkühlen ließen.
Mit dieser vorbehaltlosen Parteilichkeit der letzten Regierung bricht Obama. In seiner Rede in Kairo distanziert er sich von dem Generalverdacht gegenüber islamischen Staaten als einer tendenziellen Gefahr für Amerika und plädiert für einen „Neuanfang zwischen den Vereinigten Staaten und den Muslimen überall auf der Welt“. Während Bush stets betont hat, Israel sei die „einzige Demokratie“ in der Region, hebt sein Nachfolger ausdrücklich die moralische Qualität islamischer Werte hervor, die ebenfalls „die Grundsätze der Gerechtigkeit, des Fortschritts, der Toleranz und der Würde des Menschen“ beinhalten. Präsident Obama verzichtet in seinen Reden natürlich nicht darauf, „das Streben“ der Juden „nach Heimat“ als legitimes Recht anzuerkennen und viel Verständnis für die damit verbundenen Sicherheitsbedürfnisse zu äußern, aber auch den Palästinensern billigt er ein Recht auf Heimat zu. Und nicht nur das, er beklagt, dass deren Situation „unerträglich“ ist wegen der „täglichen Demütigungen – kleine und große, die die Besatzung mit sich bringt“.
„Die Vereinigten Staaten werden dem legitimen Streben (der Palästinenser) nach Würde, Chancen und einem eigenen Staat nicht den Rücken kehren.“ (Kairo-Rede, 04.06.09)
Sein Bemühen um die Beseitigung dieses seit über einem halben Jahrhundert existierenden Krisenherds kleidet Obama in folgende – hochgesteckten – Ziele für seine laufende Amtszeit: einen „umfassenden Frieden zwischen Israel, den Palästinensern, Syrien und Libanon“ und „die Aussöhnung der arabischen Welt mit Israel“. Und aus gutem Grund benennt er einen ganzen Stab von amerikanischen Sonderbeauftragten, die diesen Friedensprozess anstoßen, vorantreiben und überwachen sollen. Es geht nämlich um die Kleinigkeit, der Netanjahu-Regierung klarzumachen, dass die Israel von Bush ausgestellte Lizenz, unter Berufung auf seine Sicherheitsinteressen sämtliche gegen den jüdischen Staat erhobenen Rechtsansprüche als Terrorismus zu behandeln, nicht mehr gelten soll. Mitchell & Co sollen Israels Politiker davon überzeugen, dass ein Arrangement mit den arabischen Kontrahenten der einzig realistische Weg ist, „die Sicherheitsbedürfnisse“ des jüdischen Staates „auf Dauer zu lösen“. Statt als Militärmacht, die allen Nachbarn haushoch überlegen ist, ständig auf Abschreckung und Militäraktionen zu setzen, soll Israel politische Lösungen suchen, Verhandlungen führen und Kompromisse schließen. Vor allem muss die Führung in Jerusalem ihre nationalen Ansprüche reduzieren: vom (End-)Ziel, ganz Palästina, also das gesamte „den Vätern versprochene Land“, zu israelischem Staatsgebiet zu machen, hat sie sich zu verabschieden und sich wieder an den Grenzen von 1967 zu orientieren, natürlich mit den in der Zwischenzeit in den Verhandlungen erarbeiteten Modifikationen. Israel soll ferner anerkennen, dass Jerusalem nicht nur für Juden, sondern auch für die Araber und die muslimische Ummah eins der höchsten nationalen Güter darstellt. Auch wenn der Golan für Israel strategisch wichtig sein mag, seine Annexion widerspricht internationalem Recht...[14]
Weil Washington sich als überparteilicher Vermittler zwischen konkurrierenden legitimen nationalen Ansprüchen begreift, führen die US-Diplomaten auch wieder das Prinzip des „do ut des“ in die Beziehungen zwischen Israel und den Palästinensern ein. Sie bestehen darauf, dass die Anforderungen der „road map“ von beiden Seiten erfüllt werden, auf der ersten Stufe, dass nicht nur die Palästinenser den Terror bekämpfen, sondern Israel – wie vereinbart – im Gegenzug den Siedlungsbau einzustellen hat. Und dabei wollen sie sich nicht mehr – wie alle bisherigen amerikanischen Regierungen – auf die Tricks der israelischen Seite einlassen, unter Vorwänden wie „natürliches Wachstum“ der Siedlungen, „bereits erteilte und juristisch nicht rücknehmbare Genehmigungen“ oder „kurz vor dem Abschluss stehende Projekte“ den Siedlungsbau unverdrossen fortzutreiben.[15] Auch in der Jerusalemfrage, die Netanjahu für „nicht offen“ erklärt, weil das ungeteilte Jerusalem Hauptstadt Israels sei und ewig bleiben werde, besteht die US-Regierung mit der förmlichen Einbestellung des israelischen Botschafters auf der Klarstellung, dass der endgültige Status der Stadt in Verhandlungen zwischen Israel und den Palästinensern geklärt werden müsse, weshalb Israel es zu unterlassen habe, neue Fakten zu schaffen.
Weil Obama verhindern will, dass Netanjahu, dem nur mühsam ein Bekenntnis zur Zweistaaten-Lösung abgerungen werden kann, die Friedensverhandlungen unterläuft, wird eine Frist von eineinhalb Jahren gesetzt, innerhalb derer die Endstatus-Gespräche abgeschlossen sein müssen. Die Reihenfolge der zu behandelnden Fragen wird vorgegeben: erstens Klärung der endgültigen Grenzen, danach Jerusalem und die Flüchtlingsfrage. Dieser „Friedensplan“ diktiert nicht die materiellen Regelungen des angestrebten Friedensvertrags, die die Parteien souverän aushandeln sollen,[16] er besteht aber darauf, dass sie auf Basis formeller Gleichberechtigung beider Seiten durchgeführt werden: dafür werden US-Diplomaten sorgen, die den Verhandlungen beiwohnen.
Vom palästinensischen Präsidenten verlangt Obama, dass er im Westjordanland jeglichen Terrorismus verhindert und eine Regelung findet, wie die Herrschaft der Hamas im Gazastreifen beendet wird. Dabei unterstützen die USA die Palästinensische Autonomiebehörde nicht nur finanziell, sondern auch durch die Ausbildung palästinensischer Sicherheitskräfte. Außerdem üben sie Druck auf die arabischen Staaten von Saudi-Arabien bis Syrien aus, sich hinter Abbas zu stellen und die „extremistischen Kräfte“ der Hamas dazu zu bewegen, das Existenzrecht Israels und die bisherigen Abkommen zwischen Israel und der PLO anzuerkennen. Im Gegenzug setzen sich die US-Diplomaten dafür ein, dass Israel die Blockade des Gazastreifens aufhebt... Das Recht, Bedingungen für die Wiederaufnahme der Gespräche zu stellen, wie ein wirksamer und überprüfbarer Siedlungsstopp, kommt dem Palästinenser-Präsidenten allerdings nicht zu, auch wenn er von Amerika als „Friedenspartner“ anerkannt und ihm in dieser Hinsicht gegen Israel der Rücken gestärkt wird.
Die arabische Seite, die ja in der Vergangenheit hinreichend erfahren hat, dass sich für sie eine Konfrontation mit Israel nicht lohnt, ermahnt der US-Präsident, ihre „Alles oder Nichts“-Haltung aufzugeben. An der Saudi-Initiative kritisiert er, dass die arabischen Länder erst dann ihre Beziehungen zu Israel normalisieren wollen, wenn es sich auf die Grenzen von 1967 zurückgezogen hat. Als „Verbesserung“ schlägt er vor, dass beide Seiten unmittelbar zunächst mit „symbolischen Akten“ beginnen, ihre Feindschaft abzubauen. Wenn Israel einem Siedlungsstopp zustimmt, sollten die arabischen Länder es nicht als Zumutung empfinden, dass sie von Amerika dazu aufgefordert werden, ihrerseits die eingefrorenen Wirtschaftsbeziehungen zu Israel wiederaufzunehmen oder israelischen Airlines Überflugrechte zu gewähren, damit sie etliche Flugstunden auf dem Weg nach Ostasien einsparen.
Aus Sicht der USA ist auch die feindliche Haltung Assads gegenüber Israel unnötig und liegt ein Kurswechsel durchaus im syrischen Interesse. Um Damaskus davon zu überzeugen, nehmen die USA die diplomatischen Beziehungen zu dem ehemaligen „Schurkenstaat“ wieder auf und bieten an, bei einer Friedensregelung mit Israel behilflich zu sein,[17] wenn Syrien eine konstruktive Rolle bei der Lösung des israelischen palästinensischen Konflikts und der Beendigung des Irak-Kriegs spielt. Mit derartigen diplomatischen Vorstößen sucht die Regierung Obamas die Lage auszunutzen, in die ein Land wie Syrien in der Bush-Ära gebracht wurden. Als Alternative zur ständigen Kriegsdrohung seitens Israels und der Sanktionierung durch die USA erscheinen womöglich auch bescheidenere Angebote attraktiv.[18]
Ein Test auf den Iran
Auch im Fall des Iran besinnt sich die neue US-Regierung auf das Mittel der Diplomatie; es ist ihr zumindest einen Versuch wert, durch Gespräche die Bedrohung zu beseitigen, die die Politik Teherans aus Sicht der USA darstellt: Unterstützung des gewalttätigen Extremismus in der Region und Streben nach der Atombombe. Die Titulierungen „Schurkenstaat“ und „Achse des Bösen“ werden aus dem Vokabular des neuen Präsidenten gestrichen. Mag sich die iranische Führung immer noch feindlich gegenüber den USA verhalten, Obama will sie doch als Repräsentanz eines souveränen Staates anerkennen. Im Gegensatz zu Bush, der einen „regime-change“ fordert, will er sich nicht anmaßen, den Iranern ihre neue Führung vorzuschreiben [19] Zwar kritisiert er den Umgang mit der Opposition nach den Wahlen, betont aber gleichzeitig, dass es nicht Sache der USA, sondern des iranischen Volkes sei, für eine ihm gemäße Führung zu sorgen. Vor allem aber weigert er sich – trotz inneramerikanischer Vorwürfe, er trete zu wenig für die Menschenrechte ein –, seine Offerte an das Mullah-Regime zurückzuziehen: Der Iran könne „seinen rechtmäßigen Platz in der internationalen Gemeinschaft wieder einnehmen“, wenn er seine Unterstützung der Terrorgruppen einstellt und auf Atomwaffen verzichtet.
Die US-Außenministerin stellt ausdrücklich klar, dass die USA den Iran wegen seiner antiamerikanischen Ausrichtung nicht diskriminieren wollen, sondern lediglich auf der Einhaltung des NPT bestehen:
„Iran hat kein Recht auf militärische atomare Kapazitäten, und wir sind entschlossen, diese zu verhindern. Aber das Land hat ein Anrecht auf eine zivil genutzte Atomkraft, wenn es das Vertrauen der internationalen Gemeinschaft wiedergewinnt, dass es seine Programme ausschließlich für friedliche Zwecke nutzt.“ (Clinton, 15.07.09)
Deshalb wird die Einstellung der Urananreicherung (freeze) als Vorbedingung für Gespräche fallen gelassen, zugleich aber darauf bestanden, dass der Iran durch die Einräumung erweiterter Kontroll- und Überwachungsrechte für die IAEA und die weitgehende Unterstellung seiner Atomprogramme unter internationale Kontrolle beweist, dass er keine Atomwaffen baut.
Um den Iran davon zu überzeugen, dass er keine andere Wahl hat, als sich den Forderungen der USA und der internationalen Gemeinschaft zu beugen, ziehen die US-Diplomaten alle Register: Obama lockt mit „incentives“ wie der Mitgliedschaft in der WTO, US-Investitionen im Iran und Aufnahme diplomatischer Beziehungen; gleichzeitig sorgen die USA im UN-Sicherheitsrat für die verschärfte Anwendung beschlossener Sanktionen; Vizepräsident Biden erklärt, dass die USA Israel nicht einen Präventivschlag gegen die atomare Bedrohung verbieten werden; und Außenministerin Clinton leistet mit einer weiteren Drohung „Überzeugungsarbeit“:
„‚Wir halten die Tür (für Verhandlungen) immer noch offen, aber wir haben auch klar gemacht, dass wir, wie ich immer wieder gesagt habe, Aktionen unternehmen werden, Aktionen, um die Abwehr unserer Partner in der Region zu steigern‘, sagte Clinton dem thailändischen Fernsehen. ‚Wir wollen, dass der Iran kalkuliert, was meiner Meinung nach eine reelle Einschätzung ist: dass es, wenn die USA ihren Verteidigungsschirm über die Region erstrecken, wenn wir sogar noch mehr tun, die militärischen Kapazitäten unserer Alliierten im Golf zu entwickeln, unwahrscheinlich ist, dass der Iran auch nur irgendwie stärker oder sicherer sein wird, weil sie dann gar nicht so einschüchtern und dominieren können, wie sie das anscheinend glauben zu können, wenn sie einmal die Atomwaffe haben.‘“ (Dawn, 24.07.09)
Ihr „Argument“, das den Iran an den Verhandlungstisch locken soll, lautet, dass er aufgrund der negativen Wirkungen seiner atomaren Aufrüstung – außer dem amerikanischen Atomschirm bekommt er es noch mit einem Rüstungswettlauf in der Region zu tun – gar nicht in den Genuss der positiven Seiten seiner Atomwaffen kommen wird. Anstatt sich mit ihnen unberechenbar zu machen und sie als Erpressungsmittel zu nutzen, soll ihm nichts übrig bleiben als zu erkennen, dass Atomwaffen in unberechtigten Händen zu rein gar nichts nutze sind. Mit den Angeboten und Drohungen soll klargestellt sein, dass dem Iran nur eine Möglichkeit bleibt, wenn er eine wichtige Rolle in der Region spielen will: er muss sich an die Seite Amerikas stellen und mit dazu beitragen, dass sich Hizbullah und Hamas mit Israel arrangieren, und darf eine „konstruktive Rolle“ in Afghanistan, Irak und Pakistan z.B. durch Wiederaufbau- und Wirtschaftshilfe übernehmen.
Damit der Iran das diplomatische Angebot nicht mit einem Eingeständnis der Schwäche oder Mangel an Entschlossenheit Amerikas, den Drohungen Taten folgen zu lassen, verwechselt; damit er nicht auf Zeitgewinn spielt, um sich militärisch weiter zu stärken und im Hinblick auf sein Atomprogramm neue Fakten zu schaffen, setzt die US-Regierung Ahmadinedschad eine Frist bis zur UN-Vollversammlung Ende September. Bis dahin muss er klargemacht haben, ob er sein „troubling behaviour“ fortsetzen will oder nicht. Dann werden die USA entscheiden, ob sie die diplomatische Tour wieder abbrechen und durch verschärfte Wirtschaftssanktionen und politische Isolation ersetzen.
3. Neudefinition der Führungsrolle
Die US-Regierung geht davon aus, dass sie zur Lösung der globalen von der Vorgängerregierung in vielen Fällen gar nicht oder nur ansatzweise in Angriff genommenen Herausforderungen sowie zur Bewältigung der Erbschaft Bushs allein nicht in der Lage ist, selbst wenn sie die vorhandenen Mittel rationeller und effektiver einsetzt. Sie ist auf Partner angewiesen, die ihre Einschätzung der Probleme teilen und selber an deren Beseitigung interessiert sind. Dabei gibt Amerika seinen Führungsanspruch beim Ordnen der Welt nicht auf, distanziert sich aber davon, wie Bush Führung praktiziert hat:
„Wir haben... damit begonnen, eine flexiblere und pragmatischere Haltung gegenüber unseren Partnern einzunehmen. Wir werden nicht bei jeder Frage einer Meinung sein. Aber auch wenn wir nicht von unseren Prinzipien abweichen, sollte uns das nicht davon abhalten, in den Bereichen zusammenzuarbeiten, in denen wir das können. Daher werden wir unsere Partner nicht auffordern, mitzumachen oder es sein zu lassen, noch werden wir darauf bestehen, dass sie entweder auf unserer Seite oder zwangsläufig gegen uns sind. In der heutigen Welt wäre das Fahrlässigkeit mit globalen Konsequenzen.“ (Clinton, 15.07.)
Die neue US-Regierung hält es für einen Fehler, die Staaten anhand der Frontlinie des amerikanisch definierten Antiterrorkriegs in gute, mitmachwillige und abseitsstehende, unwillige bis böse zu scheiden und wirbt für eine gemeinsame Zielsetzung, in die alle Staaten vorbehaltlos und soweit wie möglich einzubeziehen sind. Nicht Frontbildung und strikte Unterordnung unter amerikanische Direktiven und Interessen ist angesagt, sondern die Organisation von Bündnissen, die „gemeinsame Aufgaben“ angehen, zu denen alle das Ihre beitragen – und sei es nur, weil alle daran interessiert sein dürften, die Betroffenheit von acht Jahren Antiterrorkrieg zu überwinden. Die nationalen Interessen der angesprochenen Helfer sind zu berücksichtigen, um sie mit ihren Mitteln für die Bewältigung der vorgestellten Probleme einzuspannen.
„Kurz gesagt werden wir führen, indem wir mehr Kooperation zwischen mehr Akteuren bewirken und den Wettbewerb reduzieren und so das Gleichgewicht von einer multipolaren Welt hin zu einer Welt mit zahlreichen Partnerschaften verlagern werden.“ (ebd.)
- Was den Kampf gegen den gewalttätigen Extremismus und die Stabilisierung der betroffenen Länder angeht, verzichten die USA darauf, sich einen exklusiven Zugriff etwa auf das irakische Öl zu sichern und die neu installierten Regierungen ausschließlich an sich zu binden. Künftig wollen sie weder ein Nutzungs- noch Regelungsmonopol beanspruchen, weil der dadurch erzielbare Nutzen für die USA mehr als ungewiss, die Kosten aber jetzt schon viel zu hoch sind. Darum sollen sich auch andere Nationen an dem unter den gegebenen Sicherheitsbedingungen wenig attraktiven Geschäft der Exploration und der Modernisierung und Reparatur der vorhandenen Ölquellen beteiligen. Und jeder Beitrag, ob von arabischer, europäischer oder russischer Seite, der dem Aufbau des Irak, der Ausstattung seiner Sicherheitskräfte und der Stärkung der dortigen Regierung zugute kommt, ist willkommen.
- Der langjährige Streit innerhalb der NATO um die Strategie in Afghanistan, zwischen den Europäern, die in erster Linie Aufbau forderten, und den USA, die den Antiterrorkrieg als Priorität vorschrieben, ist beigelegt. Dazu hat zwar in erster Linie die immer prekärer werdende Sicherheitslage im Lande beigetragen, aber Obama ist auch auf die Europäer zugegangen, indem er von vornherein einen militärischen und zivilen Ansatz propagiert hat. Die USA werfen den Verbündeten nicht mehr vor, Bündnispflichten zu vernachlässigen, zu wenig Truppen zu stellen, sondern werben dafür, jedes Land möge sich gemäß seinen Möglichkeiten stärker engagieren. Dabei gehen die USA mit gutem Beispiel voran, indem sie Zehntausende zusätzliche Kräfte mobilisieren und damit Fakten schaffen, die die Frage, wer die militärische Führung und Koordination ausüben soll, fast wie von selbst erledigen.
- Weil die USA keine prinzipielle Ausgrenzung oder Eindämmung von Staaten betreiben, suchen sie auch die Unterstützung ihres Kriegs im Mittleren Osten bei Ländern, die sich zu Bushs Zeiten eher missgünstig beobachtend verhalten haben:
„Und schließlich werden wir, zusammen mit den Vereinten Nationen, eine neue Kontaktgruppe für Afghanistan und Pakistan schmieden, die alle zusammenbringt, die ein Interesse an der Sicherheit der Region haben dürften: unsere Nato-Verbündeten und andere Partner, aber auch die zentralasiatischen Staaten, die Golfstaaten und der Iran, Russland, Indien und China. Keine dieser Nationen profitiert von einem Stützpunkt der Terroristen der al Kaida und einer Region, die ins Chaos versinkt. Alle haben ein Interesse an der Perspektive eines dauerhaften Friedens, von Sicherheit und Entwicklung.“ (Rede Obama zur Vorstellung der Policy Review zu Afpak, Rediff, 27.03.09)
Mit der Einbeziehung der UNO als (mit-)zuständigem Gremium für die Regelung der Afpak-Affäre und dem Appell an ihr Eigeninteresse sollen weitere Großmächte und sogar der Iran zur Kooperation geködert werden: weder ein Sieg der Extremisten noch die Ausweitung des Drogenanbaus noch das Abgleiten der Region in völlige Instabilität könne ihnen gleichgültig sein. Wenn Amerika bloß noch in der Pose des Organisators und Koordinators einer Mission zur Bewältigung eines gemeinsamen Problems auftritt, kann doch keine verantwortungsvolle Regierung dieser Welt sich seiner Führung entziehen.
Wenn sich die USA wieder darauf einlassen, Weltordnung als Gemeinschaftswerk der internationalen Staatenwelt zu organisieren, dann hat das für alle anderen Nationen Konsequenzen – auch sie müssen lernen, was der Change von ihnen verlangt:
- Israel darf nicht länger als regionale Supermacht den Nachbarn vorschreiben, was sie für die Sicherheit des jüdischen Staats zu leisten haben, und für die Durchsetzung dieser Ansprüche mit seiner militärischen Überlegenheit sorgen. Die Führung in Jerusalem hat sich den Beschlüssen der internationalen Gemeinschaft unterzuordnen und geschlossene Verträge zu erfüllen.[20] Die arabischen Staaten aber sollen im Gegenzug auf ihre Isolationspolitik gegenüber Israel verzichten.
- Die anderen Weltordnungsmächte sollen ihre Politik aufgeben, zu Staaten, die bisher von den USA diplomatisch isoliert wurden, Sonderbeziehungen zu pflegen und sich Einflusssphären zu verschaffen – gemeint sind zum Beispiel Frankreich und Russland im Falle Syriens oder China im Falle des Sudan.
- An der Iran-Affäre macht die neue amerikanische Führung schließlich deutlich, was ihr Verzicht auf ineffektive Alleingänge und die Anerkennung des Weltsicherheitsrats als dem für Weltordnungsfragen zuständigen Gremium für alle anderen Staaten zu bedeuten hat: Bei anhaltender Widersetzlichkeit des Iran gegen die Auflagen der internationalen Gemeinschaft sind erstens die fälligen Sanktionen zu beschließen und zweitens dann auch mit allen Konsequenzen von allen durchzusetzen.
II. Mit Russland die Welt atomwaffenfrei machen
Die neue US-Regierung hat mit Russland einiges vor. Für die Bewältigung der Herausforderungen
durch Atomwaffen und Extremismus hält sie einen Change in den beiderseitigen Beziehungen für dringend geboten:
„Diese Herausforderungen erfordern eine globale Partnerschaft, und diese Partnerschaft wird stärker sein, wenn Russland seinen rechtmäßigen Platz als Großmacht einnimmt.“ (Obama, Rede in Moskau, 7.7.09)
Neue Töne im Umgang mit dem Kreml; Amerika rückt ab von der Linie der Bush-Administration, dem (immer noch) viel zu großen und viel zu potenten Staat im Osten eigene weltpolitische Interessen und Mitspracherechte auszutreiben; seine Positionen in den großen weltpolitischen Streitfällen vom Typus Kosovo schlicht zu übergehen und ihn mit der unipolaren Entscheidungsmacht der USA zu konfrontieren; sein unmittelbares strategisches Umfeld mit bunten Revolutionen stückweise friedlich zu erobern, die militärische Einkreisung voran zu treiben; ihn so zu schwächen und zurecht zu stutzen, dass er sich widerspruchslos einfügt in die „Ordnung“, die die einzig übriggebliebene Supermacht der Staatenwelt diktiert. An die Stelle dieser Politik der Konfrontation und Schwächung tritt unter Obama die förmliche Anerkennung Russlands als Großmacht und die Einladung und Aufforderung, sich als Großmacht stark zu machen für die Bekämpfung der Hauptgefahren, die dem Weltfrieden aus amerikanischer Sicht heute drohen – die amerikanischen und russischen Bestände an Nuklearwaffen und die unkontrollierte weitere Verbreitung der Atombombe:
„Heute gibt es den Kalten Krieg nicht mehr, aber Tausende dieser Waffen gibt es noch immer. Durch eine merkwürdige Wendung der Geschichte hat die Bedrohung eines Nuklearkriegs ab-, aber die Gefahr eines Angriffs mit Atomwaffen zugenommen. Mehr Länder sind nun im Besitz dieser Waffen. Es werden weiterhin Tests durchgeführt. Auf den Schwarzmärkten wird mit nuklearen Geheimnissen und Materialien gehandelt. Die Technologie für den Bau einer Bombe hat sich verbreitet. Terroristen sind entschlossen, eine Bombe herzustellen, zu kaufen oder zu stehlen. Unsere Bemühungen, diese Gefahren einzudämmen, konzentrieren sich auf eine globale Nichtverbreitungsordnung, aber wenn mehr Menschen und Länder die Regeln brechen, könnten wir den Punkt erreichen, an dem diese Ordnung nicht mehr standhalten kann.“ (Obama, Rede in Prag, 5.4.09)
1. „Den Kalten Krieg beenden“: Eine ganze Ebene der strategischen Konfrontation zwischen Russland und den USA aus dem Verkehr ziehen
Der neue Präsident ist herzlich unzufrieden mit seinem Vorgänger; nicht nur, dass sich dessen Hoffnungen – die unter Jelzin eine ganze Weile erfreulich gut aufzugehen schienen – nicht erfüllt haben, Russlands Atomstreitmacht erledige sich durch Rostfraß und Geldmangel über kurz oder lang ganz von selbst. Mit seiner rabiaten Konfrontationspolitik hat Bush Amerika gleich in mehrfacher Weise einen Bärendienst erwiesen: Sie hat erstens dazu geführt, dass Russland sich ganz generell an die Reparatur seines Militärs gemacht und im Georgien-Krieg gezeigt hat, dass es seine Lektion in Sachen Imperialismus gelernt hat und willens und fähig ist, eine Berücksichtigung seiner Interessen gegen die USA zu erzwingen. Sie hat zweitens mit dem Vorrücken der Nato bis an die russischen Grenzen und dem geplanten Raketenabwehrsystem in Polen und Tschechien den Kreml vor die Frage gestellt, was sein letztes und mächtigstes Kriegsmittel unter den neuen Bedingungen noch wert ist, und so eine neue Runde atomare Aufrüstung provoziert: Russland hat Teile seines Arsenals an Nuklearsprengköpfen und Trägerwaffen restauriert und modernisiert, um die drohende Entwertung seiner Zweitschlagsfähigkeit abzuwenden. Mit der mehr oder minder kompletten Beendigung der Rüstungsdiplomatie mit dem Kreml hat Bush sich schließlich drittens auch noch eines Mittels der Information, Verifikation und Kontrolle über den Stand der gegnerischen Atomrüstung begeben und den „Gesprächsfaden“ abreißen lassen, den Nukleargewalttäter der obersten Kategorie dringend brauchen, um sich über Art und Umfang ihrer ungeheuren Vernichtungskapazitäten zu verständigen, damit der Gegner nicht versehentlich zerstört oder das Gleichgewicht des Schreckens
nicht – mit ebenfalls unabsehbaren fatalen Folgen – in unliebsamer Weise durcheinander gebracht wird, kurz: er hat Russland für die USA unberechenbarer gemacht. In seiner Amtszeit hat Putin den Vertrag über Konventionelle Waffen in Europa (KSE) einseitig ausgesetzt und – als Reaktion auf die Raketenabwehrpläne – laut darüber nachgedacht, auch aus dem russisch-amerikanischen Vertrag über die Abschaffung von Raketen mittlerer und geringer Reichweite (INF-Vertrag) auszusteigen, also ein neues Wettrüsten in einer schon einvernehmlich ad acta gelegten Waffenkategorie zu eröffnen.
Hinterher weiß man’s eben besser im Weißen Haus; man braucht nur vom unerwünschten Ergebnis auf die falsche Politik zu schließen – und alle sonstigen relevanten ‚Begleitumstände‘ wie die Interessen und Mittel der anderen Akteure kurzerhand zu vergessen –, dann wird klar, dass Bush nicht nur eine Gelegenheit verpasst, sondern mit seiner Intransigenz für das Fortbestehen des gefährlichen Atomszenarios gesorgt hat. Das soll jetzt entschärft werden – auf amerikanisch zupackende Weise: Der neue Präsident verkündet Russland und der atomwaffenbesitzenden Restwelt, die schon alle wissen werden, warum sie sich dieses potenteste aller Massenvernichtungsmittel zugelegt haben, seine ab sofort gültige Sichtweise zu diesem Thema: Atomwaffen sind ein Risiko für die Welt und sonst nichts; ein falscher Knopfdruck kann die Katastrophe auslösen, sie könnten in falsche Hände kommen (worunter man sich politische Irrläufer in Russland genau so vorstellen darf wie Staaten vom Schlage Nordkoreas oder „Extremisten“), deswegen müssen sie schnellstmöglich abgeschafft, auf jeden Fall in einem ersten Schritt substantiell reduziert werden. Das muss den zweitmächtigsten Atomstaat – welche Gründe er auch immer gehabt haben und immer noch haben mag, sich nuklear zu bewaffnen – einfach davon überzeugen, dass diese Gründe, von einer höheren Warte aus betrachtet, hinfällig und seine Arsenale überflüssig geworden sind. Obama hat in seiner großen Moskauer Rede noch nachgelegt und den Russen zusätzlich erklärt, dass Atombomben heute eigentlich nur mehr dem Prestige
dienen, so dass beiden Nationen geholfen wäre, wenn sie sich von dieser überflüssigen, gefährlichen und teuren Last befreien.
Das freilich ist nicht ganz die Wahrheit; die strategischen Atomwaffen, die Obama so gern aus dem Verkehr ziehen will, spielen nämlich derzeit die Hauptrolle in der Sicherheitsdoktrin des Kreml. Der Ausgangspunkt, von dem aus die USA ihre radikale (Ab-)Rüstungsdiplomatie eröffnen, unterscheidet sich in einem ganz entscheidenden Punkt vom russischen: sie haben – anders als ihr neuer Partner – ihre letzten Mittel sozusagen vervielfacht; sie verfügen neben der Nuklearwaffe über eine global wirksame Vernichtungsdrohung mit konventionellen Sprengköpfen, die in ihrer Wirkung atomaren nahe kommen, und über Waffenträger, die es erlauben – so sieht es die Strategie der Prompt Global Strikes
jedenfalls vor –, jeden Punkt auf der Welt in einer Reaktionszeit von max. 60 Minuten vernichtend zu treffen. Wenn sie Atomwaffen zur Disposition stellen, um Russland zu substantiellen Konzessionen zu bewegen, opfern sie Teile einer Waffenkategorie, an der ihre globale Abschreckungsmacht längst nicht mehr hängt, auch wenn natürlich so viele Atomsprengköpfe in den Arsenalen bleiben, wie die Generäle brauchen, um für jeden erdenklichen Fall gerüstet zu sein.
Die amerikanische Seite geht mit dem Interesse in die neuen START-Verhandlungen, auf jeden Fall – wie von den US-Militärs schon zu Bushs Zeiten vergeblich gefordert – wieder Berechenbarkeit in die beiderseitige Atomrüstung zu bringen,[21] aber auch mit einem weit anspruchsvolleren Ziel: Russlands Interkontinentalraketen auf ein für die USA durch Raketenabwehrsysteme militärisch handhabbares – also substantiell unschädliches – möglichst niedriges Maß zu dezimieren. Die andere Seite pocht – soviel man hört – ganz besonders auf ein Junktim zwischen defensiven und offensiven Systemen und wartet auch sonst mit allerhand Forderungen auf, und so rechten die Unterhändler in Genf über Ober- und Untergrenzen für Spreng- und Ersatzsprengköpfe, Trägermittel, den Ein- oder Nicht-Einbezug taktischer Atomwaffen, usw. usf.
Eine irgendwie geartete Einigung in diesen Fragen braucht Obama unbedingt; sie ist eine wichtige Vorbedingung für die Bewältigung des zweiten Kardinalproblems mit der Atomwaffe: Proliferation.
2. „Die Vision einer atomwaffenfreien Welt verwirklichen“: Ein neues Nonproliferations-Regime über die Welt verhängen
Obamas atomares Bedrohungsszenario verlagert die Gefahr, die den USA droht, vom atomaren Schlagabtausch auf Atomwaffen in den falschen Händen; da sind sie nämlich eine nicht hinzunehmende Gefahr und Amerika, meint der Visionär im Weißen Haus, stehe in der moralischen Verpflichtung
, sie von ihnen fern zu halten und die Welt atomwaffenfrei zu machen, schon wegen der schlimmen Erfahrungen in Nagasaki und Hiroshima.
Und auch da gibt es viel zu tun, weil die Vorgängerregierung auf der ganzen Linie versagt hat: Die Gefahr eines weltweiten Atomkriegs hat sich verringert, das Risiko eines atomaren Angriffs ist gestiegen.
(Obama, Rede in Prag, 5.4.09)
Das Ergebnis beweist auch hier die Fehler der Bush-Politik: den USA ist es nicht gelungen, Schurkenstaaten durch Drohungen und Sanktionen von ihren Atomprogrammen abzubringen; ganz offenbar hat es den einschlägigen Maßnahmen an Durchschlagskraft gemangelt, weil die Regierung nicht für den nötigen breiten Konsens und allgemeine Unterstützung in der Staatenwelt gesorgt, sondern unilateral agiert hat. Sie hätte eigene Verpflichtungen aus dem Atomwaffensperrvertrag nicht missachten und so unnötig Widerstand produzieren dürfen,[22] und sie hätte letztlich auch wissen müssen, dass mit nuklearen Sonderdeals wie im Fall Indien [23] die Proliferation nicht zu bremsen ist: Dass wir uns schützen können, indem wir die Länder aussuchen, die diese Waffen besitzen dürfen, ist eine Illusion.
(Obama, Rede in Moskau, 7.7.09)
Alles in allem: Die Politik der einseitigen Diktate
hat es nicht vermocht, die Welt zu amerikanischen Bedingungen zu befrieden, alle Unbefugten nuklear zu entwaffnen. Und das ist ein untragbarer Zustand für den neuen Präsidenten; ihn stört wie Bush, dass die atomare Bewaffnung anderer Staaten den USA ein unkalkulierbares und massives Restrisiko in militärischen Auseinandersetzungen beschert, denn diese Staaten machen sich für die USA in einem ganz entscheidenden letzten Punkt unkalkulierbar. Anders herum: Sie beschränken die Freiheit der USA, die Kriege zu führen, die sie für nötig halten – und auf der Eskalationsstufe, die ihnen angemessen erscheint. Außerdem ist den USA noch ein ganz anderes, ernst zu nehmendes Risiko durch die von Bush zu verantwortende Erosion des NPT-Regimes (Non Proliferation Treaty) in den letzten Jahren erwachsen: die Gefahr, dass Terroristen sich in den Besitz der Atombombe bringen und Amerika Schäden von noch ganz anderem Kaliber zufügen als 9/11.
Weil einseitige Diktate diese Probleme ganz offenkundig nicht lösen, muss es eben anders, multilateral, gehen:
„Aber kein Land kann den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts allein begegnen oder dem Rest der Welt seine Bedingungen diktieren. Das wissen die Vereinigten Staaten jetzt, genauso wie Russland es weiß. Darum (sic!) streben die Vereinigten Staaten ein internationales System an, das Ländern ermöglicht, ihre Interessen friedlich zu verfolgen, besonders wenn diese Interessen auseinandergehen; ein System, in dem die allgemeinen Menschenrechte geachtet und Verletzungen dieser Rechte geahndet werden; ein System, in dem wir uns selbst an denselben Standards messen, die wir auch für andere Nationen anlegen, mit klaren Rechten und Verpflichtungen für alle.“ (Obama, Rede in Moskau, 7.7.09)
Obama tritt an mit dem Bedarf, das Nuklear-Kontroll-Regime, das Bush teils einfach mißachtet, teils – mit wenig Erfolg – durch neue, original amerikanische bi- und multilaterale Nonproliferationsvereinbarungen wie die Proliferation Security Initiative zu ersetzen und effektiver zu machen versucht hatte, als von allen Staaten akzeptiertes und dadurch wirksames „internationales System“ neu zu organisieren. Für ein derart durchgreifendes neues Regime müssen andere Mächte gewonnen werden; sie müssen daran beteiligt werden, so dass sie sich deshalb automatisch für die Durchsetzung nützlich machen. Wirksame Gefolgschaft muss da organisiert werden, vor allem mit Russland.
Weil dieser Staat vom Uran über die Urangewinnungs-, Anreicherungs- und Wiederaufarbeitungstechnologie bis hin zu Nuklearwaffen und Trägermitteln jeder Größe über alles verfügt, eine Unmenge von einschlägig gebildeten Fachleuten inklusive, was für die zivile und militärische Nutzung der Atomtechnologie gebraucht wird; weil Russland die weltweit ergiebigste Ressource für jeden Bedarf auf diesem interessanten Feld darstellt, kommt es ganz besonders darauf an, dass seine Führer – wie im Fall der „überflüssig“ gewordenen Atomwaffen – die Übersetzung der Unzufriedenheit Obamas mit einer außer Kontrolle geratenen Atomrüstung in ein allgemeines Leiden mitmachen und sich für die Lösung eines Menschheitsproblems einspannen lassen. Da trifft es sich gut, dass entsprechende – von Bush ignorierte – Anträge aus Moskau seit längerem vorliegen:
„Gerade unsere Länder, die mit ihrem Kernwaffen- und Raketenpotenzial an der Spitze stehen, sollten sich auch an die Spitze stellen bei der Ausarbeitung neuer, härterer Maßnahmen bei der Nichtweiterverbreitung. Russland ist dazu bereit.“ (Putin auf der Wehrkundetagung in München 2007)
Russland wird beim Wort genommen; es erhält das Angebot, nicht wie in der Vergangenheit als Teil des Problems traktiert – diese Linie hat sich ja gerade blamiert! –, sondern als Hauptakteur der Problemlösung respektiert zu werden – und sich eine Sonderstellung in der Staatenwelt zu verdienen.
Die neu eröffnete Diplomatie, die Russland als atomare Großmacht anerkennt und ihm „Führerschaft“ an der Seite der USA bei der Bekämpfung der Proliferation anbietet, hat einen eindeutigen Zweck: der Partner soll seine bisherige Politik der Waffenexporte und des Verkaufs von Atomtechnologie dem neuen übergeordneten Gesichtspunkt unterwerfen. Teils erwachsen ihm hier Pflichten zur besseren Kontrolle im Inneren (Unterbindung des illegalen Handels von nuklearem Material an unseren Grenzen
), teils Verpflichtungen zur wirksamen Kontrolle und Unterbindung des internationalen Handels mit dem Zeug, in den der „Partner“ heftig involviert war und ist (Effektive Exportkontrollen
; Ausweitung und Vertiefung der Zusammenarbeit, um die Sicherheit von nuklearen Einrichtungen auf der ganzen Welt zu erhöhen; Minimierung der Verwendung von hochangereichertem Uran, usw.). Das anvisierte gemeinsame Regime läuft darauf hinaus, dass Russland seine politischen und ökonomischen Kalkulationen mit seinen enormen nuklearen Potenzen dem strategischen Interesse der USA unterordnet. Weil das viel verlangt ist, bietet Obama Russland auch auf dem Feld der nuklearen Proliferation für die Erfüllung seiner Pflichten neue Rechte und ein riesiges Geschäftsfeld an: Er verspricht zum einen, den von Bush junior auf den Weg gebrachten, dann stillgelegten russisch-amerikanischen Vertrag über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der zivilen Atomenergiewirtschaft in Kraft zu setzen und der russischen Atomindustrie so die bislang verwehrte Lizenz zur globalen Betätigung zu erteilen, zum anderen – und darin liegt der eigentliche imperialistische Witz der Sache – sichert er Russland eine politische Ausnahmestellung in einem von den beiden Hauptatommächten der Welt auferlegten neuen und strikteren Nichtverbreitungs-Regime zu: Über die Potenzen (fast) aller anderen Nationen auf diesem wichtigen Feld der Staatenkonkurrenz (mit) zu wachen und an ihnen zu verdienen: als anerkannte Wiederaufarbeitungszentrale, als Aktivist bei der Verbesserung der Sicherheit von nuklearen Einrichtungen, der Umrüstung von Reaktoren weltweit auf schwach angereichertes Uran, usw.
Ein neues Atomregime
Was Obama bei seiner Vision einer atomwaffenfreien Welt vor Augen steht, ist die Erneuerung und Umdefinition eines Bush-Bedürfnisses: Eine Entwaffnung der Staatengemeinde, aber nicht durch Androhung und Anwendung von unipolarer Gewalt, sondern durch die von Russland und den USA durchgesetzte Verpflichtung aller Nationen auf Abrüstung und eine lückenlose Kontrolle allen spaltbaren Materials und die institutionelle Verankerung dieser Kontrolle in einem neuen internationalen Nonproliferations- und Sanktions-Regime:
„... möchte ich heute eine internationale Anstrengung ankündigen, alles spaltbare Material auf der Welt innerhalb von vier Jahren zu sichern. Neue Standards und Normen zu schaffen, eine stärkere Kooperation mit Russland einzuleiten, um alle Möglichkeiten zu verfolgen, dieses Material unter Kontrolle zu bekommen. Dann müssen wir die schwarzen Märkte unter Kontrolle bekommen, den Handel unterbinden und alle Instrumente einsetzen, um diesen gefährlichen Handel zu unterbinden. (...) mehr Ressourcen, mehr Autorität für internationale Inspektionen. ... Unmittelbare Konsequenzen muss es geben für Länder, die die Regeln ignorieren ... Einige Länder werden die Regeln missachten. Und deshalb brauchen wir eine Struktur, die sicherstellt, dass es bei einer Missachtung Konsequenzen für das entsprechende Land geben wird. Gerade heute wurden wir noch einmal daran erinnert, warum wir einen neuen, energischeren konsequenteren Ansatz gegen diese Bedrohung brauchen. Nordkorea ... Regeln müssen eingehalten und ihre Verletzungen bestraft werden ... Jetzt ist es an der Zeit für eine starke internationale Reaktion!“ (Obama, Rede in Prag, 5.4.09)
Ein neues Kontrollregime soll aufgebaut und in die Form eines international anerkannten, fest institutionalisierten rechtlichen Regelwerks gegossen werden, das nicht mehr und nicht weniger enthält als die verbindliche Selbstverpflichtung aller Nationen – die eigene ist da nicht ausgenommen –, Inspektoren in jedes Labor zu lassen, in dem mit Uran-Isotopen hantiert wird oder werden könnte, und sich strafbewehrten Regeln
zu unterwerfen, die für jedes festgestellte Vergehen zwingend entsprechende Sanktionen fordern. Mit dieser Struktur
will der Präsident das ewige Rechten, ob überhaupt ein zu inkriminierender Sachverhalt vorliegt, das nervtötende Tauziehen um Mehrheiten für eine Verurteilung von Regelverstößen sowie den notorischen Streit um Art und Dauer von Sanktionen aus der Welt schaffen und das Problem ihrer Implementierung gleich dazu: Der Weg von der Feststellung einer Missachtung der Regeln zur Beteiligung an einer starken internationalen Reaktion
soll für alle Staaten zum kodifizierten Sachzwang werden. Regelverletzungen in Nuklearfragen sollen deswegen auch gleich vor dem obersten Gewaltorgan verhandelt werden; Obama denkt da an einen automatischen Verweis an den UN-Sicherheitsrat
.
Bei der Einrichtung dieses neuen Regimes ist Russland gefordert, seine Macht einzusetzen, um die Staatenwelt auf den neuen Atomkodex festzulegen und dafür zu sorgen, dass Nationen wie Nordkorea endlich effektiv sanktioniert und zur Regelkonformität erpresst werden. Ein Global Nuclear Security Summit im nächsten Jahr soll die Staaten in diesem Sinn zusammenbringen und sie mit den erbrachten Vorleistungen und Forderungen der neuen Partner in Leadership konfrontieren, in der Berechnung, dass das atomare Quasi-Monopol der beiden Großen den anderen à la longue keine Wahl lässt, als sich in die neuen Konditionen der politischen Bewirtschaftung des spaltbaren Materials zu fügen. Womöglich haben die in der Gemeinsamen Erklärung zur nuklearen Zusammenarbeit
zwischen den USA und Russland in Moskau vereinbarten Maßnahmen bis dahin schon erste Wirkungen gezeigt, als da wären: intensivere Exportkontrollen, Minimierung des Einsatzes von hochangereichertem Uran (HEU), Intensivierung der Repatriierung von HEU auch aus Forschungsreaktoren und Verstärkung des internationalen Kontrollregimes. Zusätzlich wird noch die Ausweitung und Verstärkung der Global Initiative to Combat Nuclear Terrorism vereinbart, die mit russischer Beteiligung ganz neue Wucht erlangen soll.
So sollen sich die Nationen in ein Nichtverbreitungsregime hinein bugsieren lassen, das es den USA mit russischer Unterstützung gestatten würde, das Monopol über alles spaltbare Material zu verwalten. Im Gegenzug für den Verzicht auf Eigenmächtigkeiten bliebe den Atomaspiranten die geballte Feindschaft der beiden stärksten Nationen und der erfolgreich hinter ihnen versammelten Staatengemeinde (Isolation und internationaler Druck
) erspart, Zugang zur friedlichen Nutzung von Atomenergie
wäre erlaubt – freilich gebunden an Lizenzbedingungen und internationale Aufsichtsrechte.
3. Und überhaupt: Ein neues Arrangement mit Russland
Der Umgang der Bush-Administration mit Russland hat sich für Amerika nicht bewährt. Das Land ist keineswegs, wie Bush dachte, unumkehrbar auf dem absteigenden Ast, der überwältigenden Macht der USA alternativlos ausgeliefert. Im Gegenteil: Es hat sich in den Jahren der brachialen Eindämmungspolitik des Texaners als Macht aufgebaut, die Amerika nicht mehr einfach ignorieren kann. In dieser Hinsicht war die Botschaft aus dem Georgien-Krieg klar und eindeutig: Russland besteht auf Berücksichtigung seiner Interessen, und es ist bereit und fähig, sie gegen die USA durchzusetzen. Diese Botschaft ist bei Obama angekommen; er beantwortet sie nicht mit noch viel mehr amerikanischer Gegengewalt – von einer Fortführung der unproduktiven russisch-amerikanischen Feindschaft hält der neue Präsident nichts – sondern mit dem Versuch, mit Russland zu für die USA brauchbare(re)n Arrangements zu kommen. Das Insistieren auf nationalen Interessen in Moskau heißt ja schließlich nicht, dass man mit dieser Nation nicht zu nützlichen Formen der Kooperation finden könnte. Insofern stellt die dem Kreml angetragene Partnerschaft zur Lösung des Atom-Problems einen groß angelegten Test dar, ob und wie sich der Umgang mit Russland funktionaler gestalten lässt; wie viel Gegensatz, Druck, Umzingelung, Zersetzung etc. nötig ist, wie viel sich besser durch do ut des regeln lässt, zum Beispiel der Aufbau einer Raketenabwehr gegen russische Einflussnahme auf das Atomprogramm des Iran. Das gesamte Feld der amerikanisch-russischen Beziehungen steht neu zur Debatte.[24]
Russische Dienste für eine gewaltfreie Welt werden aktuell schon dringlich gebraucht, nämlich im Fall Afghanistan. Da sind sich die beiden Seiten schnell näher gekommen. Russland soll sich sehr viel weitreichender als bisher schon mit logistischen Dienstleistungen einklinken in den Hauptkrieg Amerikas; dass es von der Zerstörung der Region betroffen ist (Destabilisierung Zentralasiens), eröffnet den USA eine hervorragende Gelegenheit für die Vermarktung der neuen „Kooperation“, auf die sie dringend angewiesen sind. So sehr, dass der Souveränität des Partners ausdrücklich die Reverenz erwiesen wird: Russland verlangt und erhält das Recht auf Kontrolle und Durchsuchung jeden Transports über russisches Territorium. Gleichzeitig und daneben, damit keine Missverständnisse aufkommen, betont der US-Vize-Außenminister das Recht der zentralasiatischen GUS-Staaten auf tatsächliche Unabhängigkeit
.[25]
Die Frage, wo das rechte Maß zwischen Kooperation und Subsumtion im neuen Umgang mit Russland liegt, wird exemplarisch ausgetragen an den Fällen Georgien und Ukraine. Dass diese schönen amerikanischen Errungenschaften bei der Zersetzung des russischen „Nahen Auslands“ unbedingt erhalten werden müssen, versteht sich; eine Anerkennung irgendwelcher russischer Einflusszonen kommt auch für Obama nicht in Frage. Andererseits soll der in Kiew und Tiflis ins Amt gehievte Antirussismus und Revanchismus sich in der neuen politischen Konstellation mit Russland nicht störend bemerkbar machen. Ein interessantes imperialistisches Problem, das die neue Regierung bislang löst mit einer abwechselnden Dosis Dämpfung (‚Keine militärische Lösung im Südkaukasus!‘) und Aufmunterung (‚Die territoriale Integrität Georgiens ist unverletzlich!‘) ihrer Kreaturen.
III. Lateinamerika: Das Ringen um eine neue US-Führungsrolle im vormaligen „Hinterhof“
1. Das Programm
Ein neuer Ton: Die USA bieten und fordern ein Ende der Anfeindungen
Zur Einstimmung auf den OAS-Gipfel in Trinidad und Tobago im April – dem erstem Treffen des US-Präsidenten mit den versammelten Staatschefs Lateinamerikas, ausgenommen Kuba – schlägt Obama neue Töne an. Mit programmatischen Worten kündigt er an, sich neu und wieder gebührend um Lateinamerika als ureigenes Feld US-amerikanischer Verantwortung zu kümmern:
„Zu oft haben die Vereinigten Staaten zu ihren Nachbarn keine Beziehungen gesucht und unterhalten. Wir haben uns zu leicht von anderen Prioritäten ablenken lassen und übersehen, dass unser Fortschritt unmittelbar mit dem Fortschritt auf dem gesamten amerikanischen Kontinent verbunden ist.“ („Eine bessere Zukunft für den gesamten amerikanischen Kontinent“, Artikel des US-Präsidenten in mehreren US- und lateinamerikanischen Zeitungen vom 16.4.)
Das soll jetzt anders werden. In einer Mischung aus Kritik an der Politik seines Vorgängers und Kritik an seinen Adressaten eröffnet er den versammelten lateinamerikanischen Staatschefs eine neue Perspektive:
„Während wir uns dem Amerika-Gipfel nähern, steht unsere Hemisphäre vor einer klaren Entscheidung. Wir können unsere gemeinsamen Herausforderungen mit einer gemeinsamen Zielsetzung überwinden, oder wir können weiterhin in den Debatten der Vergangenheit festgefahren bleiben. Zum Wohle aller Bürger in unseren Ländern müssen wir die Zukunft wählen.“ (Ebd.)
Deswegen rechnet er erst einmal mit der Vergangenheit ab, die er überwinden will.
Erstens mit falschen Gegensätzen:
„Wenn wir uns der Wirtschaftskrise stellen wollen, brauchen wir keine Debatte darüber, ob wir eine starre, staatlich gelenkte Wirtschaft oder ungezügelten und unregulierten Kapitalismus wollen – wir benötigen pragmatische und verantwortungsbewusste Maßnahmen, die unseren gemeinsamen Wohlstand fördern. Zur Bekämpfung von Gesetzlosigkeit und Gewalt benötigen wir keine Debatte darüber, ob rechte Paramilitärs oder linke Aufständische schuld sind – wir benötigen praktische Zusammenarbeit zur Förderung unserer gemeinsamen Sicherheit.“ (Ebd.)
Der Mann hat Nerven. Die blutigen Auseinandersetzungen in lateinamerikanischen Ländern; der Terror von Paramilitärs und regulären Armeen gegen soziale Protestbewegungen; der Kampf der Guerillas; nationale Programme, die auf Alternativen zur ökonomischen Ausrichtung auf den Weltmarkt und auf Unabhängigkeit vom übermächtigen Einfluss der USA gerichtet sind; der Kampf der einheimischen Bourgeoisie mit tatkräftiger Unterstützung aus Washington gegen sie: Das alles sind überflüssige, störende pur ideologische Grabenkämpfe und Schnee von gestern. Was zählt, sind gemeinsame Herausforderungen von heute, die es vereint zu bewältigen gilt!
Mit dieser Deutung der Lage setzt sich der Mann im Weißen Haus souverän darüber hinweg, welche Gegensätze da mit Gewalt ausgetragen werden – und wie es überhaupt um die Mehrheit der lateinamerikanischen Länder, die er ins Auge fasst, bestellt ist. Da kommen Staaten mit ihrer Rolle in der US-Ordnung nicht zurecht. Da sind Länder, die sich zu Geschäftssphären des Dollar- und sonstigen internationalen Kapitals zugerichtet haben und zugerichtet worden sind, mehrheitlich zu ‚failing states‘ verkommen. Und dahin hat nicht nur das jahrzehntelange segensreiche Wirken des Kapitals geführt. Jahrzehnte amerikanischer Ordnungspolitik haben ihre Wirkung getan: Die USA haben ja selbst und mit entsprechenden Kräften vor Ort und deren militärischer Ausstattung sowie politischer Unterstützung dafür gesorgt, dass Nationen nicht von diesem Weg abkommen, auch wenn ihre Rechnungen nicht aufgehen, das Volk verelendet und das Land ruiniert wird. Mit Terror und permanenten Bürgerkriegen sind soziale Aufstände und nationale Opposition niedergemacht, falsche Regierungen beseitigt worden – und, wo ein Aufstand ausnahmsweise erfolgreich war, im Fall Kuba, hat Washington die neue Herrschaft den Erfolg büßen lassen. Die Fortschritte von Freiheit, Demokratie und Marktwirtschaft unter amerikanischer Oberregie sind nicht ausgeblieben: Inzwischen verwalten und kontrollieren demokratische Regierungen aus den Reihen der Oberschicht und Militär und Milizen das wachsende Elend der Massen, sorgen dafür, dass die Geschäfte ihren Gang gehen – und werden in ihren kapitalistischen Armenhäusern der Zerstörungen in ihren Gesellschaften mit ihrer staatlichen Gewalt nicht Herr. Denn mit der Bereicherung internationalen Kapitals am Land und der kleinen Schicht von Teilhabern im Land wachsen auch Armut und Gewalt. Deswegen finden sich überall politische Aktivisten und nationale Kritiker, die diese Verhältnisse einer ordentlichen Nation für nicht würdig ansehen und den Niedergang ihres Landes und seines Volkes aufhalten wollen. Als Anhängsel der obersten Weltwirtschafts- und Weltordnungsmacht und nach deren Vorgaben rücksichtslos weiterzuwirtschaften, das halten sie angesichts der Lage ihres Landes für nationalen Verrat. Deswegen sinnen sie auf Alternativen, um ihre Massen zu erhalten und zu einem ordentlichen Staatsvolk zu machen, statt sie gewaltsam niederzuhalten, um die Reichtumsquellen für das Land fruchtbar zu machen und überhaupt den Staat zu konsolidieren – und setzen sich damit in Gegensatz zu den im Land herrschenden Kreisen und zu den Interessen der USA. So hat Washington neben Herrschaften, die ihm bei allen ‚guten Beziehungen‘ die Ordnungsleistungen schuldig bleiben, auf die es einen Anspruch erhebt, mit Staaten zu schaffen, die sich weigern, US-Kapitalinteressen und Ordnungsansprüche überhaupt als den unverrückbaren Ausgangspunkt nationalen Vorankommens und als oberste Richtschnur ihrer nationalen Politik anzuerkennen.
Und das soll alles nur das Werk ideologischer Verbohrtheit sein, die einfach nicht erkennt, worum es eigentlich geht!
Allerdings, diesen Vorwurf will Obama seinem Vorgänger nicht ersparen, sind die USA an dieser ideologischen Frontbildungen selber mit schuld:
„Die Vereinigten Staaten haben viel dafür getan, Frieden und Wohlstand in der Hemisphäre zu fördern, aber wir haben manchmal unser Engagement vernachlässigt und manchmal versucht, unsere Bedingungen zu diktieren... Zu oft ist die Gelegenheit, neue Partnerschaft zwischen den amerikanischen Staaten zu eröffnen, durch rückwärtsgewandte Debatten untergraben worden.“ (Obama auf der OAS-Konferenz, whitehouse.gov 17.04.09)
Kein Konflikt, der nicht aus den Gegensätzen resultiert, die Dollarkapital und US-Gewalt stiften; kein Gewaltaffäre, in die nicht die USA mittelbar oder unmittelbar eingemischt sind; keine politische Auseinandersetzung, in die nicht Washington federführend involviert ist und bei der es nicht nach seinen Ordnungsvorstellungen die Richtlinien zu diktieren beansprucht –: Und der Mann im Weißen Haus entdeckt neben vielen guten Taten Washingtons bloß ein paar Fehlgriffe im diplomatischen Vorgehen und – ausgerechnet – zu viel Abstinenz! Für einen Präsidenten der Weltmacht Nr. 1 mag das ja eine ungewöhnlich radikale Kritik an der US-Politik der Vergangenheit und das Äußerste an Zugeständnis an die lateinamerikanischen Vorwürfe gegen die ungeliebte Vormacht im Norden sein. Jedenfalls zeugt das von der Gewissheit, dass Washington zuständig ist für die Geschicke Lateinamerikas, und von dem Willen, sich dieser ‚Verantwortung‘ zu stellen: Denn eigentlich – einmal nüchtern und zukunftsorientiert betrachtet – ist US-amerikanisches Engagement doch das, was Lateinamerika braucht.
Deswegen muss dann auch mal Schluss sein mit dem Beschwören von ‚Fehlern der Vergangenheit‘. Die will der neue Präsident schließlich hinter sich lassen, und das sollten die Angesprochenen deshalb ihrerseits tunlichst auch. Denn diese amerikanische Selbstkritik schließt selbstverständlich ein, dass damit den Anwürfen, Washington führe sich als rücksichtslose Vormacht gegenüber Lateinamerika auf, die Grundlage entzogen ist. Das sind – jetzt endgültig – sachlich unbegründete, nur ideologisch motivierte Anfeindungen. Er ist der Beweis: Washington hat sich gewandelt und muss sich doch nicht dauernd lauter Sünden aus uralten Zeiten vorhalten lassen, womöglich noch bevor ich geboren war
- wie Obama müde lächelnd den nicaraguanischen Präsidenten Ortega abfertigt. Jetzt ist es an den Anklägern, ihre Anwürfe gegen die Führungsmacht fallen zu lassen – und sich – ebenfalls – zu wandeln:
„Es war nicht immer leicht, aber die Vereinigen Staaten haben sich geändert. Und daher denke ich, ist es wichtig, sie, werte Kollegen, daran zu erinnern: Nicht nur die USA müssen sich verändern. Wir alle haben die Verantwortung für unsere Zukunft. Ich denke, es ist wichtig anzuerkennen, was die vergangenen Verdächtigungen angeht, dass die Politik der Vereinigten Staaten sich nicht in andere Länder einmischen sollte; aber das heißt auch, dass wir nicht den Vereinigten Staaten für alle Probleme die Schuld geben sollten, die in der Hemisphäre aufgetreten sind. Das ist Teil des Handels. Das ist Teil des Wandels, der stattfinden muss. Das ist der alte Weg, und wir brauchen einen neuen Weg.“ (Ebd.)
Obamas Lagebestimmung: eine Generalkritik an Bushs verfehlter Politik
Mit dieser – weltöffentlich mit Erstaunen und von Konservativen in den USA mit Entsetzen aufgenommenen – öffentlichen ‚Vergangenheitsbewältigung‘ geht Obama demonstrativ auf Distanz zur Politik, die sein Vorgänger verfolgt hat. Dem legt er nämlich zur Last, dass die Stellung der USA als anerkannte Vormacht angegriffen ist – und das in der Region, die die Verantwortlichen amerikanischer Weltpolitik immer schon und immer noch als eine eigene Sphäre der Betätigung und Sicherung ihrer ökonomischen und politischen Interessen betrachten, in der sie mit der Vorherrschaft ihres Dollarkapitals rechnen, mit ihrer militärischen Dominanz und ihrem politischen Gewicht die Staatsverhältnisse unter weitgehendem Ausschluss der restlichen Welt zu bestimmen beanspruchen, eine Region mithin, die für ihre Weltmacht eine strategisch herausragende Rolle spielt. Die Privatisierungspolitik in ganz Lateinamerika hat die Vorherrschaft des Dollars nicht gestärkt, statt dessen sind amerikanischem Kapital Konkurrenten um Rohstoffe, Märkte und Investitionsgelegenheiten erwachsen. Die Subsumtion der ganzen Region unter ein von den USA initiiertes und dominiertes Wirtschaftsbündnis ist am Widerstand der großen Staaten und der Linksregierungen gescheitert, die auf Initiative Venezuelas ein Gegenbündnis auf den Weg gebracht haben und eine eigene lateinamerikanische Energiekooperation anstreben. China und die EU sind längst Konkurrenten bei der Erschließung und Sicherung von Rohstoffressourcen. Und mit Brasilien wächst in der Hemisphäre ein ‚Schwellenland‘ zu einer aufstrebenden Macht heran. Kuba hat sich behauptet und sogar neue Unterstützung gewonnen. Linksregierungen sind in Venezuela und anderswo an der Macht, Staatsführungen, die sich mit ihrer ökonomischen Abhängigkeit von den USA und deren negativen Folgen nicht abfinden und in ihr einrichten wollen und die sich gegen US-Einflussnahme zur Wehr setzen. Sie ernten Zustimmung, die umgekehrt die USA einbüßen. Auf der anderen Seite nehmen bei den Verbündeten der USA das Drogengeschäft und die Privatgewalt nicht ab, sondern zu. Regierungen sind nicht mehr imstande, ihre inneren Verhältnisse ordentlich unter Kontrolle zu halten. Mit all dem ist Washingtons Sonderrolle als politische Aufsichtsmacht über Lateinamerika beschädigt und angegriffen.
Gegen diese für die amerikanische Vormacht unerträgliche Entwicklung ist Bush auf seine Weise angegangen: gegen Drogensumpf und Privatgewalt in den ‚failing states‘, gegen Guerillaorganisationen, Linksregierungen und Kuba schon gleich. Das alles hat er als ein Konglomerat antiamerikanischer Umtriebe und als eine einzige Bedrohung amerikanischer Sicherheit betrachtet, hinter der die linken Feinde stecken: Die Rede vom „Narcoterrorismus“ und seinen staatlichen Helfershelfern war ja nicht nur ein Schlagwort, sondern eine grundsätzliche politische Feindschaftserklärung. Bush hat damit die störenden politischen Bestrebungen in den weltumspannenden ‚war on terror‘ einbezogen und sie entsprechend bekämpft. Das gewaltsame Vorgehen gegen den Drogenanbau und -handel in verschiedenen Ländern, die Intensivierung des Kampfs gegen FARC und ELN in Kolumbien, die Unterstützung des gescheiterten Putsches in Venezuela, die Verschärfung der Kuba-Sanktionen, die diplomatischen Anfeindungen und Drohungen gegen Chávez und Morales: Das alles war Teil des Programms, mit der Ordnungsmacht der USA deren ausgemachte Feinde zur Räson zu bringen, Bastionen Washington genehmer, von ihm und mit ihm militärisch kooperierender Staaten aufzubauen, ferner die ökonomische Anbindung möglichst vieler lateinamerikanischer Staaten an die USA institutionell fortzuschreiben und abzusichern und so die amerikanische Kontrolle über die Region insgesamt wieder zu stärken.
Obama legt seinem Vorgänger den mangelnden Erfolg dieser Bemühungen zur Last und weiß auch, woran das liegt: Bush hat die US-schädigenden Entwicklungen und die Problemlage, als die sich die Region insgesamt für die Ordnungspolitik der Aufsichtsmacht darstellt, gar nicht ernstlich ins Auge gefasst und erfolgsversprechend angepackt. Statt dessen hat er sie durch die Einordnung in sein Programm ‚war on terror‘ ideologisiert, unnötige Fronten eröffnet, dadurch Washingtons Gegnern eher noch Auftrieb gegeben, die Beziehungen auch zu anderen Staaten belastet, statt die Interessen der Staaten, die doch schon aufgrund ihrer weitgehenden Abhängigkeit von den USA auf Washington verwiesen sind, für die USA zu nützen – kurz: Bush hat mit seinem Verhalten aus den Zeiten des Kalten Krieges ... zum Anschwellen des Antiamerikanismus nicht zuletzt in Lateinamerika
(FAZ, 23.4.) beigetragen, zudem diese wichtige Region viel zu sehr vernachlässigt und so den US-Einfluss geschwächt, statt gestärkt.
So einfach bringt ein US-Präsident die Sache auf den Begriff: Washington muss nur besser führen, dann erledigt sich Antiamerikanismus.
Das neue Angebot: Gemeinsamer Kampf gegen die drängenden Probleme Lateinamerikas unter amerikanischer Führung
Das will er und kündigt deshalb Lateinamerikas obersten Repräsentanten eine bessere Zukunft, bietet allen ein neues ‚Wir‘ und echte Kooperation an:
„Ich versichere ihnen, wir streben nach einer gleichberechtigten Partnerschaft. Es gibt keinen Senior- und keinen Juniorpartner in unsere Beziehungen, sondern einzig eine Beziehung, gegründet auf gegenseitigen Respekt, gemeinsame Interessen und gemeinsam geteilte Werte.“ (whitehouse.gov 17.04.09)[26]
Die Unzufriedenheit mit den Staatenverhältnissen im Süden der Hemisphäre und den Anspruch, da für Ordnung zu sorgen, trägt Obama den Adressaten nicht als Anspruch der mit ihren Interessen richtungsweisenden Vormacht an, die gebieterisch auf Gültigkeit ihrer Ordnungsinteressen dringt, sondern stellt ihnen den Ordnungsbedarf Washingtons als ihr eigenes Bedürfnis nach Verbesserung ihrer Herrschaftszustände vor Augen, das sie auf die USA als ihren machtvollen Helfer verweist. Als solcher macht er ihnen das Angebot einer Partnerschaft, in der die USA als kooperationswilliger und respektvoller primus inter pares agieren. Die Vormacht polarisiert nicht mehr, erklärt unliebsame Regime in der Hemisphäre nicht mehr zu unverbesserlichen Gegnern und Teil einer antiamerikanischen Weltbedrohung und verlangt, sich für oder gegen sie zu bekennen. Ihr oberster Vertreter plädiert dafür, das ‚Wesentliche‘ jenseits der Anfeindungen ins Auge zu fassen, und macht allen das Angebot, sich am Kampf gegen die drängenden Probleme auf der Südhälfte des Kontinents zu beteiligen: Linksregierungen, die sich ihrer rechten Gegner zu erwehren haben, ebenso wie Regierungen vom Schlage Uribes in Kolumbien und Calderóns in Mexiko, die unter amerikanischer Regie mit militärischer Gewalt in ihren Staaten mit Drogensumpf und Guerillabewegungen aufzuräumen versuchen – sie alle spricht er als von Instabilität und Gewalt Betroffene und deshalb auch vernünftigerweise am gleichen Kampf Interessierte an.
Die Bedrohungen sieht er nämlich anders als sein Vorgänger im Amt: Lateinamerika stellt sich für ihn als eine Problemzone dar, in der es generell an Stabilität und Kontrolle, an gesicherten staatlichen Verhältnissen für die Interessen der USA fehlt.
Deswegen stehen gemeinsame Anstrengungen in Sachen
„Sicherheit“
an oberster Stelle:
„Die Sicherheit unserer Bürger muss durch unsere Entschlossenheit gefördert werden, Partnerschaften mit denen einzugehen, die überall auf dem amerikanischen Kontinent mutig gegen Drogenkartelle, Banden und andere kriminelle Netzwerke vorgehen. Unsere Bestrebungen fangen zu Hause an. Indem wir die Nachfrage nach Drogen verringern und dem illegalen Zufluss von Waffen und großen Mengen von Bargeld über unsere Grenze im Süden Einhalt gebieten, können wir die Sicherheit in den Vereinigten Staaten und darüber hinaus erhöhen. Wir werden in Zukunft einen dauerhaften Dialog in unserer Hemisphäre führen, um sicherzustellen, dass wir auf den besten Methoden aufbauen, uns an neue Bedrohungen anpassen und unsere Bestrebungen koordinieren.“ (Artikel, 16.4.)
„Wir dürfen Gewalt und Unsicherheit nicht tolerieren, gleichgültig, woher sie kommt ... Illegale Waffen dürfen nicht frei in kriminelle Hände gelangen und illegale Drogen dürfen nicht Leben zerstören und unsere Ökonomie angreifen.“ (Rede auf der OAS-Konferenz, whitehouse.gov 17.04.09).
Obama nimmt Abstand von der Ineinssetzung von Drogensumpf, Guerilla-Bewegungen und Linksregierung. Die politischen Abweichlerstaaten sind ein Problem, Drogen, Gewalt, Unruhen, Aufstände, die Ordnung gefährdende Armut ein anderes. Da sind nicht immer und überall lauter antiamerikanische Umtriebe und Feinde Amerikas unterwegs, die vor allem und bei allem bekämpft werden müssen. Sondern da ist staatsbedrohliches organisiertes Verbrechen genauso am Werk wie andere Gewalt, gegen die man entschieden vorgehen muss. Daher richtet Obama das Augenmerk darauf, jenseits politischer Feindschaften der ausufernden Gewalt und dem organisierten Verbrechen auf dem eigenen Boden und in Lateinamerika durch eine verstärkte gemeinsame Kontrolle von Geld- und Waffenströmen die Mittel zu entziehen. Dafür sollen die Staaten zusammenarbeiten – und daran unterscheidet er dann auch, wer brauchbar, kooperativ, wer unwillig oder unfähig ist, da mitzuwirken.
„Wohlstand“
Das ist klar: Was amerikanisches Kapital und Dollar in ihrer lateinamerikanischen Geschäftssphäre an Verelendung, grassierender Armut, zerstörter ‚Umwelt‘, ruinierten Staatshaushalten in den Ländern produziert haben, dafür trägt Washington keine Verantwortung. Umgekehrt: Dass ganze Länder dank ihrer Rolle als Rohstoffquellen und Großplantagen von Fruit- und anderen Companies, als Billiglohnstätte, als Absatzmärkte und Anlageobjekte der Lebensmittel-, Kommunikations- und Energiekonzerne zu Armenhäusern verkommen sind, das gehört zum Umkreis der ‚Probleme‘ dieser Länder, die es zu ‚lösen‘ gilt. Also steht Besinnung an, was diese Länder an den USA haben: einen Partner für ihr Streben nach ‚Wohlstand‘ und ‚Überwindung der Armut‘. Nein, die Zentrale des Kapitalismus ist da nicht dogmatisch und fordernd, ihr oberster Chef erinnert nur daran, wo die gemeinsamen Interessen liegen, wenn es um den ökonomischen Fortschritt ‚unserer Hemisphäre‘ geht. Statt wie die alte Regierung als radikaler Anwalt der von Amerikas Multis repräsentierten Segnungen des freien Marktes mehr Öffnung und weitere Fortschritte in der Privatisierungspolitik zu fordern und die Verstaatlichungen in Venezuela und anderswo zu geißeln, preist Obama – jenseits aller Gegensätze in Fragen des richtigen ‚Wirtschaftsmodells‘ – die US-Ökonomie und deren geschäftliches Vorankommen als die Basis lateinamerikanischen Wirtschaftens an. Wenn die Vereinigen Staaten die Geschäfte ihrer Kapitalisten voranbringen, dann bringen sie damit auch die krisengeplagten Länder im Süden voran:
„Die Vereinigten Staaten arbeiten daran, Wohlstand auf der Hemisphäre voranzubringen, indem wir unsere eigene Erholung ankurbeln. Indem wir das tun, tragen wir dazu bei, Handel, Investitionen, Geldüberweisungen und Tourismus zu fördern, die wiederum eine breitere Grundlage für Wohlstand auf der Hemisphäre bilden.“ (Artikel, 16.4.)
Und sie tun damit etwas für die Massen und damit auch ihre Herrschaften, die in den Emigranten eine unverzichtbare Dollar-Einkommensquelle besitzen – das stiftet Proamerikanismus:
„Die Menschen in Lateinamerika wollen, dass die Vereinigten Staaten erfolgreich sind; denn in den Norden gehen viele Exporte, und aus dem Norden kommen die Überweisungen der Immigranten. Dieses weitverbreitete Potential des guten Willens gilt es auszunutzen.“ (zitiert in der FAZ, 23.4.)
Der Präsident der weltgrößten Wirtschaftsmacht erinnert daran, dass Lateinamerikas Ökonomien ihre erste Adresse, ihren entscheidenden Markt und ihren Hauptkapitalgeber in der US-Wirtschaftsmacht haben. Das soll gemeinsame Interessen stiften.
Um Lateinamerika als erweiterte Geschäftssphäre seiner Multis und als Energie- und Rohstoffreservoir verstärkt zu nutzen, bietet er der anderen Hälfte der Hemisphäre eine neue strategische Partnerschaft an:
„Ein Bereich, der enorme Versprechungen birgt, ist der der Energie. Unsere Hemisphäre verfügt über reichliche natürliche Ressourcen, die erneuerbare Energien vielfältig und nachhaltig machen könnten, während sie Arbeitsplätze für unsere Bürger schaffen...
Aus diesem Grund freue ich mich darauf, eine neue energie- und klimapolitische Partnerschaft für den gesamten amerikanischen Kontinent aufzubauen, die uns helfen wird, voneinander zu lernen, Technologien auszutauschen, Investitionen zu nutzen und unsere Wettbewerbsvorteile zu maximieren.“ (Artikel, 16.4.09)
„Ich schlage heute die Schaffung einer neuen Energie- und Klimapartnerschaft vor, die sich den Weitblick und die Entschlossenheit von Ländern wie Mexiko und Brasilien zunutze machen wird, die schon Hervorragendes auf diesem Gebiet geleistet haben, um erneuerbare Energie zu fördern und die Treibhausgas-Emission zu verringern.“ (whitehouse.gov 17.06.09)
Damit meldet er – als Angebot – den Willen der USA an, Lateinamerika neben seiner Rolle als Lieferant fossiler Energierohstoffe auch als Reservoir für Bioenergie, eine immer wichtigere Option im Programm seiner Energiepolitik, zu nutzen und nicht zuletzt damit die Konkurrenten um die strategische Sicherung kapitalistischer Wachstumsgrundlagen in Lateinamerika aus dem Feld zu schlagen. Zugleich konterkariert er mit diesem Vorhaben die alternativen Bestrebungen einer lateinamerikanischen Energiekooperation unter Führung Venezuelas. Die USA haben vor, dank Mexiko und Brasilien unabhängiger vom Öl und damit von einem seiner Hauptlieferanten, Venezuela mit seinem unberechenbaren Chávez, zu werden.
„Demokratie“
„Jede unserer Nationen hat das Recht, ihren eigenen Weg zu gehen. Aber wir alle haben die Verantwortung darauf zu achten, dass die Völker Amerikas die Möglichkeit haben, ihre eigenen Träume in demokratischen Gesellschaften zu verfolgen.“ (Ebd.)
Auch wenn der neue Mann im Weißen Haus den Ordnungsauftrag der USA in Lateinamerika nicht wie Bush vornehmlich als erbitterten Kampf gegen Feinde Amerikas und ihren Sumpf versteht, sich vielmehr demonstrativ zurückhaltend gibt, was die Polarisierung in gut und böse angeht; auch wenn er jenseits aller Differenzen den Staaten das Recht auf Eigenständigkeit konzediert – für einen Präsidenten der Ordnungsmacht, die sich seit ewig für die Ausrichtung lateinamerikanischer Staaten zuständig und zum Eingreifen befugt weiß, eine weitreichende Konzession –: Er lässt keinen Zweifel daran, dass ‚good governance“ der bleibende Anspruch ist. Gerade weil er öffentlich vom Anspruch Abstand nimmt, mit seiner Macht die nationalen Bemühungen zu ‚zensieren‘, darf und muss er allen Staaten auch die ideellen Verpflichtungen auf gutes Regieren vorbuchstabieren: ‚Freiheit‘ und ‚Demokratie‘. Und die vertragen sich natürlich nicht mit gewissen Regimes, die diesen Washingtoner Maßstäben nicht genügen. Wenn sie den USA Einmischung in ihre nationale Souveränität vorwerfen, so müssen die sie daran erinnern, dass ihre Völker ein Recht auf Freiheit haben.
2. Das praktische Ringen um Ordnung in der ‚Problemzone‘ Lateinamerika und um eine anerkannte amerikanische Vormachtstellung
Diplomatische Gesten gegenüber den Linksregierungen
Mit seinem Auftreten auf dem Gipfel signalisiert der neue Präsident den lateinamerikanischen Staatsmännern, dass er es ernst meint mit dem Angebot, sich den ‚eigentlichen‘ Problemen Lateinamerikas jenseits aller ideologischen Streitigkeiten zu widmen. Der mächtigste Mann der Welt schüttelt seinem Hauptwidersacher Chávez die Hand, hört sich im Gegensatz zu seinem Vorgänger auch die Anschuldigungen des nicaraguanischen Präsidenten, dessen sandinistischer Regierung die von Reagan ausgerüsteten Contras bekanntlich ehemals einen blutigen Bürgerkrieg geliefert haben, eine Stunde lang ungerührt an und kann sogar darüber scherzen: ein glaubwürdiger Beweis von Respekt und Überlegenheit: Hier agiert nicht der hässliche Gringo, sondern ein gelassener Vertreter einer Weltordnungsmacht, der sich von seinem Versprechen, „zuzuhören“, nationale Standpunkte zur Kenntnis zu nehmen und Gemeinsamkeiten auszuloten, nicht abbringen lässt.[27]
Mit Venezuela und Bolivien wird eine Wiederaufnahme der Botschaftsbeziehungen auf den Weg gebracht. Außenministerin Clinton führt Gespräche mit den Präsidenten von Bolivien und Ecuador, Morales und Correa, mit der Perspektive, dass wir viel mehr Gründe für eine Kooperation miteinander als für Differenzen haben.
(state.gov, 09.06.09)
Die US-Administration empfiehlt diesen beiden lateinamerikanischen Armenhäusern also, auf das amerikanische Interesse an ihnen und ihren Rohstoffen zu setzen, und testet aus, wieweit sie in ihrer desolaten Lage dazu bereit sind, ‚antiamerikanische‘ Positionen aufzugeben, statt sich mit Venezuelas Unterstützung behaupten zu wollen. Im Unterschied zu Bush reiht sie einen Mann wie Correa nämlich nicht automatisch in die Riege der von Kuba und Chávez angeführten Feinde der USA ein, sondern kann sich durchaus vorstellen, dass er mit seiner ‚Revolution der Bürger‘ sogar für mehr Ordnung in seinem Land sorgen könnte – wenn er sich darauf besinnt, dass ihm die neue Regierung im Weißen Haus mehr zu bieten hat als nur Anfeindungen.
Im Kampf gegen Drogenmafia und Gewalt: Mehr Kooperation und US-Militärpräsenz
Beim Kampf gegen das organisierte Verbrechen des Drogen- und Waffenhandels, den der neue Präsident ja zu der vordringlichen Aufgabe einer effektiveren US-Ordnungspolitik erklärt hat, knüpft Obama an die Fortschritte an, die die Bush-Regierung mit ihrem Kampf gegen den ‚Narco-Terrorismus‘ erreicht hat. Die Ankündigung, dagegen noch entschiedener als bisher auch in den USA vorzugehen, richtet sich deswegen vorwiegend an die Adresse der lateinamerikanischen Staaten, von denen Washington schon bisher Durchgreifen verlangt und die es dafür materiell gefordert und gefördert hat. Als ersten Staatsführer Lateinamerikas trifft Obama Mexikos Präsidenten und vereinbart die Intensivierung der Grenzkontrollen und des militärischen Vorgehens gegen die Drogenkartelle im Land. Kolumbien wird zu einem Hauptstützpunkt für US-Militär in der Region ausgebaut; ein neues Abkommen soll Washington die Nutzung von mehr Militärbasen als bisher sichern – auch als Ersatz für die von Ecuadors Präsidenten Correa gekündigte Nutzung eines Standorts in dessen Land; Kolumbien erhält im Gegenzug logistische Unterstützung, um mit der Drogenmafia und den Resten der FARC fertig zu werden. So schreibt Obama die mit dem ‚Plan Merida‘ und ‚Plan Colombia‘ institutionalisierte Kooperation fort – und zwar ganz in deren bisherigem Sinn: Die US-Ordnungsmacht implantiert sich vor Ort machtvoller als zuvor.
Eine neue Anti-Kuba Politik: Statt bedingungsloser Feindschaft Nachhilfe für einen radikalen ‚change‘ des ewigen Störenfrieds
Als demonstrativen ersten – nach übereinstimmender Ansicht aller Beobachter äußerst mutigen – Beweis seiner neuen Politik in Lateinamerika lockert Obama einen Teil der US-Sanktionen gegen Kuba, seit 60 Jahren erklärter Hauptfeind der USA in der Region: Exilkubaner dürfen wieder öfter in ihre ehemalige Heimat reisen und Dollars an Verwandte überweisen. Für diesen als humanitären Akt gefeierten Beschluss führt er in gebührenden Worten ziemlich pragmatische Gründe an: Die Sanktionen insgesamt haben ihren Zweck, das Regime zu erledigen, nicht erreicht:[28]
„Wir suchen einen Neuanfang mit Kuba.“
„Diese Woche haben wir eine Kubapolitik berichtigt, die es seit Jahrzehnten nicht geschafft hat, für die Kubaner Freiheit oder Chancen zu fördern. Insbesondere die Weigerung, Amerikanern kubanischer Abstammung ihre Familien besuchen zu lassen oder ihnen Ressourcen bereitzustellen, war nicht sinnvoll – vor allem nach Jahren der wirtschaftlichen Not in Kuba und den zerstörerischen Hurrikanen, die im vergangenen Jahr auftraten. Diese Politik hat sich jetzt geändert.“ (Artikel, 16.4.)
Seit dem Ende der Sowjetunion, die 30 Jahre lang Kuba ein Überleben im Vorhof der USA recht und schlecht gesichert hat, haben die US-Regierungen damit gerechnet und deswegen ihre Bemühungen verstärkt, dass Kuba zusammenbricht. Ein immer umfassenderes Sanktionsregime, in das sie zunehmend auch andere Staaten einbezogen haben, um Kuba verlässlich von benötigten Weltmarktmitteln abzuschneiden und zu isolieren, sollte das verhasste Regime in die Knie zwingen und hat es ja auch geschafft, den hoffnungsfrohen kubanischen Sozialismus in einen Überlebenskampf mit ziemlich ärmlichen Mitteln zu verwandeln. Zusammengebrochen ist Kuba aber nicht, und aufgegeben hat es auch nicht.
Bush hat daraus den Schluss gezogen, dass Washington umso mehr darauf bestehen muss, dass diese Herrschaft kein Existenzrecht hat, und dafür Sorge tragen muss, dem Land ein Überleben zu verunmöglichen. In seinem Weltordnungsprogramm hat er Kuba den Platz eines lateinamerikanischen Helfers und Förderers des Terrorismus (Al Kaida, Iran, Nord-Korea, ETA, FARC, ELN, gefährliche Biotechnologie ...
) zugewiesen, den Staat also in die weltweit bekämpfte Achse des Bösen einsortiert. An Kuba als dem ausgemachten Vorreiter antiamerikanischer Bestrebungen hat er exemplarisch den Willen der USA demonstriert, politischen Alternativen in seiner Hemisphäre keine Chance zu lassen. Deswegen hat er das Sanktionsregime noch einmal verschärft und keinen Zweifel daran gelassen, dass die Sanktionen aufrechterhalten werden ... bis die beiden Castro-Brüder von der Macht weg sind.
(International Herald Tribune, 10.10.06). Unter anderem sind Reisen und Überweisungen nach Kuba beschränkt worden – als ein Hilfsmittel, den Kubanern klarzumachen, wo sie hingehören:
Das kubanische Volk hat die Wahl: Ökonomische und politische Freiheit und Chancen – oder mehr politische Repression und ökonomisches Elend unter seinem gegenwärtigen Regime.
(Verlautbarung der von Bush eingerichteten Commission for Assistance to a Free Cuba, CAFC, 10.6.06)
Diesen besonders umstrittenen Teil der Sanktionen lockert Obama jetzt ein wenig und kehrt damit zur US-Praxis früherer Zeiten zurück. Das soll erstens als Geste der Rücksichtnahme und Botschaft verstanden werden, dass seine Politik zwischen dem Volk mit seinen Nöten und seiner Führung zu unterscheiden gewillt ist, wenn er sich für „Freiheit und Demokratie“ in Kuba stark macht. In diesem Sinne ist die Lockerung auf Wirkung berechnet: Während Bush in den Besuchen und privaten Dollarzuflüssen vornehmlich falsche Überlebenshilfen für die Castro-Herrschaft gesehen und sie deshalb beschnitten hat, sieht Obama darin umgekehrt eher einen Hebel, zersetzend ins Land hineinzuwirken: Da werden die Vorzüge der Freiheit aus den USA von Landsleuten persönlich nach Kuba hineingetragen und mit den privaten Dollars die Armseligkeit der Staatsversorgungswirtschaft bloßgestellt. Dollarbesitz als materielles Privileg: Das taugt mehr als jede regierungsamtliche Propaganda für die Einsicht, wie viel besser das kubanische Volk mit Dollars und Freiheit bedient ist.[29]
Zugleich und vor allem ist diese Lockerung aber gedacht als ein diplomatisches Signal Washingtons an die kubanische Führung, dass die US-Regierung Kuba nicht mehr bedingungslos als den unverbesserlichen Feind behandeln und zum Abtreten zwingen will. Die US-Regierung eröffnet Kuba die Chance zur Diplomatie – allerdings einer Diplomatie besonderer Art: Die Gegenseite bekommt die Gelegenheit zu beweisen, dass sie zu dem Wandel fähig und willens ist, den die Zentrale von Freiheit und Demokratie erwartet:
„Die US-Regierung bietet Havanna eine Debatte über Menschenrechte, Pressefreiheit, demokratische Reformen und wirtschaftliche Zusammenarbeit an. Der Ball liegt nun auf der kubanischen Seite.“ (Der Sprecher des Weißen Hauses, Robert Gibbs)
Die neue US-Administration streitet den guten Willen Kubas nicht gleich vollständig ab, sondern nimmt sich vor, den zweiten Castro auf die Probe zu stellen, wie ernst es ihm mit ‚Reformen‘ ist, die die Schiedsinstanz in Washington definiert. Deswegen gibt Washington außer seiner ‚humanitären Geste‘ die Sanktionen auch nicht auf, sondern gibt ihnen eine neue Funktion. Sie werden als Instrument einer Erpressungsdiplomatie in Anschlag gebracht: Kuba wird die schrittweise Lockerung in Aussicht gestellt als Lohn für Fortschritte im Umgang mit Oppositionellen, in Fragen der Auswanderung, in Sachen Rechtsstaatlichkeit und demokratische Reformen, bei der wirtschaftlichen Öffnung ... kurz: Fortschritte in Richtung ‚Demokratie und Freiheit‘, über die die USA ebenso entscheiden wie über die Erleichterungen, die als Lohn winken. So will die neue US-Regierung dem Ziel näherkommen, das das kubanische Regime ihr so lange beharrlich verweigert:
„Wir denken, dass die Menschen in Kuba ihr Schicksal selbst bestimmen sollten und dass sie in Freiheit und mit der Aussicht auf Wirtschaftswachstum leben sollten.“ (Vize-Präsident Biden, FAZ, 30.3.)
Also ein neues Programm, Kuba aufzubrechen: Das Regime bekommt die Chance zum ‚regime change‘.
Die OAS als Bühne des diplomatischen Ringens um einen Kuba-Kompromiss nach Washingtons Geschmack
Dieses Programm ist dann auch Gegenstand eines diplomatischen Ringens auf der nächsten OAS-Konferenz. Die US-Regierung ist nämlich gewillt, ihr Kuba-Programm zur offiziellen Leitlinie der lateinamerikanischen Staatengemeinschaft zu erheben. An diesem für alle Beteiligten exemplarischen Fall will sie ihre Richtlinienkompetenz gegen die nationalen Ambitionen der verschiedenen lateinamerikanischen Staaten, die sich gegen amerikanische ‚Bevormundung‘ sträuben, durchsetzen.
Auf dem OAS-Gipfel stellt sich die US-Vertretung deshalb gegen den von allen lateinamerikanischen Staaten unterstützen Antrag von Venezuela und anderen Linksregierungen, den 1962 von der damaligen US-Regierung durchgesetzten Ausschluss Kubas aus dieser Organisation bedingungslos zurückzunehmen. Außenministerin Clinton stellt klar, dass die USA zwar einer Rücknahme des alten Beschlusses zustimmen, aber Kuba sich die Wiederaufnahme erst noch zu verdienen hat. Das diplomatische Kompromissergebnis, von Chávez und anderen Linksregierungen als ihr Erfolg interpretiert und gefeiert, sieht dann genau dies vor:
„Viele Mitgliedsländer dachten ursprünglich daran, den Ausschluss von 1962 aufzuheben und Kuba eine sofortige Rückkehr zu erlauben ohne Bedingungen. Andere stimmten mit uns überein, dass das richtige Vorgehen ist, den Ausschluss – der nach beinahe einem halben Jahrhundert seinen Sinn verloren hat – zu ersetzen durch einen Dialogprozess und eine Entscheidung in der Zukunft. Das wird Kubas Engagement für die Werte der Organisation voranbringen. Ich bin erfreut, dass alle zu der übereinstimmenden Auffassung gelangt sind, dass Kuba nicht einfach seinen Sitz einnehmen kann und dass wir Kubas Teilnehmerschaft einer späteren Entscheidung anheimstellen – wenn es je um Wiedereintritt nachsucht.“ (Clinton, state.gov 03.06.09)
Damit weist Washington die Bestrebungen, am Fall Kuba die amerikanische Entscheidungshoheit über genehme und nicht-genehme Regime generell infrage zu stellen, in die Schranken. Die USA erteilen keine strikte Absage an das Begehren der versammelten Lateinamerikaner, beharren aber darauf, dass sie der letzte Richter darüber sind und bleiben, ob und wann sich Kuba den Status eines anerkennungswürdigen Mitglieds der Gemeinschaft verdient hat. Diese Sicht haben dann auch die lateinamerikanischen Staaten zu übernehmen und sich entsprechend zu engagieren, wollen sie Freunde der USA sein. Das hat ihnen Obama ja schon früher gesagt:
„Genauso, wie die Vereinigten Staaten dieses Ziel, dass jedes Land in der Hemisphäre gemäß der inter-amerikanischen Demokratiecharta seinen Platz am Tisch einnehmen kann, in ihren Beziehungen zu den Bürgern Kubas verfolgen, erwarten wir von allen unseren Freunden in der Hemisphäre, gemeinsam die Freiheit, Gleichheit und Menschenrechte für alle Kubaner zu unterstützen.“ (Artikel, 16.4.)
Der Putsch in Honduras: Ein Präzedenzfall für die neue Führungsrolle der USA
In Honduras wird der Präsident von Militär und herrschender Oberschicht aus dem Amt gejagt. Der hat sich nämlich, ins Amt gekommen, vom Repräsentanten ihrer Interessen zum Anwalt einer Rettung des Staates gewandelt. Vom Standpunkt einer ordentlichen Nation her zieht er eine vernichtende Bilanz:
- Im Hinblick auf das Volk:
Armut, Elend und Ausgrenzung von mehr als vier Millionen Honduranern
(Rede beim Beitritt zum Alba-Bündnis); - Im Hinblick auf die ökonomischen Mittel des Staats:
Unabhängigkeit auf den Gebieten der Energie, der Wirtschaft und der Lebensmittelversorgung bis heute nicht erreicht
(Ebd.); - Im Hinblick auf die staats- und volksschädigende Wirtschaft:
Die Reichen rücken von sich aus überhaupt nichts heraus. Sie wollen alles für sich
(Ebd.); - Im Hinblick auf den bisherigen ökonomischen Weg des Landes:
Wie kann man behaupten, das Honduras vorankommt, wenn das Wasser, die Luft und die öffentlichen Dienste privatisiert werden?
(Ebd.) - Im Hinblick auf die Herrschaft:
Der bürgerliche Staat wird von den ökonomischen Eliten gebildet.
(El País, 28.6.)
Das will er als Präsident ändern, leitet deswegen rudimentäre soziale Reformen in die Wege, nimmt die Erdölverteilung in Staatshand und schließt sich dem Wirtschaftsbündnis der Linksregierungen unter der Regie von Chávez an. Denn er braucht Hilfe von außen und erhält sie auch in Form von Erdöl, Kredit und Traktoren aus Venezuela: Konfrontiert mit einer schweren ökonomischen Krise erhielt er von M. Chávez die Kooperation, die Washington sich sträubte ihm zu gewähren.
(Le Monde, 30.6.) Außerdem braucht er, um das Programm gegen die herrschende Oberschicht durchzusetzen, eine Absicherung seiner Führung im Innern und will sich die durch ein Verfassungsreferendum verschaffen. Dagegen revoltieren die bisher staatsbestimmenden Kräfte, setzen den Präsidenten ab und schaffen ihn ins Ausland. Der ruft das Volk daraufhin auf, „auf die Straße zu gehen“. Das Programm, mit Reformen das Land in Ordnung und eine ‚Entwicklung‘ zum Besseren für den Staat in Gang zu setzen, führt also umstandslos zu einem Machtkampf – und zur Infragestellung der Demokratie, die bisher dafür gesorgt hat, die jetzt angegriffenen Interessen an der Macht zu halten.
Der so entbrannte Kampf wird allerdings nicht im Land entschieden, sondern in den USA. Schließlich ist Honduras nichts anderes als ein von den USA gestiftetes und aufrechterhaltenes Staatsgebilde, das in seiner formellen Souveränität durch und für die USA existiert – eben das, was bürgerliche Begutachter verächtlich und Kritiker anklagend als ‚Bananenrepublik‘ bezeichnen: ökonomisch eine Großplantage für Bananen und Kaffee von US-Konzernen; ansonsten eine Sammelstelle von Dollarüberweisungen ihrer Emigranten; militärisch eine Außenstelle des US-Militärs und Stützpunkt für dessen Eingreiftruppe in Mittelamerika; was seinen Staatshaushalt angeht, ein Bankrottfall des IWF, der dieses zu den hochverschuldeten Ländern zählenden Staat mit Kredit und laufenden Entschuldungen am Leben hält; das alles bisher politisch abgesichert durch eine Demokratie, in der sich die ökonomische Nutznießerschicht im Land in Gestalt von zwei Parteien in der Präsidentschaft abwechselt, und durch das Militär, das nach innen für die Erledigung von Protesten sorgt.
Also ist die Obama-Regierung gefragt, wie sie sich zu dem Gegensatz stellt, den die politischen Verwalter dieses Staatsgebildes aktuell miteinander austragen. Honduras ist der erste Prüfstein, wie es die neue Mannschaft im Weißen Haus meint mit ihrem ‚change‘ in der Lateinamerika-Politik: Als Exempel seiner Entschlossenheit zu einer neuen Politik wird der Fall von Obama auch genommen – und als furchtbarer Präzedenzfall für die Region
(Obama, NYT, 5.7.) eingeordnet. Die Welt staunt und rechnet es Washington schon hoch an – oder kopfschüttelnd vor –, dass die Vormacht, von deren Entscheidungshoheit man selbstverständlich ausgeht, sich gegen ihre eigenen Kreaturen stellt: Neues im Hinterhof: Washington stellt sich die Seite eines Linkspopulisten und rügt den Umsturz in Honduras
. (FAS, 5.7.)
Auch und gerade in diesem Fall setzt sich Obama also demonstrativ von seinem Vorgänger und früheren US-Gepflogenheiten ab und verkündet eine scharfe Zäsur
gegenüber den Aktionen der Bush Administration, die 2002 dem kurzlebigen Putsch gegen M. Chávez eine schnelle stillschweigende Unterstützung angeboten hatte. In diese dunkle Vergangenheit wollen wir nicht zurück
, erklärt Obama, in der Militärstaatsstreiche sich über Wahlen hinwegsetzten.
(NYT, 5.7.)
„Demokratie“ buchstabiert er nicht mehr unmittelbar parteilich, also so, dass von echten demokratischen Zuständen nur gesprochen werden kann, wenn die Richtigen, die Parteigänger US-genehmer Politik am Ruder sind, sondern – so verkündet er – nach dem Grundsatz ehrlicher Wahlen. Nein, die USA ergreifen nicht mehr wie noch unter Bush Partei, machen sich rücksichtslos für den vor Ort stark, der ihre Interessen repräsentiert, und setzen sich über die Einsprüche der lateinamerikanischen Souveräne hinweg; sie polarisieren nicht und helfen diplomatisch und materiell nach, wenn die Falschen mit Wahlen an die Macht kommen; sie beweisen ihre Führungsstärke nicht mehr durch die Rücksichtslosigkeit, mit der sie auf einer ihnen genehmen Ausrichtung bestehen und in die nationale Politik in diesem Sinne eingreifen. Dagegen hat Obama schon wieder seinen Generaleinwand parat: Nicht effektiv, siehe den gescheiterten Putsch gegen Chávez!
Freilich, in der Sache lässt Obama, bei aller Kritik an den Putschisten, keinen Zweifel, da stimmt er mit dem Kurs, den Zelaya eingeschlagen hat, keinesfalls überein. Denn das, was er an sozialen Reformen und staatlichen Rettungsmaßnahmen in Angriff genommen, und die Helfer, die er dabei gesucht und gefunden hat – das geht selbstverständlich nicht in Ordnung und ist gegen Amerika gerichtet. Umso höher soll man es dem US-Präsidenten anrechnen, dass seine Regierung auf eine machtvolle Parteinahme und Feindschaftsansage verzichtet, wenn ein Kleinstaat, in dem die USA letztlich das Sagen haben, nicht umstandslos nach den Vorstellungen Washingtons regiert wird: Der Präsident der USA meint es ernst mit dem Respekt vor dem ‚Willen der Völker‘, Washington hält sich zurück, stellt sich sogar gegen seine Parteigänger, wenn die sich nicht an die Regeln der Demokratie halten:
„Die Vereinigten Staaten unterstützen die Wiedereinsetzung des demokratisch gewählten Präsidenten von Honduras, obwohl dieser sich entschieden gegen die amerikanische Politik gestellt hat. Wir tun das nicht, weil wir mit ihm einer Meinung sind. Wir achten das allgemeingültige Prinzip, dass Menschen ihre politischen Vertreter selbst wählen sollten, ob wir nun mit ihnen übereinstimmen oder nicht.“ (Rede in Moskau)
Die demonstrative Parteinahme für das Herzstück der Demokratie und die Zurückhaltung gegenüber den Putschisten hat allerdings ihre handfesten Gründe. Die Putschisten haben sich eine vom US-Präsidenten nicht genehmigte und sein Führungsprogramm störende Eigenmächtigkeit erlaubt, mögen sie auch auf Unterstützung in den ihnen verbundenen Kreisen in US-Militär, CIA und Konservativen bauen. Sie stören die Stabilität im eigenen Land, an der Washington gelegen ist. Sie stören seine gerade eröffneten diplomatischen Initiativen, die auf eine anerkannte Führungsrolle in Lateinamerika abzielen. Sie stören insbesondere sein Programm, das antiamerikanische Lager aufzubrechen, zu spalten – und für US-Interessen empfänglich zu machen. Mit dem Sturz des gewählten Präsidenten provozieren sie Volksaufruhr, statt Ordnung zu schaffen, stiften störende Gegnerschaft, radikalisieren den Konflikt mit dem honduranischen Präsidenten und treiben ihn Chávez in die Arme, während Washington gerade daran arbeitet, in seinem Sinne Einfluss auf die abweichenden nationalen Bestrebungen zu gewinnen. Kurz: Sie durchkreuzen seine ganze Linie und unterminieren das Programm, das Obama mit dem Schlachtruf ‚Demokratie‘ im Auge hat: Stabilisierung der lateinamerikanischen Staatsverhältnisse unter der Regie einer US-Aufsichtsmacht, die sich gerade dadurch bewährt, dass sie sich nicht in nationale Streitigkeiten parteilich einmischt, um die machtvoll zu entscheiden, sondern den Staaten an- und aufträgt und dabei mitwirkt, ihre Verhältnisse ‚in Ordnung‘ zu bringen.
Insofern und insoweit ist Obama den ‚Interventionsmus‘ und die ‚ideologischen‘ Streitigkeiten leid. Die Vormacht soll nicht mehr den ständigen Aufpasser spielen, der selber Konflikte entscheiden, womöglich noch einer Partei zur Macht verhilft und sie an der Macht hält, die dann doch nur ihr partikulares Interesse verfolgt, statt das übergeordnete Ordnungsinteresse Washingtons zu garantieren. Daran sollen sich die Politiker vor Ort orientieren; dafür, für Einigkeit unter den politischen Konkurrenten und für Befriedung der Massen, soll Demokratie taugen. Und das Militär soll deswegen als Garant der Stabilität und Ordnungsfaktor die alltägliche Gewalt in der Gesellschaft in den Griff bekommen, aber nicht als parteiliche Machtinstanz die politischen Auseinandersetzungen in der Führung entscheiden wollen.
Von diesem Standpunkt aus erkennt, d.h. anerkennt die amerikanische Regierung keinen unversöhnlichen Gegensatz zwischen den honduranischen Kontrahenten, sondern begreift deren Machtkampf als einen lästigen Störfall. Das sind untergeordnete Streitigkeiten, die ihren übergeordneten Aufsichtsinteressen zuwiderlaufen. Deswegen stellt sie sich als berufener Schiedsrichter demonstrativ über die widerstreitenden Parteien auf den Standpunkt demokratischer Legitimität und verlangt von beiden Seiten: Respekt vor der Demokratie
! Sie verurteilt die Putschisten, bringt aber auch nicht all ihre Mittel in Anschlag, um sie zum Aufgeben zu zwingen. Umgekehrt setzt sie sich demonstrativ für das demokratische Recht Zelayas auf Präsidentschaft ein, ohne ihm allerdings deswegen wieder ins Amt zu verhelfen. Statt dessen fordert sie von beiden Seiten, ihre unversöhnlichen Standpunkte zu relativieren und sich auf eine Regierung der Einheit und der nationalen Versöhnung
zu verständigen: Die Putschisten sollen sich also mit dem Mann, den sie gerade weggeputscht haben, friedlich-schiedlich ins Benehmen setzen – und umgekehrt Zelaya mit ihnen, damit der Störfall aus der Welt kommt. In diesem Sinne macht sich Washington, ausdrücklich im Verein mit und unter der Leitung der OAS, für Vermittlung
stark, setzt, nun wieder gegen den Willen der anderen OAS-Staaten, einen Getreuen als Vermittler durch, der den Streitparteien die übergeordnete Lesart von Rückkehr zur Legitimität
beibringen soll: Die Putschisten geben auf, und der Präsident kehrt ins Amt zurück; der muss dafür seinerseits auf sein Verfassungsreferendum, also auf die Möglichkeit einer Wiederwahl mit dem Volk im Rücken und damit auf die Fortsetzung seines Reformprogramms verzichten. Verlangt wird von ihm also die Aufgabe seines Machtprogramms als Preis für die Rücknahme seiner Entmachtung. So bekommen die Putschisten in der Sache recht und eine Handhabe, den falschen Kurs auf demokratischem Wege zu korrigieren.
Beide Seiten sollen also ihren Machtanspruch relativieren, statt eskalieren. Das macht ihnen Washington klar:
„Clinton hat Micheletti ermutigt, weiter an diesen Verhandlungen teilzunehmen, und geholfen, die möglichen Konsequenzen zu verstehen, wenn es nicht gelingt, Nutzen aus dieser Vermittlung zu ziehen.“ Zugleich lehnt sie die eigenmächtigen Rückkehrversuche Zelayas ab: „Wir haben dem Präsidenten Zelaya unsere Position klargemacht, dass nämlich Vermittlung der zu nehmende Weg ist.“ (junge welt, 22.7.)
Die Leistungen des allgemeinen Prinzips
, dem sich Obama als Leitlinie seiner Politik verschrieben hat, sind unübersehbar. Der Zynismus, ein von den USA geschaffenes Armenhaus wie Honduras mit seinen Elends- und latenten Bürgerkriegszuständen unter dem Gesichtspunkt zu verhandeln, ob da die Menschen ihre politischen Vertreter selbst wählen
, hat Methode. Gedacht ist in diesem Fall an Wiedereingemeindung und Unterordnung nationaler Unzufriedenheit, an Wiederherstellung der Einigkeit der herrschenden Klasse, also an eine Rückkehr zur demokratischen Verwaltung der unhaltbaren Zustände wie gehabt. Das sollen die da unten gefälligst hinbringen.
Gewichtiger als der Streit in Honduras ist allerdings der Richtungsstreit, der an diesem Fall in den USA eskaliert: Ob der neue Präsident nicht Parteigänger der USA bloßstellt und im Stich lässt, statt sich hinter sie zu stellen, linke Feinde Amerikas gewähren lässt, statt sie zu bekämpfen, sich von Chávez vorführen lässt, statt ihn in die Schranken zu weisen, Führungsschwäche, statt Stärke zeigt – also der amerikanischen Vormacht genau den Schaden zufügt, den er seinem Vorgänger anlastet.
[1] Ich freue mich darauf, mit Ihnen allen daran zu arbeiten, die Führungsrolle der Vereinigten Staaten durch Diplomatie zu erneuern, die unsere Sicherheit erhöht, unsere Interessen voranbringt und unsere Werte widerspiegelt.
(Hillary Clinton bei der Präsentation der neuen Außenpolitik im Senat, 13.1.2009)
[2] …die Programme dieses Ministeriums sind neu zu ordnen, um unsere Kapazitäten zu institutionalisieren und zu erhöhen für Kriege, in denen wir uns befinden, und für Szenarien, mit denen wir höchstwahrscheinlich in den kommenden Jahren konfrontiert sein werden, während sie uns zur gleichen Zeit vor anderen Risiken und Eventualitäten absichern.
(Verteidigungsminister Gates, Before the 111th Congress Senate Appropriations Subcommittee on Defense, 09.06.09)
[3] Den Terror gibt’s ab sofort nicht mehr. Die Vokabel wird getilgt, weil sich bei näherer Bestimmung, welche Nation wen oder was als selbigen verstanden und bekämpft haben möchte, gestern noch allzu schnell hässliche Misstöne ins Gemeinschaftswerk eingeschlichen haben. So wird der „War on Terror“ in eine „Overseas Contingency Operation“, so etwas Ähnliches wie eine Krisen- oder Notstandsaktion im Ausland umbenannt.
[4] In einem Briefing-Paper General McChrystals für Obama zur strategischen Einschätzung der Lage in Afghanistan schlägt er vor, mit den mittleren Chargen der Taliban Verhandlungen aufzunehmen: ‚Es gibt ein erhebliches Potential an Taliban-Kämpfern und –Führern, die ich die mittleren und niedrigen Ränge nennen würde, um die wir uns bemühen und denen wir die Wiedereingliederung zu den Bedingungen der Verfassung in Afghanistan anbieten sollten. Die meisten von ihnen machen mit wegen Geld, manche stehen unter dem Einfluss einer charismatischen Führung, manche sind frustriert wegen der lokalen Führer.‘ (…) Als Teil der neuen Strategie haben die US- und Nato-Truppen damit begonnen, ‚die erste Reihe der Taliban-Führung abzuräumen‘, zu denen der harte Kern der Militanten zählt. Die US-Strategieplaner hoffen, dass sie dadurch nicht nur die Hardliner der Talibankämpfer eliminieren, sondern dadurch auch ‚der zweiten Reihe‘ gestatten vorzutreten. Die zweite Reihe wird als entscheidend angesehen, weil solche lokalen Führer eine große Anzahl von Kämpfern im von Paschtunen dominierten Süden Afghanistans kontrollieren und anscheinend gesprächsbereit sind.
(Dawn, 30.07.09)
[5] Mit diesen Bezeichnungen hat die letzte US-Regierung ausgedrückt, dass sie die betreffenden Nationen gänzlich unter die Funktion subsumierte, die sie im Antiterrorkrieg der USA erfüllten bzw. derer sie verdächtigt wurden.
[6] ‚Das ist kein Krieg, den wir uns ausgesucht hätten (war of choice). Das ist ein Krieg, den wir gezwungenermaßen (war of necessity) führen‘, sagte Obama auf der jährlichen Konferenz der Veteranen der Auslandskriege, wobei er davor warnte, dass der Aufstand nicht von heute auf morgen besiegt werden könne. ‚Jene, die Amerika am 11. September angriffen, sind dabei, neue Anschläge zu planen. Falls man sie unkontrolliert lässt, bedeutet der Aufstand der Taliban einen sogar noch größeren Rückzugsraum, aus dem heraus al Kaida weitere Angriffe vorbereiten könnte, um mehr Amerikaner zu töten.‘ – Nachdem der planmäßige Abzug der US-Truppen aus dem Irak bis 2011 geregelt ist, versprach Obama, dass er in Zukunft Angehörige der Armee nur dann einer Gefahr aussetzen würde, wenn es absolut notwendig sei. ‚Wenn ich das tue‘, sagte der Präsident, ‚wird das auf guten geheimdienstlichen Erkenntnissen basieren und von einer gründlichen Strategie geleitet sein. Ich werde Ihnen eine klare Mission, fest umrissene Ziele und die Ausstattung und Unterstützung geben, die Sie brauchen, um den Auftrag zu erledigen‘ – eine klare Kritik an den Aktionen der Bush-Regierung im Irak.
(Los Angeles Times, 18.08.09) Was Change bedeutet, tritt klar umrissen hervor: der neue Präsident wird in Zukunft alles richtig machen, nur notwendige Kriege mit einer vernünftigen Strategie, klaren Zielvorgaben und adäquater Truppenausstattung führen. Dieser kühne Entschluss unterscheidet ihn fundamental von seinem kriegslüsternen Vorgänger.
[7] Abkommen zur Wiederwahl Benazir Bhuttos mit Nawaz Scharif, von Bushs Diplomaten in die Wege geleitet.
[8] Um unsere nationale Sicherheit und unsere gemeinsame Sicherheit zu verbessern, müssen wir das ganze Arsenal amerikanischer Macht und Erfindungsgabe in Anspruch nehmen. Um Schurkenstaaten zu zügeln, müssen wir uns effektiver Diplomatie und starker Allianzen bedienen. Um Terrornetzwerke zu durchbrechen, brauchen wir geschickte Geheimdienste, mit einer starken Führung … Um unseren Einfluss auf die Weltwirtschaft aufrechtzuerhalten, müssen wir unsere Fiskalpolitik in Ordnung bringen. Und um die Macht feindlicher Diktatoren zu schwächen, müssen wir uns selbst von unserer Ölsucht befreien. Keine dieser Machtäußerungen kann die Notwendigkeit eines starken Militärs ersetzen. Stattdessen ergänzen sie unser Militär und tragen dazu bei sicherzustellen, dass die Anwendung von Gewalt nicht die einzige uns zur Verfügung stehende Option ist.
(Obama, The American Moment: Remarks to the Chicago Council on Global Affairs, Speech on Restoring American Leadership, barackobama.com, 23.04.07)
[9] Aber im Laufe der Zeit haben wir erkannt, dass unseren übergeordneten Interessen besser gedient ist, wenn wir unsere Truppen sicher und verantwortungsbewusst aus dem Irak abziehen, einen Übergang hin zu voller irakischer Verantwortung für die eigene Nation unterstützen, unser überlastetes Militär wieder aufbauen und andere Nationen dazu zu bringen helfen, die Region zu stabilisieren und eine größere Instrumentenpalette zur Terrorismusbekämpfung zum Einsatz zu bringen.
(Anhörung von Senatorin Hillary Rodham Clinton, Amerikadienst, 13.01.09)
[10] Im Fall Pakistans müssen die Befehlshaber bloß noch davon überzeugt werden, sich auf die Hauptaufgabe der Bekämpfung des Terrorismus umpolen und von ihrem „konventionellen“ Feindbild Indien zu lassen: Um die pakistanischen Rückzugsräume für Extremisten erfolgreich zu schließen, ist ein beständiges und intensives strategisches Engagement mit der zivilen und militärischen Führung Pakistans erforderlich. Das ist unerlässlich, um unsere Bemühungen, die pakistanischen Sicherheitskräfte – sowohl das Militär als auch die zivile Strafverfolgung – sowohl zu entwickeln als auch dazu zu befähigen, anhaltende Operationen der Aufstandsbekämpfung durchzuführen. Wir müssen sicherstellen, dass Pakistan die Ressourcen und die Ausbildung hat, sein Militär neu zu eichen weg von einer traditionellen konventionellen Bedrohungshaltung hin zu einer, die sich mit den Extremisten an seiner Westgrenze befasst, die eine Gefahr für Afghanistan, Pakistan und die Vereinigten Staaten darstellen.
(Holbrooke, Hearing on Afghanistan and Pakistan: Oversight of a New Interagency Strategy, house.gov, 24.06.09)
[11] Unter der Führung von General Petraeus und mir implementieren wir gerade einen neuen integrierten zivil-militärischen strategischen Ansatz zur Kommunikation in Afghanistan und Pakistan. Dieser Ansatz nimmt drei Ziele zur gleichen Zeit in Angriff: Neudefinition unserer Botschaft; neuartige Verbindung zur Bevölkerung vor Ort in Afghanistan und Pakistan über Handys, Radio und andere Nachrichtenträger; und die Identifizierung und Unterstützung der Hauptkommunikatoren, die über lokale Erzählungen und Geschichten die Propaganda der Extremisten kontern können und eine positive Alternative präsentieren.
(Holbrooke, Hearing on Afghanistan and Pakistan: Oversight of a New Interagency Strategy,house.gov, 24.06.09)
[12] Heute haben die Vereinigten Staaten eine zweifache Verantwortung: Dem Irak zu helfen, eine bessere Zukunft aufzubauen – und den Irak den Irakern zu überlassen.
(Obama in Kairo, Ein Neuanfang, Amerikadienst, 04.06.09)
[13] Die Saudi-Initiative von 2002 sieht die Aufnahme diplomatischer Beziehungen aller arabischen Staaten mit Israel vor, als Gegenleistung für den Rückzug Israels auf die Grenzen von 1967. Sie wurde 2007 von der Arabischen Liga wieder ins Spiel gebracht, von der Bush-Regierung aber nicht als Vorschlag eines Interessenausgleichs genommen, sondern als Selbstverpflichtung der arabischen Welt interpretiert, die Feindschaft gegen Israel aufzugeben.
[14] Ein Großteil der israelischen Öffentlichkeit, die von der Linie der bisherigen US-Präsidenten und vor allem Georg W. Bushs, Israel so ziemlich alle Freiheiten zu lassen, verwöhnt ist, erhebt gegen Obama den Vorwurf, ein „Araberfreund“ zu sein, der Israels Interessen verrate. Gerecht ist das nicht, denn Zumutungen sieht die neue US-Regierung für beide Seiten, Israel und die Araber, vor. Für letztere im übrigen nicht zu knapp. Aber beide Seiten unterscheiden sich erheblich im Anspruchsniveau, an das sie sich gewöhnt haben.
[15] Um das neue Prinzip durchzusetzen, legen sich die USA mit der israelischen Hardliner-Regierung hart an – bis zu dem Punkt, in der Form eines Dementis mit der Möglichkeit von Sanktionen gegen Israel zu drohen. Wenn das Prinzip akzeptiert ist, sind die USA bereit, über Umfang und Zeitdauer des Moratoriums zu verhandeln und Israel dabei sehr weit entgegenzukommen.
[16] Dafür hat Netanjahu prophylaktisch bereits seine „roten Linien“ bekanntgegeben: Wir werden auf der Anerkennung des Staates Israel und der Demilitarisisierung eines künftigen palästinensischen Staats bestehen.
(Haaretz, 09.08.09) Die Einwände der US-Regierung beziehen sich nicht auf den Inhalt dieser Forderung, sondern nur darauf, diese als Vorbedingung für Verhandlungen aufzustellen.
[17] Fred Hoff, US-Beauftragter für Libanon und Syrien, stellt bereits einen Plan für die Regelung des Golan-Konflikts vor: ... ein Großteil der Golanhöhen soll in ein Naturreservat umgewandelt werden, das Besuchern sowohl aus Israel als auch aus Syrien tagsüber offen steht. Die demilitarisierte Zone soll unter internationaler Aufsicht unter Führung von US-Offizieren stehen, während der Abzug und die Demontage der israelischen Siedlungen auf dem Golan sich über mehrere Jahre erstreckt – parallel zur Normalisierung der Beziehungen zwischen Syrien und Israel.
(Haaretz, 25.06.09)
[18] Um Assad auf den Geschmack zu bringen, nimmt Obama eine Reihe von Waren von der Liste, deren Ausfuhr nach Syrien verboten ist: Zu den Posten gehören Ausrüstung für die zivile Luftfahrt, Flugzeugteile, Kommunikations- und Informationssysteme und –Technologie, Software, Hardware und Internet-Ausstattungen.
(Haaretz, 25.06.09)
[19] Damit beseitigt Washington auch einen Kritikpunkt der übrigen Weltordnungsmächte, insbesondere Russlands, die Bush vorwarfen, die Atomfrage nur zum Vehikel des Regime-change zu machen. Weil sie den ablehnten, hatten sie stets ein Argument, die Sanktionen nicht mitzutragen.
[20] Gleich zu Beginn ihrer Amtszeit stimmt die Obama-Regierung im UN-Sicherheitsrat einer Präsidentenerklärung zu, die Israel verpflichtet, der Sicherheitsrat-Resolution 1860 nachzukommen, die die road-map und den Annapolis-Prozess für völkerrechtlich verbindlich erklärt.
[21] Auch wenn bis Dezember kein neuer Vertrag ratifiziert werden kann, sollte START nicht auslaufen, weil der Datenaustausch und andere Verifikationsmaßnahmen im Vertrag ganz wesentlich zur strategischen Stabilität beitragen und in unserem nationalen Interesse sind.
(Ike Skelton, Vorsitzender im „Hearing on the U.S. Security Relationship with Russia“, house.gov, 30.7.09)
[22] Der neue Präsident bekennt sich ausdrücklich zu den Verpflichtungen, die der NPT den USA auferlegt. Die USA und Russland rüsten ab, und das von Bush auf Eis gelegte Atomteststopp-Abkommen soll umgehend ratifiziert werden. Obama verlässt auch hier die bisherige Linie; die Befürchtung, Amerika fessele sich unnötigerweise selbst, gewichtet er geringer als den zu erzielenden Nutzen. Mögliche Nachteile für die USA werden zurückgewiesen mit dem Verweis auf Simulationstechniken, über die allein die USA in einer Qualität verfügen, die Realtests, wie man hört, so gut wie überflüssig machen, so dass ein Teststopp alles in allem klaren Nutzen bringt: Er beraubt andere ambitionierte Nationen eines entscheidenden Mittels, ihr Atomprogramm voranzubringen, und es nimmt der Kritik an Pflichtversäumnissen der USA den Wind aus den Segeln. Überhaupt versucht der neue US-Führer sein Glück mit konzilianteren Tönen in der Abrüstungsdiplomatie. Er signalisiert den widerspenstigen Geistern aus der Gruppe der blockfreien Staaten Gesprächsbereitschaft bei Themen, die Bush routinemäßig von der NPT-Agenda gestrichen hatte (nukleare Bewaffnung Israels, Sonderstatus, den Amerika der Atommacht Indien verliehen hat), und auch an den Gottesstaat in Teheran ergeht ein Angebot: wenn Iran das Zusatzprotokoll des NPT ratifiziere und unangekündigten Kontrollen durch die IAEO zustimme, könne man unter Umständen durchaus von der bisherigen Forderung auf einen völligen Verzicht auf Wiederaufarbeitung Abstand nehmen. (rfe/rl, 14.4.09)
[23] Alles Wichtige hierzu findet sich in GegenStandpunkt 3-06.
[24] Die USA legen großen Wert darauf, der Partnerschaft mit Russland auch den passenden institutionellen Rahmen zu geben. Eine Bilaterale Präsidentenkommission, koordiniert durch die Außenminister, wird als Plattform für die neue Kooperation eingerichtet; sie dokumentiert, dass die USA sehr viel gemeinsamen Regelungsbedarf mit Moskau sehen – und dass sie ihm höchste Priorität einräumen.
[25] Die USA müssen den Ländern Zentralasiens helfen, tatsächlich unabhängig zu werden. Das sagte US-Vizeaußenminister für politische Fragen William Burns, ehemaliger Botschafter der USA in Russland. Er besuchte unlängst Usbekistan, Turkmenien, Kasachstan und Kirgisien. (RIA Nowosti, 24.7.09)
[26] Die US-Regierung macht diese doppelte Botschaft zum immer wieder verkündeten Markenzeichen ihrer neuen Diplomatie: Wir sind nicht daran interessiert alte Schlachten zu schlagen oder in der Vergangenheit zu leben. Wir sind entschlossen, eine bessere Zukunft für alle amerikanischen Länder aufzubauen, indem wir zuhören, lernen und Partnerschaften schmieden, die auf wechselseitigen Respekt gegründet sind. Gleichzeitig werden wir immerzu die zeitlosen Prinzipien von Demokratie, Menschenrechten und der Herrschaft des Rechts verteidigen, die unsere Gesellschaften beseelen und als Leuchtfeuer all derer in der ganzen Welt dienen, die unterdrückt, mundtot gemacht und unterjocht werden.
(Shannon, state.gov, 03.06.09)
[27] Die hiesige Öffentlichkeit, vertraut damit, dass die Weltmacht USA auch ganz anders kann, hat es geradezu als Sensation oder gelungenen diplomatischen Schachzug gewürdigt, dass sich Obama herablässt, den Feinden Washingtons einen solchen ‚Respekt‘ zu erweisen. Gegner von Obamas neuer Linie in den USA haben in diesen diplomatischen Gesten dagegen eine unerträgliche Erniedrigung der USA ausgerechnet durch den Präsidenten selber und einen Verrat an der gebotenen Führungsstärke ausgemacht: Kennt der Narzissmus dieses Mannes keine Grenzen? Es geht nicht um ihn. Es geht um sein Land!
Die Welt da draußen wird sehr rasch eine Situation ausnutzen, wenn sie glaubt, sie habe es mit einem schwachen Präsidenten zu tun oder mit einem, der nicht aggressiv für die Interessen Amerikas einsteht und diese verteidigt.
(Stimmen aus dem konservativen Lager, zitiert in der FAZ, 23.4.) Gegen den Vorwurf, Amerikas Sicherheit aufs Spiel zu setzen, hat Obama seinerseits klargestellt, worauf sich seine Diplomatie verlässt – auf die Macht der USA: Der Verteidigungshaushalt Venezuelas beträgt wahrscheinlich ein Sechshundertstel des amerikanischen Verteidigungsbudgets.
(Ebd.)
[28] Der Präsident steht damit nicht allein: Im Frühjahr stellte ein Bericht des Auswärtigen Ausschuss des US-Kongresses die ‚Ineffektivität‘ von fast sechs Jahrzehnten Blockadepolitik fest. Das Embargo zur Erzwingung eines ‚Regimewechsels‘ auf der roten Insel stehe nationalen US-Interessen sogar entgegen... Anstelle der gescheiterten Embargopolitik solle eine Strategie gewählt werden, die Kuba in den kapitalistischen Weltmarkt – über Kreditvergaben und Institutionen wie Weltbank und IWF – stärker einbindet.
(junge welt, 22.7) Diesen Empfehlungen folgt Obama allerdings auf seine eigene Weise.
[29] Dass es bei den ‚menschlichen Erleichterungen‘ um Zersetzung der kubanischen Herrschaft geht, das ist dann auch der Leitfaden aller Kommentare auch der deutschen Presse, die zustimmend oder zweifelnd Chancen und Risiken dieses Schritts für diesen guten Zweck bespricht: Man ist uneins, ob die ‚menschlichen Erleichterungen‘ geeignet sind, das Regime in Schwierigkeiten zu bringen und Volk und Führung zu spalten, oder eher eine gewisse Kapitulation vor dem Beharrungsvermögen der Castros darstellen.