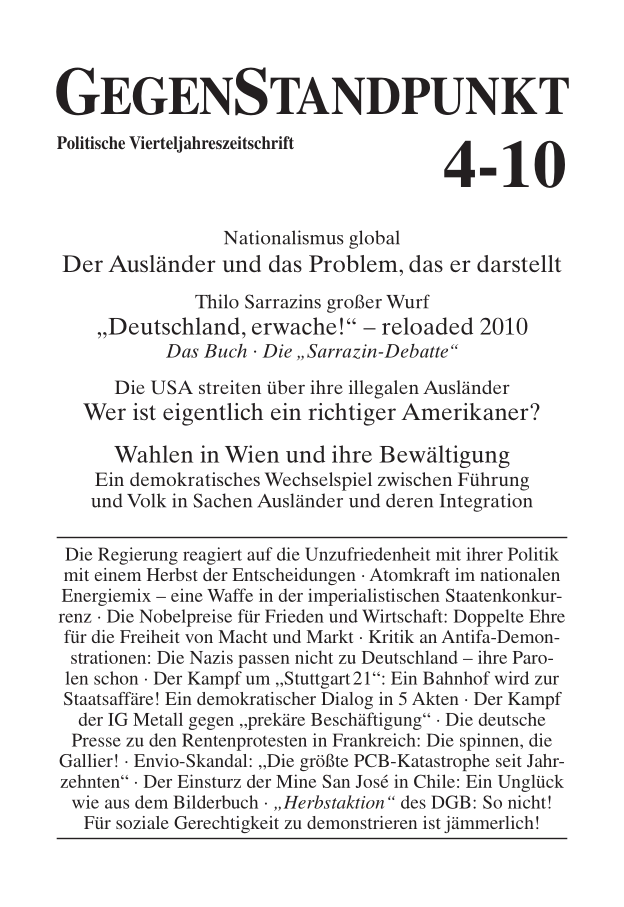Nationalismus global
Der Ausländer und das Problem, das er darstellt
Überall gibt es Ärger mit den Ausländern – mehr als lange üblich. Immer wieder und immer massiver stören sich politische Parteien und Regierungen am Vorhandensein, an der Zahl oder der Verfassung von Bevölkerungsteilen, die als nicht dazugehörig identifiziert und vom Hauptvolk abgegrenzt werden. Diese Ab- und Ausgrenzung lebt von der Scheidung zwischen zwei Sorten von Menschen, welche niemand anderer als die Staatsmacht in die Welt setzt: Zwischen solchen, die zu ihr gehören, ganz und gar ihrer exklusiven hoheitlichen Gewalt unterworfen sind, also nicht umhinkommen, ihre Ansprüche zu bedienen – sie genießen als Inländer das interessante Recht, im Bereich dieser Hoheit leben zu dürfen. Und all denjenigen, die anderen Staaten angehören und im Land nichts verloren haben, es sei denn, der Staat hat besondere Gründe, ihnen den Aufenthalt dennoch zu gestatten – weil und solange die Fremden ihm von Nutzen sind. Ob und wann sie stören, hängt also auch nicht von ihnen ab.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Siehe auch
Nationalismus global
Der Ausländer und das Problem, das er
darstellt
Überall gibt es Ärger mit den Ausländern – mehr als lange üblich: In Deutschland, Österreich, den USA (dazu die folgenden Artikel), in Frankreich, das rumänische Roma deportiert, in England, wo eine British National Party Streiks gegen die Beschäftigung osteuropäischer EU-Bürger organisiert; in einer ganzen Reihe weiterer EU-Staaten, wo ausländerfeindliche Parteien Wahlen gewinnen. Immer wieder und immer massiver stören sich politische Parteien und Regierungen am Vorhandensein, an der Zahl oder der Verfassung von Bevölkerungsteilen, die als nicht dazugehörig identifiziert und vom Hauptvolk abgegrenzt werden. Diese Ab- und Ausgrenzung lebt von der Scheidung zwischen zwei Sorten von Menschen, welche niemand anderer als die Staatsmacht in die Welt setzt: Zwischen solchen, die zu ihr gehören, ganz und gar ihrer exklusiven hoheitlichen Gewalt unterworfen sind, also nicht umhinkommen, ihre Ansprüche zu bedienen – sie genießen als Inländer das interessante Recht, im Bereich dieser Hoheit leben zu dürfen. Und all denjenigen, die anderen Staaten angehören und im Land nichts verloren haben, es sei denn, der Staat hat besondere Gründe, ihnen den Aufenthalt dennoch zu gestatten – weil und solange die Fremden ihm von Nutzen sind. Ob und wann sie stören, hängt also auch nicht von ihnen ab.
1.
Staaten, die ihre kapitalistische Wirtschaft globalisiert haben, behandeln die Reichtumsquellen der ganzen Welt, über welche ihre ausländischen Konkurrenten gebieten, als Mittel der nationalen Bereicherung. Nicht nur Waren- und Kapitalmärkte, sondern auch fremdes Menschenmaterial, das als Arbeitskräftepotenzial interessant ist. Wenn das Wachstum auf dem Kapitalstandort, den die nationale Herrschaft kommandiert, es erfordert; wenn also die heimische Unternehmermannschaft Bedarf an bestimmten Sorten tüchtiger und preisgünstiger Arbeitermannschaften anmeldet oder gar insgesamt eine Knappheit an Arbeitskräften zu registrieren ist, welche die Löhne hochtreibt und das Wachstum beschränkt, dann öffnet die Regierung die Grenzen für Bürger fremder Länder, damit sie als mobile Reserve das verfügbare Arbeitskräftereservoir erweitern. Wenn sie genug von ihnen hat, sagt sie ‚Das reicht‘ und macht die Grenze dicht. Wenn, sei es wegen der erfolgreichen Freisetzung von Arbeitskräften durch den technologischen Fortschritt der Profitproduktion, sei es infolge einer Krise, zu viele da sind, haben sie ihre Schuldigkeit getan und werden wieder weggeschickt – Schikanen plus Rückkehrprämien sind gebräuchliche Methoden. Wenn sie auf Dauer gehalten werden sollen, dürfen großzügigerweise die Familien oder gewisse Teile derselben nachkommen, sofern sie sich an die kleinlichen, aber rechtlich einwandfrei beschlossenen Bedingungen halten, mit denen sie als Ausländer von und gegenüber den Inländern diskriminiert werden. Wenn sie sich nicht mehr nützlich machen, werden sie als lästige Kostenfaktoren behandelt und als soziale Last drangsaliert. Je mehr die Einwanderer sesshaft werden und je weniger das Kapital sie braucht, desto unhandlicher werden sie als die Manövriermasse, die man ins Land geholt hatte.
Über mangelnden Nachschub an armen und verarmten, also billigen und willigen Bewerbern brauchen sich Westeuropa und Nordamerika, die Zentren des Weltkapitalismus, nicht beklagen; anatolische Bauern müssen nicht mehr angelockt werden. Der geschäftliche Zugriff auf die ganze Welt hat für massenhaft Leute das Leben in ihren Geburtsländern unmöglich gemacht. Der Ruin der traditionellen Lebensbedingungen, den die überlegene Konkurrenzmacht der westlichen Konzerne auf dem Globus anrichtet, sorgt schon dafür, dass selbst die elendsten Löhne ein attraktives Angebot für Afrikaner, Latinos, Ost- und Südeuropäer etc. sind und bleiben. Diese Elendsflüchtlinge sind auf jeden Fall zu viele, sie stören bloß. Also werden sie vom nationalen Territorium ferngehalten, inzwischen mit allen Mitteln der militärischen Grenzsicherung. Wenn bei dem Versuch, Mauern, Stacheldrähte und Meere zu überwinden, jährlich Tausende sterben, so spricht das nur dafür, die abschreckende Grenzsicherung zu perfektionieren – dann braucht es auch keine inhumanen Auffanglager mehr in Griechenland und anderswo, jedenfalls nicht innerhalb Europas. Die nicht Wenigen, die es dennoch über die Grenze schaffen, werden je nach herrschaftlichem Kalkül mal eine Zeitlang geduldet, denn als „Papierlose“, d.h. illegale Existenzen sind sie für ehrenwerte heimische Geschäftsleute besonders attraktiv; wenn sie Glück haben, werden sie sogar auf Zeit oder dauerhaft legalisiert; oder sie werden aufgespürt, als Verbrecher kaserniert und deportiert.
Während sie die Ärmsten der Armen, die ein Überleben suchen, mit aller Gewalt fernhalten, können die kapitalistischen Hauptmächte von einer speziellen Sorte Einwanderern gar nicht genug kriegen: Untereinander konkurrieren sie darum, aus dem globalen Pool von Wissenschaftlern und Spezialisten bis hinunter zum qualifizierten Mittelbau möglichst viele auf ihr Territorium zu ziehen und ihrer Ökonomie als human capital verfügbar zu machen. Leute, von denen man sich technologische Vorsprünge oder wenigstens Beiträge zur Produktivität des Standorts verspricht, sollen mit attraktiven Angeboten geworben werden und unbürokratisch zuwandern können, damit „Wir“ nicht zum „Migrationsverlierer“ werden. Zur globalisierten Republik gehört es eben auch, anderen Staaten die Elite zu klauen und deren Ausbildungsleistungen aufs eigene Wachstum umzulenken.
Wieder andere Ausländer werden aus politischen Gründen ins Land gelassen und bekommen einen entsprechenden Rechtsstatus verpasst. Gern gesehen sind bisweilen „Dissidenten“, die in einem zum Feind erklärten Land verfolgt werden. Ihnen gewährt man Asyl, um den Unrechtscharakter des dortigen Regimes zu unterstreichen. Andere kommen aus Kriegs- oder Bürgerkriegsregionen, in denen die eigene Nation militärisch involviert oder an denen sie „vital“ interessiert ist. Einigen Exemplaren von der menschlichen Basis der Kriegspartei, auf die man setzt, wird erlaubt, sich vor dem Töten und Sterben in Sicherheit zu bringen. Mit solch humanitären Aktionen macht der Staat sich als Schutzmacht für die unterstützten politischen Kräfte geltend. Den (Bürger-)Kriegsflüchtlingen bietet er Aufenthalt, solange es in seine imperialistischen Berechnungen passt. Samt der nötigen Vorschriften, versteht sich, etwa mit einem Arbeitsverbot, um ein Sesshaft-Werden zu verhindern. Das macht dann die Last besonders drückend, die die Existenz der Flüchtlinge für den Staatshaushalt darstellt. Sobald die Regierung beschließt, der Krieg ist erledigt, oder auch nur das Interesse an ihm verliert, ist auch diese Ausländerkategorie, die der politischen Flüchtlinge, nur noch ein Problem. Seine Lösung steht fest. Als ehemals nützliche menschliche Instrumente der nationalen Außenpolitik werden sie in ihr zerstörtes Bürgerkriegsland zurückexpediert, egal was sie dort an Elend oder Verfolgung erwartet. Denn das ist ihre Heimat, in die sie doch wohl zurück wollen, oder?!
So sortieren politische Gewalten die Ausländer der Welt: entweder sich zu oder aus – je nach der nützlichen oder schädlichen Rolle, die sie ihnen zuschreiben. Sie behandeln sie als menschliche Manövriermasse, als globale Ressource ihrer ökonomischen und politischen Macht. Und sie betrachten es als Privileg, das sie vergeben, wenn sie fremden Bürgern das Recht einräumen, innerhalb ihrer hoheitlichen Grenzen zu leben und – das gilt erst recht als eine Gnade – bei ihnen arbeiten und sogar die Staatsbürgerschaft erwerben zu dürfen. Derjenige, der bleiben darf, muss sich den Status verdienen, der ihm – unter ständigem Vorbehalt – gewährt wird. Er muss allen Ansprüchen des „Gastlandes“ genügen; und ob bzw. wie lange er das tut, entscheidet nicht er. Klar ist in jedem Fall eines: Einwanderer müssen mit allen Existenzbedingungen zurechtkommen, die ihnen diktiert werden; wie sie das machen, das ist – wie stets in der freien Gesellschaft – ihre Privatsache. Sie müssen zurechtkommen, denn Scheitern bedroht nicht nur Einkommen und sozialen Status, sondern gleich das Recht zu leben, wo sie leben. Wenn sie alle Anforderungen auf die Art bewältigen, wie es Einwanderer seit je tun, ist es auch wieder nicht in Ordnung: Sie ziehen in Stadtviertel, wo schon andere ihrer Nationalität leben, halten untereinander zusammen, betreiben eine inoffizielle Ökonomie in den eigenen Reihen und pflegen in der Diaspora die Sitten der alten Heimat. Damit schaffen sie das nächste Ärgernis: Sie bilden eine „Parallelgesellschaft“.
2.
Der Vorwurf ist ein Witz. Die kapitalistische Nation besteht aus lauter Parallelgesellschaften, die untereinander wenig soziale Gemeinsamkeiten haben und kultivieren. Wann verkehren schon die wirklich Reichen mit Normalverbrauchern, wo trifft sich das akademische Unterhaltungsbedürfnis mit dem Zeitvertreib des Proletariats oder das Landvolk mit der Schwulenszene? Bei all den gegeneinander mehr oder weniger abgeschotteten Subkulturen steht für die Obrigkeit eines allerdings fest und wird gar nicht erst thematisiert: die Zuordnung zur eigenen Nation. Für genau die garantiert die Gemeinde der Ausländer nicht, auch wenn so mancher von ihnen inzwischen einen inländischen Pass vorzeigen kann. Ihr Anderssein begründet ein Misstrauen, das sich nicht erst rührt, wenn politische Illoyalität der Einwanderer gegenüber Gesetzen des Landes, seinen außenpolitischen Bündnissen, Feindschaften und Kriegen gefürchtet wird. Der Anspruch reicht weiter. Die Migranten stehen im Verdacht, nicht zuverlässig „Amerika“, „Deutschland“ oder „Österreich“ zu denken, wenn sie „Wir“ sagen. Womöglich buchstabieren sie Heimat immer noch anders und adressieren ihre Hoffnungen und Sorgen nicht automatisch und zuerst an die Staatsmacht, deren Gesetzen sie gehorchen; womöglich übersetzen sie Unzufriedenheit nicht in den Vorwurf schlechten Regierens und in die Sehnsucht nach besserem. Den Eingewanderten traut die Staatsmacht die fundamentale nationale Politisierung nicht zu, die sie bei ihren Eingeborenen wie eine natürliche Eigenschaft voraussetzt, die diese mit der Muttermilch eingesogen haben. Einerseits untergräbt die globalisierte Republik das borniert überkommene Zusammengehörigkeitsgefühl des völkischen Kollektivs, wenn sie sich ihre Bevölkerung aus aller Welt zusammenholt, andererseits verlangt sie von alten und neuen Landesbewohnern genau diese allem Denken und Wollen vorausgesetzte Parteilichkeit für Volk und Staat. Das ist der Inhalt des kategorischen Imperativs der „Integration“, den die Politiker erlassen. Menschen unter ihrer Hoheit haben ihre ganze Individualität über die Zugehörigkeit zu dem Staat zu definieren, in den es sie verschlagen hat. Dass sie das auch tun, können die Zugereisten der misstrauischen Obrigkeit durch bewusste und gewollte Dokumente ihrer Anpassungsbereitschaft prinzipiell nicht beweisen. Mit der fremden Sprache, die sie untereinander sprechen, sowie mit jedem Rest von Sitten, Trachten, Lebensstilen ihres Herkunftslandes zeugen sie vielmehr von einer abweichenden, fremden Identität. An welchen Indizien die unerträgliche Randständigkeit jeweils dingfest gemacht und entlarvt wird, das lässt sich die Politik gerne von den Urteilen vorgeben, die im Volk so kursieren.
3.
Auf dessen Ausländerfeindlichkeit ist nämlich Verlass. Sie ist Konsequenz der nationalen Identität, zu der sich die vom Staat zusammengezwungene Klassengesellschaft bekennt. Deren Insassen stellen dieses Verhältnis auf den Kopf und verstehen sich als Menschen-Kollektiv, dem die Staatsmacht dient und dessen Wohl zu mehren ihre ganze Räson ist. Die Ausländer sind aus diesem Kollektiv von vorneherein ausgeschlossen; denn sie sind ja keine Inländer, denen der Schutz des Staates gebührt. Vielmehr muss das einheimische Kollektiv sein Wohlergehen ja gegen den Egoismus und die nationalistischen Umtriebe anderer Staaten und Völker verfolgen und verteidigen. Das Volk, vor allem das in seinem Erwerb stets bedrohte Arbeitsvolk, versteht seine Zugehörigkeit zu seinem Staat als ein Privileg und eine Sicherheitsgarantie, wenn schon nicht vor den Geschäftskalkulationen der Arbeitgeber, so doch vor fremden Konkurrenten, denen dasselbe Privileg nicht zusteht. Auch wenn die Ausländer die niedrigsten und am schlechtesten entlohnten Tätigkeiten verrichten, steht fest, dass sie „uns“ ausnützen, weil sie in „unserem“ Land ihren Vorteil suchen. Generell belastet es das Vertrauensverhältnis der Volksangehörigen zu ihren Politikern, dass die es Ausländern erlauben, sich im Land aufzuhalten und den Einheimischen Arbeits- und Kindergartenplätze, Wohnungen und sonst noch was wegzunehmen. Amtsträger geraten da in den Verdacht der Untreue gegenüber ihrem Volk.
4.
Die Politik benutzt und lenkt dieses Ressentiment, indem sie darauf eingeht. Es gilt ihr als ehrenwerter Standpunkt und als ein gutes Recht des Volkes, das sie nicht zurückweist, von dem sie ihre global ausgreifende Bevölkerungspolitik aber auch nicht stören lässt. Dass „Deutsche zuerst!“ drankommen, sagen nur rechtsradikale Parteien, praktisch rechtfertigt sich alle Politik vor diesem Maßstab. Was immer der Staat im Umgang mit Einwanderern für nötig hält, was er ihnen an Diskriminierung antut, an Sonderprüfungen ihrer Loyalität abverlangt und an Sonderaufsicht zumutet, alles präsentiert er den Alt-Eingesessenen als Dienst an ihnen und kann sich ihrer Zustimmung zu jeder Gemeinheit sicher sein. Wenn er Bedarf danach verspürt, kann er die Aggression des Volkes gegen beliebige national und ethnisch definierte Bevölkerungsgruppen richten und sich dann mit der Bewältigung der Spannungen und der Beseitigung ihrer Ursachen beauftragen. Wenn er es für opportun befindet, kommt die Bestätigung des nationalistischen Ressentiments – „Wir“ brauchen die Ausländer und sie nützen „uns“ doch auch! – mäßigend daher; so sollen undifferenzierter Hass und eigenmächtige Übergriffe auf die Fremden gebremst werden.
5.
Anders verhält es sich mit der offiziellen Ausländerfeindlichkeit, die im letzten Jahrzehnt in den westlichen Staaten entstanden ist und sich auf eine Kategorie von Migranten richtet, die gar nicht durch die Zugehörigkeit zu einer anderen Nation als fremd identifiziert werden, sondern durch ein Glaubensbekenntnis. In Frankreich trifft es die Nordafrikaner, in England die Pakistani, in Deutschland die Nachkommen der türkischen Gastarbeiter, die früher alle als Angehörige ihrer jeweiligen Nation wahrgenommen und auch schon ekelhaft genug behandelt wurden; heute verschmelzen diese Nationalitäten in der Figur des Moslems. Seine Religion ist die störende Andersartigkeit, die eine Integration erschwert oder verhindert. Den Islam lassen die Länder der Religionsfreiheit nicht als Privatsache gelten, jedenfalls nicht so einfach wie andere Religionen. Sie bezweifeln, dass dieser Glaube sich darauf beschränkt, brave Privatreligion zu sein, die man keinem nehmen will, und hegen den Verdacht, dass er doch mehr, nämlich praktisch-politischer, mit den westlichen Verhältnissen unverträglicher Wille ist.
Die Charakterisierung dieser Religion trägt Züge eines Feindbilds. Man erfährt über sie nichts als die Liste ihrer Verstöße gegen Modernität und Freiheit. Erstens hat der Islam die schmerzhafte Aufklärung versäumt, die dem Christentum so gut tut; er ist buchstabengläubig, intolerant und tötet. Zweitens – das leistet die Trias: Kopftuch, Zwangsehe, Ehrenmord – hat Mohammed im 7. Jahrhundert die Unterdrückung der Frau verordnet, die bei uns seit ein paar Jahrzehnten offiziell nicht mehr erlaubt ist. Freie Denker vertiefen sich begeistert in die verkehrte Religion und tragen mit Koranstudien und Islamwissenschaft zur kritischen Prüfung und dadurch zur Objektivierung des Feindbilds bei. Im Ergebnis wird die Ausgeburt der fremden religiösen Phantasie unter die Kategorie Verbrechen und Unterdrückung subsumiert; ein Urteil, das seinerseits die Unterdrückung der üblen Gesinnung nötig und gerechtfertigt erscheinen lässt. Der Islam verdient, wenn nicht gleich Verfolgung, so doch das Misstrauen, das der Westen ihm entgegenbringt.
Auch in diesem Fall rechtfertigt das Feindbild eine politische Feindschaft, die andere Gründe hat als die moralische Ablehnung der fremden Moral. Allerdings handelt es sich schon um eine ungewöhnliche Feindschaft, wenn im 21. Jahrhundert eine Religion das Bild des Feindes bestimmt: Die USA, Deutschland und die meisten EU-Staaten führen Krieg gegen den „islamistischen Terror“, sie haben dafür nach dem 11. September 2001 den Nato-Verteidigungsfall ausgerufen. Sie kämpfen in Afghanistan, aber nicht gegen Afghanistan. Sie kämpfen dort, in Pakistan, Somalia, im Jemen und wo auch immer sie Nester von Al Kaida und Gesinnungsgenossen wissen oder vermuten. Der Feind ist nicht ein Staat, sondern eine radikale Bewegung und politische Kräfte, die ihnen eine Heimstatt geben. Die aktuellen Objekte der Feindschaft der westlichen Nationen, ihre Unverträglichkeit mit der durchgesetzten Weltordnung des Kapitals, sind also nicht staatlich definiert, sondern als nicht-staatliche Terroristen, die ihre radikalen Motive dem Islam entnehmen. Die Feindschaft der Weltordnungsmächte schließt also die islamische Region mit ein, sofern diese als Nährboden und Waffe der Gegner identifiziert ist. Am Hindukusch begründen die Taliban ihren antiamerikanischen und antiwestlichen Kampf mit dem Islam; und der Westen begründet das Engagement für seinen Statthalter Karzai mit dem Kampf gegen den Islamismus, gegen die Burka und für Mädchenschulen. Die Kritik an der Religion, die antiwestliche Radikalisierung nicht zuverlässig verhindert, rechtfertigt jedes Zuschlagen der zivilisierten Staatenwelt.
Andererseits richtet sich deren Kampf auch wieder nicht gegen den Islam; man hütet sich, sich die ganze islamische Welt von Marokko über Bosnien bis Indonesien zum Feind zu machen. Feind ist „bloß“ der politische Islam, der Aufstand gegen die westliche Penetration und Dominierung des Morgenlandes. Es ist bezeichnend, dass führende Politiker sich immer wieder zu Klarstellungen genötigt sehen: Die USA, so versichert Präsident Obama, befinden sich nicht im Krieg mit den Moslems; auch der Islam gehöre heute zu Deutschland, setzt der deutsche Bundespräsident hinzu. In ihren Dementis geben sie zu erkennen, wie fest das Feindbild sitzt, welches sie und ihre freie Öffentlichkeit in einem Jahrzehnt des Antiterrorkrieges etabliert haben. Sie geben sich große diplomatische Mühe, ein Feindbild zu differenzieren, was der Natur eines solchen im Grunde widerspricht. Ein unmenschliches Monster hat schließlich nicht böse und gute Seiten.
Das Ringen der Staatsmänner um die (Unter-)Scheidung von eigentlich tolerierbarer islamischer Religion und fundamentalistischem Verbrechen bekommt die eingewanderte islamische Bevölkerung in Amerika und Europa zu spüren. Die Moslems mit dem Migrationshintergrund werden zu Opfern des ebenso unverzichtbaren wie um selektive Anwendung bemühten Feindbilds. Und das nicht erst, wenn man die Moscheen verdächtigt, Rekrutierungsfeld und Rückzugsraum von Al Kaida zu sein – auch das gab es und gibt es immer mal wieder. Die Unvereinbarkeit mit der als antiwestlich identifizierten Glaubenskultur ist umfassender: Auch wenn sie unpolitisch bleiben, passen diese Leute nicht ins Abendland, es sei denn, sie beweisen „uns“ glaubwürdig, dass sie ihren Allah hinter unseren säkularen Staat, der über allen Göttern thront, zurückzusetzen bereit sind. Darüber, ob und wie so ein Beweis echter Loyalität zu liefern ist, der „uns“ zufriedenstellt, entbrennt überall ein fundamentalistischer Streit. Der heißt in Deutschland Integrationsdebatte.