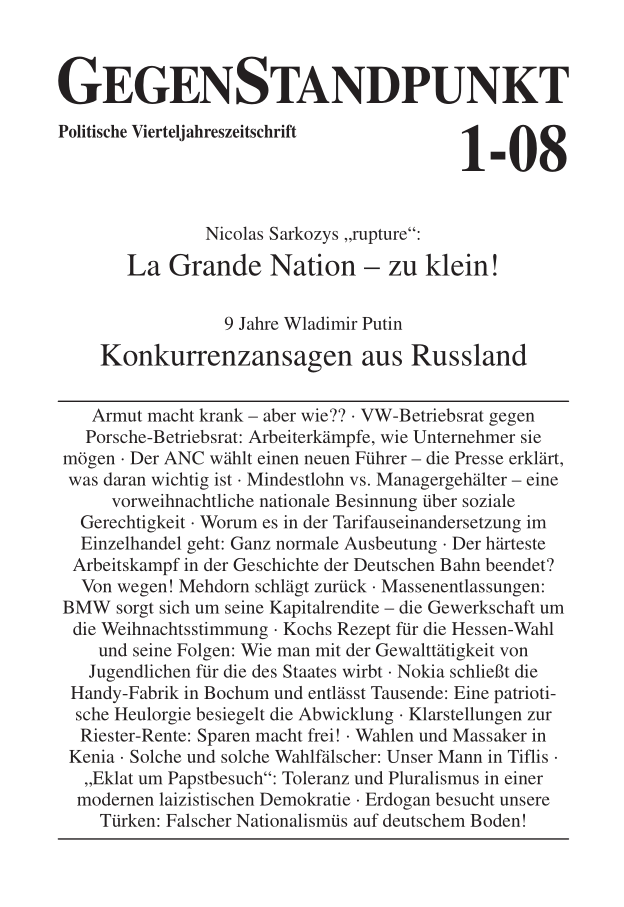Weltlage 2007, Teil 2
Nicolas Sarkozys „rupture“:
La Grande Nation – zu klein!
Frankreichs neuer Staatspräsident ist nicht zufrieden. Mit seiner Nation nicht, weil die in der Welt von heute einfach nicht die Rolle spielt, die ihr in den Augen ihres obersten Nationalisten zukommt; daher auch nicht mit der Welt und der in ihr herrschenden Ordnung, die seinem Land den ihm gebührenden Status verwehrt. „Frankreich ist ins Hintertreffen geraten gegenüber dem Rest der Welt“ (Neujahrsansprache, Le Monde, 2.1.08); und damit will der neue Chef sich keinesfalls abfinden. Sich selbst und seiner Nation verlangt er in aller Bescheidenheit eine „politique de civilisation“ ab, „damit Frankreich die Seele der neuen Renaissance wird, die die Welt braucht“, auch wenn die das noch gar nicht bemerkt hat. Seiner Regierung erteilt er den entsprechenden Auftrag; und der Erste Minister versteht: Es geht darum, „Frankreich grundsätzlich zu ändern, damit es in der Welt stets an der Spitze steht; mit einer erobernden Wirtschaft, aber auch mehr respektiert in der Welt.“
Aus der Zeitschrift
Teilen
Siehe auch
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Gliederung
- I. Selbstkritische Besichtigung des nationalen Innenlebens: Defizitdiagnose und Therapiekonzepte
- II. Wozu die Aufmöbelung der Nation gut sein soll Auch Frankreich hat (s)eine globale Mission
- 1. Die Nation ist rundherum unzufrieden mit ihrem politischen Machtstatus in der Staatenwelt
- 2. Frankreich verkündet ein Aufbruchsprogramm, mit dem es nichts Geringeres verspricht, als die Staatenwelt zu zivilisieren
- 3. Die in Anschlag gebrachten Mittel zur Umsetzung des Programms: Beiträge zum innereuropäischen Machtkampf und zur Großmachtkonkurrenz
- Die Verstärkung der französischen Kriegsmacht
- Einmischung in die Kriegs- und Friedens-Fronten der Welt, um den strategischen Einfluss der Nation zu mehren
- Frankreich setzt Fakten, um seine Macht in, über und mittels Europa zu vergrößern
- Ein Angebot zur Vollmitgliedschaft in der NATO – unter der Bedingung, dass eine reformierte Allianz den Euro-Militarismus voranbringt
- Durch den Export mächtiger kapitalistischer Produktivkräfte mächtige Bündnisoptionen mit aufstrebenden Großmachtkonkurrenten erschließen
Nicolas Sarkozys „rupture“:
La Grande Nation – zu klein!
Frankreichs neuer Staatspräsident ist nicht zufrieden. Mit seiner Nation nicht, weil die in der Welt von heute einfach nicht die Rolle spielt, die ihr in den Augen ihres obersten Nationalisten zukommt; daher auch nicht mit der Welt und der in ihr herrschenden Ordnung, die seinem Land den ihm gebührenden Status verwehrt. Frankreich ist ins Hintertreffen geraten gegenüber dem Rest der Welt
(Neujahrsansprache, Le Monde, 2.1.08); und damit will der neue Chef sich keinesfalls abfinden. Sich selbst und seiner Nation verlangt er in aller Bescheidenheit eine politique de civilisation
ab, damit Frankreich die Seele der neuen Renaissance wird, die die Welt braucht
(Neujahrs-Pressekonferenz, 8.1.08), auch wenn die das noch gar nicht bemerkt hat. Seiner Regierung erteilt er den entsprechenden Auftrag; und der Erste Minister versteht: Es geht darum, Frankreich grundsätzlich zu ändern, damit es in der Welt stets an der Spitze steht; mit einer erobernden Wirtschaft, aber auch mehr respektiert in der Welt.
(Premierminister François Fillon, Le Monde, 2.1.)
Originell ist dieses Aufbruchsprogramm nicht, noch nicht einmal die – freilich sehr französische – Rhetorik. In den letzten Jahrzehnten tritt in kaum einer namhaften Demokratie eine Führungsmannschaft zur Wahl und eine gewählte Regierung ihr Amt an, ohne unter Titeln wie „Change“ oder „Wende“ die gründliche Mobilmachung der Nation zu versprechen. Das macht den französischen Fall jedoch nicht uninteressant, sondern exemplarisch: Auch in Frankreich sieht der neue Präsident sich berufen und durch seine Wahl dazu beauftragt, seine Nation fit zu machen für Siege in einem Konkurrenzkampf der bedeutenden kapitalistischen Mächte, für den alle Beteiligten sich ganz neue Anstrengungen abverlangen. Er reagiert damit – der Premierminister deutet es an – auf eine gewisse Beschädigung seiner Nation: ihres kapitalistischen Reichtums, dessen Wachstum unter der Allmacht der Märkte
leidet; nämlich, genauer, unter dem Lohn-, Geld- und Sozialdumping
(Sarkozy in einer Rede vor der Parlamentsmehrheit am 20.6.07) der einen und einem hemmungs- und rücksichtslosen Finanzkapitalismus
(ein großes Thema seiner Neujahrs-Pressekonferenz) gewisser anderer Weltwirtschaftsmächte. Beschädigt ist ebenso die Weltgeltung der Grande Nation: Wenn der Präsident in der Staatenwelt ein Defizit an französischer „civilisation“ feststellen muss und dabei eine zunehmend kriegerische Grobheit im internationalen Verkehr im Auge hat, dann ist das seine Art, ebenso kritisch wie selbstkritisch zur Kenntnis zu nehmen, dass die wichtigsten Macher des Weltgeschehens die Maßstäbe imperialistischer Durchsetzungsfähigkeit zurechtgerückt haben und Frankreich den entsprechenden Anforderungen in Sachen Respekt erheischender Gewalt derzeit nicht genügt. Die so zu Frankreichs und zu ihrem eigenen Nachteil veränderte Welt sieht der Präsident zudem durch neue mächtige Subjekte bevölkert – Indien und China nennt er in seiner Rede am 20.6. beim Namen, Russland restauriert seine politische Gewalt, und zur amerikanischen „Supermacht“ müssen sich ohnehin alle Staaten, die auf dem Globus etwas zu melden haben wollen, ganz neu ins Verhältnis setzen: Subjekte, neben denen Frankreich sich noch gar nicht richtig als maßgeblicher Akteur etabliert hat und gegen deren Ambitionen es das unbedingt tun muss.
Das sind so im Groben die Herausforderungen, vor die Sarkozy sein Land gestellt sieht – es sind die, vor die die paar Mitglieder der imperialistischen Elite auf dem Erdball zu Beginn des 21. Jahrhundert sich wechselseitig stellen. Und so wenig wie in der kritischen Bilanz unterscheidet die neue Führung Frankreichs sich im Ansatz ihrer herausfordernden Antwort auf die diagnostizierte Lage von ihren Rivalen, agiert vielmehr auch da beispielhaft: Sie geht davon aus, dass ihre Nation ganz zweifelsfrei vermag, wozu sie herausgefordert ist und worauf sie ein Recht hat. Eine Weltmacht von Rang zu sein, das steht Frankreich nicht bloß fraglos zu; für den neuen Chef ist es eine ausgemachte Sache, dass sein Staat das Zeug dazu hat, das auch wieder zu werden und sich gegen alle anderen durchzusetzen – er muss es nur tun. Dazu braucht es nicht mehr als den entschlossenen Willen, das eigene Schicksal in die Hände zu nehmen. Allerdings auch nicht weniger. Und dafür braucht es eine historische Gestalt wie ihn: einen Sarkozy, den neuen Danton:
«De l’audace, toujours de l’audace, encore de l’audace et la France sera sauvée!» („Mut, mehr Mut, noch mehr Mut und Frankreich wird gerettet sein!“) (Georges Danton 1792 vor dem Konvent während des Krieges; Nicolas Sarkozy vor den UMP-Parlamentariern am 20.6.07)
I. Selbstkritische Besichtigung des nationalen Innenlebens: Defizitdiagnose und Therapiekonzepte
Vor dem hoffnungsvollen Aufbruch steht die kritische Diagnose; und die fällt vernichtend aus: Ein Land, das seit dreißig Jahren zögert, seine Strukturen und seine Gewohnheiten zu überdenken
(Fillon, Regierungserklärung, 3.7.); ein durch und durch in Agonie versunkenes Gebilde, hauptsächlich regiert durch eine Tradition von verschleppten und fehlgeschlagenen Reformen
und maßgeblich geprägt von Jahrzehnten des Konservatismus und Einheitsdenkens, das so bequem fortzuführen war
(Neujahrs-Pressekonferenz, 8.1.08); ein Etwas, das nicht nur alt an Jahren, sondern in seinem inneren Bestand auch genauso beisammen ist wie ein Fossil: Frankreich ist ein altes Land. Viele seiner Institutionen sind altbacken und verknöchert
(Attali-Kommission, Le Monde, 20.1.08) Das kann so nicht weiter gehen!
(Sarkozy, eigentlich immerzu)
Die starken Sprüche, mit denen Frankreichs neue politische Führung ihr Land schlecht macht, so als könnte sie es kaum fassen, was für einen Laden die Vorgängerregierung, der Sarkozy selber ja immerhin angehört hat, ihr hinterlassen hat, zeugen von einem starken Veränderungswillen – und einer fast ebenso großen Verlegenheit. Der Welterfolg ihrer Nation lässt für ihren Geschmack ganz enorm zu wünschen übrig; aber ein Defekt, der sich als Ursache bestimmen und durch gezielte Eingriffe beheben ließe, ist nicht recht auszumachen – „Verkrustung“ ist ja keine Diagnose in dem Sinn, weder über die politische Ökonomie des Landes noch über deren Erträge für die politische Macht; jedenfalls nicht in dem Sinn, dass daraus zweckmäßige Maßnahmen zur Steigerung des Wachstums oder zur Auffüllung der Staatskasse abzuleiten wären. Der erbitterte Erfolgswille des Präsidenten findet in seiner fundamentalen Unzufriedenheit mit der Performanz der nationalen Ökonomie und Politik wenig Handhaben für konkrete großkalibrige Verbesserungen.
Der eine Grund dafür ist allgemeiner Natur und betrifft im Prinzip die politische Herrschaft im Zeitalter des modernen Weltkapitalismus generell. Die braucht und will und „fördert und fordert“ nach Kräften eine Sorte Nationalreichtum, den die kapitalistischen Unternehmen in eigener Regie und im globalen Konkurrenzkampf mit ihresgleichen aus dem Land, seinen Leuten und den darin schon angesammelten produktiven Reichtümern herauszuwirtschaften haben. Für den Erfolg, auf den es ihr ankommt, weil davon ihre Macht abhängt, schafft die zuständige Obrigkeit mit ihren Gesetzen und ihren Haushaltsmitteln, Schulden inklusive, die Bedingungen; nach bestem Wissen und Gewissen – und beraten durch zahllose Lobbys, deren Ratschläge einander allerdings regelmäßig durchkreuzen, sowie außerdem durch Sachverständige, die gar nichts dabei finden, dass sie ihre Prognosen Monat für Monat gemäß dem tatsächlichen Konjunkturverlauf korrigieren – wirkt sie mit Maßregeln und Geld auf den Konkurrenzkampf ein, in dem „ihre“ nationale Firmenwelt siegen soll. Doch eben weil es um Erfolge in der internationalen Konkurrenz ums Geld der Welt geht – und solange es nach dem Willen einer auf Marktwirtschaft abonnierten Staatsgewalt auch genau darum und um nichts anderes gehen soll –, sind rechtliche Vorgaben kein erfüllbarer Plan und sogar Geldsummen keine Gewähr dafür, dass ihre Verwendung im Endeffekt den erwünschten Ertrag abwirft. Diese eigentlich banale Eigenart allgemeiner Geschäftsbedingungen, keine verlässlichen Wirkursachen und schon gar keine Erfolgsgarantien zu sein, irritiert die verantwortlichen Machthaber zwar überhaupt nicht in ihrem festen Standpunkt, es gäbe für sie so etwas wie zuverlässig wirkende Erfolgsstrategien, und mit der Macht der Politik müsste sich doch herbeimanipulieren lassen, was sie von ihrer Klassengesellschaft haben wollen. Damit verdoppeln sie aber nur den Konkurrenzkampf der Firmen, dessen Ausgang eben eine Frage des ökonomischen Kräftemessens ist, um den der Nationen – also um ihre eigenen Konkurrenzmanöver, mit denen sie einerseits bloß auf Siege und Niederlagen „ihrer“ Konzerne reagieren und andererseits die Ergebnisse, die „am Markt“ zustande kommen, beständig zu korrigieren suchen.
Dabei steht völlig außer Frage, dass eine tatkräftige Staatsmacht mit ihren Maßregeln und Subventionen enorm viel an produktiven Anstrengungen, in Sachen Ausbeutung wie an spekulativer Kreditvermehrung, in Gang setzen und in Schwung halten – und dadurch anderswo kaputt machen – kann. In den altgedienten kapitalistischen Nationen, zu denen Sarkozy sein Frankreich rechnet, verhält es sich bloß so, dass die politische Herrschaft dort schon seit langem ein reichhaltiges Instrumentarium an Rechten und Krediten zum Einsatz bringt, so dass den Managern des Kapitals nicht mehr viel Zweckmäßiges zu wünschen übrig bleibt – man merkt es an dem etwas absurden Ansinnen „neoliberaler“ Helden der marktwirtschaftlichen Freiheit, der Staat möchte am besten sich selbst als Kostenfaktor ganz aus dem Verkehr ziehen. Gerade in Europa haben die großen Machthaber ihre Länder konsequent zu Kapitalstandorten durchgestylt; die Nationen konkurrieren mit perfekter Infrastruktur und Niedrigsteuern, mit Subventionen und machtvoller Rechtssicherheit auch für Auslandsgeschäfte, mit guter Währung und einer Arbeits- und Sozialpolitik, die das nationale Lohnniveau konsequent absenkt, so dass die Lohnstückkosten mit denen aufstrebender asiatischer Billiglohnländer mithalten können. Natürlich findet sich da immer noch einiges umzubauen. Gerade die sozialstaatlichen Errungenschaften früherer Jahrzehnte, die für viel Effektivität bei der rentablen Verwendung von Arbeitskraft gesorgt haben, bieten noch einige Handhaben für eine kapitalfreundliche Minderung der Unterhaltskosten des nationalen Fußvolks. So viel steht aber auch fest: Mit noch ein paar weiteren Steuernachlässen für Unternehmer und sozialen Gemeinheiten gegen Arbeitslose ist die Wettbewerbssituation des nationalen Kapitalismus dieser Länder nicht wirklich durchgreifend zu verbessern. Das ist der zweite, etwas speziellere Grund dafür, dass ein frisch gewählter Staatschef in seiner Unzufriedenheit mit Macht und Reichtum seiner Nation so fundamentalistisch auf den Putz haut und dass es absurd wäre, einen Mann wie Sarkozy zu fragen, warum es mit welchen „Strukturen“ in seinem Land unmöglich so wie bisher „weiter gehen kann“ und welche „Verkrustungen“ die französische Wirtschaft denn im einzelnen daran hindern, von China bis Brasilien die Weltmärkte zu erobern: Sein regierungsamtliches Leiden an unzureichendem Erfolg der Nation steht in keiner plausiblen Beziehung zu einzelnen oder auch zur Summe aller einzelnen Behinderungen von Geschäft und Gewalt.
Was nicht heißt, dass der Präsident und seine Leute nicht jede Menge davon aufzuzählen wüssten. Mit einschlägigen Beschwerden und Verbesserungsvorschlägen hält der neue Mann sich aber gar nicht groß auf. Er steigt gleich auf einer höheren Abstraktionsebene ein, geht ins Grundsätzliche und wirft seinen Reformelan zuerst auf die Gesamtheit der staatlichen Einrichtungen und Prozeduren, die dafür da sind – und nach seinem Urteil ganz generell an ihrer Aufgabe versagen –, zweckmäßige Regeln für eine garantiert erfolgreiche Bewirtschaftung des nationalen Kapitals und der nationalen Klassengesellschaft – und der nationalen Arbeiterklasse durchs nationale Kapital – zu erlassen. Wenn von irgendwelchen Maßnahmen gegen irgendwelche Missstände die für fällig erachtete Renovierung der Macht der Nation gar nicht zu erwarten ist, dann – so der kühne, aber systemimmanent folgerichtige Schluss des Präsidenten – muss die produktive Aufmischung des Herrschaftsapparats den nötigen Fortschritt bringen. Neue Maßregeln fürs Tätigwerden der Herrschaft selber: darauf zielen seine wortgewaltigen Nörgeleien. Aus Sarkozys Sicht hat die Nation sich 30 Jahre lang mit ihren doch so offensichtlichen Defiziten eingerichtet! Trotz ihrer lausigen und im Endeffekt immer lausiger werdenden internationalen Performance hat die Republik in Gestalt des sie leitenden Führungspersonals es sich in ihren verknöcherten Verhältnissen bequem
gemacht. Ihre wechselnden politischen Vorstände haben genau genommen gar nicht regiert, sondern ewig nur dasselbe Einheitsdenken
ihrer Vorgänger vor sich hin gedacht – anstatt einmal gescheit zu überdenken
, ob die Machtmittel, über die sie gebieten, überhaupt für den Zweck taugen, den sie verfolgen; oder ob sie, was auf dasselbe herausläuft, beim Gebrauch ihrer Macht nicht schon längst den Zweck vollkommen aus den Augen verloren haben, dem der zu dienen hat. So oder so: Für den neuen Präsidenten der Republik haben seine Vorgänger jedenfalls den Skandal herbeigewirtschaftet, dass der Staat nicht nur den Dienst am Erfolg der Nation schuldig bleibt. Für ihn stellt sich bei genauerer Betrachtung heraus, dass heute der Staat selbst das Hindernis für das Wachstum und für den Fortschritt ist
(Sarkozy, 20.6.07). Und was das Schlimmste ist: Auch ihrem Volk haben die bisherigen Regenten Frankreichs in ihrer grenzenlosen Selbstzufriedenheit gestattet, es sich bequem zu machen und sich gemütlich einzurichten – in Verhältnissen, mit denen ein nationaler Führer, dem es ernst ist mit dem Erfolg seiner Nation, nie und nimmer zufrieden sein kann!
So kommt bei Sarkozy zum Idealismus einer herrschaftlichen Erfolgsmethodik der ebenso tatendurstige Glaube an Erfolgstugenden, die im Volk im Prinzip zwar vorhanden, tatsächlich aber verschüttet sind – und darauf warten, dass er sie wieder freilegt.
1. Kampf um die Mobilisierung herrschaftlicher Potenzen
Bei der Umsetzung des Projekts, dem staatlichen Machtapparat zum besseren Funktionieren für seinen Auftrag zu verhelfen, braucht ein Staatsmann natürlich das Wissen von Experten. Gefragt ist da ein Sachverstand, der den grandiosen Einfall des Präsidenten, ausgerechnet den politischen Urheber und machtvollen Regenten des zweitgrößten europäischen Kapitalstandorts als Wachstumshindernis zu identifizieren, konstruktiv weiterdenkt, ihn in zielführende therapeutische Maßnahmen überführt und sich in diesem Sinne an die kritische Durchmusterung der staatlichen Einrichtungen und ihrer funktionellen Zuordnung macht. Also richtet sich der große Kritiker der staatlichen Bürokratie und ihrer ‚Verknöcherung‘ als erstes einen ansehnlichen bürokratischen Apparat von Kontrollzirkeln, Reformarbeitskreisen, Evaluationskommissionen und Forschungsausschüssen ein, der die Regierung mit Vorschlägen zur herrschaftlichen Verfahrensoptimierung
versorgt,[1] und der legt dann wunschgemäß los.[2]
Effektiver ‚Machttransfer‘ im Land!
Da stellt sich für die Kenner der Materie, die die politische Bewirtschaftung eines kapitalistischen Standorts für auch so ein Verfahren neben anderen halten, manchmal heraus, dass die Zentrale in Paris aus dem, was außerhalb der Metropole abläuft, ausgemischt ist, sie womöglich auf wichtige Entscheidungen, die nicht bloß regionalen Charakter haben, nicht den gewünschten Einfluss nehmen kann. Daraus folgern sie als erstes, dass man die Präsenz des Staates in den Regionen verstärken muss
(Le Monde, 12.12.07). Das ist sehr logisch, leuchtet ein und wird politisch auch sogleich auf den Weg gebracht. In einer flächendeckenden Umorganisation des Staates von der größten Bedeutung seit der Schaffung der Regionspräfekturen 1964
(ebd.) soll die Verwaltungshierarchie im Staat neu durchkonstruiert werden. Die politischen Kompetenzen des Machtapparates werden neu aufeinander zugeschnitten, die Präfekten der Departements denen der Regionen unterstellt usw. Neues kommt darüber nicht auf die politische Agenda, aber einem zügigen und reibungslosen ‚Durchregieren‘ in Frankreich steht so möglicherweise schon weniger im Weg als vorher. Möglicherweise. Denn kommt es in diesem Sinne darauf an, die Hierarchie der staatlichen Verwaltung von oben nach unten und von der Zentrale in Richtung Peripherie zu straffen, so wäre nach Expertenmeinung für denselben Zweck manchmal bei der Ausübung der Staatsgewalt auch die umgedrehte Richtung wünschenswert. Also wird untersucht, welche Funktionen, die heute in Paris ausgeübt werden, morgen in der Provinz angesiedelt werden können
(Sarkozy, Ansprache bei der Präsentation des Woerth-Berichts, 12.12.07), was ja auch etwas für sich hat: Wenn die Herrschaftszentrale eigene Metastasen gleich in die Provinzen einpflanzt, braucht es sie ja in der Metropole nicht mehr, worüber ‚Friktionen‘ sowie alle sonstigen institutionellen Hindernisse eines effektiven Regierens zwischen der und den Provinzen schlagartig gegen Null gehen müssten. So wird der Herrschaftsapparat auf der methodischen Ebene seiner institutionellen Einrichtungen unter Anleitung von ganz viel wissenschaftlichem Sachverstand modernisiert, und so bescheuert eine beständige Kompromisssuche und -findung zwischen konsequenter Zentralisierung einerseits, entschlossener Dezentralisierung andererseits auch sein mag: Ein der Form nach neues politisches Innenleben lässt sich dem Land auf diesem Weg zweifellos verpassen.
Effektive Entscheidungsprozesse in der Machtzentrale!
Die unter dem Stichwort ‚Gewaltenteilung‘ zusammengefassten rechtsstaatlichen Einrichtungen und Verfahren der demokratischen Selbstkontrolle müssen sich – irgendwie ganz konsequenterweise in dem Land, dem die Menschheit die größten gedanklichen Anstrengungen zur Begründung und Rechtfertigung dieser Herrschaftsmethode verdankt – eine gnadenlose Überprüfung in Hinblick auf ihre Verträglichkeit mit dem Wohl der Nation gefallen lassen. Nach Auffassung des Präsidenten bedarf es für Frankreichs Aufbruch in eine große Zukunft einer Neujustierung unserer Institutionen, die eine bedeutende Verstärkung der Macht des Parlaments, ein tatsächliches Gegengewicht zur Macht der Exekutive, einen Obersten Gerichtshof, der seine Aufgaben in völliger Unabhängigkeit von der politischen Gewalt ausführt, einschließt
. (Sarkozy, bei der Einsetzung der Balladur-Kommission, 18.7.07) Ob das so alles zueinander passt, was er für sich passend machen will, fragt man besser nicht. Das sind Petitessen für einen Mann, der den unbedingten Erfolg der Macht haben will, an deren oberster Spitze er selbst steht, und dem deshalb die Effektivierung der Machtausübung zur wichtigsten politischen ‚Sachfrage‘ wird. Also kündigt er an, die Gewalt der Exekutive über die Stärkung der Macht der Legislative auf Vordermann zu bringen und beide Mächte dann nochmals durch die Stärkung einer Judikative stark zu machen, die jenseits beider Abteilungen ihres Amtes waltet. Und weil er eben ein Mann der Tat ist, macht er sich gleich praktisch an die vorwärtsweisende Neuauslegung der ‚Gewaltenteilung‘: Über die Neudefinition der Vollmachten für den Staatschef, über die Neuregelung des Modus der Gesetzgebung, der Befugnisse des Rechnungshofes, des Verfassungsrats usw. wirft er viele der politischen Gepflogenheiten, wie sie innerhalb der herrschenden Klasse sowie in und zwischen ihren funktionellen Untergliederungen eingerissen sind, über den Haufen. Ebenso souverän setzt er sich über die demokratischen Grundgesetze der Parteienkonkurrenz und des Umgangs einer Regierung mit ihrer parlamentarischen Opposition hinweg, beruft demonstrativ gegen den Widerstand aus den Reihen seiner eigenen Partei Mitglieder der sozialistischen Parlamentsminderheit in wichtige nationale und internationale Ämter, handelt also im Sinne seines Verdachts, überkommene Gewohnheiten des politischen Betriebs, hier: die Monopolisierung politischer Ämter durch die in Wahlen siegreiche Partei, wären bloß dazu angetan, politische Ressourcen, schöne Herrschaftstalente in dem Fall, verkommen zu lassen. Das schafft Spannung in der Regierungsmannschaft, bricht altes ‚Parteiendenken‘ auf, ist also offenkundig innovativ – mithin genau das, was Frankreich braucht!
Wie schon bei der Renovierung des Machtapparats, so bleibt auch bei der seines parlamentarisch-demokratischen Herzstücks alles beim alten, was den Stoff der Politik und die Zwecke des Regierens betrifft. Nur eben viel lebendiger soll es zugehen im Parlament sowie in und zwischen den Instanzenzügen der Macht. Ganz viel Mut zur Freisetzung der Produktivkraft des Durcheinanders ist angesagt, weil die ja das beste Rezept gegen alte und deswegen schlechte Gewohnheiten ist. Und damit das Personal wie vom Chef erwünscht auch als ein riesiges politisches Potenzmittel wirken kann, scheucht der die parlamentarischen Sesselfurzer und Partei-Karrieristen in den Nischen auf, in denen sie sich so bequem eingerichtet haben.
Effektives Dienstpersonal auf allen andern Ebenen der Entfaltung staatlicher Macht!
Sein tatkräftiges Naturell lässt der Präsident auch die unteren Ränge des staatlichen Dienstpersonals spüren. Wo in anderen Ländern die Sitte eingerissen ist, sich im Wege der Privatisierung staatlicher Funktionen den kostspieligen Unterhalt von Beamten und öffentlichen Dienstkräften vom Hals zu schaffen, schwebt ihm ein alternatives Spar- und staatliches Effektivierungsprogramm obendrein vor. Der öffentliche Dienst soll als Modell und als Leader dienen
(Sarkozy, Le Monde, 13.1.08), nämlich als Vorbild dafür, wie sich politische Weisungsbefugnis unmittelbar in Maßnahmen zur kostengünstigen Optimierung staatlicher Herrschaftsanliegen umsetzen lässt. Für die notorische Sammelklage seiner Bürger hat er da mal ein offenes Ohr, denn Institutionen, die zu viel kosten, für einen Service, der immer schlechter wird
(Attali-Kommission, Ziel Nr. 8, Le Monde, 20.1.08), bezeugen für ihn nur schon wieder das große Versäumnis, das der öffentliche Dienstherr sich in der Vergangenheit hat zuschulden kommen lassen: Er hat sein Personal offensichtlich nicht gescheit auf Trab gebracht! Das sitzt seine Stunden ab, kassiert auch noch Geld dafür, wartet ansonsten darauf, in Pension geschickt zu werden, hat sich insgesamt in einer Tradition selbstzufriedenen Verwaltens eingerichtet – unmöglich, so etwas! Nur gut, dass der Präsident zur Behebung dieses Skandals einfach auf das segensreiche Prinzip zurückgreifen kann, das im privaten marktwirtschaftlichen Treiben seiner Bürger regiert – und schon weiß er, was er sich wünscht: Ich wünsche einen Öffentlichen Dienst mit weniger, aber besser bezahlten Staatsdienern und besseren Karrierechancen.
(Sarkozy, Le Monde, 21.9.07) Weniger Personal, das mehr leistet, dafür aber auch besser entlohnt wird und dem sogar Chancen eröffnet werden, mit noch mehr Leistung Karriere zu machen – so wird aus dem öffentlichen Dienst das Exerzierfeld jenes modernen betriebswirtschaftlichen Personalmanagements, das andernorts die Effektivierung des Humankapitals besorgt; natürlich auch mit den dort üblichen Folgen für alle, deren Dienste nicht gefragt sind : 35 000 bis 50 000 Stellen werden jedes Jahr bis 2015 gestrichen.
(ebd.) So weit zum savoir vivre, wie ein Präsident es sich für seine ihm unmittelbar Unterstellten wünscht.
Der harte Kern der Reform des öffentlichen Dienstes, die Sarkozy einleitet, ist insoweit ein ganz banales Sparprogramm. Der beständig beschworene tiefere Sinn der Veranstaltung liegt jedoch in dem Beitrag, den sie für das Endziel liefern soll, die Nation zu einer erfolgreichen Kampfmaschine für den globalen Konkurrenzkampf herzurichten. Der Beitrag besteht zum einen in den Tugenden des Erfolgs, die dadurch „freigesetzt“ werden sollen; angefangen vom Mut
, den die Staatsführung hat und praktisch unter Beweis stellt, über das nötige Umdenken
zur Schaffung von mehr Effizienz
bis hinunter zum Willen zur Leistung
ihrer besoldeten Diener, der das Land in ein Paradies des Service verwandeln soll. Damit ist auch schon der andere Teil des präsidentiellen Ertüchtigungsprogramms angesprochen: Von Staats wegen besser bediente, also effektiver regierte Bürger funktionieren selber besser.
2. Initiativen zur Mobilisierung der Ressource Volk
Dass seine Landsleute – mit ganz wenigen Ausnahmen – in ihrem alltäglichen Leben, das auch in Frankreich kein Honigschlecken ist, äußerst wenig Grund für Zufriedenheit haben, ist dem Präsidenten natürlich bekannt. Er legt sich das so zurecht, dass es sich bei der Unzufriedenheit seiner Bürger nur um dieselbe Anwandlung handeln kann, die ihm bei der Bestandsaufnahme der Verfassung seiner Nation gekommen ist: Überhaupt nicht er allein ist es, der sich am so unsagbar verschnarchten Zustand seiner Republik stört – seine Bürger sind es, die grundsätzliche Änderungen wollen in der Weise, wie Politik gemacht wird, also auch in der Funktionsweise der Institutionen: mehr Transparenz, mehr Verantwortung, mehr Modernität, mehr Demokratie
(Sarkozy bei der Einsetzung der Balladur-Kommission, 18.7.07) – also dass Schluss gemacht wird mit der ganzen Schwerfälligkeit, mit dem Defätismus und mit dem Zaudern der Vergangenheit
(Fillon, Regierungserklärung, 3.7.07). Vorbei ist es dann natürlich auch mit den Unsitten unzeitgemäßer Bequemlichkeit, die sich aus Sarkozys Sicht das geehrte Volk zugelegt hat. Er jedenfalls nimmt sich vor, die Franzosen mit den Worten Erfolg, Arbeit, Verdienst, Risiko zu versöhnen
(Sarkozy, Rede vom 20.6.07), obwohl die sich mit diesen Worten ganz bestimmt nicht entzweit haben.
Eine neue Kultur des Arbeitens und Geldverdienens
Ich will der Präsident der Kaufkraft sein!
(Sarkozy, Rede vor der CGPME (Verband der kleinen und mittleren Unternehmer), 7.12.07) – das ist der Tenor aller ökonomischen Reformen, die der Präsident seinem Volk ansagt. Dabei hat er als Erstes ein großes Ärgernis im Visier: die 35-Stunden-Woche in Großbetrieben, die noch übrig geblieben ist von den Bemühungen der sozialistischen Vorvorgängerregierung, die Arbeitslosigkeit im Land lohnkostenschonend umzuverteilen. Dieser Eingriff gehört zu den großen Fehlern der Vergangenheit: Da hat man doch glatt den Franzosen erklärt, dass man weniger arbeiten müsse, während man dieselben Bezüge behalten könne, und im Ergebnis gab es weniger Wachstum, weniger Beschäftigung und weniger Kaufkraft
(ebd.). Kein Wunder: So eine Regelung ist eine einzige absurde Fessel fürs Kapital wie für dessen geldbedürftige Dienstkräfte. Sie gehört unbedingt weggeräumt; in Zukunft sollen die Unternehmen selbst die Dauer der Arbeit festlegen
(Le Monde, 1.12.07). Dass sie das in Einverständnis mit den Beschäftigten hinkriegen, versteht sich für Sarkozy von selbst; wird denen damit doch die Chance eröffnet, mit mehr Arbeit mehr Geld zu verdienen, was sie nach Jahren des Wirtschaftsaufschwungs, in denen die Arbeit immer rentabler gemacht worden ist, sicher dringend brauchen. Was für die Arbeitswoche gilt, das soll ebenso fürs gesamte Arbeitsleben gelten: Die von Staats wegen verordnete Frühverrentung vor dem 65. Lebensjahr muss abgeschafft werden
(Sarkozy, Rede vor dem Journalistenverband, 18.9.07). Damit die Arbeitnehmer ihre Freiheit, mehr zu arbeiten, um mehr zu verdienen
, sachgerecht ausnutzen können, entfallen zudem Vorschriften für die Gestaltung von Arbeitsverträgen: Wir wollen die Regeln vereinfachen, den Arbeitsvertrag geschmeidiger machen, eine flexible Sicherheit auf französisch
(Fillon, Le Monde, 25.10.07), wobei die Geschmeidigkeit à la française für die Unternehmerseite darin besteht, Arbeit bedarfsweise abrufen und sich ihrer nach Erledigung des Auftrags problemlos wieder entledigen zu können. Das ist flexibel und sicher zugleich, weil jede Seite genau weiß, woran sie ist: Der Kapitalist beutet seine Arbeitskräfte garantiert nur so lange aus, wie sich das für ihn rentiert; und die wissen schon vor ihrer Ausbeutung, ab wann sie sich um eine neue Verdienstquelle zu kümmern haben. Den Unternehmern werden zudem „Lohnnebenkosten“ erlassen, damit sie das Versprechen der Regierung wahr machen, die Arbeitslosigkeit auf 5 % zu drücken und den Beschäftigtenanteil auf 70 % zu erhöhen
(Sarkozy, Le Monde, 9.11.07), und damit mehr Geld in Umlauf kommt: Ich will weniger Belastungen für die kleinen und mittleren Betriebe und mehr Einkommen für die Arbeiter.
(Sarkozy, Rede vor der CGPME, 7.12.) Programmatisch nimmt der Präsident höchstselbst die Lohnfrage in die Hand; erklärtermaßen nicht, um das Lohnniveau wachstumsdienlich weiter zu senken, sondern um die nationale Lohnsumme in ihrer anderen volkswirtschaftlichen Funktion zu stärken, nämlich die Kaufkraft, die der nationalen Industrie die Ware versilbert, vor weiterem Verfall zu retten. Ganz offenbar hat er das nötig, der nationale Lohn!
Im Sinne seiner Verantwortung für die Kaufkraft der Nation nimmt der Präsident auch gleich die Gewerkschaften in die Pflicht. Mit ihren gelegentlichen Störmanövern gegen ein schwungvolles Arbeiten und Einkaufen gehören die ganz entschieden mit zu den verknöcherten Strukturen
, die Frankreich an den Rand des Absturzes in die weltwirtschaftliche Zweitklassigkeit geführt haben. Also werden die Organisationen ganz grundsätzlich mit der Androhung einer schärferen staatlichen Kontrolle ihres Innenlebens und ihrer Finanzen – von unsauberen Deals mit den Metall-Arbeitgebern und schwarzen Kassen ist die Rede – sowie mit ein paar zusätzlichen Bedingungen für die Wahrnehmung des Streikrechts diszipliniert; die Mitglieder werden u.a. der netten Vorschrift unterworfen, ihrem Patron eine Arbeitsniederlegung spätestens 48 Stunden vorher anzukündigen. Was den Gewerkschaften noch zu tun bleibt, darüber befindet keine Arbeiterversammlung, sondern die neue Obrigkeit: Die gibt den „Sozialpartnern“ auf, mit gemeinsam erarbeiteten konkreten Antworten bezüglich der Arbeitsbedingungen, der Beschäftigung, Gehalt, Kaufkraft und der Gleichheit in der Arbeitswelt von Männern und Frauen
(Sarkozy, Le Monde, 3.9.07) zu einer verlässlichen Ordnung in der Arbeitswelt beizutragen. Der Premierminister legt ihnen dazu gleich ein Orientierungsdokument zur Modernisierung des Arbeitsmarktes und der beruflichen Bildung
vor, eine road map von sieben Seiten, die einen einheitlichen Arbeitsvertrag empfiehlt, wogegen alle Gewerkschaften sind. Dabei gilt eine Verpflichtung zu Ergebnissen bis zum Jahresende. Wenn die Sozialpartner nicht zu einer Übereinstimmung kommen, wird die Regierung die Reformen festschreiben.
(Le Monde, 10.8.07), was der Präsident noch einmal bekräftigt: Ich bin offen, was die Mittel und die Methoden anbetrifft, aber ich schließe jeden Kompromiss bezüglich der Ziele und Prinzipien aus.
(Le Monde, 20.9.07)
Ob der durchschnittliche Franzose sich von alldem am Ende mehr kaufen kann, darf bezweifelt werden. Mit seinem Aufruf, durch Mehrarbeit mehr Kaufkraft in Umlauf zu bringen, zielt der Präsident aber ohnehin auf der einen Seite mehr auf eine Ermunterung des Geschäftslebens, in dem außerdem ein neuer Geist der Konkurrenz Einzug halten soll. Auf der anderen Seite, was die große Masse seiner Franzosen betrifft, geht es ihm erst recht ums Grundsätzliche: um die Wiedererweckung des Willens, sich beim Geldverdienen und überhaupt ordentlich ins Zeug zu legen, damit Frankreich, die gemeinsame Heimat, wirtschaftlich und überhaupt wieder an die Weltspitze kommt. Dafür braucht es eine modernisierte Arbeitsmoral – und nicht nur die. Was Not tut, ist:
Eine neue politische Kultur überhaupt!
Viele Franzosen glauben nicht mehr an den Fortschritt
(Sarkozy, Rede vor der Parlamentsmehrheit, 20.6.07), und das wundert den Präsidenten überhaupt nicht – bei diesem vor sich hin verkrustenden Staat, in dem sie leben! Der hat ihre republikanische Staatsbürgermoral eingeschläfert, ihre patriotische Gesinnung in pure Selbstzufriedenheit ausarten lassen – die Krise der Werte ist noch nie so tief gewesen
(Sarkozy, Antrittsrede, 6.5.07) –, klar also, was da ansteht: Die bürgerlich-vaterländischen Tugenden, die im Franzosen stecken, gehören sich gründlich wiederbelebt, und auch dazu hat der Staatspräsident die passenden Initiativen parat. Die erste verkörpert er selbst, nämlich in Gestalt des unverwechselbaren Stils, in dem er seine Amtsgeschäfte führt. Dazu gehört als Erstes alles, was ihm von Nörglern im In- und Ausland als „Hyperaktivismus“ angekreidet wird und offenbar auch bei denen so viel Eindruck macht, dass die ein anderes Kriterium als das des Präsidenten selbst: Effizienz dagegen gar nicht in Anschlag bringen. Ein Beispiel gibt der Mann ebenso bezüglich der moralischen Produktivkraft des Geldmaterialismus, den er in seinem Volk anstachelt: Reichtum ist ausgesprochen schön und bekömmlich, wenn man ihn hat; Berührungsängste im Umgang mit denen, die ihn haben, zeigt er ausdrücklich nicht. Locker und überhaupt nicht öffentlichkeitsscheu lässt er sich von denen seine Ferien finanzieren und sich auch sonst bei jeder passenden Gelegenheit heraushängen, wie überaus billig und gerecht es nur ist, wenn einer, der so viel leistet wie er, mit entsprechend viel Luxus belohnt wird; Ex-Model als glamouröse Gattin inklusive. Daneben lanciert Sarkozy zwecks Erweckung der rechten Moral im Volk einen kleinen Angriff auf den liebevoll gepflegten ideologischen Überbau seiner Nation: Wenn sich das Volk in alter laizistischer Tradition unter dem staatsrepublikanischen Wertehimmel von liberté, égalité und fraternité derart zur geistigen Bequemlichkeit hat hinreißen lassen, dann gehört es schon mal daran erinnert, was es damit an Wertvollem alles verpasst. Im Glauben an Gott, den Allerhöchsten, steckt nämlich noch einiges mehr an staatsnützlicher Produktivkraft: Ein Mensch, der glaubt, ist ein Mensch, der hofft. Und das Interesse der Republik ist, dass es viele Menschen gibt, die hoffen.
(Le Monde, 22.12.07) Das hat unter den feinsinnigen Intellektuellen im Land schon für ein wenig Aufregung gesorgt. Aber die hat sich wieder gelegt, zumal der Präsident sie ja keineswegs vergessen hat:
Eine exzellente Elite braucht das Land!
Denn auch die Verfassung des Geisteslebens in Frankreich lässt für ihn sehr zu wünschen übrig. Nicht was das Zeug betrifft, das an den Fakultäten erforscht und gelehrt wird. Aber dass seit fünfundzwanzig Jahren unsere Hochschulen in den internationalen Rankings zurückfallen
, ist ein Skandal, zumal die Konkurrenz in Deutschland aus einem ähnlichen Desaster schon ihre praktischen Schlüsse gezogen hat. Also steht auch für Frankreich fest: Unsere Hochschulen müssen zu wirklichen Exzellenzpolen werden
(Fillon, Regierungserklärung, 3.7.07), und so etwas werden sie in ungefähr derselben Weise, in der in der Arbeitswelt die Befreiung der Konkurrenz von staatlicher Gängelung Wachstum und Kaufkraft schafft: Mit einer Hochschulreform erhalten die Universitäten eine wirkliche Autonomie
in Gestalt eines eigenständigen Budgets, das sie sich im Wege der Gründung von Geschäftsfirmen oder der Akquisition von Fremdmitteln auffüllen können. Das beflügelt den Wettbewerb unter ihnen und sorgt über kurz oder lang von selbst dafür, dass die Produktionsstätten des Wissens sich in solche scheiden, die einfach schon deswegen ‚exzellent‘ sind, weil sie Mittel haben, und andere, für die nach beiden Richtungen der Gleichung das Umgekehrte gilt. Freilich stehen auch die letzteren in der Pflicht, die obrigkeitlich angeordnete intellektuelle, moralische und künstlerische Renaissance
(Sarkozy, Brief an die Erzieher, 4.9.07) im Geistesleben der Nation voranzutreiben; nicht zuletzt in Form einer neuen Schule des Respekts
, in der sich die Schüler erheben, wenn der Lehrer eintritt
(Le Monde, 5.9.). Denn was das Land im Zuge seiner moralischen Runderneuerung braucht, das sind Autorität, Moral, Respekt, Leistung und der Stolz auf das eigene Land
(Sarkozy, Antrittsrede, 6.5.07); und deswegen kriegt der Bildungsnachwuchs verpflichtend zum Anfang des Schuljahres den letzten Brief eines hingerichteten jungen Widerstandskämpfers vorgelesen, der – wofür auch sonst!? – für Frankreich gestorben ist.
Ordnung in den Banlieues!
Im Umgang mit der Masse von pauperisierten Immigranten aus Ex-Kolonien und Protektoraten zeigt der Präsident, dass er sich auch aufs feine Differenzieren versteht. Leute, die sich mitten in Frankreich eine Gesellschaft konstruieren, wo jeder sich verbarrikadiert mit jenen, die wie er sind, die wie er leben, die wie er denken, die die gleiche Herkunft haben, dieselbe Religion
(Sarkozy, Eine neue Politik für die Banlieues, 8.2.08), kann er schlechterdings nicht leiden. Aber er duldet sie in seinem Land. Hinaussortiert werden von dem Pack nur die, die erstens keinen französischen Pass haben und sich zweitens in ihrem Gastland auch noch etwas haben zuschulden kommen lassen. Unter den übrigen Slumbewohnern, denen mit französischem Pass, wird aufgeräumt: Polizei und Justiz jagen die notorischen Krawallmacher und fördern so die Integration der übrigen, um die sich außerdem das Ministerium für nationale Identität und Einwanderung
kümmert. Wenn die redlicher Erwerbstätigkeit nachgehen und ihr Brot beim Bäcker kaufen, winkt ihnen die Chance, zum Mitglied des wertvolleren Volksteils erhoben zu werden. Wie weit man es in Sarkozys neuem Frankreich sogar mit Migrationshintergrund bringen kann, zeigen seine drei feschen Damen im Kabinett. Die haben es nicht nur in ihrer Karriere weit nach oben gebracht. Die sind dabei auch noch zu derart reinrassig französischen Nationalisten geworden, dass sie eigens zu dem Zweck Politik machen, damit in gewissen Stadtvierteln, in gewissen Banlieues jeder sich in der Nation wiederentdecken kann, jeder neu Vertrauen in die Institutionen schöpfen kann
(Sarkozy, Eine neue Politik für die Banlieues, 8.2.08), und etwas Besseres kann einer Vorstadt in Frankreich nun wirklich nicht passieren.
3. Richtlinien zur Mobilisierung eines Kapitalismus in den Farben Frankreichs
Wenn der neue Präsident in seinem verkommenen Laden mit etwas zufrieden ist, dann ist es die heimische Kapitalistenklasse. Zwar muss er auch der ein wenig ins Gewissen reden, damit sie ihre enormen Gewinne mit ihren Belegschaften ein bisschen teilt, so die Kaufkraft erhöht
– selbstverständlich ohne die Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen zu ruinieren
– und auf die Art ganz nebenbei die Mitarbeiter mit dem Kapitalismus und der Marktwirtschaft versöhnt
(Sarkozy auf der Neujahrs-Pressekonferenz, 8.1.08). Immerhin haben die Unternehmen aber Erfolg, die großen jedenfalls. Und wenn diese Erfolge doch immer noch zu wünschen übrig lassen, dann liegt das nicht an den Managern und deren französischer Unternehmenskultur. Da liegen im Gegenteil jene Stärken der Nation, die den Präsidenten so sicher machen, dass sein Land fraglos das Zeug dazu hat, die Welt mit einer „Renaissance“ made in France zu beglücken. Eben diese Stärke ist allerdings bedroht: Sarkozy fürchtet um den französischen Charakter seines nationalen Kapitalismus, der sich im Weltvergleich der Nationen zu behaupten hat. Er fürchtet darum: auch, aber nicht nur deswegen, weil die großen nationalen Champions zum Teil mit ausländischen Firmen verflochten und deswegen womöglich nicht mehr ganz französisch sind; auch, aber nicht nur deshalb, weil es von den wirklich gediegen blauweißroten Multis allemal zu wenige gibt und die eventuell doch noch zu klein sind. Es geht wieder um sehr Grundsätzliches: Sarkozy sieht eine Gefahr für die nationale Identität des Kapitalstandorts Frankreich insgesamt; und dass sich bei seiner Beschwörung dieser Gefahr manches wie aus dem Rhetorik-Lehrbuch des jungen Faschisten anhört, liegt in der Natur seines Anliegens:
„Angesichts des Hereinbrechens der extrem aggressiven Spekulations- und Staatsfonds steht außer Frage, dass Frankreich darauf reagiert. ... Frankreich muss seine Unternehmen schützen und ihnen die Mittel geben, um sich zu wehren und zu entwickeln. Die ‚Caisse des Dépôts‘ soll das Instrument dieser Politik sein, die die maßgeblichen nationalen Wirtschaftsinteressen verteidigt und fördert. Ich denke besonders an die Industrie, weil ich davon überzeugt bin, dass ein Frankreich ohne Industrie und ohne Arbeiter ein verarmtes Frankreich ist, nicht nur wirtschaftlich verarmt, sondern auch kulturell und moralisch, weil es eine Arbeitermoral, weil es eine Arbeiterkultur und eine Industriekultur gibt, die Teil unserer Identität sind. Man kann nicht alles für einen sich selbst überlassenen Kapitalismus aufgeben. Der Finanzkapitalismus muss, das wiederhole ich immer wieder, moralisch bewertet werden.“ (ebd.)
Nun ist es wirklich nicht so, dass der Präsident, der Frankreich auf Biegen und Brechen „modernisieren“ will, auch nur im Entferntesten ein fundamentaler Kritiker des „raffenden Kapitals“ wäre: Sofern der internationale Finanzkapitalismus, „aggressive Spekulation“ inklusive, sich am Standort Paris tummelt, ist er willkommen, verdient also offenbar moralisch die besten Noten; Sarkozys Regierung tut jedenfalls alles dafür, die eigene Hauptstadt nicht bloß neben, sondern gegen Frankfurt, London und New York zum weltweit führenden Finanzplatz zu machen. Es ist auch keineswegs so, als wollte der Kämpfer gegen „Verkrustungen“ aller Art unrentable Industrien wiederbeleben, nur weil deren Personal aus guten Franzosen bestand, die liebenswerte Kulturgüter schufen; für den Präsidenten ist allemal nur ein spitzenmäßig rentables Industrieunternehmen ein gutes Stück „Industriekultur“, und nur eine total „flexible“ Arbeitskraft verdient Anerkennung als Teil der blauweißroten „Arbeiterkultur“. Als politischer Chef des modernen französischen Kapitalismus will Sarkozy am Kapitalismus gar nichts ändern. Eben deswegen ist es ihm aber umso wichtiger, dass dieser lupenreine Kapitalismus lupenrein französisch bleibt; was so viel heißt wie: dass Frankreich davon profitiert und dass kein auswärtiger Standort „aggressiv“ gegen französische Interessen vorgeht, sondern allein Frankreich im Zeichen seiner „politique de civilisation“ mit seinen kapitalistischen Potenzen gegen das konkurrierende Ausland gewinnt. Das Geschwätz des Präsidenten vom industriekapitalistischen Volkscharakter Frankreichs ist die – zugegeben: etwas exaltierte französische – Fassung einer in der Sache unmissverständlichen Ansage: Die Regierung erteilt sich den Auftrag, Frankreichs innere Potenzen nach außen wirksam zur Geltung zu bringen. Denn erstens können sie sich nur so richtig entfalten – und zweitens sind sie letztlich genau dafür überhaupt da.
II. Wozu die Aufmöbelung der Nation gut sein soll Auch Frankreich hat (s)eine globale Mission
1. Die Nation ist rundherum unzufrieden mit ihrem politischen Machtstatus in der Staatenwelt
Für den neuen französischen Präsidenten steht fest, dass Frankreich aus dem Weltgeschäft nicht den Reichtum an Land zieht, der diesem hervorragenden Staate zusteht. Für ihn ist zweitens sonnenklar, dass Frankreichs Stimme in der Welt viel zu wenig als Machtwort zählt, dem Respekt gebührt. Und er diagnostiziert zwischen diesen beiden Missständen, unter denen die Nation leidet, einen eindeutigen Zusammenhang: Frankreich droht ein Opfer der „Globalisierung“ zu werden, weil es ihm an Macht fehlt, die globalen Herrschaftsverhältnisse und damit auch die Konditionen des weltweiten Geschäfts zu bestimmen. Der vermisste Erfolg im ökonomischen Vergleich der Nationen ist für Nicolas Sarkozy ein einziges Indiz dafür, dass es der Staatsgewalt, die er regiert, an Durchsetzungskraft gegen ihresgleichen fehlt.
Entsprechend fällt die Liste der Leiden Frankreichs nicht nur mit der Entdeckung von lauter Schuldigen auswärts – Staaten, Bündnissen und Weltordnungs-Institutionen –, sondern auch mit massiver politischer Selbstkritik zusammen: Frankreich hat es nicht vermocht, sich die nötigen Machtquellen und -koalitionen zu verschaffen, um seinen nationalen Interessen erfolgreich Bahn zu brechen.
- La France hat es nicht geschafft, die Europäische Union zu einem schlagkräftigen Verein imperialistischer Durchsetzung herzurichten.[3] Die ist unterdessen tendenziell zu einem „trojanischen Pferd für alle Bedrohungen“ der „Globalisierung“ geworden, statt „die Völker Europas zu schützen“. (Sarkozy am Wahlabend, 6.5.2007) Sie hat der „Gier“ ausländischer Geschäftemacher Tür und Tor geöffnet und zerrüttet damit die Reichtumsbasis der abendländischen Nationen. Wo es doch umgekehrt ihre soziale Aufgabe wäre, ihre Volksmassen für die erfolgreiche Aneignung der auswärtigen Reichtumsquellen einzuspannen. In Form einer rhetorischen Frage ergeht ein vernichtendes Urteil:
Ist Europa nicht zum Transmissionsriemen der Auswüchse der Globalisierung geworden, wo es doch vielmehr deren Erschütterungen abfedern und unsere Völker in die Lage versetzen sollte, alle Chancen, die sie bietet, zu nutzen?
(Sarkozy, Botschafterkonferenz, 27.8.2007) Kein Wunder, laut Sarkozy – wenn schon allenthalben der nötige Wille fehlt. Da drücken sich die Regierungen Europas um die „drängenden Fragen“ von klaren „Grenzen“, „Identität“ und „Zielsetzung“ der Union herum, während die weltpolitische Konkurrenz in die Offensive geht. Das Europaparlament ist eine „Konsensmaschine für Dogmen und kraftlose Ideen“ ohne „politischen Elan“; die Zentralbank gefällt sich „im Status der Unabhängigkeit“, statt ihrer „Rechenschaftspflicht“ nachzukommen und den Euro als Waffe für den internationalen Konkurrenzkampf zu schärfen. Für die „Verteidigung“ wollen kaum dreieinhalb der 27 Nationen Europas einen Beitrag entrichten, obwohl die zahlreichen Weltordnungsfronten, in denen politischer Einfluss und Macht ‚verteilt‘ werden, den nachhaltigen Einsatz militärischer Fähigkeiten aus Europa gebieten würden. (Vgl. Sarkozy, Neujahrsrede, 8.1. 2008) - Frankreich hat die politische Degradierung durch die USA nicht verhindert. Soll die Grande Nation sich etwa mit dem minderen politischen Status abfinden, den das Bush-Amerika ihm nach seinem Nein zum Irakfeldzug verpasst hat? Wenn Frankreich hauptsächlich seine politische Distanz zu den Antiterrorkriegsfronten der USA betont, statt selber Führungs-Verantwortung zu übernehmen, muss es sich nicht wundern, dass es immer mehr ins weltpolitische Abseits gerät.
- Da sitzt das Land als Vetomacht im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, gehört als Atommacht zum exklusiven Führungsclub, und was nützt es ihm? Obwohl die Zusammensetzung des obersten UN-Gremiums heute, zwanzig Jahre nach dem Kalten Krieg, überhaupt nicht mehr den wirklichen Machtverhältnissen entspricht, kümmert sich Frankreich nicht um die längst fällige Reform, die deshalb auch nicht stattfindet.
- Da liefert Frankreich – laut Selbstbenotung ein „Musterschüler“ in der NATO – fleißig militärische Beiträge für aktuelle Einsätze in Europa und im Antiterrorkampf ab und zieht daraus so gut wie keinen politischen „Nutzen, etwa in der Transformationsdebatte, bei der Einflussnahme auf Operationen oder ... Kommandoposten“. Als „diejenigen, die nörgeln und hinhalten“, stünden die Franzosen vielmehr meistens in der Ecke, statt über Rolle und Interventionen der Allianz führend mit zu entscheiden. (Verteidigungsminister Morin, 17.9.2007)
- Da muss die traditionsreiche Kolonialmacht mit anschauen, wie sich nicht nur die USA, sondern auch die Chinesen und demnächst die Inder in Afrika, ‚unserem‘ Kontinent, immer breiter machen, ökonomische Ressourcen und lokale Obrigkeiten in Beschlag nehmen. Und sie kann sich nicht groß wehren, weil die lieben europäischen Mitstreiter sich zu schade sind, den Auftrag zu übernehmen, Paris mit Eurocorps oder sonstigen Eingreiftruppen tatkräftig zu unterstützen.
2. Frankreich verkündet ein Aufbruchsprogramm, mit dem es nichts Geringeres verspricht, als die Staatenwelt zu zivilisieren
Wenn Staatsmänner zur systematischen Kritik am minderwertigen Machtstatus ihrer Nation schreiten, dann haben sie Großes vor. Die nachhaltige Korrektur der beklagten imperialistischen Defizite steht auf dem Programm. Und das heißt nichts Anderes, als die Machtfrage neu zu stellen. Die Aufwertung der Nation – der internationale Respekt vor ihren Ansprüchen an das, was sie Weltordnung nennen – will schließlich erzwungen sein.
Diplomatische Ansage an die ganze Welt
Der neue französische Präsident verkündet der Menschheit eine „politique de civilisation“. Die will er „umsetzen, damit Frankreich die Seele der neuen Renaissance wird, die die Welt braucht“. (Neujahrsrede, 8.1.2008) Die der Welt verordnete Wiedergeburt, die Frankreich inspirieren soll, kann, so seine Diagnose, nur durch die erfolgreiche Bewältigung von „drei großen Herausforderungen“ gelingen: durch den Kampf gegen den „fundamentalistischen Extremismus“, die Klima-verträgliche Sicherstellung einer „dauerhaften Energieversorgung“ und die „Integration“ der „aufstrebenden Riesen, China, Indien oder Brasilien, in die neue globale Ordnung“ (Botschafterrede).
Der Mann hat klare Vorstellungen davon, was die Neuordnung der Welt gebietet. Er hat auch kein Problem damit, dass er diese drei Tagesordnungspunkte nicht unbedingt erfunden hat; sie erinnern ja nicht zufällig an das Weltzivilisierungsprogramm der Weltmacht USA. Der Kern der Botschaft, auf den Sarkozy hinaus will, ist nicht zu überhören: Frankreich stellt sich auf eine Stufe mit der Weltordnungsmacht; Frankreich definiert die vom militanten amerikanischen ‚Hegemon‘ eröffneten Fronten als die wirklich entscheidenden Sicherheitsprobleme; und Frankreich erteilt sich damit den Auftrag, den fälligen Kampf an diesen Fronten maßgeblich mit-, also seinen Ausgang im Sinne Frankreichs zu gestalten.
- „Gegen den Terror!“ ist der oberste Kampfbegriff der USA. Er markiert einen globalen Feind, identifiziert gleichermaßen nicht-staatlichen Widerstand wie staatliche „Diktaturen“, welche die Unterwerfung unter die verlangten Dienste der Weltmacht verweigern, als illegitime Gewalt und gibt sie damit zum Abschuss frei. Der schöne moralische Titel ‚Antiterrorismus‘ – mit der ihm eigenen abstrakten Kriegserklärung gegen jede störende Gewalttätigkeit – eignet sich bestens zur Übernahme – auch und gerade für einen Konkurrenten der USA, der deren Sortierung der Staatenwelt in Freund und Feind nicht mitmachen will. Seine ideologische Stoßrichtung passt zu jedem Vorherrschaftsprogramm; es eröffnet dem Anwalt der gerechten Gewalt schließlich die Freiheit der Einordnung. Und darüber, dass der französische Präsident sich die Wahl seiner Freunde, potenziellen Partner und Gegner vorbehält, will er niemanden im Zweifel lassen. Deshalb betont er immer wieder, dass sein Kampf den islamischen Extremisten gilt, dass aber unbedingt „einer Konfrontation zwischen dem Islam und dem Westen vorgebeugt werden“ muss – ein vom Terrorismus geläutertes Land wie Libyen und erst recht all die anderen arabischen Nationen also nicht diskriminiert und von den Errungenschaften des kapitalistischen Fortschritts ausgeschlossen werden dürfen. (Botschafterrede)
- Was den Kampf betrifft, der gegen die „beträchtlichen Risiken“ für eine „dauerhafte Energieversorgung“ und das künftige Weltklima ansteht, so fallen dem Präsidenten spontan immer wieder die Atomkraftwerke ein, auf deren Produktion und ausgiebige Verwendung bekanntlich Frankreich spezialisiert ist. Die Verbreitung dieser strahlenden Strom-Fabriken soll (Haupt-)Teil einer eleganten Lösung gleich beider Probleme sein: der Energieunsicherheit wie der Klimaerwärmung. Entscheidend ist die politische Sache, um die es Sarkozy dabei geht. Der pur strategische Rahmen, in den er Öl, Gas und Kernkraft stellt –
„Wenn wir einer Milliarde Muslime weltweit sagen, dass sie kein Recht auf die zivile Kernenergie haben, wenn sie auch kein Öl und kein Gas mehr haben; dass sie kein Recht auf die Energie der Zukunft haben; dann schaffen wir die Voraussetzungen für Elend, Unterentwicklung und folglich für eine explosionsartige Ausbreitung des Terrorismus.“ (Botschafterrede)
- macht klar: Frankreich beansprucht das Recht, über die Kontrolle und Zuteilung der zentralen Ressourcen des Wirtschaftswachstums an die Staaten der Welt an vorderster Front mitzubestimmen. Es will entscheiden, wie über die Energieträger und -technologie – welche in ihrer Eigenschaft als Bedingung und Motor kapitalistischer Produktion zugleich elementares Mittel nationaler Machtentfaltung sind – verfügt wird. Energie ist eine Frage der politischen Zugriffsmacht, also selbst eine Gewaltfrage höchsten Kalibers. Sicherheit von Energieversorgung schließt die Macht über die Quellen von Öl und Gas, den Handel mit ihnen, die Transportwege sowie die Potenzen zur Nutzung alternativer Technologien (atomare inklusive) ein, die eine Nation ein Stück unabhängig machen von all den „Risiken“, für welche die Berechnungen ausländischer Rohstofflieferanten sorgen können. Deswegen müssen die ja nach Kräften unter Kontrolle genommen werden! Auch in puncto Energieversorgung ist die globale Reichweite der Zuständigkeit folglich eine Selbstverständlichkeit. Und der aktuelle Oberverantwortungstitel, die ‚Sorge um das Weltklima‘, ist geradezu prädestiniert dafür, die Notwendigkeit eines weltumspannenden energiepolitischen Vorschriftenwesens zu illustrieren.
- Die „Riesen von morgen“ werden als imperialistische Rivalen ins Visier genommen, die Frankreich – beim Kampf um den Zugriff auf die strategischen Ressourcen, aber nicht nur da – immer mehr in die Quere kommen. Sie werden aus der Warte des berufenen politischen Platzanweisers begrüßt und gewarnt zugleich:
„Sie sind Motoren des weltweiten Wachstums; ich will ihnen aber in aller Freundschaft sagen, dass sie auch Faktoren gravierender Ungleichgewichte sind; als Riesen von morgen wollen sie mit vollem Recht, dass ihre neue Stellung anerkannt wird, aber sie müssen sich von einem Freund auch folgende Überlegung anhören: Wenn man den Status einer großen Macht haben will, muss man bereit sein, die Regeln zu respektieren, die im Interesse aller liegen.“ (Botschafterrede)
Als Motoren der Weltwirtschaft und damit Quellen nationaler Bereicherung Frankreichs sind die neuen Riesen dem Präsidenten also recht, den Status einer Großmacht aber müssen sie sich erst durch Wohlverhalten verdienen. Ihnen wird freundlich klargemacht, welche ihrer Interessen jedenfalls nicht „im Interesse aller“ sind:
„Russland setzt seine Rückkehr auf die weltpolitische Bühne durch, indem es mit einer gewissen Brutalität seine Trümpfe, besonders im Erdöl- und Erdgasbereich, ausspielt, während die Welt, und insbesondere Europa, von ihm einen wichtigen, positiven Beitrag zur Regelung der Probleme erhofft, wozu seine wieder gewonnene Stellung berechtigt. Wenn man eine große Macht ist, darf Brutalität nicht zum Handwerk gehören.
China, das eine in der Geschichte der Menschheit einmalige beeindruckende Wiedergeburt erlebt, wandelt seine unersättliche Suche nach Rohstoffen in eine Strategie der Kontrolle um, besonders in Afrika. Selbst die Währung, fern der Gesetze des Marktes, wird zu einem Instrument im Dienste machtpolitischer Strategien. Die von den Staaten nach und nach ausgehandelten und verabschiedeten Regeln werden allzu oft missachtet.“ (Botschafterrede)
Der Mann sagt ziemlich ehrlich heraus, worin sein Zivilisierungsprogramm besteht: Das, was er als selbstverständliches Recht Frankreichs betrachtet und nach Kräften forcieren will – die Erweiterung der Zugriffsmacht auf Energieträger, die strategische Verwendung derselben und die Kontrolle über fremde Staatswesen –, wird bei den Russen, Chinesen, Indern etc. als brutaler Regelverstoß gebrandmarkt, den man natürlich nicht dulden kann. Präventiver Schutz der zu stiftenden neuen Weltordnung ist also angesagt. Umgekehrt steht das großzügige Freundschafts-Angebot: Wenn sie ihre wachsenden Machtpotenzen nutzen, um einen Beitrag zum französischen Regelungsbedarf zu leisten, dann sind sie als anerkannte Partner durchaus willkommen.
Ein etwas anderer Antiamerikanismus
Die drei globalen Herausforderungen markieren die Fronten, an denen sich die ordnungsstiftende Potenz der Staatsgewalten bewährt und entscheidet. Indem Frankreich für sich eine maßgebliche Zuständigkeit für die Sanierung der Konkurrenzordnung reklamiert, stellt es sich demonstrativ auf ‚Augenhöhe‘ mit der amerikanischen Weltmacht. Weil das genau so gemeint ist, lässt Sarkozy Amerika die entsprechende Botschaft auch auf seine direkte Art zukommen. Er deklariert die von seinem Vorgänger Chirac angegriffene „unipolare Weltordnung“ der USA als faktisch überholt, stuft die Supermacht zu einem Faktor der „multipolaren“ Machtrivalität herab und hakt den Feldzug der USA gegen den Irak explizit als Beweis für das Scheitern des amerikanischen Monopolanspruchs ab:
„Die Welt ist multipolar geworden, aber diese Multipolarität, die ein neues Konzert der Großmächte ankündigen könnte, driftet eher in einen Aufeinanderprall machtpolitischer Strategien ab.
Die Vereinigten Staaten konnten der Versuchung einer einseitigen Anwendung von Gewalt nicht widerstehen ...
Angesichts internationaler Krisen wie der im Irak steht heute fest, dass die einseitige Anwendung von Gewalt zum Scheitern verurteilt ist.“ (Botschafterrede)
So zensiert Sarkozy die alten und neuen Großmächte und warnt vor der Gefahr eines „antagonistischen Multilateralismus“, zu welcher die von Frankreich gestartete Konkurrenzoffensive natürlich überhaupt nicht beiträgt. Er fordert einen „effizienten Multilateralismus“ – also eine Weltordnung, in der Frankreich eine bestimmende Rolle spielt. Das ist der harte Kern hinter dem Weltverbesserungs-Ideal, dass Frankreich die aufeinander prallenden Gegensätze zwischen den ambitionierten Staatsgewalten „versöhnen“ wolle.[4]
Um diesen französischen Weltordnungsanspruch neu anzumelden und zugleich dessen Verträglichkeit mit dem amerikanischen zu versichern, ist Präsident Sarkozy in die Hauptstadt der Weltmacht Nr. 1 gereist. Mit den großen Gesten, mit denen er dem „großen amerikanischen Volk“ generös die erneuerte Freundschaft Frankreichs angeboten hat, dokumentiert er einerseits das Interesse seiner Regierung, das Zerwürfnis mit den USA – in Folge der verweigerten Unterstützung des Irakfeldzugs durch Vorgänger Chirac – zu beenden. Andererseits kommt es ihm geradezu darauf an, der politischen Klasse Amerikas wie dem Rest der Welt in aller diplomatischen Offenheit zu erklären, dass Frankreich sich für die Rolle eines Vasallen im US-Krieg gegen den Terror ein für allemal zu schade ist. Mit dem pathetischen Bekenntnis vor dem US-Kongress, dass man die „universellen Werte“ – in deren Namen Präsident Bush die Welt gewaltsam zivilisieren will – teile, weil sie, recht betrachtet, eigentlich die Errungenschaften der französischen Revolution sind, fordert er „echte Partnerschaft“ bei der Umgestaltung und Kontrolle der Staatenwelt ein. Wobei die Betonung auf ‚echt‘ liegt, weil er von der ‚Führungsmacht der freien Welt‘ die Anerkennung einer autonomen Ordnungspolitik Frankreichs und damit eines gleichberechtigten Status verlangt:
„Politik der Zivilisation heißt für Frankreich, seinen Werten und seinen Freunden treu zu bleiben, jedoch mit allen zu sprechen. Wir wollen die Zugehörigkeit Frankreichs zum westlichen Lager, zum Lager der Demokratien bekräftigen, ohne uns zugleich von irgendjemandem abhängig zu machen. Ich habe es im US-Kongress gesagt: Frankreich will Freund, Verbündeter und Partner der Vereinigten Staaten sein, aber wir wollen vor allem ‚ein ebenbürtiger Freund, ein unabhängiger Verbündeter und ein freier Partner sein‘. Frankreich will eine gleichgewichtsstiftende Rolle spielen. Frankreich will eine Politik der Versöhnung führen, mit allen sprechen, denn durch den Dialog mit allen kann man Frieden und Gerechtigkeit voranbringen. Wir sind uns selbst treu, wenn wir mit allen sprechen.“ (Sarkozy, Neujahrsrede, 8.1.2008)
Auf fast schon ironisch klingende Weise führt der Chef Frankreichs die Kunst der Diplomatie vor, wenn er im Namen des Respekts vor, gar der unverbrüchlichen Freundschaft mit der überlegenen Staatsgewalt für seine Nation das Recht in Anspruch nimmt, von den Feinddefinitionen der USA abzuweichen. Im Klartext: Auch Frankreich will und wird seinerseits – als „Freund aller“! – erstens eine Politik der universellen Einmischung betreiben und zweitens ganz nach eigener Interessenlage entscheiden, welche Geschäfte und welche Kriege man (mit)macht oder lässt, mit wem man diplomatisch verkehrt oder nicht und welche Bündnisse man schmiedet. Wie die USA eben. Und der Wink mit dem Zaunpfahl, wonach gerade die USA in Anbetracht ihrer kriegerischen Drangsale „starke Bündnispartner brauchen“, bildet den Auftakt, um im Namen der Europäer die bisherige militärische ‚Arbeitsteilung‘ im transatlantischen Bündnis für hinfällig, ja: für regelrecht abnorm zu erklären. Sarkozy verlangt, dass die USA endlich eine autonome Sicherheitspolitik Europas akzeptieren:
„Was ich hier sage, ist mir wichtig, darum will ich, dass es alle verstehen: Wer könnte es den Vereinigten Staaten verübeln, ihre Sicherheit gewährleisten zu wollen? – Niemand. Wer könnte es mir verübeln, dass ich mir wünsche, dass Europa in stärkerem Maße für seine Sicherheit einsteht? – Niemand.“ (Rede vor dem US-Kongress, 7.11.2007)
Er will nicht hinnehmen, dass die USA die Europäer weiterhin nach Kräften daran hindern, sich aus ihrer strategischen Abhängigkeit von Amerika zu befreien und ihre Sicherheit selbst zu garantieren. Ihn stört genau das, was der große amerikanische Freund nicht missen will: diese kriegspolitische Abhängigkeit, welche die Geschäftsgrundlage der NATO-Allianz war und ist. Denn sie garantiert den USA, dass ihre immer noch stärksten Konkurrenten nicht zu weltpolitisch eigen-mächtigen Rivalen werden und so die Gleichung außer Kraft setzen, der zufolge Amerikas Sicherheit dasselbe ist wie seine dauerhafte Vorherrschaft über die Staatenwelt.
Indem der französische Präsident von Washington das gleiche Recht zur Selbstverteidigung verlangt, das sich die ‚einzige Supermacht‘ herausnimmt, bestreitet er ihren Monopolanspruch, ohne sie anzugreifen. Eine Konkurrenz-Offensive ohne Konfrontation: das ist die Mixtur von Pro- und Antiamerikanismus, mit der Frankreich sich dem Weltmachtniveau der USA annähern will.
Europa vom Kopf auf die Füße stellen und so für Frankreich stark machen
Um die französischen Weltmachtambitionen in ein realistisches Programm zu verwandeln, will der französische Präsident sich um Europa kümmern:
„Der Aufbau Europas bleibt weiterhin die absolute Priorität unserer Außenpolitik. Ohne eine starke, aktive EU könnte Frankreich keine effiziente Antwort auf die drei Herausforderungen unserer Zeit geben. Ohne ein Europa, das seine Rolle als Machtfaktor ausübt, würde der Welt ein notwendiger Pol des Gleichgewichts fehlen.“ (Botschafterrede)
Das würde die Welt vielleicht nicht weiter stören, wohl aber Frankreich. Im Klartext: Frankreich braucht die EU – als Mittel, sich als respektierte Weltordnungsmacht in Stellung zu bringen; und zwar eine EU, die als mächtiges imperialistisches Subjekt auf der höchsten Ebene der Gewaltkonkurrenz aktiv wird. In diesem Sinne will Frankreich das Kommando über das europäische Einigungswerk übernehmen:
„Ich habe mir vorrangig zum Ziel gesetzt, Frankreich wieder in den Mittelpunkt des Aufbaus Europas zu stellen.“ (Sarkozy, Rede vor dem EU-Parlament)
Damit die Europäische Union für den Kampf auf Augenhöhe mit den USA taugt, muss eine ziemliche Neugründung her. Das alte Erfolgsrezept hat ausgedient:
„Europa von der Wirtschaft her aufzubauen, über Kohle und Stahl, über den Handel, war ein genialer Streich der Gründerväter. Aber die Politik ist gegenüber der Wirtschaft zu sehr ins Hintertreffen geraten...“ (Rede vor dem EU-Parlament)
Mit der grundsätzlichen Gegenüberstellung von wirtschaftlicher Methode und „Politik“ greift Sarkozy nicht weniger als das bisherige Konstruktionsprinzip der Europäischen Union an. Das bestand in der sukzessiven Ausgestaltung eines einheitlichen Kapitalstandorts, der die Interessen von immer mehr Nationen bedient, die sich mittels Europa stärken wollen. Und diese „Vergemeinschaftung“, die nur über das bekannte Ringen um Kompromisse zwischen den Mitgliedstaaten, die weiterhin um ihren Nutzen und Einfluss konkurrieren, vorankam, installierte zugleich lauter ökonomische ‚Sachzwänge‘, welche den Willen zur weiteren politischen „Integration“ herbeimanipulieren sollten. Womit so manche (Führungs-)Nation das Ideal verband, dass auf die Weise sozusagen automatisch eine „vertiefte“ Unterordnung der störenden nationalen Egoismen unter einen auch kriegspolitisch handlungsfähigen
Supranationalismus zustande käme. Darauf will sich die neue französische Regierung nun endgültig nicht mehr verlassen. Sie fordert vielmehr, dass Schluss sein muss mit dem desolaten Zustand, dass die lieben Partner hauptsächlich auf kleinkrämerisches Verdienen an und Profitieren von der Union scharf sind, statt sich um die politischen
Grundlagen, will sagen: das erfolgreiche Bestehen in der schieren Machtkonkurrenz mit den alten und aufstrebenden Großmächten zu kümmern. Wo die längst dabei sind, „uns Europäern“ den weltpolitischen Einfluss zu bestreiten, und unseren ungeschützten wirtschaftlichen Reichtum als Selbstbedienungsladen missbrauchen!
- Europas Priorität soll folglich die strategische Machtentfaltung sein:
„Ich will für die europäische Verteidigung kämpfen. Unabhängig von der Bedeutung der Nato muss Europa in der Lage sein, sich eigenständig und effektiv zu verteidigen. Europa kann nicht eine Wirtschaftsmacht sein, ohne seine eigene Sicherheit zu garantieren.“(Sarkozy, FAZ, 25.9.07)
Europa kann überhaupt nicht sein, ohne seine Identität auf eine umfassende militärische Gewalt zu gründen:
„Es ist höchste Zeit, die Interessen unseres Kontinents zu berücksichtigen und namentlich die Bedeutung der regionalen Stabilität bei den Nachbarn einer EU, die mehr als 450 Millionen Einwohner zählt und deren Bruttosozialprodukt ein Viertel der Weltproduktion ausmacht. Wenn man gemeinsame Interessen geschaffen hat, muss man sie gemeinsam verteidigen. ...
Wie kann man nur ein gemeinsames Schicksal behaupten und dann nicht den Apparat schaffen, der seinen Schutz übernimmt, das heißt das Europa der Verteidigung?
Das Europa der Verteidigung aufbauen heißt sich identifizieren, sich der Existenz Europas bewusst werden und dessen, was wir als Europäer sind. Das Europa der Verteidigung aufbauen heißt Europa mit Leben versehen.“ (Außenminister Morin, Münchner Sicherheitskonferenz, 9.2.2008)
So kann man auch ausdrücken, dass alle zivilen Interessen, welche kapitalistische Nationen in Kraft setzen und als ihre Lebensmittel schützen, nur soviel wert sind wie ihre kriegerische Fähigkeit, ihresgleichen in Schach zu halten! Da beschwört der Mann zuerst die „Schicksalsgemeinschaft“, die er für die angemessene und eigentliche ‚Idee‘ von Europa hält. Man habe sich doch darauf geeinigt, dass Staaten, Völker und Einwohner des Kontinents – im unverbrüchlichen WIR vereinigt, das keine Unterschiede und keine Gegensätze mehr kennt – auf Gedeih und Verderb an einem Strick ziehen; dass wir ALLE unser Leben und Überleben zur gemeinsamen Sache gemacht haben; also ein Kampfprogramm gegen die Bedrohung von außen zu bestehen haben, weshalb sich alle kleinlichen Berechnungen gegeneinander verbieten. Und dann klagt er die Einlösung dieses Programms ein, das eben – und für nichts Anderes steht die Ideologie der ‚Schicksalsgemeinschaft‘ – in der Beauftragung einer Gewalt kulminieren muss, welche ihren höchsten Sinn und Zweck darin hat, sich durchzusetzen, also andere Gewalten in die Schranken zu weisen. Das Pathos der Rede, die nicht umsonst ein wenig an Mobilmachung erinnert, passt zu dem harten Inhalt dieser Botschaft, die das Leben Europas mit Verteidigung identifiziert und deswegen, ebenso konsequent, in einem tauglichen
Apparat
– einer potenten Kriegsmaschinerie – ihre ebenso banale wie alles entscheidende Erfüllung findet.Die Direktiven aus Paris sind damit jedenfalls klar: Militante Selbstverteidigung im globalen Maßstab ist gefordert statt „Resignation“ und selbstgefälliges Verharren Europas „in seiner Situation der Abhängigkeit“ (ebd.)! Echte Kriegsbereitschaft ist verlangt. Einflusssphären in Afrika und anderswo sind zu sichern und zu erobern. Koordinierte Aufrüstung und Einsatzplanung sind überfällig. Und dabei haben gefälligst alle 27 Mitgliedstaaten einen ordentlichen Beitrag zu leisten, statt sich im Ernstfall womöglich sicherheitspolitisch auf die Seite des großen Konkurrenten, der USA, zu schlagen.[5]
- Ferner sind die politischen Führer der EU gefordert, ihre Macht zur offensiven Protektion des heimischen Kapitalstandorts einzusetzen und allen unlauteren Anfeindungen durch hochsubventionierte „Dumping“-Händler aus Amerika, China und sonstwo zu trotzen – ganz im Namen des fairen Wettbewerbs, versteht sich:
„Europa legt Wert auf Wettbewerb. Aber Europa kann ihn nicht als einziger in der Welt zu einer Religion erheben. Deshalb wurde beim Gipfel in Brüssel beschlossen, dass der Wettbewerb für Europa ein Mittel und nicht ein Ziel ist.“ (Rede vor dem EU-Parlament)
Will sagen: Der Wettbewerb taugt nur soviel, wie er die ökonomische Macht Europas befördert. Verantwortliche Politik muss vor allem dafür sorgen, dass die strategischen Ressourcen, von denen Europas Machtbasis – Wirtschaftswachstum und Volksmassen – lebt, den europäischen Herrschaften zur sicheren Verfügung stehen und nicht denen ausgeliefert werden, die ihre Mittel auf Kosten Europas sicherstellen wollen. Auch hier gilt das Motto ‚hart, aber fair‘:
„Europa will keinen Protektionismus, aber Europa muss Gegenseitigkeit fordern. Europa will keinen Protektionismus, aber Europa muss seine Unabhängigkeit in der Energie und bei Nahrungsmitteln sicherstellen.“ (Rede vor dem EU-Parlament)
Wenn Sarkozy hier sogar noch die Ernährungsfrage einfällt – die Autarkie, die er im Sinne hat, meint keine Rückkehr zu nationaler Selbstgenügsamkeit. Er will auch keinen Antrag bei der WTO einbringen, um gewisse Konkurrenzregeln zu modifizieren, sondern darauf bestehen, dass dem Überlebensinteresse der Nationen Europas der absolute Vorrang gegenüber jedem internationalen Regelwerk zukommen muss. Dieses Prinzip sollen gefälligst alle Mitglieder der EU unterschreiben und in die Tat umsetzen, statt unsere Interessen dem ‚neoliberalen‘ Fetisch des „Wettbewerbs“ zu opfern.
- Für die interne Wirtschaftsordnung der Europäischen Union soll dasselbe gelten. Verlangt ist die Revision alter Regeln, Vorgaben und Institutionen: Der Stabilitätspakt darf das französische und europäische Wachstum nicht behindern. Die Europäische Zentralbank soll nicht weiter der Geldwertstabilität als höchstem Götzen dienen, sondern den Euro zu einem schlagkräftigen Instrument im Konkurrenzkampf gegen den Dollar-, Yen oder Yuan-Imperialismus machen!
Überhaupt gehört sich eine „Wirtschaftsregierung“ der Euro-Länder, welche die ökonomischen Waffen schärft und sich dem Ausverkauf des Reichtums an unfaire Konkurrenten in den Weg stellt. Die Staaten dürfen nicht Sklaven einer Wirtschaft sein, die keine höhere Verantwortung kennt als die eigenen Gewinnbilanzen. Die Regierung hat umgekehrt dafür zu sorgen, dass die Profis des Geschäfts den Imperativen des Staates folgen und seinen Machtansprüchen die nötigen Mittel liefern. In diesem Sinne hat Sarkozy eine Kampagne
Für eine Moralisierung des Finanzkapitalismus
gegen vaterlandslose Spekulanten gestartet. Den ausländischen Heuschrecken und den Subprime-Kreditfälschern aus Ami-Land sollen die nicht hinnehmbaren Angriffe auf unseren Produktionskapitalismus verwehrt werden.[6]So soll die ökonomische Basis der europäischen Nationen nicht länger als abhängige Variable der freien grenzüberschreitenden Geschäftemacherei fungieren, sondern die Wirtschaft befähigt und verpflichtet werden, ihren maximalen Dienst zur Bewältigung der großen politischen Herausforderungen beizutragen, die der Kampf um eine Neue Weltordnung bereit hält. Dafür soll die Ratspräsidentschaft Frankreichs im zweiten Halbjahr 2008 genutzt werden. Sarkozy will die Frage des politischen Willens zu Europa neu stellen, eine Grundsatzentscheidung der Mitgliedstaaten einfordern. Das ist die Absicht, welche der geforderten „Debatte ohne Tabus“ über das Endziel, die territorialen Grenzen und die Identität der EU zugrunde liegt. Alle sollen Farbe bekennen: Ob sie gute Europäer wie das französische Vorbild sein wollen, sich also konstruktiv zu dessen Auftrag stellen, bei der strategischen Neuaufteilung der Welt maßgeblich mitzumischen, oder ob sie die notwendige Kraftanstrengung sabotieren wollen.
Ein etwas anderes französisch-deutsches Verhältnis
Das französische Programm, die EU von ihrem Gewaltbedarf her neu zu formieren, richtet sich nicht nur gegen den alten ‚ökonomistischen‘ Weg, sondern auch gegen die andere europäische Führungsmacht: den Achsenpartner Deutschland. Denn dieser gilt als und war ja auch der Hauptagent und Repräsentant der Methode von kontinuierlicher „Erweiterung und Vertiefung“ des Clubs der – auf sich allein gestellt – mindermächtigen Nationen. Der Erfinder des Stabilitätspakts, der oberste Hüter einer ‚unabhängigen‘ Zentralbank, der große Anwalt einer zentralen Rolle der NATO bei der Verteidigung Europas und der selbsternannte, scheinbar überparteiliche Vermittler zwischen den gegensätzlichen Interessen der Nationalstaaten wird nicht etwa konsultiert, um eine gemeinsame Linie zu vereinbaren, sondern gehört selbst zu den Adressaten der französischen Imperative. Revision, nicht Kontinuität, ist auch hier angesagt. Der deutschen Regierung wird freundlich mitgeteilt, dass man zwar auf ihre Unterstützung setzt, aber die traditionelle Führungsachse „als Motor nicht mehr hinreichend leistungsfähig“ ist für das Erreichen des ehrgeizigen Projekts der Umgestaltung des ganzen Ladens. Die Atommacht Frankreich geht praktisch davon aus, dass ihr mit dem Übergang zum Aufbau eines militärstrategisch aktionsfähigen Europa natürlicherweise die Rolle der überlegenen, also entscheidenden Führungsmacht zuwächst. In der Pose einer europäischen Schutzmacht, die sich auf der Ebene der internationalen Gewaltkonkurrenz durch ihre atomare wie konventionelle Kriegsmacht hinreichend qualifiziert hat, bietet Frankreich großzügig eine „Mitsprache“ beim Einsatz der französischen Nuklearwaffen an – und gibt sich „überrascht“ über die Ablehnung dieser Offerte durch die deutsche Bundesregierung. So zeigt sich: Frankreich will Deutschland, das es weitgehend als Schmarotzer am kollektiven Verteidigungssystem betrachtet, in sein Projekt der strategischen Emanzipation Europas einbinden und dafür zur Steigerung seiner militärischen Potenzen bewegen. Und so will es zugleich eine Führungskooperation neuen Typs schaffen, in welcher klar ist, wer den Ton angibt.[7]
Das Fazit des Präsidenten für Freund und Feind:
Wie Sie wohl verstanden haben, habe ich eine sehr anspruchsvolle Vorstellung von Frankreich und seiner Rolle in der Welt von heute; ich habe große Ziele für die Europäische Union, ihren natürlichen Platz im Zentrum eines effizienten multilateralen und gerechten Systems.(Botschafterrede)
3. Die in Anschlag gebrachten Mittel zur Umsetzung des Programms: Beiträge zum innereuropäischen Machtkampf und zur Großmachtkonkurrenz
Die hiesige Öffentlichkeit pflegt die Diskrepanz zwischen dem hochtrabenden Pathos, mit welchem Monsieur Le Président den Weltordnungsanspruch seiner Nation präsentiert, und den realen Mitteln der Durchsetzung mit Häme zu kommentieren und ihm das Scheitern zu prognostizieren. So äußert sich das meinungsbildende Fußvolk eines nachbarschaftlichen Konkurrenten Frankreichs. Der Vorwurf des Größenwahns ist der Sache ganz unangemessen und mit Kritik schon gleich nicht zu verwechseln. Tatsächlich nimmt das Programm des neuen französischen Führers seinen Ausgangspunkt von der Feststellung, dass die strategischen und ökonomischen Ressourcen seiner Nation viel zu matt ausfallen – gemessen an dem Maßstab, Frankreich „seinen Platz“ in der obersten Etage der Staatenhierarchie zu sichern. An der Überwindung der konstatierten Defizite soll ja gerade gearbeitet werden!
Und dass Frankreich durchaus Mittel zu mobilisieren und neue Optionen für die Erweiterung seiner Macht zu erschließen vermag, hat Sarkozy schließlich schon in seinem ersten Präsidentschafts-Halbjahr vorgeführt. Immerhin mit dem Zwischenergebnis, dass dieselben schwarz-rot-goldenen Kritiker ziemlich beeindruckt sind, wenn sie nicht gar große Gefahren vermelden, die aus seinen imperialistischen Aktivitäten für „unsere“, sprich die deutschen Pläne und Perspektiven erwachsen.
Die Verstärkung der französischen Kriegsmacht
Die Modernisierung der Streitkräfte in allen Waffengattungen wird vorangetrieben. Einen Schwerpunkt bildet die Erneuerung der Hochsee-Marine, welche für die Mittelmeermacht Frankreich und ihre Fähigkeit zur flexiblen „Machtprojektion“ – Interventionen in jeder Weltgegend – entscheidend ist.[8] Zugleich erteilt Präsident Sarkozy den Auftrag zu einer Generalrevision der militärischen Strategie und Bedarfsplanung; das entsprechende „Weißbuch“ liegt in Kürze vor. Es soll, man höre und staune nicht, zugleich als Vorlage für die Renovierung der EU-Sicherheitsstrategie und Rüstungsplanung dienen.
Darüber hinaus bemüht sich Frankreichs Präsident um die Intensivierung militärischer Kooperation mit Anrainern der strategisch bedeutenden Konfliktregionen Nordafrikas und des Nahen Ostens. In Abu Dhabi wird eine französische Militärbasis für alle Waffengattungen eröffnet, vor allem die Flotte erhält damit eine vorgeschobene Operationsbasis – zusätzlich zum französischen Hauptstützpunkt im Indischen Ozean, Djibouti. Der Stützpunkt liegt unmittelbar bei der Meerenge von Hormuz am Persischen Golf, d. h. im Zentrum der nahöstlichen Kriegsregion. Im Fall eines Krieges gegen den Iran ist Frankreichs Militär damit automatisch involviert – eine ‚geopolitische Tatsache‘, an welcher Frankreichs Regierung offenbar gelegen ist. Die Entscheidung markiert zugleich einen „‚Bruch‘ mit der bisherigen Praxis“, keine Militärstützpunkte außerhalb der postkolonialen Einflusszonen Frankreichs zu akquirieren. Sie demonstriert den Willen zur militärstrategischen Expansion und „ist ein Signal, das sich an alle richtet, dass Frankreich zur Stabilität in dieser Region beiträgt“ (Sarkozy, FAZ, 17.1.2008). Mit „allen“ sind nicht zuletzt die USA gemeint. Denen soll die Erzwingung der passenden Ordnung nicht überlassen werden. Abu Dhabi ist insofern auch ein Exempel für den Willen zu verschärfter Einmischung in Regionen, in denen der Terrorismus und – folglich – der amerikanische Antiterrorismus irgendwie am Werk sind:
Einmischung in die Kriegs- und Friedens-Fronten der Welt, um den strategischen Einfluss der Nation zu mehren
Die Regierung Sarkozy forciert den militärischen und politischen Einsatz Frankreichs.
In Afghanistan kommt sie der Forderung der US- und NATO-Führung ein Stück weit nach, nicht nur wie bisher die einigermaßen befriedete Hauptstadt Kabul zu sichern, sondern auch zur kriegerischen Vernichtung der Taliban beizutragen. Sie verlegt einige Mirage-Kampfbomber von Tadschikistan nach Afghanistan. Sie erklärt sich der Forderung gegenüber aufgeschlossen, auch Kampftruppen zu stellen, welche die amerikanisch-britisch-kanadische Südfront verstärken. Der Übergang zur aktiven Kriegführung steht für Entschlossenheit und den Anspruch, mehr Einfluss auf die politischen Entscheidungen vor Ort und in der Nato zu gewinnen.
Im Falle des Iran, wo die US-Regierung einen Regimewechsel erzwingen will, macht sich die französische Regierung selber dafür stark, die Sanktionen notfalls auch ohne UNO-Sicherheitsrats-Beschluss zu verschärfen und so den erpresserischen Druck auf Teheran zu erhöhen. Der neue Außenminister Kouchner, Sozialist und Ex-Mediziner ohne Grenzen, ergänzt die grobe amerikanische Kriegsdrohung um eine fein formulierte französische: Man müsse „die schreckliche Alternative zwischen einer iranischen (Atom-)Bombe und einer Bombardierung des Iran“ nach Kräften verhindern. Anschließend lässt die Regierung in Paris dementieren, dass sie mit Krieg droht: Wenn der Iran die Uran-Anreicherung aufgibt, wäre Frankreich zu umfassender Kooperation bereit! Wenn nicht, dann ist er selber schuld. So bestätigt sie, dass sie einem Staat wie dem Iran die Verfügung über die ‚dual-use‘-Technologie mit allen Mitteln bestreiten will. Und mit diesem ihrem eigenmächtig-nationalen Eskalationskurs konfrontiert sie die beiden anderen Mitglieder der EU-Troika, Großbritannien und Deutschland, das vor allem Russland und China in der Pressionsfront gegen Iran halten und auf die Weise eine Alternative zu einem amerikanischen Krieg fördern will. So wird die Führungskompetenz Frankreichs praktisch bewiesen.
Im Libanon startet Sarkozy eine politische Einmischungsoffensive. Diesem Staatswesen will Frankreich die Unabhängigkeit bescheren – von syrischer Einmischung. Dazu gibt die Regierung erst einmal dem Verdikt der USA recht, welches Syrien als Störenfried und Terroristenhelfer brandmarkt. Dann macht sie sich daran, dem Libanon eine geeignete Herrschaft zu schmieden, die seine Souveränität gewährleistet, lädt zu diesem Zweck alle politischen Parteien inklusive der radikalislamischen Hizbullah-Bewegung zu konstruktiven Verhandlungen ein. Die Parteien einigen sich tatsächlich auf einen General Suleiman als Kompromisskandidaten für das vakante Präsidentenamt, aber nicht auf die Bedingungen der künftigen Machtverteilung in Staat und Regierung (Verfassung, Regierungsbeteiligung und Vetorecht der prosyrischen Opposition etc.), weshalb der Kandidat ein ums andere Mal nicht gewählt wird. Das stört Herrn Kouchner, weil damit erstens das Weisungsrecht der „traditionellen“ Schutzmacht des Libanon, Frankreichs also, missachtet wird und weil damit zweitens die andere Schutzmacht, die USA nämlich (die weder den General noch eine Allparteienlösung mögen), zu konkurrierenden Interventionen animiert wird. Denn für die Bush-Regierung steht fest: Eine ordentliche und freiheitliche Staatsgewalt hat die „Hizbullah-Terroristen“ nicht etwa einzubauen, sondern endlich zu entmachten! Der Schuldige an der misslichen Lage steht für Frankreich fest: Es fordert den syrischen Präsidenten Assad ultimativ auf, endlich seine Einmischungspolitik zu beenden, will sagen: die Hizbullah dazu zu nötigen, den von Frankreich abgesegneten Präsidenten ohne Bedingungen zu wählen. Und weil Assad statt dessen auf die Autonomie der anti-israelischen schiitischen Opposition verweist, die schließlich eine Hälfte der Libanesen repräsentiert, suspendiert Frankreich bis auf Weiteres die diplomatischen Beziehungen zu diesem Staat. Verschärfung des Konfrontationskurses gegen ein eigenmächtiges, deshalb unbotmäßiges Regime und imperialistische Zuständigkeitskonkurrenz mit der Oberkontrollmacht Amerika fallen so abermals praktisch zusammen.
Auch in ferneren Weltgegenden, z. B. im Hinterhof der USA, schaltet sich der neue französische Präsident ein – und das ohne jedes Hilfeersuchen aus Washington. Er macht sich für die Freiheit einer prominenten Geisel der kolumbianischen Guerilla stark, die einen französischen Pass besitzt (die Politikerin Betancourt). Er rügt die Art Antiterrorismus, derer sich der Präsident und Ami-Freund von Bogotá befleißigt, und erteilt gegen dessen Willen dem Bösewicht von Venezuela, dem Präsidenten Chavez also, ein Mandat zu Verhandlungen mit den FARC-Rebellen über die Freilassung der bekannten Geiseln. Und für die Kritiker aus dem Weißen Haus, die sich solch eine Einmischung mit Hilfe des antiamerikanischen „Diktators“ verbitten, hat Sarkozy eine demokratische Abfuhr parat:
„Was ist das für ein ‚Diktator‘, der ein Referendum organisiert, das er verliert? Das ist doch eher ein gutes Zeichen!“ (Nouvel Observateur, 13.12. 07)
Der Wille zu politischer Omnipräsenz wird allenthalben diplomatisch aktiv. Dazu gehört, dass auch eine exklusive Einflusssphäre der Weltmacht Nr. 1 nicht von französischen Konkurrenzinitiativen verschont wird.
Die postkolonialen Besitzstände, welche die Grande Nation mittels der inzwischen unabhängigen „Partnerstaaten“ in Afrika unterhält, werden genutzt, um die Reichweite der französischen Macht auf dem Nachbarkontinent zu erweitern und sich Ordnungsmacht-Rechte bei der „Stabilisierung“ der wachsenden Anzahl von Konfliktregionen zu sichern. Der Tschad, Nachbarstaat des Sudan, einer weiteren Station des Ringens um die Unterordnung der lokalen Gewalten, ist ein solcher Vorposten, dessen Herrschaftsclique durch die militärische Dauerpräsenz französischer Truppen geschützt wird. Jetzt, wo die amerikanische Destabilisierung des falsch regierten Sudan und der – dadurch angeheizte – innere Machtkampf zwischen den verschiedenen Clans und Stämmen für die unvermeidliche „humanitäre Katastrophe“ gesorgt haben, die in Form von Flüchtlingswellen auch den Tschad erreicht, sieht die französische Regierung eine schöne Gelegenheit, eine neue Qualität von (Mit-)Kontrolle über die künftigen Machtverhältnisse in der Region zu erlangen. Gegen das „unmenschliche Regime“ in Khartum hat Frankreich schon deswegen eine abgrundtiefe Abneigung, weil es immer wieder oppositionelle Kräfte im Tschad unterstützt. Damit bedroht es unmittelbar die Interessen Frankreichs. Unter dem Titel „Schutz der Flüchtlinge“, die zu Hunderttausenden im Tschad zu überleben suchen, besorgt sich Frankreich – schon wieder ganz in nationaler Initiative – ein UN-Mandat und übernimmt die Verantwortung für die Aufstellung einer militärischen Truppe von gut 4000 Mann. Man weiß auch schon, wo man sie zu rekrutieren gedenkt. Die EU ist laut Sarkozy prädestiniert, den Auftrag zu exekutieren, also die Soldaten zu stellen, welche über die französische Kerntruppe hinaus benötigt werden. Er erinnert die europäischen Partner an ihren eigenen weltpolitischen Ehrgeiz und an die ‚Europäische Sicherheits- und Verteidigungs-Politik‘ (ESVP), die doch wohl ihre Glaubwürdigkeit beweisen müsse, und bekommt tatsächlich die förmliche Ermächtigung zu einem EU-Einsatz. Ein schönes Exempel dafür, wie sich Frankreich eine europäische Sicherheitspolitik vorstellt: als Instrument erweiterter Machtentfaltung unter der Führung Frankreichs eben. Als die designierten Truppensteller, vor allem Deutschland und England, die Entsendung ihrer Soldaten verweigern, weil sie nicht einsehen, warum sie als Handlanger „rein französischer“ Interessen fungieren sollen, besteht Sarkozy erst recht auf der Mission: Er sucht sich eine Koalition der Willigen und rekrutiert russische und ukrainische Kontingente mit den wüstentauglichen Helikoptern, die WIR in Deutschland angeblich nicht oder schon anderweitig verplant haben, und stockt sein eigenes Truppenkontingent auf. Der Einsatz der „EUFOR“-Truppe ist damit „im Prinzip“ gesichert. Er muss allerdings fürs Erste ausfallen, weil erst mal der neuerliche Machtkampf im Tschad gewonnen werden muss, „im Notfall“ auch durch den direkten Einsatz des französischen Militärs. In jedem Fall steht das Flüchtlingsdrama in Darfur und im Tschad inzwischen auch für die Anstrengungen Frankreichs, die EU militärisch in eine, nämlich seine imperialistische Ordnungspolitik in Afrika zu involvieren – zur Verteidigung der europäischen Ansprüche gegen das bedrohliche Vordringen der Amerikaner und Chinesen auf diesem „unserem“ Kontinent.
Frankreich setzt Fakten, um seine Macht in, über und mittels Europa zu vergrößern
Die Regierung Sarkozy leistet sich eine ganze Reihe von „Alleingängen“, die in den anderen Hauptstädten Europas missbilligt werden. Es handelt sich um lauter politische Initiativen, die auf eine Änderung der überkommenen Geschäftsordnung der Union zielen.
Ein Teil der Beschlüsse und Maßnahmen besteht dementsprechend (siehe Teil I.) hauptsächlich in der Weigerung, die geltenden Richtlinien und Vereinbarungen der EU anzuerkennen bzw. zu beachten. Sie werden faktisch ein Stück weit außer Kraft gesetzt.
- Sarkozy lädt sich zur Sitzung der EZB ein und erklärt ihren Auftrag für revisionsbedürftig. Er betreibt explizit und demonstrativ die ‚politische Einmischung‘, welche im Sinne der offiziellen „Unabhängigkeit“ der Notenbank unterbleiben soll. Er prangert deren Stabilitätsfetischismus als falschen Ökonomismus an und kündigt die praktische Untergrabung des Paktes zur Limitierung der Staatsverschuldung an.
- Der neue Präsident missachtet den Stabilitätspakt und die Vereinbarung der Euro-Minister, bis 2010 einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen, weil er das für kontraproduktiv hält. Nicht, dass er für freies Schuldenmachen ist, wohl aber dafür, dass die Schulden, die Frankreich macht, nützlich sind, also genehmigt sein müssen. Denn eines sollen sich alle Partner merken:
Denn wenn es Frankreich gut geht, kann ganz Europa davon profitieren.
(Rede vor dem EU-Parlament) Dieses Motto ist Frankreichs Programm! - Sarkozy stellt die einseitige Aufkündigung der vereinbarten Fischfangquoten in Aussicht und startet damit einen
Angriff auf eins der Schlüsselinstrumente der 1983 geschaffenen gemeinsamen Fischereipolitik
. Er stellt sich dabei demonstrativ und „demagogisch“ auf die Seite der „unzufriedenen Fischer“, die ihre zunehmende Verarmung „Europa“ anlasten und von ihrem Chef nationalen Schutz gegen die Schikanen aus Brüssel verlangen. (Les Echos, 24.1.2008) - Präsident Sarkozy be- oder verhindert nach Bedarf die forcierte ‚Freiheit des europäischen Kapitalverkehrs‘, also die unerwünschten Bestrebungen auswärtiger Konzerne, französische Firmen zu übernehmen; umgekehrt schafft oder stützt er ‚nationale Champions‘ im Rüstungs- und Energiebereich sowie in sonstigen Hochtechnologiesektoren, um die europäischen Konkurrenten auszubooten – ganz wie es ihm passt –, und in den einst politisch gestifteten, französisch-deutsch geführten europäischen Vorzeige-Multis will er die deutschen Partner loswerden oder eindeutig dominieren.[9] Und für all das beansprucht er auch noch Respekt, als Vorkämpfer gegen eine falsch verstandene Globalisierung nämlich.
Wenn sich Sarkozy betont negativ zu den ‚gewachsenen Strukturen‘ und Verfahren der EU stellt, so ist diese „rupture“ eine politische Waffe und auch so gemeint. Der „Bruch“ geht schließlich von einer der beiden Führungsmächte aus. Der Präsident will eine institutionelle Debatte über seine positive Vision von einem Europa erzwingen, das endlich mit dem politischen Zwergendasein Schluss macht.
- Um diese Absicht klarzustellen, setzt er einen „Rat der Weisen“ durch, der schnellstens Vorschläge zur „Identität“ und „Finalität“ der EU auf den Tisch legen soll. Als ersten und entscheidenden Schritt zur Gründung eines echt handlungsfähigen imperialistischen Blocks fordert er, die angestrebte politische Einheit – im buchstäblichen Sinne – räumlich zu definieren, d.h. Grenzen festzulegen.
- Sarkozy belässt es nicht bei einem Appell. Er tut etwas dafür, dass die richtige Abgrenzung auf den Weg kommt. Eine der ersten Maßnahmen seiner Regierung ist der tätige Einspruch gegen eine Mitgliedschaft der Türkei in der EU. Dass die längst eröffneten Verhandlungen laut gültiger Beschlusslage die Möglichkeit einer vollen Integration einschließen, den künftigen Status der Türkei also in der Schwebe halten, lässt er nicht gelten. Er will einen Schlussstrich. Er sorgt dafür, dass das auf der Tagesordnung stehende Kapitel ‚Wirtschafts- und Finanzpolitik‘ abgesetzt wird, da es nur für künftige Mitglieder relevant sei. Sarkozy widerruft damit faktisch das ursprüngliche Votum, die Türkei wegen ihrer strategischen Bedeutung einzugemeinden, setzt stattdessen darauf, die Funktionalisierung dieses Landes durch eine „privilegierte Partnerschaft“ zu erreichen. Er gibt so seinem Vorhaben, die EU zu einer imperialistisch schlagkräftigen politischen Einheit zu formieren, oberste Priorität bei der Entscheidung über die Behandlung der Türkei. Die funktionale Ein- und Unterordnung dieses Staates ist in seinen Augen nämlich nicht zu haben; ein mit allen Rechten ausgestattetes Mitglied Türkei würde vielmehr die überkommene wie erst recht die vorgesehene Machthierarchie durcheinanderbringen und so den geplanten Neuaufbau der EU zum Scheitern verurteilen. Und das nicht wegen einer unpassenden kulturellen und religiösen Identität der Menschen jenseits des Bosporus, sondern deswegen, weil der türkische Staat nicht nur ein ehrgeiziges und eigenwilliges nationales Aufstiegsprogramm – mittels der EU, und notfalls ohne sie – verfolgt, sondern mit seinem 80 Millionen-Volk und seiner riesigen Armee auch über eine solide Grundlage für seine Ambitionen gebietet.
Sarkozy fordert nicht nur die Festlegung einer hoheitlichen Grenze der EU im Osten, um Europa fit zu machen für die schweren imperialistischen Bewährungsproben, die er ausgemacht hat. Er verordnet ihr gleichzeitig – auf der festen Grundlage einer „finalen“ politischen Identität eben – ein Ausgreifen nach Süden. Das Großprojekt, das er auf die Tagesordnung setzt, zielt auf nicht weniger als die politische Subsumtion Afrikas unter die Europäische Union. Als ob er den amerikanischen Doppelkontinent als Vorbild vor Augen hätte, gemeindet er ideell schon mal den afrikanischen Kontinent samt Orient in eine europäische Hemisphäre ein – als Vorgarten oder Hinterhof nämlich, auf dass künftig „Europa und Afrika gemeinsam das Schicksal der Welt bestimmen“.[10] Und wieder schreitet er sogleich zur Tat: Mit dem Projekt einer Mittelmeer-Union
, inzwischen EU-freundlich umgetauft in „Union für das Mittelmeer“, will Frankreich den Anfang des großen geschichtlichen Auftrags markieren.
Kaum im Amt, verkündet Sarkozy die Absicht, eine möglichst exklusiv französisch dominierte Einflusssphäre zu schaffen, die sämtliche Anrainer-Staaten des Mittelmeers – die südlichen EU-Länder und die Staaten an Afrikas Nordküste bis zu Israel und der Türkei im Vorderen Orient – umfasst.[11] Die politische Organisierung des mediterranen Raumes soll zugleich eine Etappe und ein Mittel zur imperialistischen Erschließung ganz Afrikas und für den Aufstieg der EU zur Weltmacht sein. Neben der EU und stellvertretend für sie nimmt sich der Franzose die Aufgabe vor, bei der die EU versagt hat. „Der Barcelona-Prozess ist gescheitert“, der die Staaten des „mare-nostrum-Bogens“ zur strategischen Peripherie der Union machen sollte – Grund und Berechtigung genug, die Sache in die eigene, kompetentere Hand zu legen. Dem Präsidenten ist klar, um welch brisanten, von innen und außen umkämpften „Raum“ es sich handelt, dessen miteinander verfeindete Herrschaften er allesamt auf die Grande Nation und ihr Europaprogramm ausrichten und auf die Art befrieden und entwickeln will. Hier sind alle großen „drei Herausforderungen“ höchst präsent, denen Frankreich sich stellen will. Es handelt sich erstens um eine Region, die massenhaft Terroristen beherbergt und hervorbringt, zweitens um eine Region, die wegen ihrer Energieressourcen hart umkämpft ist, und drittens um einen Schauplatz der neu eröffneten imperialistischen Konkurrenz um die ‚Aufteilung der Welt‘, auf dem sich nicht nur die Oberkontrollmacht USA, sondern inzwischen auch schon die neuen Rivalen von China über Indien bis Brasilien tummeln. Genau wegen dieser dreifachen Brisanz sieht Frankreich sich gezwungen, den politischen Besitzanspruch Europas auf sein nahes südliches Ausland zu bekräftigen und in die Offensive zu gehen.
Aktiv, wie er ist, geht Sarkozy sofort auf die Reise und empfängt zwischendurch noch Libyens Oberst Gaddafi, um die designierten „key allies“ von Algerien bis Saudi-Arabien mit seinem Antrag zu konfrontieren. Die Hebel und Mittel der Anbahnung strategischer Kooperationsbeziehungen sind immer dieselben: Sarkozy nimmt direkt Bezug auf die elementaren Bedürfnisse der Herrschaften, ihren Nationen die Bedingungen staatlicher Selbstbehauptung zu verschaffen, also militärische Gewaltmittel und die politisch-ökonomischen Voraussetzungen einer nationalen Akkumulation kapitalistischen Reichtums. Er bietet die technologischen Potenzen, zu denen es ‚seine‘ kapitalistischen „Champions“ in den „strategischen Sektoren“ gebracht haben, zum käuflichen Erwerb an, vornehmlich Atomkraftwerke, moderne Infrastruktur von Meerhäfen über Flughäfen, Eisenbahnlinien bis zu Autobahnen, die Vernetzung mit Telekommunikationssystemen und nicht zuletzt attraktive Waffensysteme für den Land-, Luft- und Seekrieg. Dabei setzt er sich offensiv über die Schranken hinweg, welche die amerikanische Weltmacht und die Freunde aus der EU beim Export von Waffen und nuklearen ‚dual use‘-Gütern – zumindest in Hinsicht auf so definierte ‚Problemstaaten‘ – gezogen haben wollen.[12] Speziell die neuesten Schlager der französischen Nuklearindustrie, die Druckwasserreaktoren EPR, treffen nicht nur bei Staaten ohne eigene Öl- und Gasvorkommen auf großes Interesse, sondern auch und gerade bei den ‚reichen Ölstaaten‘. Denn diese wollen ihre Zahlungskraft, die sie den Öleinnahmen verdanken, nutzen, um sich aus der puren Abhängigkeit von auswärtiger Nachfrage nach ihren fossilen Rohstoffen zu befreien, und halten die ihnen aufgenötigte Enthaltsamkeit in Sachen Atomwaffen sicher nicht für einen erstrebenswerten Dauerzustand. Wie die Liste der Vertragsabschlüsse und -optionen zeigt, die in den Zeitungen nachzulesen war, kommen einige „strategische Geschäfte“ in Gang, mit denen Sarkozy Frankreich in die Rolle eines, wenn nicht des entscheidenden Ausstatters der arabisch-muslimischen Mittelmeer-Nationen hineinmanövrieren will. Es sollen, wie es gute imperialistische Sitte ist, substanzielle Abhängigkeiten der betreffenden Nationen installiert werden. Denn die lassen sich ausschlachten, um auf die innere Staatsräson sowie den äußeren Machtgebrauch des „Partnerstaats“ einzuwirken – also ein Stück der angestrebten politischen Vorherrschaft zu realisieren.
Mit dieser Mittelmeer-Politik stellt der französische Präsident die EU auf jeden Fall vor ein paar vollendete Tatsachen. Und er bringt das innere Gefüge der Union abermals durcheinander. Um seinem Projekt Mittelmeer-Union eine Erfolgsperspektive zu verleihen, macht sich der französische Präsident parallel zu seinen bilateralen Vorstößen in Nordafrika auf, die designierten Südstaaten der EU als Bündnispartner zu gewinnen. Spanien und Italien werden mit dem zutreffenden Hinweis, dass sie ja selbst Vormachtsambitionen im Mittelmeer-Raum verfolgen, zur privilegierten Mitarbeit aufgefordert. Damit beide Länder nach anfänglichen Bedenken zustimmen, wertet er sie zu gleichberechtigten Partnern auf, die er künftig auf seine Afrikareisen mitzunehmen gedenkt.[13] So sortiert er die EU neu, spaltet sie in zuständige und weniger zuständige Staaten, was die Neuordnung der Mittelmeerpolitik betrifft. Einfach ausgrenzen will er die Rest-EU nicht, wie er auf deutsche Spaltungsvorwürfe hin beteuert. Er beruft vielmehr einen ersten Gipfel der Mittelmeer-Union (G-MED) für den Vortag der EU-Ratssitzung im Juli ein, auf dass die abservierte Gesamt-EU das Projekt anschließend feierlich absegnet und ihm künftig konstruktiv assistiert. Im Gegenzug darf sich die EU-Kommission künftig zu den Sitzungen des G-MED einladen lassen.[14]
Ein Angebot zur Vollmitgliedschaft in der NATO – unter der Bedingung, dass eine reformierte Allianz den Euro-Militarismus voranbringt
Parallel zu seinen Bemühungen, sich und Europa neue militärische Optionen zu verschafften, bietet Frankreich den USA die volle Rückkehr in die integrierte Militärstruktur der NATO und – damit – das Fallenlassen der bisher gepflegten politischen Vorbehalte gegen dieses Kriegsbündnis an. Zugleich reicht es Vorschläge beim NATO-Rat ein. Unter dem technisch klingenden Titel, wie „die Transparenz und Kooperation zwischen EU und NATO verstärkt“ werden soll, wird nicht weniger beantragt als die Anerkennung der (bislang rudimentären) autonomen sicherheitspolitischen Gremien als Institutionen, die mit der Nato gleichberechtigt sind. Das Junktim zwischen Angebot und Forderung ist der Witz der Sache. Frankreich will so die überkommene „Struktur“ der Nato aufbrechen, eine Grundsatzdebatte über die Nato erzwingen [15] und die Machtverhältnisse in ihr nachhaltig verändern. Die dialektische Offerte besagt, dass Frankreich bereit ist, ‚mehr Verantwortung‘ – so heißt der angestrebte politische Statuszuwachs auf diplomatisch – im Bündnis zu übernehmen, falls bzw. genauer gesagt: damit die USA endlich akzeptieren, dass die EU sich zum verteidigungspolitischen Garanten der eigenen Interessen macht und die Europäer vom abhängigen Juniorpartner zum mitentscheidenden Subjekt in der Nato avancieren. Denn der explizite Ausgangspunkt des beabsichtigten „Deals“ besteht in der Diagnose, dass das Projekt einer eigenständigen EU-Militärpolitik so lange nicht wirklich vorankommt, wie die USA ihm die Lizenz verweigern und die Spaltung der Union in Pro- und Antiamerikaner betreiben.[16] Umgekehrt soll die Entkräftung des amerikanischen Verdachts, die EU plane ein imperialistisches Konkurrenzunternehmen als Alternative zur Nato, einen neuen Anstoß zu einer realistischen europäischen Emanzipationsperspektive stiften. Gleichsam als Test auf den guten, d.h. entgegenkommenden Willen der USA werden hohe Nato-Kommandofunktionen für französische Generäle gefordert, wie sie „der militärischen Bedeutung Frankreichs entsprechen“ – als Unterpfand der angestrebten Europäisierung der NATO. Und wenn die beanspruchten französischen Führungsposten auf Kosten der britischen und deutschen gehen, ist das auch kein Problem, jedenfalls nicht für Frankreich. Das setzt schließlich die einzig richtige Linie für eine NATO-Reform durch, indem es sich an die Spitze des europäischen Pfeilers setzt.[17]
Durch den Export mächtiger kapitalistischer Produktivkräfte mächtige Bündnisoptionen mit aufstrebenden Großmachtkonkurrenten erschließen
Der französische Präsident reist zu den großen Rivalen, so auch in die VR China. Er versucht, die aktuelle Gunst der Konkurrenzlage zu nutzen: Nachdem kurz zuvor Kanzlerin Merkel und Völkerfreund Bush den Dalai-Lama empfangen und so die chinesischen Politiker verärgert haben, stellt sich Sarkozy zwar ebenfalls als Anwalt der Menschenrechte vor, der „Verbesserungen“ anmahnt, aber vor allem als Freund Chinas. Er betont die Anerkennung der territorialen Einheit der Volksrepublik, indem er erklärt, dass Taiwan und Tibet Bestandteile Chinas sind. Er tut das in der Pose und mit dem selbstverständlichen Recht eines führenden Weltordners, dem die Zuweisung der legitimen Rechte an fremde Nationen ebenso obliegt wie die Zuteilung von Mitteln, die ihnen zustehen.
Er hat Angebote im Reisegepäck, die sich sehen lassen können, und es kommt zu einem „eindrucksvollen Wirtschaftsabkommen in Höhe von 20 Milliarden Euro“:
„China kauft 160 Airbusse (12 Mrd.) sowie zwei französische Atomkraftwerke (8 Mrd.). In dem bisher größten Geschäft der französischen Nuklearindustrie vereinbarte der Staatskonzern Areva außer der Lieferung der Reaktoren und des dafür nötigen Kernbrennstoffs eine umfangreiche Kooperation beim massiven Ausbau der Kernenergie in China. Die Volksrepublik will wegen ihres rasant steigenden Energiebedarfs etwa zwei Dutzend Atommeiler bis 2020 bauen.“
Über die Lieferung einer kompletten nuklearen Wiederaufbereitungsanlage werde außerdem verhandelt, jedenfalls sei damit zwischen Frankreich und China eine neue Ära einer beständigen Atomenergiepartnerschaft ... vereinbart.
(Spiegel Online, 31.10.2007)
Das ist es, worauf es dem französischen Präsidenten ankommt. Er nutzt auch hier die ökonomische Macht, zu der es das französische Kapital auf dem Felde der technologischen Produktivkräfte – vor allem in der Sphäre der nuklearen Energieerzeugung – gebracht hat, um daraus einen Hebel für die Erringung eines Stücks politischer Macht über eine Staatsgewalt zu machen, die auf Weltmacht programmiert ist. Deren nationale Reichtumsakkumulation soll nach dem Willen der chinesischen Staatsführung weiter voranschreiten, wofür mehr und neue Wachstumsquellen und -bedingungen unabdingbar sind. Sarkozy sieht diesen Bedarf und legt es darauf an, einen möglichst großen Anteil davon, vor allem den Energiebedarf, für französisches Geschäft in Beschlag zu nehmen – selbstverständlich auf Kosten anderer kapitalistischer Erfolgsnationen, die dasselbe wollen. Denn aus solchen Geschäften erwachsen strategische Hebel. Die Verfügung über sichere und billige Energie ist schließlich – weil Basis allen nationalen Wachstums – eine Existenzfrage für die Nation. Die Abhängigkeit Chinas von dieser Verfügung verschafft deshalb dem Lieferstaat Hebel zu politischer Erpressung und außerdem den französischen Exporteuren eine Ausweitung der Geschäfte, wodurch sich wiederum die ökonomische Macht der französischen Nation vermehrt. Das ist die Art von „Globalisierung“, die Sarkozy gefällt. Sich im Gegensatz zu Anderen zum Garanten solcher Mittel in fremder Staatshand zu machen, ist (s)eine bevorzugte Waffe im Kampf um die Verteilung der Macht über die Staatenwelt – und direkt unterhalb des Exports der wirklichen, der militärischen Waffen angesiedelt. Kein Wunder deshalb, wenn einem französischen Reporter in Peking gleich die Frage einfällt, wie es denn mit der Lieferung von Kriegsmitteln an die VR China steht, zumal Frankreich ja in der Tat das gültige Waffenembargo aufheben will. Die Antwort des Außenministers ist ebenso bezeichnend:
„Ich halte die Frage des Waffenembargos nicht für ausschlaggebend für unsere bilateralen Beziehungen; das wird sich zu gegebenem Zeitpunkt klären; es gibt eine europäische Position, der wir folgen werden. Man muss nicht Waffen verkaufen, um Freunde zu haben, man muss nicht zwangsläufig Freunde haben, weil man ihnen Waffen verkauft.“ (Kouchner, 31.10.07 bei der Pressekonferenz)
Sarkozy und Kouchner sorgen also einstweilen für den Verkauf von AKWs und von Hightech-Infrastruktur (Airbusse, Hochgeschwindigkeitszüge, Telekommunikationsnetze), für die ungefähr das Gleiche gilt wie für die Mittel nationaler Energiesicherheit.
Das „Wirtschaftsabkommen“, das eben eine Staatskooperation auf strategischem Niveau darstellt, offenbart zugleich den Vorteil dieser Sorte Partnerschaft: Sie eröffnet Bündnisoptionen gegen Dritte, wobei die Stoßrichtung gegen die Weltordnungsmacht besonders beliebt ist. Die antiamerikanische Dimension der französisch-chinesischen Kooperationsperspektive wird gleich praktisch: Frankreich und die VR China werden sich einig in einem Stück demonstrativer Absage an die bisherigen Privilegien des amerikanischen Weltgeldes. Sie „holen überraschend zum Schlag gegen den Dollar aus“, vermeldet die hiesige Presse: Der Kontrakt über den 12 Mrd. Euro-Deal lautet erstmals in Euro, statt wie üblich in der US-Währung.[18]
Was in Bezug auf die VR China einstweilen noch am Waffenembargo scheitert, soll im Verhältnis zu einem anderen ambitionierten „Schwellenland“, Brasilien, wahrgemacht werden. Frankreich will sich in die Rolle des militärischen Hauptausstatters dieser südamerikanischen Großnation hineinbefördern. Die will sich unter der Parole, ein „neues brasilianisches Entwicklungsmodell“ umzusetzen, endgültig zu einem potenten kapitalistischen Standort mit einer eigenen High-Tech–Rüstungsproduktion emanzipieren. Bei einem Gipfeltreffen mit Präsident Lula erklärt sich Sarkozy bereit, diesem Bedürfnis entgegenzukommen, um das seinige – zu Lasten der konkurrierenden Waffenexportnationen – voranzubringen: Spitzenerzeugnisse französischer Rüstungstechnologie, nämlich Kampfflugzeuge, U-Boote und Helikopter, dürfen künftig in Brasilien produziert werden.[19] So will sich Frankreich eine strategische Position im Zentrum Südamerikas verschaffen und dafür sorgen, dass die nationalen Aufbruchtendenzen von Latino-Staaten, die sich gegen die nordamerikanische Vorherrschaft richten, mit einem wachsenden Einfluss des europäischen Imperialismus auf diesem Kontinent einhergehen. So etwas heißt diplomatisch „Zusammenarbeit im Dienste des Friedens“ (Sarkozy, 14.2.2008), damit es die Amerikaner nicht missverstehen!
Wenn es um den Auf- und Ausbau von strategischen Positionen im Verhältnis zu den „Riesen der Zukunft“ geht, darf Indien selbstverständlich nicht fehlen. Präsident Sarkozy stellt sich in Neu-Delhi vor, um den Waffenexport anzukurbeln und den gigantischen AKW-Markt für (den Nuklearkonzern) Areva
zu erschließen. Das indische Interesse, die Versorgung mit Nukleartechnologie und Brennstoff nicht vom politischen Kalkül der USA abhängig zu machen, will Frankreich sich zunutze machen. Die Politiker stellen die Weichen und das Nuklearkapital steht in den Startlöchern. Die auf französischer und indischer Seite beteiligten Firmen unterschreiben eine gemeinsame Erklärung, die die Form der zivilnuklearen Kooperation zwischen den beiden Ländern ab dem Tag definiert, an dem Indien dieser Handel von der internationalen Gemeinschaft gestattet wird.
(Les Echos, 28.1.2008) Für diese Erlaubnis weiß sich die Atommacht Frankreich mit zuständig. Deren Präsident betont deshalb – gerade angesichts der ‚unilateralen‘ Billigung der indischen Atomrüstung durch die USA – die Notwendigkeit, dass die „Nuclear Suppliers Group“ die Aufwertung Indiens zu einem legitimen Atomstaat förmlich zu beschließen hat, und kündigt großzügig an, dass die französische Regierung schon für ein positives Votum sorgen wird.
*
Mit seinem persönlichen wie politischen „Hyperaktivismus“ exerziert der neue französische Präsident aller Welt vor, dass Frankreich mit seiner passiven – also leidenden – Rolle beim Ringen um die imperialistische Machtverteilung in der Staatenwelt Schluss machen will. Seine Aktionen und Entscheidungen stellen klar, wie die Parole „Frankreich ist der Freund von jedermann“ gemeint ist: Seine Politik der globalen Zivilisierung setzt sich über die Sortierung in Gut und Böse hinweg, welche die Supermacht USA mit ihrer Antiterrormission verbindlich machen will; sie sucht sich die Mittel und Bündnispartner selber, die dem Machtzuwachs Frankreichs dienen. Die Anstrengung, sich als nationale Avantgarde der Europäischen Union zu beweisen und die politische ‚Idee von Europa‘ zu retten, also die Berufung Europas zu einer Weltmacht unter der Führung Frankreichs endlich wahr zu machen, gerät unvermeidlich zum Angriff auf das ‚selbstzufriedene‘ europäische Gefüge, dessen Fortschritte dem Mechanismus des kleinsten gemeinsamen Nenners folgen. Und dieser Angriff ist beabsichtigt. Die diplomatischen Erklärungen und laufenden ‚Alleingänge‘ des französischen Präsidenten sind deshalb zugleich eine programmatische Kampfansage für das zweite Halbjahr 2008, in welchem der oberste Franzose zugleich Ratspräsident der EU ist. Nicolas Sarkozy steht für den politischen Willen zu einem schlagkräftigen Euro-Imperialismus und fordert die Unterordnung unter dieses Ziel; und er will eine Antwort erzwingen, so oder so.
[1] Am bekanntesten sind das Komitee für Überlegungen und Vorschläge zur Modernisierung und Neugewichtung der Institutionen der Fünften Republik
, die sog. Balladur-Kommission
; die Kommission für die Befreiung des französischen Wachstums
unter Jacques Attali; Dominique Perbens Die Stadt von morgen denken
; die Kommission für die Entwicklung der Lehrerberufe
unter Marcel Pochard sowie das Dauerkomitee für die Generalüberprüfung des öffentlichen Dienstes
unter Éric Woerth.
[2] Während das Woerth-Komitee 96 Maßnahmen, um den Staat effektiver zu machen,
(Le Monde, 15.12.07) vorschlägt, stellt die Attali-Kommission 314 Maßnahmen zur Beförderung der Liberalisierung
vor. (Le Monde, 20.1.08)
[3] So habe die Vorgängerregierung das NEIN der Franzosen zum „EU-Verfassungsvertrag“ glatt als Niederlage empfunden und zum Anlass genommen, sich aus der europäischen Führungsrolle zurückzuziehen, statt wahrzunehmen, dass das Referendumsvotum des unzufriedenen Volkes auf ein stärkeres Europa zielte und nicht auf ein schwächeres.
[4] Für die Reform des UNO-Sicherheitsrats, die er durchsetzen will, nominiert Sarkozy schon mal fünf neue ständige Mitglieder; ebenso für die G 13, welche die G 8 ablösen müsse. (Botschafterrede)
[5] „Ich möchte, dass die Europäer ihrer Verantwortung und ihrer Rolle im Dienst ihrer eigenen Sicherheit und der der Welt voll gerecht werden. Dazu müssen wir zuallererst unsere Kapazitäten für die Planung und Durchführung der Einsätze verstärken; wir müssen das Europa der Rüstung mit neuen Programmen weiterentwickeln und die bestehenden rationalisieren; wir müssen für die Interoperabilität unserer Streitkräfte sorgen; und ein jeder in Europa muss seinen Teil zur gemeinsamen Sicherheit beitragen. Über diese Instrumente hinaus brauchen wir jedoch auch eine gemeinsame Sicht der uns drohenden Gefahren und der Mittel, um ihnen zu begegnen: Wir müssen zusammen eine neue Europäische Sicherheitsstrategie
entwickeln, die diejenige fortführt, die 2003 unter der Ägide von Javier Solana beschlossen wurde. Wir könnten diesen neuen Text 2008 unter der französischen Ratspräsidentschaft verabschieden.“ (Botschafterrede)
[6] Den Kapitalisten schreibt Sarkozy ins Stammbuch: Europa hat sich für die Marktwirtschaft und für den Kapitalismus entschieden.
Und zwar deshalb, weil die Politiker Europas auf seine nützlichen Dienste setzen und nicht etwa wegen eines Naturrechts auf private Bereicherung – weshalb das ABER auf dem Fuße folgt: „Aber diese Entscheidung bedeutet nicht, alles und jeden gewähren zu lassen; beinhaltet nicht Entgleisungen des Finanzkapitalismus, der eher den Spekulanten und Privatiers Einnahmen beschert als den Unternehmen und Arbeiternehmern.
Der europäische Kapitalismus war immer ein Unternehmerkapitalismus, eher ein Produktionskapitalismus denn ein Spekulations- oder Vermögenskapitalismus.
Ja, Europa fällt bei der notwendigen Moralisierung des Finanzkapitalismus eine Rolle zu. Und was bei der Subprime-Krise vorgefallen ist, kann Europa nicht hinnehmen.“ (Rede vor dem EU-Parlament)
Dies die aktuelle französische Neuauflage jener sattsam bekannten politischen Klage, die einen erheblichen Unterschied zwischen dem guten schaffenden und dem bösen raffenden Kapital behauptet. Sie kommt wie immer dann auf, wenn das ansonsten durchaus geschätzte Geschäftsgebaren der Finanzkapitalisten die eigene Nation in Nöte bringt.
[7] Sarkozy plant außerdem einen neuerlichen diplomatischen Versuch, die zweite große europäische Atommacht, Großbritannien, für den forcierten Aufbau einer eigenständigen EU-Verteidigungsorganisation zu gewinnen – wohl wissend, dass dies eine Abkehr von der ‚special relationship‘ mit den USA und damit einen völligen Kurswechsel Englands bedeuten würde. Dass der Irak-Krieg die britisch-amerikanischen Sonderbeziehungen ziemlich strapaziert hat, wird als günstige Bedingung betrachtet. Es wird erwogen, die Briten zu einem anglo-französischen Verteidigungsgipfel einzuladen. Der soll unter dem Namen Saint-Malo II
laufen – in Anspielung auf das Gipfeltreffen zwischen Frankreich und England, auf dem 1998 erste Ansätze einer ‚Europäischen Sicherheits- und Verteidigungs-Politik‘ beschlossen wurden. Statt diese weiterhin zu „blockieren“, sollen die Briten einsteigen und das Projekt voranbringen: durch eine Verstärkung der Planungs- und Kommandokapazitäten der Europäischen Union, indem das EU-Operationszentrum zu einer dauerhaften Einrichtung gemacht wird, und durch die Entwicklung der militärischen Kapazitäten Europas und des Europas der Rüstung.
(Le Monde, 13.9.07)
[8] Zwei neue Fregattentypen mit Tarnkappentechnik werden „in beeindruckendem Tempo“ produziert, eine zur Luftraumsicherung, prädestiniert zum Begleitschutz des generalüberholten Flugzeugträgers, die andere als Mehrzweck-Kampfschiff für Attacken auf U-Boote und Landziele. (Vgl. Neue Zürcher Zeitung, 3.1.2008)
[9] So soll die französische Atomfirma Areva NP den 34-Prozent-Anteil des Münchner Siemens-Konzerns selbst übernehmen.
(SZ, 10.9.07), und Airbus/EADS zugunsten von mehr französischer Kapital- und damit Kontrollmacht saniert werden. Vgl. GegenStandpunkt 2-07: Krise bei Airbus.
[10] Das bescheidene Motto: Heute gehört uns Europa, morgen die ganze Welt:
„Über das Mittelmeer wird Europa seiner Stimme wieder Gehör verschaffen. (...)
Über das Mittelmeer werden Europa und Afrika gemeinsam das Schicksal der Welt und den Kurs der Globalisierung bestimmen.
Über das Mittelmeer werden Europa und Afrika dem Orient die Hand reichen.
Denn, wenn die Zukunft Europas im Süden liegt, dann liegt die Zukunft Afrikas im Norden.
Ich rufe alle, die dazu imstande sind, auf, sich für das Projekt Mittelmeerunion zu engagieren, denn sie wird die Grundlage Eurafrikas sein, dieses großen Traums, der die Welt verändern kann ...
Ich weiß, dass alle Völker des Mittelmeerraums es im Grunde wollen.“ (Sarkozy in Marokko, Regierungsdokument, 25.10.2007)
[11] Im Rahmen der Mittelmeerunion fände die Türkei demnach durchaus ihren – sogar privilegierten – Platz, auch ohne ihr dafür EU-Mitgliedsrechte einräumen zu müssen, die sie ‚missbrauchen‘ könnte.
[12] Ein Beispiel: Kurz nachdem die USA den Staat Qatar davon abgebracht haben, eine zivile Nuklearanlage anzustreben, verspricht Sarkozy den benachbarten Vereinigten Arabischen Emiraten die Lieferung zweier AKWs. Das Recht, sich über die Status- und Mittelzuweisungen der Weltmacht USA hinwegzusetzen, hat er schon vorher als wichtiges Element (s)einer zivilisatorischen Weltpolitik, d.h. als friedensfördernde Unterstützung gemäßigter islamischer Staaten gegen einen Aufschwung des Extremismus propagiert:
Einer Konfrontation zwischen dem Islam und dem Westen vorbeugen heißt ferner, wie Frankreich es vorschlägt, den muslimischen Ländern zu helfen, Zugang zur Energie der Zukunft zu erhalten: Atomstrom, unter Beachtung der Verträge und in voller Kooperation mit den Ländern, die diese Technologie bereits beherrschen.
(Botschafterrede)
[13] „Die spanische Regierung hat gestern dem Mittelmeerunions-Projekt, das Nicolas Sarkozy lieb und teuer ist, dem sie aber am Anfang sehr reserviert gegenüberstand, ihre eindeutige Unterstützung zugesagt. Es wurde beschlossen, dass der französische und spanische Außenminister, ja sogar der französische Präsident und der Präsident der spanischen Regierung, gemeinsam die Länder an den Ufern des Mare Nostrum
bereisen, um dieses große Projekt vor dem Gipfeltreffen von Paris am 13. Juli, das ihm gewidmet ist, ‚voranzubringen‘.“ (Les Echos, 11.1.2008)
[14] Von den Ländern, die die Abkommen von Barcelona unterzeichnet haben – das sind die 27 EU-Länder plus die 10 Südstaaten – sollen in der ersten Phase nur die an das Mittelmeer angrenzenden Länder zugelassen werden; das sind 8 Länder im Norden + die 10 Südstaaten. Der Status der Mittelmeerunion soll der einer aktiven zwischenstaatlichen Kooperation im Hinblick auf Wirtschafts- Umwelt-, Bevölkerungs- und Sicherheitsprojekte sein. Es geht um konkrete Gemeinsamkeiten, wobei die institutionellen Fragen auf später verschoben werden, so wie die Väter Europas ja auch vorgegangen sind, die 1951 mit der Gründung der Europäischen Gemeinschaft von Kohle und Stahl (EGKS) begonnen haben ... Die Kommission könnte rechtmäßig einen Sitz beanspruchen und Partner sein. Die Mittelmeerunion sollte mit einem G-Med (Gipfeltreffen der Staatschefs) und einer Finanzinstitution ausgestattet werden...
(Les Echos, 7.12.2007)
[15] Hinsichtlich der künftigen NATO-Strategie fordert Sarkozy, die Allianz sollte sich wieder hauptsächlich auf den militärischen Grundauftrag der gemeinsamen, vor allem eben europäischen Sicherheit besinnen; sie solle nicht – durch fortdauernde Erweiterung – zu einer bündnis-politischen (amerikanisch geleiteten) Ersatz-UNO werden und dürfe erst recht nicht zu einem Werkzeugkasten für amerikanische Interventionen in der weiten Welt verkommen: Eine ‚globale‘ Nato würde zu einer politischen Organisation, de facto zu einer Kopie der UNO.
Und „Frankreich stellt den Nutzen der Nato-Response-Force (die von den USA als weltweit einsetzbare ‚Türöffner‘-Elitetruppe beantragt und zumindest teilweise auf die Beine gestellt wurde) in Frage, die die von Washington gewollte ‚Umgestaltung des Bündnisses‘ repräsentiert.“ (Eine „offizielle Quelle“, laut Le Monde, 13.9.2008)
[16] Der französische Chef der EU-Militärkommission Bentegeat präsentiert dieses Kalkül positiv: Ich denke, wenn Frankreich seine Beziehungen zur Nato normalisiert, dann werden die europäischen Verteidigungsprojekte leichter vorankommen‘ , sagte er. ‚Bei der gegenwärtigen Situation mit einem Fuß drin, einem Fuß draußen gibt es immer einen Verdacht, dass Frankreich eine versteckte Agenda verfolgt. Wenn Frankreich einen Platz auf demselben Level einnimmt wie die anderen, werden einige Bedenken und Vorurteile entkräftet sein.
(UPI, 27.9.2007)
[17] Ob sich Frankreich tatsächlich entschließt, die Unterminierung der bestehenden NATO-Hierarchie, sprich der amerikanischen Suprematie von innen heraus voranzutreiben, soll von den Konditionen abhängen, die man in Washington erreicht. Die Ambivalenz einer solchen Strategie-Wende ist der Regierung klar, der Haken wird sogar offen ausgesprochen – dass die Wende nicht zu mehr Autonomie, sondern eher zur Anpassung führen kann. Außenminister Morin weist darauf hin, „dass die Rückkehr in die Nato-Struktur ‚Risiken‘ mit sich bringt. Wir können immerzu befürchten, dass wir uns dann im Laufe der Zeit für unsere Verteidigung auf die Nato verlassen würden, wie es gewisse europäische Nachbarn von uns machen. (Wer damit wohl gemeint ist?!) Das Risiko besteht also in einer geringeren Souveränität. Der Nachteil, erklärte Morin, ist vielleicht eine Abschwächung unserer internationalen Position, die vielleicht auf Linie gebracht erschiene.“ (Le Monde, 13.9.2007)
[18] Solche Dokumente der strategischen Partnerschaft hindern Frankreich andererseits natürlich nicht daran, im Bunde mit der amerikanischen Weltmacht und im Rahmen der internationalen Institutionen den Druck auf China und andere ‚Schwellenländer‘ zu erhöhen, damit sie mit dem „Lohn-, Preis- und Währungsdumping“, den „Verstößen gegen das Patentrecht auf geistiges Eigentum“ etc. aufhören, sich also an die „Regeln“ halten, die wir ihnen diktieren.
[19] ‚Ich habe Präsident Lula gesagt, dass wir dazu bereit sind, dass eines unserer Scorpène-U-Boote in Brasilien hergestellt wird,‘ erklärte Sarkozy. ‚Wir sind dazu bereit, Technologietransfers zu organisieren, damit Helikopter und Kampfflugzeuge – ich denke da vor allem an die Rafale – in Brasilien gefertigt werden können,‘ sagte er weiter.
(Le Monde, 14.02.2008)