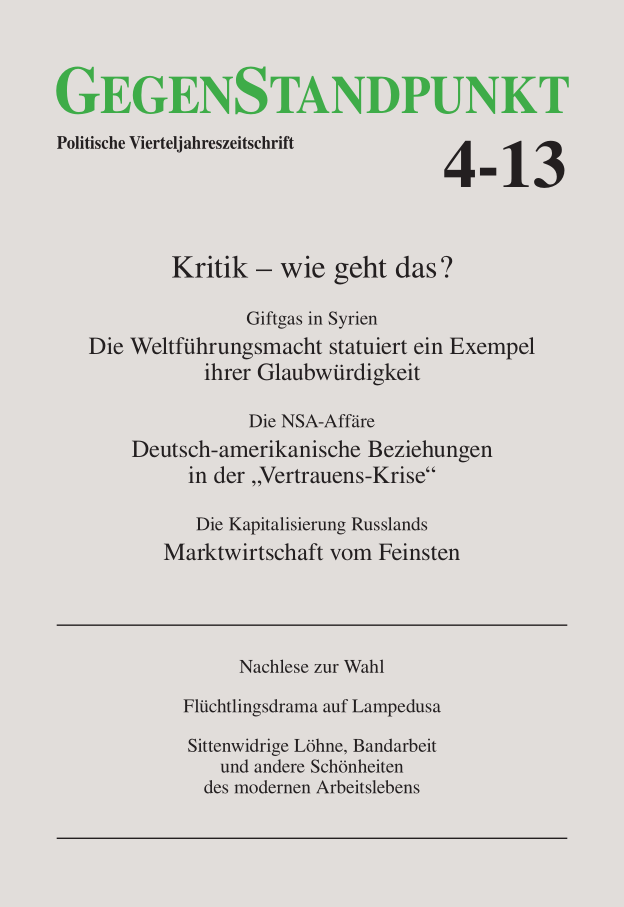Aus der Reihe „Chronik - kein Kommentar!“
Die Flüchtlingskatastrophe vor Lampedusa
Eine notwendige Tragödie
Anfang Oktober gerät ein Boot mit afrikanischen Flüchtlingen vor der italienischen Insel Lampedusa in Seenot und sinkt. Hunderte Flüchtlinge ertrinken. Die Presse und andere Medien, deutsche und europäische Politiker zeigen sich erschüttert von dem Unglück an den Außengrenzen der EU, fordern bzw. versprechen, dass man angesichts dieser „Schande Europas“ (Papst Franziskus) nicht zur Tagesordnung übergehen dürfe, und klagen Maßnahmen ein, die sicherstellen, dass dergleichen nicht wieder vorkommt. Zugleich wissen alle, die sich zu Wort melden, dass gar kein Unglück vorliegt – weder zufälliges Pech, noch überhaupt ein ganz außergewöhnliches Ereignis, sondern nur ein extremer Fall dessen, was normal ist auf dem Mittelmeer zwischen Afrika und Europa. Und auch, was die Maßnahmen zu Verhinderung neuen Massensterbens betrifft, liegen die kritischen Stellungnahmen zwischen billigem Humanismus, Zynismus und Ratlosigkeit: Auf je verschiedene Weise bescheinigen sie alle der Katastrophe die furchtbare Folgerichtigkeit einer griechischen Tragödie – und räumen so ein, dass der massenhafte Versuch von Afrikanern und Arabern, in der EU ein Überleben zu finden, ebenso wie das tödliche Fernhalten der Flüchtlinge zu diesem Europa und seiner Lebensart einfach dazugehören.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Die Flüchtlingskatastrophe vor Lampedusa
Eine notwendige Tragödie
Anfang Oktober gerät ein Boot mit afrikanischen Flüchtlingen vor der italienischen Insel Lampedusa in Seenot und sinkt. Hunderte Flüchtlinge ertrinken. Die Presse und andere Medien, deutsche und europäische Politiker zeigen sich erschüttert von dem Unglück an den Außengrenzen der EU, fordern bzw. versprechen, dass man angesichts dieser „Schande Europas“ (Papst Franziskus) nicht zur Tagesordnung übergehen dürfe, und klagen Maßnahmen ein, die sicherstellen, dass dergleichen nicht wieder vorkommt. Zugleich wissen alle, die sich zu Wort melden, dass gar kein Unglück vorliegt – weder zufälliges Pech, noch überhaupt ein ganz außergewöhnliches Ereignis, sondern nur ein extremer Fall dessen, was normal ist auf dem Mittelmeer zwischen Afrika und Europa. Und auch, was die Maßnahmen zu Verhinderung neuen Massensterbens betrifft, liegen die kritischen Stellungnahmen zwischen billigem Humanismus, Zynismus und Ratlosigkeit: Auf je verschiedene Weise bescheinigen sie alle der Katastrophe die furchtbare Folgerichtigkeit einer griechischen Tragödie – und räumen so ein, dass der massenhafte Versuch von Afrikanern und Arabern, in der EU ein Überleben zu finden, ebenso wie das tödliche Fernhalten der Flüchtlinge zu diesem Europa und seiner Lebensart einfach dazugehören.
„Leben retten!“
Zuerst regen sich Trauer und Empörung. Ihnen verleiht Heribert Prantl in der SZ Ausdruck, indem er einmal ungeschminkt die durchaus bekannte Wahrheit über das Grenzregime der EU zu Papier bringt:
„Das Mittelmeer ist ein Massengrab. Die toten Flüchtlinge sind ... Opfer der europäischen Flüchtlingspolitik, der Politik also des Friedensnobelpreisträgers von 2012, der Europäischen Union. In dieser Politik hat die Abwehr von Menschen den Vorrang vor der Rettung von Menschen. ... Hilfe gilt als Fluchtanreiz. Deshalb ist sie verboten, deshalb wird sie bestraft, deshalb nimmt die EU-Politik den Tod der Flüchtlinge fatalistisch hin. Die Tränen, die nun angesichts des Massentodes vor Lampedusa von EU-Politikern zerdrückt werden, sind Krokodilstränen; und die Reden dieser Politiker sind Krokodilsreden. Der Tod der Flüchtlinge ist Teil der EU-Flüchtlingspolitik, er gehört zur Abschreckungsstrategie, die der Hauptinhalt dieser Politik ist.“ (Prantl, SZ, 8.10.13)
Dass Europas Grenzsicherung über Leichen geht, will der Gewissenswurm der deutschen Politik dann doch so nicht stehen lassen: Prantl nimmt seine korrekte Denunziation der gezielten Abschreckung in den Vorwurf einer Unterlassungssünde zurück – die Toten seien Opfer unterlassener Hilfeleistung; womöglich handelt es sich auch um Tötung durch Unterlassen
–, die die Politiker gefälligst unterlassen sollen. Um ihnen ins Gewissen zu reden und seinen Imperativ unüberhörbar zu machen, wird er poetisch und erhebt die ersoffenen Auswanderer in eine höhere Sphäre: Sie sind Botschafter, lebende Appelle an unsere Humanität. Dem eigenen hohen Wert wenigstens hätte die EU zu entsprechen und Zuflucht zu gewähren. Die Flüchtlinge sind die Botschafter des Hungers, der Verfolgung, des Leids. Doch Europa mag diese Botschafter nicht empfangen. Die europäischen Außengrenzen wurden so dicht gemacht, dass es dort auch für Humanität kein Durchkommen mehr gibt.
Bei Prantl bleibt dunkel, wie viel oder wie wenig sich wirkliche Flüchtlinge davon versprechen dürfen, wenn Europa seine Türen so weit öffnet, dass die Humanität selbst hindurchpasst. Tom Koenigs von den Grünen, ein Kollege im Geiste, scheut sich weniger auszusprechen, was und was nicht die Flüchtlinge sich erwarten dürfen, wenn Europa schnell, realistisch und praktisch die Hilfe leistet, die er fordert.
„Man kann auf die EU schimpfen und langfristige Lösungen fordern. Aber jetzt geht es um schnelle Hilfe für Flüchtlinge. ... Deutschland kann nicht alle aufnehmen, heißt es, die EU auch nicht. Natürlich, darum geht es aber jetzt nicht. Die Situation in den Ländern, aus denen die Flüchtlinge kommen, muss sich verbessern. Ja, aber sollen so lange die Leute im Meer ertrinken? Das Schlepperunwesen muss bekämpft werden. Richtig, nur: Das geht am akuten Problem vorbei, da geht es um Menschenrettung. Man kann doch nicht jemanden ertrinken lassen, nur weil man nachher nicht weiß, wohin mit ihm. Es geht hier zuallererst um Rettung Ertrinkender. 1500 im Jahr. Das kann doch nicht unmöglich sein.“ (FR, 8.10.13)
Koenigs weist – als ob es das Gleiche wäre – sowohl Kritik zurück, die sich den Ursachen der Katastrophe zuwendet, wie auch die Funktion, in der er das Plädoyer für langfristige Lösungen oft genug zu hören kriegt: als Ausrede nämlich, alles beim Alten zu belassen und gar nichts zu tun. Er vertritt genau das Gegenteil: Wer hier und heute helfen will, darf sich weder um die Gründe der Einwanderung noch um die der europäischen Abwehr der Einwanderer kümmern. Den einen bescheinigt er ihre – jedenfalls kurzfristige – Unveränderlichkeit, den anderen sogar ein gewisses Recht. So macht er dann schon deutlich, was er an der Katastrophe von Lampedusa notwendig findet und was nicht: Wenn die Fluchtursachen ebenso als bleibendes Faktum hingenommen werden müssen wie der Umstand, dass die meisten Flüchtlinge nach Europa nicht hereindürfen, dann ist an dem gefährlichen Zusammentreffen von Flucht und undurchlässiger Grenze nur eines vermeidbar: Der nasse Tod selbst hätte nicht sein müssen und soll nicht mehr sein. Diese der Lebensrettung und sonst gar nichts verpflichtete Ethik ist nicht so fern von den Konsequenzen, die die EU-Behörden selbst aus der Lage ziehen: Sie verstärken die Präsenz der Frontex-Einheiten in den Gewässern zwischen Afrika und Italien, fangen Boote möglichst vor dem Kentern ab und bringen die Flüchtlinge sicher wieder dorthin zurück, von wo sie fliehen wollten. Außerdem werden Fluchthelfer härter verfolgt und strenger bestraft.
„Unkontrollierte Immigration hält Europa nicht aus!“
FAZ-Journalist Frankenberger widmet sich der europäischen Abschottungspolitik, die Prantl für die Toten verantwortlich macht, – und findet sie einfach unverzichtbar.
„Es stimmt: Die europäische Politik hat vornehmlich das Ziel, illegale Einwanderer – und um solche handelt es sich – abzuwehren. ... Aber fairerweise muss man sagen, dass das Ausmaß selbst die vernünftigste Flüchtlingspolitik überfordern würde. Zwischen Westafrika und Vorderasien warten nicht Zehn- oder Hunderttausende auf eine günstige Gelegenheit, endlich nach Europa aufzubrechen, weil dort Milch und Honig flössen – es sind Millionen. Die ‚solidarische Willkommenskultur‘, die hierzulande nun gefordert wird, wäre faktisch eine Einladung zu einer gigantischen Wanderungsbewegung.“ (FAZ, 5.10.)
Dem Kommentator ist es selbstverständlich: Lässt man einen afrikanischen oder asiatischen Hungerleider in die EU herein, dann kommen zehn oder hundert Mal soviel hinterher. In den Herkunftsländern herrschen seiner Kenntnis nach perfekte Fluchtbedingungen
. Die Not, die die Flüchtlinge aus ihrer Heimat treibt, trifft nicht einzelne, sondern die Bewohner von eineinhalb Kontinenten. Sie hat mit temporären Problemen oder einem durch auswärtige Unterstützung bewältigbaren Ernte- oder Produktionsausfall nichts zu tun, sondern zeigt einen dauerhaften Ruin der Lebensgrundlagen an. Warum gleich neben potenten Wirtschaftsmächten wie Europa ganze Kontinente liegen, in denen nicht einmal das Überleben mehr geht, interessiert Frankenberger nicht weiter. Davon geht er als „den Gegebenheiten“ aus, auf die „wir“ uns einstellen, ein Wohlstandsgefälle
, mit dessen Wirkungen „wir“ fertig werden müssen. Ganz egal was irgendwer gegen die EU-Einwanderungs-Verhinderungspolitik einwenden mag, und was sich vielleicht auch gegen sie einwenden ließe: Diese Flut kann Europa nicht verkraften, selbst die vernünftigste Flüchtlingspolitik
würde da scheitern.
Er präsentiert damit noch so eine „Gegebenheit“, die ihm keine Frage wert ist. Warum versteht es sich denn von selbst, dass Deutschland und erst recht die große EU nicht Millionen aufnehmen können? Fehlt es etwa an Platz oder materiellen Mitteln, zusätzliche Wohnungen zu bauen und Essen heranzuschaffen? Die Flüchtlinge werden als untragbare Belastungen und Unkosten für die sozialen Sicherungssysteme ins Auge gefasst; dass die nach Europa wollen, um mit Arbeit für sich und ihre Familien zu sorgen, wird gar nicht erst in Betracht gezogen. Könnten sich die Einheimischen mit neuen zupackenden Händen nicht die Arbeit teilen, und das zusätzlich Benötigte leicht herstellen? Können sie eben nicht! Frankenberger hält sich nicht auf mit dem Warum; er geht davon aus, dass in dieser Wirtschaftsweise massenhaft zusätzliche Arbeitsleute keine willkommene Unterstützung darstellen, sondern ein Problem. Ihm ist die Absurdität vertraut, dass Arbeit selbst – der Aufwand, der nötig ist zur Herstellung der gebrauchten Güter – ein knappes Gut ist und schon ohne Einwanderer nicht für alle reicht. Arbeit muss man in dieser Gesellschaft haben und sie dafür erst einmal finden und nehmen. Weil Unternehmer dafür zuständig sind, Arbeit zu geben, die sich für sie lohnt, und weil sie dafür mit Lohn und Arbeitsplätzen knapp kalkulieren, ist Arbeit nicht einfach die Mühe, die sie ist, sondern ein Privileg, das der, der es hat, mit anderen nicht teilen kann. Nur deshalb sind zusätzliche Menschen im Land eine Bedrohung für diejenigen, die Arbeit haben. Das Kapital definiert, wie viele Leute gebraucht werden, also nützlich sind und leben können, und wie viele – an ausschließlich seinem Bedarf gemessen – Überbevölkerung darstellen und nur stören. Wer zu welcher Sorte Mensch gehört, entscheidet, so weit er kann, der Staat: Während Unternehmer arme Migranten bisweilen schon als Billigarbeitskräfte brauchen könnten, hält sie die Politik zum Schutz des nationalen Arbeitsvolks mit ihrem Grenzregime vom nationalen Standort fern. So macht er sie zu sozialen Kostgängern und die Arbeit – den Flüchtlingen gegenüber – zum nationalen Privileg. Weil Frankenberger diese Logik kapitalistischer Arbeit so natürlich ist, dass er sie gar nicht mehr thematisiert, sondern sich nur noch auf sie beruft, ist ihm auch klar, dass die Unterbindung einer Masseneinwanderung mit allen dafür nötigen Mitteln leider eine Notwendigkeit des europäischen Wohlfahrtsmodells ist.
„Fluchtursachen bekämpfen!“
Wenn man die Flüchtlinge schon nicht nach Europa hereinlassen kann, dann ist die eigentliche Ursache der Katastrophe darin zu suchen, dass sie überhaupt herein wollen. Und da zeigen sich – angesichts der hohen Zahl der Opfer – die diversen Wortmeldungen einmal nicht giftig gegen Wirtschaftsflüchtlinge, die nur ihren Vorteil suchen. Auch der Mann von der FAZ möchte es den Auswanderern nicht verdenken, dass sie wegwollen aus ihren Heimatländern, in denen sie keine Perspektive sehen und Elend, Gewalt und Krieg erfahren haben.
Ausnahmsweise also kein Vorwurf an die Afrikaner, die kommen; weil Europa sie gleichwohl nicht brauchen kann, thematisieren die Meinungsprofis mitfühlend deren heimatliche Existenzbedingungen als Zustände, die so eigentlich nicht bleiben dürften: Europa müsste mehr tun, um die Fluchtursachen zu bekämpfen.
Jeder sagt das – und die meisten sagen gleich dazu, dass das ein Jahrhundertwerk wäre, von dem man sich Besserung so bald nicht erwarten darf.
„Die Ehrlichkeit gebietet es, sich einzugestehen, dass dieses Problem allenfalls langfristig zu lösen ist, wenn überhaupt. Jenseits der europäischen Grenzen, im Süden und Südosten, herrschen oft ‚perfekte‘ wirtschaftliche, soziale und politische Abwanderungsbedingungen. Dort muss die europäische Politik ansetzen: beitragen, die Lage zu verbessern und Konflikte zu bewältigen. Kurzfristig wird das den Druck jedoch nicht mindern. Dafür ist das Nord-Süd-Gefälle einfach zu groß.“ (Frankenberger, FAZ, 12.10.13.)
Viel verspricht der FAZ-Mann sich nicht von europäischen Beiträgen zur Verbesserung der Lage, für die er ist. Ohne Ursachen dafür wissen, geschweige denn kritisieren zu wollen, bescheinigt er den afrikanischen Zuständen, weitgehend unkorrigierbar zu sein.
Nicht alle Journalisten freilich fassen die riesenhafte Aufgabe, Fluchtursachen zu beseitigen, nur ins Auge, um ihre Unbewältigbarkeit zu beschwören. Manche teilen den verbreiteten Fatalismus nicht. Sie wüssten schon, was zu tun wäre, und bezichtigen die EU nicht nur, das Nötige zu unterlassen, sondern Fluchtursachen durch ihre Afrikapolitik direkt zu erzeugen.
„Mit Abwehrmaßnahmen und auch den Aktionen von Frontex werden nicht die Ursachen der illegalen Zuwanderung bekämpft. Und zu diesen Ursachen trägt zum Beispiel die Wirtschafts- und Agrarpolitik der EU mit Subventionen und Einfuhrbeschränkungen nicht unerheblich bei, in deren Folge Bauern in afrikanischen Ländern ihre Existenzgrundlage verlieren und sich dann eben auf den Weg gen Europa machen, um Arbeit zu suchen.“ (Martina Doering, Frankfurter Rundschau, 6.10.)
Noch härtere Worte findet Sebastian Schoepp von der Süddeutschen:
„Nur am Rande hat Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich beim Treffen mit EU-Kollegen den wahren Kern des Problems berührt: Man müsse mehr tun, um Fluchtursachen in den Herkunftsländern zu beseitigen. Damit hat er recht. Nur leider hat er versäumt auszuführen, was er damit meint, und das möglicherweise mit Absicht. Denn es ist die EU selbst, die die Schlüssel in der Hand hält, um Migrationsgründe zu reduzieren. Sie müsste nur wollen, wofür es trotz Flüchtlingsdramen keine Anzeichen gibt.
Ausbeutung und Arroganz halten Afrika am Boden. Es geht damit los, dass man aufhören könnte, die Küsten Westafrikas leer zu fischen, den Menschen mithin die Lebensgrundlage zu entziehen und ihre Regierungen dafür mit Almosen abzuspeisen. Man könnte auch das Dogma vom Freihandel nicht nur zum eigenen – kurzfristigen – Vorteil interpretieren und stattdessen Handelsschranken abbauen, denn die machen es armen Ländern fast unmöglich, gewinnorientiert zu produzieren. Man könnte versuchen, die Afrikaner nicht mehr zu Rohstofflieferanten zu degradieren. Viele Länder leben vom Extraktivismus, was heißt: davon, was sie aus dem Boden kratzen und von den Bäumen holen. Extraktivismus jedoch nährt korrupte Eliten und behindert technischen Fortschritt.“ (SZ 12.10.13.)
Ob die Autoren verstehen, was sie da an Umständen und Ursachen anführen? Wenn Afrika hungert, weil die EU die Einfuhr dortiger Agrarprodukte beschränkt und zugleich europäische Agrarexporte subventioniert, dann offenbart das viel mehr als eine egoistische Handelspolitik: Auch in Afrika hängt das Leben und Überleben nicht mehr davon ab, ob die Bauern dort genug und wie viel Lebensmittel sie für sich und ihre Abnehmer erzeugen, sondern vom Geld, das sie verdienen können – und zwar auf einem globalen Markt. Extraktivismus hin oder her; so viel Kapitalismus ist auf dem Katastrophenkontinent jedenfalls schon eingezogen, dass nur essen kann, wer – Schoepp sagt es – Gewinn zu machen oder sich dafür nützlich zu machen vermag – in Konkurrenz zu anderen, oft internationalen Anbietern, die dasselbe wollen und die unmöglich alle ihr Ziel erreichen können. Erst auf dieser Basis ist Europa mit seiner Marktregulation, Finanzkraft und Produktivität im Konkurrenzkampf um Geldquellen, Preise und Gewinne gegenüber afrikanischen Produzenten nicht nur gnadenlos überlegen und macht deren gewinnorientierte Produktion unmöglich, es ist überhaupt das politische und ökonomische Subjekt, das mit den entrichteten Lizenzgebühren für den Fischfang ebenso wie mit seiner Nachfrage nach mineralischen Rohstoffen entscheidet, wie viel Geld überhaupt in Afrika ankommt und von den diversen Eliten angeeignet und ausgegeben werden kann. Die Kritiker zählen immer wieder dieselben drei Geschäftsfelder – Fischfang, Cash Crops und Bergbau – auf; andere fallen ihnen nicht ein, weil es eine andere kapitalistische Nutzung des schwarzen Kontinents so gut wie nicht gibt. Es ist dasselbe ökonomische System, das die Flüchtlinge in den Zielländern zur Störung werden lässt, das sie auch aus ihrer Heimat vertreibt.
Journalisten, die sich nicht gleich damit abfinden, dass sich an der Lage Afrikas nichts ändern lässt, machen schlechte Politik für die Fluchtursachen verantwortlich; Politik, meinen sie, müsste sich mit gutem Willen doch korrigieren lassen. Schoepp weiß nicht recht, ob er „Freihandel“ für die Rechtfertigungsideologie der außenwirtschaftlichen Konkurrenz der Nationen halten soll oder für ein unverwirklichtes Versprechen von Fairness. Egal, er klagt mal die Verwirklichung des Versprechens ein – und rechnet erkennbar nicht damit, dass jemand darauf hört: Der Autor, der Europa der gezielten Ausbeutung und Arroganz bezichtigt, weiß, dass die EU ihre Politik gegenüber Afrika gar nicht ändern will, weil diese Politik den „kurzfristigen“ europäischen Wirtschaftsinteressen ganz gut entspricht. Seinen Verbesserungsvorschlägen steht die ganze Realität des wuchtigen Wirtschaftsbündnisses entgegen – und dem trägt er Rechnung mit dem durchgehaltenen Konjunktiv seiner Forderungen.
In einem letzten Versuch, Europa davon zu überzeugen, dass seine Afrikapolitik schlecht nicht nur für Afrika, sondern für Europa selbst ist, appelliert er an genau die imperialistischen Benutzungsinteressen, denen er gerade noch die katastrophale Lage des schwarzen Kontinents zur Last gelegt hat.
„Europa droht Afrika zu verlieren – und verpasst damit eine Chance. Viele afrikanische Länder haben enorme Wachstumsraten. Ruanda, Kongo, ja selbst Somalia sind weit mehr in Technologie und globale Wirtschaftszusammenhänge integriert, als das hierzulande wahrgenommen wird. Das Geschäft machen jedoch zunehmend andere, Brasilianer und Chinesen. Um das einzuleiten, müsste man jedoch die rassistische Brille abnehmen, durch die Afrikaner noch immer wie zu Fortschritt unfähige Nehmer aussehen, zu denen man sie ja stets auch machen wollte.“(Ebd.)
Imperialismus ohne Vorurteile – sollte es das sein, was Afrika weiterhilft?
„Mit der Flut leben!“
Die schönste Einsicht in die Notwendigkeit präsentiert Thomas Schmid in der Frankfurter Rundschau:
„Das Flüchtlingsdrama vor Lampedusa zeigt: Flucht ist die andere Seite der Globalisierung. Eine Politik, die den Kontinent zur Festung gegen Migranten macht, gehört endlich auf den Misthaufen der Geschichte. ... Weltweit sind nach UN-Angaben 45 Millionen Menschen auf der Flucht. Jährlich versuchen vermutlich an die 100 000 Afrikaner ihren Kontinent zu verlassen – die meisten wohl aus wirtschaftlichen Gründen. Auch diese sind durchaus respektabel. Wie Kapital da hinfließt, wo die größten Profite locken, so zieht es die Habenichtse der Welt eben da hin, wo sie sich ein besseres Leben versprechen. Das ist die andere Seite der Globalisierung.“ (FR 4.10.13)
Wenn die Staaten dem Kapital die Grenzen wegräumen und seiner Jagd nach Rendite den globalen Vergleich der nationalen Standorte gestatten, müssen sie sich nicht wundern, dass die dadurch ihrer Lebensgrundlagen beraubte Weltbevölkerung auch mobil wird und an denselben Grenzen anstößt, die fürs Kapital so durchlässig geworden sind. Schmid stellt das ohne kritischen Unterton fest: Er findet, dass, wer A sagt, auch B sagen muss; und meint das keineswegs sarkastisch in dem Sinn, dass die kapitalistische Welt mit dem einen Wahnsinn einen zweiten produziert. Er hält den Zustand, dass 45 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht und über Länder und Kontinente hinweg auf der Suche nach einem Leben sind, für normal im Zeitalter der Globalisierung: Dem Hin- und Herschwappen der Kapital- und Investmentströme entspricht halt ein ebensolches Schwappen der Menschenfluten. Die Politik soll dem neuen dynamischen Gleichgewicht der Weltwirtschaft nur keine unhaltbaren Dämme in den Weg stellen wollen, sondern sich mit Einwanderungsquoten, Integrationspolitik und anderen Instrumenten der Migrationssteuerung darauf einstellen.