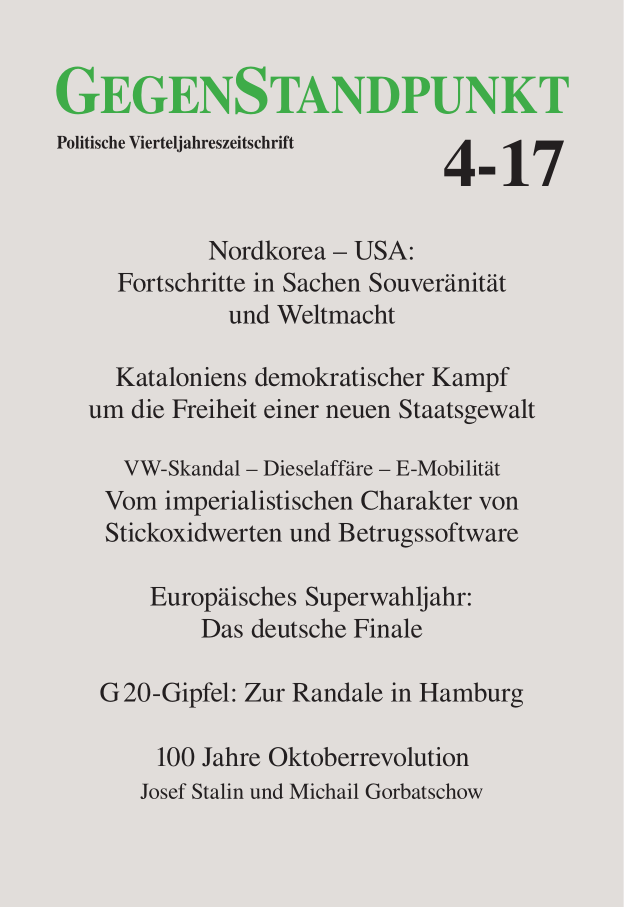Aus der Reihe „Chronik - kein Kommentar!“
Europäisches Superwahljahr: Das deutsche Finale
2017 war, hieß es, ein ‚europäisches Superwahljahr‘ – nicht deswegen, weil vielerorts in Europa gewählt wird. Vielmehr deswegen, weil es bei allen europäischen Wahlen in erster Linie um Europa geht – jedenfalls aus der unbestechlich objektiven Sicht der deutschen Führungsmacht. Bei wichtigen Nachbarn sind die Wahlen im ersten Halbjahr gar nicht schlecht ausgefallen: Unbeschadet aller nationalen Schäden und Unzufriedenheit in den Partnerländern gab es dort keinen Durchbruch für offensiv antieuropäischen, womöglich antideutschen Nationalismus, keine Absage von unbefugter Seite an die EU, sondern lauter Bekenntnisse zur Alternativlosigkeit eines Europas unter deutscher Führung. Im Herbst 2017 findet in Deutschland das sogenannte ‚Finale‘ statt – nicht deswegen, weil die Wahlen in Europa damit zu Ende wären. Vielmehr deswegen, weil sich an der politischen Willensbildung in Deutschland maßgeblich entscheidet, was aus Europa wird.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Europäisches Superwahljahr: Das deutsche Finale
2017 war, hieß es, ein ‚europäisches Superwahljahr‘ – nicht deswegen, weil vielerorts in Europa gewählt wird. Vielmehr deswegen, weil es bei allen europäischen Wahlen in erster Linie um Europa geht – jedenfalls aus der unbestechlich objektiven Sicht der deutschen Führungsmacht. Bei wichtigen Nachbarn sind die Wahlen im ersten Halbjahr gar nicht schlecht ausgefallen: Unbeschadet aller nationalen Schäden und Unzufriedenheit in den Partnerländern gab es dort keinen Durchbruch für offensiv antieuropäischen, womöglich antideutschen Nationalismus, keine Absage von unbefugter Seite an die EU, sondern lauter Bekenntnisse zur Alternativlosigkeit eines Europas unter deutscher Führung. Im Herbst 2017 findet in Deutschland das sogenannte ‚Finale‘ statt – nicht deswegen, weil die Wahlen in Europa damit zu Ende wären. Vielmehr deswegen, weil sich an der politischen Willensbildung in Deutschland maßgeblich entscheidet, was aus Europa wird.
Der deutsche Wahlkampf selbst verläuft, heißt es, langweilig, aber beruhigend. Langweilig, weil sich recht früh abzeichnet, dass es keine Unzufriedenheit im Lande gibt, die eine ‚Wechselstimmung‘ einzuleiten vermag – sodass alle Unzufriedenheiten, die im Wahlkampf zur Sprache kommen, für die Profis der deutschen Öffentlichkeit letztlich zum Gähnen sind. Beruhigend, weil damit auch die Gefahr gebannt zu sein scheint, die von der rechten, antieuropäischen ‚Alternative‘ ausgerechnet im Lande der europäischen Führungsmacht ausgeht – für die Kontinuität der Politik, an der offenbar nicht nur der Kanzlerin, sondern auch der deutschen Öffentlichkeit gelegen ist. Im Ergebnis haben die deutschen Wähler dann doch für Spannung und Beunruhigung gesorgt: Zwar wollen sie unterm Strich auch nach zwölf Jahren weiter von Merkels C-Parteien regiert werden; sie bescheren ihnen allerdings deutliche Verluste, dem sozialdemokratischen Koalitionspartner sogar einen Absturz auf ca. 20 %, womit ihm die Aberkennung des Ehrentitels ‚Volkspartei‘ droht. Und vor allem: Die Wähler machen die AfD überraschend stark, sogar zur drittstärksten Kraft im Bundestag, und lösen damit einen ‚Schock‘ aus: Zwar findet nur ein Achtel von ihnen seinen Fremdenhass und seine Heimatliebe erst durch die neue alternative Rechtspartei hinreichend bedient, aber nach den anspruchsvollen Maßstäben des etablierten Parteienspektrums sind das offenbar schon viel zu viele Gegenstimmen gegen dessen kollektives Monopol auf die Zustimmung der Bürger, also gegen alles, was in unserer Demokratie heilig ist. Nachdem sich dann die SPD schon am Wahlabend in die Opposition verabschiedet, ist die Bildung einer neuen Regierung auch völlig offen – der nächste Schock für die deutsche Kultur der stabilen Herrschaft.
1.
Mitten in der großen Aufregung über das Wahlergebnis erinnert die Kanzlerin ans Wesentliche: Ein besseres Ergebnis wäre besser gewesen, aber nach den gültigen Regeln der demokratischen Selbstbestimmung hat sie gewonnen, sodass die überparteiliche Verantwortung aller anderen darin besteht, sich als Steigbügelhalter für ihre vierte Amtszeit bereitzuhalten. Dass das Volk es so will, hat es mit dem Wahlergebnis bewiesen; dass das Volk es so braucht, steht ohnehin fest: Gerade in stürmischen Zeiten
wie diesen ist eine stabile deutsche Regierung
, also die Handlungsfreiheit der deutschen Staatsgewalt, ein Wert an sich
. Das ist ein bemerkenswerter Hinweis, und zwar nicht bloß wegen der Offenherzigkeit, mit der die Kanzlerin Herrschaft sans phrase zum alles überragenden Bedürfnis der Wähler erklärt, auch nicht wegen der Chuzpe, mit der sie die Lage der ganzen Welt zum Ruf nach ihrer Führung deklariert. Bemerkenswert an diesem Hinweis ist vielmehr, dass darin zwar eine Erinnerung an die Sache enthalten ist, die das ‚europäische Superwahljahr‘ überhaupt zu einer so schicksalsträchtigen Angelegenheit macht: die prekäre Lage der EU, ihre Infragestellung und sogar Anfeindung von innen und von außen, damit der kriselnde Zustand des Kernstücks der gesamten außenpolitischen Staatsräson der Bundesrepublik. Das alles kommt aber eben auffällig anonym vor – als eine diffuse Bedrohung, angesichts derer es vor allem darauf ankommt, mit solider Herrschaft Schaden von den Deutschen abzuwenden.
Das passt auch ganz gut zum Wahlkampf der Kanzlerin, in dem Europa, die wesentliche politische Messlatte für die auswärtigen Wahlergebnisse, so gut wie gar nicht vorgekommen ist, schon gar nicht als das Projekt, dem man sich in Berlin mit neuem Elan widmen und für das man die Bestätigung der Wähler haben will. Stattdessen wirbt die Kanzlerin für sich mit den Erfolgen der Deutschen unter ihrer Regentschaft in der Konkurrenz ums Geld – in Europa und weltweit: ein stetes, starkes Wachstum und weltweit beneidete Exportbilanzen, ohne dass man sich dafür weiter hat verschulden müssen. Und wenn man den richtigen Maßstab anlegt, nämlich den einzigen, den die regierende Union anbietet, dann sind das gute Nachrichten nicht nur für ‚die Wirtschaft‘ und die Verantwortlichen der ‚schwarzen Null‘, die sich über ihre Bilanzen freuen können, sondern für alle anderen Deutschen. Sie finden nämlich Arbeit in rekordverdächtigen Zahlen, was deswegen gut ist, weil das allemal besser ist als keine Arbeit zu haben – ein Schicksal, das die europäischen Partnervölker allzu oft und durchaus selbstverschuldet trifft. Dass die Löhne und die Sozialleistungen, auf die deutsche Arbeitsplatzbesitzer und -anwärter setzen müssen, oft zu wünschen übrig lassen, schon vor der mit Sicherheit zu erwartenden Altersarmut, soll damit auch nicht dementiert, sondern unter einer doppelten Prämisse gewürdigt werden, die wenig Raum für Beschwerden lässt: Erstens verdankt Deutschland seinen Wohlstand einer Wettbewerbsfähigkeit, die auf die spitzenmäßige Produktivität deutscher Arbeit, also auf ‚Lohnstückkosten‘ zurückgeht, die den Ertrag der Arbeit für die Unternehmen mit Ansprüchen der Arbeiter auf einen Lebensunterhalt nicht übermäßig belasten. Zweitens genießen die Deutschen die Früchte einer Haushaltsdisziplin, die zwar wenig Geld für Soziales bietet, dafür ein solides; das Geld mag in vielen Fällen nicht reichen, aber es behält seinen Wert. Es gibt einfach keine soziale Notlage, die nicht in Merkels Handtasche passt – die also nicht auf dem gleichen Erfolgskurs zu erledigen wäre. Die Notwendigkeiten der globalen Konkurrenz, in der sich Deutschland nachweislich bestens schlägt, lassen sich ohnehin nicht abwählen; deren weitere Bewältigung gehört also in die Hände der erfolgreichen, also erfolgsfähigen Kanzlerin. Jede Partei, die das anders sieht, will nur unser lebenswertes Deutschland schlechter machen, als es ist, um sich attraktiver zu machen, als sie ist; sie kippt bloß Wasser auf die Mühlen der Rechtspopulisten oder entlarvt sich selbst als einer. Dabei hat das Volk in der Kanzlerin alles, was es braucht, nämlich das glaubwürdige Versprechen, die Leistungen der Nation in der Konkurrenz um Geld gegen unberechtigte Ansprüche von außen, etwa von ihren europäischen Partnern, zu verteidigen.
Genauso wenig Raum für Unzufriedenheit lässt die christdemokratische Flüchtlingspolitik. Schließlich bietet die Kanzlerin eine beeindruckende Versöhnungsleistung von Humanität und Härte im Geiste eines Realismus, der sowieso jede Alternative, also auch jede Kritik disqualifiziert. Ihre damalige ‚Willkommenskultur‘ unter dem Motto Wir schaffen das!
will sie nicht mehr als die notwendige und ehrenwerte Innenseite der ‚Verantwortung‘ für das globale Elend verstanden haben, die eine so potente und gute Nation übernehmen muss – so die Formulierung für das Projekt, der EU die deutsche Definition samt einer Lösung der ‚weltweiten Flüchtlingskrise‘ aufzudrücken, um diese Definition dann als Europa der gesamten Staatenwelt aufzudrücken. Das versteht sie rückblickend als eine leidige Notsituation, die der Kanzlerin eine sachlich gebotene Ausnahme von der Durchsetzung der sachlich gebotenen Regel aufgenötigt hat, die sie seitdem befolgt. Die verlangt auch machtvolle Taten nach außen: die vermehrte und rapidere Abschiebung abgelehnter Asylbewerber, einschlägige Abkommen mit Nordafrika nach Vorbild des Flüchtlingsabkommens mit der Türkei, sowie eine ‚Fluchtursachenbekämpfung‘ inklusive Entwicklungshilfe, die das Elend vor Ort, also weit vor unseren Grenzen betreut. Über den nach innen gewandten Charakter von dieser weltweiten Verantwortung täuscht sich niemand, und soll es auch nicht: Es geht um den Schutz der Deutschen vor fremdem Elend, das hier kein Aufenthaltsrecht hat. Das Deutschland
, in dem die Deutschen es so gut getroffen haben, bleibt Deutschland
– eine beruhigende Botschaft an die Wähler, die sich keine Xenophobie nachsagen lassen müssen, bloß weil sie ‚Ängste‘ vor Fremden haben. Mit Deutschland den Deutschen!
ist das allerdings nicht zu verwechseln, weil man das Asylrecht im Grundgesetz belässt und das unmenschliche Vorurteil der radikalen Rechten nicht teilt, die berechtigten Fremden könnten die von ihnen verlangte Anpassung nie hinkriegen – sei es an eine ‚Leitkultur‘ oder bloß an das Grundgesetz, das man sich da gerne als Wertebündel für ein fortschrittliches Gemeinwesen denkt.
Alles in allem eine gelungene Kombination der Zurückweisung jeder materiellen wie ideellen, also patriotischen Unzufriedenheit mit viel Verständnis für die Feindschaft ihrer Bevölkerung gegen die ‚Fremden‘. Vor dem Hintergrund ist die Klage der bayrischen Schwester – sowie von Teilen der eigenen Partei –, man habe es in der Ausländerfrage an ‚klarer Kante‘ fehlen lassen, damit die ‚rechte Flanke‘ für die AfD geöffnet, mindestens ungerecht, eher ein bösartiger Witz. Was die CSU mit ihren Beschwerden verlangt, sind erstens das Bekenntnis der Kanzlerin zur Substanz ihrer neuen Politik und zweitens Verschärfungen, die das unter Beweis stellen: Die Chefin, die sich standhaft weigert, ihre Wende in der Flüchtlingspolitik als klare Wende und Korrektur eines damit eingeräumten Fehlers auszusprechen, soll der CSU, die schon bald wieder eine Wahl zu bestehen hat, wenigstens nachträglich die Obergrenze von 200 000 bei der Aufnahme von Flüchtlingen zugestehen, was sie schon wieder nicht in der geforderten Eindeutigkeit tut. Den fortgesetzten Streit darum erkennt die Öffentlichkeit mit ihrem scharfen Blick für das Demokratische an der inhaltlichen Auseinandersetzung als immer eindeutigeres ‚Sägen am Stuhl‘ der Vorsitzenden. Den Flüchtlingen selbst kommt damit die Ehre zu, Material für den beeindruckenden Eiertanz der CSU zwischen standfester Ausländerfeindlichkeit und unerschütterlichem Machtwillen abzugeben, also dafür, dass patriotische Unzufriedenheit mit Merkel wegen der wahrnehmbaren Kritik der CSU an Merkel in Merkels Union gut aufgehoben ist.
So geht also der Wahlkampf der Hauptregierungsparteien im europäischen Superwahljahr: als eine Kampagne der verordneten Zufriedenheit mit einer Regierung, unter der die Deutschen – jeder an seinem Platz und auf seine Art – gut fahren, die deutsche Interessen schützt und auf ihre Deutschen aufpasst. Das Projekt Europa, das zur allgemeinen Überraschung im Wahlkampf der C-Parteien – und der anderen auch – eine bloß marginale Rolle spielt, kommt dann doch deutlich vor: als Warnung vor Ansprüchen der unterlegenen Mitgliedsnationen an die Steuergelder ihrer überlegenen deutschen Führungsnation und als die Ankündigung, man werde sich eine nationale Grenzsicherung gegen Flüchtlinge vorbehalten, solange die EU-Außengrenzen noch nicht dicht sind. Diese Grundfragen staatlichen Reichtums und souveräner Gewalt in ihrer aktuellen Fassung sind für die Kanzlerin Angelegenheiten der Wahrung des nationalen Wirtschaftswachstums und der heilen Heimat. Das ist eine europapolitische Ansage, nämlich eine implizite, aber deutliche Absage an die ‚europäische‘ Dimension der überkommenen Staatsräson, so wie man sie von den Nachbarn nicht nur erwartet, sondern einfordert.
2.
Dass die SPD nicht vorhat, der Kanzlerin den Weg zur nächsten Amtszeit zu bahnen, stellt der Spitzenmann Schulz schon am Wahlabend klar: Seine Partei hat zwar das zweitbeste, aber zugleich ihr schlechtestes Ergebnis erzielt, entscheidet sich daher für die Lesart, dass die Große Koalition abgewählt ist, sodass ihr nur der Gang in die Opposition bleibt. Das heißt allerdings nicht, dass sie dort weniger Verantwortung für den Erfolgskurs der Nation als in der Regierung tragen würde. Eine Opposition, so die sozialdemokratische Auskunft, ist für die Stabilität der Macht genauso wichtig wie die Regierung selbst. Zu dem Zweck will sie erstens dafür sorgen, dass die neue Regierungskoalition es in der kommenden Legislaturperiode dauerhaft in die Fresse kriegt
(Nahles), auch wenn sie noch gar nicht sagen kann, welche Kritik und welches Anliegen sie gegen welche Regierungsmaßnahme so entschieden vertreten will. Darauf kommt es auch gar nicht an, denn der eigentliche Gegner dieser Opposition ist ohnehin nicht die Regierung, denn die hat ihre einzig nennenswerte Sünde schon längst begangen: Sie hat der AfD den Weg ins Parlament geebnet, indem sie mit ihrer unerbittlich überparteilichen, präsidialen Tour den Streit im Keim erstickt hat, den die mit-regierenden Sozialdemokraten natürlich hemmungslos gegen sie geführt hätten. Sie hat ihrem Juniorpartner nie die Chance gegeben, dem Volk den Schein einer sozialdemokratischen Alternative zu bieten, die es bei der Stange gehalten hätte. Den Streit muss die SPD jetzt umso entschiedener von der Oppositionsbank aus führen, damit die neue rechte Partei – der eigentliche Gegner – möglichst schnell in der Versenkung verschwindet. Als demokratischer Widerpart wird die Sozialdemokratie der Regierung – dies der zweite Teil ihrer neuen Verantwortung – konstruktiv entgegentreten. Denn auch das steht für die SPD schon vor der Geburt der neuen Regierung fest: Es gibt keine Unzufriedenheit, die eine Opposition im Sinne eines Einspruchs gegen den Erfolgskurs der Nation begründen könnte – für den zeichnet die SPD schließlich seit beinahe zwei Jahrzehnten mit kurzer Unterbrechung mit-regierungsverantwortlich. Zumindest in der Hinsicht kommt die SPD dem Ruf der Kanzlerin also doch nach: Sie will auf ihre Weise, nämlich per Streit gegen die Regierung die rechte Opposition marginalisieren und ihren Beitrag zur Sicherung des Konsenses leisten, zu dem es auch in ihren Augen eine Alternative weder gibt noch braucht.
Freilich erledigt dieses Übermaß an demokratischem Verantwortungsbewusstsein nicht die Frage, warum der Partei der Zuspruch der Wähler immer mehr abhandenkommt – dies der Ausgangspunkt für eine Sternstunde der innerparteilichen Demokratie, also des Machtkampfs der Führungsfiguren innerhalb der SPD um den zukünftigen Stellenwert der ‚sozialen Gerechtigkeit‘, deren Zeit pünktlich zum Wahlkampf gekommen war. Schulz gelingt im Nachhinein die erstaunliche Entdeckung, dass die Wahlkampagne unter dieser Parole als recht unglaubwürdig aufgefasst wurde, und beschließt eine Neujustierung der Ansprache an die Wähler, damit der verantwortungsvolle Mist namens Opposition spätestens nach einer Legislaturperiode vorbei ist – dafür wären sogar kapitalismuskritische Töne an der richtigen Stelle willkommen. Das halten andere Genossen von Rang erst recht für unglaubwürdig; sie haben nämlich herausgefunden, dass die Wähler solche plötzlichen Volten für bloß taktisch
und die Partei insgesamt für allzu machtorientiert
halten – was von einer ganz schlechten Taktik der Machteroberung zeugt. Deutschlands Wähler schätzen vielmehr Ehrlichkeit, also fährt man besser mit einem ehrlichen Bekenntnis dazu, dass die sozialdemokratische Volkspartei eben keinesfalls mehr eine systematisch geschädigte Arbeiterklasse vertritt und vertreten will, sondern ein Volk, ein Kollektiv namens Wir, das einzig mit einer besseren, sachgerechteren Bewältigung der feststehenden Notwendigkeiten des nationalen Erfolgs bedient wäre. Diese Klientel ‚Volk‘, die man gelegentlich gerne ‚die Mitte‘ nennt, überzeugt man nicht mit einem ohnehin bloß propagierten Abschied von dem Abschied vom Standpunkt einer Partei der Schlechterverdienenden, den man doch endlich losgeworden ist, sondern – dies die entscheidende Erkenntnis aus der erfolgreichen Wahl in Niedersachsen – erstens mit Kompetenz in puncto Wirtschaftserfolg und law and order, zweitens mit ‚reinen Wein einschenken‘ in puncto Soziales. Statt einen ‚Linkspopulismus‘ zu pflegen, den man sowieso nicht ernst meint, und von dem die Linkspartei offenbar auch nicht profitiert, braucht man eine klare Ansprache an das Volk, das keine sozialen Korrekturversprechen – das ist abstraktes
Gerechtigkeitsgeschwafel –, sondern konkrete
Maßnahmen will. Das sind solche, die eine konsequente Fortsetzung des Kurses erkennen lassen, auf den ein erfolgreich regierender Sozialdemokrat stolz sein kann, auch wenn niemand mehr weiß, warum es dafür einen Sozialdemokraten braucht. Vorerst – so weit reicht der Konsens unter den streitenden Genossen – fällt ihnen nichts Besseres zur Rettung der Sozialdemokratie ein, als erst mal vier Jahre lang als Gut- und Bessermacher des Merkelschen Erfolgsweges für Deutschland neue Glaubwürdigkeit zurückzugewinnen.
Worüber die Genossen erst gar nicht streiten, ist eine sozialdemokratische Vision von Europa, für die sie im Wahlkampf sowieso nicht – nicht einmal mit ihrem ‚Mr. Europe‘ an der Spitze – offensiv werben wollten. Auch für sie eröffnet die ‚Flüchtlingsfrage‘ nicht den Blick auf das, was man unter demokratischen Ideologen ‚weltpolitische Verantwortung‘ zu nennen pflegt, also auf die bislang gepflegte Ambition, sich der Staatenwelt als sozialpolitische Führungsmacht aufzudrängen. Sie stellt vielmehr – schon im Wahlkampf lässt sie so den konstruktiven Geist aufblitzen, den sie nun in der Opposition pflegen will – der alternativlosen Politik der Kanzlerin die ‚Einzelfallprüfung‘ zur Seite, also die konsequente Einhaltung von law und order bei der Notwendigkeit vermehrter Abschiebung. Sie passt so die weltweite Flüchtlingskrise sauber ins deutsche Asylrecht ein, will da jedenfalls nichts durcheinanderkommen lassen – was auch einiges an Fluchtursachenbekämpfung Merkelscher Art erfordert. Ganz in dem Sinne hätte man – noch ein konstruktiver Vorwurf an die Kanzlerin – früher und entschlossener die europäischen Partner bei der Lösung unseres Flüchtlingsproblems einbinden müssen, damit Deutschland weniger von den Flüchtlingen betroffen ist, für die es sich zuständig erklärt hat. Doch kein Abkommen, das man zur Abwehr der Flüchtlinge eingeht, darf dazu führen, dass sich Deutschland als Souverän und europäische Führungsmacht vom Partnerstaat respektlos behandeln lassen muss – so gelingt Schulz der einzige Wirkungstreffer gegen Merkel im Kandidaten-Duell: Er übertrumpft sie mit der offensiveren Ächtung des nicht pflegeleichten, aber wichtigen und bisher auch wichtig genommenen Partners Türkei.
3.
Dass die Sozialdemokraten im Jahr 2017 die eigentlichen Konservativen sind, die Nation keinen Kurswechsel verdient und alle sozialen Sorgen bei der SPD bestens aufgehoben sind – das bestätigt ihr der gewerkschaftliche Arm der Arbeiterbewegung, wenn der im Wahlkampf gegen die rechtspopulistische Opposition polemisiert:
„Die AfD [entwirft] ein vollkommen schiefes Bild unseres Landes. Deutschland wird in die Nähe einer Bananenrepublik gerückt, in der Demokratie, Justiz, Politik und Medien auf ganzer Linie versagen. Dieses Bild ist falsch und gefährlich: Denn bei aller Kritik an unserer Gesellschaft und ihren Institutionen muss doch klar sein, dass wir in einem der sichersten, wohlhabendsten und demokratischsten Länder dieser Erde leben. Indem die AfD aber eine Weltuntergangsstimmung heraufbeschwört, treibt sie einen Keil in unsere Gesellschaft.“ (DGB-NRW: Argumente gegen Rechtspopulisten: Fokus AfD)
Das ist ein interessanter, nämlich seltsam überparteilicher Vorwurf für eine Gewerkschaft, deren ganze Existenz immerhin auf der Streikbereitschaft beruht, die ihre Mitglieder aufbringen, weil sie mit ihrer Lage und der Berücksichtigung, die ihre Interessen bei Staat und Kapital erfahren, nicht zufrieden sein können. Weil die AfD das Land schlecht macht und Unzufriedenheit auf ihre rechten Mühlen lenkt, weist der DGB nicht etwa eine falsche, sondern Unzufriedenheit mit diesem Land überhaupt als unbegründet und unberechtigt zurück. Die Organisation derer, die mit ihrem Interesse an einem auskömmlichen Lohnarbeiterdasein immer nur stören, tritt auf als Agentur der Zufriedenheit der Arbeiterschaft und gegen die Unzufriedenheit, die die Rechten ausbeuten. Umso schlimmer, dass so viele Bewohner dieser sozialen Heimat, auch und gerade gewerkschaftlich organisierte, ausgerechnet in der AfD eine attraktive Alternative gefunden haben. Wer sind überhaupt diese Menschen? Eine DGB-Studie weiß es:
„Die meisten Menschen in Deutschland nehmen die aktuelle wirtschaftliche Situation positiv wahr – doch viele machen sich Sorgen um ihre Zukunft... Abstiegsängste und die Sorge, die Kontrolle über persönliche und gesellschaftliche Lebensumstände zu verlieren, sind verbreitet. Daraus könnten Rechtspopulisten Kapital schlagen: Menschen, die befürchten, dass es ihnen und ihren Kindern künftig schlechter gehen wird oder die der Meinung sind, dass auf mehreren Ebenen über sie hinweg entschieden wird, neigen überdurchschnittlich häufig der AfD zu.“ (boeckler.de)
Eine einzige Bestätigung der gewerkschaftlichen Sicht auf die soziale Lage der Lohnabhängigen in Deutschland – wenn man nur die richtige Perspektive einnimmt: Dazu muss man erstens den Erwartungshorizont akzeptieren, dass sich schon glücklich schätzen kann, wer wenigstens bislang über die Runden hat kommen können. Wenn man dann zweitens die Gewissheit der Abhängigkeit von Rechnungen, die weder von den Lohnarbeitern noch in ihrem Sinne aufgestellt werden, also in der Regel für sie auch nicht aufgehen, in ein Gefühl der Ungewissheit, in die diffuse Sorge übersetzt hat, dass die guten
Zeiten bald zu Ende gehen, dann braucht man nur noch drittens für selbstverständlich zu halten, dass sich Lohnarbeiter in ihrer materiellen Unzufriedenheit an die politische Macht wenden, die ihnen in ihrer Ohnmacht Sicherheit bieten soll; dass also demokratische Parteien aus der Unzufriedenheit ihrer Bürger insofern schon immer Kapital schlagen
, als sie diese Unzufriedenheit in eine Stimme für ihre Ambitionen auf die Macht im Staate verwandeln. Dann kann man mit dem DGB den Schluss ziehen, dass die Falschen, die rechten Gegner unserer feinen Republik, daraus jedenfalls kein Kapital schlagen dürfen. Das sind diejenigen, die die deutschen Verhältnisse viel schlechter machen, als sie sind, die empfindliche Seele der Lohnarbeiter ausnutzen, um daraus einen unbegründeten Protest zu verfertigen. Den Gewerkschaften sind da glücklicherweise einige Punkte bekannt, wo die Politik einen gewerkschaftlichen Hebel ansetzen könnte, um die aus dem Lot geratene Seelenlage der Unzufriedenen wieder zu richten, also die Zustimmung zu bewahren, die der etablierten Politik jenseits aller Beschwerden einfach zusteht.
„Wer den Rechtspopulisten das Wasser abgraben will, muss Fehler am Arbeitsmarkt und in den sozialen Sicherungssystemen korrigieren: ‚Unsere Antwort kann nur lauten: Mehr Sicherheit im Betrieb mit Tarifverträgen und einer starken Mitbestimmung, und eine Ordnung auf dem Arbeitsmarkt, die Gute Arbeit fördert und sichert, also prekäre Beschäftigung wie Leiharbeit eingrenzt und sachgrundlose Befristung abschafft‘, so Hoffmann.“ „Sicherheit in der Arbeitswelt und die Möglichkeit, als Arbeitnehmer am eigenen Arbeitsplatz mitzubestimmen, machen weniger anfällig für rechtspopulistische Parolen.“ „Wer noch mehr Zeitarbeit will, mehr Befristung oder die Arbeitszeit deregulieren will, wer nicht mal die Begriffe Tarifvertrag und Mitbestimmung im Wahlprogramm verankert hat, hat nicht verstanden, was auf dem Spiel steht.“ (dgb.de)
Der DGB braucht überhaupt nichts neu zu erfinden. Die komplette Liste der Forderungen, die er einmal zum Schutz seiner Mitglieder erhoben und zielstrebig schon immer an die Politik gerichtet hatte, präsentiert er den Politikern der etablierten Parteien als Instrumente, ihren Monopolanspruch auf die Zutraulichkeit der arbeitenden Massen wieder zurückzugewinnen: Er wirbt bei ihnen für sich, indem er den nationalen Nutzen sozialer Rücksicht herauskehrt.
4.
Auch für Die Linke – Deutschlands andere, etwas rötere sozialdemokratische Partei – ist das starke Abschneiden der AfD eine echte Herausforderung. So bekommt sie es schwarz auf weiß: Den doppelten Status als soziale Protestpartei – den sie unbeschadet ihrer jahrelangen Mitwirkung an einigen Regierungen im Osten weiterhin beansprucht – und als politische Heimat eines diskriminierten Ost-Volkes hat sie bis auf Weiteres an die AfD verloren. Ihre Hoffnung, die neue Konkurrenz von rechts mit Verweis auf deren wirtschaftsliberale Ursprünge als Teil des neoliberalen Establishments, damit als unglaubwürdigen Fürsprecher der kleinen Leute zu blamieren, ist nicht aufgegangen. Sie muss vielmehr zur Kenntnis nehmen, dass die unzufriedenen und enttäuschten Arbeiter, für die sie sprechen will, sie viel zu wenig als ihren Ansprechpartner verstehen und wählen.
Warum gerade Arbeiter seiner Partei das Vertrauen entziehen, versteht ihr saarländischer Vor- und Querdenker gut: Schuld ist eine verfehlte Flüchtlingspolitik
, die bei ihren Antworten auf die weltweite Flüchtlingsproblematik das Prinzip der sozialen Gerechtigkeit außer Kraft gesetzt
hat (Neues Deutschland, 27.9.17). Oskar Lafontaine schließt in seine Kritik auch die eigene Partei ein, die mit ihrem humanistischen Internationalismus Merkels Politik mitgetragen hat. Sie erinnert er daran, dass soziale Gerechtigkeit nicht nur ‚Schutz für die Armen‘, sondern zuerst für die Allerärmsten meint und das im internationalen und im nationalen Rahmen. National findet er es ungerecht, den Schwächsten unter den Deutschen die Last der vielen Flüchtlinge aufzuhalsen, die er darin gegeben sieht, dass diese unterste Schicht in direkter Konkurrenz um Arbeit und Wohnung mit den Migranten steht. Das führt ihn nicht zur Kritik der Konkurrenz, auch nicht zu der Forderung, mit Niedriglohn und Mietwucher Schluss zu machen und die bessergestellten Deutschen für die Finanzierung der Flüchtlinge heranzuziehen, sondern zum internationalen Aspekt seines hohen Ideals:
Man hilft unstreitig viel mehr Menschen, wenn man die Milliarden, die ein Staat ausgibt, um das Schicksal der Ärmsten dieser Welt zu verbessern, dazu verwendet, das Leben in den Lagern zu erleichtern und Hunger in den Armutsgebieten zu bekämpfen.
(Ebd.)
Global gedachte Gerechtigkeit hilft doppelt: Erstens würden von Hungerhilfen in den Lagern der Entwurzelten mehr Menschen und wirklich die Ärmsten der Armen profitieren und nicht die offenbar gar nicht total armen Flüchtlinge, die sich die weite Reise leisten können und es bis Deutschland schaffen. Zweitens würden die heimatnah Versorgten hier erst gar nicht anlanden und den heimischen Armen ihre schöne Konkurrenz um Arbeitsplätze und Wohnraum versauen.
Natürlich ruft Lafontaines Wahl-Nachlese Empörung unter den Parteigenossen hervor, die darin den nationalsozialen
Standpunkt entdecken, mit dem ihr rechter Gegner Erfolge feiert, und den sie für einen Hohn auf die soziale Gerechtigkeit halten, wie sie sie meinen. Zu Unrecht. Nicht nur Lafontaines Version der sozialen Gerechtigkeit, auch ihrer eigenen ist der Bezug auf die Nation nämlich gar nicht fremd. Die Forderung danach, die sie im Namen der ‚sozial Schwachen‘ erheben, hat stets ein Schutzobjekt und einen Adressaten: Schutzobjekt sind anständige und dabei ohnmächtige Leute, die nicht an die Mittel herankommen, die sie brauchen, die darüber aber auch nicht böse werden, sondern auf eine helfende Hand hoffen. Der Adressat dieser Hoffnung ist die politische Macht; nur sie kann den Ausgleich zwischen arm und reich oder irgendein Minimum davon erzwingen, wozu die Armen nicht fähig, vor allem aber nicht befugt sind. Gerechtigkeit verspricht und schuldet der Staat den armen Leuten aus keinem anderen Grund, als weil sie gleichberechtigte Mitglieder seines Volkes sind. Mit und ohne Lafontaine, ausdrücklich oder nicht, setzt die Forderung danach auf diese Mitgliedschaft als den gültigen Anspruchstitel – und was sie verlangt, ist die eigene Nation als eine soziale Heimat, in der auch die Armen zu ihrem Recht kommen. Dieses – natürlich längst nicht verwirklichte – Ideal ist sehr patriotisch gedacht, aber es hilft nichts. In Deutschland 2017 ist die linke Variante der Heimatliebe für die Schlechterverdienenden ein Angebot, das in der Bevölkerung auf wenig Nachfrage, im sonstigen Parteienspektrum auf Ausgrenzung trifft.
5.
Die Grünen ernten zwar das schwächste Ergebnis im neuen Bundestag, nach dem Abschied der SPD in die Opposition können sie aber die Chance einer Regierungsbeteiligung feiern – und damit den Erfolg dessen, worauf ihr ganzer Wahlkampf gemünzt war. Schließlich hatten sie alle Gegensätze zwischen ihren zwei Flügeln unter ihren geteilten, prinzipienfesten Willen zum Mitregieren subsumiert, ihre Programmpunkte praktischerweise gleich in Form von ‚roten Linien‘, also als Verhandlungsmasse für die Bildung einer Regierung gefasst, die sie bei Bedarf auch und gerade mit der Kanzlerin eingehen will. Und trotzdem: Auch sie haben Stimmen an die AfD verloren und lernen – zusammen mit allen anderen Parteien und dem Bundespräsidenten – aus den Erfolgen der AfD, dass sie das Wort ‚Heimat‘ nicht oft genug im Mund geführt haben:
„‚Ich bin sehr dafür, dass wir Grüne Begriffe wie Heimat und Deutschland nicht der AfD überlassen. Wir müssen sie mit unseren Geschichten füllen.‘ Habeck sagte, er habe es im unmittelbaren Gespräch häufig erlebt, dass Leute sich über die Tradition ihrer Orte, ihres Berufs, ihrer Heimat definierten. ‚Da verbietet sich jede Form von Verächtlichkeit.‘ ‚Wir müssen uns trauen, über Begriffe wie Heimat und Patriotismus zu reden, sie für uns zu reklamieren und sie definieren. Heimat ist der Raum, in dem wir leben und den wir gestalten, gleich, woher wir kommen. Heimat ist unser Zusammenleben.‘“ (Habeck, FAZ, 6.10.17) „Wir lieben dieses Land. Es ist unsere Heimat. Diese Heimat spaltet man nicht.“ (Göring-Eckardt auf dem kleinen Parteitag nach der Wahl, 30.9.17)
Groß ist die Korrektur ja nicht bei der Partei, die ihre Kritik an Regierungen, an denen sie nicht beteiligt war, und am Wirken der Wirtschaft immer schon als Anklage vorträgt: Die anderen ruinieren unsere Umwelt, unseren Lebensraum, unsere Natur, von der wir ein Teil sind – nur das Wort hat eben gefehlt. Das immer schon gemeinte, ausdrückliche Bekenntnis zur Heimat verbindet der Grüne aus Kiel allerdings mit einer Selbstkritik, so als hätten die Grünen bisher für Heimat nichts übriggehabt und auf Dumpfköpfe herabgeschaut, die ihre Persönlichkeit in lokalen und berufsständischen Traditionen realisiert sehen. Jedenfalls empfiehlt er seiner Partei, den bisher gepflegten Gestus von Sachkenntnis und ideologiefreiem Abwägen bei ihrer Politik für die Heimat aufzugeben, weil dieser Gestus den schlechten Eindruck von Distanz erzeugt und elitär rüberkommt. Besser soll sie offensiv die unmittelbare, emotionale Befangenheit in den Lebensumständen, wie sie nun mal gegeben sind, die ‚Liebe zur Heimat‘ als Basis und Antrieb ihres politischen Willens herauskehren und sich damit den nationalbewussten Wählern als ihresgleichen, also als höchst sympathisch präsentieren. Dabei enthält der selbstgestellte Auftrag, der AfD den ‚Begriff‘ Heimat zu entreißen, eine weiterreichende Botschaft: Wenn ein Politiker sich zu diesem Wert als Leitlinie seiner Politik bekennt, verliert die Heimat alles Regionale, borniert Bodenständige; das geliebte Objekt heißt Deutschland und das ‚Wir‘, das beschworen wird, sind nicht die Bekannten und Nachbarn; sie sind nur das Bild für die Vertrautheit und das Verwachsensein des Einzelnen mit dem ganzen deutschen Volk. Unbedingte Parteilichkeit für dieses Deutschland – und zwar nicht für das bessere, das die Grünen irgendwann einmal schaffen wollten, sondern für das wirkliche, erklären sie zu ihrer Sache und zur Eintrittskarte in den Kreis der verantwortlichen Politiker. Kritik, egal welcher Art, wie man sie ihnen immer wieder vorgeworfen hat, spaltet nur und weist auch den größten nationalistischen Meckerer als einen aus, der nicht zur Heimat hält.
6.
Die FDP feiert ihre Rückkehr als eine Bewegung von ‚freien Demokraten‘ unter der Aufbruchstimmung verbreitenden Führung ihres Vorsitzenden Christian Lindner. Der hat den Ruf der ‚Partei der Besserverdienenden‘ endgültig begraben und das alte Profil durch einen Personenkult um den saumodernen, lockeren Erfolgstypen an der Spitze ersetzt. Die aufwendige Inszenierung seiner Person steht allerdings für ein Programm – und zwar mit dem einen Inhalt: Deutschland muss alles für seinen Erfolg tun. Das erfordert erstens eine unüberhörbare ökonomische Konkurrenzansage an die Welt unter dem Titel Digital first, Bedenken second!
– also die Aufrüstung der Republik für den Erfolg der als ‚Digitalisierung‘ bekannten Rationalisierungsoffensive, der er auf die Art die Unausweichlichkeit, also Unwidersprechlichkeit verleiht, die ‚die Zukunft‘ nun einmal an sich hat. Sorgen und Einsprüche angesichts ihrer befürchteten Auswirkungen – etwa die über die Rückkehr der Massenarbeitslosigkeit in ein Land, das sich gerade wieder an die flächendeckende Benutzung der Bevölkerung durch erfolgreiche industrielle und sonstige Kapitale gewöhnt hat – kommen in der Parole erst an zweiter Stelle, gehören in der Sache ganz fallen gelassen. Wenn Bedenken angebracht sind, dann in Bezug auf die Entschlossenheit der Regierenden, diese Wende offensiv und rücksichtslos genug voranzutreiben. Der fällige nationale Aufbruch erfordert zweitens die entschiedene Wiederherstellung deutscher Souveränität gegenüber Europa und der Welt. Zwar fehlt hier die entsprechende englische Parole ‚Germany first!‘, aber ansonsten lässt man an Eindeutigkeit nichts zu wünschen übrig: Die FDP fordert eine endgültige Absage an alles, was nach Transferunion riecht – ein Frontalangriff auf die deutsche Europolitik, der kaum auffällt, weil er keine Zurückweisung, aber auch keine Unterstützung durch die anderen Parteien im Wahlkampf erfährt – keine mag sich für die überkommene Europapolitik und Europa in die Bresche werfen und darum streiten. Schließlich tritt die Partei für eine strikte Trennung zwischen ‚Flüchtlingspolitik‘ und ‚Einwanderungspolitik‘ ein, die dafür sorgt, dass Deutschland sich die Einwanderer, die es nach liberaler Ansicht natürlich braucht und geben darf, nach eigenem Bedarf frei aussuchen kann – und dass alle anderen ferngehalten werden. Motto: Don’t call us, we’ll call you!
Mit dem betont lockeren Stil des Vorsitzenden und dem betont verbissenen Einsatz für nationale Rücksichtslosigkeit gegenüber den Konkurrenten fahren die freien Demokraten ein Ergebnis ein, bei dem nach vierjähriger Pause vom Bundestag wieder eine Machtperspektive winkt.
7.
Auch die AfD verficht die von allen Parteien der ‚Mitte‘ getragene Wendung sämtlicher sozial- und weltpolitischer Probleme in eine nach innen gewandte Sorge um Deutschland und das deutsche Volk. Der Schein, sie sei damit womöglich bloß ein Abfallprodukt des neuen Konsenses der Republik, kommt aber nicht auf; im Gegenteil: Die AfD erscheint umgekehrt als Vorkämpferin – nämlich des zutiefst verletzten Rechts des deutschen Volkes auf seine heile Heimat Deutschland. Und so viel Wahrheit enthält die stilsichere Inszenierung dieser Partei als Volkstribun gegen das etablierte Parteienspektrum allemal: Mit permanenten Tabubrüchen, Verletzungen der Sprach- und sonstigen Anstandsregeln, die in der demokratisch etablierten Echokammer namens ‚Verfassungsbogen‘ bis dato unbedingt gegolten haben, wirbt die AfD um jegliche Unzufriedenheit, die durch die von oben verordnete Zufriedenheit ins Abseits gestellt ist, also um jede. Die anderen, namentlich die regierenden Parteien wollen den patriotischen Standpunkt der Wähler dadurch für sich (zurück-)erobern, dass sie die verordnete Gleichung von Patriotismus und Zufriedenheit mit der herrschenden Politik auf die AfD anwenden, also der Unzufriedenheit, die diese Parteialternative verkörpert, jeden ehrbaren Patriotismus absprechen. Die tut sich angesichts der vielfältigen Unzufriedenheiten, die es gibt und auf die sie sich beruft, leicht damit, an der Ausgrenzung, die sie als konkurrierende Partei erfährt, zu demonstrieren, wie sehr die Etablierten sich von ihrem Volk abgewandt haben, wie unglaubwürdig und volksfremd also deren Kampagne eines Patriotismus der Zufriedenheit ist.
8.
Und die Öffentlichkeit? Sie registriert das Ergebnis unter Überschriften wie AfD-Schock
oder Rechtsruck
und richtet – ca. eine Woche lang – ihre volle Aufmerksamkeit auf die 13 % der Wähler, die rechtsaußen, also falsch gewählt und eine Gefahr für die ‚Stabilität‘ und das ‚Ansehen‘ der Republik herbeigeführt haben. ARD, Bild oder Spiegel behandeln den Erfolg der ‚überraschend starken‘ Heimatschutzpatrioten von der AfD wie das Eindringen eines Fremdkörpers in die deutsche Demokratie; umgekehrt begreifen sie Merkels ‚Wende‘ in der Flüchtlingsfrage weniger als ihre Politik denn als Anbiederei an den rechten Zeitgeist, dem sie im Interesse ihres Machterhalts hinterherlaufe. Sie behaupten glatt, die Gesinnung der Etablierten sei gar nicht die, die sie äußern, und unsere Demokratie eigentlich unvereinbar mit staatlich praktizierter Ausländerfeindschaft. So retten sie ihre offenbar unverwüstlich gute Meinung von der Republik, in der dieser ‚rechte‘ Nationalismus nichts verloren hat, zu der er vielmehr in schreiendem Widerspruch steht. Als Produkt der etablierten Parteien gilt ihnen die AfD nur in einer Hinsicht: Die Demokraten hätten das Nötige und Geeignete unterlassen, um die ‚Hassprediger‘ gegen unser liebenswertes Vaterland und seine Repräsentanten zu verhindern. Aus diesem Blickwinkel erfährt der historische ‚Betriebsunfall‘ seine demokratische Deutung:
Wie konnte, was in dieser Nation eigentlich keinen Platz hat, sich trotzdem breitmachen? Die Stellung der Frage unterstellt einen unversöhnlichen Gegensatz zwischen dem christlich, sozial, liberal oder ökologisch orientierten Patriotismus und dem Ausländerhass rechter Nationalisten – ihre Beantwortung dementiert ihn zur Hälfte wieder: Die einen Politikberater warnen die Parteien der ‚Mitte‘ davor, der AfD durch das ‚Kopieren rechter Themen‘ das Wasser abgraben zu wollen. Das würde nichts nützen und die AfD erst recht salonfähig machen. Sie trauen den Demokraten die Übernahme radikal rechter Programme also zu und können sich vorstellen, dass die auch beim Volk ankommen und zum Mainstream werden. Andere, vor allem Bild, verlangen umgekehrt, die Politik möge wachsende Fremdenfeindlichkeit als ‚Ausdruck berechtigter Ängste der Bürger‘ anerkennen und durch staatliche Härte bedienen; nur so sei die AfD kleinzukriegen. Komplementär zur Kritik am Versagen der Parteien, das ‚die Populisten erst groß gemacht‘ habe, üben die ‚Leitmedien‘ die Selbstkritik, sie hätten die AfD durch zu große Befassung gestärkt. Offenbar glauben sie sich ihren Anspruch aufs Monopol bei der Betreuung der Volksmeinung so sehr, dass sie den Aufstieg der AfD auf ihr Versagen zurückführen – der Marsch der Republik nach rechts, ein Produkt misslungener Manipulation. Die Alternative, die die Meinungsmacher als Methodenfrage wälzen, ist bezeichnend: totschweigen oder diffamieren? Schadet es der AfD mehr, wenn man ihr die Ehre öffentlicher Erwähnung und damit einer öffentlichen Existenz überhaupt verweigert; oder bekämpft man ihre politischen Ziele wirkungsvoller, wenn man ihre Vertreter als Personen ins moralische Abseits stellt, sie als verkappte Nazis oder Möchtegern-Führer enttarnt?
Nach der Aufregung über den Rechts-Rumms
(Bild) richtet die Öffentlichkeit ihr Interesse schnell auf ein spannenderes Thema: Was machen die wirklichen Führer mit und aus dem wählerseitig ausgestellten Blankoscheck für die Macht, die sie, allen Verlusten zum Trotz, in der Hand halten?
9.
Wie es sich für eine Demokratie gehört, wird der Machtkampf der Jamaika-Sondierer mit nimmermüder öffentlicher Anteilnahme bedacht, nämlich mit den sachgerecht unsachlichen Fragen, wer sich dabei durchsetzt und seinen Prinzipien treu bleibt statt umzufallen, aber auch, wer aus patriotischer Verantwortung seinen Parteiegoismus überwindet; vor allem aber mit der Frage, wie lange es denn jetzt noch dauert, bis CDU/CSU, die Grünen und die FDP endlich zu Potte kommen und den demokratischen Zirkus in das münden lassen, wofür er da ist: die Bildung einer starken und stabilen Regierung, die das Land in den angesagten „stürmischen Zeiten“ braucht. So kommt hinter all den interessanten oder nervenden Hahnenkämpfen
das zur Sprache, worum es dabei geht: die herrschaftliche Definition des Staatsprogramms, dem Land und Leute die nächsten vier Jahre unterworfen werden.
Zu Beginn der Sondierungen wird von weitgehender Einigkeit in wichtigen Punkten berichtet. Die vier Parteien beschließen noch vor allen weiteren Überlegungen, wie sie die Republik „gestalten“ wollen, dass sie sich dafür eine finanzielle Grenze setzen: die schwarze Null
. Ein Staatshaushalt ohne Schulden gerade in dem europäischen Land, das jeden Kredit genießt und sich Schulden locker leisten könnte, ist nicht das Geschenk einer guten Konjunktur oder der Nullzinspolitik der EZB, sondern wird unabhängig von allen Umständen als politisches Oberziel der deutschen Politik festgelegt. Innenpolitisch bedeutet das, dass diesem Ziel alle anderen staatlichen Aufgaben und Erfordernisse untergeordnet werden: Nicht nur will man es sich gemeinsam verbieten, angesichts übervoller Kassen soziale Begehrlichkeiten
zu wecken. Mit der Selbstverpflichtung auf den ausgeglichenen Haushalt definieren die verhandelnden Parteien zugleich das Wofür ihrer Ausgaben. Sie kehren das Verhältnis von Aufwendungen für politische Aufgaben und Einnahmen für deren Finanzierung dahingehend um, dass sie Geld nur übrig haben wollen für Ausgaben, die für staatliche Steuereinnahmen sorgen. Die Politik, auf die sie sich damit einigen, hat kein anderes Ziel als den an nichts relativierten, wachsenden Erfolg des deutschen Kapitals.
Man verständigt sich auch leicht darüber, was für diesen Erfolg politisch zu tun ist, nämlich für welche Herausforderung das Land und seine Wirtschaft fit gemacht werden müssen. Nicht nur die FDP will der Digitalisierung
jede Priorität einräumen: Als ob sie keinen Macher und Nutznießer hätte, stellen die politischen Planer diese nächste Rationalisierungswelle in Industrie und Dienstleistungswirtschaft, die von den gewohnten Arbeits- und Lebensverhältnissen wenig beim Alten lassen wird, als einen unausweichlichen, subjektlosen Sachzwang vor, der auf das Land zurollt und dem es sich anpassen muss, um nicht überrollt zu werden. Die tatsächliche Herausforderung für den ökonomischen Riesen Deutschland besteht darin, sich zum Subjekt dieser Revolution zu machen und sie auf den Rest der Welt zurollen zu lassen, um den geschäftlichen Ertrag daraus bei sich zu konzentrieren und entsprechende Anstrengungen anderer Länder, die in Entwicklung und Anwendung dieser Techniken nachziehen müssen, zu entwerten – womit der Sinn der „Digitalisierung“ schon auf den Punkt gebracht ist. Die nationale Konkurrenzoffensive besteht erklärtermaßen darin, den amerikanischen Internetriesen ihre marktbeherrschende Stellung zu bestreiten und den unerträglichen Zustand zu überwinden, dass auf diesem Zukunftsmarkt andere europäische Nationen weiter sind als wir
. Neben der Glasfaserverkabelung der Republik, die die Konkurrenzoffensive auf Gigabit-Geschwindigkeit
beschleunigen soll, bedarf es dafür eines Updates derer, die die notwendige Arbeit zu leisten haben: Bildung
braucht der Standort, brauchen also die Lohnabhängigen, denen die Digitalisierung ihren Lebensunterhalt permanent wegrationalisiert, um den Anforderungen ihrer morgigen und übermorgigen Anwender gerecht zu werden. Die Förderung des lebenslangen Lernens und der Weiterbildung, damit jeder und jede in einer sich wandelnden Arbeitswelt auch teilnehmen kann
, vereinbaren die sondierenden Parteien ganz schnell. Sie wollen Vollbeschäftigung in unserem Land erreichen
, denn flächendeckend für den Wirtschaftserfolg der Nation in Anspruch genommen zu werden, zu dem Preis und den Konditionen, die sich für die Anwender lohnen – Arbeit eben und immer mehr davon –, ist das Glück, das ungehemmtes Kapitalwachstum im besten Fall für die Masse der Bürger vorsieht und das Politiker dem Volk gerne schenken.
Schwierig sind die Verhandlungen bei den Themen Klimaschutz und Flüchtlingspolitik, die dem Vernehmen nach dann auch zum Knackpunkt des Scheiterns werden. Auf beiden Feldern hat sich Deutschland als Führungsmacht aufgebaut, die anderen Nationen den Weg weist und Aufgaben zuteilt, indem es Menschheitsanliegen, also übernationale Herausforderungen und Gefahren, die alle betreffen, definiert und sich zum Sachwalter dieser Probleme macht. Dass die edle Vorreiterrolle im Klimaschutz auf den Export deutscher alternativer Energietechnik berechnet ist, dass die kurzzeitig großzügige Aufnahme von Kriegsflüchtlingen auf ein ordnungspolitisches Ausgreifen der EU auf ihre südliche und östliche Peripherie und auf deutsche Vorschriften für das Grenzregime, für Asyl- und Nationalitätenpolitik der EU-Mitgliedsländer zielt, dass die Motive für diesen Internationalismus also durchaus nicht national selbstlos sind, das alles ist einbegriffen, wenn Deutschland als verantwortliche Führungsnation und nicht als nur national bornierter Vertreter seiner Interessen auftritt. Es gewinnt Einfluss auf nahe und ferne Partnerstaaten, indem es sie auf Probleme anspricht, die die selbst haben, dafür seine Lösungen anbietet und bei ihrer Realisierung hilft. Im Land wird diese Tour von Anfang an nicht als Methode der Eroberung einer Position imperialistischer Vormacht, sondern als Einsatz für die Menschheit und Selbstlosigkeit der Nation betrachtet und je nachdem als hochherzige Gesinnung geschätzt, die „uns“ als die Besseren auszeichnet, die deshalb auch erwarten können, dass man auf ihre Angebote eingeht, oder als nationale Dummheit verworfen, die bis an den Verrat am eigenen Volk heranreicht.
Die außenpolitische Tour der Merkel-Republik kommt in den Sondierungsgesprächen seitens der FDP, der CSU und von Teilen ihrer eigenen Partei unter Beschuss – und zwar in der Form, dass sie beispielhaft an der Klima- und Flüchtlingspolitik denunziert wird – als grüne Zumutung gegen eine realistische, konsequent an deutschen Interessen orientierte Politik: Braunkohle ist billig; die CO2-Reduktionsziele hat Deutschland sich selbst gesetzt. Wer soll ihm abverlangen, sie einzuhalten? Kein Zehntel Prozent des deutschen Wirtschaftswachstums für den Klimaschutz! Warum lässt sich Deutschland durch sein eigenes Asylrecht fesseln und zu langwierigen Verfahren nötigen, wenn man sich doch einig ist, dass man Flüchtlinge fernhalten will? Die Grünen, die wirklich alles, was an ihrer Programmatik nicht völlig in den Realismus der Republik passt, zur Verhandlungsmasse degradieren und mit immer neuer Kompromissbereitschaft schleifen, werden als Vertreter des Gestrigen angegriffen – und Merkel vermittelt zwischen diesen unfreiwilligen Repräsentanten ihrer früheren Politik und den neuen Partnern, die sie braucht.
Diese Abrechnung gilt auch dem Kern der auswärtigen deutschen Staatsräson, der Europäischen Union, dem Feld eben, auf dem diese Methode des deutschen Imperialismus ein halbes Jahrhundert lang mit ungeheurem Erfolg praktiziert wurde. Die „Schwarze Null“ im Staatshaushalt entfaltet ihre eigentliche Bedeutung im Außenverhältnis zu den Euro-Partnern: Mit seinen höchst soliden Staatsfinanzen ist Deutschland die Basis der Stabilität und Geldmacht des Euro, die die anderen brauchen; als Garantiemacht der Gemeinschaftswährung setzt es die Messlatte für Staatsschulden und Haushaltsführung, der die Partner gerecht werden müssen, wenn sie das gute Geld, das längst auch ihres ist, weiter nutzen wollen. Diese Kommandomacht wird das Deutschland der nächsten Jahre noch viel weniger mit den Partnern teilen als bisher. Und was Europa kosten darf, ist mit der Schwarzen Null auch schon festgeschrieben: Ausgaben, die neue Schulden erfordern und den so wichtigen Stabilitätsvorsprung des deutschen Staatshaushalts schmälern könnten, kommen nicht in Frage. Was immer die EU aus sich machen und anpacken mag: Nicht mit unserem Geld!
Einig sind die sondierenden Delegationen in der Grundrichtung ihrer Europapolitik: Schritte in Richtung auf eine europäische Transferunion oder Schuldenvergemeinschaftung werden sie nicht zulassen. Das ist eine Absage an Macron, der ihnen vor einem halben Jahr mit seinem bejubelten Sieg die EU gerettet hatte. Seine Initiative, Deutschlands ökonomische Stärke für eine Festigung der Eurozone in Anspruch zu nehmen, lässt man ins Leere laufen. Wie weit man dabei geht, ist Gegenstand des Streits der Sondierungsgespräche und ein Stoff ihres Scheiterns. So viel wird darüber offiziell: Die Weise, in der der deutsche Imperialismus den Aufbau der EU zur ökonomischen und politischen Weltmacht bisher vorangetrieben hat, hat – jedenfalls jenseits einer Regierungsbeteiligung der SPD – keine Mehrheit mehr.
Fragt man den Verhandlungsführer der Partei, die die Verhandlungen abgebrochen hat, nach dem Grund dafür, wird der prinzipiell: Lindner lässt kein bestimmtes Thema als Scheidungsgrund gelten, denn man habe sich im Grund auf gar nichts geeinigt: Die vier Gesprächspartner [konnten] keine gemeinsame Vorstellung von der Modernisierung unseres Landes und vor allem keine gemeinsame Vertrauensbasis entwickeln.
Dass die Parteien um die Berücksichtigung ihrer programmatischen Identitäten feilschen und Merkel allen Kompromisse abverlangt, beweist Lindner, dass es keinen Willen zum Aufbruch in seinem Sinn gibt, keine gemeinsame Mission, in der sich die möglichen Regierungspartner aufeinander verlassen können. Er besteht darauf, dass er für die Trendwende
gewählt worden sei und nicht für irgendeine Form des „Weiter so“. Seinem Rigorismus des nationalen Interesses kommen alle Kompromisse, die Merkel und die anderen von ihm fordern, wie Verrat vor: eine Fortsetzung der Großen Koalition mit ein bisschen grünem Schnittlauch drauf
. Er bezichtigt die alte und neue Kanzlerin, ihr moderierendes Aufgreifen seines Radikalismus wäre nichts weniger als dessen Boykott und kommt zu dem Schluss, dass unter ihr der Bruch mit der sozialdemokratisierten, vergrünten, internationalistischen Republik, wie er sie sieht, nicht zu haben ist. Die anderen Jamaikaner lassen seine Begründung nicht gelten und versichern, was er verabscheut, dass man nämlich für alles einen Kompromiss hätte finden können. Sie sehen den Gegensatz von Lindners radikalem Geldmaterialismus der Nation zu ihren Zielen gar nicht und geben so auf ihre Weise zu erkennen, dass die von ihm geforderte Korrektur des deutschen Kurses im Inneren und nach außen schon unterwegs ist. Nicht nur Lindners bürgerliche Rechtspartei, auch ihre Partner bezweifeln längst, ob ihr Land angesichts der Macht und der Mittel, die es in den Merkel-Jahren akkumuliert hat, Rücksicht auf Interessen der Nachbarn und überhaupt auf andere Nationen noch nötig hat. In den Verhandlungen über eine Jamaika-Koalition haben sich die Partner darüber zerstritten, wie viel Rücksichtslosigkeit sich das Land gegen seine bisherigen Erfolgsbedingungen leisten will. Gescheitert ist die Koalition daran, dass die anderen den Kurswechsel nicht mit der von der FDP geforderten Eindeutigkeit als Absage an den bisherigen deutschen Weg durchziehen wollen.