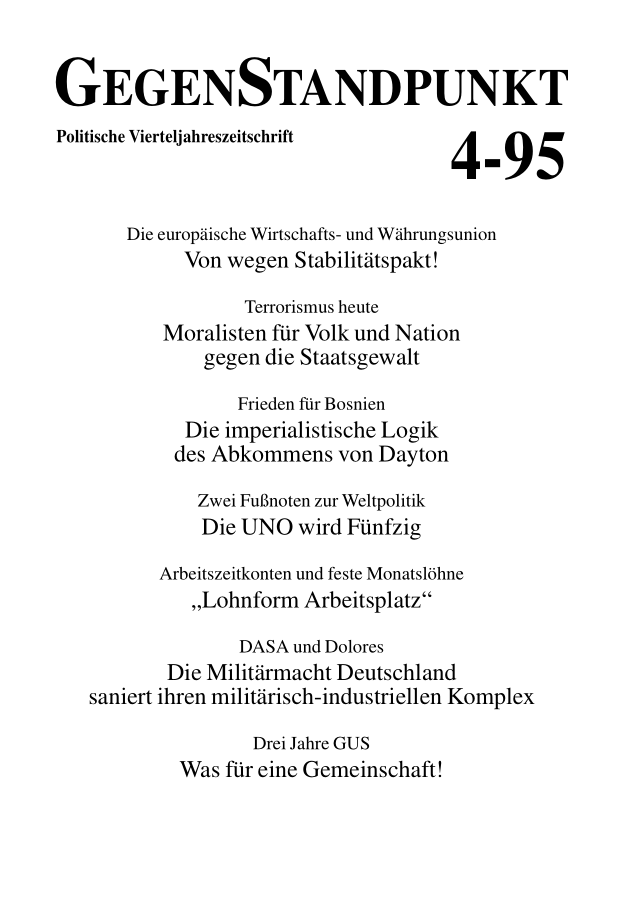DASA und Dolores
Die Militärmacht Deutschland saniert ihren militärisch-industriellen Komplex
Um beim Weltordnen bestimmend mitzumachen braucht Deutschland eine nationale Rüstungsindustrie. Diese ist ein ganz nach staatlichem Bedarf definierter Haushaltsposten, wird jedoch umso mehr als Sphäre kapitalistischen Weltmarktgeschäfts organisiert, wobei aufgrund der durch und durch politischen Ware feststeht, dass der Staat bei jedem Geschäftsakt dabei ist. Also ist eine Krisenlage des deutschen Rüstungsmultis ein Auftrag an den Staatshaushalt: Wettrüsten ist Standortpolitik.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Gliederung
- Aparte Sorgen: Die Nation bangt um ihre DASA
- Die Rüstungsindustrie – ein hochpolitischer Erwerbszweig
- Die militärpolitische Seite: Rüstungskonkurrenz im Bündnis
- Die DASA und ihre Schulden: Das deutsche Instrument in der Rüstungskooperations-Konkurrenz – ein Opfer der neuen Weltlage
- Fazit
DASA und Dolores
Die Militärmacht Deutschland saniert ihren militärisch-industriellen Komplex
Aparte Sorgen: Die Nation bangt um ihre DASA
Die Nation ist aufgeschreckt: Beim deutschen High-Tech- und Rüstungskonzern DASA sind Milliardenverluste aufgelaufen. Als Gründe werden von den verschiedenen Seiten der Dollarkurs, die Konkurrenz mit ihren ruinösen Geschäftsmethoden, aber auch Mißmanagement und „Verschleierungspolitik“ des Vorstandes angegeben. Der läßt sich nicht vorwerfen, daß er seinen Job nicht versteht, und legt einen Sanierungsplan unter dem Titel „Dolores“ vor. Dieses blumige Kürzel steht für „dollar low rescue“, womit Diagnose und Programm der Sanierung zusammengeschlossen sind: Schuld an den roten Zahlen der DASA ist der Dollarkurs, und deshalb soll das Geschäft der DASA so umorganisiert werden, daß der Konzern auch noch bei einem Dollarkurs von DM 1,35 „in die Gewinnzone fliegt“ (Vorstandsvorsitzender Schrempp). Diesem selbsterteilten Auftrag will der Vorstand durch anerkannte Methoden der Kostensenkung nachkommen: Entlassung einiger tausend Flugzeugbauer, Schließung etlicher Standorte und Produktionsverlagerung ins Ausland. Damit wäre eigentlich alles in bester Ordnung, ist es in diesem Fall aber nicht. Die Konzernleitung läßt verlauten, ihre besten Pläne würden nichts bringen, wenn der deutsche Staat nicht für mehr Planungssicherheit
sorge. Regionalpolitiker von Scherff bis Stoiber üben Kritik an der Sanierung: Damit würden nationale Kapazitäten in der deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie vernichtet. Gewerkschafter klagen politische Verantwortung für Arbeitsplätze ein, über deren nationalen Nutzen doch Einigkeit bestehe. Die Kritik mündet in einem breiten Konsens: Die Bundesregierung soll die DASA mit neuen Rüstungsaufträgen beglücken. Und der Bundeswirtschaftsminister weist das Ansinnen keineswegs im Namen von „freier Marktwirtschaft“, „weniger Staat“, und „der Staat muß sparen“ einfach zurück. Er ruft zur Konferenz in Bonn und verspricht, die Bundesregierung werde „der privatisierten deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie in einer schwierigen Phase beistehen“, für „geeignete Bedingungen für den Marktzugang“ und „Planungssicherheit bei Beschaffungsvorhaben“ sorgen und mehr Mittel für Forschung und Entwicklung bereitstellen.
Auf diese Weise kommen die neuen deutschen Rüstungsprojekte auf die nationale Tagesordnung. In einem ist man sich offenkundig einig: Deutschland braucht als neue Weltmacht eine „Luft- und Raumfahrtindustrie“, die seinen ausgreifenden Bedürfnissen genügt; deshalb darf die deutsche Politik den Lieferanten dieser feinen Ware nicht im Regen stehen lassen. Daß Staat und Kapital beim neuerlichen deutschen Aufrüsten an einem Strang zu ziehen haben, ist der nationale Konsens, der der Debatte ihren Schwung verleiht. Es geht bei der Sanierung der DASA eben weder darum, Folgen von „Mißmanagement“ zu bereinigen, noch um die bestmögliche Vermeidung neuer staatlicher Haushaltslöcher. Es geht um die deutsche Rüstungspolitik und ihre kapitalistische Finanzierung. Die hat ihre Eigenheiten.
Die Rüstungsindustrie – ein hochpolitischer Erwerbszweig
Der staatliche Rüstungsbedarf
Der deutsche Rüstungsbedarf bemißt sich an der weltpolitischen Mission, zu der sich Deutschland befugt, weil befähigt sieht. Die heißt seit ein paar Jahren „mehr Verantwortung auf der Welt“. Daß diese vor allem nach überlegenen Kriegsmitteln verlangt, hat der Kanzler bei der Feier von 40 Jahren Bundeswehr noch einmal bekräftigt: Die Welt ringsum wirft Ordnungsprobleme auf; Deutschland sieht sich als „robuster“ Vermittler gefragt und zu militärischem Eingreifen herausgefordert. Dabei zu sein, wenn auf der Welt geschossen wird, sind „wir“ uns einfach schuldig. Und zwar nicht in der untergeordneten Rolle einer Konfliktpartei, sondern als unzweifelhaft überlegene Macht, die den Kriegsparteien vor Ort mit Gewalt vorbuchstabiert, wie weit ihre Rechte gehen und für welche Verbrechen sie niedergemacht gehören.
Mit „Verantwortung“ ist der deutsche Anspruch benannt, beim Weltordnen dabeizusein. Dieser eigentümliche außenpolitische Zweck nimmt seinen Ausgangspunkt bei einigen gar nicht selbstverständlichen Eigenheiten der gegenwärtigen Weltpolitik:
- In einer Hinsicht sind die Gewaltverhältnisse zwischen den Nationen auf der Welt ziemlich grundsätzlich geklärt. Die Staatenwelt sortiert sich in eine aus der Zeit des Kalten Krieges siegreich hervorgegangene Supermacht plus Bündnispartnern, die die Konditionen des zwischenstaatlichen Verkehrs diktieren, und den großen Rest der Staatenwelt, der sie sich diktieren lassen muß. Dieser Zustand heißt nicht deshalb Weltordnung, weil es in ihm so friedlich-schiedlich zuginge, sondern weil bei den NATO-Mächten so überlegene militärische Gewaltmittel versammelt sind, daß sie geradezu als Aufsicht über die restliche Staatenwelt agieren können. Die USA und ihre Bündnispartner haben sich die Macht und die Freiheit gesichert, ihr nationales Interesse zum gültigen Welt-Recht zu erheben, gegenläufige staatliche Interessen als Rechtsbruch oder sogar staatlichen Terrorismus zu definieren; militärische Auseinandersetzungen zwischen untergeordneten Mächten gelten als „Konflikte“, die von den höheren Gewalten nach deren Gutdünken beaufsichtigt und geregelt werden.[1] Diese eindeutige Machtverteilung garantiert, daß sich die niedere Staatenwelt mit Diplomatie, Kredit, Embargos etc. zu manchem erpressen läßt, und läßt den unmittelbaren Kampfeinsatz von NATO-Soldaten zum Sonderfall des „Ordnens“ werden. So erzeugt das annähernde Gewaltmonopol der NATO den Schein einer sowieso gültigen Ordnung, den man dann sogar Weltfrieden nennen kann. Auf dieser Grundlage können moderne Pazifisten sich glatt einbilden, sie seien „gegen Gewalt“, wenn sie gegenüber unbotmäßigen Souveränen für Aushungern statt für Bomben votieren – als brächten diese menschenfreundlichen Methoden etwas ohne geklärte Machtverhältnisse, und als wäre dem Arsenal der NATO nicht gerade dies zu entnehmen: wieviel kriegerische Gewalt die Idylle des modernen demokratischen Weltfriedens einschließt. Manche kritische Geister wissen aber gar nicht mehr, was sie an den Rüstungsweltmeistern der Allianz und erst recht an der waffenstarrenden deutschen Republik auszusetzen haben sollen, wenn sie nicht erobernd losmarschierten – dabei geht es diesen Staaten gar nicht ums Erobern; schlicht deswegen, weil die Benutzung fremder Länder zum eigenen nationalen Vorteil über das weltweite Regime von Freiheit und Eigentum bewerkstelligt wird und die unerläßliche Kontrolle über den erpresserischen Zugriff auf fremde Souveräne
- Dieser Zweck eint die NATO-Partner und entzweit sie zugleich aufs Heftigste. Mit der Etablierung der NATO-Herrschaft ist nämlich – andererseits – überhaupt nicht geklärt, was jede am Bündnis beteiligte Nation von ihrer Teilhabe daran hat. Hier herrscht Konkurrenz, und zwar in mehrfacher Hinsicht. Erstens konkurrieren die NATO-Partner als Weltwirtschaftsmächte um ökonomische Erträge und stehen sich dabei wechselseitig zunehmend im Weg. Zweitens geht es deshalb jeder Nation darum, sich im Rest der Staatenwelt „Einfluß“ zu sichern, besondere politische Abhängigkeiten und Verbindungen zu schaffen und damit Geschäftsgelegenheiten gegen die Konkurrenz politisch zu monopolisieren. Drittens will deswegen jede NATO-Macht zum einen entscheidend darüber mitbestimmen, wie das Bündnis Freund und Feind definiert und militärisch behandelt; dafür muß sich ein jeder durch seinen militärischen Beitrag zum Bündnis in ihm unverzichtbar machen. Zum andern kennt jede große Mitgliedsnation lebenswichtige Interessen, deren Versicherung durch die Allianz ihr überhaupt nicht genügt, und benötigt deswegen viertens militärische Mittel in rein nationaler Verfügung – Seestreitkräfte oder Atomwaffen oder beides und noch viel mehr, je nach der Vielseitigkeit ihrer Sicherheitsbedürfnisse.
Deutschland leitet aus seinem Anspruch, autonomes und im Bündnis mitbestimmendes Subjekt aller anfallenden Weltordnungsgeschäfte zu sein, einen doppelten Auftrag für sein Militärprogramm ab. Zum einen will es sein Militär weiterhin als wuchtigen Beitrag zur NATO gestalten und ausbauen, um sich der Macht dieses Bündnisses als Mittel seines nationalen Interesses zu versichern. Das verlangt eine Neudefinition der eigenen militärischen Rolle, da der Frontstaatauftrag entfallen ist. Zum anderen kann und will sich die Militärmacht Deutschland nicht mehr darauf verlassen, daß mit einem Militär, das bloß als Beitrag zur NATO auftritt, ihre nationalen Interessen schon gesichert seien. Also forciert sie zugleich – und durchaus im Widerspruch zum ersten Anliegen – das Projekt einer Militärmacht Europa. Das ist etwas größer, aber auch langfristiger gestrickt; es geht darum, sich aus der militärischen und damit weltpolitischen Vorherrschaft der USA zu befreien, ohne auf einen „Alleingang“ zurückgeworfen zu sein. Das Projekt, die halbe Bundeswehr in „Krisenreaktionskräfte“ zu verwandeln, kombiniert beide Vorhaben: Deutsche Soldaten und Waffen müssen jederzeit kriegs- und in aller Welt einsatzfähig sein, wenn Deutschland bei der Feinddefinition und dem Wann, Wo und Wie von Kriegen entscheidend mitreden können und autonom werden will. Aus diesem hohen Anspruch ergibt sich die Sorte Bewaffnung, die Deutschland sich vornimmt.
Die DASA ist in der Realisierung dieser militärisch-politischen Ziele ein Pfund, mit dem Deutschland wuchern kann. In ihr verfügt es über eine nationale Produktionsstätte, die zur Herstellung des modernsten Kriegsgeräts fähig ist, und damit über ein Konkurrenz- und Einflußmittel gegenüber den NATO- wie den europäischen Partnern. Diese Kapazität hat Deutschland allerdings nicht einfach; sie will verteidigt und nach den neuen Maßgaben ausgebaut sein. Darum geht es.
Die politische Ökonomie des Rüstens
Das nötige Kriegsgerät bestellt der weltpolitisch engagierte bürgerliche Staat bei der kapitalistischen Geschäftswelt. Auch bei der Deckung dieses ganz speziellen Bedarfs bricht er nicht mit dem Prinzip, daß in seiner Gesellschaft alles Produzieren Sache privater Unternehmer ist, die dafür ihr Eigentum einsetzen, um es zu vermehren. Seine Rüstung kommandiert der moderne Staat nicht herbei – bzw. nur mit dem ökonomischen Kommandomittel, das er für jedermann in Kraft setzt und verbindlich gemacht hat: Mit Geld. Der Staat zahlt, was er braucht; indem er seine Soldaten bewaffnet, macht er die Gewinnkalkulation kapitalistischer Unternehmer wahr.
Das Geld, das er dafür – wie für alle seine Aufgaben und Vorhaben – braucht, verdient der Staat sich nicht: Er schafft keine Ware, die er sich von seinen Bürgern abkaufen läßt – daß die Ausübung der Regierungskunst eine die Gesellschaft bereichernder Leistung wäre, die mit Abgaben und Gebühren passenderweise versilbert würde, ist bestenfalls eine nette Ideologie, und noch nicht einmal eine besonders ernstgenommene. Mit seiner höchsten Gewalt hat der bürgerliche Staat das produktiv angewandte Privateigentum als einzige Quelle des gesellschaftlichen Reichtums etabliert – das gilt auch dann, wenn ausnahmsweise die Eigentumstitel bei staatlichen Instanzen liegen. Folglich gibt es auch keine anderen Geldquellen als die privaten Einkommen, die durch die produktive Verwendung des Eigentums und in der Zirkulation seiner Produkte gestiftet werden. Denen fügt der Fiskus keine neue Quelle hinzu; er bedient sich vielmehr an den vorhandenen, greift sich bei jedem Zirkulationsakt seinen gesetzlich festgelegten Anteil ab. Er enteignet insoweit anteilig alle, die sich ihr Geld verdienen, indem sie durch den Einsatz ihres Vermögens, managend oder mit der Ableistung von Lohnarbeit am Geschäftsleben, also daran beteiligt sind, Geld zu machen.
Mit diesem Zugriff verstößt der Staat nicht bloß formell gegen den Schutz des Eigentums, dem er doch den Rang eines Grundrechts zuspricht und dem er das Monopol auf die Hervorbringung gesellschaftlichen Reichtums zuweist. Diese Inkonsequenz muß der Staat sich leisten, weil der erfolgreiche staatliche Grundrechtsschutz und die Herrichtung des gesamten regierten Menschenhaufens zu einer marktwirtschaftlich tauglichen Klassengesellschaft nun einmal eine aufwendige Sache ist; und dieser Aufwand vermehrt sich noch darüber, daß die höchste Gewalt in ihrer Eigenschaft als Nationalstaat die von ihr organisierten und ins Recht gesetzten Interessen auch nach außen protegiert, also zu zweckdienlichen Übergriffen auf andere nationale Gesellschaften ermächtigt. Mit dem Einzug von Steuern aus allen verdienten Geldeinkommen beschränkt der Staat seine Gesellschaft auch materiell: Im Maße dieses Abzugs schränkt er ihre Potenz ein – die nun einmal im Privateigentum und sonst nirgends existiert –, Reichtum hervorzubringen und Geldquellen sprudeln zu lassen. Diese Beschränkung ist zwar unumgänglich, insofern sie den Staat befähigt, nützliche Bedingungen für die Produktion und erweiterte Reproduktion kapitalistischen Reichtums zu stiften. Dennoch schmälert sie die Masse Vermögen, die für diese erweiterte Reproduktion zur Verfügung steht, und die Rate, in der das Privateigentum sich im Zuge seiner Reproduktion vergrößert. Weil der Fiskus seinerseits von der Größe und Masse der verdienten Geldeinkommen abhängt, und seine zukünftigen Einnahmen von deren Zunahme, also der möglichst kräftigen Akkumulation des Kapitals im Land, gebietet nicht bloß der Respekt vor dem Privateigentum, sondern staatliche Berechnung Sparsamkeit beim hoheitlichen Geldverbrauch.
Freilich stößt dieser Imperativ seinerseits gleich wieder an Schranken, nämlich in den staatlichen Notwendigkeiten. Und unter denen sind die militärischen allemal die ernstesten. Im Ernstfall jedenfalls sind sie unabweisbar und gehen leicht über das hinaus, was eine kapitalistische Gesellschaft von ihrem wohlverdienten Geld erübrigen kann, ohne an ihrer Akkumulationsrate oder sogar an ihrer einfachen Reproduktion Schaden zu nehmen. Deshalb war hier schon immer im bürgerlichen Staat eine zweite Art fiskalischer Geldbeschaffung am Platz, nämlich das Borgen. Mit Kriegskrediten lassen sich sogar die Mittel und Instrumente für die Massenvernichtung und die Bekämpfung gegnerischer Militärmaschinerien marktwirtschaftlich einkaufen. Ursprünglich war diese Finanzierungsmethode für den Ernstfall reserviert und von dem Bewußtsein begleitet, daß auch dieser Zugriff auf die Geldvermögen und -einkommen der Bürger, der deren Enteignung vermeidet, dennoch die Quelle des kapitalistischen Wachstums, das produktiv verwendete Eigentum angreift. Zu den Früchten des Sieges sollte daher auch stets die Eroberung der Mittel zur Rückzahlung des Ausgeborgten, zur Entschädigung des Privateigentums für seine vorübergehende militärische Zweckentfremdung gehören: Der Verlierer hatte nicht bloß die angerichteten Verwüstungen zu „reparieren“, sondern mit seinen Zahlungen für die Kriegsschulden des Siegers einzustehen.
Von diesem historischen Ausgangspunkt ist das moderne staatliche Geldbeschaffungswesen weit weg. Schulden werden nicht erst im Notfall gemacht, sondern um die Staatstätigkeit ziemlich prinzipiell von den Schranken des gesellschaftlichen Steueraufkommens freizusetzen; deswegen ist die Kreditaufnahme auch nicht mehr auf Tilgung bis zur Schuldenfreiheit des Staatswesens berechnet. Die Kunst des Schuldenmachens ist demgemäß weiterentwickelt worden, nämlich so, daß die Beschaffung von Geldmitteln für den Staat nicht mehr unmittelbar die Masse der Finanzmittel in privater Hand und darüber die gesellschaftliche Potenz zur erweiterten Reproduktion von Geldüberschüssen mindert: Was der Staat sich borgt, fehlt den Geldverdienern nicht, sondern existiert bei ihnen als für Zahlung verwendbarer Vermögensbestandteil, als zirkulationsfähiges Wertpapier. Die Techniken des kapitalistischen Kreditgeschäfts geben das leicht her. Der Kredit trennt ja ohnehin nicht nur das Eigentum als fortdauerndes Recht von seiner geschäftlichen Verwendung durch andere; er läßt auch die geschäftliche Benutzung des bloßen Eigentumstitels zu, so als wäre das verliehene Geld noch verfügbar; er erlaubt die geschäftliche Benutzung zukünftiger Einnahmen, so als wären sie schon vorhandenes und verfügbares Geld; usw. So wirkt der Kredit durchaus geldvermehrend, auch ohne erfolgte Produktion und erfolgreichen Verkauf; und das so leicht und so massiv, daß der Staat als ideeller Gesamtkapitalist um der Seriosität der getätigten Kreditgeschäfte willen allerhand Restriktionen erläßt. Sich selbst als realen Schuldner nimmt er davon freilich aus; schon deswegen, weil er das Geliehene überhaupt nicht für eine eigene Geschäftstätigkeit verwendet, schon gar nicht für eine, deren Ertrag Zinsen und Tilgung abwerfen würde – auch die Ausgaben, die nach der Nomenklatur der Haushaltspolitik „investiv“ heißen, machen die höchste Gewalt nicht zum Warenfabrikanten und Händler, sondern sind purer Konsum. Die Wirkung der staatlichen Verschuldung ist entsprechend. Wo der Staat sich Kredit nimmt, schöpft er Zahlungsfähigkeit; nicht weniger Geld steht für das kapitalistische Geschäftsleben zur Verfügung, sondern immer mehr; fast so, als wären die Mittel zur erweiterten Reproduktion des kapitalistischen Reichtums nicht vom Staat verfrühstückt, sondern durch seinen souveränen Federstrich sogar vermehrt worden die Form des gesellschaftlichen Reichtums, als Geld und Kredit zu existieren, macht’s möglich.
Freilich, die ganze Wahrheit ist das nicht. Denn so sehr die „ungedeckten Wechsel“. die der Staat mit seinen Schuldscheinen ausstellt und ad infinitum prolongiert, echte und unzweifelhafte Zahlungsfähigkeit stiften: Verdientes Geld, neu geschaffener und in Geld realisierter kapitalistischer Reichtum sind sie eben nicht. Und da das ihre Tauglichkeit als Zahlungsmittel nicht beeinträchtigt, rächt sich die kapitalistische Substanzlosigkeit der Kreditzettel, für die der Staat mit seiner Gewalt geradesteht, an dem gesetzlichen Zahlungsmittel überhaupt. Das – Papier- – Geld der Nation repräsentiert unterschiedslos geschaffenen und fingierten Reichtum und taugt deshalb immer weniger als angemessener Wertausdruck der wirklichen Akkumulation. Die allgemeine Freiheit zur Preissteigerung, die die staatlich kreierte Zahlungsfähigkeit eröffnet und die die kapitalistischen Produzenten und Kaufleute ausnutzen, bringt es an den Tag: Die Teuerung wird so allgemein, daß sie das zirkulierende Nationalgeld als aufgeblasene Fiktion entlarvt, nämlich faktisch entwertet. Daß der Staat seinen Kredit nicht nur verkonsumiert, sondern auch noch verzinst, und zwar vermittels zusätzlicher Schulden – so daß in manchen Staatshaushalten der Schuldendienst der einzige Posten bleibt, der noch kräftig wächst –, beschleunigt nicht unerheblich den Zirkel, daß die staatliche Vermehrung der national verfügbaren Finanzmittel deren Wert vermindert. So daß in vielen kapitalistischen Ländern die Lohnarbeiter samt unproduktivem Anhang schon heftig verarmt werden müssen – durch die entsprechende freie Preisgestaltung und durch staatliche Umverteilungsmanöver –, damit wenigstens noch der kapitalistische Reichtum als dauerhafte Einkommensquelle funktioniert…
Ein Konkurrenzproblem haben freilich alle Staaten mit der Entwertung, die sie ihrem nationalen Geld antun; je nachdem eben, wie sie im internationalen Währungsvergleich abschneiden. In dieser schon sehr verwandelten Form macht sich für alle Nationen dann doch die Wahrheit geltend, daß der Staatskonsum die nationale Potenz zur kapitalistischen Akkumulation schmälert, auch dann, wenn er nicht auf dem Wege der fiskalischen Enteignung der geldverdienenden Privateigentümer finanziert wird, sondern mit dem Mittel des Schuldenmachens. Dieses Mittel gehört eben für die gesamte Staatenwelt inzwischen zum festen Repertoire der nationalen Geldbeschaffung, so daß Inflation zur Tagesordnung gehört: Der dauerhafte staatliche Übergriff auf die gesellschaftlichen Reichtumsquellen ist zur allgemeinen Geschäftsbedingung avanciert, mit der die Geschäftswelt ganz gewohnheitsmäßig umgeht.
Diese staatliche Praxis ist gerade im Hinblick auf die ernstesten Ausgaben der Staatsmacht verlangt, die auf keinen Fall einem allgemeinen Spar-Imperativ untergeordnet werden können. Ihren militärischen Bedarf vermögen die maßgeblichen Mitglieder der kapitalistischen Welt schon seit langem nicht mehr mit der Auflegung punktueller Kriegskredite zu finanzieren. Damit war es endgültig vorbei, als sie ihre „Eindämmungs-“ und Konfrontationspolitik gegen den sowjetischen Staatenblock eröffnet haben, die nicht unzutreffend als Kalter Krieg in die Geschichtsbücher eingegangen ist. Das Mittel dieser Politik war nämlich die jederzeit abrufbare Fähigkeit, gewissermaßen aus dem Stand einen auch atomar geführten Weltkrieg erfolgreich zu bestehen – um einen geringeren Preis war die „Abschreckung“, die der vereinigte Westen zur Absicherung seines Weltsystems für unerläßlich hielt, nicht zu haben. Sehr große Armeen mußten da unter Waffen gehalten und mit Vorräten ausgestattet werden, als könnte es jederzeit losgehen. Zum großen Verschleiß durch wirklichen kriegerischen Einsatz der Arsenale kam es zwar nicht – bzw. „nur“ in einer überschaubaren Vielzahl „begrenzter“ Kriege an verschiedenen Nebenschauplätzen. Dafür wurde aber die technische Perfektionierung sämtlicher Waffensysteme in einer Weise zum – vor-kriegerischen – Kampfmittel gemacht, als wäre ein Durchbruch auf diesem Felde, ein qualitativer Vorsprung beim „Wettrüsten“ schon beinahe dasselbe wie der militärische Sieg. Der „moralische“ Verschleiß an Rüstung, nämlich die selbstgeschaffene Notwendigkeit, „Veraltetes“ zu ersetzen, war entsprechend gewaltig und geriet zu einer Last, die bürgerliche Staaten sich sonst nur im wirklichen Ernstfall zumuten – das Rüsten mit der Absicht, den Feind „totrüsten“ zu können, war eben wirklich jahrzehntelang der Ernstfall für die NATO-Alliierten.
Der Ertrag dieses ein halbes Jahrhundert lang jährlich neu aufgelegten regelrechten Kriegskredits ist auch nicht gering zu veranschlagen. Wobei der schließliche friedliche Sieg, den die Gegenseite hergeschenkt hat, gar nicht einmal eindeutig als nützlicher Posten einzuordnen ist; im deutschen Fall wird davon noch zu reden sein. Per „Abschreckung“ gesichert wurde immerhin eine – wenn auch nicht ganz weltweite – „Weltordnung“: ein alle Kontinente umspannendes System kapitalistischer Geschäftemacherei, das der Akkumulation des Reichtums in den maßgeblichen Nationen außerordentlich gut bekommen ist. Mit der Einrichtung des Dings namens Weltmarkt haben sich dem kapitalistischen Eigentum nicht bloß neue Gelegenheiten eröffnet; der Reichtum der meisten Nationen hat Masse und Wachstumsrate des Kapitals der maßgeblichen Welt-Wirtschaftsmächte gestärkt – ein Nutzen, der denkbare Erträge einer regelrechten Eroberung leicht überbieten dürfte.
Einen Haken hat dieser Ertrag allerdings auch: Ihm fehlt die Eindeutigkeit der nationalen Zuordnung, die eine Okkupation sichert. Einmal etabliert, verteilt „der Weltmarkt“ – im Klartext: die globale Konkurrenz der Kapitalisten – den jeweiligen nationalen Anteil am weltweiten Kapitalwachstum keineswegs gemäß der jeweiligen nationalen Anstrengungen zur Sicherung des Systems. Diese beiden Seiten des Imperialismus sind mit der Durchsetzung einer gesamt-„westlichen“ Weltordnung ja gerade gründlich entkoppelt worden: Prinzipiell unabhängig vom Aufwand der einzelnen Staaten zur „Abschreckung“ des Systemfeindes und zur Befriedung des gesamten Staatenensembles konkurrieren die Multis um Marktanteile, die Nationen um nachzählbare, ihnen zurechenbare Anteile am Weltgeschäft. Deren Konkurrenzmittel sind Masse wie Rate der Kapitalakkumulation im eigenen Land – zwei Größen, die ihrerseits vom Rüstungsaufwand der jeweiligen Nation durchaus nicht unberührt bleiben.
Für die Führungsmacht der westlichen Welt sind imperialistischer Aufwand und imperialistischer Ertrag vier Jahrzehnte lang nicht gar so sehr auseinandergelaufen. Nicht nur der Erfolg ihrer Multis, sondern auch ihre Position als Heimat militärischer Sicherheit auf der Welt hat den USA den Kredit der Geldeigentümer aller Nationen eingespielt und über lange Zeit eine gigantische Rüstung bei ungeschmälertem, im Weltvergleich jedenfalls erstklassigem Wachstum des kapitalistischen Reichtums der Nation gestattet. Noch in den 80er Jahren hat der US-Präsident Reagan sich und seinen Staat keineswegs blamiert, als er das aufwendigste Rüstungsprogramm aller Zeiten mit der Stärkung der Wachstumspotenz des geschäftlich tätigen Privateigentums durch Steuersenkungen verband. Der Zufluß von Kredit aus aller Welt hat die Rechnung aufgehen lassen und der Währung, die den größten Schuldenberg aller Zeit repräsentiert, in ihrem Vergleichswert mit anderen Währungen steigen lassen. Überhaupt haben die Geldmärkte Amerikas Sonderstellung als militärische Weltmacht oft genug beglaubigt: Krisen im Ost-West-Verhältnis haben die Konkurrenz der Währungen regelmäßig zugunsten der Weltwährung Dollar zurechtgerückt. Daß die Entfaltung militärischer Macht und der nationale Ertrag des Weltgeschäfts dennoch gar nicht notwendig zusammenfallen, das haben die Konkurrenzhändel zwischen der Führungsmacht und ihren Partnern aber auch immer schon zur Geltung gebracht. Und ausgerechnet der Sieg des von den USA durchgesetzten Weltsystems, das Verschwinden des Feindes, gegen den im Verbund gerüstet wurde, hat die der Führungsmacht vorbehaltene Verknüpfung von militärischer Potenz und ökonomischem Nutzen aufgelöst. Genauer gesagt: Dieses politökonomische „Privileg“ wird der Führungsmacht von ihren Konkurrenten entschieden bestritten. Und zwar doppelt: Die Partner entziehen sich der unbestrittenen militärischen Dominanz der USA, entleeren auf diese Weise den Sonderstatus der „Supermacht“ und konkurrieren in ihrer Eigenschaft als Kapitalstandorte ohne frühere Rücksichten, so daß die nach wie vor größte Militärmacht aus ihrer nach wie vor singulären Weltkriegsfähigkeit und -bereitschaft gar keine singulären Vorteile mehr schlagen kann. Mehr als bisher macht sich im Gegenteil geltend, daß das, was eine Nation sich für Rüstung leistet, ihrem Kredit, dieser ersten und wichtigsten Standortqualität, gar nicht gut bekommt. Auf einmal will jetzt jeder wissen, daß die USA mit ihren Weltmachtambitionen ihre ökonomische Leistungsfähigkeit „überdehnt“ und sich mit dem „Totrüsten“ der Sowjetunion doch zu viel zugemutet hätten. In welchem Maß, das ist am Vergleich der prominenten Weltwährungen abzulesen, an der Währungskonkurrenz gegen die USA, zum Nachteil des in Dollar zirkulierenden und akkumulierenden Reichtums. Wie zur Bestätigung erhebt die US-Regierung anläßlich der neuen militärischen Interventionen, die sie zur Sicherung ihres siegreichen Weltordnungssystems für unerläßlich hält, Anspruch auf unmittelbare finanzielle Vergütung für ihren Friedensdienst durch die nutznießenden Verbündeten – eine „Friedensdividende“ eigener Art, so marktwidrig wie Reparationszahlungen vom Kriegsverlierer und genauso kriegslogisch wie diese. So kommt alle Welt praktisch auf die politökonomische Wahrheit zurück, daß der Staat seine Gesellschaft Geld kostet, auch wo er es vermehrt, und mit seiner global dimensionierten Kriegsrüstung, auch wenn er sie noch so kunstvoll mit Kredit finanziert, seine nationalen Reichtumsquellen überstrapaziert.
Eine Übereinkunft der kapitalistischen Großmächte, beim Rüsten fortan Zurückhaltung zu üben und auf keinen Fall in eine neue Rüstungskonkurrenz einzusteigen, ist darüber freilich nicht zustandekommen. Im Gegenteil: Dem Befund, die USA hätten sich selbst ökonomisch ein wenig „totgerüstet“, folgt auf dem Fuß der Beschluß der wichtigsten europäischen Konkurrenten, ihre eigene ökonomische Ertragskraft zu strapazieren und den USA auf dem Felde der Rüstung Monopole und Vorsprünge streitig zu machen. Kriegstüchtigkeit – nicht mehr, wie bisher, im Bündnis für den west-östlichen Weltkrieg, dafür unter wachsender Betonung europäischer und nationaler Autonomie für absehbare Eingriffe gegen Eigenmächtigkeiten anderer Souveräne – bleibt unabweisbare Staatsaufgabe, über deren Finanzbedarf nur nach Maßgabe ihrer immanenten Erfolgskriterien entschieden werden darf. In dem Maße, in dem die anfallenden Kosten sich angesichts der ökonomischen Konkurrenzlage der Nationen als problematische Last darstellen, werden die Staaten nicht bescheiden, sondern gehen mit dem Willen zur Ökonomisierung ihrer Rüstung in die Offensive.
Die Organisation einer nationalen Rüstungsindustrie
Die kapitalistischen Führungsnationen unterhalten nicht bloß schlecht und recht ein stehendes Heer. Sie benötigen die Fähigkeit, erstens weltweit, zweitens jederzeit aus dem Stand, drittens mit fragloser Überlegenheit militärisch einzugreifen. Die beträchtlichen Unkosten dafür sind ein ebenso gewaltiger wie dauerhafter Ausgabeposten. Weil an der Last, die damit dem staatlichen Haushalt aufgebürdet ist, so wenig haushälterisch zu mindern geht[2], setzt sich der ideelle Gesamtkapitalist das Ziel, sie ökonomisch produktiv zu machen: Er benutzt das viele Geld, das er sich seine Macht kosten läßt, um seiner Nationalökonomie die Rüstungsproduktion als Branche, als gewichtigen eigenen Geschäftszweig zu implantieren und einen volkswirtschaftlichen Beitrag, eine blühende Abteilung nationaler Profitmacherei daraus zu machen.
Staatshaushalt und Monopol
Die Güter, die der Staat zur Erledigung seines militärischen Auftrags haben will, entnimmt er nicht dem allgemeinen Fundus an Waren, die seine Geschäftswelt zwecks Realisierung ihres Werts auf privaten Märkten produziert. Der Staat ist der einzige Nachfrager nach Rüstungsgut; seine Nachfrage stiftet überhaupt erst das Kapital, das sie bedient und an ihr verdient, und definiert damit Mittel und Bedingungen des Geschäfts in dieser Sphäre.
Erstens kommt es dem Staat beim Einkauf von Waffen auf deren nützliche Eigenschaften an, und zwar unabhängig davon, was deren Herstellung kostet; an deren unzweifelhaft verläßlichem Gebrauch hängt schließlich die Erfüllung seines militärischen Programms. Deshalb verlangt er für seine Rüstungsgüter immer das Beste. Hier gilt tatsächlich einmal das Interesse an „Technik“ sans phrase: Forschung und Produktentwicklung hat ein Rüstungskapital im Dienste waffentechnologischen Vorsprungs zu betreiben; welche Rohstoffe und Materialien es einkauft und wie es diese verarbeitet, hat sich an deren Nützlichkeit für die Waffenqualität zu entscheiden. Zweitens bestimmt der Staat mit seiner Nachfrage auch über den Umfang der Produktionskapazitäten in dieser Sphäre. Wann und in welchem Umfang Aufträge anfallen, hängt von den Konjunkturen des nationalen Interesses und der internationalen Kräfteverhältnisse ab; zugleich legt der Staat Wert darauf, daß einmal eingerichtete Kapazitäten auch dauerhaft und jenseits eines aktuellen Bedarfs erhalten bleiben. Drittens schließlich kennt das staatliche Interesse an bester Qualität zum jeweils passenden Zeitpunkt zu seiner national dienlichen Verwirklichung noch eine weitere Bedingung: Seine souveräne Verfügung über die nötigen Entwicklungs- und Produktionskapazitäten ist nur gegeben, wenn diese auch ihren Standort in wesentlichen Abteilungen auf dem eigenen Territorium haben.
Dem Kapital, das diese staatlichen Exklusivansprüche an Qualität, Verfügbarkeit und Produktionsstandort als Geschäftsmittel benutzt, ist eine Sonderstellung in der kapitalistischen Konkurrenz eingeräumt, die eines Monopols. Als vom Staat beauftragter Lieferant muß es sich in seiner eigenen Sphäre mit keiner Konkurrenz um einen Markt streiten. Was der staatliche Abnehmer an Produktqualität und -quantität verlangt, bezahlt er auch; also muß das Kapital seine Kosten und Preise nicht nach Maßgabe der üblichen, von der Konkurrenz um beschränkte Zahlungsfähigkeit erzwungenen Preis-Leistungsabwägungen kalkulieren. Der Umfang des Absatzes steht fest; das Rüstungskapital konkurriert also auch nicht mit anderen Produktionssphären um einen Anteil an der gesamten gesellschaftlichen Zahlungsfähigkeit, sondern hat exklusiv Zugriff auf das Geld, das der Staat für Rüstung einplant. Damit ist dem Rüstungskapital der Freibrief erteilt, alle staatlichen Ansprüche an das Rüstungsgut als Kostengrößen zu veranschlagen, die dem Auftraggeber in Rechnung gestellt werden und ein Recht auf Profit begründen. Der Kapitalvorschuß dieses Unternehmens ist damit politisch definiertes und lizenziertes Gewinnmittel; jenseits von Geschäftskonjunkturen und Sphärenwechsel verfügt es in seiner Anlage über eine gesicherte Verdienstquelle. Das ist der Preis, den der Staat dafür zahlt, daß er sein Rüstungsgut auf jeden Fall bekommt.
Daß er nicht zuviel dafür bezahlt, steht damit als besondere neue Aufgabe der Haushaltspolitik fest. Indem er nämlich sein Ideal, die Kriegsproduktion als ganz normales kapitalistisches Geschäft zu organisieren, in Gestalt von Rüstungsmonopolen realisiert, verschafft der kapitalistische Militärstaat sich die Notwendigkeit und seinen Haushaltsexperten den Auftrag, auf die Rüstungsausgaben aufzupassen; sparsame Verwendung der Mittel ist auch hier das Gebot, wenn einmal feststeht, wofür sie verausgabt werden müssen. Die staatlichen Rüstungsökonomen verlassen sich keineswegs darauf, daß die Interessen von Staat und Kapital hier nahtlos aufeinanderpassen. Mit dem eingeräumten Recht, das politische Interesse am Rüstungsgut zum Gewinnmittel zu machen, handelt sich das Rüstungskapital den im Standpunkt des Haushalts institutionalisierten Verdacht ein, es würde seine Auftraggeber über das gebotene Maß hinaus zur Kasse bitten wollen – ein Verdacht, der ebenso begründet wie haltlos ist, weil es ein ökonomisches Preismaß für diese Produkte eben nicht gibt. Also wird die Preisfindung im Rüstungsbereich nicht den Kalkulationen des Geschäfts überlassen, sondern kommt als Ergebnis eines Schachers zwischen Auftraggeber und Produzent zustande. An die Stelle des durch die Konkurrenz exekutierten Zwangs, Kosten, Preise und Kapazitäten an Marktlagen anzupassen, tritt der hoheitliche Anspruch ans Kapital, seine „Preisvorstellungen“ zu begründen, also mit dem nachweislichen Aufwand und der erbrachten Leistung zu rechtfertigen. Zur Kontrolle werden dem Rüstungskapital staatliche Aufpasser in die Buchführungsabteilungen gesetzt; es werden Margen für „erlaubte“ Preissteigerungen in der Zeit festgelegt (die hier einmal Geld bringt, statt welches zu kosten); sofern es die nationale industrielle Basis erlaubt, werden Rüstungsaufträge auch ausgeschrieben und mehrere Angebote eingeholt – so wird Konkurrenz fingiert und das Interesse des Kapitals an Kostensenkung politisch angeheizt.
Der Weltmarkt als Hebel der Ökonomisierung
Fiskalische Pfennigfuchserei muß zwar sein, damit der Staat nur das wirklich Nötige für seine Militärgüter ausgibt. Vom Standpunkt des Haushalts aus betrachtet heißt das aber nur, daß dessen Belastung nicht größer ausfällt, als sie eben sein muß; ein Hebel zur dauerhaften, echten Entlastung der Staatsfinanzen erwächst daraus nicht. Moderne Weltmarktmächte ziehen aus dieser Sachlage den passenden Schluß. Sie nehmen alles, was an nationaler Rüstungsproduktion durch ihre Einkäufe zustandegekommen ist, von ihrem Haushalt lebt und mit ihrem Kredit sein Geschäft macht, als Potenz zur Eroberung von Anteilen am Weltmarkt in Anspruch. Aus der Waffenproduktion soll eine nationale Wachstumsbranche werden; und zwar eine, deren Expansion nur zum kleinsten Teil aus dem eigenen Finanzaufkommen, also durch Strapazierung des eigenen Kredits bezahlt, für die vielmehr die Finanzkraft auswärtiger Kunden ausgenutzt werden soll.
Rüstungsexport
ist daher das erste und oberste Gebot – durchaus abweichend vom sonst gültigen staatlichen Standpunkt, der kostensenkenden Import und gewinnbringenden Export gleichermaßen als Mittel nationalen Wachstums schätzt. Wenn es gelingt, andere Staaten einseitig zu Kunden der heimischen Rüstungsindustrie zu machen, dann nützt das nämlich erstens der Ertragskraft und Größe des darin engagierten Kapitals, somit der Fortentwicklung dieses Geschäftszweigs, der Reichweite dessen, was er kann, der Vielfalt und Qualität der Produkte, die er zustandebringt; und zwar über das aus dem eigenen Haushalt Bezahlte hinaus – was sich auch umgekehrt so ansehen läßt, daß der Staatshaushalt Entwicklungs-, Stück- und sonstige, überhaupt: Kosten sparen kann. Ob das Ganze dadurch billiger kommt, als wenn das nationale Militär sich seinen Bedarf seinerseits weltweit beim billigsten Anbieter zusammenkaufen würde, darf bezweifelt werden, ist aber auch gar nicht die Frage – nationale Behörden, die pflichtgemäß aus Haushaltsgründen gelegentlich für Import statt Eigenbau plädieren, erfassen bloß den Kostengesichtspunkt, der mit der Einrichtung eines einheimischen Rüstungsgewerbes und der Entdeckung des Exports als Mittel seiner für den Auftraggeber wohlfeilen Vergrößerung prinzipiell überwunden ist. Da geht es eben darum, nicht Haushaltsmittel überhaupt einzusparen, sondern im Verhältnis zur Größe und Leistungsfähigkeit der Monopole, die sich um die militärische Hardware kümmern und konkurrenzlos gut werden sollen, weil das ihren Auftraggeber in der Konkurrenz der Mächte gut dastehen läßt. Auswärtige Einkäufer heimischer Rüstung verbessern dieses Verhältnis zwischen dem Aufwand an Haushaltsmitteln und dem Ertrag an Rüstungspotenz – und leisten damit gleich auch noch einen zweiten Dienst, nämlich einen guten an den nationalen Außenhandelsbilanzen.
Im Export, und nur da, gelingt es also dem Rüstungsgewerbe, seinen politökonomisch unerfreulichen Charakter als bloßer kapitalistischer Kostgänger des verstaatlichten Reichtums bzw. als monopolistischer Großverbraucher staatlichen Kredits zu bessern: Sobald seine Ware die Grenze überschreitet, verdient sie das Weltgeld anderer, zieht zusätzlichen Reichtum ins Land, statt immer bloß die leibhaftige Vernichtung nationaler Akkumulationspotenzen zu sein. Während eigener Rüstungskonsum die Nation immer bloß ärmer macht, wird sie durch den Rüstungsbedarf anderer Staaten, den diese bei ihr decken, tatsächlich reicher. Umgekehrt wird durch Rüstungsimporte nicht bloß der unproduktiv verausgabte Staatskredit aufgebläht, sondern auswärtigen Gläubigern ein Recht auf wirklichen, in Weltgeld gemessenen nationalen Reichtum eingeräumt. An der Oberfläche des internationalen Geschäftslebens stellen sich diese Effekte so dar, daß die Käufernation ihre Staatsschulden und ihre Auslandsverbindlichkeiten vergrößert, ohne ihr inländisches Bruttosozialprodukt zu mehren. Dagegen kehrt der Kreditverbrauch der Exportnation in der volkswirtschaftlichen Rechnung als Beitrag zum inländischen Wachstum wieder – was zwar genauso absurd ist wie die gleichartige Verbuchung des Kanzlergehalts oder eines Brandschadens; in dieser absurden Form ist aber festgehalten, daß die „faux frais“ der Nation, ihre unproduktiven Aufwendungen für Militärisches, nicht auch noch echt verdienten heimischen Reichtum ins Ausland transferieren –, und außerdem gibt es wieder einmal einen Außenbeitrag zur Inlandskonjunktur zu notieren.
So wird also staatlicher Militaria-Konsum zur national lohnenden Kapitalanlagesphäre: Rüstungsexport ist die eine Methode. Der andere Weg zur kapitalistischen Ökonomisierung die Finanzlast imperialistischer Macht besteht darin, dem Rüstungskapital ein
Ziviles Standbein
zu verschaffen. Die Potenzen kapitalistischen Produzierens, die der Staat mit seinem Rüstungskapital stiftet, sind nämlich noch zu anderen Geschäften brauchbar als bloß zur Produktion von Waffen; das ergibt sich schon aus den Anforderungen an Technologie und Qualität, die der Staat an die für ihn bestimmten Produkte stellt. Die zu deren Herstellung nötigen, modernsten Produktionsmittel sind vielfacher Verwendung fähig; vor allem sind sie aber auch selbst gefragte Produkte, die sich in allen Sphären der Kapitalakkumulation einsetzen lassen. Also läßt sich mit solchen Produkten das Geld unternehmungsfreudiger Kapitalisten verdienen und auch auswärtige Zahlungsfähigkeit in weitaus größerem Umfang mit Beschlag belegen, als dies beim Zugriff „bloß“ auf fremde Rüstungshaushalte der Fall ist.
Diese Weltmarkt-Zahlungsfähigkeit hat der nationale Hüter einer fortgeschrittenen Rüstungsproduktion im Auge, wenn er diese zu einer High-Tech-Unternehmung hochprotegiert. Dem Rüstungskapital wird mit solcher staatlicher Unterstützung ein Wechsel der Anlagesphäre ermöglicht; es soll in der Lage sein, sich am gesamten Spektrum der Weltmarktnachfrage nach moderner Technologie gewinnbringend zu bedienen. Die ökonomisierende Wirkung auf die nationale Bilanz und den Rüstungshaushalt, die der Staat sich von einer solchen Geschäftsausweitung verspricht, ist entsprechend anspruchsvoll: Die vom Staat gestifteten zivilen Produktionspotenzen des Rüstungskapitals sollen diesem Einnahmequellen eröffnen, die ihm – jedenfalls in Teilen seines Geschäfts – ein vom Staatshaushalt unabhängiges, ganz und gar geschäftsmäßig „am Markt“ zustandekommendes Wachstum sichern. Die Rüstungsproduktion soll in ein aus sich heraus unschlagbares Weltgeschäft eingebettet werden; und der staatliche Kredit für Rüstung soll als Bestandteil einer allgemeinen High-Tech-Förderung die nationale Akkumulation und die Eroberung auswärtiger Zahlungsfähigkeit ebenso allgemein befördern. Indem die ganz unökonomisch begründeten Ausgaben fürs Militär als Wirtschaftsförderung verausgabt werden, soll deren Qualität als nationale Kost zur kredit- wie haushaltsmäßig leicht zu bewältigenden Nebenwirkung einer insgesamt günstigen Hauptwirkung aufs Wirtschaftswachstum herabgesetzt sein.
Schon wieder darf also nicht gespart werden – es geht ja darum, das eigene Rüstungskapital als High-Tech-Produzent im Weltmaßstab konkurrenzfähig zu machen, also in der Konkurrenz gegen andere gleicher Art obsiegen zu lassen. Das staatliche Interesse an der national ertragreichen Vermarktung solcher Produkte gebietet die politische Betreuung von deren Zustandekommen und Verkauf, was bei der Subventionierung der Produktion anfängt und bei der staatlich sollizitierten Kreditvergabe an prospektive Käufer nicht aufhört. Schließlich handelt es sich bei diesen feinen Waren anerkanntermaßen um „Schlüsseltechnologien“; also um Produktionsmittel, von deren Besitz heutzutage die Konkurrenzfähigkeit kapitalistischer Unternehmen und ganzer Nationen in Sachen Kostensenkung, Produktentwicklung usw. abhängt – für Staaten, die auf alle Fälle Macher des Weltmarkts und nicht Betroffene des kapitalistischen Fortschritts sein wollen, ein ganz eigenständiger Grund – noch jenseits ihres Interesses an Rüstung –, auch hier auf Eigenbau statt Einkauf zu setzen.
Rüstung – ein Standortbeitrag
Mit dem Aufstieg der Rüstungsproduktion zur High-Tech-Industrie verwischen sich die Trennungslinien zwischen dieser Sphäre und ganz normaler, durch die gesellschaftliche Nachfrage nach Konsum- und Produktionsmitteln gestifteter Kapitalanlage. Nicht nur ist das Geschäft mit dem Militärgut selbst im Maße seiner Ausweitung zum integralen Bestandteil nationaler Produktion gemacht und in Gestalt von Großfirmen und tausendfachen Zulieferindustrien in die nationale Akkumulation eingebaut; als High-Tech-Produzent wird es darüber hinaus zum allgemeinen nationalen Wachstumsfaktor. Nach Maßgabe dessen, wie dessen Weltgeschäft gelingt, trägt es tatsächlich zur Verbesserung der nationalen Bilanz und zur Stärkung der nationalen Kreditwürdigkeit bei; und die schiere Größe der hier gestifteten Kapitale bringt es mit sich, daß dieser Beitrag für die nationale Produktion, für die Akkumulation, für Exporterfolge und Härte der nationalen Währung ziemlich entscheidend wird.
Mit dem Aufstieg der Rüstungsproduktion zur High-Tech-Industrie ist also zugleich klar, daß von einem bloßen Bestandteil der nationalen Industrie, einer Branche unter anderen nicht die Rede sein kann. Das Gelingen des Geschäfts mit Rüstungs- und High-Tech-Export hat national oberste Priorität und genießt vornehmlichste Unterstützung. Aus einem einfachen Grund: Weil davon soviel auf Staatskredit läuft, sind die Rechnungen der Nation von den Erfolgen dieser Industrie in entscheidender Weise abhängig, von ihren Mißerfolgen ganz besonders betroffen.
Die militärpolitische Seite: Rüstungskonkurrenz im Bündnis
Kalkulationen mit einem politischen Produkt
Das Rüstungskapital macht sein Geschäft mit einem durch und durch politischen Produkt: Es geht um die Ausstattung der Staatsmacht für den im Prinzip immer präsenten Ernstfall. Also sorgt der Staat auch dafür, daß sein Interesse an diesen Geschäftsartikeln für den Geschäftsverlauf, für Umschlag und Verwertung des Kapitals bestimmend bleibt. Wenn er Rüstungskonzerne schafft, sie mit seinem Kredit unterhält und ihnen den Weltmarkt zur geschäftsmäßigen Nutzung eröffnet, erteilt er ihnen keineswegs die Freiheit, sich dort wie ein ganz normaler Multi aufzuführen, der verkauft, was und an wen er will, und alle Nationen als Märkte und Standorte durchkalkuliert.
Rüstungsexport als Teil der Militärpolitik
Der Rüstungsexport wird zum profitablen Geschäftszweig größeren Ausmaßes überhaupt nur durch die Protektion des politischen Souveräns; von dessen Kalkulationen und Rücksichten hängt sein Verlauf damit auch ab; und diese sind keineswegs bloß, noch nicht einmal vorrangig ökonomischer Art. Die zum Verkauf stehenden Waren sind Mittel staatlicher Souveränität; deshalb behält der Staat auch die Hand darauf, welchen Staaten seine Kapitalisten welche Produkte zu welchen Konditionen liefern dürfen. Für ihn sind die Kapazitäten und technologischen Fähigkeiten seiner Rüstungsindustrie ein Mittel, politischen Einfluß auf andere Staaten zu gewinnen, die es dazu nicht im gleichen Maße bringen, und – weil alle modernen Militärmächte so verfahren – ein wesentliches Mittel der imperialistischen Konkurrenz. Sein Einsatz ist deshalb Gegenstand der Militärdiplomatie. Das Interesse, fremde Staaten im letzten und entscheidenden Rückhalt ihrer Souveränität von eigenen Machtmitteln abhängig zu machen – und deren Staatshaushalte als Einnahmequelle zu nutzen –, muß gegen das Bedenken abgewogen werden, ob damit nicht falschen Herrschern eine viel zu souveräne Handlungsfreiheit gewährt wird. Dabei tritt der exportierende Staat in Konkurrenz zu anderen Gewalten mit gleichlautenden ökonomischen wie politischen Interessen, was das Interesse am Export anheizt – falsche Bedenklichkeiten würden der Konkurrenz ja nur in die Hände spielen. Mit allzugroßer Freizügigkeit kann sich die Nation aber auch Ärger einhandeln, insbesondere den mächtiger Bündnispartner. Da ist mehr als Verkaufsgeschick gefragt, und da können auch Fehler passieren.
Auf jeden Fall entscheidet sich das Zustandekommen solcher Geschäfte nicht einfach nach Gründen des Geldbedarfs – weder dem der Nation noch dem des Rüstungskapitals. Weil alle diese einander widersprechenden Gesichtspunkte gelten, kommt es zu eigenartigen Formen der Geschäftsabwicklung. Da läuft manches hochoffiziell und gleichzeitig geheim; den Konkurrenten bzw. der Aufsichtsmacht bleibt es anheimgestellt, sich mit dieser Rücksichtnahme auf die diplomatische Form zufriedenzugeben oder sie auffliegen zu lassen. Auch illegal läuft manches, politisch geduldet, aber auch ganz unerwünscht. Deshalb gibt es ein Außenwirtschaftsgesetz, das die Ahndung solcher Verstöße regelt, und viel Gelegenheit zu politischem Getöse einer empörten Öffentlichkeit. Mancher gute Bürger findet sich unversehens als Verbrecher wieder, wenn politische Konjunkturen sich ändern und, was jahrelang als harmloses Pflanzenschutzmittel durchging, von einer höheren Macht als Giftgas identifiziert wird.
Das zivile Standbein als außenpolitisches Macht- und Einflußmittel
Das Geschäft mit unmilitärischen Gütern, mit dem tatkräftige Rüstungsmonopole sich in die erlesensten Sektoren des Welt-Warenmarkts einschalten, bleibt von den politischen Interessen und Vorbehalten, die dem Rüstungsexport gelten, nicht unberührt: Die Ökonomisierung der nationalen Rüstungsproduktion führt zu einer gründlichen Politisierung des Außenhandels. Schon der zivile Charakter der Handelsware wird zur Interpretationsfrage, die zwischen den Konkurrenten öfters strittig bleibt. Der Unterschied zwischen „militärischen“ und „zivilen“ Märkten löst sich darüber überhaupt weitgehend auf: Harmlose Produkte wie Computer oder Chips avancieren zum „strategischen Gut“, weil sie sich auch zur Herstellung von Raketen verwenden lassen; ein Sachverhalt, der sich bei Bedarf auch umgekehrt lesen läßt: Was soll an diesen Dingern noch „militärisch“ sein, wenn sie sowieso überall Verwendung finden? Das gibt interessante Fragen für Rüstungsexportkontrolleure und neue Streitpunkte zwischen den Partnern der westlichen Wertegemeinschaft; z.B. wenn ein amerikanischer Präsident aus Geschäftsgründen Computerverkäufe an China freigibt, die andere Politiker aus Aufsichts- und Kontrollgründen ablehnen; ganz zu schweigen von den Abgründen des internationalen Kerntechnologiegeschäfts.[3] Jeder Konkurrent weiß vom anderen, daß die Beförderung des High-Tech-Exports ein Mittel zur Subventionierung der Rüstungsindustrie ist und umgekehrt; so daß nicht erst dann häßliche Worte fallen, wenn die Konkurrenz Militärflieger nach Taiwan liefert. Mancher kapitalistisch schon gedeichselte Geschäftsabschluß scheitert so am Ende doch noch am Einspruch der politischen Aufsicht wegen eigener oder übermächtiger fremder Embargo-Gesichtspunkte.
Die politische Betreuung des Rüstungskapitals: Mehr als bloß Standortpolitik
Die Internationalisierung der Profitquellen des Rüstungskapitals ist als dessen Beitrag zur nationalen Bilanz gewollt; als Produzent der nationalen Machtmittel aber hat dasselbe Kapital durch und durch national zu bleiben und seine Geschäftsinteressen den diesbezüglichen Kalkulationen der Nation unterzuordnen. Die politisch gewollte Erschließung neuer Märkte schließt nicht die Freiheit fürs Kapital ein, die Sphäre ganz zu wechseln und aus der Rüstungsproduktion einfach auszusteigen, wenn an anderen Produkten mehr zu verdienen ist als an Militärfliegern. Das Interesse an auswärtigen Märkten hat nicht so weit zu gehen, daß das Kapital in der Standortfrage vaterlandslos wird und auswärtige Produktionsorte höher schätzt als die Heimat. Werksschließungen und Produktionsverlagerungen ins Ausland unterliegen politischer Überprüfung unter dem Gesichtspunkt, inwieweit solche Mittel des Konzernprofits die territoriale Verankerung von Rüstungskapazitäten angreifen. Umgekehrt gebieten gelegentlich militärische Überlegungen industrielle Standortentscheidungen, die rein ökonomisch gar nicht naheliegen: Wenn ein ganzes Nordmeer als militärisches Aufsichtsproblem neu hinzukommt zum nationalen Aufgabenkatalog, dann muß auch an dessen Küste auf Staatskosten eine Werft entstehen; die geschäftsschädigenden Folgen für die restliche nationale Werftindustrie werden in Kauf genommen und irgendwie ausgebügelt.
Staat und Rüstungskapital – ein kritischer Dialog in konstruktiver Absicht
Vom übergeordneten Standpunkt der Sicherung nationaler Produktionspotenzen modifiziert der Staat immerzu die Gewinn- und Verlust-Rechnungen seines Rüstungskapitals; sein Kredit bleibt deshalb auch als letztes Garantiemittel des Geschäfts gefordert. Rüstungsstandortpolitiker wissen, daß das Kapital sich bei der Übersetzung aller staatlichen Ansprüche und Angebote in Kosten, die Profit zu bringen haben, verrechnen kann; und sie wissen auch, daß ihre eigenen, ganz unökonomischen Berechnungen den Grund dafür abgeben, daß manches Geschäft hier nicht so läuft wie geplant. Also stehen sie im Dauerdialog mit ihren Rüstungskapitalisten in der Frage, wie der lohnende Geschäftsverlauf jeweils mit den staatlichen Ansprüchen kompatibel zu machen sei. Ihre Dialogpartner von den Kapitalseite wissen ihrerseits ihr Geschäft als eines, das nicht bloß überhaupt zum nationalen Wachstum beiträgt, sondern für das Gelingen einer unbedingt gültigen nationalen Sache die geschäftliche Verantwortung trägt. Aus diesem Dienst leiten Rüstungsmanager ein Mitspracherecht bei der Festlegung dessen ab, was sie wann und wie zu produzieren haben, und fordern von ihrem Auftraggeber, im Dienst ihrer Kalkulation für Kapazitätsauslastung und Planungssicherheit zu sorgen. Als intime Kenner der staatlichen Auftragslage fühlen sie sich durchaus auch berufen, in Eigeninitiative Vorschläge und Entwicklungen für neues Gerät einzubringen, selbstverständlich mit der Absicht, damit neue Forschungsgelder und Aufträge an Land zu ziehen – eine Strategie, mit der sie im Prinzip nie falsch liegen. Daß sie sich zu diesem Zweck auch in die Politik einmischen und als Experten ihren Senf zu nationalen Bedrohungslagen- und Beschaffungsdebatten dazugeben, versteht sich von selbst; vom Ausgang solcher Debatten hängen schließlich ihre Geschäftskalkulationen ab.
Rüstungskritiker erheben gegen solche Gepflogenheiten gerne den Vorwurf, das Rüstungskapital würde den Staatshaushalt als „Selbstbedienungsladen“ benutzen, den Staat zu unsinnigen Rüstungsausgaben veranlassen und aus eigensüchtigem Profitinteresse (böse) die souveräne staatliche Entscheidung über das politisch-militärisch Nötige (gut) beeinträchtigen. Aber auch die umgekehrte Klage wird laut: Daß der Staat (in diesem Falle: böse) bei seiner Auftragsvergabe keine Rücksicht nehme auf Arbeitsplätze und Region, die doch von der Auftragslage der (in diesem Falle lieber unter High-Tech geführten) Rüstungsindustrie abhängig sind, also seine Sorgfaltspflicht gegenüber dem Geschäft des Unternehmens (in diesem Falle: gut) verletze. Daß Rüstungs- und Beschaffungspolitik als Kungelei zwischen Ministerpräsidenten, Verteidigungsministern und Konzernvorständen stattfindet, stimmt; diese Kungelei führt auch zu Ergebnissen, die manchem Landesvater und seinen Rüstungsbetriebsräten nicht gefallen. Die moralische Bewertung dieser Sachverhalte geht allerdings an der Sache vorbei. Erstens gehören zum Erpressen immer zwei; zweitens aber handelt es sich beim Verhältnis zwischen Rüstungskapital und Staat weder in der einen noch in der anderen Richtung um Erpressung. Mit seinen ökonomischen Argumenten und technologischen Angeboten liegt das Rüstungskapital grundsätzlich allemal richtig. Wenn umgekehrt der Staat mit seiner Förderung des Rüstungsgeschäfts ganze Regionen von dessen Fortgang abhängig macht, dann hat das nichts mit einem Versprechen zu tun, immerzu genau das Zeug weiterproduzieren zu lassen, mit dem dort gerade ein Geschäft gemacht wird; ganz zu schweigen von der Garantie irgendwelcher „Lebensinteressen“.
Rüstung im Bündnis
NATO-Vorbehalt stiftet Planungssicherheit
Die politische Definition des nationalen Rüstungsbedarfs, der haushaltspolitische Umgang mit den dafür nötigen Kosten, die Gesichtspunkte erlaubten und verbotenen Rüstungsexports, die Instrumentalisierung der nationalen Rüstungsindustrie als ‚Motor‘ des Standortwachstums, last not least der Umgang mit den Wirkungen all dieser Kalkulationen auf den nationalen Kredit – all dies war im NATO-Bündnis alter Weltordnung dem gemeinsamen militärischen Auftrag subsumiert. Die sich aus diesen disparaten Gesichtspunkten ergebenden nationalen Konkurrenzinteressen waren als Bündnisproblem geregelt, also bei aller Gegensätzlichkeit einem letztlichen Einigungszwang unterworfen. Was jede NATO-Macht bei sich produzierte, ergab sich aus dem geplanten Krieg gegen die UdSSR und einer darauf berechneten „Arbeitsteilung“ – abgesehen von dem, was die meisten Mitglieder daneben noch für ihre nationalen Sonderinteressen für nötig hielten. Was ihr Bündnisbeitrag sie kostete, war wiederum Gegenstand politischer Abmachungen, die jede Nation dazu verpflichteten, einen bestimmten Prozentsatz ihres Haushalts fürs Rüsten zu benutzen. Rüstungsexport wurde – in gebremster Konkurrenz zueinander – nach Maßgabe der Hauptkampflinie erlaubt und verboten; die gebotenen Rücksichtnahmen und Berechnungen waren bündnispolitisch institutionalisiert und bewacht. Die Konkurrenz mittels High-Tech war in einer Richtung gebremst – dafür stand die COCOM-Liste, die keineswegs nur Militärgüter umschloß –, ansonsten freigesetzt.
Kooperation bei der Rüstungsproduktion in und für Europa
Aus dieser besonderen Konkurrenzlage erwuchs bei den europäischen Nationen das Projekt der europäischen Rüstungskooperation. Für die gab es gute Argumente. Erstens stand zwar fest, welchem Zweck der Gesamt-Rüstungsbedarf des Bündnisses zu widmen war; keineswegs aber, welche Waffensysteme zu jedem Zeitpunkt anzuschaffen waren. Um sich da größere Mitsprache, aber auch ein Stück militärpolitischer Unabhängigkeit von den USA zu sichern, war eine eigene Rüstungsproduktion ein nützlicher Hebel. Daß diese im wesentlichen europäisch und nicht national zu sein habe, ließen die europäischen Nationen sich deshalb einleuchten, weil man sich damit gemeinsam der ökonomischen Potenz des gesamten Europa – das als Wirtschaftsunion ohnehin in Arbeit war – als Basis der Konkurrenzbemühungen gegen die USA versicherte. Die europäische Fähigkeit zur Eigenproduktion – dafür stand ehedem der Ersatz des Starfighter durch den Tornado – entlastete zweitens die europäischen Bilanzen und verwandelte einen Abzug aus den nationalen Kassen in einen Hebel europäischen Wachstums. Deshalb war die eigene Waffenproduktion drittens gleich als ein Konkurrenzmittel gegen die USA auf Drittmärkten geplant, mit dem der europäische Kredit gegen den Dollar zu stärken war. Diesem Zweck diente nicht zuletzt auch das europäische Airbus-Projekt: Europa hat es sich nicht nehmen lassen, seine Luft- und Raumfahrtindustrie gleich als Einheit von Militär- und Zivilproduktion zu organisieren, der außer der Produktion von Tornados, Helikoptern usw. der Auftrag erteilt war, das amerikanische Weltmarktmonopol für Zivilflieger zu brechen.
Zur Verwirklichung dieser vielfältigen Absichten schufen sich die europäischen NATO-Staaten eine gemeinsame militärtechnologische Basis und gaben damit der Konkurrenz der nationalen Rüstungsambitionen im Bündnis eine neue Verlaufsform. Für die Kooperationsprojekte fungieren die nationalen Rüstungsetats als gemeinsam zu nutzender Finanz-„Topf“; im selben Umfang haben die europäischen Kooperationspartner damit auch die Erträge, die sie voneinander aus dem wechselseitigen Rüstungsexport erwirtschaften, vergemeinschaftet. Die Verteilung von Nutzen und Lasten der gemeinsamen Projekte erfolgt mithilfe eines Systems von Quoten, mit dem die Partnerländer Produktionsanteile und Kosten unter sich aufteilen. Das Recht, die gemeinsame Rüstungsproduktion als Mittel des eigenen Standorts mit Beschlag zu belegen, erwirbt sich jede europäische Nation, indem sie sich in gleichem prozentualen Anteil an den Kosten für die Gesamtproduktion beteiligt. So kommt es zu Vorteils-Nachteils-Rechnungen neuen Typs: Jede an der Kooperation beteiligte Nation kalkuliert für ihren militärischen und rüstungsindustriellen Bedarf die Partner im Umfang ihrer Finanzbeiträge als ihr Mittel ein, nämlich als sichere Abnehmer und somit wichtige Stütze der eigenen Rüstungsproduktion. Die dafür aufgebaute Industrie ist für alle beteiligten Staaten ein Mittel, sich in der Rüstungskooperation unentbehrlich zu machen und gemeinsam in der Weltmarktkonkurrenz durchzusetzen. Das Quotensystem setzt beide Rechnungen ins Recht und stellt damit sicher, daß diejenige Nation, die sich kreditmäßig am meisten leisten kann und will, sich auch den größten Zugriff auf die gemeinschaftlich organisierten Militärpotenzen verschafft. Beschlußfassung und Durchführung der gemeinsamen Projekte finden daher als unaufhörliches Gefeilsche um Systementscheidungs- und Exportrechte, Produktionsstandorte und Kostenverteilung statt. Gerechter geht’s nimmer.
Deutsche Rechnungen im Bündnis
Die nationale Rüstungsproduktion der europäischen NATO-Staaten ist durch ihre Kooperationsprojekte in großen Teilen entnationalisiert. Nämlich in dem Sinne, daß die Entscheidung darüber, was in welchem Umfang zu produzieren ist, welchen Nutzen jede Nation aus ihren Rüstungskapazitäten zieht, was sie mit deren Produkten anstellen kann usw., einem Sammelsurium zusätzlicher, der Bündniskooperation und -konkurrenz auf den verschiedenen Ebenen sich verdankender Berechnungen unterworfen ist. Jede Nation kann ihre militärpolitische und rüstungswirtschaftliche Souveränität nur in Abhängigkeit von dem ausüben, was die Partner erlauben, aber auch vermögen.
Diese Beschränkung ist natürlich leicht durch den Ertrag der Kooperation aufgewogen. Der besteht nicht nur in dem unschätzbaren Vorteil, mithilfe europäischer Waffen und Waffenproduktion zu einem ernstzunehmenden Teilhaber an einer veritablen militärischen Welt-Herrschaft geworden zu sein. Ihre Zusammenarbeit in Sachen Rüstung ermöglicht es den Europäern auch, die einschlägige Industrie zum Mittel europäischer Standortpolitik zu machen und deren Geschäft darüber so richtig in Schwung zu bringen. Es verwundert daher nicht, daß Deutschland von Anfang an der Hauptprotagonist der europäischen Rüstungskooperation war. Frankreich und Großbritannien hatten als alte Groß- und Kolonialmächte noch ihre exklusiven militärischen Ambitionen und nahmen deshalb nur soweit an der europäischen Kooperation teil, wie sie sie bei der Verfolgung ihrer nationalen Sonderinteressen nicht beschränkte. Frankreich behielt sich sein Recht auf eine Force de frappe vor; die dafür nötigen heimischen Rüstungskapazitäten standen zur europäischen Vergemeinschaftung nicht zur Disposition. Großbritannien verstand sich weiterhin als Commonwealth-Seemacht und bevorzugter Bündnispartner der USA und hat lange Zeit daraus seine Rüstungsproduktion und seine Einkaufspolitik im Bündnis bestimmt. Die BRD war schon deshalb hier die treibende Kraft, weil sie als Erbe des Kriegsverlierers über gar kein eigenständiges militärpolitisches Interesse verfügen durfte, dies aber auch gar nicht wollte. Ihre nationale Militärmacht wurde ausschließlich als NATO-Beitrag wiederhergestellt; der deutsche Revanchismus erwarb sich damit, anders als nach dem 1. Weltkrieg, die Rückendeckung durch die große Sieger- und Weltkriegsmacht. Der Übergang zu eigenständiger nationaler Hochrüstung stand daher gar nicht zur Debatte.
Der deutsche Bedarf an Militärgütern definierte sich 40 Jahre lang aus dem Interesse, sich als Frontstaat im Bündnis in den europäischen Kooperationsprojekten möglichst große Mitsprache zu sichern. „Europa“ hieß auch hier der Weg des Wiederaufstiegs, in diesem Falle zur Militärmacht. Der besondere nationale Erfolgsweg als Weltwirtschaftsmacht verschaffte der Nation die ökonomischen Mittel, diesen Aufstieg als erfolgreiche Kombination von Aufrüstung und Standortpolitik durchzuziehen. Der dazugehörige Rüstungsexport wurde veranstaltet unter dem wunderbar widersinnigen Motto „Keine Waffenlieferung in Spannungsgebiete!“ – die junge Republik sah ein, daß ihr eine entscheidende Einflußnahme auf den Ausgang von „Krisen“ und „Konflikten“ noch nicht so recht gestattet war; doch der Rüstungsbedarf, der auch völlig ohne „Spannungen“ weltweit entstand, bot genügend Absatzchancen. So stieg das friedliche neue Deutschland ganz nebenbei zum führenden europäischen Rüstungsstandort auf.
Die DASA und ihre Schulden: Das deutsche Instrument in der Rüstungskooperations-Konkurrenz – ein Opfer der neuen Weltlage
Kurz vor seiner „Wiedervereinigung“ krönte das demokratische Deutschland seinen Wiederaufstieg zum Heimatland einer weltmeisterlichen Rüstungsindustrie mit der Fusion des Großkonzerns Daimler, der selbst schon einiges an Rüstungskapazitäten vorzuweisen hatte, mit dem Staatskonzern MBB zum nationalen Quasi-Monopol namens DASA. Vom Standpunkt der Standort- und Kreditpolitik war diese Fusion ein gelungener Coup. Die Zusammenfassung von Produktionslinien verschiedener Standorte setzte sehr zur Freude der Regierung sofort Rationalisierungspotenzen frei, die den Staatshaushalt zugunsten neuer Projekte entlasteten. Im Rüstungsexport war Daimler schon vorher eine große Nummer mit den entsprechenden Verbindungen und Vertriebswegen; daß auf diesem Felde nun auch für ehemalige MBB-Produkte ein privates Kapital als Verkäufer unterwegs war, räumte gewisse diplomatische Schranken aus dem Weg. Als Mittel entscheidenderer Mitsprache Deutschlands in der europäischen und der NATO-Aufrüstung wurde Kapital in neuer Größenordnung mobilisiert, ohne den Staatshaushalt entsprechend zu belasten – weshalb sich der Staat das Zustandekommen der Fusion auch einige Milliarden kosten ließ. Die ökonomische Kalkulation mit Rüstungsgütern war damit in die Gesamtkalkulation eines Weltmarktgeschäfts eingeordnet, das sich aller lohnenden Sphären bedient; die staatlichen Rüstungsvorhaben erhielten eine ökonomische Basis im Kapitalreichtum eines Unternehmens, das nicht nur an Staatsaufträgen verdient, also seine Kreditwürdigkeit auch aus eigenem Geschäftserfolg bezieht. Damit sollten nicht nur die ursprünglich für Rüstung geschaffenen Kapazitäten von der Beschränkung befreit sein, „nur“ für staatlich nachgefragte Ware nutzbar zu sein; das Rüstungsgeschäft sollte eine verläßliche Grundlage im Zugriff des Konzerns auf privaten Kredit bekommen. Die vom Daimler-Konzern ganz „zivil“ erwirtschafteten Gewinne und die Fähigkeit des Konzerns zur Mobilisierung von Kredit waren politisch ausdrücklich als ökonomische Manövriermasse für Ertragsschwankungen im Rüstungsgeschäft ins Auge gefaßt, die bislang vom Staatshaushalt zu tragen gewesen waren. Der standortpolitische Auftrag an den neuen Konzern lautete, Rüstung, Airbusse, Autos usw. ununterschieden zum Mittel dafür zu machen, sich in der Weltmarktkonkurrenz zu bewähren und damit den deutschen Standort und das deutsche Geld zu stärken. Vom Standpunkt Daimlers aus las sich die Kalkulation umgekehrt: Das Gelingen der staatlichen Rüstungsvorhaben und die dafür reichlich fließenden Staatsgelder sollten das Mittel sein, um über das Geschäft mit Autos hinaus in neuen Sphären Gewinn zu machen.
Die neue Lage I: Imperialistische Konkurrenz statt Kalter Krieg
Die Rechnungen des politischen Auftraggebers sind nicht aufgegangen; die seines Kunstprodukts ebensowenig. Die neu ausgebrochene ökonomische wie politisch-militärische Konkurrenz der Weltmächte zieht die Geschäftsgrundlage der DASA ziemlich gründlich in Mitleidenschaft.
Ein ‚ziviles Standbein‘ macht Verluste
Um den Absatz ziviler Flugzeuge wird zwischen den Produzenten und zwischen den engagierten Nationen ein verschärfter Konkurrenzkampf ausgetragen. Davon ist die DASA zum einen als deutscher Produzent des Airbus betroffen, zum anderen als Haupteigentümer der niederländischen Firma Fokker, mit der sie sich den Weltmarkt für Regionalflugzeuge neu erschließen wollte.
– Das Geschäft mit Fokker ist an der Konkurrenz der USA und Großbritanniens gescheitert; deshalb wird die Übernahme dieses Unternehmens inzwischen allseits als Fehlgriff gehandelt.[4]
– Das Geschäft mit dem Airbus ist von mehreren Seiten angegriffen. Zum einen lassen Finanznöte der meisten Luftfahrtgesellschaften den Weltmarkt für Verkehrsflugzeuge schrumpfen; die Anzahl der erwarteten Bestellungen ist von ursprünglich projektierten 210 Flugzeugen pro Jahr auf 120 Stück gefallen; an mehreren Airbus-Standorten wird deshalb schon seit längerer Zeit Kurzarbeit gefahren. Zum anderen gehört es zu den Eigentümlichkeiten des Weltflugzeugmarktes, daß dieser im wesentlichen auf Dollar-Basis abgewickelt wird, so daß jeder Dollarkursverfall den bei Auftragsannahme ausgehandelten Verkaufspreis entwertet; Währungsgeschäfte zur Kurssicherung kosten umso mehr, je mehr alle Welt mit dem weiteren Fallen des Dollar rechnet, bringen also keine Kompensation mehr. Das macht dem Geschäft mit dem Airbus zu schaffen, wenn zugleich an Preissteigerungen wegen der allgemein schlechten Geschäftslage nicht zu denken ist. So tritt der DASA als Geschäftshindernis die Tatsache entgegen, daß deutsches Kapital Geschäftserfolge gegen die USA eingespielt, die Stellung des Dollar als maßgebliches Weltzahlungsmittel in wichtigen Bereichen aber noch nicht entscheidend zurückgedrängt hat. Mit diesem Konkurrenzvorteil im Rücken hat die Luftfahrtindustrie der USA dem Airbus neu den Kampf angesagt[5] und bekommt Schützenhilfe von der eigenen Regierung. Die erklärt die amerikanische Luft- und Raumfahrtindustrie zur „strategischen Exportindustrie“ und will ihr mittels staatlicher Protektion das Weltmarktgeschäft reservieren. Die deutsche Politik reagiert entsprechend:
„Minister Rexrodt will künftig… ‚den Türöffner‘ für die internationale Vermarktung des Airbus spielen… Es gebe Indizien dafür, daß die US-amerikanische Konkurrenz ‚sehr entschlossen und sehr unkonventionell und mit Hilfe der Regierung für ihre Flugzeuge Werbung betreibe.‘ Konkret wandte er sich gegen Wettbewerbsverzerrungen über Vereinbarungen von Kreditversicherungen.“ (HB 31.5.94)
Waffenhandel im politischen Zwielicht
Die Golfregion ist seit dem Krieg gegen den Irak als Käufer deutsch-europäischer Wertprodukte mehr oder weniger ausgefallen, und die USA legen schwer wert darauf, daß das so bleibt.[6] In Reaktion auf die US-Vorwürfe in Sachen „Händler des Todes“ hat die Bundesregierung 1993 zunächst die Exportrichtlinien für Waffenexporte verschärft; beides hat das Geschäft der DASA in Mitleidenschaft gezogen. Die NATO-Lizenz „Hauptsache antikommunistisch“ hat ausgedient; der Waffenexport ist explizit zum politischen Konkurrenzmittel der Imperialisten geworden. Deshalb läßt auch die deutsche Politik da inzwischen manche Rücksicht fallen; insofern kann die DASA wieder hoffen. Ihre Vertreter sitzen bei Kohl-Besuchen in China mit am Tisch, und auch gewisse Landesväter halten von falscher Rücksichtnahme hier nichts. Planungssicherheit im alten Stil wird sich allerdings kaum wieder einstellen, wenn jeder Export ganz offen als Angriff auf die politische Zuständigkeit und das ökonomische Interesse der imperialistischen Konkurrenz gehandelt wird. Zumal die deutsche Politik ihre Exportvorstöße immer noch am höheren Gut eines grundlegenden Einverständnisses mit der Supermacht relativiert und z.B. gegenüber dem neuen Kunden Iran lieber einen offiziellen Rückzieher macht, als sich als Lieferant an Terroristen bloßstellen zu lassen.
Turbulenzen bei der deutsch- europäischen Aufrüstung
Das Abdanken des Hauptfeindes veranlaßt Deutschland zu einer gründlichen Umorientierung seiner Rüstungsvorhaben. Was für die Rüstung als Frontstaat nötig war, entfällt; für die DASA macht sich das in Gestalt von Mittelstreichungen und Unterauslastung geltend. Was neu benötigt wird, um deutsches Militär als Mittel des souverän gewordenen Deutschland neu herzurichten, steht insoweit fest, als eigene Krisenreaktionskräfte hermüssen. Die Umsetzung der Planungen in echte Aufträge hängt aber nicht nur an der Zeit, sondern auch daran, daß diese Kräfte vorerst nicht als Mittel gedacht sind, um im Alleingang irgendwo regelnd einzugreifen, sondern als Beitrag zur immer noch gültigen NATO-Weltaufsicht. Insofern ist nicht einfach national zu entscheiden, wieviel von was nun ausgerechnet Deutschland benötigt und was es sich im Verbund verschafft. Wesentlich beeinträchtigt wird das DASA-Geschäft außerdem durch den Streit, der innerhalb Europas und zwischen Europa und den USA im Bereich der großen Rüstungs- und Raumfahrtprojekte aufgekommen ist.
Der Eurofighter
Erst im Mai 1988 hatten Deutschland, Großbritannien, Spanien und Italien – gegen den entschiedenen Einspruch der USA, die ihnen einen eigenen Flieger verkaufen wollten – das Projekt eines neuen europäischen Kampfflugzeugs beschlossen. Dessen militärischer Auftrag ist inzwischen sang- und klanglos auf dem Müllhaufen der Geschichte gelandet. Daß Europa deshalb gleich überhaupt keinen eigenen Militärflieger mehr benötigt, meinte aber keine der beteiligten Nationen. Unklar war, was für einen und wieviele davon. Beim Versuch, diese nicht unwichtige Frage zu beantworten, durchkreuzen sich militärische, politische und finanzielle Bedürfnisse der verschiedenen Nationen sowie deren Konkurrenzgesichtspunkte. Das vorläufige Zwischenergebnis: Obwohl nach wie vor alle den Flieger wollen, fliegt er noch lange nicht.
Die erste Reaktion der versammelten Verteidigungsminister auf die neue „Bedrohungslage“ war, eine „abgespeckte Version“ des alten Flugzeuges zu verlangen und den Zeitpunkt seiner geplanten Indienstnahme erstmal um zwei Jahre auf das Jahr 2001 zu verschieben – machte 380 Mill. DM Kostenersparnis im Bundeshaushalt 1992, die der DASA schon einmal nicht zuflossen. Darüber hinaus verdonnerten die Minister ihre Flugzeugbauer zu einem Festpreis pro Flugzeug von ca. 90 Mill. DM (die Industrie hatte 1992 noch 102,5 Mill. DM veranschlagt). Rühe sah im Herbst 1993 „für die Serienfertigung des Flugzeugs keinen Entscheidungsbedarf, da dafür erst Mitte 1996 Mittel bereitgestellt werden müßten.“ (HB 8.1.93) 1994 wurden die technischen Anforderungen an das Flugzeug abermals herabgesetzt und die Entwicklungsphase noch einmal bis zum Jahr 2002 verlängert. Wie die Dinge bei der Rüstungsproduktion nun einmal liegen, wurden darüber die von den Produzenten veranschlagten Herstellungskosten des Flugzeugs allerdings nicht niedriger, sondern höher, was im Frühjahr dieses Jahres zum Krach zwischen dem Bundesrechnungshof und dem deutschen Verteidigungsminister führte. Außerdem wurde beschlossen, statt ursprünglich veranschlagter 250 nur noch 140 Stück benötigen zu wollen. Allerdings hatte man in Bonn einen Vertrag unterschrieben, nach dem die Produktionsanteile prozentual entsprechend der national bestellten Stückzahl vergeben werden. Die europäischen Konkurrenten bestehen auf ihrem Schein, was deutsche Politiker unerträglich finden:
„Der Fortgang des Projekts wird behindert durch die Forderung des britischen Partners nach einem höheren Arbeitsanteil, da Bonn die geplante Beschaffung auf 140 reduziert hat und die Briten die Übernahme von 250 Einheiten angekündigt haben. Würde man das auf die Arbeitsanteile umrechnen, dann verbleibe für die deutsche Seite nur noch ein Anteil von 23%, die Briten bekämen 40%… Lammert hält dies für unakzeptabel, und er bezweifelt zudem die Ernsthaftigkeit der Beschaffungsankündigung der britischen Seite.“ (HB 22.10.95)
Schließlich weiß doch jeder, wie es um deren Finanzkraft bestellt ist. In dieser Lage muß der journalistische Sachverstand der deutschen Politik glatt Fahrlässigkeit vorwerfen:
„Die Ministerpräsidenten dröhnen vollmundig und fordern eine schnelle Entscheidung für den Jäger. Alle betreiben in Wahrheit billigen Populismus, schaden den Verhandlungen und damit sich selbst: Würde der Bund jetzt der Beschaffung zustimmen, dann müßte er sich mit dem niedrigen workshare von 23% bescheiden und gleichzeitig Arbeitsplätze preisgeben.“ (SZ 25.10.95)
Die europäische Rüstungskooperation bekommt eine neue Schärfe. Es geht eben nicht bloß darum, für die alte Weltlage auf den Weg gebrachte Projekte neu zu besichtigen und umzudefinieren; der Zweck der Kooperation selbst definiert sich ein wenig anders als vorher. Zunehmend geht es nicht mehr um europäische Zusammenarbeit im Bündnis mit den USA und für es, sondern um den Aufbau militärischer Potenzen als Konkurrenzmittel gegen die Supermacht. Dafür wird die europäische Kooperation um so mehr unerläßliches Mittel der beteiligten Nationen – ganz abgesehen davon, daß sie ihre diesbezüglichen Potenzen auch gar nicht mehr auseinandersortieren könnten, ohne ihnen nicht wiedergutzumachenden Schaden zuzufügen. Zugleich werden die überkommene Verlaufsformen und Arbeitsteilungen in dieser Kooperation aber in dem Maße fragwürdig, wie die europäischen Imperialisten untereinander um die Vormacht in ihrem neuen Europa streiten. Aus seiner DM-Macht leitet Deutschland auch hier das Recht ab, beim Streiten vorneweg zu sein. Wer bloß ein Pfund zu verteidigen hat, hat eben kein Recht auf 40% workshare beim Rüsten. Das sehen die Briten etwas anders; also könnte sich die Sache noch hinziehen.
Future Large Aircraft und andere Querelen
„Es muß ein gemeinsamer, konsolidierter europäischer Markt für Rüstungsgüter entstehen. Nur er bietet die Möglichkeit, ausreichend große Stückzahlen zu wirtschaftlichen Bedingungen zu produzieren, die Europa gegenüber den USA wettbewerbsfähig machen… Zum Selbstverständnis eines zusammenwachsenden Europa gehöre, einem ‚buy american‘ ein ‚buy european‘ entgegenzustellen.“ (Rühe lt. Handelsblatt 26.4.95)
Das sagt ausgerechnet der Aufrüstungsminister des Staates, der beim Eurofighter auf einer deutschen Extrawurst besteht. Der Chef der französischen Industrieverbandes der Luft- und Raumfahrt wird noch deutlicher:
„(Frage:) Die Niederlande haben kürzlich die Beschaffung der McDonnell Douglas AH-64 Apache beschlossen. Sollte nun politischer Druck auf Großbritannien ausgeübt werden, um eine ähnliche Entscheidung dort zu verhindern? (Antwort:) Wir sollten die Gespräche über die Einigung Europas mit der britischen Regierung einstellen, wenn sie sich für einen amerikanischen Kampfhubschrauber entscheidet.“ (Flugrevue Juni 1995)
Die Briten mögen ihre bewährte Kooperation mit den USA in Rüstungsgütern nicht einstellen. Das nehmen ihnen die europäischen Partner inzwischen offen als Anschlag auf die europäische Rüstungsbasis und deren Finanzierung übel. Besondere Brisanz hat dieser Streit am Projekt des „Future Large Aircraft“ bekommen. Dieses dient einem doppelten Ziel: Militärpolitisch will sich Europa damit unabhängig von den USA die Verfügung über einen Militärtransporter sichern, mit dem die geplanten Krisenreaktionskräfte hinaus in die Welt fliegen sollen. Standortpolitisch sollen damit die Airbus Industries ein „militärisches Standbein“ bekommen – auch eine interessante Umdrehung! –, womit die Europäer ausdrücklich die Methode der USA kopieren wollen, ihre zivile Fliegerindustrie über Militärausgaben zu subventionieren.
Letztere Erwägung ist auch der Grund, warum sich die British Aerospace an der Machbarkeitsstudie zu dem Projekt beteiligt. Dessen Realisierung hängt jetzt an der britischen Regierung. Die hat sich erst kürzlich für den Kauf eines neuen Transporters von Lockheed entschieden – mit dem ganz unpassenden Argument, daß es den schon gibt, während der neue Large Aircraft eben ziemlich future ist. Die britische Regierung demonstriert damit nicht nur ihren Unwillen, ihre nationalen Rüstungskalkulationen einem europäischen Verbund unterzuordnen[7] – sie führt auch vor, daß ihr Bedarf an Großraumfliegern sich immer noch ganz eigenen nationalen Gesichtspunkten verdankt.
Der Weltraum als europäischer Militärstandort
Nach dem Ende der Frontstellung zum Osten hat Deutschland erst einmal das Projekt einer europäischen Raumstation gegen den Willen Frankreichs zu Fall gebracht; das führte zu Mittelstreichungen für die DASA. Die Entscheidung darüber, was in diesem Sektor in Europa weiter laufen solle, zog sich bis zu diesem Herbst hin. Die Deutschen wollen eine europäische Mitarbeit an der US-Raumstation Alpha; die Franzosen machen ihre Zustimmung dazu davon abhängig, daß Deutschland sich am Bau eines europäischen Spionagesatelliten beteiligt. Die deutsche Politik betreibt auch in dieser Sphäre ihren Spagat zwischen dem Interesse, mit Frankreich Europa zu stärken, und dem gegenläufigen Anliegen, mit den USA im Geschäft zu bleiben. Hier war allerdings Festlegung verlangt. Die USA konterten den französischen Plan zum Eigenbau nämlich mit einem Angebot, von dem sie annahmen, daß die Deutschen es nicht würden ablehnen können. Sie wollten Deutschland einen Militärsatelliten verkaufen, der bislang unter ausschließlicher US-Kontrolle gestanden hatte, und das auch noch zu einem Dumpingpreis. Die Motive beider Seiten werden freimütig ausgeplaudert:
„Die deutsche Entscheidung war Präsident Clinton wichtig genug, um einen persönlichen Appell an Kohl zu richten, sich für die amerikanische Alternative zu entscheiden… Viele deutsche und europäische Politiker haben begonnen, die französische Sorge zu teilen, daß Washington bei der Bereitstellung von Satellitendaten unzuverlässig sei. Die Europäer sind immer noch verärgert über die abrupte Unterbrechung in der Lieferung von Aufklärungsmaterial, als der Kongreß ein Ende der amerikanischen Unterstützung für die Durchsetzung des Waffenembargos gegen Bosnien verfügte… Der Chef der CIA flog nach Deutschland, um die deutsche Aufklärung zu überzeugen… Er dementierte ausdrücklich Berichte, nach denen die US-Satelliten einen Kontrollmechanismus enthielten, der den USA die Verhinderung eines unerwünschten Gebrauchs ermöglichen würde.“ (International Herald Tribune 19.10.95)
Die USA wollen Deutschland als Führungspartner in die NATO einbinden und ihr eigenes militärisches wie wirtschaftliches Monopol beim Satellitenbau wahren. Dagegen wirbt Frankreich mit der ebenso diplomatisch unmißverständlichen Begründung, daß Europa unabhängiger in seiner Aufklärung werden müsse und den Anschluß an die Technologie nicht verlieren dürfe. Als „zusätzliches Argument“ für die europäische Variante nennt Luft- und Raumfahrtkoordinator Lammert „die Tatsache, daß die Europäer mit Maastricht II eine eigene Außen- und Sicherheitspolitik diskutieren.“ (HB 2.5.95)
Vielleicht ist das Argument doch nicht ganz so zusätzlich. Vor wenigen Wochen jedenfalls hat sich dieser Standpunkt als gemeinsames europäisches Programm durchgesetzt, womit auch die europäische Beteiligung an der Raumstation Alpha positiv entschieden war.
Die neue Lage II: Wie ein nationaler Rüstungsmulti rechnet
Wäre Daimler-DASA wirklich bloß ein privater High-Tech-Konzern, der unter anderem mit Staatsaufträgen sein Geschäft macht, dann stünde das Unternehmen – wie etwa weiland die „Metallgesellschaft“ – jetzt vor der Frage, ob es Konkurs anmelden muß oder noch einen Vergleich mit seinen Gläubigerbanken hinbekommt, und Ex-Vorstandschef Reuter säße vielleicht mit dem Immobilienunternehmer Schneider in einer Zelle. Normalerweise lassen kapitalistische Geldgeber jedenfalls einen Schuldenberg von 1,6 Mrd. DM nicht durchgehen, ohne irgendeine Prüfungsbehörde einzuschalten. Der ganze Daimler-Konzern samt all dem dafür mobilisierten privaten Kredit liefe Gefahr, wegen der Pleite der DASA von der Aktienspekulation schlecht behandelt und an der Börse in New York, wo er sich gerade erst eingeführt hatte, bestraft zu werden. Und angesichts der Größe des betroffenen Unternehmens wäre vielleicht sogar die zuständige Währung ein wenig „ins Gerede gekommen“.
Tatsächlich kam die Befürchtung, daß Daimler pleitegehen könnte, keinen Moment lang ernsthaft auf; nicht einmal der Kredit der Firma hat Schaden genommen.[8] Mit größter Selbstverständlichkeit wurden die Schuldenberge des Konzerns sofort als „Lage“ besprochen, die es auf die übliche kostenkalkulatorische Tour zu „bereinigen“ gelte. Unterstellt war, daß sie sich auf diese Weise auch bereinigen läßt, ohne daß die Kreditgeber des Ladens mißtrauisch werden und auf Zahlung drängen. Wenn Vorstandsmitglied Schrempp davon spricht, daß der Konzern erst in zwei Jahren wieder profitabel Airbusse verkaufen könne, dann verläßt er sich darauf, daß dem Konzern eine Stillegung seiner Flugzeugproduktion wegen Unrentabilität von seinen Gläubigern nicht abverlangt wird. Selbstverständlich ist das nicht. In diesem Fall liegt der Vorstand aber völlig richtig: Er kann sich darauf verlassen, daß das politische Interesse an seinem Laden sich allemal in Kreditwürdigkeit übersetzt.
Auf der Grundlage schreitet die Firma zur Tat. Die gewissenhafte Führung des Geschäfts verlangt auf der einen Seite die Prüfung, wie mit den Geschäftssparten ökonomisch umzugehen ist, die die Gesamtbilanz von Daimler belasten. Die Alternativen stehen fest: Verkaufen, Dichtmachen oder Sanieren. So soll der Triebwerkshersteller MTU an BMW verkauft werden; die AEG wird unter massiver Entwertung von Kapital an diverse Interessenten abgestoßen. „Outsourcing“, Verlagerung von „Nichtkernfähigkeiten“ in den Dollarraum und Lohnsenkungen sollen den Airbus wieder profitabel machen. Der Sanierung des Geschäfts, das auf purem Staatskredit beruht, fallen so auch Geschäftsabteilungen zum Opfer, in denen echter kapitalistischer Reichtum produziert und realisiert wird; das läßt sich eben beim DASA-Daimler-Geschäft beim besten Willen nicht mehr auseinandersortieren. Das gleiche Interesse an Wiederherstellung der Profitabilität verlangt auf der anderen Seite aber auch, daß der Konzern bei seinen politischen Auftraggebern Unterstützung anmahnt. Die Daimler-Manager berufen sich auf den Dienst, den sie mit der geschäftsmäßigen Organisation der Rüstung an der nationalen Sache erledigen, und verlangen, den eingetretenen Schaden nicht einfach als Geschäftsschicksal hinnehmen zu müssen. Normalerweise haben Kapitalisten da nicht viel zu rechten. Die DASA-Chefs aber können sich darauf berufen, daß die roten Zahlen, die sie bilanzieren, nicht aus dem Markt kommen, also auch ihren Erträgen nicht anzulasten seien. Für ihre Firma zählt eben als Argument, was sonst nirgends gilt: Weil ihr Geschäft auf nichts anderem als staatlichem Kredit beruht, deshalb hat der Staat die Pflicht, für ihr Geschäft noch mehr davon bereitzustellen. Das ist nämlich der ganze Inhalt ihrer Forderung nach Planungssicherheit. Sie haben den festen Willen, das Rüstungs- und Fliegergeschäft rentabel zu machen. Vom Staat verlangen sie dafür, was nur recht und billig ist: Wenn er in seiner Eigenschaft als Militärmacht eigene Anforderungen an Standortwahl, Kapazitäten etc. anzumelden hat, dann muß er für sie auch den entsprechenden Sonderpreis zahlen.
Der Weg aus der Krise: Mehr deutsche Macht in Europa
Mit diesem Verlangen rennt die DASA beim Staat offene Türen ein. Für den buchstabieren sich angesichts der DASA-Verluste die Vorteile, die er sich aus der Übernahme von MBB durch Daimler ausgerechnet hat, als Gefahren, die es abzuwenden gilt, bei deren Abwendung er also auch gefordert ist. Er wollte einen wichtigen Teil der nationalen Rüstungsproduktion in einem zivilen Spitzenkonzern der deutschen Wirtschaft ansiedeln, und zwar ausdrücklich mit der Berechnung, daß diese große Firma die Wechselfälle des Rüstungsgeschäfts auffangen würde:
„Schließlich habe Bonn der Fusion von Daimler Benz und MBB zugestimmt, damit die deutsche Luft- und Raumfahrt endlich privatwirtschaftlich geführt und der Bund nicht schon bei den ersten Turbulenzen ‚wieder an Bord gezerrt‘ werde.“ (Rexrodt lt. SZ 29.9.95)
Wenn es dazu aber kommt, dann ist auch gleich klar, daß sämtliche Verluste dieses Konzerns und sein außerordentlicher Kreditbedarf zu einer Sache werden, die die Nation mit ihrem Staatshaushalt zu regeln hat. Es ist ganz natürlich, daß von Staats wegen alles aufgeboten wird, um die Solidität des Unternehmens unter Beweis zu stellen, dessen solide Finanzkraft den Staatshaushalt entlasten sollte.
Natürlich erspart das der Firma nichts von ihrem erzkapitalistisch konzipierten Sanierungsprogramm; „Dolores“ ist deutschen Politikern gerade recht. Bei der Frage allerdings, ob und inwieweit Daimler Rüstungsstandorte unter dem Gesichtspunkt seiner Gesamtbilanz zur Disposition stellt, will der Staat ein Wörtchen mitzureden haben. Diesen Part in der staatlichen Kalkulation übernehmen im wesentlichen die Landespolitiker, bei denen die Rüstung sich als Standort versammelt findet – die Gefahr, die deutsche Hubschrauberproduktion könnte ganz in französische Hände gelangen, läßt einen Stoiber nachts nicht schlafen. Gemeinsam einigt man sich darauf, in folgender Hinsicht Planungssicherheit zu stiften: Bis zum Jahre 2009 werden 4,3 Mrd. für den Future Large Aircraft in den Haushalt eingestellt. Außerdem sollen in den nächsten Jahren zwei neue Hubschrauber beschafft werden. Das Förderprogramm für die Luft- und Raumfahrt wird in Höhe von 600 Mill. DM bis über 1998 hinaus fortgesetzt. In der EG soll auf eine Anhebung der zulässigen Förderhöchstsätze im nationalen Luftfahrtforschungsprogramm von derzeit 50% auf 75% hingewirkt werden.
Vor allem aber werden die Potenzen der europäischen Rüstungskooperation mobilisiert. Auf europäischer Ebene erklärt sich Deutschland mit dem Projekt des Spionagesatelliten einverstanden und erreicht damit auch Einverständnis mit einem europäischen Beitrag zur Raumstation „Alpha“. Letzteres gelingt auch mit einer kleinen Erpressung Italiens, das aus Finanzgründen aus dem Projekt aussteigen will: Italien darf sich bei der ESA verschulden, damit es sich nicht den Vorwurf anhängen lassen muß, am europäischen Ausstieg aus dem Projekt schuld zu sein. Zwar soll dieser Kreditschwächling wegen Maastricht Haushaltsdiziplin üben; ihm als Finanzier für deutsch-europäische Weltraumambitionen noch ein paar Schulden mehr aufzuhalsen, ist aber offenbar kein Problem:
„Dies schaffe keinen gefährlichen Präzedenzfall, hieß es gestern aus deutschen Regierungskreisen.“ (HB 19.10.95)
Daß Italien kein Geld hat, zählt für den Verteidigungsminister der Führungsmacht überhaupt nicht, dessen Kollege Finanzminister gerade dem gleichen Land Unfähigkeit zur Teilnahme an der Währungsunion bescheinigt. Das Argument zieht offenbar: Italien will sich nicht wegen Geldmangel aus der Reihe der europäischen Militärmächte abmelden. So wird dann sogar der eine oder andere deutsche Standort gerettet, z.B. die Raumfahrtschmiede Bremen…
Fazit
Um die Gesundheit des deutschen Rüstungskapitals braucht sich niemand Sorgen zu machen. Die Produktion deutscher Waffen, als kapitalistisches Geschäft in der DASA organisiert, ist deutsche Waffe in der imperialistischen Konkurrenz um militärische Vorherrschaft, um die Stärke der Währung, um die Attraktion von Weltmarktgeschäft. Also versammeln sich auch die staatlichen Interessen aus allen diesen Abteilungen in dem einen Anliegen, der Nation ihr Rüstungskapital zu sichern und profitabel zu machen. Da gibt es im Verhältnis zwischen nationalem Bedarf an Rüstung und den Kosten, die er deutschem Kredit verursacht, nichts mehr gegeneinander abzuwägen oder auszuspielen; keiner dieser Gesichtspunkte läßt es zu, daß das DASA-Geschäft leidet. Also gelten sie auch alle als gute Gründe für Staatsaufträge, für Militärdiplomatie, für neuen Waffenexport… Wettrüsten ist Standortpolitik, Standortpolitik ist Wettrüsten – wer wollte da noch unterscheiden?
Also bekennt sich die Nation auch dazu, hier nicht mehr unterscheiden zu wollen. Im übergreifenden Titel „Arbeitsplätze“ ist die Rüstungsproduktion endgültig von jedem moralischen Makel befreit und die Verschleuderung von Reichtum zum unabweisbar ehrenhaften und über jede Kritik erhabenen Mittel erklärt, um alle Werte zu sichern, die der Nation am staatsmaterialistischen Herzen liegen. Angesichts der DASA-Krise schwören auch ehemalige Rüstungskritiker öffentlich ihren „Bauschschmerzen“ ab. Natürlich, die Produktion von Gummibärchen wäre ihnen lieber. Aber wie die Dinge nun einmal stehen, hängt die Zukunft der Nation, der Region, der Einkommen, der DM nun einmal an der Rüstung. Wie sagt ein „Arbeitskreis betroffener Betriebsräte“ so schön:
„Die Politiker, die bisher nicht in der Lage seien, der Branche etwas mehr Planungssicherheit zu geben, müßten sehen, daß die dort Beschäftigten und deren Angehörigen auch Wähler seien. Man fordere keine neuen Rüstungsprojekte, nur um Arbeitsplätze zu sichern… Es gehe darum, nationale Mindestfähigkeiten und Mindestkapazitäten zu sichern. Auch müsse die Politik, die ‚Ja sagt zur Bundeswehr‘ und den Bestand einer nationalen wehrtechnischen Industrie als Teil der Sicherheitsvorsorge wünsche, sich im Falle öffentlicher Kritik klar vor die Industrie und ihre Beschäftigten stellen.“ (HB 10.5.95)
Man kann ja gegen Waffen haben, was man will – für einen nationalen Schulterschluß zwischen Kapital und Arbeit sind sie doch immer gut!
[1] Die Russen mögen sich zum Ärger der Nationen, die das gesamte Weltgeschehen auf sich als befugte Aufsichtsmächte beziehen, in dieses bewährte Schema nicht recht einordnen; sie werden deshalb als potentieller Konfliktfall erster Güte behandelt.
[2] Daß der Staat in Rüstungsfragen von einer „Sparpolitik“ nichts wissen will, ist das unerschöpfliche Material einer moralischen Kapitalismuskritik („In der Rüstung sind sie fix, für die Bildung tun sie nix!“), die sich vor allem dadurch auszeichnet, daß sie über die Gründe nichts wissen will, aus denen in unserem schönen Gemeinwesen Militär und Polizei unbedingte, alle angeblich so menschenfreundlichen sozialen Taten des Staates so relative Anliegen sind.
[3] Vgl. hierzu den Artikel über die Verlängerung des Atomwaffensperrvertrags in GegenStandpunkt 3-95, S.3.
[4] „Man hat zu lange geglaubt, durch den Erwerb der Mehrheit bei Fokker die Zusammenarbeit mit weiteren europäischen Partnern vermeiden und dieses Marktsegment in Eigenregie allein bedienen zu können. Das war ein teurer Irrtum.“ (Lammert in „Flugrevue“, Oktober 1995) Die DASA hat sich inzwischen zwecks Produktion eines Regionaljets zu einer gleichberechtigten Kooperation mit dem Konkurrenten Großbritannien sowie mit China und Korea zusammengetan – sehr zum Ärger von Boeing.
[5] Bereits vor einem Jahr verkündete DASA-Vorstandsmitglied Schrempp: „Wir stehen mit Boeing einem Wettbewerber gegenüber, der voll in den Preiswettbewerb eingetreten ist. In letzter Zeit werden Rabatte gegeben, die wir vor einem Jahr nicht für möglich gehalten hätten. Bei Boeing läuft ein Programm, mit dem die Kosten um 30% gesenkt werden sollen. Wir müssen mindestens das gleiche schaffen.“ (Handelsblatt vom 31.10.94)
[6] „Der Präsident des deutsch-französischen Hubschrauberherstellers Eurocopter nannte die derzeitige Marktlage die schlechteste seit Mitte der 60er Jahre. Ausnahme sei allein 1991, das Jahr des Golfkrieges, gewesen.“ (Handelsblatt 20.1.94) Die USA hören deshalb noch lange nicht auf, gegen europäische Unterwanderungsversuche in Sachen Saddam zu polemisieren: „Frankreich, China, Rußland im Sicherheitsrat der UNO, aber auch Deutschland, die Ukraine, Nordkorea wollen, daß der Irak wieder Öl verkaufen kann, damit sie ihm ihre Nuklear- und Raketentechnologie verkaufen können… Wo ist das Fingerspitzengefühl des „Spiegel“ hinsichtlich deutscher Firmen, die Saddam helfen?“ (New York Times 16.10. 95)
[7] Diesen Standpunkt hat Großbritannien neulich noch einmal mit seiner Weigerung unterstrichen, die WEU zum militärischen Arm der Europäischen Union umdefinieren zu lassen.
[8] Am Tag nach der Bilanz-Pressekonferenz, die Daimler absichtlich in New York abhielt, konnten die deutschen Börsenbeobachter aufatmen. Die ängstliche Frage: Schadet das der Daimler-Aktie und dem DAX? konnte nach einem kurzzeitigen Kurssturz dann doch mit einem erleichterten „Nein“ beantwortet werden.