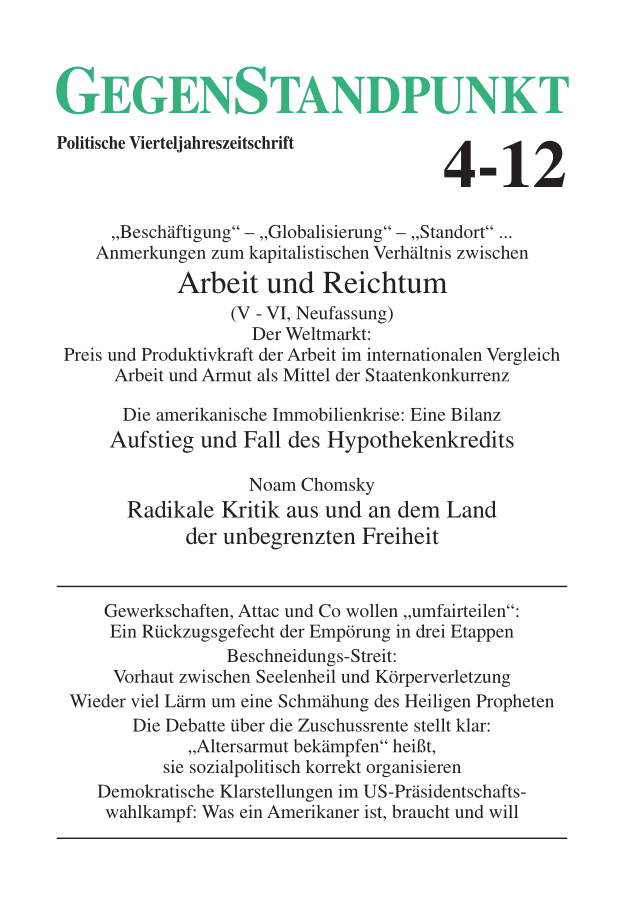Aus der Reihe „Chronik - kein Kommentar!“
Beschneidungs-Streit:
Vorhaut zwischen Seelenheil und Körperverletzung
Ein Kölner Gericht erklärt das religiös motivierte Wegschneiden der Vorhaut bei Jungen für strafbar. Weder das Urteil noch das davon angestoßene Öffentliche Rechten benötigen für die Kritik an der Kulthandlung auch nur ein einziges Argument gegen ihr religiöses Motiv. Im Gegenteil: Die religiös-weltanschauliche Botschaft, die diese Körperverletzung von anderen Tattoos unterscheidet, ist nicht nur bekannt, sondern es wird ausdrücklich Respekt angemahnt und bezeugt dafür, dass der Initiationsritus „für Juden und Muslime mehr als ein frommer Brauch“ und „aus der Sicht der jeweiligen Religionen eine Auszeichnung ist“ (FAZ, 29.6.12). Schließlich geht es genau darum auch bei der christlichen Taufe, wo auch keiner der Beschneidungskritiker fragt, was es an einem Neugeborenen eigentlich schon auszuzeichnen gibt. Gefeiert wird nämlich die Ehre, dem Kollektiv zugewiesen zu werden, das der Herrgott dafür vorgesehen hat, auf der Welt für den Glauben an ihn Reklame zu machen.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Beschneidungs-Streit:
Vorhaut zwischen
Seelenheil und Körperverletzung
1. Der religiöse Inhalt der Kulthandlung
Ein Kölner Gericht erklärt das religiös motivierte Wegschneiden der Vorhaut bei Jungen für strafbar. Weder das Urteil noch das davon angestoßene öffentliche Rechten benötigen für die Kritik an der Kulthandlung auch nur ein einziges Argument gegen ihr religiöses Motiv. Im Gegenteil: Die religiös-weltanschauliche Botschaft, die diese Körperverletzung von anderen Tattoos unterscheidet, ist nicht nur bekannt, sondern es wird ausdrücklich Respekt angemahnt und bezeugt dafür, dass der Initiationsritus „für Juden und Muslime mehr als ein frommer Brauch“ und „aus der Sicht der jeweiligen Religionen eine Auszeichnung ist“ (FAZ, 29.6.12). Schließlich geht es genau darum auch bei der christlichen Taufe, wo auch keiner der Beschneidungskritiker fragt, was es an einem Neugeborenen eigentlich schon auszuzeichnen gibt. Gefeiert wird nämlich die Ehre, dem Kollektiv zugewiesen zu werden, das der Herrgott dafür vorgesehen hat, auf der Welt für den Glauben an ihn Reklame zu machen.
Die besondere Beziehung zum höchsten Herrn, die einen vom Rest der Menschheit abhebt, beanspruchen alle Weltreligionen für sich. Den Juden ist für diese Idee der passend unbescheidene Ausdruck vom auserwählten Volk Gottes eingefallen. Das Verhältnis der Auswahl steht da schon etwas auf dem Kopf: Nicht der Gläubige ist so frei, sich seine Religion samt dazugehöriger Gottheit zu wählen, sondern umgekehrt. Der Glaube soll seine Unanfechtbarkeit bereits aus der Vorstellung gewinnen, dass man sich ihn nicht aussuchen kann, sondern von dem Gott, den man sich einbildet, dafür ausgesucht wird, sein Anhänger zu sein.
Diese Verkehrung der eigenen Freiheit in einen Akt göttlicher Verfügung gehorcht der inneren Logik dieser irrationalen Denkart, die der Glaube ist. Wer sich in seinem religiösen Denken von allen wirklichen Bestimmungen frei macht und sich von dem Bedürfnis leiten lässt, hinter all den weltlichen Interessen, Zwecken und Ansprüchen, mit denen er es zu tun bekommt, einen letzten Grund, einen absoluten Sinn zu finden, der nicht an jenen Interessen auszumachen ist, die sein Leben beherrschen, der kann diesen Sinn nur einem Zweck zuschreiben, den kein Mensch sich setzen kann, sondern der dem Menschen selbst gesetzt, vorgegeben ist. So landet das Bedürfnis, mit der Welt, auch und gerade wenn sie voller Not, Elend und Gewalt ist, seinen persönlichen Seelenfrieden zu machen, an sich selbst eine über den Dingen stehende Zufriedenheit mit ihnen herzustellen, bei der Einbildung einer höchsten überirdischen Instanz, die alle irdischen Geschicke in der Hand hat; die einen Plan hat, der gerade auch dann, wenn der Mensch ihn nicht begreift, einem höheren Wozu und Weißwarum folgt. Sich in dieser Vorsehung aufgehoben zu wissen, stiftet das grundsätzliche Einverständnis mit Gott und der Welt.
Was somit die Identität jeder religiösen Gemeinde ausmacht, ist das Selbstbewusstsein, keinen Geringeren als den obersten Weltenlenker persönlich zum Chef zu haben – und den bzw. das beansprucht jede Gemeinde exklusiv für sich. Wer sich als Mensch so entmündigt, dass er sich als Erfüllungsgehilfe eines lebenslänglichen Auftrags begreift, wer sich so erniedrigt, dass er verglichen mit seinem Herrn und Schöpfer eine gottserbärmliche Kreatur darstellt – ein derart ohnmächtiger Knecht erhöht sich genau dadurch, dass er dem konkurrenzlos Allmächtigen dienen darf, dem alle unterworfen sind, selbst die, die das nicht wissen oder glauben. Daraus speist sich das unerschütterliche Rechtsbewusstsein des Glaubensmenschen, im Leben zwar manchen Fehltritt tun zu können, dank seiner Zugehörigkeit zum einzig richtigen Glaubensverein und in seinem Gottesdienst aber einem unfehlbaren Weg und Willen zu folgen.
*
Diese eigentümliche, sinnstiftende Dialektik von Unterwerfung und höchstem Rechtsbewusstsein bestimmt nicht zufällig auch die Initiationsriten als solche: Wie die christliche Taufe wird die Beschneidung am Kind vorgenommen, bei den Juden am neugeborenen, bei den Muslimen auch etwas später. Dieser Vollzug am unmündigen Subjekt erfüllt seinen Tiefsinn als vorbewusster, vorwillentlicher Akt jenseits jeder Berechnung, als den ihn die Eltern am Novizen vollstrecken lassen, so wie er an ihnen selbst vollstreckt wurde. Die Beschneidung soll, indem sie die Markierung durch ein bleibendes Körpermal setzt, der Zugehörigkeit zur religiösen Herde zudem die unabänderliche Qualität des Biologischen, die Authentizität des Naturmerkmals verleihen.
Egal, wie weit die jeweilige Initiation da geht, der Religionsbeitritt ist in den Augen des Gläubigen nichts Willkürliches, sondern erhält in der Kulthandlung den Symbolgehalt des Auftrags von ganz oben, des Auserwählt-Werdens. Was den Willen des Herrn angeht, verbietet sich der Verdacht der Willkür sowieso, weshalb die Gläubigen in der Verantwortung stehen, sich der Gnade dieser Auswahl durch ihre Gottesfurcht würdig zu erweisen, sie sich verdienen zu müssen. Wer so in der Pflicht ist, kann mit dem Opfer als Beweis seiner Dienstbarkeit nicht früh genug anfangen, am besten, bevor er selber das überhaupt will. Diesbezüglich mag die Beschneidung, die angeblich in der abrahamitischen Tradition von Menschenopfer und Kastration bereits eine vergleichsweise zivile Aufweichung darstellt, manchem modernen Glaubensmenschen immer noch als archaisch roh und unzeitgemäß erscheinen, aber der Stellenwert von Demut und Opferbereitschaft im religiösen Menschen- und Weltbild sollte auch ihm vertraut sein.
*
Die religiöse Sittlichkeit im Volk ist bei der wirklichen Herrschaft im Prinzip gern gesehen. Die Zeiten, zu denen sich die reale Macht ihrerseits mit Gottes Gnadentum legitimiert hat, sind hierzulande zwar vorbei, aber unter der Berufung auf einen höchsten Wert und Auftrag tut es auch ein moderner, säkularer Staat nicht. Keiner verzichtet auf eine ideelle Begründung seiner hoheitlichen Gewalt, die mehr als nur ein zweckrationaler Apparat sein will. Auch der bürgerliche Staat kann jedenfalls mit einer religiös-irrationalen Geistesausstattung seiner Bürger etwas anfangen, er weiß sie zu schätzen als Bindemittel zwischen Volk und Herrschaft. In der Freiheit, sich die Welt religiös zu deuten, unterwirft sich der Gläubige zwar einem anderen, seinem absoluten Herrn, schafft es aber zugleich, sich auf seine Lebenswirklichkeit einen ganz persönlichen Sinn zu reimen, der im Normalfall seine Loyalität auch zur realen Obrigkeit einschließt. Insofern und solange diese Spielart der Affirmation funktioniert, hat die Einbildung, in der speziellen Mission eines Außerirdischen unterwegs zu sein, ihren anerkannten Platz im bürgerlichen Gemeinwesen.
2. Die Vorhaut als staatliches Rechtsgut
Angesichts des einvernehmlichen Verhältnisses, das Staat und Religion pflegen – man weiß, was man aneinander hat – und angesichts des Respekts, den der religiöse Gehalt der Beschneiderei genießt, fragt sich, was denn Vertreter unseres Rechts an dieser Kulthandlung stört. Auf den ersten Blick mag es wie eine Unangemessenheit, wie eine Themaverfehlung anmuten, wenn Richter von einem strafbaren Fall von Körperverletzung sprechen, wo es den Veranstaltern des Events doch um die göttliche Gnade ewigen Seelenheils zu tun ist. Wo sie das Signum der Auserwähltheit zelebrieren, fällt den Herrn vom profanen Recht ein, dass es weh tut.
Was aber so daneben aussieht, ist eben die Fassung des religiösen Akts als Tatbestand des Rechts, eine praktisch sehr gültige Verfremdung des Themas also. Und der merkt man schnell an, dass es da im Kern nicht ums Wehtun geht. Wenn Vertreter des bürgerlichen Rechts den religiösen Ritus ins Visier nehmen, werden da nicht einfach Vorhäute beschnitten, sondern mit ihnen Rechte. Insofern rührt die juristische Betrachtung und Behandlung der Glaubenspraxis – mag sie sich auch am kleinsten Zipfel festmachen – schnell ans Grundsätzliche, was auch die Reaktion von entrüsteten Rabbinern und muslimischen Oberhäuptern deutlich macht. Die wollen sich vom Staat nicht die Leviten lesen lassen, verbieten sich jede Einmischung in ihr Treiben – und missverstehen das Recht auf freie Religionsausübung, wenn sie meinen, dass diese den Staat nichts anginge.
Denn der Staat, der der Religion ein eigenes Grundrecht zugesteht, mit dem er ihre Freiheit schützt, legt sie damit auf den Gebrauch dieser Freiheit fest. Diese Festlegung hat es in sich. Zwar darf jeder glauben, an wen oder was er will, wie er auch meinen darf, was er mag. Damit gilt die religiöse Meinung aber genau so viel, nämlich nicht mehr als eine unter vielen Meinungen, die im doppelten Wortsinn gleich gültig, also gleichgültig und auf praktische Folgenlosigkeit festgelegt sind. Der weltanschauliche Absolutismus der Religionen verträgt sich im Grunde schlecht mit so einem Relativismus und Pluralismus, aber sich in eben diese Gleichgültigkeit der Religionen einzureihen, mutet der säkulare Staat den von ihm zugelassenen Kirchen zu. Diese dürfen die Selbstfeier der Frömmigkeit ihrer Schafe organisieren, ihnen vorbeten, dass ihr Gott über allem steht, und sich als seine Vertretung auf Erden vereinsintern sonst was anmaßen. Klar muss aber sein, dass sie dabei nur eine private Lebensanschauung vertreten und betreuen, während die staatliche Hoheit als solche unangetastet über all den sinnhaltigen Weltbildern steht. Als Freiheit, als staatliche Erlaubnis, sie ausüben zu dürfen, ist die Religion somit herabgestuft, ist die Kirche dem Rechtsstaat untergeordnet und so fürs bürgerliche Gemeinwesen funktionalisiert.
So gut sich die Kirchen mit dieser Platzanweisung arrangiert haben, so affirmativ sie die Welt deuten und so loyal in der Regel ihre Anhänger auch der weltlichen Macht dienen – der Gegensatz ist damit nicht weg und lauert in seiner Grundsätzlichkeit im scheinbar abseitigsten Reibungspunkt und Schauplatz. Das belegt auch die Fußnote zur Debatte, dass die christliche Kirche sich in dem Fall mit ihrer jüdischen und muslimischen Konkurrenz solidarisch erklärt. Wo es um Staat gegen Religion geht, wollen die Religionen zusammenhalten.
*
Die rechtsgelehrte Art, wie sich dieser staatliche Anspruch an die Religion vorträgt, besteht hier darin, die gewiss respektierte Religionsfreiheit an einem anderen Grundrecht, dem auf körperliche Unversehrtheit, zu relativieren. An dem religiös motivierten Eingriff drängt sich einem Richter also die Frage auf, welches Recht hier mehr verletzt wird oder zu schützen ist: das des Kindes auf Unversehrtheit oder aber, im Verbotsfall, das der Eltern, ihr Kind religiös aufzuziehen. Auf Rechtsdeutsch heißt das „Kollision zweier Rechtsgüter“ – und dann wird abgewogen.
Dabei geht es zu wie im Abituraufsatz, insbesondere wenn
der Streit seine öffentliche Fortsetzung über die
Meinungsseiten, Feuilletons bis in die Leserbriefspalten
der Gazetten findet: Auf beiden Seiten – für und wider
Beschneidung – werden dieselben Werte
reklamiert. Hier wie dort sprechen Anwälte und Experten
des Kindeswohls – was auch sonst! Das will nur
entsprechend interpretiert sein: Da wissen die einen ganz
genau, dass so ein Kleinkind ein Mensch gewordener Ruf
nach religiösem Halt ist: Ist das sichere Wissen um
die Zugehörigkeit zu einer religiösen Gemeinschaft nicht
wichtig für ein nach vertrauensvollen und verlässlichen
Beziehungen strebendes Kleinkind?
(SZ, 1.10.) Vor einem „lebenslangen
Trauma“ warnen dagegen die Kritiker, während die
Befürworter den Eingriff so harmlos „wie eine
Masernimpfung“ einstufen (FR, 12.7.). So nimmt die
Debatte freie Fahrt auf und lässt sich zu weiteren
sachfremden Betrachtungen aller Art ausbauen. Der
Standpunkt der Vorhaut-Schützer wird von
psychologisch-pädagogisch-medizinischem Sachverstand
flankiert: Das Kindes-Recht auf gewaltfreie Erziehung
wird aufgefahren, auch das auf erogene Zonen.
Entsprechend auf der Gegenseite: Wer mag, kann in der
Vorhautentfernung eher eine hygienische Vorsorgemaßnahme
sehen. Dass es den Brauch schon paar tausend Jahre und
fast weltweit gibt, sind auch gute Argumente – für ihn
selbstverständlich.
Wie sich all die Standpunkte als solche des Rechts vortragen, so haben sie im Recht auf Freiheit der Person ihre abstrakte Zusammenfassung: Auch die Beschneidungskritiker sprechen im Namen der Religionsfreiheit. Gerade weil die Körperverletzung irreversibel ist, verletze sie das Recht der beschnittenen Person auf religiöse Selbstbestimmung. Daran schließt sich der Vorschlag an, die Beschneidung bis zum Alter der „Religionsmündigkeit“ zu verschieben. Eine Kompromissvariante will zumindest den etwas später beschnittenen muslimischen Kindern ein Veto-Recht einräumen.
Derlei Anträge werden wiederum rechtskundig damit relativiert, dass die Entscheidungsfreiheit bei Unmündigkeit des Kindes nun mal den Eltern zufällt. Doch davon, dass all das rechtliche Herumschieben des Willens an der Passivität des Rituals, also an der Idee der Auserwählt-Werdens ziemlich vorbeigeht, einmal abgesehen: Kritisiert wird am so schlimmen, lebenslangen Trauma einzig und allein, dass die Person zu ihrem Trauma nicht frei und mündig ja sagt; die Verletzung verliert auch in den Augen ihrer Kritiker den Schrecken, wenn in dem Sinn ein fett gedrucktes Selbst davor steht.
An diesem Punkt der öffentlichen Debatte haben die
theoretischen Fundamentalisten der Willensfreiheit ihren
Auftritt. Sie hieven den Streit am Ende in
philosophiegeschichtliche Höhen und sprechen von der
Auseinandersetzung zwischen religiöser Archaik
und aufklärerischer Vernunft. Aus der Warte des
Überbaus überblicken sie den langen und mühsamen Weg,
den unsere Gesellschaft zurücklegen musste, bis sich die
Vorstellung, jeder Mensch sei von Natur frei und
selbständig, durchsetzen konnte
(FR, 19.7.) – ein Weg, den diese
Vorsintflutlichen also noch vor sich haben. Dabei weisen
die Wortführer der Ratio es freilich weit von sich, auch
nur eine zarte Kritik am Irrationalismus der Religion
anzumelden, im Gegenteil: „Es ist eine Zumutung für
den gläubigen Menschen, wenn Jahrtausende alte Rituale
infrage gestellt werden – Rituale, deren Zweck es ist,
die Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft festzulegen,
identitätsstiftende Rituale also, die für das
Selbstverständnis eines Mannes als Jude oder Muslim von
immenser Bedeutung sind. Religionen befinden sich
aber weder in einem rechtsfreien noch in einem
rechtfertigungsfreien Raum. Sie können Gott als höchste
Instanz betrachten. Sie können überzeugt davon sein,
seine Worte und Gebote aus Heiligen Büchern und aus dem
Mund ihrer Propheten genau zu kennen. Trotzdem –
oder gerade deshalb – müssen sie in unserer
aufgeklärten Gesellschaft Kritik aushalten wie jeder
andere.“ (FR, 19.7.)
Welche „Kritik“ müssen sich die Glaubensmenschen also gefallen lassen? Dem mitfühlenden Verständnis von wegen „Zumutung“ folgt mit dem aber die inhaltsleere Zumutung der Selbstrelativierung. Die Freunde der Aufklärung gestehen den Gläubigen ausdrücklich zu, sich in ihren vernunftfreien Zonen einzuhausen, die Selbstbestimmung an „Gott als höchste Instanz“ abzutreten – aber zugleich sollen sie die Freiheit der Person als den verpflichtenden Höchstwert anerkennen. Wo sich für den religiösen Menschen die „Identität“ darin erfüllt, vom höheren Willen auserwählt und verplant zu sein, sagen die Willensschützer: Bilde dir das ruhig ein, aber in der wirklich gültigen letzten Instanz ist der Staat der Hüter des freien Willens, und der oder das gilt selbst für den, der sich für auserwählt hält. Solange sich die Religion dahingehend relativiert, ist sie offenbar mit einer Vernunft gut vereinbar, die den Fetisch freier Wille mit den obersten moralischen Werten des Menschenrechts gleichsetzt und den Staat zu einem Diener an denselben verklärt.
3. Die Eskalation des Streits und seine salomonische Schlichtung
Klar, dass die Nachfahren Abrahams das Archaische ihrer
Religion etwas anders sehen, nämlich als Beleg
unanfechtbarer Geltung. Die politische Heimstatt der
jüdischen Religion kontert gar nicht erst auf der Ebene
geistesgeschichtlicher Ergüsse, sondern aus Israel kommen
Ansagen der unmissverständlichen Art. Dieser bürgerliche
Staat, der sich die Besonderheit gestattet, den jüdischen
Glauben zur Staatsreligion zu erklären, sieht als
politischer Arm des auserwählten Volkes von diesem Urteil
im deutschen Rechtsstaat nicht nur einen Ritus, auch
nicht nur eine Religion, sondern mit seiner
Nationalreligion sich selbst angegriffen: Israel
werde eine solche Beschränkung jüdischer Praktiken
nirgendwo tolerieren, und ganz sicher nicht in
Deutschland
(NZZ, 10.7.).
Der Nachsatz ruft zudem drohend die deutsche
Vergangenheit herbei und unterstellt dem aktuellen
Rechtsurteil antisemitische Befangenheit, also
eine Feindseligkeit gegen das auserwählte Volk, die
deutsche Köpfe gleich einem bösen Erbgut offenbar nicht
mehr loswerden. Auf jüdischer Seite will man sich
jedenfalls an den Holocaust erinnert fühlen
, redet
vom Tod des Judentums
und fragt die Deutschen:
Wollt ihr uns Juden noch?
(SZ, 15./16.9.)
Das gibt der Debatte eine Wendung, bringt sie auf eine
Ebene der Eskalation, die die deutsche politische Führung
rasch aktiv werden lässt. Das jüdische Grollen wird als
Weckruf genommen, in der Grauzone Beschneidung
(SZ, 26.9.) einen Zustand von
Rechtsunsicherheit auszumachen, der – da sind
sich alle einig – gar nicht geht. So wird ein Gesetz auf
den Weg gebracht, das auf eine Art und Weise die Luft aus
der Sache herauslässt, die im grotesken Verhältnis zu den
Dimensionen des öffentlichen Streits um Staat und
Religion steht. Der Gesetzentwurf hält nämlich jeden
Bezug zum religiösen Anlass und Inhalt draußen, fasst
Beschneidung generell als „Körperverletzung“, die aber –
solange sie „fachgerecht“ durchgeführt wird – straffrei
und den Eltern der beschnittenen Kinder anheimgestellt
bleiben soll. Somit regelt der Staat die Angelegenheit,
indem er die Rechtsaffäre auf eine Frage des
medizinischen Handwerks bzw. der adäquaten Ausbildung der
Beschneider herunterfährt.
Dass sich von daher am Ende auch noch die Ärzte etwas wichtig machen und die Fachkompetenz nur religiös autorisierter Schnipsler anzweifeln, ist wohl der matte Nachtrag zur großen Debatte. Die jüdischen und muslimischen Glaubensfunktionäre erklären ihre Zufriedenheit, Frau Knobloch bleibt in Deutschland und die Leserbriefe hören auch auf.