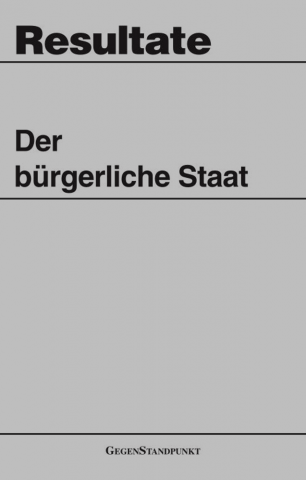§ 9
Demokratisches Procedere: Wahlen – Parlament – Regierung
Der bürgerliche Staat kann seine ökonomischen Ziele nur dann verwirklichen, wenn sich seine Bürger bei der Verfolgung ihrer materiellen Interessen innerhalb der Grenzen bewegen, die er ihnen setzt. Er ist darauf angewiesen, dass alle die staatlichen Praktiken als notwendige Funktionen für ihr Interesse anerkennen. Die einen müssen sich zu der schlichten Einsicht bequemen, dass gewisse Einschränkungen ihres Gewinnstrebens unerlässlich sind bei der staatlichen Garantie der produktiven Verwendung ihres Eigentums. Die anderen müssen sich damit abfinden, dass gewisse Einschränkungen ihrer Reproduktion unerlässlich sind für die staatliche Garantie ihrer Lohnarbeit.
Aus dem Buch
Systematischer Katalog
Teilen
§ 9
Demokratisches Procedere: Wahlen – Parlament – Regierung
Der bürgerliche Staat kann seine ökonomischen Ziele nur dann verwirklichen, wenn sich seine Bürger bei der Verfolgung ihrer materiellen Interessen innerhalb der Grenzen bewegen, die er ihnen setzt. Er ist darauf angewiesen, dass alle die staatlichen Praktiken als notwendige Funktionen für ihr Interesse anerkennen. Die einen müssen sich zu der schlichten Einsicht bequemen, dass gewisse Einschränkungen ihres Gewinnstrebens unerlässlich sind bei der staatlichen Garantie der produktiven Verwendung ihres Eigentums. Die anderen müssen sich damit abfinden, dass gewisse Einschränkungen ihrer Reproduktion unerlässlich sind für die staatliche Garantie ihrer Lohnarbeit.
Der Verzicht der Bürger auf die Anwendung von Gewalt bei der Austragung ihrer Gegensätze, positiv: die Zustimmung zum staatlichen Gewaltmonopol, ist das Mittel des Staates, die konkurrierenden, daher freien Bürger seinem Zweck, der Vermehrung des Privateigentums, zu unterwerfen. Weil ihr Materialismus diesem Zweck nur dient, wenn er sich durch den staatsidealistischen Gehorsam gegenüber seinen Gesetzen relativiert, wenn sich also die Klassen zum Instrument des Allgemeinwohls machen, versichert er sich des Funktionierens seiner Gewalt dadurch, dass er sich beim Volk die Einwilligung zu seinen Maßnahmen einholt.
Dabei stellt er selbstverständlich nicht seine notwendigen Geschäfte in die Disposition der Bürger, sondern lässt sie darüber entscheiden, welche Alternativen staatlicher Gewaltausübung eingeschlagen werden. Sie bestimmen in Wahlen diejenigen Repräsentanten, die sie für die Verrichtung der staatlichen Aufgaben für am besten geeignet halten. Da es in der Wahl nur um die Zustimmung zu den Staatsmaßnahmen geht, sind alle Stimmen gleich wichtig. Die Wahl wird durch Mehrheit entschieden und der bleibenden Notwendigkeit dieser Willenskundgabe durch periodische Abhaltung Rechnung getragen. Die Bürger, die sich für das politische Amt zur Verfügung stellen wollen, erhalten von Staats wegen die Möglichkeit, ihr Programm, durch das sie sich mit Gleichgesinnten zusammenschließen, zu propagieren: die Parteien konkurrieren durch politische Willensbildung um die Stimmen der Wähler und damit um die Führung der Staatsgeschäfte.
Diese besteht einerseits in der Tätigkeit des Parlaments, in dem die gewählten und nur ihrem staatsmännischen Gewissen verantwortlichen Repräsentanten mehrheitlich die anfallenden Kollisionen durch gesetzliche Vorschriften so regeln, wie es das Allgemeinwohl gebietet. Andererseits in dem Wirken der Regierung, die diese Vorschriften mit Hilfe des Gewaltapparats durchsetzt. Schließlich in der konstruktiven Kritik der Opposition, welche als repräsentative Minderheit der Wähler deren Unzufriedenheit die einzig er-wünschte Form gibt, die einer politischen Alternative.
Der beständig beschworenen Gefahr, dass die institutionalisierte Rücksichtnahme auf den Bürgerwillen für die praktische Kritik am Staatszweck missbraucht wird, begegnet die Demokratie durch den Zwang zur Grundgesetztreue (Parteienverbot u.ä.) sowie durch die gesetzlich fixierte Bereitschaft der Staatsmänner, auf die Demokratie zu verzichten, wenn es um die Rettung des Staates geht.
Mit den gefeierten demokratischen Prozeduren gesteht der moderne bürgerliche Staat ein, dass seine politische Herrschaft vom Willen der Unterworfenen abhängt, die Bürger also über alle Mittel verfügen, ihn überflüssig zu machen.Zugleich nimmt dieser Staat auf den freien Willen nur so Rücksicht, wie dieser als Abstraktion von den materiellen Interessen auftritt. Damit liegt der Fortschritt der Demokratie gegenüber allen früheren Staatsformen darin, dass sie den Willen der Untertanen für die Vermehrung des Reichtums, von dem sie nichts haben, einsetzt. Deshalb führt der ökonomische Kampf der Lohnarbeiter zum politischen Kampf gegen den Staat, während der politische Kampf um staatliche Alternativen den ökonomischen verhindert und mit dem Staat die Ausbeutung erhält – so oder so!
a)
Vom Standpunkt des Staates bzw. seiner Agenten, die die Konkurrenz entsprechend den Bedürfnissen des Privateigentums verwalten, stellt sich die abstrakte Bestimmung der Demokratie, dass die Staatsgewalt auf dem Willen des Volkes beruht, in einem etwas anderen Licht dar: Demokratie gilt ihnen als „die schlechteste aller Staatsformen, außer allen anderen“, womit sie klar zum Ausdruck bringen, dass der Staat nicht seinen Endzweck darin hat, sich dem Willen der Bürger anzubequemen. Umgekehrt: er wird mit seinen Aufgaben am besten fertig, wenn er sich die Zustimmung der Bürger zu seinen Werken verschafft. In ihrer positiven Unterstützung seiner Gewalt (die es nicht schon deshalb nicht mehr gibt, weil sie unterstützt wird) beweisen sie ihm, dass sie den Willen haben, sich in der Konkurrenz durchzuschlagen, also ihre Freiheit so zu gebrauchen, wie es ihm gefällt. Die Notwendigkeit demokratischer Legitimation besteht also für den bürgerlichen Staat insofern, als die Abstraktion der arbeitenden Bürger von ihrem besonderen Willen identisch ist mit der Fortführung ihrer ökonomischen Funktion und Pflicht, mithin das Funktionieren der Produktionsweise garantiert. Wenn die geschädigte Mehrheit des Volkes ihm die Loyalität verweigert, will sie ihre Freiheit nicht mehr, denkt an minder hohe Güter der menschlichen Existenz, so dass er sich bemüßigt fühlt, die Freiheit gegen die niederen Kräfte hochzuhalten. Im Votum für den Staat bekundet das Volk, dass es bereit ist, den Staat für sich auszunutzen, solange es ihn braucht – und der Staat antwortet auf diese Bereitschaft mit all den Gesetzen, die jene unselige Zweideutigkeit des Wortes ,brauchen‘ beseitigen: er wird gebraucht, ohne für sie brauchbar zu sein. Die demokratische Wahl, die nicht mit den Stimmen der Kapitalisten entschieden wird, gestattet also dem Staat die Verwendung der Arbeiterklasse, nicht umgekehrt, weil sie Index des sozialen Friedens ist. Eine Tatsache, die jeder Staatsmann ausspricht, wenn er öffentlich die Stimmen radikaler Parteien und anderes zählt; als Test bewusst durchgeführt bei allen werdenden Demokratien!
b)
Die Leistung des demokratischen Zirkus besteht also durchaus nicht darin, dass sich der Staat durch Wahlen vom Willen seiner Bürger abhängig macht, er weiß vielmehr die vorhandene Abhängigkeit so zu gestalten, dass die Bürger selbst ihren Willen aufgeben. Wenn der Staat sie nur darüber abstimmen lässt, wer von den Politikern die staatlichen Ämter verwalten darf, so lässt er keinen Zweifel darüber, dass neben den nicht gewählten Organen von Recht, Verwaltung etc. auch die Institutionen der politischen Entscheidungen sich nicht den Wünschen der Bürger anbequemen, geschweige denn ihre Existenznotwendigkeit in Frage steht. Er regelt die Willenskundgabe so, dass seine Untertanen keine andere Wahl haben, als ihre Unterwerfung unter den Staatswillen zu bekunden.
Die höchste demokratische Errungenschaft zeichnet sich dadurch aus, dass sie die gewaltsame Abstraktion des „freien Menschen“ zur Leistung seines eigenen Willens macht. Das Kreuz hinter dem Kandidaten ist die zur Anschauung gebrachte Gleichgültigkeit gegen die Überlegungen der Wähler, die auf das Votum für einen Repräsentanten und damit auf das Ja zum Staat zusammen-schrumpfen. Der Staat kann daher den Wählerwillen messen und mit dem Mehrheitsprinzip auch offen die Rücksichtslosigkeit gegen den besonderen Willen und seine Gründe demonstrieren. Durch diesen demokratischen Grundsatz wird weder die Minderheit der Stimmen vergewaltigt noch die Regierung der Besten verunmöglicht, wie reaktionäre Kritiker monieren – die Mehrheit des Volkes gibt sich für den Staat auf, weswegen Mehrheit, Minderheit und Nichtwähler gleichermaßen je nach Klassen zugehörigkeit die Staatsgewalt zu spüren bekommen. Weil die Wahl den Gegensatz zu seiner Basis institutionalisiert, die Bürger von der Herrschaft ausschließt, indem sie ihr zustimmen, weiß der Staat auch den bleibenden Konflikt zwischen seinen Maßnahmen und den Interessen seiner Bürger zu bewältigen: die periodische Abhaltung von Wahlen gewährleistet den Bestand des Gewaltverzichts. Sie macht mit der regelmäßigen Ausnahme des Bürgervotums seine Rücksichtslosigkeit zum Alltag der Untertanen.
Deren erzwungene Unterordnung unter die staatlichen Zwecke wird also durch die Wahl als das beständige Werk ihrer eigenen staatsbürgerlichen Vernunft besiegelt. Die ihnen abverlangte Willensleistung, sich zum willfährigen Objekt der Staatsgeschäfte zu machen, bewerkstelligen sie dadurch, dass sie alle paar Jahre das zum alleinigen Inhalt einer politischen Entscheidung machen, was sie ansonsten als tägliche politische Enthaltsamkeit praktizieren: die Mehrheit der Bürger verrät ihr Interesse an dem Staatszweck durch den vorab entschiedenen Vergleich ihrer Wünsche mit politischen Alternativen ihrer Nichterfüllung. Der einzelne Bürger schafft es, freiwillig von seinen Interessen zu abstrahieren und in der Wahl sich aufgrund seines Vergleichs für eine Weise der Durchführung des Staatsprogramms auszusprechen, in der kaum verhüllten Gewißheit, dass er damit die Fortdauer seines Schadens beschließt. Die mangelnde Wahlmüdigkeit des Volkes zeigt, dass auf der subjektiven Seite des angestellten Vergleichs nur Bedürfnisse in die Waagschale geworfen werden, die schon in Staatsillusionen verwandelt sind. Nicht erst im Akt der Wahl nimmt also der Prolet von sich Abstand; in ihr vollzieht er nur die ausdrückliche Zustimmung zu der Gewalt, die er erträgt, weil er sie – als Lohnarbeiter auf sie angewiesen – zum Mittel seiner Reproduktion verklärt. Dazu gehört nicht zuletzt der schöne Trost, die Regierung selbst gewählt zu haben, mit der man unzufrieden ist, und eine Alternative zu haben, die man das nächste Mal wählen kann.
c)
Wenn der demokratische Staat die Abhängigkeit seines Erfolges vom Willen der Bürger in ein Mittel seines Gewaltgeschäfts verwandelt, macht er mit der Sicherung seiner politischen Existenz die seiner Repräsentanten zu einer unsicheren Sache. Zwar kann heute jeder beschließen, Politiker zu werden (und die Demokratie hat nie über den Mangel an Politikernachwuchs klagen müssen, weil die herrschenden Klassen noch immer der Wille ausgezeichnet hat, den Staat für ihre Interessen zu bewahren), doch hängt sein Zugang zu den politischen Ämtern davon ab, ob er die Gunst der Wähler zu gewinnen und zu erhalten vermag; den Charaktermasken der Staatsnotwendigkeiten fällt also die demokratische Pflicht zu, um ihrer Karriere willen den Bürgern all die Sauereien in rosigem Lichte auszumalen, die sie ihnen anzutun gewillt sind, falls sie sie zum Zuge kommen lassen. Die Rücksichtnahme, die ansteht, ist die Übersetzung der Staatsentscheidungen in das Interesse der Betroffenen am Staat.
Die politische Willensbildung des Volkes durch die Parteien besteht in dem einfachen Trick, dem eigennützigen Staatsidealismus des einfachen Mannes, der auf die Leistungen des Staates für sich spekuliert, das zuteil werden zu lassen, was er verlangt: den Betrug. Die Politiker verwenden ihre ganze beschränkte Phantasie, die ihr praktisches Geschäft nicht erfordert, darauf, die Bürger, denen der Staat im gesellschaftlichen Alltag die Segnungen ihrer jeweiligen Klasse zuteil werden lässt, mit dem Versprechen zu beglücken, dies alles werde nur zu seinem Besten fortgesetzt. So vielfältig die Konkurrenz der Kandidaten sich gestaltet, so simpel sind die Grundprinzipien, derer sie sich dabei bedienen. Man muss allen gesellschaftlichen Gruppen unbekümmert um ihre Gegensätze, deren Erhaltung der Staat besorgt, versprechen, nur die staatlichen Maßnahmen aus dem Repertoire auszuwählen, von denen sie sich etwas versprechen, wobei die Sammlung der verschiedenenorts geäußerten Versprechungen das bekannte, weil notwendige Staatsprogramm ergibt – allerdings in der verhimmelten Gestalt des Nutzens für alle. Die hohe Kunst, jedem gerade das anzukündigen, was er sich jeweils erwartet, stößt notwendig auf Schranken. Die Staatsbürger wissen nicht nur durch die öffentliche Kenntnisnahme sich widersprechender Ankündigungen, sondern auch durch die vergangenen vier Regierungsjahre, dass der Staat nur wenige zufriedenstellt. Die Politikerangebote enthalten daher auch stets zusätzliche Hinweise auf den Charakter ihrer Absichten: Einschränkungen werden gemacht, die Ohnmacht des Staates ins Feld geführt und an die staatsbürgerliche Einsicht appelliert, dass die divergierenden Ansprüche nur dann zur Geltung kommen können, wenn alle den Rahmen des Möglichen berücksichtigen. Wem dabei die Möglichkeiten, und wem dabei die Notwendigkeiten zu-fallen, bleibt nicht verborgen, weswegen die Parteienkontroversen am liebsten auf dem Feld der Ideale geführt werden, die noch jeder Bürger mit seinem Vorteil gleichsetzt, obwohl sie ihm mit der verklärten Form der ersten Staatsparagraphen die Gewalt sämtlicher Paragraphen ankündigen. Es sind die heiligsten Güter der Demokratie, die Ideale des Gegensatzes von Staat und Bürger, um die die Parteien im „Grundwertestreit“ rangeln: Freiheit, Würde des Menschen, Gleichheit und Gerechtigkeit etc. Wenn sich die Parteien gegenseitig die Befähigung zur Vertretung der gemeinsamen Ideale absprechen, dann demonstrieren sie, wozu diese taugen: die Wirkungen der alle Politiker einenden Staatsnotwendigkeiten lassen sich in die Folge von Unfähigkeit und in den Verrat an den höheren Zielen des Staates verwandeln. Um Ideale lässt sich munter streiten, vor allem, wenn es darum geht, die Sorgen der Betroffenen in Zustimmung zu verwandeln. Deswegen kämpft die eine Partei für persönliche Freiheit, christliche Verantwortung und soziale Marktwirtschaft gegen Sozialismus, die andere um Freiheit, soziale Gerechtigkeit und Reformsolidarität gegen die ewig Gestrigen und die dritte für Freiheit und persönliche Würde gegen den Rest der Parteienwelt. Was sich nicht nur hierzulande als klassische Parteienlandschaft tummelt – Konservative, Reformer und Liberale –, das sind die notwendigen Ausgestaltungen der staatsmännischen Reflexion auf die Konflikte zwischen Staat und Bürgern, deren Unzufriedenheit der Politiker als Gefährdung der wirtschaftspolitischen und sonstigen Maßnahmen und vor allem seines Postens fürchtet, weswegen er sie nicht aus der Welt schaffen, sondern in Zustimmung verwandeln will. Die Reformer lassen es sich angelegen sein, die Unzufriedenheit der Untätigkeit des Staates anzulasten und demokratische Politik in das Wagnis zu mehr Demokratie zu übersetzen. Dagegen knüpfen Konservative an der anderen Seite des Gegensatzes, dem Bewusstsein des Bürgers von der Notwendigkeit des Staates an und machen aus Politik ein dauerndes Geschäft zur Rettung des Staates, dem der einzelne zu seinem eigenen Besten nicht beständig anspruchsvoll in die Quere kommen dürfe. Die Liberalen schließlich – nicht ganz auf der Höhe der Zeit – setzen auf die Säuernis des Privatsubjekts, das den Staat als Mittel und Hindernis zugleich begreift. Deswegen erklären sie die Allgegenwart des Staates zur Ursache aller Übel, stellen garantiert die Freiheiten an die erste Stelle und den Staatsbürger als den idealen Menschen des § 1 in Gegensatz zum Staat der späteren §§ und verkünden, um an die Macht zu kommen, die Einschränkung des Staates zum staatlichen Endzweck.
Weil Parteien diesen Streit veranstalten, um von allen gewählt zu werden, ,Weltanschauungsparteien‘, wie der Name schon sagt, in funktionierenden Demokratien verpönte Minderheiten sind, sind auch die Grundattribute der existierenden Alternativen wenig mehr als das variierte Versprechen, Staat für alle zu machen – sozialdemokratisch die soziale Frage zu lösen, christdemokratisch die gemeinsamen Ideale zu bewahren und liberaldemokratisch säkularisierter Christenmensch und negativer Sozialdemokrat zu sein. Demokratische Parteien sind Volksparteien, die den einseitigen Interessenausgleich des Staates in ihren eigenen Reihen vor-wegnehmen, indem sie durch innerparteiliche Demokratie und sonstigen Zirkus dafür sorgen, dass die Interessen der gesellschaftlichen Gruppen, die nach Einflussnahme auf den Staat streben, sich in der Partei ausklüngeln können und zugleich alle auf die Vertretung der Parteilinie nach außen verpflichtet sind.
Deswegen hat der beständige Kleinkrieg mit großen Idealen mit den praktischen Entscheidungen der Politiker auch wenig zu schaffen. Wenn es um das Regieren geht, demonstrieren sie noch jedes mal, dass ihre Auseinandersetzungen um die beste Politik in der Erhaltung der besten aller möglichen Welten endet – und in der gibt es keine Alternativen, zumindest nicht für das materielle Interesse der Mehrheit. Regierungswechsel erschüttern die Kontinuität der staatlichen Gewaltmaschinerie nicht, sie dienen ihr; und alle Gegensätze, die beim Geschäft, an die Regierung zu kommen, nicht ausgetragen, aber demonstriert werden und das Herz aufrechter Demokraten höher schlagen lassen, weil seine Staatsform so lebendig ist, verschwinden, wenn keine Partei die Mehrheit gewinnt: große und kleine Koalitionen. Die praktischen Alternativen aber sind eben die in den früheren §§ dargestellten – und finden Befürworter und Gegner quer durch die Parteien bzw. je nachdem, wer sie gerade als Regierung zu beschließen und wer als Opposition anzugreifen hat. dass die Kontinuität der Politik, die sich hierzulande über die immer wieder mühsam aufgepäppelten Differenzen der Parteien vermittelt durchsetzt, auch umstandsloser vonstatten gehen kann, zeigt sich dort, wo sich Volksparteien nicht aus politischen Organisationen gesellschaftlicher Interessengegensätze gebildet haben, sondern von Haus aus gemeinsame Mittel der konkurrierenden Interessengruppen gewesen sind. In den USA ist Politik pragmatisch, Parteien sind Wahlkampfmaschinen, Kandidaten Erfolgsmenschen und ihre Konkurrenz die um die überzeugendste Darstellung der nackten Staatsmoral und ihrer eigenen Person.
Die beständige Konkurrenz der Parteien um die Bürgerstimme konstituiert neben der politischen Praxis die Agitation als bleibende Einrichtung des politischen Lebens, in der all die Weisheiten verkündet werden, die in den Ideologiezusätzen die Staatsseite charakterisieren. Was vor der Wahl als Wahlkampf ausgefochten wird, bildet nur einen selbständigen und staatlich finanzierten Teil dessen, was die Parteien täglich an politischer Bildungsarbeit zu leisten haben – dem Staatsinteresse der Bürger ihre Variante von Politik als Material seines Vergleichs zu präsentieren und seinem staatsbürgerlichen Idealismus beständig neue Nahrung zu geben, weil sie sich seiner bedienen wollen. Weil die Parteien die Staatsgeschäfte vollziehen und als Parteipolitik kritisieren, sind sie der Gegenstand der Zustimmung, Enttäuschung und Kritik von seiten des Volkes und bereichern dessen Opfer um die Freiheit der Wahl von Alternativen seiner Durchsetzung – die Staatsgewalt aber um die relative Sicherheit, der Kritik entzogen zu sein. Indem die Parteien alles, was im Staat passiert, zum Mittel ihrer Durchsetzung machen, machen sie sich zum Mittel seiner Erhaltung und werden als solches in der Verfassung gewürdigt – auch wenn ihre Konkurrenz ab und an das ,Vertrauen in den Staat‘ erschüttert.
Die Konkretisierung des willentlichen Gewaltverhältnisses, als das der demokratische Staat in § 3 erklärt wurde, ergibt auch nähere Bestimmungen der Spezies von Repräsentanten, die für die Sphäre politischer Entscheidungen zuständig sind. Sie haben nicht nur die Aufgabe, über die Gewaltausübung zu entscheiden, die Ärmsten müssen dies Geschäft auch dem Bürger als seinem Interesse dienend nahebringen und dem politischen Gegner all das vorwerfen, was sie selbst sind und tun. Gewalt und Moral gehören auch bei ihnen zusammen: die eine praktizieren sie, wenn man sie lässt, die andere demonstrieren sie, damit man sie lässt. Heuchelei ist ihre Profession und daher auch ihr Charakter, Korruption und Lüge ihre politische Existenznotwendigkeit. Auch sie sind beschränkte Demokraten: das Volk führen sie beständig im Munde, weil es ihnen überall in die Quere kommt. – Kurz, sie sind das getreue Spiegelbild ihrer Opfer!
d)
Durch die Wahl ist die Erledigung der Staatsgeschäfte von den Repräsentanten abhängig, die das Volk mit der Ausübung der Staatsgeschäfte betraut hat. Damit die gewählten Volksvertreter ihre Entscheidungen über die Kollisionen der bürgerlichen Gesellschaft im Staatsinteresse fällen können, die Wahl also nicht dazu missbraucht werden kann, von den Repräsentanten Konzessionen gegenüber partikularen Interessen zu erzwingen, sind die Gewählten vom Willen ihrer Wähler unabhängig: indirekte Demokratie (Gewissensfreiheit der Abgeordneten und Nichtverantwortlichkeit der Regierung gegenüber dem Volk). Auf der anderen Seite darf die Erfüllung der Staatsfunktionen, soll sich der Staat erhalten, nicht der Willkür einer unabhängigen Regierung überlassen bleiben. Es muss gewährleistet sein, dass die Erfordernisse der Konkurrenz, um derentwillen die Bürger den Staat brauchen und wollen, den gültigen Maßstab bilden, nach dem sich alle Maßnahmen richten. Die Anerkennung des Bürgerwillens bleibt darin erhalten, dass die Anwendung der Staatsgewalt von der Entscheidung aller gewählten Repräsentanten über die effizienteste Bewältigung der entstehenden Aufgaben abhängig ist: die Exekutive ist den Beschlüssen des Parlaments unterworfen, in dem die Volksvertreter die Prinzipien festlegen, nach denen die anfallenden Kollisionen zu behandeln sind, und sie der Regierung in Gesetzesform zur Ausführung vorschreiben. Die Beratung und Gesetzgebung des Parlaments sorgt dafür, dass die Ansprüche an die Staatsleitung gemäß der Gesamtheit der Staatsleistungen relativiert und ihre (Nicht-)Erfüllung dementsprechend verbindlich festgelegt wird. Die parlamentarische Demokratie gibt sich damit als eine Regelung der Staatsgewalt zu erkennen, die den Staat als Mittel der nationalen Reichtumsvermehrung erhält, indem sie die Regierungsgewalt verpflichtet, von der rücksichtslosen Erfüllung aktueller Bedürfnisse Abstand zu nehmen, und in Gesetzen die einzelnen Probleme dem staatlichen Gesamtinteresse, das er mit seinen begrenzten finanziellen Mitteln verfolgt, unterordnet: Das Parlament entscheidet nicht nur über alle Maßnahmen des Staates und fixiert ihre Ausführung durch Gesetze, es beschließt auch durch die Bewilligung des jährlichen Staatshaushalts und der staatlichen Kreditvergabe die Verteilung der Mittel für die Ausführung der Gesetze.
Die Arbeit des Parlaments besteht also darin, den sich wandelnden Erfordernissen nach rechtlichen, sozial-und wirtschaftspolitischen Aktivitäten der Regierung durch Gesetze nachzukommen, die mit der Verpflichtung des Staates die Rechtmäßigkeit von Ansprüchen an ihn und die Verpflichtung der Bürger gegen ihn allgemeingültig festlegt. Als gesetzgebende Gewalt stößt das Parlament dabei die Gesetze, die für die Bürger unumstößlich sind, beständig um: sie werden ergänzt, geändert, aufgehoben, womit der Gesellschaft das Recht zuteil wird, das sie braucht. Damit gesetzliche Neuregelungen nicht dem in den bestehenden Gesetzen existenten Staatszweck zuwiderlaufen, sind sie dem Gebot der Verfassungsmäßigkeit unterworfen, die durch das Verfassungsgericht festgestellt wird.
Die gesetzlichen Entscheidungen über die beste Regelung der anfallenden Kollisionen werden von den im Parlament versammelten Volksvertretern gemeinsam, wegen ihrer differierenden Vorstellungen über die beste Staatsführung aber mehrheitlich gefällt. Damit der in den verschiedenen Parteien zum Programm erhobene Weg, die Bürger Mores zu lehren, anläßlich einzelner Beschlüsse nicht der Freiheit des Abgeordneten zum Opfer fällt, unterwerfen die Parteien ihre Abgeordneten dem Zwang, der den Wählern verboten ist: Durch den Fraktionszwang und die geschäftsordnungsmäßige Übertragung aller parlamentarischen Initiativen an die zu Fraktionen zusammengeschlossenen Parteien wird der einzelne Abgeordnete zum Erfüllungsgehilfen des Parteiwillens, weswegen neben die Berufung auf die Gewissensfreiheit der Abgeordneten gegenüber dem Wähler die Berufung der Parteien auf den Wählerauftrag gegenüber dem einzelnen Abgeordneten tritt. (Dagegen wird in solchen Ländern, wo die Parteien die in ihnen sich geltend-machenden politischen Ansprüche der diversen Interessengruppen nicht zu einer gemeinsamen politischen Programmatik ausgestaltet haben, wo der einzelne Abgeordnete also als Interessenvertreter bestimmter Gesellschaftsgruppen im Parlament sitzt, die Konkurrenz der Anforderungen an den Staat durch jeweils aktuell sich bildende Mehrheiten von Befürwortern oder Gegnern der jeweiligen Gesetzesvorlage entschieden, also im Parlament selbst ausgetragen.)
Um zu gewährleisten, dass die regierende Partei die Gesetzesbeschlüsse nicht ohne Rücksichtnahme auf die gesellschaftlichen Interessengruppen, auf die der Staat angewiesen ist, fällt, ist das Gesetzgebungsverfahren zumeist als Zweikammersystem organisiert, wobei die zweite Kammer nur als Instanz moralischer Einflussnahme durch ein gewisses Beratungs- oder Einspruchsrecht bei Gesetzesbeschlüssen oder aber als Kontrollorgan des Parlaments durch die Instanzen ausgestaltet sein kann, denen die Ausführung der Gesetze mit zufällt.
Da die Gesetze der Parlamentarier die Erwartungen der Wählermehrheit beständig enttäuschen – sie werden dem Allgemeinwohl geopfert –, dient die Beratung der Gesetze zugleich der Agitation der Bevölkerung für seine Repräsentanten/Alternativen: Öffentlichkeit des Parlaments. Während die für die Festlegung der Gesetzesvorlagen notwendigen juristischen, ökonomischen und politischen Erörterungen den von Sachberatern und Regierungsexperten unterstützten, nach Fraktionsstärke besetzten Ausschüssen zufällt, dienen die öffentlichen Debatten der Demonstration der konkurrierenden im Parlament vertretenen Parteien; sie zeigen, dass sie mit der Beschließung bzw. Ablehnung des jeweiligen Gesetzes das Staatswohl im Auge haben und damit den Wählerauftrag erfüllen. Die Größen der Parteien bewähren sich dabei stellvertretend als gewählte Repräsentanten, indem sie auf der Grundlage der falschen Gleichung von Staats- und Bürgerinteresse sich wechselseitig die Befähigung zur Erledigung der Staatsgeschäfte absprechen, sich die Ideale der staatlichen Gewalt unter die Nase reiben und so im formellen Gewande des Streits über faktisch schon entschiedene Gesetze den Staatsidealismus der Bevölkerung für sich zu vereinnahmen suchen. Anwesenheit der Abgeordneten und Intensität der Plenumsdebatten richten sich daher weniger nach der Wichtigkeit des behandelten Gesetzes für den Staat als nach dem Demonstrationseffekt, den sie erlauben, d.h. danach, wieweit sich an der behandelten Entscheidung Alternativen herausstreichen lassen, weil es im Volk Affinitäten zur einen oder anderen Seite gibt. Neben Haushaltsdebatten, in denen die Funktionstüchtigkeit des Staates am Ensemble seiner Maßnahmen diskutiert wird, firmieren daher Entscheidungen, an denen die nationale Moral der Wähler für Regierung oder Opposition mobilisiert werden kann, oder andere, gerade die Öffentlichkeit bewegende Regelungen (Reform des § 218, Energie) als bevorzugte Gegenstände ausgedehnter, öffentlich verfolgbarer Parlamentssitzungen.
Während die Regierungspartei in diesen Debatten ihre für alle verbindlichen Entscheidungen rechtfertigt, bewährt sich in ihnen die Opposition als konstruktive Kritik der Staatsmaßnahmen im Rahmen des Staates und erfüllt damit ihre demokratische Aufgabe, den sicheren Schaden der Bevölkerungsmehrheit, den sie ihr statt der Regierung antun möchte, der Regierungspartei anzulasten und so die bleibende Unzufriedenheit in Form einer möglichen Regierungsalternative zu repräsentieren. Gesetzen, die auch ohne ihre Zustimmung zustandekommen, stimmt sie deshalb zu oder lehnt sie ab, je nachdem, ob sie sich davon Anklang bei den Wählern verspricht, und nutzt so den Vorteil, nicht regieren zu müssen, dazu aus, die staatsbürgerliche Unzufriedenheit mit der Regierung gehörig zu schüren, um selbst an die Macht zu kommen.
Eigentlicher Angriffspunkt der Bürger und damit der Opposition ist die Regierung, der Exekutivausschuß der Mehrheitspartei, also das Ausführungsorgan der Gesetze. Den Schranken parlamentarischer Beschlüsse unterworfen, setzt sie diese in die Tat um und zeichnet sich gegenüber dem im Parlament organisierten Streit der Repräsentanten durch die Einheitlichkeit ihrer Handlungen aus (Richtlinienkompetenz, Ministerverantwortlichkeit gegenüber dem Kanzler). Sie bildet die politische Spitze der Verwaltung, modifiziert die bleibenden Staatsaufgaben, die von der verbeamteten Bürokratie kontinuierlich und unbeschadet aller politischen Wechsel erledigt werden, gemäß den jeweiligen politischen Entscheidungen über ihren besten Vollzug und findet am bürokratischen Sachverstand ihren willfährigen Diener ebenso wie ihr Korrektiv. Die verschiedenen verfassungsrechtlichen Formen der Abhängigkeit bzw. Unabhängigkeit von Parlament und Regierung sind dabei nichts weiter als Modi, die parlamentarischen Entscheidungen und ihre Ausführung nicht in einen prinzipiellen Widerspruch geraten zu lassen, die Regierung nicht gegen die gemäß seinen Aufgaben und Mitteln in Gesetze verwandelten Kompromisse gesellschaftlicher Anforderungen an den Staat handeln zu lassen und das Parlament nicht gegen die konkreten Erfordernisse der staatlichen Gewaltausübung Gesetze erlassen zu lassen. Je nach den Modi der Abhängigkeit oder Einflußnahme von Parlament und Regierung hat die wechselseitige Korrektur den Charakter friedlicher Zusammenarbeit von Parlamentsmehrheit und Regierung gegen die Opposition oder dauernder Konfrontation der verschiedenen Staatsor-gane. Dabei ist verfassungsrechtlich oder praktisch dafür gesorgt, dass die Regierung auf die Gesetzgebung genügend einwirken kann, um die in der Verwaltung des Staates bemerkten Notwendigkeiten gesetzlich fixieren zu lassen. Deswegen steht der Regierung bzw. der Verwaltung auch das Recht zu, im Rahmen der Gesetze die Ausführung selbst rechtsverbindlich zu konkretisieren.
In allen Fällen dient der demokratische Gewalten„teilungs“-zirkus, zu dem auch die „Überschneidung“ der Gewalten gehört, der Funktionalität der Staatsmaßnahmen für die Kollisionen der Konkurrenzgesellschaft, der Effektivität der von seinen Repräsentanten durchgesetzten Entscheidungen für den Erhalt von Staat und Ökonomie, also der Bewahrung der Zustimmung der von ihnen Betroffenen, die Bedingung und Kriterium des politischen Erfolgs ist.
Deswegen ist das demokratische Staatsinstrumentarium einerseits durch das Verbot der Änderung von Verfassungsgrundsätzen und durch die Erschwerung von Verfassungsänderungen geschützt. Andererseits ist für den Fall des „Staatsnotstands“, unter den gleichermaßen Naturkatastrophen, äußere Bedrohung und innerer Aufruhr gegen die Staatsgewalt fallen, für den Fall also, wo die demokratischen Prozeduren und Rücksichtnahmen die Staatsfunktionen gefährden, ihre Fortführung ohne den Umweg der repräsentativen Zustimmung des Volkes und die offene Rücksichtslosigkeit gegen Willen, Person und Leben der Bürger gesetzlich fixiert: Notstandsgesetze. Zur Erhaltung der Demokratie bedarf es im Notfall ihrer verfassungsrechtlich sanktionierten Aufhebung.
e)
Wenn die parlamentarische Demokratie die Ausübung der Staatsgewalt mit Hilfe der Zustimmung ihrer Bürger organisiert, dann ist sie Produkt des gesellschaftlichen Bedürfnisses nach einer souveränen Gewalt und nach Funktionalität dieser Gewalt für, d.h. Unterwerfung ihrer Entscheidungen unter die Interessen, welche ohne diese Gewalt keinen Bestand haben. Der demokratische Staat konstituierte sich also durch die Korrektur einer Staatsgewalt durch gesellschaftliche Interessen, die sich gegen einen Souverän durchsetzten, der von ihnen abhängig geworden war, ohne ihnen zu dienen. Denn eine Gewalt beugt sich denen, die sie unterwirft, nur dann, wenn sie sich anders nicht mehr erhalten kann; umgekehrt stimmt eine gesellschaftliche Klasse einer ihr übergeordneten Gewalt nur dann zu (statt sie zu beseitigen), wenn sie ihrer bedarf. Das Verdienst, eine demokratische Entwicklung eingeleitet zu haben, kommt also der Bourgeoisie zu; ihre Vollendung ist das Werk der Arbeiterklasse.
Seine wachsende ökonomische Macht benutzte das Bürgertum dazu, den Souverän am ökonomischen Mißbrauch seiner politischen Macht zu hindern und ihm den rechten Gebrauch seiner Gewalt, die man anerkannte, vorzuschreiben: Steuerbewilligungsrecht durch ein Ständeparlament, in dem sich das Bürgertum mit dem Staat der Grundbesitzer auseinandersetzte. Die ökonomische Kontrolle über die Entscheidungen des Souveräns benützte das Bürgertum als Mittel, dem absoluten Fürsten das Gesetzgebungsrecht aus der Hand zu nehmen und ihn auf die Ausführung der von den Parlamentsvertretern der herrschenden Klassen getroffenen Entscheidungen zu beschränken oder durch eine gewählte Regierung zu ersetzen: konstitutionelle Monarchie bzw. Republik. Die Indienstnahme der Staatsgewalt durch die besitzenden Klassen erlaubte diesen mit der rücksichtslosen Durchsetzung der großen Industrie eine immer größere Zahl von Lohnarbeitern zu schaffen, die von ihrer Lohnarbeit nicht leben konnten und mit jeder Anstrengung, ihre Existenz zu sichern, in Gegensatz zur Staatsgewalt gerieten. So machten die staatsgefährdenden Bemühungen der Proleten um ihre Existenz als Lohnarbeiter dem Staat klar, dass er ohne die Berücksichtigung dieses sich ständig vergrößernden Standes, also ohne die Aufhebung der Rechtlosigkeit der Arbeiterklasse, keinen dauerhaften Bestand haben konnte. Umgekehrt bemerkten die Arbeiter an den Reaktionen des Staates, dass sie ihn als Mittel im Kampf gegen ihre Ausbeuter gebrauchen mussten: die Durchsetzung ihrer materiellen Interessen war gleichbedeutend mit ihrer Durchsetzung im Staat, erforderte die Veränderung der öffentlichen Gewalt, die sich als Instrument der Kapitalisten ohne Rücksicht auf die Erhaltung ihres Ausbeutungsmaterials betätigte. Der Kampf um das allgemeine Wahlrecht, die Durchsetzung der Demokratie war also Klassenkampf, freilich nicht in der ersten Demokratie, in Amerika.
f)
1. Die demokratische Organisation der Staatsgewalt verdankt sich der Abhängigkeit ihres Erfolgs von der Zustimmung ihrer Bürger und institutionalisiert sie als Grundlage der politischen Maßnahmen gegen sie. Der darin enthaltene Widerspruch, der sich in der beständigen Gefährdung des staatsbürgerlichen Vertrauens in den Nutzen seines Staates niederschlägt, ist dem Staat ein Problem – nicht hinsichtlich seiner Existenz, die er auch ohne Zustimmung zu erhalten gewillt ist, wohl aber hinsichtlich seines demokratischen Fortbestandes. Die unvermeidliche Kritik an seinem Tun stellt für den Staat die Drohung dar, der Grundlage verlustig zu gehen, die beständig offene Gewaltausübung überflüssig macht und daher seine Durchsetzung am effektivsten sichert. Die Wissenschaft der Politologie widmet sich daher der bürgerlichen Unzufriedenheit, um ihre demokratische Praktizierung durch das entsprechende Demokratielob zu befördern. Als solche ist sie die demokratische Wissenschaft par excellence und daher auch antikritisch: Sie bespricht alle Momente des institutionalisierten Gegensatzes von Staat und Bürger als Willensverhältnis, d.h. unter dem Aspekt, inwieweit sie die Staatsgewalt durch die Zustimmung der ihr Unterworfenen festigen, und bekämpft durch die propagandistische Darstellung staatlicher Institutionen und Ideale jede Unmutsäußerung gegenüber dem Staat unabhängig von ihrem konkreten Inhalt.
In der demokratischen Institutionenlehre werden die Wahlsysteme nach den Kriterien Wahlgerechtigkeit contra Regierungsfähigkeit verglichen, die Parteien als vermittelnde Instanz zwischen Bürgerinteresse und Staatsgewalt begrüßt, Zwei-und Mehrparteiensysteme, Volks-und Weltanschauungsparteien nach den Gesichtspunkten Einheitlichkeit der Staatsführung, Wahlalternativen, Interessenartikulation = innerparteiliche Demokratie abgewogen, die repräsentative Demokratie gegen Vorstellungen direkter Einflußnahme des Volkes auf die Staatsentscheidungen verteidigt und die Funktionalität der Gewaltenteilungsmodi und ihrer notwendigen Grenzen für den Machtgebrauch im Sinne der Bürger gepriesen.
Das Eingeständnis der Gewalt der Staatsverhältnisse und des Unterwerfungscharakters der bürgerlichen Willenskundgabe wird mit dem Hinweis auf den rechtsstaatlichen, nicht willkürlichen Charakter dieser Gewalt verlängert und im Lob der demokratischen Grundsätze von Freiheit, die durch ihre staatliche Beschränkung verwirklicht wird, und politischer und rechtlicher Gleichheit, die keine soziale sein darf, zum reinen Staatsidealismus verklärt, dessen Grundlage in der Konkurrenz in den legitimatorischen Sprüchen über die Notwendigkeit des Staates zur Bändigung und Erfüllung der Menschennatur aufscheint. Der Blick in die Vergangenheit der Staaten-und „politischen Ideenwelt“ dient mit den entsprechenden Vergewaltigungen früherer, keineswegs politologischer Denker als Beleg, dass die heutige Demokratie alle Menschen-, sprich Staatsbürgersehnsüchte verwirklicht hat, und enthebt mit seinen Tautologien den Politologen der Antwort auf die Frage nach dem Nutzen von Freiheit und Gleichheit. (Die internationale Politik ergänzt die Verwandlung der Staatsgewalt in eine gemütliche Bürgersache durch die Proklamation der nützlichen Gewalt nach außen und benutzt den Staatsidealismus der Bürger zur Relativierung seiner demokratischen Ideale, bzw. als Grundlage des Lobs, wieweit wir es gebracht haben).
Das regelmäßige Resultat dieser wissenschaftlichen Anstrengungen, dass die Labilität der Demokratie die Stärke der besten aller schlechten Staatsformen ist, der Staat also als Gewalt am besten funktioniert, wenn er nicht beständig den Bürgern seinen Willen erst aufzwingen muss, beweist die Politologie durch die vierte Abteilung ihres wissenschaftlichen Treibens: den – in der Totalitarismusforschung zum selbständigen Zweig ausgebauten – Pseudovergleich zwischen Demokratie und Diktatur, deren Notwendigkeit im Falle einer ernsthaften,Krise der Demokratie‘ damit eingestanden und bedauert wird. In der Abwägung der diversen Vor-und Nachteile von Diktatur und Demokratie, der stets zugunsten letzterer ausfällt, wird die Demokratie als Mittel der Verhinderung der Diktatur besprochen, ihr damit das unvermeidliche Armutszeugnis ausgestellt (das sich hierzulande in das Lob kleidet, dass die BRD es bisher im Unterschied zu Weimar geschafft hat, die Demokratie ohne Faschismus zu retten, und die DDR beständig beschämt). Das gibt den Übergang zur Beschwörung der notwendigen Grenzen der Demokratie und zum direkten Angriff auf die bürgerliche „Staatsverdrossenheit“ ab. Schuld an der Gefährdung der Demokratie sind ihre Kritiker, die den Bürger immer noch freier und gleicher, die Demokratie immer direkter und zum Prinzip des gesamten gesellschaftlichen Lebens machen wollen (ein Vorwurf, dem die Kritiker normalerweise recht geben): Demokratisierungsdebatte. Das eigentliche Problem der Demokratie aber ist der Bürger als solcher, der sich zu wenig, zu viel, zu unsachverständig an ihr beteiligt, zu wenig demokratische Bildung besitzt und seinen Egoismus nicht staatstreu relativieren will, weil ihm die Mündigkeit fehlt.
Mit dem Eingeständnis, dass sie nur ein Problem quält, die willentliche Unterstützung der Staatsgewalt, löst sich die Politologie in die offene Propaganda der Staatsgewalt gegen die Bürger auf und kann als solche ihre Nützlichkeit für die staatsbürgerliche Zurichtung im Deutsch-, Geschichts-, Heimatkunde- und Sozialkundeunterricht beweisen. Da sie sich aber die bleibende Kritik am Staat als ihren eigenen Mißerfolg ankreidet, hat sie sich inzwischen um die empirische Abteilung erweitert, die durch Wahlanalysen usw. dem Staat praktische Hilfestellung bei der Beurteilung bzw. Verbesserung seiner Bestandsaussichten geben will, ferner eine kritische Politologie hervorgebracht, die – wie immer in schöpferischer Abwandlung amerikanischer Vorschläge, den Bürger mehr für den Staat zu interessieren – mit der Soziologisierung aller politologischen Probleme dem Staat empfiehlt, durch mehr Zufriedenheit unter seinen Bürgern seine Legitimität zu erhalten; schließlich fehlen auch nicht die in allen Wissenschaften üblichen methodologischen Verrenkungen, die das Scheitern in Form wissenschaftlicher Vorschriften für eine nützliche Politologie besprechen und auch Marx zu einem Gehilfen für diese degradieren.
2. Da es das parlamentarische Hin und Her nur gibt, wenn die Bürger ihr Interesse am Staat soweit entwickelt haben, dass sie wählen gehen, also auch der Dialektik von Erwartung und Enttäuschung regelmäßig Pflege angedeihen lassen, stellen sie mit ihrer Enttäuschung auch nicht ihre Erwartungen infrage, sondern widmen sich der intensiven Suche nach den Mängeln in den demokratischen Prozeduren, denen sie die Nichterfüllung ihrer Erwartungen zur Last legen können. Am Procedere der Demokratie bewähren sich die kritischen Staatsbürger in ihrer armseligen Unterwürfigkeit – ihr vernachlässigtes Interesse bemäkeln sie als politologische Amateure, die ihre nicht vorhandene Aufmüpfigkeit durch die Anerkennung der professionellen Agitatoren, die sie in die Schranken weisen, nur allzu bereitwillig eingestehen. Die Politiker sind ihnen Gegenstand persönlicher Sym- oder Antipathie, ihre Propaganda zu unsachlich, zu wenig auf ihre Interessen bezogen, zu elitär, eine Stilfrage. Die Tätigkeit der Parteien im Parlament ist ihnen nicht verständlich genug, zu wenig transparent, lässt zu wenig Alternativen erkennen und erschüttert ihr Vertrauen in die Würde des Hohen Hauses. Auf der einen Seite vermissen sie die echte Konkurrenz zwischen den Volksvertretungsvereinen, auf der andern fürchten sie sie. Im Wahlkampf fühlt sich der Demokrat wohl, weil er das, was von seiner Stimme abhängt, überschätzt; Unwohlsein bereitet ihm die Agitation, die ihn in den von der großen Politik getrennten privaten Geschäften stört und ihn, statt seinen individuellen Interessen und Ansprüchen an den Staat konkrete Entscheidungshilfen zu liefern, mit Grundwertedebatten bombardiert. Manche bedauern die Entgleisungen des Wahlkampfs, die eigentlich dem ernsten Geschäft der Politik fremd sind, und sind deshalb froh, wenn endlich wieder normal regiert wird. Die Kritik an der Agitation einschließlich ihrer Fortsetzung in der Gewaltausübung nimmt bei den konsequent enttäuschten Demokraten die Form resignativ-schlauer Verharmlosung des ,Schwindels‘ an, bei dem sie nicht mitspielen, so dass die Enttäuschung als Täuschung sinnfällig wird. Der aufrechte Demokrat bemäkelt dagegen immer erst nach der Wahl, dass sich die Regierung nun aber endgültig unglaubwürdig macht, was ihn bisweilen zur Teilnahme an den Debatten bewegt, wie das Verhältnis des Volkes zu seinen Repräsentanten enger gestaltet werden könne.
Es ist also nicht überflüssig, den demokratischen Zirkus ausführlich zu kritisieren, obwohl noch jeder Bürger ihn in-und auswendig kennt, so gut wie kein gutes Haar an ihm lässt und von den Medien ganz und gar nicht manipuliert, sondern laufend mit den brutalen Berechnungen und Techniken seiner Repräsentanten bezüglich der Stimmenfängerei konfrontiert wird. Zwar handelt es sich bei den vielgepriesenen demokratischen Prozeduren um alles andere als den Betrug an den fortschrittlichen Hoffnungen des Volkes; aber die Kenntnis des demokratischen Getriebes und des Charakters seiner politischen Agenten, die Unzufriedenheit über die periodischen Bemühungen um sein politisches Bekenntnis hindern den Bürger nicht daran, es periodisch abzulegen. Die Moral seines allmächtigen Staatsbürgerverstandes besteht nämlich nicht darin, sich Illusionen über die Rücksichtslosigkeit des politischen Geschäfts zu machen, sondern an sie Erwartungen zu knüpfen, also mit ihr zu rechnen. Zu dieser Rechnung gehört das Bewusstsein, dass es beim Kampf um die Macht zugeht wie im Leben, mit dem kleinen Unterschied, dass hier die Inhaber der Macht am Werk sind und er ihr Hilfsmittel ist. Deswegen paart sich auf diesem Feld die staatsbürgerliche Kritik ohne Umschweife mit dem umstandslosen Verständnis für die Notwendigkeiten und Zwänge des politischen Geschäfts, und die kritischen Stimmen zur Wahl sind weder mehr als eine Pflichtübung in Sachen idealer Demokratie, noch wollen sie mehr sein.
Auch die revisionistische bzw. faschistische Kritik bildet keine Ausnahme von dieser allgemein bekannten demokratischen Heuchelei – nur ist sie weniger anerkannt. Für die Revisionisten ist die Volksvertretung keine wahre, weil nicht unabhängig von den Interessen und Einflüssen der mächtigen Monopole und ihrer Verbände (Stamokap), dafür aber zu wenig abhängig von den Interessen der Mehrheit des Volkes, der sie schaden, was das imperative Mandat als Alternative einer wirklichen Demokratie wünschenswert erscheinen lässt nebst Wahl aller Beamten durch das Volk. Wahlen sind wegen ihres zweifelhaften Nutzens für die Wählermehrheit ein Betrug, es sei denn man wählt die wahre Alternative, die revisionistische Partei, die sich schon durch die Klassenherkunft ihrer Kandidaten gegenüber den abgenutzten Lakaien der Herrschenden auszeichnet. Einmal an die Macht gekommen, schaffen sie deshalb auch die Demokratie im Namen der Demokratie ab. Für die verstaatlichte Ausbeutung sind Wahlen zwar nicht mehr Mittel der Zustimmung und Repräsentation, aber dennoch nicht ganz unbrauchbar: demokratische Prozeduren als erzwungene Akklamation.
Als einzige Alternative zu den verbrauchten bürgerlichen Parteien preisen sich auch die Faschisten an. Sie haben jedoch die Schwächung des Staates im Auge, die sie im Konkurrenzkampf der Parteien, im Opportunismus der Repräsentanten und in der Orientierung der Politiker an den Launen der Bürger, die mehr an sich als an den Staat denken, entdecken. Die demokratischen Parteien und ihre Führer sowie die parlamentarischen Prozeduren halten sie für eine einzige Gefährdung des Staats, der Einheit des Volkes, des Bestands der Nation. Die Notwendigkeit des Staats spielen sie konsequent gegen ihren Grund, die Konkurrenzinteressen und ihre Äußerungen im politischen Getriebe, aus; alle Verlautbarungen des Bürgerwillens, welche die Bedingungen zum Vorschein kommen lassen, unter denen er ein Wille zum Staat ist, gelten dem Faschisten als Element des Kommunismus. Seine Ideale sind Saubermann und Opfermut, ihre Praktizierung rettet das Volk; Demokraten sind Staatsfeinde. Wenn es Faschisten gelingt, mit Hilfe der Mehrheit der enttäuschten Staatsbürger die Macht zu ergreifen, präsentieren sie dem Volk die Inkarnation seines einheitlichen, weil von seinen Interessen absehenden Willens. Der Führer lässt sich ebenfalls akklamieren, allerdings nicht als Vollstrecker von Interessen – er ist das personifizierte Ideal, die Nation. Das unterstellt freilich, dass der Materialismus aus der Politik verschwunden ist, weswegen nicht nur Juden in den KZs verschwanden.