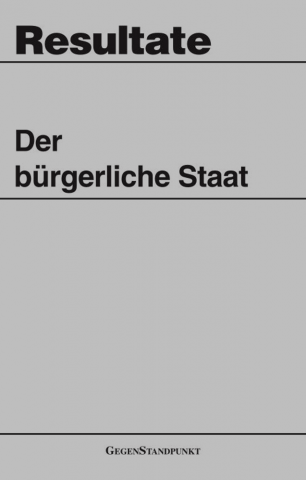§ 10
Bürgerliche Öffentlichkeit – Meinungspluralismus – Toleranz
Da der Staat periodisch von seinen Bürgern die Entscheidung verlangt, auf die Führung der Staatsgeschäfte keinen Einfluss nehmen zu wollen, dafür aber die Konsequenzen dieser Geschäfte widerstandslos zu ertragen, ist sein demokratisches Funktionieren davon abhängig, dass die Enttäuschung der regierten Bürger als positive Grundlage, als Willen zum demokratischen Staat, erhalten bleibt. Dem unausbleiblichen Vergleich zwischen Erwartungen an den Staat und seinen Leistungen bricht er dadurch die Spitze ab, dass er die Artikulation jedes gesellschaftlichen Interesses zulässt, um die gegensätzlichen Ansprüche der Bürger an ihn sich relativieren zu lassen und als nicht gleichzeitig realisierbar abzuweisen. Das Interesse des Bürgers wird zur Meinung, weil ihm der Staat durch die Konfrontation mit den konkurrierenden Interessen anderer die Partikularität seines Standpunkts zur Last legt und nur noch den Wunsch, aber nicht seine Berechtigung anerkennt. Er begrüßt den besagten Vergleich als theoretischen, um an ihm seine Ideologie des Interessenausgleichs in die Propaganda der Toleranz und des Meinungspluralismus zu verlängern.
Aus dem Buch
Systematischer Katalog
Teilen
§ 10
Bürgerliche Öffentlichkeit – Meinungspluralismus – Toleranz
Da der Staat periodisch von seinen Bürgern die Entscheidung verlangt, auf die Führung der Staatsgeschäfte keinen Einfluss nehmen zu wollen, dafür aber die Konsequenzen dieser Geschäfte widerstandslos zu ertragen, ist sein demokratisches Funktionieren davon abhängig, dass die Enttäuschung der regierten Bürger als positive Grundlage, als Willen zum demokratischen Staat, erhalten bleibt. Dem unausbleiblichen Vergleich zwischen Erwartungen an den Staat und seinen Leistungen bricht er dadurch die Spitze ab, dass er die Artikulation jedes gesellschaftlichen Interesses zulässt, um die gegensätzlichen Ansprüche der Bürger an ihn sich relativieren zu lassen und als nicht gleichzeitig realisierbar abzuweisen. Das Interesse des Bürgers wird zur Meinung, weil ihm der Staat durch die Konfrontation mit den konkurrierenden Interessen anderer die Partikularität seines Standpunkts zur Last legt und nur noch den Wunsch, aber nicht seine Berechtigung anerkennt. Er begrüßt den besagten Vergleich als theoretischen, um an ihm seine Ideologie des Interessenausgleichs in die Propaganda der Toleranz und des Meinungspluralismus zu verlängern.
Die Praktizierung dieser Ideale erreicht er, indem er die für die Information seiner Bürger notwendigen Institutionen darauf festlegt, dass sie alle zur Sprache gebrachten Interessen im Hinblick aufs Allgemeinwohl relativieren. Er verpflichtet diejenigen, die das Interesse an Information und Kritik zu ihrem Beruf gemacht haben, auf die Verwandlung sämtlicher Staatsaktionen in mehr oder weniger gelungene Wohltaten fürs Volk – und auf die Umdeutung aller Opfer in alternative Staatsprogramme. Zusätzlich schaltet er sich selbst als Agitator in seine Öffentlichkeit ein, wobei er sich mit gewissen Sonderrechten ausstattet, oder nimmt sie als öffentlich-rechtliche Anstalten unmittelbar in seine Pflicht. Das Prinzip der bürgerlichen Öffentlichkeit, die der demokratische Staat mit einigem Aufwand institutionalisiert und benutzt, besteht also darin, dass die Opfer der Staatsgewalt ihre Interessen auf Meinungen herunterbringen lassen, dieselben von ihrem Handeln trennen und in der Gegenüberstellung beider die Wahrheit ihrer Bedürfnisse zugunsten von Staatsillusionen aufgeben, um den Trost zu genießen, dass wenigstens ihre falschen Gedanken frei sind.
a)
Die gar nicht geringe Leistung, die der demokratische Staat der Mehrheit seines Volkes abverlangt, erschöpft sich also nicht darin, dass es sich als Material der Ausbeutung dienstbar macht. Es soll sich darüber hinaus positiv um die Ausgestaltung der Gewalt kümmern, die seiner Ausbeutung den würdigen Rahmen verleiht, den sie nicht entbehren kann. Die Demokratie begnügt sich nicht mit der schlichten Unterordnung des Willens unter die Staatsgewalt, sie erinnert ihn ständig daran, dass diese Unterordnung seine eigene Selbstaufgabe zu sein hat. Diejenigen Bürger, die den Staat wollen müssen und beständig enttäuscht werden in ihrem erzwungenen Kalkül, dass sie dem Staat, den sie brauchen, auch g e brauchen können, erfreuen sich der besonderen Pflege ihrer Enttäuschung: die Unzufriedenheit wird zu ihrem Recht, der Misserfolg zum Bestandteil des freien Willens. Er gilt trotz staatlich verordneten Beschränkungen, indem er die objektiven Hindernisse seiner Betätigung zu seiner ureigensten Qualität erhebt. „Schlaf ein, mein Liebling, alles was man will, das kann man nicht haben!“ Der Staat benützt den Anspruch seiner gebeutelten Untertanen an sich so, dass er das Einverständnis mit seiner Existenz, welches im Anspruch liegt, gegen die Unzufriedenheit mit seiner Verwaltung des Allgemeinwohls kehrt und die Erwartung mit der Faktizität seiner Entscheidungen widerlegt. Er blamiert alle unerfüllten Wünsche mit seiner Realität, wobei er nicht versäumt, seine eindeutigen Zielsetzungen wieder und wieder in Ohnmacht gegenüber den ganz verständlichen Anliegen zu übersetzen – und verlangt von denen, die ja als Bürger zu ihm kommen, dass sie ihren freien Willen behalten: als relativierter ist er gerettet !
b)
Der sich selbst relativierende freie Wille zeichnet den Staatsbürger aus, der trotz aller Enttäuschungen durch seinen Staat einer bleiben will. Sein Interesse hat er nicht einfach aufgegeben, sondern sich zu einer theoretischen Stellung zu ihm durchgearbeitet: die Anliegen, die er hat, will er nicht realisieren, er möchte, dass sie im Rahmen der demokratischen Ordnung und ihrer Notwendigkeiten realisierbar sind. Die Antizipation der negativen Bescheide von seiten der Staatsgewalt sowie der resignativen Hinnahme derselben verwandelt nicht nur seinen Willen in einen nicht praktizierten, also theoretischen, so dass in der bürgerlichen Gesellschaft noch jedem Blödmann die Gleichsetzung von „theoretisch“ und „nicht möglich“ eine ausgemachte Sache scheint – auch die Gewißheit seines Bedürfnisses, sein Bewusstsein von dem, was er nötig hat, wird ein nur bedingt gültiges: der Bürger hat eine Meinung von dem, was ihm von Staats wegen zusteht. Wenn er es in seinen Äußerungen nicht schafft, alles über seine Interessen Gesagte mit den Insignien der Relativierung zu versehen, werden ihn seine Mitmenschen zurechtweisen, dass er nur seine Meinung vertrete. Nimmt man die Form des Argumentierens ernst, dann besteht das Hin und Her in der bürgerlichen Öffentlichkeit nur in einem Argument, nämlich dem, dass keine Meinung etwas gilt, da ( ! ) es auch noch andere gibt. Der Staat spielt in diesem Getue die erste Geige; er relativiert alle Meinungen und demonstriert, weshalb seine eigene immer gilt: er hat die Macht, allen zu beweisen, dass ihr objektives Interesse darin besteht, dass sie von ihrem „bloß“ subjektiven Bedarf Abstand nehmen.
c)
Die Toleranz ist das vom Staat gegen alle verkündete Ideal der Gewalt, an der jedem etwas liegt – negativ zu den anderen. Während in den wohlbehüteten Sphären bürgerlicher Öffentlichkeit der Staat für den Meinungspluralismus zu sorgen weiß, Polemik also ausgestorben ist und nur dem Schein nach als Streit um die Frage „Wer ist der bessere Demokrat?“ u.ä. vorkommt, merken die Leute unter Umständen, in denen der Staat nicht präsent ist, sehr schnell, dass sie keine Meinungsverschiedenheiten haben – im trauten Kreise von Familie und Wirtshaus ist die Kundgabe eines Interesses noch immer der Auftakt für Schlägereien. An ihnen kann man sehen, was der Staat mit der Meinungsfreiheit kodifiziert: das Verbot, Interessengegensätze anders zu behandeln als in der Form von differierenden Ansichten. Meinungen müssen vorgebracht werden können um welche zu bleiben. Die Gefahr, dass seine Bürger Meinungsäußerungen als Argumente ernstnehmen und gegen den Staat gerichtete Meinungen zum Anlass nehmen, etwas gegen ihn zu unternehmen, bringt noch jeden demokratischen Staat zu der Überlegung, wo die Freiheit der Meinungsäußerung und die Pressefreiheit ihre Grenze haben muss (GG Art. 18), eine Überlegung, die bei uns durch § 88a und andere fortgesetzt ist. Aus gegebenem Anlaß wird es sich also keine Demokratie nehmen lassen, von sich aus Meinung mit Willen gleichzusetzen, und sie handelt sich von seiten der Demokraten sicherlich in all diesen Fällen die Kritik ein, dergleichen störe die Botmäßigkeit der Bürger empfindlich – womit sie das Geheimnis der demokratischen Öffentlichkeit aussprechen.
d)
Dem demokratischen Staat gilt die freie Meinungsäußerung als etwas Positives, weil sie seine Bürger politisiert: Die Presseorgane und Medien nehmen eine öffentliche Aufgabe wahr, wenn sie an den Bürgern die Gewohnheit ausbilden, die Korrektur ihres Materialismus durch die Unterwerfung unter den Staat an sich selbst vorzunehmen, so dass sie schon als Staatsidealisten zu streiten anfangen. Weil jedoch auch staatsbürgerliche Interessen den ihnen zugrundeliegenden Gegensatz nicht zum Verschwinden bringen, spielt sich zwischen professionellen Verfechtern von Sonderinteressen nicht nur das wechselseitige Bestreiten ihrer Anliegen an den Staat ab: es verallgemeinert sich auch die Kritik an Regierung und Parlament, zu der die Herren Journalisten noch von jedem Standpunkt aus gelangen. Gerade die Verwandlung jedes nicht berücksichtigten Bedürfnisses in eine Unterlassung der Herren von der Politik bringt diese in Gegensatz zu den Agitatoren des Staats. Deshalb spielt sich die Konkurrenz der Parteien außer in ihren Organen vor allem als Kampf um die Möglichkeit der Selbstdarstellung, als Medienpolitik ab, die besonders in den öffentlich-rechtlichen Anstalten in Streitereien um Sendeminuten und dergleichen ausartet. Auf der Basis des gemeinsamen Interesses am Staat suchen Journalisten Politiker auf und laden Politiker Journalisten ein, um sich wechselseitig die Meinung zu sagen – und diese langweilige Praxis wird regelmäßig durch einstweilige Verfügungen, Beleidigungsklagen und Schadenersatzprozesse mit hohem Streitwert (es geht um die Ehre!) unterbrochen. Und weil manchmal schon die Verbreitung eines Sachverhalts so gut wie eine interessierte Interpretation politischer Untaten das Ansehen eines Staatsmannes ramponiert, das Vertrauen der Bevölkerung in den Staat erschüttert oder gar dem äußeren Feind die Spionage zu billig macht, erscheint manchem Politiker die freie Presse als eine staatszersetzende Mafia, was umgekehrt dazu führt, dass Journalisten jeden Staat und seine Vertreter daran messen, wieviel sie für die Pressefreiheit übrig haben. Vor einiger Zeit galt die höchste Sorge eines solchen Schreibers mitten im „vom Krieg“ zerstörten SO-Asien seiner Schreibmaschine!
Die Auseinandersetzungen zwischen Politik und Journalismus beruhen auf ihrem gemeinsamen Anliegen, auf Kosten der unzufriedenen Bürger die Harmonie zwischen Staat und Bürger herzustellen. Die Politiker sähen es am liebsten, wenn sich ihre Propagandatrupps bei ihnen selbst auf die Beweihräucherung ihrer Verantwortung, ihres schweren Amtes, des Dilemmas, der schmalen Grate zwischen allem und jedem, ihrer Energie, des Sachverstandes, der Leidenschaft, der Sachlichkeit, der Integrität etc. etc. beschränkten, kurz: sie möchten dafür gelobt werden, dass sie Staatsmänner sind und die undankbare Aufgabe übernommen haben, die so vielen Ansprüchen gegenüber bekannte Ohnmacht des Staates auf ihre Schultern zu laden. Dem agitierten Publikum gegenüber vermissen sie die Reduktion der Staatspropaganda auf moralische Ermahnungen und die Belehrung über die Pflichten des Staatsbürgers. Obgleich die Journalisten all das tun, was ihre öffentliche Aufgabe ist (in schweren Stunden pflegen sie einhellig die freie Meinung des Bundespressesprechers wiederzukäuen!), können sie nicht umhin, den Grund ihres Berufes: den Gegensatz zwischen Staat und der Mehrzahl seiner Bürger, zu erwähnen, und zwar so, wie sich das für jemanden gehört, der sich um den effektivsten Staat bemüht. Sie tadeln nämlich ihre Adressaten immer und die Staatsmänner nur dafür, dass sie ihr Zeug nicht geschickt genug, nicht rechtzeitig, nicht im richtigen Stil usw. machen, dass also die Unannehmlichkeiten, die sie den Bürgern bereiten, auf Kosten von deren Vertrauen in den Staat gehen. Sie beherrschen alle von § 1 bis § 9 erwähnten Formen der staatstreuen Kritik und ergreifen innerhalb der darin angelegten Alternativen Partei für eine Parteilinie, die sie – ob diese sich nun in der „Regierungsverantwortung“ oder in der Opposition befindet – in ihren Vor-und Nachteilserwägungen vom Standpunkt des Staats dann eben hoch-leben lassen. Ihr Bezug auf die Parteienkonkurrenz erscheint so als Quelle für die Unzufriedenheit von Politikern mit den Elaboraten ihrer Agitatoren, die sie deshalb so gerne durch eigenes Auftreten in den Medien ergänzen (man lässt sich zitieren) oder ersetzen (Parlamentsdebatten in Funk und Fernsehen, Wahlkampf) – wenn sie nicht der freien Presse insgesamt skeptisch gegenüberstehen.
Das ungemein lebhafte Hickhack zwischen den berufenen Repräsentanten der Öffentlichkeit und denen, die sie brauchen, ist also nicht zufällig ein immerzu breitgetretenes Thema der Zeitungen und Funkanstalten. Die methodischen Diskussionen über das eigene Handwerk gehört zu diesem, weil es beständig sein Scheitern befürchten muss: die Information, das was den Leuten verkauft wird, ist zwar stets die demokratisch zugerichtete Interpretation der Opfer, die die letzten Staatsmaßnahmen fordern – als Abstraktion von den materiellen Interessen der Mehrheit hat sie aber den agitatorischen Mangel, das stets erwähnen zu müssen, worauf es ihr nicht ankommt. Nicht, dass demokratische Journalisten deshalb die Revolution befürchten – solange sie vor der Radikalisierung des Pöbels anlässlich ungeschickter politischer Entscheidungen warnen, ist die Gefahr nicht groß – sie stehen vor einem ganz anderen Problem. Ihre Kommentare zum Für und Wider politischer Alternativen finden nicht genug Anklang bei den Geschädigten, die andere Sorgen haben, als die Abstraktion von ihren Bedürfnissen zum politischen Engagement werden zu lassen. Bereitschaft zum Gehorsam, auch zur Wahl eines kernigen Burschen zum Regierungsoberhaupt ist noch nicht dasselbe wie die hingebungsvolle Beschäftigung mit den Finessen demokratischer Effizienz.
Aber auch dem wird in der bürgerlichen Öffentlichkeit Rechnung getragen. Schließlich ist der „einfache Mann“ deswegen, weil er nicht so tut, als wäre Politik oder die Werbung für sie sein Beruf, noch lange kein unpolitischer Mensch. Er heißt ja deswegen einfach, weil er sich alle Accessoires des Durchkommens in seiner Scheiße angeeignet hat, und zwar ohne alle Schnörkel. Er kann sehr wohl unterscheiden, wann er den Hut in der Hand zu halten hat und wann er sich von einem dahergelaufenen Messerstecher nichts sagen lassen darf; er kennt die Anlässe, in denen er sich als deutscher Arbeiter zu behaupten hat, und auch die Situationen, in denen er mit dem Schnaps prahlen muss, den ihm ein Studierter bezahlt hat. Wer sich so benimmt, bedarf gar nicht der komplizierten Agitation einer ,Süddeutschen Zeitung‘ und der politischen Magazine. Sein Gemüt ist politisiert, so dass es bestätigt werden kann – jede Störung würde Schaden anrichten. Diesen Grundsatz beherzigt die Abteilung „Massenbetreuung“ der bürgerlichen Öffentlichkeitsarbeit – sie ist ihrer Natur nach faschistisch, weil sie jede Regung demokratischer Ideale auf ihren staatspolitischen Kern, auf die Notwendigkeit staatlicher Ordnung überhaupt, reduziert. Hier wird nie über die Problematik eines Verfahrens gehandelt, das Politiker einschlagen, nie über das Verhältnis eines neuen Gesetzes zum Sozial-oder Rechtsstaat (es sei denn, die „DDR“ oder andere Satelliten sind das Thema), und Flügelkämpfe in den Parteien sind entweder Zeichen der Gesundheit oder des Kommunismus – nichts dazwischen. Es regieren der gesunde Menschenverstand und der gute Geschmack, der Gelegenheit bekommt, sich zu entlarven, denn dem faschistischen Gerechtigkeitswahn ist gerade die Unterhaltung eine Gelegenheit, den öffentlichen Auftrag der Meinungsbildung zu erfüllen:
1. Wenn die Massen positiv zur staatlichen Gewalt stehen und zugleich unzufrieden mit der praktizierten Politik sind, dann liegen sie richtig. Die Aufgabe der Massenblätter besteht darin, ihnen die Schuldigen zu nennen. Sowohl innerhalb der Politik treiben sich Leute herum, die nur den Schaden des Ganzen wollen (also Kredite verschenken, sich mit Kommunisten einlassen, den Haushalt in Unordnung bringen, den Gewerkschaften Zucker in den Arsch blasen, Verbrecher mit Stipendien versorgen etc.), als auch in den verschiedensten Winkeln der Gesellschaft. Die Entlarvung dieses Gesindels fordert geradezu den Trost heraus, den wertvolle Bürger verkörpern – die es eben auch überall gibt. Die Moral dieser politischen Berichterstattung läuft darauf hinaus, dass jeder anständige Bürger noch anständiger bleibt, mit dem Staat zufriedener und seinen Schädlingen und Schmarotzern gegenüber unversöhnlich.
2. Zur Pflege dieser Staatsbürgermoral gehört die ausführliche Kenntnisnahme von Verbrechen aller Art, die jedermann beweisen, wieviel Schwierigkeiten der Staat bei der Zähmung von Unmenschen hat, die den guten Bürger bedrohen, wieviel Unterstützung er dabei verdient. Dieser Beweis und der andere, dass sich Verbrechen nicht lohnen, reichen jedoch dem nicht aus, der den Gerechtigkeitssinn seiner Adressaten schärfen will – dass man mit bestimmten Verhaltensweisen Verbrechen gegen sich herausfordert, muss ebenfalls gesagt werden: Differenzierungen hinsichtlich der Verständlichkeit der Motive; Opfer, denen es recht geschieht, neben völlig Unschuldigen.
3. So kann eine Ehegattin nicht mit Verständnis rechnen, wenn sie wegen dauernder Fremdgeherei von ihrem Mann, der eine Zahnarztpraxis hat und bei allen Patienten sehr beliebt ist, erstochen wird. Weil der Frust des Familienlebens allzuviele auf krumme Gedanken bringt, ist die Liebe auch außerhalb von Justizhämmern eine wichtige Sache – das Thema rückt wegen der staatlichen Gebote mit ihrer demolierenden Wirkung auf einigen Seiten der Boulevardzeitungen ganz in den Mittelpunkt des Lebens. Nackte Weiber inklusive Tipps für den Umgang mit dem Hänger daheim.
4. Dass die Massenkultur eine Anstalt der Moral ist, deshalb die Dialektik von Liebe und Heimat, Verbrechen und Hula Hula ausschöpft, ist aus § 5 bekannt. Die Herren Kulturproduzenten brauchen nichts davon zu wissen, wie sehr sie sich dem Begriff des Staates verdanken. Sie müssen sich nur an den Geschmack des Publikums, also an ihren eignen anlehnen – und schon haben sie die Ideale der bürgerlichen Welt bebildert, samt der ihnen einbeschriebenen Enttäuschungen. dass die diesbezüglichen Kunst-werke keine mehr sind, obgleich sie denselben Inhalt haben wie die große bürgerliche Kunst, zeigt nur, dass Schönheit ohne Wahrheit nicht zu machen ist.
5. Gemeinsam ist den beiden Ebenen politischer und kultureller Agitation, dass sie die Affirmation allen Übels und aller Opfer darstellen, die sie zum Gegenstand haben. So deckt sich das Interesse dieser Leute mit dem Grund ihrer Existenz; ihre moralische Agitation begrüßt den Schaden, dessen Hinnahme sie bewirkt; sie sind Virtuosen in der Anwendung des soziologischen und psychologischen Denkens.
e)
Wenn das Prinzip der bürgerlichen Öffentlichkeit darin besteht, dass bei allen Kontroversen zwischen Privaten und Staat die Kritik des Publikums Zustimmung zum Staatszweck unterstellt, dann hat es Pressefreiheit und dgl. solange nicht gegeben, wie die Kritik bestimmter Interessengruppen die Veränderung des Staates, d.h. seines Verhältnisses zu den Klassen implizierte. Begrifflich und historisch letztes Moment in der demokratischen Apparatur – anders in Amerika, wo freie Konkurrenz der Ausgangspunkt war und nicht der Feudalstaat!
f)
Das soziologische Denken ist deswegen ebenso wenig uralt wie das psychologische, auch wenn beide Abteilungen bürgerlicher Wissenschaft sich auf Platon und Aristoteles berufen. Es ist nämlich etwas anderes, ein Buch über den Staat oder über die Seele zu schreiben, als das zu tun, was die beiden modernen Disziplinen sich in ihren Rezepten für die Erhaltung der bürgerlichen Gegensätze ausdenken.
Die Soziologie hat es mit den Schwierigkeiten, die sich dem Staat darbieten, wenn er der bürgerlichen Gesellschaft ihr gegensätzliches Funktionieren aufherrscht. Die Erfahrung, dass im Kapitalismus manches nicht klappt, solange das ganze System klappt, drängt sie zur Frage, welche Bedingungen erfüllt werden müssen, damit nichts kaputt geht am Ganzen. So nimmt es nicht wunder, dass sie auf die Institutionen des Staates als die Möglichkeiten für die unangenehmen Pflichterfüllungen seitens der Individuen stößt, die Rollen zu spielen haben, welche sich aus den Normen ergeben, die sich tautologisch aus den Rollenerwartungen entspinnen. Alle Bestimmungen der ökonomischen Subjekte, also auch ihre staatsbürgerlichen Taten, werden auf ihren Beitrag zum Ablauf des sozialen Systems hin abgeklopft, avancieren zu Unterabteilungen sozialen Verhaltens, was die gelungene (oder auch nicht) Bezugnahme der Rollenträger auf die Notwendigkeiten des Systems meint. Diese Bezugnahme spielt sich fast nur im Verhältnis zu anderen Typen ab, ist Interaktion und hängt enorm davon ab, ob die sozialen Atome sich ordentlich verständigen. Kommunikation muss her, wenn Christen und Lehrlinge, Oberschüler und Kaufleute ihren Beitrag zur Erhaltung des Normengefüges leisten sollen, das ohnehin durch abweichendes Verhalten häufig genug gestört wird. In ihrer Betrachtung aller gesellschaftlichen Vorgänge vom Standpunkt des idealen Kapitalismus leistet diese Wissenschaft nun zwar einen Beitrag zum Arsenal von Einstellungen, den die Ausbildung den werdenden Bürgern beizubringen hat, setzt sich aber im übrigen dem Verdacht aus, dem Staat nur unnütze bis revolutionäre Theorien zu präsentieren, weswegen sich soziologische Denker um einen echten Nutzen für die praktischen Belange des Staates bemühen: empirische Sozialforschung, ungeheuer praxisnah.
Die Psychologie hat das Odium der Weltfremdheit, der Gleichgültigkeit gegenüber den praktischen Notwendigkeiten der bürgerlichen Welt von vornherein vermieden. Sie stellt die Probleme, deren sich der Staat in der öffentlichen Agitation annimmt – der Wille der Staatsbürger soll sich aufgeben –, als menschliche Fürsorge dar. Sie denkt an nichts anderes als an die Leistungen, die bürgerliche Individuen immer wieder nicht bringen, und verspricht Abhilfe qua Therapie. Das Individuum gilt ihr als ein Bündel von Fähigkeiten, die es einsetzen muss, um zurechtzukommen, und all denen, die nicht zurechtkommen, macht der Psychologe weis, es läge an ihnen. Wer es nicht schafft – nicht arbeits-, denk-, lern-, liebesfähig ist –, den fordert er auf, sich zu normalisieren, und seine Theorien, ob von Freud oder von Skinner, sind Programme zur Domestizierung des widerspenstigen Willens. Wohlgemerkt: Dies alles betreibt die Psychologengattung unter dem Vorwand, den Leuten zu helfen, und der Staat gestattet ihnen diese Hilfestellung in Schulen und Gefängnissen, Gerichtssälen etc. In den Medien hat der psychologische Angriff auf die Individualität längst als beinharte Agitation seine Bewährungsprobe hinter sich: kollektive Analyse für den kleinen Mann.
g)
Die öffentliche Agitation des Staates, sein unablässiges Drängen auf „konstruktive Kritik“, auf das Engagement seiner Bürger für die Institution, die sie wählen müssen, ruft bei all denen, die sich engagieren, konstruktive Kritik hervor. Dem alltäglichen Lob der Meinungs- und Gedankenfreiheit setzen Bürger, bisweilen auch gemaßregelte Journalisten, den armseligen Einwand entgegen, dass die freie Meinung keiner Zensur bedürfe, vielmehr eine Sache des verantwortungsvollen, mündigen Gebrauchs zu sein habe. Mit Inhalt und Zweck der öffentlichen Meinungsbildung einverstanden, erhitzen sie sich nur allzu gerne über formelle Beschränkungen der Massen-und anderer Kommunikation. Man kommt in der Diskussion nicht oft genug dran, obwohl man den Finger oben hat; dem Springer gehören alle Zeitungen; die Meinungsvielfalt ist keine richtige; nur (!) vor den Wahlen wird man gehört; die Kommunikation ist einwegig, jeder müsste zugleich Sender und Empfänger sein; Informationen werden verfälscht und verschwiegen, unterdrückt, kurzum: Manipulation allenthalben, Irreführung der Menschheit, ein Vorwurf, der an Dummheit nicht überboten werden kann angesichts der Deutlichkeit, mit der gesagt wird, was man vom Volk will.
Die Rechten entdecken in jedem engagierten Diskutierer einen Kommunisten, der sich anmaßt, in den ohnehin umständlich demokratisch ablaufenden Gang der Staatsgeschäfte einzugreifen. Ganze Redaktionen sind unterwandert, und die Diskussion mit dem Pöbel geht schon viel zu lange vor den Sachverstand.
Der bürgerliche Staat bleibt bei alledem kalt: er weist rechte wie linke Angriffe zurück, indem er den in Demokratien herrschenden Meinungspluralismus herausstreicht und mit den Staaten vergleicht, in denen seine Kritiker das Sagen haben. Manipulation lässt er sich nicht nachsagen, und ihre Kritik ist ein heißer Renner im Erziehungsprogramm zum mündigen Bürger. Er sorgt sogar dafür, dass die Medien mit ihren Adressaten über sich und ihren staatlichen Auftrag diskutieren, wobei jede Seite mit der Wunschliste der anderen fertig gemacht wird. Leserbriefe und Wunschkonzerte sind darüber hinaus prima Demonstrationen dafür, wie sehr der Mensch wo mitgestalten kann. Das einzige, womit er Probleme bekommt, sind die Bürgerinitiativen, die sich aus Leuten zusammensetzen, die nicht nur gehört werden wollen, sondern meinen, der Staat müsse auf das hören, was er sich anhört. Hier ist für Staatsmänner der Moment gekommen zu sagen, dass sie sich dem „Druck der Straße“ nicht beugen wollen, auch gar nicht dürfen. Die Erfolge, die Bürgerinitiativen erzielen, sind keine des Drucks, sondern des Umstands, dass sie die Vertrauensfrage heraufbeschwören und bisweilen den Opportunismus einer Partei herausfordern. Wenn sie meinen, ihr Protest sei nicht Ohnmachtsdemonstration, sondern der Weg des Erfolgs im Kampf um Leistungen gegen den Staat, fordern sie ihre Widerlegung durch die Bullen heraus. Den Kindergarten im Frühjahr haben sie bekommen (die Stadtsparkasse hat auch dafür gespendet), aus den besetzten Häusern kommen sie im Sommer mit blutigen Köpfen. Ihrer politischen Einvernahme für bürgernahe Politik, ihrer Umwandlung in Hearingspartner legen sie kaum etwas in den Weg – nicht einmal dort, wo der Staat unmittelbar ihr Leben ruiniert (Kernkraftwerke).
Der Staatsbürger, der „seine Meinung“ sagt und stolz darauf ist, dass er – wenn schon sein Interesse nicht zum Zug kommt – zumindest eben seine unmaßgebliche Meinung sich nicht nehmen lässt, ist mündig. Dieses Gütesiegel wird ihm von höchster Stelle attestiert, weil er sich der demokratischen Gewaltausübung gemäß gemacht hat, mit der Gleichung Freiheit = Selbstbeschränkung ernst macht. Er hat gelernt, jede Zumutung und Auflage seitens des Staates auch als Notwendigkeit zu akzeptieren, und im Umgang mit der unzufriedenen Meinung anderer lässt er sein Einverständnis mit der politischen Herrschaft heraushängen: dass sich die Politik der Nation nicht von irgendeiner besonderen Meinung abhängig machen darf, gilt ihm als selbstverständlich – ebenso wie das Faktum, dass diese Politik „der Wirtschaft“, von der alle abhängig sind, zu dienen hat. Was in §1 noch als Arrangement des Privatinteresses mit einem äußeren Zwang erscheint, findet seine Verlaufsform im verantwortungsbewussten Umgang mit den eigenen Ansprüchen – und die Illusion vom Staat als Mittel des Bürgers nimmt die gar nicht rätselhafte Gestalt der Vorstellung an, dass man sich dieses Mittel eben nur durch Zurückhaltung erhalten kann. Alles andere zahlt sich nicht aus!
Wem der demokratische Staat diese Selbstbeherrschung lohnt, für wen sie also keine ist, bedarf keines Kommentars, ebenso wenig wie die Bereitschaft des mündigen Staatsbürgers, „sein“ Gemeinwesen gegen alle Schranken, die es bei seinen ökonomischen Vorhaben außerhalb seines Herrschaftsbereiches antrifft, zu unterstützen. (Dabei ist übrigens von vornherein das Opfer des Lebens einkalkuliert.) Demokratie und Nationalismus (samt den zugehörigen kosmopolitischen, internationalistischen Idealen) schließen sich nicht aus – Demokratie und Kommunismus schon. An jedem Argument von Kommunisten entdeckt der unzufriedene, aber meinungsstarke Bürger das kompromisslose Beharren auf dem Interesse einer Klasse und die Folgen, die dessen Durchsetzung fürs Ganze zeitigt, selbst dort noch, wo der moderne Kommunismus dieses Interesse in das Verlangen nach einem besseren, wirklich funktionierenden, echten Gemeinwesen verwandelt. dass die Presse-und Meinungsfreiheit von Kommunisten praktisch in Anspruch genommen werden, heißt eben auch nicht, dass die öffentliche Meinung ihr Mittel ist – im Gegenteil: sie werden mit den Prinzipien des meinenden Wohlverhaltens fertiggemacht, was nicht erst im KPD-Verbotsurteil bemerkbar wird. Eine Meinungsäußerung, die sich nicht im Augenblick ihres Vorbringens selbst relativiert, erfreut sich also gleich der herzlichsten Feindseligkeit –was auch im demokratisch verbildeten linken Lager zur festen Institution ausgebaut worden ist: Vorwurf des Dogmatismus, der keine Widerlegung nötig hat.