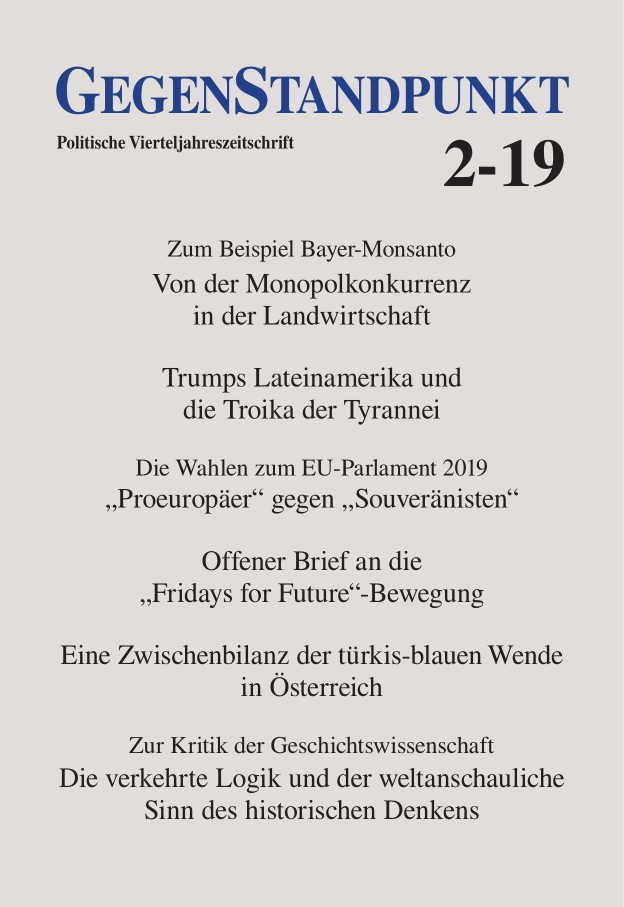Zur Kritik der Geschichtswissenschaft
Die verkehrte Logik und der weltanschauliche Sinn des historischen Denkens
Der Ertrag der historischen Betrachtungsweise besteht in der Erkenntnis, dass ‚Wir‘ ein Produkt der Geschichte sind und uns als ein solches zu begreifen haben. Was es da zu ‚begreifen‘ gilt, ist, dass sich dieses ‚Wir‘ einer höheren Notwendigkeit verdankt. Die Pointe des historischen Denkens besteht eben darin, dass es Sinn und Zweck des in seinen Betrachtungen unterstellten oder auch ausdrücklich von ihm namhaft gemachten Kollektivsubjekts, dessen Schicksal es geistig anteilnehmend verfolgt – ‚unsere Identität‘ –, nicht in dessen gegenwärtigem Dasein und Treiben ausmacht, sondern jenseits davon ansiedelt, in der Vergangenheit. Der Sinn der Wertegemeinschaft, der wir uns zurechnen dürfen, geht nach der Logik dieses Denkens aus der Geschichte hervor und besteht schlicht und ergreifend darin, zu werden bzw. geworden zu sein, was wir heute sind. Der Auftrag dieser Wertegemeinschaft ist es, sich zur Entfaltung und Geltung zu bringen, und in dessen Erfüllung hat auch ihr Dasein, folgt man derselben Logik, seine Rechtfertigung.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Gliederung
- 1. Das Prinzip Vorgeschichte: Ein Quidproquo zwischen Chronologie und Kausalität
- 2. Teleologie oder: Die Gegenwart bestimmt die Vergangenheit
- 3. Das Handwerk(szeug) des Konstruierens
- 4. Die Empirie in ihrer doppelten Funktion – als Material der Konstruktion und als Instanz ihrer Beglaubigung
- 5. Geschichtsschreibung: Die Wissenschaft erzählt Storys
- 6. Der Zweck der Veranstaltung: Sinnstiftung
Zur Kritik der Geschichtswissenschaft
Die verkehrte Logik und der weltanschauliche Sinn des historischen Denkens
Was immer das Interesse eines Historikers erregt, als Erstes interessiert ihn das Datum des Geschehens. Drei, drei, drei, bei Issos Keilerei. Solche Eselsbrücken zum Pauken von historischen Daten mögen mittlerweile etwas aus der Mode gekommen sein. Das, was man sich mit ihrer Hilfe hat merken sollen – die Jahreszahl –, gilt immer noch als grundlegend für jede historische Betrachtung. Deswegen erfreuen sich auch Nachschlagewerke wie der ‚Große Ploetz‘ oder der ‚dtv-Atlas zur Weltgeschichte‘, in denen alle wichtigen Daten der Vergangenheit chronologisch geordnet verzeichnet sind, nach wie vor großer Beliebtheit – auch wenn die Datierung von Geschehnissen zur Erkenntnis derselben wenig beiträgt, könnte man meinen. Mit einer Jahreszahl versehen lässt sich das einzelne Ereignis lediglich chronologisch einordnen; mehr als Bestimmungen wie ‚vorher‘, ‚nachher‘ oder ‚gleichzeitig‘ gibt eine Chronologie der Ereignisse nicht her.
Gerade diese zeitlichen Bestimmungen aber betrachten Historiker als grundlegend für die Erkenntnis in ihrem Fach. Ganz in diesem Sinne gibt ein Ahnvater der modernen Geschichtswissenschaft zu Protokoll, dass uns [in den Erscheinungen] das Nacheinander, das Moment der Zeit als das maßgebende [gilt]
. [1] Das historische Erkennen und Erklären zeichnet sich demnach dadurch aus, dass es sich auf die zeitliche Reihenfolge der Ereignisse stützt – und zwar in der Weise, dass man in dem zeitlich Vorhergehenden die Gründe für das Nachfolgende dingfest macht. Von Seiten moderner Vertreter dieser Wissenschaft heißt es dazu: Die Geschichtswissenschaft gründet auf der Überzeugung, dass die Gegenwart aus der Vergangenheit hervorgeht.
[2] Das Bemühen der Geschichtswissenschaft richte sich darauf, die gegenwärtige Welt als historisch gewordene zu erklären
. [3] Geschichte versteht sich als Studium der Gegenwart durch das Studium der Vergangenheit.
[4] Die Besonderheit der Geschichtswissenschaft liegt all diesen programmatischen Aussagen zufolge nicht einfach darin, dass sie Geschehnisse aus vergangenen Zeiten zum Gegenstand hat, sondern darin, dass sie ihre Gegenstände – vergangene wie gegenwärtige – historisch erklärt. Es ist der Modus ihrer Erklärungen, der sie auszeichnet: Sie erklärt ihre Gegenstände durch das Geschehen, das ihnen zeitlich vorausgegangen ist; rekurriert auf die Vergangenheit, um mit ihr die Gegenwart, d.h. das, was heute passiert, verständlich zu machen. Der schon zitierte Altmeister des Fachs erläutert dieses Programm noch einmal so:
„Unter den bedingenden Momenten für das in der Gegenwart praktisch Vorhandene ist auch das Gewordensein dieses Einzelnen, ist dessen Vorgeschichte... Daher ist es unzweifelhaft sehr wichtig, die menschlichen Geschäfte auch nach den Vorbedingungen ihres Wirkens, nach ihrem Gewordensein zu betrachten und in den Geschäften der Gegenwart nur die letzten Spitzen, das zutage Stehende der Vergangenheit, zu sehen.“ [5]
Nachdem er zunächst nur darauf hinweist, dass für die Erklärung des „in der Gegenwart praktisch Vorhandenen“ „auch“ dessen Vorgeschichte von Belang ist, pocht er im nächsten Satz bereits darauf, dass für das Verständnis des heute Gegebenen dessen „Gewordensein“ „unzweifelhaft sehr wichtig“ ist, um schließlich kategorisch darauf zu bestehen, dass die „Geschäfte der Gegenwart“ überhaupt „nur“ als Wurmfortsatz der Vergangenheit zu begreifen sind. Aus der Banalität, dass alles Existierende „auch“ entstanden sein muss, zieht er den Schluss, dass alles, was uns heute begegnet, seine Erklärung in der Vergangenheit, in den „Vorbedingungen“, den Bedingungen seiner Entstehung findet. Ein moderner Kollege vertritt denselben Standpunkt, indem er die Vergangenheit kurzerhand zum Schlüssel zum Verständnis der Gegenwart
[6] erklärt.
1. Das Prinzip Vorgeschichte: Ein Quidproquo zwischen Chronologie und Kausalität
Wenn sich der Historiker mit der Frage nach dem „Gewordensein“ seines Gegenstandes der Vorgeschichte zuwendet; wenn er sich mit der Frage, wie die betreffende Sache zustande gekommen ist, auf deren Voraussetzungen verwiesen sieht, so ist für sich genommen weder diese Frage noch die Konsequenz ein Fehler. Die Frage nach der Entstehung einer Angelegenheit kann durchaus von wissenschaftlichem Interesse sein, und eine Befassung mit den Umständen und Bedingungen ihres Zustandekommens ist dann nur konsequent. Die Rückbesinnung auf die Bedingungen, die zur Entstehung dieser Sache geführt haben, klärt darüber auf, warum es sie gibt; man weiß dann, welchen Umständen sich ihre Existenz verdankt.
Ein Fehler ist es allerdings, sich von der Klärung dieser Frage Aufschluss über die Identität der betreffenden Sache zu versprechen. Wer sich vornimmt, eine Sache mit ihrer Vorgeschichte, Gegenwärtiges mit der Vergangenheit zu erklären, leistet sich einen Widerspruch. Er wendet sich von der Sache ab, die zur Erklärung ansteht, und besteht darauf, dass die Erklärung der Sache nicht in den Bestimmungen liegt, die an ihr zu finden sind, sondern jenseits der Sache in etwas anderem zu suchen ist – eben in Geschehnissen, die ihr vorhergehen. Der Grundfehler allen historischen Denkens und Erklärens besteht darin, dies beides – die Frage nach der Entstehung einer Sache und die Frage nach ihrer Identität – in eins zu setzen. Indem sie die Erklärung eines Gegenstandes in die Erklärung seiner Entstehung hineinverlegt, abstrahiert die Geschichtswissenschaft komplett von der Natur der Sache, zu deren Verständnis sie beitragen will.
Dies hat Konsequenzen. Die erste besteht darin, dass mit der Abstraktion von der Identität der Sache auch jeder bestimmte Zusammenhang zwischen der Sache und ihren Entstehungsbedingungen negiert ist. Dies ist für einen Historiker allerdings kein Mangel, sondern damit öffnet sich für ihn das weite und ausgreifende Feld der historischen Zusammenhänge, auf dem er sich von Berufs wegen wie ein Fisch im Wasser bewegt. Fragt einer dieser Gelehrten nach den Entstehungsbedingungen eines Gegenstandes, kann man sich fast schon sicher sein, dass er nicht bei den näheren Umständen stehenbleibt, unter denen dieser Gegenstand zustande gekommen ist. Ein Vertreter dieser Zunft, der z.B. über die Parteien und Standpunkte aufzuklären verspricht, die in der Französischen Revolution gegeneinander angetreten sind, lässt als Erstes hören: Wenn wir genauer wissen wollen, was der Jakobinismus ‚eigentlich‘ ist, können wir auf der Leiter der Kenntnisse oder Informationen weiter zurückgehen.
[7] Wir lernen daraus: Wenn ein Historiker etwas „genauer“ wissen will, geht er immer „weiter“ von seinem Gegenstand weg. Macht sich ein Geschichtswissenschaftler über Willy Brandts Ostpolitik her − die Beispiele sind zufällig gewählt und interessieren hier nur hinsichtlich der in ihnen deutlich werdenden historischen Sicht- und Vorgehensweise –, so hält er sich nicht lange mit der Frage auf, welche politischen Zwecke diese Politik verfolgt, welcher Staatsräson sie gedient und in welcher Lage die BRD auf sie gesetzt hat. Er macht die Vorgeschichte zum Thema und vermeldet über die erst einmal, dass sie sehr weit zurückreicht: Wer sich mit den Ostverträgen 1970 näher befasst, steht sehr schnell vor der Notwendigkeit, die Geschichte der deutsch-polnischen Beziehungen bis ins Mittelalter zurückzuverfolgen.
[8] In diesen fernen Zeiten landet auch, wer etwas über die wahren Gründe für die Machenschaften des europäischen Imperialismus erfahren will: Sicher ist es in der neuzeitlichen Entfaltung des europäischen Expansionismus zu vielen neuen Facetten gekommen, die entscheidenden Weichenstellungen dieser Sonderentwicklung finden sich jedoch schon im Mittelalter.
[9] Und im Mittelalter ist noch lange nicht Schluss. Eine althistorische Schrift klärt darüber auf, dass der Anfang Europas
in den griechischen Anfängen
[10] zu suchen ist. Und eine ‚Geschichte des Westens‘ landet mit dem Prinzip Vorgeschichte endgültig in der grauen Vorzeit: Die Ursprünge des Okzidents
liegen im 14. Jahrhundert vor Christi Geburt bei Pharao Echnaton und seinen ersten Gehversuchen in Sachen Monotheismus: Ohne ihn ist der Westen nicht zu erklären.
[11]
Wo mit dem Prinzip Vorgeschichte Ernst gemacht wird, gibt es offensichtlich kein Halten mehr. In ihren Schriften greifen Historiker auf alles Mögliche aus der langen Weltgeschichte zurück, das sich allein dadurch als Beitrag zur Erklärung der Gründe und Ursachen empfiehlt, die zum Zustandekommen einer bestimmten Angelegenheit geführt haben, dass es vor dieser auf der Welt war. Die angeführten Beispiele zeigen, dass sich die historischen Gelehrten um den Zusammenhang zwischen einer Sache und ihren Entstehungsbedingungen keinen Deut scheren und einfach dem Prinzip Vorgeschichte folgend nach Belieben alles, was vor dieser Sache existent war – und zwar bloß, weil es vorher existent war –, als Bedingung oder Faktor ihrer Entstehung aufmarschieren lassen.
Das Verhältnis, in dem das aus der Vorgeschichte herbeizitierte Geschehen zu dem Gegenstand steht, der in seiner Vorgeschichte seine Erklärung finden soll, besteht der Sache nach nur in dem äußerlichen Zusammenhang, der im zeitlichen Neben- und Nacheinander der Ereignisse gegeben ist. Aus diesem äußerlichen Zusammenhang machen Historiker etwas anderes, wenn sie eine Sache aus ihrer Vorgeschichte, die Gegenwart aus der Vergangenheit erklären. Sie münzen ihn um in einen Zusammenhang, der eine innere Notwendigkeit und Folgerichtigkeit hat. Das der Sache zeitlich Vorhergehende wird von ihnen, bloß weil es vor ihr stattgefunden hat, in den Rang einer Ursache erhoben, welche das Spätere hervorgebracht hat; das Spätere wird umgekehrt, bloß weil es späteren Datums ist, als Wirkung dieser Ursache, als deren Produkt gefasst. Deswegen – wegen dieses theoretischen Schwindels – kommt „das Moment der Zeit“ in der Geschichtswissenschaft zu so großen Ehren. Wo mit ihm argumentiert wird, geht es stets darum, die Chronologie der Ereignisse für eine Kausalität sprechen zu lassen, die sich in ihr offenbaren soll.
Eine Sozialgeschichte des sich etablierenden Kapitalismus, die sich u.a. um eine Erklärung der nationalistischen Exzesse bemüht, die damals die Szene beherrscht haben, demonstriert beispielhaft, wie ein Historiker das zeitliche Neben- und Nacheinander von Begebenheiten in ein Verhältnis der Notwendigkeit verwandelt:
„Im Kaiserreich war der sich in kürzester Zeit durchsetzende Übergang zur kapitalistischen Marktwirtschaft und Marktgesellschaft mit harten individuellen und kollektiven Umstellungszwängen verbunden. Sie führten zu traumatischen Schäden, die einen zugespitzt radikalisierten Nationalismus hervorbrachten...“ [12]
In nur wenigen Zeilen führt er ökonomische, soziale, psychologische und politische Phänomene auf. Warum und auf welche Weise all diese verschiedenartigen und disparaten Erscheinungen in Verbindung stehen und inwiefern sie in dieser Verbindung für die genannten schrecklichen Folgen verantwortlich zu machen sind, wird sachlich nirgendwo begründet. Der Zusammenhang der Ursächlichkeit, der mit allen möglichen rhetorischen Formeln zum Ausdruck gebracht wird – der Übergang war mit Zwängen „verbunden“, diese „führten zu“ Schäden, welche den Nationalismus „hervorbrachten“ – wird allein durch den zeitlichen Zusammenhang nahegelegt, in dem all diese Erscheinungen stehen.
Dank dieses Erklärungsschemas legt allein schon die Nummerierung von Weltkriegen historische Zusammenhänge zwischen dem ersten und dem zweiten offen. Das ist jedenfalls die ganze Logik, wenn der Historiker den Ersten Weltkrieg als Vorgeschichte und determinierende Kraft des Zweiten Weltkriegs
[13] bestimmt. So beginnt eine Studie über die Zeit des Nationalsozialismus mit dem Ersten Weltkrieg, dem Zeugungsakt für die meisten weiteren Katastrophen und Gräuel des zwanzigsten Jahrhunderts. Es war dieser Krieg und seine vertrackten Nachwirkungen...
[14] Dieser Wissenschaftler braucht gar nicht zu erläutern, inwiefern der Erste Weltkrieg der Grund für den zweiten gewesen sein soll. Er war schließlich der erste und das weist ihn zureichend als „Zeugungsakt“ für den Zweiten Weltkrieg aus. Und mit seinen ihm zugeschriebenen „vertrackten Nachwirkungen“ fungiert dieser Krieg dann – wiederum allein aufgrund der zeitlichen Reihenfolge – auch gleich noch als Ursprung und Erklärung für alle möglichen späteren „Katastrophen und Gräuel“. Alle noch so konträren Interpretationen des Ersten Weltkriegs machen in diesem Sinne und in schönster Eintracht den Ersten Weltkrieg als Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts vorstellig.
Dass diese Art des Begründens konstitutiv für die Theoriebildung in diesem Fach ist, geben dessen Vertreter gerne zu Protokoll. Sie bekennen sich freimütig dazu, dass sie für die Ursächlichkeiten, die sie behaupten, kein anderes Argument haben und in Anspruch nehmen als den Verweis auf das zeitliche Aufeinanderfolgen der Begebenheiten, und verfertigen daraus ihren Begriff von Ursache und Wirkung. In Historikerkreisen versteht man unter der Kategorie der Ursache nichts anderes, als dass der Begriff der Ursache von der Vorstellung einer linearen Zeitfolge abhängt
. [15] Weil die Ursachen in der Regel zeitlich früher liegen
, [16] sieht man sich in diesem Fach zu der Annahme berechtigt, dass es sich bei dem zeitlich Früheren um die Ursache des Späteren handeln muss. Ein Ereignis tritt ein, weil zuvor andere Ereignisse stattgefunden haben
; [17] deswegen kann das Spätere aus dem Früheren erklärt werden
. [18]
2. Teleologie oder: Die Gegenwart bestimmt die Vergangenheit
Geht man so ein Werk der Geschichtsschreibung durch, fällt auf, dass sich unter den Entstehungsgründen und -bedingungen für „das in der Gegenwart Vorhandene“, die der Historiker in der Vergangenheit ausfindig gemacht haben will, nicht nur Begebenheiten aus früheren Zeiten befinden. Die heute vorhandenen politischen oder gesellschaftlichen Gegebenheiten selber finden sich bereits in der Vergangenheit, die der Historiker zu deren Erklärung aufbietet – in einem anderen logischen Aggregatzustand ihrer selbst gewissermaßen. Bevor es die deutsche Nation, Staaten mit einer demokratischen Verfassung und ein politisches Subjekt namens Europa gegeben hat – in deren Vorgeschichte eben –, waren all diese Dinge, folgt man den Darstellungen der Geschichtswissenschaft, bereits der Idee nach vorhanden, als noch nicht realisiertes Telos, und in dieser widersprüchlichen Existenzweise der Nicht-Existenz auch schon wirksam. In den Ereignissen der Vergangenheit, die sie besprechen, entdecken Historiker lauter wirkende Kräfte
, [19] welche einzig und allein die Bestimmung haben, dem noch nicht Existenten, einer Idee, die das Künftige vorwegnimmt, zur Wirklichkeit zu verhelfen. [20]
So finden sich in einem Lexikon der Geschichtswissenschaft zur Nationsbildung
Erkenntnisse wie die folgende:
„Die Suche nach der Gestalt der Zukunft äußerte sich im 19. Jahrhundert zunächst vor allem anderen im Prozess der Nationsbildung, denn in ihm liefen die vielfältigen gesellschaftlichen Entwicklungslinien zusammen und gewannen ihre politische Stoßkraft.“ [21]
Der zitierte Historiker befasst sich mit der Gründung von Nationalstaaten im Europa des 19. Jahrhunderts und anderswo auf der Welt, und er verschwendet keinen Gedanken darauf, was für politische Gebilde da aus der Taufe gehoben wurden. Er interessiert sich ausschließlich für den Prozess, der zur Entstehung dieser Gebilde geführt hat, und weil er vom Ergebnis her weiß, dass am Ende der Nationalstaat, so wie wir ihn heute kennen, das Licht der Welt erblickt hat, sieht er sich schon mal berechtigt, diesen als „Gestalt der Zukunft“ anzusprechen. Doch damit nicht genug. Er lässt den „Prozess der Nationsbildung“ gleich auch noch mit der Suche nach dieser ‚Gestalt‘ beginnen: Folgt man seinen Ausführungen, kommt in der Entstehung der Nationalstaaten gar nichts anderes zum Ausdruck als die „Suche nach der Gestalt der Zukunft“ – die sich „im Prozess der Nationsbildung äußerte“. Dass sich die Suche in diesem Prozess äußerte – sich seinerzeit also Nationen und nicht etwas anderes gebildet haben –, erklärt der Historiker damit, dass in diesem Prozess alle möglichen Entwicklungen „zusammenliefen“, die dem Umstand ihres Zusammenlaufens in diesem Prozess „ihre politische Stoßkraft“ verdankten. Die „vielfältigen gesellschaftlichen Entwicklungslinien“, die er anspricht, helfen aus dem tautologischen Gedanken, mit dem er die Nationenbildung erklärt, jedoch gar nicht heraus, sondern führen nur in die nächste Tautologie hinein. Die Frage, warum diese Entwicklungslinien im Prozess der Nationenbildung zusammenliefen, beantwortet er nämlich damit, dass sich ihre Vertreter – die Protagonisten der verschiedenartigen Reformziele und Modernisierungsstrategien der Zeit
, namentlich die Wortführer der nationalen Bewegungen
in den verschiedenen Ländern – verbreitet dem Leitbild der Nation und des Nationalstaats
[22] verschrieben haben. Dafür, dass sich dieses Leitbild in den verschiedenen „Bewegungen“ durchgesetzt hat – und nicht ein anderes –‚ findet sich in seinen ganzen Ausführungen keine andere Begründung als die, dass dieser Leitwert das Zeug dazu hatte, sich durchzusetzen: Es war ein wirkungsmächtiges Leitbild, mit dem kein anderes ernsthaft konkurrieren konnte.
[23] Und mit seiner Durchsetzung bewies es ... seine Kraft
. [24] Die gesamte Argumentation fasst sich somit in der Tautologie zusammen, dass sich die Bildung von Nationen der Durchsetzungskraft der Idee der Nation bzw. der „Bewegungen“, die sich dieser Idee verschrieben haben, verdankt.
Derselben Logik bedienen sich Historiker in der Erklärung von was auch immer. Auch die bereits zitierte Sozialgeschichte, die sich um eine Erklärung des radikalisierten Nationalismus
im Kaiserreich bemüht, argumentiert in dem Sinn und führt als letzten Grund dafür, dass sich ein solcher Nationalismus damals durchsetzen konnte, das Argument an, dass er nicht auf die Gegenkräfte einer gefestigten politischen Kultur traf, die manche seiner exzessiven Ansprüche hätten entschärfen und relativieren können
. [25] So gesehen verdankt dieser Nationalismus seine Durchsetzung letztlich dem Nichtvorhandensein dessen, was dem Autor als wertvolle Errungenschaft heutiger Verhältnisse und als Telos der weiteren historischen Entwicklung an dieser Stelle seiner Argumentation klar vor Augen steht: einer demokratisch „gefestigten politischen Kultur“, die die Durchsetzungskraft dieses Nationalismus hätte bremsen können.
Dieselbe Logik begegnet uns in der Erläuterung, die ein anderer Vertreter dieser Zunft den Gründen für den Zusammenbruch der DDR
[26] widmet. Er sieht im Abgang dieses Staatswesens und der Übernahme seines Inventars durch das kapitalistische Deutschland – die er als Parteigänger demokratischen Regierens, der er offenbar ist, unter der Hand als einen Akt der Befreiung und Demokratisierung würdigt – eine eindrucksvolle Bestätigung für die Demokratisierungskraft, die von Beginn an der modernen Idee der Nation eingeprägt war
. [27] Folgt man seiner Erklärung, war das Ende der DDR also bereits mit der ‚Nationsbildung‘ beschlossene Sache, die, wie gesehen, im 19. Jahrhundert stattfand, also lange bevor an so etwas wie die DDR überhaupt zu denken war. Auch dieser Historiker versteht es, das Ereignis, das er zu erklären beansprucht, als noch nicht realisiertes Telos in die Geschichte zurückzuprojizieren, um es anschließend aus der Kraft zu erklären, die er diesem Telos beilegt. Wobei es gar nichts ausmacht, dass in den Nationen, in deren Anfängen er diese „Demokratisierungskraft“ bereits am Werk sieht, von einem Willen zur Demokratie „von Beginn an“ wenig zu sehen war. Ihre „eindrucksvolle Bestätigung“ findet die Kraft, die er der Demokratisierung zuschreibt, in seiner Argumentation ja nicht in den damaligen, sondern in den heutigen Verhältnissen; nämlich in dem Faktum, dass sich die demokratisch verfassten Staaten auf dem Globus mittlerweile durchgesetzt haben. Und wenn im neu gegründeten Staat Bismarcks ein ‚obrigkeitsstaatliches Denken‘ geherrscht hat, wie von Historikern berichtet wird, so fällt die Bestätigung für die Durchsetzungsfähigkeit dieser Kraft, folgt man der Logik seiner Argumentation, nur umso eindrucksvoller aus – mussten doch die Widerstände, die besagtes Denken einer Demokratisierung der Gesellschaft entgegengesetzt hat, durch die der Demokratisierung innewohnende Kraft erst überwunden werden.
Hier ist gegenüber dem Quidproquo zwischen zeitlichem Nacheinander und Kausalität, das wir in Punkt 1 unserer Kritik behandelt haben, ein Fortschritt im historischen Denken und Erklären zu verzeichnen. Die Vertreter dieser Kunst beschränken sich in ihrer Argumentation nicht darauf, Vergangenheit und Gegenwart, Früheres und Späteres – aufgrund der zeitlichen Abfolge der Ereignisse – in ein ursächliches Verhältnis zu setzen. Sie belassen es nicht bei einer Wissenschaft, die, wie sie selber sagen, Tatsachen ... miteinander zu Wirkungszusammenhängen verknüpft
. [28] Indem sie in dem vergangenen Geschehen, das sie ursächlich für die Entstehung all dessen verantwortlich machen, was uns aus der heutigen Welt vertraut ist, teleologisch verfasste Wirkkräfte identifizieren, die in der Herbeiführung des „in der Gegenwart Vorhandenen“ ihre einzige inhaltliche Bestimmung haben, ergänzen sie ihre Argumentation um das, was sie mit ihr zwar immer schon postulieren, bislang aber nicht eingelöst haben: um den inneren Zusammenhang, eine Identität zwischen dem vergangenen und dem gegenwärtigen Geschehen, die ja immerhin unterstellt ist, wo von Ursache und Wirkung die Rede ist. Die „Tatsachen“ aus der Vergangenheit und die aus der Gegenwart, die die Geschichtswissenschaft „zu Wirkungszusammenhängen verknüpft“, sind für sich genommen, so wie sie sich ihrem Inhalt nach darbieten, ja einfach nur verschiedene Angelegenheiten, die als solche gar nicht erkennen lassen, was die einen zur Ursache prädestiniert und inwiefern die anderen als deren Wirkung zu begreifen wären.
Die historischen Gelehrten, die um die Differenz zwischen einem bloßen zeitlichen Nacheinander und dem Verhältnis der Ursächlichkeit wissen, gehen um der Überzeugungskraft ihrer Darlegungen willen daher dazu über, in die Chronologie der Ereignisse den inneren Zusammenhang hineinzukonstruieren, der in ihr aufscheinen soll, und sie tun das, indem sie vom Ergebnis, vom Ende der Geschichte ausgehend die Historie als finalen, mit innerer Notwendigkeit auf dieses Ende zulaufenden Prozess interpretieren. Moderne Geschichtswissenschaftler bekennen sich freimütig und ohne jeden Anflug von Selbstzweifel zu diesem Verfahren:
„Das Verfassen einer wie auch immer gearteten Chronologie bedeutet, Kausalität in einem Zeitablauf zu lokalisieren. Das heißt, Historiker wählen Informationen aus und ordnen sie chronologisch, genau, um die kausalen Beziehungen zwischen den beschriebenen Ereignissen aufzuzeigen.“ [29]
Wobei das ‚Lokalisieren‘ und ‚Aufzeigen‘ eben in der Weise geschieht, dass man das, was man in dem Zeitablauf lokalisiert und aufzeigt, zuvor von seinem Ergebnis aus rückwärts in ihn hineingedeutet hat:
„Die Struktur einer Geschichte, die handelnden Personen, das Wichtige und Unwichtige, die Art der Aufeinanderfolge, die Interdependenz und die kausale Verkettung, das alles hängt vom Ende der Geschichte ab. Der Geschichtenerzähler wählt all das aus, was für das Ende relevant ist; er weiß immer schon, wie das Ende sein wird, und er organisiert das Material unter dieser Perspektive.“ [30]
„Historische Darstellungen bedürfen eines Fluchtpunktes.“ [31]
Mit diesem Verfahren bringt es die Geschichtswissenschaft zu Erkenntnissen wie den eingangs von diesem 2. Punkt zitierten und analysierten, in denen der Zusammenhang von Grund und Begründetem unmittelbar auf der Hand liegt, die bei Lichte besehen freilich in nicht mehr bestehen als einer formellen Verdopplung des zu erklärenden Phänomens in es selbst und eine dieses Phänomen hervorbringende Kraft oder wirkmächtige Idee, die selber gar keinen eigenen Inhalt hat; deren ganze Bestimmung vielmehr in dem Phänomen liegt, das ihr als Wirkung zugeschrieben wird bzw. als ihre Verwirklichung begriffen werden soll. Die Argumentation der Geschichtswissenschaft nimmt daher die Form einer ausdrücklichen Tautologie an: Der Nationalstaat verdankt seine Existenz dem Streben nach ihm, die fertige Demokratie zeigt, wie wirkungsmächtig die Demokratisierungskräfte gewesen sind, die sie hervorgebracht haben usf. – vorne und hinten in der Erklärung steht nun jeweils derselbe Inhalt. Die Vergangenheit, die der Historiker zur Erklärung gegenwärtigen Geschehens mobilisiert, ist, so wie er sie darstellt, von der Gegenwart durchdrungen, die ihm als Telos der Geschichte vor Augen steht und die er in seiner Darstellung der Geschichte zu deren „Fluchtpunkt“ macht. Das Ursache-Wirkungsverhältnis steht damit gewissermaßen auf dem Kopf: Die Kausalität, die er in der Geschichte wirken sieht, beruht auf tautologischen Rückschlüssen, mit denen der Historiker, ausgehend von den ‚Bedürfnissen seiner Zeit‘, in der umgekehrten Richtung der Vergangenheit entsprechende Bestimmungen zuschreibt – mit der absurden Konsequenz, dass die Geschehnisse der Vergangenheit, nimmt man ihre Darstellung durch die Geschichtswissenschaft ernst, nachträglich einem Wandel unterworfen zu sein scheinen. [32]
Die Vertreter dieser Wissenschaft stehen aber zu den Konsequenzen ihres Treibens, betrachten es als Herausforderung an sich, dass die Geschichte beständig neu geschrieben werden muss, weil sich in der Gegenwart etwas geändert hat, und setzen den mit ihrer Wissenschaft nicht so vertrauten Rest der Menschheit gerne in Kenntnis über das Maß an Irrationalismus, das man akzeptieren muss, wenn man in dieser Wissenschaft Fuß fassen will:
„Wir können in gewissem Sinne von der Vergangenheit als einer veränderlichen sprechen; derart nämlich, dass ein Ereignis neue Eigenschaften erwirbt, weil es in ein anderes Verhältnis zu Ereignissen gerät, die erst später eintreten.“ [33]
Sachen gibt’s!
3. Das Handwerk(szeug) des Konstruierens
Es ist also nicht so, wie Historiker in ihren Werken immerzu glauben machen wollen und beschwörend ankündigen:
„Überblickt man die Phasen der Französischen Revolution, so gleichen sie in ihrer Aufeinanderfolge den Gliedern einer logischen Kette.“ [34]
„Sucht man die Vorgänge, die zum Abschluss des Attischen Seebundes führten, zu rekonstruieren, so scheint sich mit ziemlicher Folgerichtigkeit einer aus dem anderen zu ergeben.“ [35]
Wenn es so scheint, so verdankt sich dieser Schein des Notwendigen und Folgerichtigen den interpretatorischen Anstrengungen, die der Geschichtswissenschaftler unternimmt, um es so scheinen zu lassen. Und damit es so scheint, führt er die Geschichtsteleologie, deren abstraktes Prinzip wir kennengelernt haben, am Stoff durch.
Die erste Aufgabe, vor der er da steht, besteht darin, die ihrem Inhalt nach disparaten Ereignisse, die sich neben- und nacheinander in der Geschichte zugetragen haben – die Taten der Mächtigen, Kriege, Friedensschlüsse, Fürstenhochzeiten, aber auch Staatsschulden, technologische Errungenschaften, soziale Bewegungen und Naturkatastrophen –, in die Form eines einheitlichen Ganzen zu bringen. Dafür hat sich die Geschichtswissenschaft ihr eigenes begriffliches Instrumentarium geschaffen, in dem der Begriff der Epoche und der der Entwicklung von zentraler Bedeutung sind. Beide Begriffe, die, wie sich gleich zeigen wird, eng verwandt sind und wechselseitig aufeinander verweisen, transportieren für sich genommen erst einmal gar nichts anderes als eine abstrakte Vorstellung von Kontinuität, wobei das eine Mal mehr die Einheit in der Veränderung betont wird, das andere Mal mehr die Veränderung in der Einheit. Diese Kontinuitätsvorstellungen
, [36] die erklärtermaßen das A und O jeder Geschichtsschreibung sind – Jede Geschichtsschreibung privilegiert die Suche nach Kontinuitäten
[37] –, wendet die Geschichtswissenschaft auf das historische Geschehen an. Und zwar in der Weise, dass sie die sich oft über Jahrhunderte erstreckende Chronologie der Ereignisse zunächst einmal in Abschnitte aufteilt, die durch ihren zeitlichen Anfang und ihr zeitliches Ende – jeweils durch ein prägnantes Ereignis vorstellig gemacht – definiert sind und von der Geschichtswissenschaft unter ein einheitsstiftendes Motto gestellt werden, in dem das Wesen einer geschichtlichen Epoche
[38] zum Ausdruck kommen soll; die in ihr ‚herrschende Tendenz‘, ihr ‚Signum‘, das ‚Kennzeichen der Zeit‘. Was mit einem solchen Motto – das ‚Absolutismus‘, ‚Industrialisierung‘, ‚Zeitalter des Imperialismus‘, ‚Moderne‘ oder auch ‚Postmoderne‘ lauten kann – gewonnen ist, spricht ein moderner Historiker recht freimütig aus: Es dient der Deutung von Geschehnissen im Sinne der relativen Einebnung unendlich vieler Impulse in die Einheit des Sinnganzen
. [39] Offenherzig plaudert er aus, dass um der „Einheit des Sinnganzen“ willen ein Plattmachen der inhaltlichen Bestimmtheit unabdingbar ist, die an den Gegenständen geschichtswissenschaftlicher Deutungskunst in Erscheinung tritt: Eine Einheit in dem disparaten Geschehen muss her, damit es als von einer inneren Notwendigkeit beherrschtes Geschehen verstanden werden kann. Die Einheit stiftet ein Gesichtspunkt, unter dem sich die jeweilige Epoche als ein Schritt hin zum Hier und Heute begreifen lässt – wie ein Geschichtslexikon erläutert:
„So gilt die Epochenbezeichnung ‚Mittelalter‘ vornehmlich für die in einer Jahrhunderte währenden Entwicklung und Umgestaltung entstandene, weitgefächerte kulturelle Einheit der romanisch-germanisch-westslawischen Völker, die auf der Grundlage der karolingischen Großreichsbildung jene römisch-abendländische Christenheit formiert hatte, aus der das moderne Europa hervorgehen sollte.“ [40]
Da mögen bei der Benennung einer Epoche durchaus substanzielle Angelegenheiten wie die ‚Nationsbildung‘ oder der Imperialismus Pate gestanden haben. Das, was die damit gekennzeichnete Epoche zum Inhalt hat, ist bei näherer Betrachtung dessen, was der Historiker daran festhält bzw. was ihn daran interessiert, dann doch nichts anderes als das Abstraktum eines die Epoche beherrschenden einheitsstiftenden Gesichtspunkts, einer Entwicklung, die ihrerseits im Wesentlichen bloß zum Inhalt hat, dass sie von einer Epoche zur nächsten führt. Deswegen findet so eine Epoche ihre nähere Bestimmung nicht etwa in den Bestimmungen des Geschehens, das in ihr stattgefunden hat, sondern in einer weiteren Unterteilung, die den in ihr angeblich stattfindenden Entwicklungsprozess wieder in Phasen aufgliedert – in eine erste, die sich dadurch auszeichnet, dass das Neue der Epoche auf den Plan tritt; eine mittlere, die Hochzeit, in der das die Epoche Kennzeichnende zur Entfaltung kommt, und in eine Spätphase, in der es sein Ende erreicht und sich die neue Epoche ankündigt.
Diesen sattsam bekannten Schematismus, der kein Gramm Erkenntnis über irgendeinen objektiven Tatbestand enthält, dafür umso mehr die Absicht des Historikers erkennen lässt, eine innere Logik, einen Zusammenhang, der eine Notwendigkeit erahnen lässt, in den Ablauf der historischen Ereignisse hineinzulesen, wendet die Geschichtswissenschaft – wie bereits gesagt – auf die Chronologie der Ereignisse an; die historischen Vorkommnisse und Gegebenheiten werden unter ihn subsumiert. Die historischen Fakten, die der Geschichtswissenschaftler umfassend erforscht und die er kenntnisreich und detailversessen in seine Geschichtskonstruktion einbringt, werden so zu Faktoren. Als solche haben sie ihre Identität nicht in den Bestimmungen, die an ihnen aufzufinden sind, sondern in Bestimmungen, die sie aus ihrem Bezug auf die das historische Geschehen übergreifenden Ganzheiten, die der Geschichtswissenschaftler konstruiert und in die er sie einordnet, überhaupt erst gewinnen: Sie werden als konstituierende Momente solcher Ganzheiten – einer Epoche oder des Prozesses, der in ihr abgelaufen sein soll – bestimmt. Ein um klare Festlegungen im Vorgehen seiner Wissenschaft bemühter Historiker erläutert diesen Zusammenhang so: Das, was an einem Prozess mitwirkt, soll hier Impuls heißen... Die Impulse werden durch die Prozess-Kategorie dem Sinnganzen eines einheitlichen umfassenden Vorgangs unterworfen.
[41] Das einzelne historische Ereignis, das, in den umfassenden Zusammenhang der historischen Konstruktion gestellt, seine Würdigung als Impuls oder Faktor erfährt, wird damit als Movens eines historischen Prozesses bestimmt, als ‚Triebkraft‘, die eine Entwicklung vorangebracht oder sonst wie beeinflusst hat. Auch wenn der Historiker in einem Ereignis einen ‚Sprung‘ im geschichtlichen Verlauf, einen ‚Rückschlag‘, ‚Umweg‘ oder auch eine ‚krisenhafte Zuspitzung‘, also wie auch immer eine Diskontinuität in der Kontinuität diagnostiziert, sind dies alles Bestimmungen, die dem betreffenden Ereignis nicht als solchem zukommen, sondern solche, die im Verhältnis des Ereignisses zu dem Ganzen der geschichtlichen Entwicklung begründet sind, das der Historiker in seiner Darstellung erstehen lässt und in das er das Ereignis einordnet. [42]
Die Epoche, in der das so bestimmte Ereignis zusammen mit tausend anderen Vorkommnissen verortet wird – als Faktor ist es immer nur ein Faktor unter anderen, ein Moment, Teil des Ganzen –, stellt sich auf der Grundlage dar als
„ein Geflecht außerordentlich dynamischer, gerichteter Triebkräfte, die auf Widerstand prallten, zeitweise blockiert wurden, unablässig neue Probleme bei ihrer Entfaltung aufwarfen – sich letztlich aber als durchsetzungsfähig erwiesen“. [43]
Auch wenn der Sache nach so ein „Geflecht“ nach wie vor in nichts anderem als im Neben- und Nacheinander der historischen Ereignisse besteht, bekommt es vom Historiker hier unter der Hand die Qualität einer eigenständigen Wesenheit zugesprochen; und die „Entwicklungsprozesse“, die durch die vielen als „Triebkräfte“ und „Impulse“ wirkenden Geschehnisse angetrieben werden, avancieren zum Subjekt des Geschehens:
„Historische Entwicklungsprozesse ... wälzen sich, von einer Vielzahl zusammen und gegeneinander wirkender Impulse getrieben, dahin.“ [44]
Diese Metamorphose der historischen Prozesse, der jeweiligen Zeit, in der sie stattgefunden haben, und letztlich der Zeit selbst zu über den Dingen stehenden Mächten kriegt ein Historiker ganz einfach dadurch hin, dass er das Verhältnis zwischen den vielen Geschehnissen und den Gesamtheiten, die durch sie angeblich konstituiert werden, umkehrt. Einer der Gründerväter der modernen Geschichtswissenschaft hat auch schon bemerkt, dass mehr als diese Umkehrung wirklich nicht dran ist an der ‚Logik‘, die der Historiker vorführt:
„Das Einzelne wird verstanden in dem Ganzen, aus dem es hervorgeht, und das Ganze aus dem Einzelnen, in dem es sich ausdrückt.“ [45]
Allerdings scheint ihm nicht aufgefallen zu sein, dass er mit dem, was er da zu Protokoll gibt, seiner Wissenschaft ein ziemliches Armutszeugnis ausstellt: Immerhin heißt das ja, dass in dieser Wissenschaft nichts von dem, was sie behandelt – weder Vergangenes noch Gegenwärtiges – als das genommen wird, was es ist. Alles Objektive wird in ihr um seine Bestimmungen gebracht und zu einem Moment, dem Derivat eines übergeordneten Zusammenhangs erklärt, der seinerseits keine eigene Bestimmung hat, weil er sich umgekehrt auflöst in die einzelnen Elemente, die ihn ausmachen.
Die Leistung dieses von jedem Inhalt entleerten Kreisverkehrs, der sich wissenschaftlich gelehrt auch als wechselseitige Abhängigkeit von Ereignis und Entwicklung
[46] ins Gespräch bringen lässt, besteht darin, dass mit ihm der Verlauf der Geschichte selber zum Grund dafür erhoben wird, wie die Geschichte verlaufen ist; die Zeit, in der sich so manches abgespielt hat, wird zur höheren Notwendigkeit und Macht erklärt – zur die ganze Welt beherrschenden
[47] Macht der Zeit
[48] –, aus der sich das historische Geschehen, das in ihr stattgefunden hat, begründet.
Diese zentrale historische Denkfigur dient dem Historiker als universell anwendbares Erklärungsmuster. Ein Beispiel für eine nach diesem Muster gestrickte Erklärung liefert uns ein Forscher, der sich mit dem vorrevolutionären Frankreich befasst. Wie er zu berichten weiß, ist in Frankreich zu dieser Zeit dem Anspruch der Monarchie auf ein hohes Maß an staatlicher Machtkonzentration eine Verfassungswirklichkeit entgegengestanden, in der dem Monarchen tatsächlich eine oft nur indirekte Gewalt
[49] zugekommen ist. Die Frage, warum die Monarchie mit ihrem absolutistischen Staatsideal gescheitert ist, beantwortet er wie folgt:
„Das war auch gar nicht anders möglich; die Entwicklung der europäischen Staaten lief eben nicht auf eine Zusammenfassung und Monopolisierung von Macht hinaus, sondern auf Machtteilung und Machtkontrolle.“ [50]
„Die Entwicklung lief eben“ auf etwas anderes „hinaus“, lautet das Argument, mit dem der Historiker begründet, dass die Entwicklung auf etwas anderes hinauslaufen musste. Worauf sie hinauslief, das weiß der Historiker aus seinem Studium der Faktenlage. Die ‚Entwicklung‘, die er konstatiert, ist einerseits nichts anderes als der zusammenfassende Ausdruck für diese Faktenlage. Andererseits behandelt er diese Entwicklung in seiner Erklärung wie ein gegenüber dieser Faktenlage selbständig existierendes Wesen, ein autonomes Bewegungsgesetz, aus dem sich diese Faktenlage begründet. So gelingt es ihm, den Verlauf der Geschichte mit dem Verlauf der Geschichte zu erklären.
4. Die Empirie in ihrer doppelten Funktion – als Material der Konstruktion und als Instanz ihrer Beglaubigung
Das historische Denken bewegt sich in dem schwindelhaften Zirkel, einerseits in die Chronologie der Ereignisse eine innere Logik hineinzulesen, welche immer gerade das gebietet, was der Verlauf der Geschichte faktisch ergibt, um dann andererseits diese innere Logik und höhere Notwendigkeit umgekehrt unter Verweis auf den faktischen Ablauf der Geschichte zu beglaubigen. In diesem Zirkel kommt der Empirie, den Fakten, also eine doppelte Bedeutung zu: Alles Wissen um die Geschehnisse der Vergangenheit macht die Geschichtswissenschaft zum Material ihrer theoretischen Konstruktionen; sie lässt nichts von dem objektiven Geschehen, mit dem sie argumentiert, für sich gelten, sondern subsumiert es unter ihre Kategorien, mit denen sie es darauf anlegt, dem Ablauf der Ereignisse das Signum einer unwidersprechlichen Notwendigkeit aufzudrücken. Andererseits werden die Fakten im Rahmen ihrer so gearteten Bemühungen von ihr als Instanz der Beglaubigung der Behauptungen in Anspruch genommen, die sie über die historischen Zusammenhänge aufstellt; sie beruft sich auf sie, macht sie zum Argument für die Objektivität ihrer Urteile.
Die Pflege dieser Instanz ist ihr deswegen einige Mühen wert. Getrennt von der Theoriebildung, die in den dargelegten Formen daneben weiter ihren Gang geht und in der die Fakten in dieser doppelten Funktion Verwendung finden, und mit dem Ziel, dieser Sorte Theoriebildung zuzuarbeiten und ihre Fortentwicklung und weitere Perfektionierung zu ermöglichen, unterhält die Geschichtswissenschaft eine Abteilung, die empirische Forschung heißt. Hier werden mit sehr viel Aufwand und einer geradezu blödsinnigen Gewissenhaftigkeit Fakten erhoben.
Die Blödsinnigkeit dieser Veranstaltung ist den Maßstäben geschuldet, denen man gerecht zu werden versucht und die ziemlich konsequent aus der verkehrten Betrachtungsweise folgen, die in der Geschichtswissenschaft praktiziert wird: Eine Wissenschaft, die sich in ihren theoretischen Bemühungen darauf verlegt, das zeitliche Nacheinander der historischen Geschehnisse mit einem Verhältnis der Ursächlichkeit gleichzusetzen, also prinzipiell nicht gewillt ist, die Unterschiede zwischen Ursachen, Bedingungen, äußeren Umständen oder auch bloß assoziierten Zusammenhängen gelten zu lassen, gelangt damit dann auch zu zusammenfassenden Urteilen wie dem folgenden:
„Die totale Ursache eines Ereignisses besteht aus der totalen Summe von Bedingungen für dieses Ereignis, das heißt der Gesamtsumme von Umständen, die sein Auftreten notwendig machten.“ [51]
In ihrer empirischen Forschung verschreibt sich die Geschichtswissenschaft daher dem Ideal der vollständigen Erfassung der Fakten. Es gilt, möglichst alle ermittelbaren Fakten zu ermitteln. Und weil dies ein Ideal ist, das durch keine Forschungstätigkeit der Welt jemals einzulösen ist, stachelt die Bemühung, ihm gerecht zu werden, die Forscher zu nie enden wollenden Höchstleistungen an. Kein Aufwand ist zu hoch, um möglichst viele Fakten dem Orkus des Vergessens zu entreißen. Jede Hinterlassenschaft aus nahen oder fernen Zeiten – Schriftdokumente aller Art, Aufzeichnungen mündlicher Überlieferungen, Einkaufszettel, Bauruinen, Kleidungsstücke, bis hin zu Tonscherben, Grabbeigaben etc. – gilt hier als potenzielles Fenster in die Vergangenheit, durch das sich möglicherweise weitere Aufschlüsse über das historische Geschehen gewinnen lassen. Deswegen darf der empirische Forscher grundsätzlich nicht zwischen wesentlich und unwesentlich unterscheiden; alles, auch das Nebensächlichste und Unwichtigste, wird hier als Angelegenheit von größter Bedeutsamkeit behandelt. Und weil man die eigene Forschungstätigkeit als Voraussetzung für das Erstellen empirisch immer noch besser fundierter Theorien begreift, legt man sich in dieser Abteilung auf den Imperativ fest, dass in der Erforschung der Tatsachen Enthaltsamkeit zu üben ist, was die theoretische Beurteilung der erhobenen Tatsachen betrifft. In einer für eine Wissenschaft völlig perversen Form – und nur in dieser Form! – kommt hier die Objektivität zu ihrem Recht. Nämlich nicht als begriffene, sondern getrennt von jedem Urteil über sie, als pures Faktum, als unbegriffene Tatsache. Aber das passt ja auch wieder zu einer Wissenschaft, die in ihrer theoretischen Abteilung die Objektivität mit Füßen tritt, indem sie alles objektive Geschehen gnadenlos zum Material ihrer gedanklichen Konstruktionen degradiert, um anschließend zur Beglaubigung der Objektivität ihrer Konstruktionen die Fakten als Instanz anzurufen und darauf ihren ganzen Stolz als empirische Wissenschaft zu gründen.
5. Geschichtsschreibung: Die Wissenschaft erzählt Storys
Eine Spezialität dieser Wissenschaft – die die Geschichtswissenschaft immer schon ausgezeichnet hat und mit der sie mittlerweile stilbildend auch für andere Geistes- und Gesellschaftswissenschaften geworden ist – liegt darin, dass sie ihre Erkenntnisse, die sie sich mit den erläuterten theoretischen Verbrechen erarbeitet, in der Form von Erzählungen präsentiert. Sie verleugnet der Form nach ihre argumentativen Anstrengungen, ihre Urteile und Schlüsse, mit denen sie eine Teleologie in die Geschichte hineinkonstruiert, und tut so, als würde sie tatsächlich nur den Verlauf der Geschichte, den faktischen Ablauf der Geschehnisse schildern. Zur Erzeugung dieses Scheins verfügt der Historiker über ein ganzes Repertoire an rhetorischen Mitteln.
Ein erster Kunstgriff, die zeitliche Abfolge der historischen Ereignisse so darzustellen, dass sie sich unmittelbar als inhaltlich folgerichtiges Geschehen darbietet, besteht einfach darin, den Leser mit der überwältigenden Masse der Fakten, die man herbeizitiert und in eine chronologische Reihenfolge bringt, zu erschlagen. Die großen (und auch die kleineren) Werke der Historiker zeichnen sich dadurch aus, dass ihr Autor penibel ermittelte, quellenkritisch geprüfte und genauestens datierte Fakten ohne Rücksicht auf die Geduld seiner Leser über ein paar hundert Seiten auf der Zeitachse aufmarschieren lässt, so dass am puren Hintereinander der Faktenkolonne ersichtlich wird, mit welcher inneren Konsequenz das historische Geschehen in Richtung auf das zulief, was am Ende herausgekommen ist, und wie zielgerichtet alle Hindernisse niedergewalzt worden sind, die sich der Entwicklung dahin in den Weg gestellt haben. Die Kunst, die Fakten für sich sprechen zu lassen, fällt umso überzeugender aus, je mehr Fakten aufgefahren werden. Es kommt auf die Faktendichte an und auf den Eindruck, dass man eine lückenlose Ereigniskette dargeboten bekommen hat.
Weil aber die Fakten selber die Botschaft nicht in der Deutlichkeit aussprechen, in der sie der Geschichtsschreiber mit ihnen transportiert sehen will, wird nachgeholfen: Es kann im Begleittext gar nicht oft genug gesagt werden, wie überzeugend
und eindrucksvoll
sich die historischen Tatsachen zu dem Ganzen einer Kausalkette
, [52] einer Ursachenkette
, [53] einer Kontinuitätskette
[54] fügen und das Bild eines Kontinuitätsstrangs
, [55] einer Handlungsverkettung
[56] oder auch eines Kraftstroms
[57] ergeben.
Auch mit einer überbordenden Metaphorik wird Überzeugungsarbeit geleistet. Zur Kennzeichnung historischer Ereignisse greift man gerne in die Kiste der Botanik, redet von Wurzel, Keim oder Blüte, von Reife und Fäulnis. Auch der Tagesverlauf mit dem sich ändernden Sonnenstand bereichert die Ausdrucksmittel des historischen Schriftstellers: Da ‚dämmert‘ manches herauf, während anderes bereits seinen ‚Zenit überschritten‘ hat. Und es hagelt nur so an Sprachkonstruktionen für die immer gleiche teleologische Botschaft, die zum Ausdruck gebracht sein will: Für die Anliegen des einen Herrschers war ‚die Zeit reif‘, das, wofür ein anderer gestanden ist, hatte sich ‚überlebt‘; ein dritter war mit seinen Anliegen ‚seiner Zeit voraus‘ und ‚musste‘ deswegen scheitern; er ‚sollte‘ aber (wie man heute weiß) noch Recht bekommen... In dieser Wissenschaft gehört die überzeugende Darstellung, die den Leser beeindrucken und vereinnahmen will, anerkanntermaßen zum Handwerk. Der Übergang zur Kunst, zur unterhaltsamen oder erbaulichen Literatur, in der auch die Originalität, Genialität und Kühnheit des Schriftstellers etwas zählen, ist fließend, und weil man in diesem Fach einen Großteil der Überzeugungskraft auf die literarische Form gründet, ist es nur konsequent, dass die Anerkennung seiner Werke als große, womöglich sogar nobelpreiswürdige Literatur für einen Historiker die Krönung ist.
6. Der Zweck der Veranstaltung: Sinnstiftung
Im Geistesleben der Nationen spielt die Geschichte eine nicht unerhebliche Rolle. Zum festen Bestand eines solchen Geisteslebens gehört es, die Geschichte zum Argument zu machen und sich nach ihrer Bedeutung für uns zu fragen. Nach allgemeinem Dafürhalten geht es hier um nicht weniger als um ‚unsere Identität‘, von der der historisch gebildete Mensch weiß, dass sie ‚in der Geschichte begründet‘ ist. Es werden Herausforderungen ausgemacht, vor die ‚uns‘ die Geschichte stellt; es gilt Lehren aus der Geschichte zu ziehen; und man führt ‚historisch begründete Rechte‘ ins Feld, um mit ihnen heute für fällig erachtete Forderungen und Aktivitäten ins Recht zu setzen.
Argumentiert wird in den einschlägigen Debatten und Redebeiträgen unbefangen im Namen und vom Standpunkt eines ‚Wir‘ aus, das in der Gegenwart existiert, sein gegenwärtiges Dasein als seine Heimat begreift, und zwar unter Gesichtspunkten, die sich aus der positiven Bezugnahme auf die bestehenden Verhältnisse ergeben: Die Nation, das Recht, die in einer Demokratie wie der unseren herrschende Sittlichkeit, die moderne Staatenordnung, Europa oder der Westen sind für die Angehörigen dieses ‚Wir‘ selbstverständlich Werte, Gegenstände also nicht nur ihrer jeweils persönlichen Wertschätzung, sondern solche, die fraglos unser aller Wertschätzung verdienen. Mit diesem Rechtsstandpunkt, den Konsens der Wertegemeinschaft zu vertreten, treten alle, die im Namen so eines ‚Wir‘ argumentieren, an und in die Debatte ein – was für keine Einigkeit unter ihnen sorgt, sondern dafür, dass der Streit um das rechte Verständnis von Nation, Demokratie, Anstand etc. so richtig an Fahrt gewinnt. Jede Partei streitet da nämlich für ihren Standpunkt – in der Frage des Umgangs mit Ausländern, mit Amerika, mit der Autoindustrie oder mit dem ungeborenen Leben – mit dem Anspruch, dass der als allgemeinverbindlicher anerkannt zu werden hat; und in jeder Abweichung von ihm wird nicht dessen Verletzung durch ein ihm entgegenstehendes Interesse ausgemacht, sondern eine Verletzung der höheren Werte, auf die sich die feine Gemeinschaft angeblich geeinigt hat und die letztlich Sinn und Zweck ihres ganzen Trachtens ausmachen sollen. Hier findet etwas Doppeltes statt, nämlich eine Konkurrenz der politischen Standpunkte um die Ausrichtung der Nation in den sich aus der Sache der Politik – der Durchsetzung der ökonomischen und sonstigen Interessen der Nation daheim und auswärts – ergebenden Grundsatzfragen, die zur Entscheidung anstehen. Ausgetragen wird diese Konkurrenz jedoch als Streit um das rechte Verständnis der und die richtige Stellung zu den höheren und höchsten Gütern sowie um die Konsequenzen, die aus ihnen zu ziehen sind; wobei man sich gerne eben auch auf die Geschichte beruft, um aus den Lehren und Aufträgen, die sie ‚uns‘ erteilt, zu begründen, was wir uns und anderen (als Deutsche, Europäer etc. mit dieser Geschichte) in dieser oder jener ‚Frage‘ schuldig sind.
Die Geschichtswissenschaft beruht auf dem so gearteten Geistesleben einer Nation. Als allein der Wahrheit und der wissenschaftlichen Forschung verpflichtete Einrichtung ist sie anerkanntermaßen und von Amts wegen zuständig für die Sache, die in dem nationalen Debattenwesen als Berufungsinstanz fungiert. Und in der Betrachtung dieser Sache – der Geschichte – nimmt sie wie selbstverständlich den im Geistesleben der Nation allgegenwärtigen Standpunkt der sittlichen Gemeinschaft ein. [58] Sie nimmt diesen Standpunkt sogar ziemlich unverblümt ein: Sie bekennt sich zum grundsätzlichen Wertbezug des historischen Denkens
; sie bespricht es selbstbewusst als ihre Leistung, die Ereignisse vergangener Zeiten so aufzubereiten, dass daraus eine Geschichte wird, die für die Gegenwart
, [59] nämlich für uns von Bedeutung ist; sie gibt methodische Fingerzeige darauf, dass es dazu einer Betrachtungsweise bedarf, die die Geschehnisse der Vergangenheit konsequent der Perspektive der Gegenwart unterwirft; sie besteht in dem Zuge darauf, dass es dabei darauf ankommt, das, was das vergangene Geschehen für uns bedeutet, als seinen Sinn zu fassen. Und eben dafür hat sich diese Wissenschaft ihre jeder vernünftigen Logik spottenden drei bis fünf theoretischen Argumentationsmuster zugelegt.
Womit wir zum Ertrag der historischen Erkenntnis kommen. Der besteht erstens und zuallererst und noch vor jeder inhaltlichen Ausfüllung des Gedankens in der Erkenntnis, dass ‚Wir‘ ein Produkt der Geschichte sind und uns als ein solches zu begreifen haben. Was es da zu ‚begreifen‘ gilt, ist, dass sich dieses ‚Wir‘ einer höheren Notwendigkeit verdankt. Die Pointe des historischen Denkens besteht eben darin, dass es Sinn und Zweck des in seinen Betrachtungen unterstellten oder auch ausdrücklich von ihm namhaft gemachten Kollektivsubjekts, dessen Schicksal es geistig anteilnehmend verfolgt – ‚unsere Identität‘ –, nicht in dessen gegenwärtigem Dasein und Treiben ausmacht, sondern jenseits davon ansiedelt, in der Vergangenheit. Der Sinn der Wertegemeinschaft, der wir uns zurechnen dürfen, geht nach der Logik dieses Denkens aus der Geschichte hervor und besteht schlicht und ergreifend darin, zu werden bzw. geworden zu sein, was wir heute sind. Der Auftrag dieser Wertegemeinschaft ist es, sich zur Entfaltung und Geltung zu bringen, und in dessen Erfüllung hat auch ihr Dasein, folgt man derselben Logik, seine Rechtfertigung.
Was zweitens die Erkenntnisse über die Vergangenheit anbelangt, zu denen es das historische Denken bringt, so erschöpfen sich diese konsequenterweise darin, dass die historischen Ereignisse ihre Würdigung als Beitrag zur Herausbildung dieser wunderbaren Wertegemeinschaft erfahren. Die Affirmation, die ein Historiker quasi berufsbedingt der Gegenwart entgegenbringt, geht so auf die vergangenen Zeiten über, die er seiner Betrachtung unterzieht. Den grauenhaftesten Zuständen, in die frühere Obrigkeiten ihre Völker versetzt haben, und insbesondere den brutalsten Formen des Machtgebrauchs, mit dem die maßgeblichen Subjekte in der Geschichte ihre Sache vorangebracht haben, gewinnen diese Gelehrten, die offenbar Nerven wie breite Nudeln haben, das Urteil ab, dass sie Kulturleistungen erbracht haben, denen wir unser heutiges Dasein verdanken; [60] ein Urteil, dem weder zu entnehmen ist, worum es den Akteuren damals gegangen ist und wofür sie was angerichtet haben, noch, was die dem historischen Treiben attestierten Kulturleistungen – wie z.B. das Ende der Leibeigenschaft, die Einheit der Nation, die Überwindung des Nationalsozialismus oder auch die Nachkriegsordnung – ihrem Inhalt nach eigentlich sind. Das Urteil speist sich nach beiden Seiten hin allein aus dem Geist der Affirmation, und es befriedigt auch kein anderes intellektuelles Bedürfnis als das offenbar reichlich vorhandene Bedürfnis nach Sinn.
Womit auch schon die dritte Leistung des historischen Denkens angesprochen wäre: Die von den historischen Gelehrten angestellten Betrachtungen der Vergangenheit adeln die gegenwärtigen Verhältnisse. Sie laden den Menschen dazu ein, die moderne Welt als ein Ensemble von lauter Errungenschaften zu begreifen und sich zu seiner Existenz in dieser Welt zu beglückwünschen.
Diese Leistung erbringen die Historiker zuverlässig über alle politischen Wenden und Zeiten hinweg, weil sich ja die Werte, denen sie sich verschreiben, der affirmativen Bezugnahme auf die jeweils bestehenden Verhältnisse verdanken – und nicht etwa umgekehrt. Es handelt sich um Idealisierungen dieser Verhältnisse, in die das weltanschauliche Meinen des jeweiligen Autors, seine politischen Vorlieben, die gültigen Moralvorstellungen einfließen; es sind aber in welcher weltanschaulich gefärbten Form auch immer jedenfalls Idealisierungen dieser Verhältnisse, sodass es nicht weiter verwunderlich ist, dass sich deutsche Historiker zu Hitlers Zeiten zuhauf mit der Vorstellung ans Werk gemacht haben, dass es die Herausbildung eines völkischen Führerstaates ist, was es als Kulturleistung der Menschheit und Endzweck der Geschichte zu würdigen gilt, während sie sich danach recht schnell mehrheitlich darauf verlegt haben, dieselbe Geschichte als Siegeszug von Freiheit und Demokratie darzustellen und den Nationalsozialismus als unglückselige Episode in der deutschen Geschichte auf dem Weg in die Moderne einzuordnen. Die Logik des historischen Denkens hat sich für das eine als so brauchbar erwiesen wie für das andere; ihr „Wertbezug“ macht Historiker zu Opportunisten aus Überzeugung.
Die geistige Veredelung unseres Daseins fällt umso beeindruckender aus, je umfassender die Sinnbögen sind, die die Historiker über die Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg schlagen. Und so kann es nicht ausbleiben, dass auch noch eine Schlacht, die vor 2500 Jahren, im Frühsommer des Jahres 480 vor Christi Geburt bei einer kleinen Insel im Ägäischen Meer nahe Athen stattgefunden hat, ihre Würdigung als Schlüsselereignis erfährt, das die Weltgeschichte auf dem Weg zur demokratischen Kultur des Abendlandes einen entscheidenden Schritt vorangebracht hat:
„Die Enge von Salamis bildete gleichsam ein Nadelöhr, durch das die Weltgeschichte hindurch musste, wenn in ihr statt großer, monarchisch regierter Reiche jenes eigenartige, vom Osten her exotisch anmutende Volk eine entscheidende Rolle spielen sollte, das in lauter kleinen selbständigen Städten, fast überall ohne Monarchen und vielfach schon bei weitgehender politischer Mitsprache breiter Schichten lebte. So hat John Stuart Mill behauptet, dass Salamis für die englische Geschichte wichtiger gewesen sei als die Schlacht bei Hastings.“ [61] Und sie war nicht nur für die englische Geschichte wegweisend: „Wie sich die Griechen behaupteten, war weniger für die Weltpolitik der Zeit, umso mehr aber für die Weltgeschichte von Bedeutung, die während dieser Zeit im Ägäisraum ein großes Stück vorangetrieben wurde.“ [62]
Eine Sternstunde historischer Deutungskunst! Eine Schlacht, von der ein Mensch unserer Tage ohne den Berufsstand der historischen Gelehrten noch nicht einmal Kenntnis hätte, wird durch sie aufbereitet zu einem Datum, das für uns von größter Bedeutsamkeit ist. Was wären wir heute, wenn die Griechen damals nicht ihren heldenhaften Abwehrkampf gegen die Perser geführt hätten?! Womöglich hätte der Despotismus orientalischer Monarchien in der Weltgeschichte die Oberhand gewonnen und er würde heute unser Dasein bestimmen! Wir dürfen diesem putzigen Volk also dankbar sein, dass es den Persern mutig entgegengetreten ist, weil sich so überhaupt erst die demokratische Kultur der „politischen Mitsprache“ Bahn brechen konnte, die wir in unserem aufgeklärten christlichen Abendland so schätzen.
Die historische Deutungskunst hat also, gerade wenn sie so sinngeschwängert und pathetisch auftritt, durchaus auch ihre albernen Seiten. Übersehen sollte man darüber allerdings nicht, dass das Argument, aus dem das historische Denken seine Werturteile begründet und aus dem sich der Sinn, den es den gegenwärtigen und den vergangenen Verhältnissen attestiert, speist, eher nicht so lustig ist. In seinen weiteren Erläuterungen verleiht der soeben zitierte Historiker der Idee der politischen Mitsprache kurzerhand das Gütesiegel historisch approbiert
. [63] Und zwar aus keinem besseren Grund als dem, dass sie sich durchgesetzt hat. Dass diese Durchsetzung ein Akt der Gewalt war, wird von ihm nicht nur erwähnt, sondern ist überhaupt das Einzige, was man über diese ‚Idee‘ erfährt. Und eben das verleiht ihr nach der Logik des historischen Denkens die Würde einer Angelegenheit, die unseren Respekt verdient.
Hier wird nach der brutalen ‚Logik‘ des Erfolgs gedacht, der die erfolgreiche Sache ins Recht setzt. Nach derselben Logik beweist einem Historiker die Tatsache, dass die Sowjetunion mit ihrem sozialistischen Staatenblock in der Auseinandersetzung mit dem unter der amerikanischen Führungsmacht zum größten Militärbündnis aller Zeiten vereinten kapitalistischen Westen erfolgreich zurückgedrängt und totgerüstet worden ist und am Ende aufgegeben hat, dass die Sache des Sozialismus von vornherein zum Scheitern verurteilt war; sie hat sich als lebensunfähig
[64] erwiesen, musste also untergehen, während sich das Modell von Demokratie & Marktwirtschaft im selben Zuge als ‚zukunftsfähig‘ erwiesen und bewährt hat. Die Tatsache der Durchsetzung bzw. des Scheiterns wird in solchen Urteilen zu einer moralischen Qualität der betreffenden Sache überhöht. Die Macht der Staaten, mit der sie sich durchsetzen konnte, wird zu einer Instanz, die einer höheren moralischen Gerechtigkeit zur Durchsetzung verhilft. Große Kriegszüge und Völkerschlachten sind für Historiker daher nicht einfach einschneidende Ereignisse in der Geschichte, durch die die politische Lage in einer Weltgegend oder auch auf dem Globus insgesamt verändert und für die nachfolgenden Zeiten entschieden worden ist. Ihr Ergebnis kommt einem Gerichtsurteil gleich, das die Geschichte, das Weltgericht, über die beteiligten Nationen und Völker spricht:
„Für die Kulturgeschichte war der Krieg bedeutsam als eine Form der Kommunikation... Kulturgeschichtlich bedeutsam waren Wikingerfahrten und Kreuzzüge, in denen fremde Völker einander kennen lernten. Die letzten Kriege dieser Art waren die Kolonialkriege, die den Völkern Amerikas, Afrikas und Asiens die Überlegenheit der europäischen Zivilisation bewiesen und damit die Europäisierung der Erde einleiteten... Der Krieg rückt – wie Bismarck sagte – die Zeiger der Uhr der Geschichte richtig. Er ist ein Anpassungsvorgang... Die in diesem Sinne bedeutsamen Kriege wurden nicht zwischen zwei Heeren, zwei Völkern oder zwei Staaten geführt, sondern zwischen zwei Zeitaltern.“ [65]
Kulturgeschichtlich betrachtet, d.h. aus der im historischen Denken generell eingenommenen Perspektive der Gegenwart, aus der sich die Geschichte als ein Prozess darstellt, der lauter Kulturleistungen erbracht hat, haben die Raubzüge der Wikinger und die Kreuzzüge abendländischer Fürsten die überfallenen Völker nur der Welt nähergebracht, sie haben ihnen gewissermaßen den Blick über den Tellerrand ihres beschränkten Kulturkreises geöffnet. Wenn die Völker solchen Formen der Kommunikation gelegentlich zum Opfer gefallen und untergegangen sind, so zeigt dies dem historisch denkenden Intellekt nur, dass ihre Kultur eine unterlegene war. Ihre Zeit war abgelaufen. Die Geschichte rückt so etwas zurecht. Umgekehrt ist die „Europäisierung der Erde“, d.h. die in den „Kolonialkriegen“ herbeigeführte Unterwerfung der „Völker Amerikas, Afrikas und Asiens“ unter die Herrschaft der Europäer als logische Folge der „Überlegenheit der europäischen Zivilisation“ zu betrachten, die die Europäer in eben diesen Kriegen unter Beweis gestellt haben. Ein Fortschritt nicht zuletzt auch für die betreffenden Völker, denen die „Europäisierung“ ihrer Länder die Teilhabe an einer der ihren überlegenen Zivilisation gebracht hat. So geht historisches Denken! [66]
[1] Johann Gustav Droysen, Historik (1858), hrsg. von Rudolf Hübner, München/Berlin 1937, S. 326
[2] Richard J. Evans, Fakten und Fiktionen. Über die Grundlagen historischer Erkenntnis, Frankfurt am Main 1998, S. 153
[3] Stefan Jordan, Theorien und Methoden der Geschichtswissenschaft, Paderborn 2008, S. 214
[4] Fernand Braudel, Schriften zur Geschichte I, Gesellschaften und Zeitstrukturen, Stuttgart 1992, S. 91
[5] Johann Gustav Droysen, Historik (1858), hrsg. von Rudolf Hübner, München/Berlin 1937, S. 28
[6] Richard J. Evans, Fakten und Fiktionen. Über die Grundlagen historischer Erkenntnis, Frankfurt am Main 1998, S. 182
[7] Jörg Schmidt, Studium der Geschichte, München 1975, S. 16
[8] Ernst Opgenoorth, Günther Schulz, Einführung in das Studium der neueren Geschichte, Paderborn/München/Wien 2001, S. 17
[9] Michael Mitterauer, Warum Europa? Mittelalterliche Grundlagen eines Sonderwegs, München 2004, S. 200
[10] Christian Meier, Kultur, um der Freiheit willen: Griechische Anfänge − Anfang Europas?, München 2009
[11] Heinrich August Winkler, Geschichte des Westens, München 2009, S. 25
[12] Hans-Ulrich Wehler, Deutsche Gesellschaftsgeschichte, Bd. 3: Von der Deutschen Doppelrevolution bis zum Beginn des Ersten Weltkrieges 1849 – 1914, München 2008, S. 1291
[13] Hans-Ulrich Wehler, Beginn einer neuen Epoche der Weltkriegsgeschichte, in: FAZ, 6.5.2014
[14] Michael Burleigh, Die Zeit des Nationalsozialismus: Eine Gesamtdarstellung, Frankfurt am Main 2000, S. 21
[15] Richard J. Evans, Fakten und Fiktionen. Über die Grundlagen historischer Erkenntnis, Frankfurt am Main 1998, S.137
[16] Ebd.
[17] Hagen Schulze, Wir sind, was wir geworden sind. Vom Nutzen der Geschichte für die deutsche Gegenwart, München 1987, S. 25
[18] Thomas Nipperdey, 1933 und die Kontinuität der deutschen Geschichte, in: ders., Nachdenken über die deutsche Geschichte, München 1986, S. 204
[19] Hans-Ulrich Wehler, Deutsche Gesellschaftsgeschichte, Bd. 1: Vom Feudalismus des alten Reiches bis zur defensiven Modernisierung der Reformära 1700 – 1815, München 1987, S. 13
[20] Für die Vertreter dieser Wissenschaft mögen Welten liegen zwischen einer Geschichtsschreibung, welche in der Geschichte Ideen walten sieht und einer, die sich darauf verlegt, Entwicklung und Fortschritt in der Geschichte als Wirkung von Kräften und Impulsen zu erklären, die von historischen Ereignissen oder gesellschaftlichen Strukturen ausgehen. Ihrer Logik nach liegen die angestrengten Erklärungen nicht weit auseinander: Schließlich muss der Historiker, der sich der ersten Variante verschrieben hat, den Ideen, die er zum Argument für Veränderungen in der Welt macht, auch – ausdrücklich oder unterstellterweise – eine irgendwie geartete Wirksamkeit zuschreiben; sonst könnten sie ja nichts bewirkt haben. Und die Kräfte, die in der anderen Variante zur Erklärung von historischen Veränderungen mobilisiert werden, haben schon auch immer eine inhaltliche Bestimmung, und die liegt – auch wieder ausgesprochen oder unausgesprochen – in dem, was sie bewirkt haben sollen oder was unter ihrer Mitwirkung hervorgebracht worden sein soll, in dem Telos also, auf das sie hingewirkt haben.
[21] Fischer Lexikon Geschichte (hrsg. von Richard van Dülmen), Frankfurt am Main 1990, S. 390
[22] A.a.O., S.391
[23] Ebd.
[24] Ebd.
[25] Hans-Ulrich Wehler, Deutsche Gesellschaftsgeschichte, Bd. 3: Von der Deutschen Doppelrevolution bis zum Beginn des Ersten Weltkrieges 1849 – 1914, München 2008, S. 1291
[26] Dieter Langewiesche, Zeitwende, Geschichtsdenken heute, Göttingen 2008, S. 109
[27] Ebd.
[28] Volker Sellin, Einführung in die Geschichtswissenschaft, Göttingen 2005, S. 70
[29] Martha Howell, Walter Prevenier, Werkstatt des Historikers, Köln 2004, S. 160
[30] Thomas Nipperdey, 1933 und die Kontinuität der deutschen Geschichte, in: ders., Nachdenken über die deutsche Geschichte, München 1986, S. 221
[31] Heinrich-August Winkler, Der lange Weg nach Westen, Bd. I: Vom Ende des Alten Reiches bis zum Untergang der Weimarer Republik, München 2000, S. 2
[32] Diese Form des teleologischen Argumentierens unter Zuhilfenahme wirkmächtiger Ideen und final bestimmter Kräfte ist und bleibt ein logisches Grundmuster allen historischen Denkens und Erklärens, und sie hat als solches auch in der modernen Geschichtswissenschaft ihren festen Platz – auch wenn sich dem Projekt einer Universalgeschichte, welche ein geschlossenes
, teleologisches Geschichtsbild
darbietet, heute nur noch wenige Historiker verschreiben mögen. In der Regel erteilt man dem Gedanken eines definitiven Endzwecks, auf den sich die Geschichte der Menschheit hinbewegt haben soll oder hinbewegen wird – als Beispiele dafür werden in dem Zusammenhang immer wieder Hegels Geschichtsphilosophie und der Historische Materialismus genannt – eine Absage. Diese Absage richtet sich, auch dort, wo sie sich teleologiekritisch gibt, jedoch nicht gegen das teleologische Denken als solches und auch nicht gegen entsprechende gedankliche Konstruktionen. Zu dem Verfahren, die Chronologie der Ereignisse auf einen Fluchtpunkt in der Gegenwart oder Zukunft hinzuorientieren, um die Abfolge der Ereignisse als zielgerichteten Prozess erscheinen zu lassen, bekennt man sich in der modernen Geschichtswissenschaft vielmehr ausdrücklich. Die Erkenntnistheoretiker des Fachs, die Hermeneutiker und namentlich die Vertreter eines um sich greifenden und für das Selbstverständnis der heutigen Geistes- und Gesellschaftswissenschaften durchaus maßgebenden, mehr oder minder radikalen Konstruktivismus
bestehen darauf, dass so und nicht anders Wissenschaft geht und zu gehen habe. Und als Konsequenz aus der von ihnen vertretenen durch und durch affirmativ zu den theoretischen Unarten moderner Geistes- und Gesellschaftswissenschaft stehenden ‚Einsicht‘, wonach sich die Wissenschaft ihre Gegenstände zurechtkonstruiert und sich letztlich auch gar nicht auf eine objektive Welt, sondern nur auf ihre eigenen Konstruktionen bezieht, fordern sie ein Bekenntnis zur Subjektivität und Relativität aller historischen, wenn nicht gleich aller Erkenntnis überhaupt ein. Mit einem solchen Bekenntnis geht dann nach dem Selbstverständnis der modernen Wissenschaft auch alles teleologische Konstruieren in Ordnung. Verlangt ist nur, dass sich der Geschichtsschreiber erkenntnistheoretisch abgeklärt auf den Standpunkt stellt, dass mit dem Fluchtpunkt, auf den er die historischen Geschehnisse zulaufen lässt, keinesfalls ein objektives Urteil über die Geschichte verbunden sein soll; dass er nur so etwas wie eine ‚heuristische Idee‘ ist, die im Reich der Theoriebildung gute, wenn nicht sogar unverzichtbare Dienste beim Konstruieren einer Geschichte leistet. Und schon wird im Reich der Wissenschaft die Offenheit der Zukunft
durch kein geschlossenes Geschichtsbild
mehr verstellt, ist den Anforderungen einer pluralistischen Wissenschaft Genüge getan und darf jeder Historiker unter Anwendung des ganzen Instrumentariums teleologischen Argumentierens seiner speziellen Sinnstiftungsperspektive huldigen und seine Geschichte schreiben. In diesem Sinne hat sich heute verbreitet die Auffassung durchgesetzt, dass sowieso nichts anderes Bestreben, Aufgabe und Leistung der Geistes- und Gesellschaftswissenschaften ist und sein kann, als die Menschheit mit Narrativen zu versorgen: mit sinnstiftenden Erzählungen, die einen Anspruch auf die Objektivität der mitgeteilten Erkenntnisse gar nicht erst erheben (können), vielmehr von vornherein als alternative Angebote zur zeitgemäßen Identitätsfindung in die Welt gesetzt werden und als solche um die Gunst des Publikums konkurrieren.
Zitate aus: Thomas Nipperdey, Wider eine instrumentalisierte Geschichtswissenschaft, in: Jürgen Kocka, Geschichte, München 1976, S. 157
[33] Arthur C. Danto, Analytische Philosophie der Geschichte, Frankfurt am Main 1980, S. 250
[34] Jörg Schmidt, Studium der Geschichte, München 1975, S. 12
[35] Christian Meier, Athen, Ein Neubeginn der Weltgeschichte, Berlin 1997, S. 300
[36] Jörn Rüsen, Historische Methode, in: Christian Meier und Jörn Rüsen (Hrsg.), Historische Methode, München 1988, S. 76
[37] Dieter Langewiesche, Über das Umschreiben der Geschichte. Zur Rolle der Sozialgeschichte, in: Jürgen Osterhammel u.a. (Hrsg.), Wege der Gesellschaftsgeschichte, Göttingen 2006, S. 68
[38] Ernst Opgenoorth und Günter Schulz, Einführung in das Studium der neueren Geschichte, Paderborn/München/Wien/Zürich 2001, S. 36
[39] Christian Meier, Fragen und Thesen zu einer Theorie historischer Prozesse, in: Karl-Georg Faber und Christian Meier, Historische Prozesse, München 1978, S. 13
[40] Fischer Lexikon Geschichte (hrsg. von Richard van Dülmen), Frankfurt am Main 1990, S. 346 f. (Hervorhebungen im Zitat: GegenStandpunkt)
[41] Christian Meier, Fragen und Thesen zu einer Theorie historischer Prozesse, in: Karl-Georg Faber und Christian Meier, Historische Prozesse, München 1978, S. 11
[42] An einem solchen Subsumieren unter Allgemeinheiten haben die französischen Wissenschaftsphilosophen Foucault, Lyotard und Derrida Anstoß genommen, die mit dem Schlachtruf
Krieg dem Ganzen, zeugen wir für das Nicht-Darstellbare, aktivieren wir die Differenzen, retten wir die Differenzen!
gegen den Terror
des identifizierenden Denkens
zu Felde gezogen sind. Diese postmodernen Denker sind mit der Praxis einer Wissenschaft bestens vertraut, in der die Sehnsucht
nach sinnstiftender Einheit, nach dem Ganzen und dem Einen
, Leitfaden der Gedankenbildung ist; namentlich auch eine Geschichtswissenschaft ist ihnen ein Dorn im Auge, in der man munter Teleologien
entwirft, indem man einen ganzen Komplex von Begriffen, von denen jeder auf seine Weise das Thema der Kontinuität variiert
, dergestalt zur Anwendung bringt, dass man diese Begriffe an das historische Geschehen heranträgt
, es darunter subsumiert und entsprechend zurichtet
. Dies hat diese Wissenschaftsphilosophen jedoch nicht zur Kritik der existenten verkehrten Wissenschaft, zur Kritik ihrer Fehler und ihres ‚Erkenntnisinteresses‘ veranlasst, sondern dazu, das Begreifen überhaupt als Vergewaltigung des Objekts zu geißeln. Sie haben die geistige Anwaltschaft für die Differenzen
– alternativ: für die Diskontinuitäten
, die Äußerlichkeit
, die Brüche
, die Zufallsreihe der Ereignisse
– übernommen und sich dem Ideal einer Wissenschaft verschrieben, die sich vornimmt, durch umfassende Dekonstruktion
aller Begrifflichkeit das nicht in Begriffen Fassbare (das Nicht-Darstellbare
) freizulegen und so überhaupt erst fassbar zu machen – in Begriffen, die keine sein dürfen, weil die ja als Grund allen Übels ausgemacht sind; also in etwas, das es gestatten möge, die Wirklichkeit in ihrer Differenziertheit gedanklich zu fassen, das sich aber nicht als Begriff bestimmen lässt
. Den Anhängern dieser Wissenschaftsphilosophen geschieht es recht, dass sie sich bis heute mit dem Zweifel herumzuschlagen haben, ob sie ihre Meister verstanden haben oder jemals begreifen werden.
Zitate aus:
Jean-Francois Lyotard, Beantwortung der Frage: Was ist postmodern? In: Postmoderne und Dekonstruktion. Texte französischer Philosophen der Gegenwart, Stuttgart 1990, S. 33 – 48
Michel Foucault, Archäologie des Wissens, Frankfurt am Main 1988, S. 22 und 33
Peter Engelmann, Einführung: Postmoderne und Dekonstruktion. Texte französischer Philosophen der Gegenwart, Stuttgart 1990, S. 5 – 52
[43] Hans-Ulrich Wehler, Deutsche Gesellschaftsgeschichte, Bd. 5: Bundesrepublik und DDR 1949 – 1990, München 2008, S. 422
[44] Hans-Ulrich Wehler, Anwendung von Theorien in der Geschichtswissenschaft, in: Jürgen Kocka und Thomas Nipperdey, Theorie und Erzählung in der Geschichte, München 1979, S. 30
[45] Johann Gustav Droysen, Historik (1858), hrsg. von Rudolph Hübner, München/Berlin 1937, S. 25
[46] Friedrich Prinz, Grundlagen und Anfänge, Deutschland bis 1056, München 1993, S. 16
[47] Fernand Braudel, Schriften zur Geschichte I, Gesellschaften und Zeitstrukturen, Stuttgart 1992, S. 81
[48] Thomas Nipperdey, Deutsche Geschichte 1800 – 1866, Bürgerwelt und starker Staat, München 1983, S. 802
[49] Hagen Schulze, Staat und Nation in der europäischen Geschichte, München 1995, S. 34
[50] A.a.O., S. 34 f.
[51] Chris Lorenz, Konstruktion der Vergangenheit: Eine Einführung in die Geschichtstheorie, Köln/Weimar/Wien 1997, S. 190
[52] A.a.O., S. 194
[53] Hans Jürgen Goertz, Umgang mit Geschichte. Eine Einführung in die Geschichtstheorie, Reinbeck bei Hamburg 1995, S. 124
[54] Peter Blickle, Das Alte Europa, München 2008, S. 15
[55] Alfred Haverkamp, Perspektiven deutscher Geschichte während des Mittelalters, Gebhardt Handbuch der deutschen Geschichte, Bd. 1, Stuttgart 2004, S. XVII
[56] Jörn Rüsen, Grundzüge einer Historik 2, Rekonstruktion der Vergangenheit: Die Prinzipien der Historischen Forschung, Göttingen 1986, S. 123
[57] Jürgen Kocka, Das lange 19. Jahrhundert, Stuttgart 2004, S. 147
[58] In dieser Eigenschaft und mit diesem Standpunkt sehen sich die Vertreter dieser Wissenschaft auch immer wieder dazu herausgefordert, Stellung zu beziehen in ‚Fragen‘, die den nationalen Zeitgeist umtreiben. Ein prominentes Beispiel dafür ist der sog. Historikerstreit in der BRD der 80er Jahre, losgetreten von Ernst Nolte, der darunter litt, dass Deutschland befangen ist in einer Vergangenheit, die nicht vergehen will
. Mit einem feinen Gespür dafür, wie nationale Moral und wirklicher Machtstatus der Nation zusammengehören, hat (nicht nur) dieser Gelehrte erkannt, dass es zu Rang und Namen, die seine Nation mittlerweile erobert hat, nicht mehr so recht passen will, dass diese Nation ihre moralische Größe und Vorbildlichkeit immer noch maßgeblich über ein Bekenntnis zur nationalen Schuld, nämlich auf dem Wege der Übernahme der Verantwortung für die einzigartigen Verbrechen der Nazis, unter Beweis stellt. Und er hat mit der Autorität seiner Wissenschaft im Rücken mutig die These in den Raum gestellt, dass die angeblich singuläre Tat
, der Holocaust, so singulär gar nicht war; dass ihr durchaus vergleichbare Verbrechen der Bolschewiki
vorausgingen, so dass sich die Frage stellt, ob Auschwitz nicht besser als die aus Angst geborene Reaktion auf die Vernichtungsvorgänge der russischen Revolution
zu verstehen wäre. Der heftige Widerspruch, auf den Nolte, Stürmer und andere Historiker mit ihrem Versuch gestoßen sind, das Geschichtsbild zeitgemäß zu renovieren, war bezeichnenderweise durchgängig von der Sorge um das einer Bundesrepublik Deutschland angemessene nationale Selbstbewusstsein getragen. Wortführer des Widerspruchs war damals Jürgen Habermas, der mit folgender Begründung auf der Unverzichtbarkeit des Bekenntnisses zur nationalen Schuld für die nationale Identität der Deutschen bestanden hat:
Die vorbehaltlose Öffnung der Bundesrepublik gegenüber der politischen Kultur des Westens ist die große intellektuelle Leistung unserer Nachkriegszeit, auf die gerade meine Generation stolz sein könnte... Der einzige Patriotismus, der uns dem Westen nicht entfremdet, ist ein Verfassungspatriotismus. Eine in Überzeugungen verankerte Bindung an universalistische Verfassungsprinzipien hat sich leider in der Kulturnation der Deutschen erst nach – und durch – Auschwitz bilden können. Wer uns mit einer Floskel wie ‚Schuldbesessenheit‘ (Stürmer und Oppenheimer) die Schamesröte über dieses Faktum austreiben will, wer die Deutschen zu einer konventionellen Form ihrer nationalen Identität zurückrufen will, zerstört die einzige verlässliche Basis unserer Bindung an den Westen.
Zitate aus:
Ernst Nolte, Vergangenheit, die nicht vergehen will, in: FAZ, 6.6.1986
Ders., Die negative Lebendigkeit des Dritten Reiches, in: FAZ, 24.7.1980
Jürgen Habermas, Eine Art Schadensabwicklung. Die apologetischen Tendenzen in der deutschen Zeitgeschichtsschreibung, in: Die Zeit, 11.7.1986
[59] Stefan Jordan, Lexikon Geschichtswissenschaft, Stuttgart 2002, S. 263
[60] Unter dem Titel ‚Oral history‘ oder ‚Alltagsgeschichte‘ bemüht sich seit ein paar Jahrzehnten eine Abteilung in der Geschichtswissenschaft, dem normalen Menschen, dem einfachen Volk, den gesellschaftlichen Unterschichten
(Carlo Ginzburg, Der Käse und die Würmer – die Welt eines Müllers um 1600, Berlin 1990, S. 22) das Recht auf historische Darstellung
(Klaus Tenfelde, Die Geschichte der Arbeiter zwischen Strukturgeschichte und Alltagsgeschichte, in: Wolfgang Schieder, Volker Sellin, Sozialgeschichte in Deutschland IV, Göttingen 1987, S. 99) zukommen zu lassen. Man kritisiert die offizielle Geschichtsschreibung wegen einseitiger Festlegung auf das Handeln der Obrigkeiten und die Haupt- und Staatsaktionen
(Carola Lipp, Schimpfende Weiber und patriotische Jungfrauen, Bühl-Moos 1986, S. 9) und vermisst die Würdigung der Rolle, die das Fußvolk und das weibliche Geschlecht in der Geschichte gespielt haben. Das hat noch gefehlt: eine Geschichtsschreibung von unten, die es sich zum Anliegen macht, dem Menschenmaterial der Obrigkeiten, die Geschichte geschrieben haben, das Verdienst zuzuschreiben, dass sich ohne es der Fortschritt der Menschheit kaum hätte Bahn brechen können.
[61] Christian Meier, Athen. Ein Neubeginn der Weltgeschichte, Berlin 1997, S. 33
[62] A.a.O., S. 284
[63] A.a.O., S. 35
[64] Hans-Ulrich Wehler, Deutsche Gesellschaftsgeschichte, Bd. 5: Bundesrepublik und DDR 1949 – 1990, München 2008, S. 424
[65] Alexander Demandt, Endzeit? – Die Zukunft der Geschichte, Berlin 1993, S. 78 f.
[66] Zu den dümmsten Einfällen, auf die Kritiker der bürgerlichen Gesellschaft jemals gekommen sind, gehört zweifelsohne der historische Materialismus. Im Prinzip mit demselben logischen Instrumentarium des historischen Denkens, mit dem die bürgerlichen Geschichtsphilosophen der Geschichte abgelauscht haben wollten, dass sie im bürgerlichen Staat ihr Telos erreicht, hat man eine in die Zukunft verlängerte hoffnungsstiftende Perspektive in die Geschichte hineinkonstruiert und sich eine Lehre zusammengezimmert, derzufolge die Geschichte ein gesetzmäßiger Entwicklungsprozess der Gesellschaft vom Niederen zum Höheren
ist, eine Geschichte von Klassenkämpfen
, in denen sich jeweils die Partei durchsetzt, die auf der Seite des Fortschritts steht, bis schließlich der Kommunismus, die klassenlose Gesellschaft
erreicht ist. Diese ‚Lehre‘, die es später unter dem ‚realen Sozialismus‘ zur offiziellen Staatsideologie gebracht hat, will auch eine historische Gesetzmäßigkeit
kennen, die dafür sorgt, dass die Geschichte mit Notwendigkeit diesen Gang nimmt. Ihr Inhalt besteht in der Behauptung, dass die bestehenden Produktionsverhältnisse immer wieder zur Schranke für die Entfaltung der Produktivkräfte geraten und dann nach dem Gesetz des Fortschritts revolutioniert werden müssen.
Die Urheber und späteren Anhänger dieser Lehre, die mit dem Nachweis, dass die bestehenden kapitalistischen Produktionsverhältnisse unvereinbar sind mit dem materiellen Interesse derjenigen, denen unter diesen Verhältnissen die Rolle der Arbeiterklasse zukommt, durchaus gute Gründe auf ihrer Seite hatten, den Angehörigen dieser Klasse den Umsturz der Verhältnisse nahezulegen, wollten nicht darauf verzichten, der praktischen Konsequenz, die sie aus ihrer Kapitalismuskritik gezogen haben und gezogen sehen wollten, die Weihen einer höheren Notwendigkeit zu verleihen. So als wäre diese Konsequenz erst wohlbegründet, wenn sie nicht nur materialistisch damit begründet ist, dass das Interesse der Lohnarbeiter in diesem Laden systematisch unter die Räder kommt, sondern von der Geschichte höchstpersönlich auf die Tagesordnung gesetzt wird, haben sie – nicht sehr materialistisch! – darauf bestanden, dass der Kommunismus die historische Mission der Arbeiterklasse
ist, und im Rahmen ihrer Geschichtsphilosophie – was nur konsequent ist, wenn man die historische Denkweise adoptiert! – auch der Ausbeuterklasse eine historische Mission
bescheinigt, nämlich die, in der Entwicklung der Gesellschaft vom Niederen zum Höheren
ganz viel zur Entfaltung der Produktivkräfte beigetragen zu haben.
Zitate aus:
Philosophisches Wörterbuch, hrsg. von Georg Klaus und Manfred Buhr, Leipzig 1975, Bd. 1, S. 457 f.
Wörterbuch der Geschichte, Dietz Verlag, Berlin 1984, S. 592