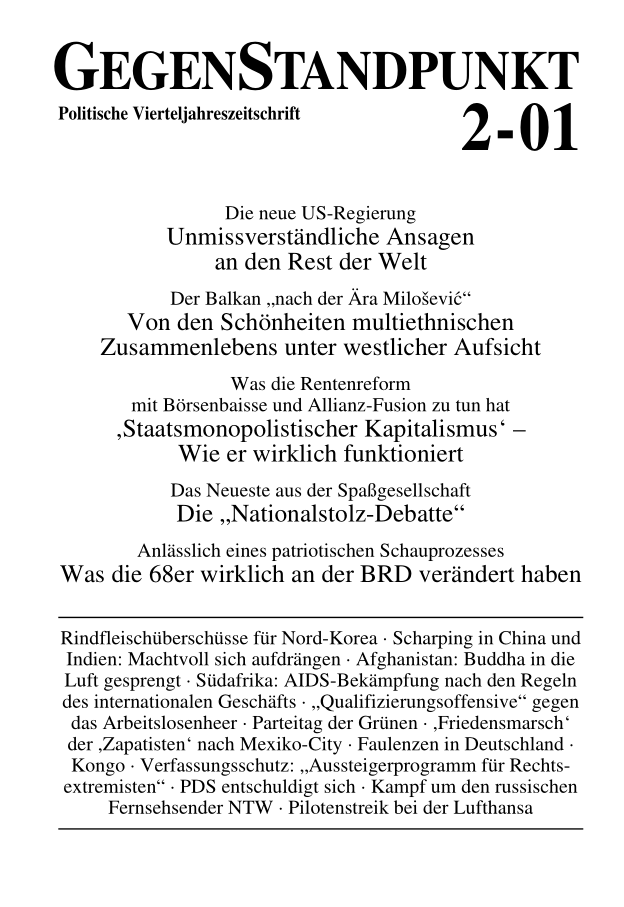Aus der Reihe „Chronik - kein Kommentar!“
Der ‚Friedensmarsch‘ der ‚Zapatisten‘ nach Mexiko-City:
Eine Guerilla präsentiert sich als nationale Kraft – das hat den Indios noch gefehlt!
Die Guerilla der ‚Zapatisten‘ mit ihrem Anführer ‚Subcommandante Marcos‘ wollen die nationale Anerkennung der Indios als respektable Volksgruppe. In den elenden Lebensbedingungen, denen die Indios unterworfen sind, sehen sie den Ausdruck mangelnden Respekts vor einer Kultur, die sich durch Überlebenskunst unter eben diesen Umständen auszeichnet. Die neue Regierung Fox sieht im Eingehen auf diese Forderung die Möglichkeit einer Befriedung der Region, die sie für Geschäftsinteressen interessant machen will. Das entsprechende Gesetz lässt von den Forderungen der ‚Zapatisten‘ nach materiellen Verbesserungen für die Indios deswegen nichts übrig.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Der ‚Friedensmarsch‘ der ‚Zapatisten‘
nach Mexiko-City:
Eine Guerilla präsentiert sich als
nationale Kraft – das hat den Indios noch gefehlt!
Gemeinhin sind Guerillabewegungen
in Mittel- und
Südamerika für den gewaltsamen Widerstand bekannt, mit
dem sie sich gegen die Machenschaften ihrer staatlichen
Obrigkeit zur Wehr setzten. Auch die Nationale
Zapatistische Befreiungsarmee
(EZLN) in Mexiko ist
vor einigen Jahren für die Belange der indianischen
Bevölkerung kämpferisch angetreten und hat notgedrungen
der Macht des Staates und dem Terror von
Großgrundbesitzern, die den Indios auch ihre noch
verbliebenen Lebensgrundlagen bestreiten, anfänglich an
Gewalt entgegenzusetzen versucht, was sie aufzubieten
vermochte.
Und jetzt das: Die Führer dieser Guerillabewegung begeben
sich mit einer bunten Begleittruppe von Indios,
Demonstranten und Journalisten auf einen
Friedensmarsch
nach Mexiko City – unter dem
Beifall des mexikanischen Präsidenten und von der Polizei
durchs Land geleitet! Sie reisen ins Zentrum derselben
Macht, die diese Guerilla und alle, die der Sympathie mit
ihr verdächtig schienen, blutig bekämpft – um im
Parlament vor denen, für die die Indios mit ihren
bescheidensten Lebensbedürfnissen ein einziger Störfall
und eine Herausforderung an ihren Gewaltapparat und sonst
nichts sind, eine Rede zu halten! Eine Rede vor dem Hohen
Haus zur Frage der indigenen Bevölkerung
, auf die
das Parlament, bitte sehr!, eine zufriedenstellende
Antwort zu beschließen hätte. Kein Zweifel: Ein
politischer Lernprozess
, den die
Weltöffentlichkeit am ‚Subcomandante Marcos‘ befriedigt
zur Kenntnis nimmt, hat da schon stattgefunden – fragt
sich nur, worin er besteht.
1.
Die Zapatisten unter der ideologischen Führung des ‚Subcomandante‘ haben auf die ‚Gewaltfrage‘, die ihnen und ihren Anhängern aufgemacht wird, eine ziemlich originelle Antwort gefunden: Wo die Bevölkerung durch Großgrundbesitzer von ihrem Land vertrieben wird, wo der Staat sie als nutzloses und störendes lebendiges Inventar behandelt und es an allen Anstrengungen, die in ‚zivilisierten‘ kapitalistischen Verhältnissen im Hinblick auf Brauchbarkeit und Gehorsam des Volkes unternommen werden, fehlen lässt, wo statt dessen Militärs und Paramilitärs im Dienste des Staats und der Grundbesitzer ihr Werk verrichten, da schwören die Zapatisten dem Guerilla-Kampf offiziell ab und verlegen sich darauf, die Interessen der indianischen Bevölkerung politisch zu vertreten, d.h. sie bei den herrschenden Kreisen anzumelden und auf friedlichem Wege ihre Berücksichtigung einzufordern. Ihre ‚Rebellion‘ soll nicht mehr die Zuständigen für den rücksichtslosen Umgang mit den eingeborenen Massen entmachten, sondern sie nachdrücklich an ihre politische Pflicht erinnern, in ihr politisches Treiben im Namen des Volkes auch die Sache der Indios mit einzuschließen und entsprechend über sie zu beschließen:
„Deshalb wollen wir allen Abgeordneten und Senatoren sagen, dass sie ihre Pflicht erfüllen, dass sie wahre Repräsentanten des Volkes seien.“ (Rede der Kommandantin Esther vor dem Kongress)
Diese Guerilla-Mannschaft hat sich mithin in die Rolle des Bittstellers begeben, der bei seinen Gegnern an deren politische Verantwortung appelliert und sie vor gewalttätigen Unruhen warnt, die keineswegs von ihr selbst, sondern von ganz anderen Irrläufern ausgehen könnten:
„Die ethnische Frage kann hier wie anderswo zur Entstehung fundamentalistischer Bewegungen führen, die zu allen mörderischen Verrücktheiten bereit sind.“ (Le Monde diplomatique, März 2001)
Was sie selber angeht, so wollen sie als Vorkämpfer unterdrückter Massen also ein anderes Vorbild geben als frühere Guerillabewegungen mit ihrem demonstrativen Kampfeswillen: kein Vorbild für den Massenaufstand, sondern eines an nationaler Verantwortung. Den Regierenden bieten sie Gehorsam an, wenn die Indios endlich in Mexiko eingemeindet werden, so dass auch sie den Staat als den Ihren begreifen können. Darauf zielt er ab, der „moderne“ Kampf gegen Elend und Unterdrückung in Mittelamerika.
2.
Elend und Unterdrückung haben sich überhaupt nicht
geändert, wie selbst dem idealistischen Forderungskatalog
zu entnehmen ist, mit dem die Zapatisten bei den
Staatszuständigen vorstellig werden. Dem griffigen Bild,
was den Indios von Staats wegen alles gewährt werden
sollte – Wohnung, Land, Arbeit, Lebensmittel,
Gesundheit, Erziehung, Unabhängigkeit, Gerechtigkeit,
Freiheit, Demokratie und Frieden
(Erklärung aus dem Lacandona-Wald) – ist
ja durchaus anzusehen, wie die Lage wirklich ist: Nichts,
was zum Leben und Überleben nötig ist, ist für sie
gesichert, im Gegenteil, noch die nötigsten
Subsistenzmittel werden ihnen laufend bestritten und
gewaltsam vorenthalten. Anzumerken ist diesem griffigen
Katalog aber auch, von welchem Standpunkt aus sich die
Zapatisten, die sich so „zivilisiert“ der unterdrückten
indianischen Rechte annehmen, dieser Lage widmen. Sie
begreifen sie als einen einzigen Verstoß gegen all die
guten Werke, die der Staat dieser Mannschaft eigentlich
zu leisten schuldig wäre, aber schuldig bleibt. Wenn ihre
elementarsten Lebensinteressen nichts gelten, dann liegt
das daran, dass ihnen der Staat etwas Höheres vorenthält:
den Respekt, der ihnen von seiner Seite gebührt –, und
zwar in ihrer Eigenschaft als Zugehörige des Kollektivs,
das seiner Gewalt untersteht. Als solche sind sie in und
mit ihren ganzen Überlebenssorgen etwas Besonderes, das
von oben gewürdigt zu werden verdient. Am Elend der
Subsistenzbauern und der übrigen Armutsgestalten besticht
die Indio-Vertreter nämlich die Tradition, die
dieser Menschenschlag diesbezüglich mit seinen
Überlebenskünsten in indianischen Dorfgemeinschaften
vorzuweisen hat, die in diesen Lebensverhältnissen
entdeckte Kultur, die diese Population in all
ihrer Not unendlich groß macht. Die verdient es, dass
die Indios zu Vollbürgern
gemacht werden. Als
Indios sollen sie geachtete Bürger sein
dürfen. Die von oben beglaubigte Wertschätzung als
ordentliches eigenes Volk ist nach Auffassung des
Subcomandante die seligmachende Perspektive für eine
Mannschaft, die ums Überleben kämpft:
„Die Indios sind die Vergessenen Mexikos. Sie gelten als Bürger zweiter Klasse, als Störfaktor. Aber wir sind kein Abfall. Wir gehören zu jenen Völkern, die eine tausendjährige Geschichte, tausendjährige Weisheit vorweisen können, die mit Füßen getreten und vergessen wurden, aber noch nicht tot sind. Und wir wollen als Bürger anerkannt werden wie alle anderen auch, wir wollen ein Teil Mexikos sein, ohne unsere Kultur aufgeben zu müssen, kurz: ohne auf unsere Existenz als Indigene zu verzichten.“ (Le Monde diplomatique, März) „Dass wir Anerkennung wollen für unsere Art uns zu kleiden, zu sprechen, zu regieren, zu organisieren, zu beten etc.;“ (Rede vor dem Kongress)
Konstitutionelle Anerkennung
also haben sie
verdient in ihrer Eigenschaft als völkische Minderheit.
Für ihre in der Rasse verbürgte besondere
Erdverbundenheit: Wir sind das Volk, das die Farbe der
Erde hat
(Subcomandante Marcos
immerzu); für eine 500jährige Geschichte von Elend
und Terror, in der glatt nicht alle Indios ausgerottet
worden sind; für die gemeinsam ausgehaltene Lebensnot;
für die von den Verhältnissen erzwungene Bescheidenheit,
die diese geduldigen Opfer auszeichnet; also für ein
anständiges Sich-Einrichten in der Not: Das
nämlich ist die Tugend, die die Indios zum
Volkskollektiv qualifiziert, das sich so vorbildlich
abhebt vom Sittenbild einer bürgerlichen
Konkurrenzgesellschaft mit ihrem schmutzigen
Streben nach Reichtum, mit ihrer Amerikanisierung
und ihrer Unterdrückung aller Minderheiten
. Die
durch ein Autonomiestatut gesicherte politische
Erlaubnis, sich als völkische Minderheit im Staat
heimisch fühlen zu dürfen: Das ist das großartige
Verlangen, mit dem die Guerilla gegen die Gewalt antritt,
die den Indios tagtäglich das Leben schwer macht. Mit
staatlicher Garantie und Betreuung sollen sie endlich
ungestört ihre völkischen Eigenheiten pflegen können –
durch eine weitreichende Selbstverwaltung nach
‚traditionellem Muster‘ mit Dorfversammlungen,
‚indianischer Rechtsprechung‘ und ähnlich gut bei der
Elendsbewältigung bewährtem Brauchtum. Von der Pflege der
indianischen Sprachen bis zur Wiederherstellung ihres
gemeinschaftlichen Bodennutzungsrechts können sich die
Zapatisten da mitten unter den wüstesten Verhältnissen
lauter Wohltaten der Staatsmacht vorstellen, die dem
Indio doch das besagte ‚eigene‘ Leben in
Unabhängigkeit, Gerechtigkeit, Freiheit, Demokratie
und Frieden
ermöglichen könnten – wenn, ja wenn sich
nur die Einstellung der herrschenden Elite gegenüber den
‚Marginalisierten‘ änderte.
Kein frommer Wunsch; denn dazu ist die Staatsführung ja verpflichtet – jedenfalls nach Auffassung von Indio-Anwälten, die die zapatistische Staatsideologie „Freiheit und Land“ für das einfache Volk, mit der das moderne Mexiko sich als ordentlicher aufstrebender Nationalstaat präsentiert hat, kultursoziologisch-moralisch ausdeuten und zum Schlachtruf eines politischen Anerkennungsprogramms erheben. Das 70 Jahre währende leere Versprechen der Regierungen der ‚institutionalisierten Revolution‘, sie seien den bäuerlichen Massen besonders verpflichtet, legen sie sich absichtsvoll als eigentlichen mexikanischen Staatszweck zurecht, den sie dann nicht verwirklicht sehen – ein Unrecht, das die eingeborene Kreatur zum empörten Aufschrei berechtigt:
„Die guten Männer und Frauen hören diese Schreie nicht, weil sie selbst der Schrei sind… Damit die anderen wissen, dass ihr Reichtum schmutzig ist, soll sich dieser Schrei in ein Erdbeben verwandeln. Eins das diesmal die Farbe der Erde hat.“ (Dorfrede von Marcos vom 1.3.)
Als gute, um ihre Achtung betrogene Menschen sind die
Indios damit ein Vorbild für all das, was ein
Intellektueller im Urwaldlager sich unter dem Stichwort
Zivilgesellschaft
so angelesen hat: die Armen im
Lande, andere ethnische Minderheiten, Lesben und Schwule,
Frauen, aber auch wegen ihrer abweichenden Meinungen
verfolgte kritische Geister… Sie alle eint nach
Auffassung der Kämpfer wider das ‚Vergessen‘ und die
‚Marginalisierung‘ das berechtigte Verlangen, mit ihren
Bedürfnissen in allererster Linie national ge-
statt verachtet zu werden. Ausgerechnet ein
Staat wie der mexikanische, der die massenhaft
unbrauchbaren Elemente seiner Gesellschaft gnadenlos mit
Gewalt im Griff hält und dessen Sachwalter deshalb den
bürgerlichen Freiheitsrechten eines geregelten
demokratischen Staatslebens wenig abgewinnen können, wird
mit dem Idealismus beehrt, er sollte sich ganz
undogmatisch und gewaltfrei zum Garanten für alle
möglichen abweichenden privaten, gesellschaftlichen und
politischen Bedürfnisse seiner Bürger machen und für ein
glückliches Miteinander sorgen, in das von den Indios bis
zu den linken politischen Dichtern und Denkern im Land
alles eingemeindet wird, was nicht eindeutig zur
herrschenden politischen Elite zählt:
„Wir wollen ein Land, wo man den Unterschied anerkennt und achtet. Wo das Anderssein oder das Andersdenken nicht Grund ist, dass man ins Gefängnis kommt, verfolgt wird oder sterben muss.“ (Rede vor dem Kongress, 28.3.)
Und was tun, wenn die Macher im Land eine ganz andere Auffassung von ihrer Verantwortung haben und laufend klarstellen, dass es nicht um ‚Unterschiede‘, sondern um die Durchsetzung von Interessen geht, die Rücksichten verbieten? Dann sprechen die Befürworter eines bunten Staatslebens von unten den regierenden Patrioten einfach die Verantwortung ab, veranstalten inoffizielle Volksabstimmungen für mehr Indio-Rechte und nehmen den Staatsrepräsentanten das Recht, das ‚wahre Mexiko‘ zu repräsentieren, ideell aus der Hand:
„Der Regierung wird die Obhut über das Vaterland entzogen; die Fahne von Mexiko, das oberste Gesetz der Nation, die Hymne Mexikos und das Nationalwappen sind ab heute unter der Obhut der Widerstandskräfte, bis die Legalität, die Legitimität und die Souveränität auf dem ganzen nationalen Gebiet wieder hergestellt sind.“ (Erklärung aus dem Lacandona-Wald) „Wir marschieren heute, weil die mexikanische Fahne die Unsere werden soll, aber stattdessen bietet man uns das zerfetzte Tuch des Schmerzes und des Elends“ (Le Monde diplomatique, März)
So marschiert diese Guerilla demonstrativ durchs Land, um ihrem Staat mit einem eigenen patriotischen Beitrag zum Gelingen der Herrschaft zu dienen. Gegenüber einer Herrschaft, die ihren Massen selbst die elementarsten Lebensbedürfnisse gewaltsam streitig macht, treten die Vorkämpfer für ‚Vielfalt‘ im politischen Leben mit dem Schlachtruf ‚Einheit statt Spaltung‘ an und legen den Vertretern der Staatsgewalt die drangsalierten Massen als die besten und aufopferungsvollsten Anhänger Mexikos ans Herz. Die wollen endlich zu einem Staat halten können, der sie als staatstragende Basis gar nicht braucht und schätzt:
„Wir wollen ein Teil von Mexiko sein, Indianische Mexikaner“ in einem „Nationalstaat Mexiko, der gerechter und solidarischer ist“; damit „wir alle in den entscheidenden Augenblicken unserer Geschichte unsere Unterschiede zurückstellen gegenüber dem, was wir gemeinsam haben, das ist, dass wir Mexikaner sind.“ (Rede vor dem Kongress)
Mit der politischen Anerkennung der ‚Minderheiten‘ verbinden die Antragsteller zugleich ein weitreichendes Angebot an den Staat. Nach innen wird ihm die Zustimmung seiner Mehrheit und damit eine gefestigte nationale Basis versprochen, nach außen soll sich das Land damit endlich aus den für unwürdig befundenen Abhängigkeitsverhältnissen vom amerikanischen Ausland befreien – ein Angebot, das nach ihrer Meinung kein Anhänger Mexikos ausschlagen kann. Allen mexikanischen Nationalisten bringt die Guerilla-Führung im Parlament in Erinnerung,
„dass unsere Nation, gebildet aus Unterschieden, souverän ist und unabhängig. Und nicht eine Kolonie, wo das Plündern, die Willkür und die Schande an der Tagesordnung sind.“ (Rede vor dem Kongress)
Sie meint nämlich, Mexiko müsste erst noch zu einer richtigen Nation zusammengeschmiedet werden, indem der Staat endlich auch seine ‚Minderheiten‘ in den Rang echten Volkstums erhebt.
Die Bereitschaft dazu haben sie bei der PRI vermisst, der sie vorwerfen, 70 Jahre lang den Staat usurpiert und für sich monopolisiert zu haben. Für diese Bereitschaft entdecken sie umgekehrt gewisse Anzeichen beim neuen Präsidenten – allein deswegen, weil er der PRI-Dauerherrschaft mit seinem Wahlerfolg ein Ende gemacht hat:
„Ohne Zweifel waren wir ein Teil der Kräfte, die den PRI besiegt haben. Aber letztlich war es die nichtorganisierte Gesellschaft. Es bleibt noch genau zu eruieren, was genau die Gesellschaft damit sagt… Wahrscheinlich hat das ‚no‘ keine Zustimmung für die Rechte bedeutet, nicht für den PAN, nicht für Fox… Das Land will etwas Neues schaffen. Und wir … zusammen mit der Gesellschaft … schaffen uns einen Raum als Indianische Völker, die wir sind.“ (Marcos-Interview mit Ignacio Ramonet, El País, 25.2.)
Man muss nur genau auf Volkes Stimme hören, die sich in Wahlkreuzen versteckt, dann klärt sich, dass hier nicht bloß ein neuer Präsident gewählt worden ist und sich insofern an den entscheidenden Verhältnissen überhaupt nichts geändert hat. Hier ist der Auftrag des Volkes zu einem neuen Aufbruch ergangen, und damit auch schon ein erster entscheidender Schritt hin zu seiner Verwirklichung getan. Wohin der führen soll, bleibt zwar noch genauer zu eruieren, aber ein schöner Gleichklang mit der Macht ist schon mal erreicht, wenn der Wahlsieg des Kandidaten Fox wie auch immer ein Sieg des Volkes ist. Es braucht also wirklich nicht viel, um dem Versöhnungswillen der Guerilla geeignete Perspektiven für einen ‚nationalen Dialog‘ zu eröffnen. Wenn sonst niemand, eröffnen sie sich ihre Perspektive, nicht ganz ausgeschlossen zu sein von der Mitgestaltung der nationalen Politik, eben selber:
„Wie sehen Sie die Lage? Wie einen Kampf zwischen der Stechuhr des Präsidenten Fox und der Sanduhr, die wir haben. Der Streit geht darum, ob wir uns der Stechuhr anpassen oder Präsident Fox sich der Sanduhr anpasst. Weder das eine noch das andere geht. Wir – er und wir – müssen begreifen, dass wir an einer gemeinsamen Uhr arbeiten müssen, einer gemeinsamen Uhr, die den Rhythmus für den Dialog und schließlich den Frieden anzeigen wird… Einmal mehr handelt es sich um den Kampf, ob die politische Zukunft von der politischen Klasse diktiert wird oder sich aus Ideen gestaltet, die wir mitbringen. Und wieder denke ich, weder das eine noch das andere wird siegen… Unsere Aufgabe ist es, die Regierung zu überzeugen, dass wir einen Verhandlungstisch bauen, dass die Regierung sich mit uns daran setzen muss und gewinnen wird.“ (Marcos-Interview mit Gabriel García Márques, FAZ, 11.4.)
3.
Dieses politische Emanzipationsprogramm ist wahrlich nicht den Köpfen der drangsalierten Elendsgestalten entsprungen, in deren Namen sich die ‚Zapatisten‘ aufstellen. Die Kämpfer für die Rechte der eingeborenen Bevölkerung treten zwar mit dem Anspruch an, sie würden mit ihren Forderungen nur deren ureigensten Bedürfnissen eine ‚Stimme‘ verleihen. Sie gehen aber selber davon aus, dass die ‚Vergessenen‘ von sich aus ihren Anspruch auf eine gebührende Rolle im Staat gar nicht passend zu artikulieren vermögen. Schließlich sind die Indios – ob noch halbwegs dorfgemeinschaftlich organisiert oder nicht – ja nicht als pflichtbewusste demokratische Bürger unterwegs, die mit Berufung auf Rechtsstaat und Demokratie ihre ihnen zustehenden Rechte bei der Obrigkeit einklagen. In dergestalt staatsbürgerlich sortierten Bahnen bewegt sich niemand, der die Obrigkeit vornehmlich in Gestalt unmittelbarer Gewalt und Willkür erfährt und sich deshalb schon glücklich schätzt, wenn er in Ruhe gelassen und von ihr nicht auch noch zusätzlich drangsaliert wird. Dieser ziemlich ohnmächtigen und leidensfähigen Einstellung der Indio-Bevölkerung zu der Macht, die laufend negativ über ihre Geschicke entscheidet, entnehmen Marcos und seine Mitkämpfer den Auftrag, stellvertretend für sie als Dolmetscher und Anwalt der indianischen Volksrechte ihr Anliegen dort zu Gehör zu bringen, wo über die nationalen Belange entschieden wird. Während die Indios mehr schlecht als recht in ihren Umständen dahinkrebsen, deuten ihre Fürsprecher die Unzufriedenheit und alltäglichen Sorgen dieser Mannschaft im Sinne einer großen völkischen Bürgerbewegung, die sich nach Bewahrung und Pflege ihrer eigenen Lebenskultur sehnt, und setzten sich entschieden an deren Spitze.
Sie bestätigen die Indios also in ihrer armseligen Lebensweise, aus der sie sie nicht herausreißen wollen, sondern deren Pflege sie sich zum Anliegen erkoren haben, überhöhen sie und beschäftigen sich damit, den von ihnen vertretenen Armutsfiguren den höheren Sinn und die politischen Perspektive, die sie in deren Leben ausgemacht haben und für die sie unterwegs sind, als deren ureigenen Willen nahe zu bringen. Die entsprechende politische Überzeugungsarbeit bei ihrer Basis leisten sie durch Demonstrationen ihrer Volksverbundenheit, die auf deren einfaches Untertanengemüt berechnet sind: Sorgfältig pflegt die EZLN in ihrem Auftreten die Erinnerung an den großen Volkshelden Zapata, und dort, wo sie dazu in der Lage ist, dürfen die Massen ein Stück alternativer Lokalherrschaft mit Dorfversammlungen und anderen Elementen echt indianischer Kultur genießen. Dafür ernten die alternativen Volksvertreter bei denen, in deren Namen sie sprechen, viel Verehrung – wer kümmert sich sonst schon um sie –, aber auch manches Unverständnis, weil sich die Vorstellungen der Indios von ihrer Lage nicht mit den volksfreundlichen Auslegungen und Anliegen ihrer Anwälte decken. Gesicherten Landbesitz, um existieren zu können, und ein Ende des Terrors, wer will das nicht; auch das mit der ‚Farbe der Erde‘ versteht noch jeder auf die eine oder andere Weise; was aber alles politisch daraus folgen soll und wie es mit der Anerkennung seiner Würde bestellt sein soll, schon weniger.
4.
Das macht aber nichts, weil die Interpreten der
indianischen Anliegen es dafür umso genauer wissen und
mit ihrer Botschaft im Übrigen auch ganz woanders um
Unterstützung werben: bei der nationalen und
internationalen Öffentlichkeit. In der sehen sie nämlich
einen machtvollen Helfer ihrer Sache. Weil sie die
Regierenden mit demokratischen Methoden umstimmen zu
können meinen, sehen sie in der Sphäre der
öffentlichen Meinung ihr eigentliches Kampffeld.
Die Meinungsmacher wollen sie wider das Vergessen und
die Lüge
mobilisieren, wie wenn die gebührende
Bekanntmachung des von ihnen konstatierten schreienden
Unrechts einen entsprechenden allgemeinen Aufschrei nach
sich ziehen müsste, der die Regierenden dann einfach
nicht mehr kalt lassen kann. Denn dass alle guten
Menschen und Patrioten sich in ihrem Urteil im Grunde
einig sind, dessen sind sie sich sicher:
„Wir glauben grundsätzlich, dass die ganze mexikanische Gesellschaft sowie die internationale Gesellschaft auch überzeugt ist, dass die aktuelle Situation der indianischen Völker unerträglich ist.“ (Marcos-Interview mit Ignacio Ramonet, El País, 25.2.)
Also gilt es nur immer von neuem, nachdrücklich genug
der Welt zu zeigen, dass es ein Mexiko der Armut und
Verzweiflung gibt
, dann können Erfolge nicht
ausbleiben. Daher mühen sich Marcos und seine Mitstreiter
nach Kräften um den Zuspruch der Öffentlichkeit, indem
sie sich entsprechend präsentieren: als moralisch integre
und tatkräftige Vorreiter in einem gemeinsamen Kampf für
eine buntere und gerechtere Welt, der alle guten Bürger
eint. Nach diesem Muster ist die Erfolgsstrategie des
Subcomandante gestrickt: Botschaften an die Regierenden
der Welt und Mobilisierung von ‚Solidaritäts‘-Klicks qua
Internet – das macht Eindruck und Druck! Für diesen Kampf
ist einer, der sich seine politökonomischen Einsichten
bei Shakespeare und anderen Dichtern abholt, der rechte
Mann:
„Die Literatur mit ihrem Sarkasmus und Humor hatte uns für Marx und Engels untauglich gemacht. Vom ABC kamen wir direkt zur Literatur und von da zu den theoretischen und politischen Texten… ‚Don Quijote‘ ist das beste Buch politischer Theorie, danach kommen ‚Hamlet‘ und ‚Macbeth‘. Es gibt keine bessere Form, um das politische System Mexikos zu begreifen: ‚Don Quijote‘, ‚Hamlet‘ und ‚Macbeth‘. Besser als jede Analyse in der Zeitung.“ (Marcos-Interview mit Márques, FAZ, 11.4.)
Wer in den banalen Interessen von Geschäft und Gewalt die immerwährende Versuchung der Macht und die tragikomische Verstrickung der Figuren entdeckt, die sie ausüben, der ist auch um pathetische Phrasen nie verlegen, die die schlechte Welt der Oberen geißeln:
„Die Mächtigen sind Raubvögel, das Geld ist Scheiße, und wenn das alles dem Erdboden gleichgemacht ist, wird Gott sprechen.“ (El País, 11.3.)
So und ähnlich meldet sich Marcos ein ums andere Mal zu Wort, gibt Polit-Dichtern Interviews, in denen er sich mit ihnen über den Ungeist der Herrschenden verständigt, und präsentiert sich in seiner Guerilla-Kluft aller Welt als selbstloser Streiter für eine menschlichere Herrschaft: ganz die Stimme des guten Volkes, die seinem unstillbaren Verlangen nach Gerechtigkeit und Frieden beredeten Ausdruck verleiht und überall Gehör verschafft. So kämpft er wirklich gegen das ‚Vergessen‘ indem er sich nach Kräften darum bemüht, dass dieses Anliegen von der Öffentlichkeit zur Kenntnis genommen wird, dass kein Meinungsmacher mehr darum herumkommt, Notiz vom guten Begehren zu nehmen und seiner moralischen Berechtigung und Güte die Anerkennung nicht versagen kann. Die Sache der Indios soll in der Weltöffentlichkeit präsent sein, als ob sie da bestens aufgehoben wäre.
Diese Öffentlichkeitsarbeit hat die zu ihr passenden Erfolge gezeitigt. Marcos ist zu einer Leitfigur aufgestiegen: für die Globalisierungsgegner, die diesen Standpunkt teilen und überall unterwegs sehen; für Lateinamerikas kritische Intellektuelle, die auch meinen, dass ihre Länder eine innere Erneuerung und Befriedung bräuchten, um endlich ordentliche Nationen zu werden – und in gewissem Sinne sogar für einen Teil der Weltöffentlichkeit, der das Moment von Befriedung in diesem Anliegen sowie die Professionalität würdigt, mit der ein nicht etablierter Politiker sie für sich einzunehmen versucht. Der andere Teil freilich entdeckt genau umgekehrt nach wie vor den Willen zum Aufruhr und hat keinen besseren Einwand als den Vorwurf, hier sei ja einer gar nicht wirklich als Vertreter des Volkes unterwegs, sei weiß und nicht erdbraun, sei Intellektueller statt Indio, zugereist statt bodenständig – als wäre es ihnen recht, wenn die Indios ihre Interessen selber und ganz echt kämpferisch vertreten würden.
Der Friedensmarsch
in die Hauptstadt und ins
Parlament unter reger Anteilnahme der nationalen und
internationalen Öffentlichkeit stellt insofern ein
Highlight des Kampfs dieser Guerilla dar: Sich
auf den Spuren des ‚Volkshelden Zapata‘ in den Städten
und Dörfern als Anwälte des Volks präsentieren; dem
ganzen Land zeigen, dass man weltweit beachtet und
unterstützt ist; sich national als Hoffnungsträger eines
neuen anderen Mexikos feiern lassen; als politisch
bedeutsame Kraft im Staat unterwegs sein, die den neuen
Präsidenten mit seinen Phrasen vom neuen mexikanischen
Aufbruch öffentlich in die Pflicht nimmt und ihn
verdächtigt, „keine Vision des Staates“ zu haben, sondern
in Wahrheit, „der Mann vieler Worte und weniger Taten“ zu
sein; und schließlich auch noch vor den gewählten
Volksvertretern als mahnende Stimme eines
vernachlässigten Volksteils auftreten –: Wenn das nicht
ein Erfolg für eine Guerilla ist, die die öffentliche
Aufmerksamkeit, die sie erregt, für ihre beste Waffe
ansieht! Diesen Erfolg feiert sie denn auch zu Recht,
weil für sie eben in ihrem öffentlichen Auftritt die
ganze „Veränderung der Machtverhältnisse“ besteht:
„Künftig geht nichts mehr ohne uns.“
5.
Dabei haben sich in Wahrheit nur die Berechnungen der herrschenden Figuren geändert; die haben diesen öffentlichen Propagandafeldzug der Zapatisten überhaupt erst ermöglicht. Dem neuen Präsidenten dienen sie nämlich erstens zum Beweis, dass er der neue Mann ist, unter dem alles besser wird, weil er das Land endlich zu befrieden vermag. Aus diesem Grund verfolgt er die Strategie, die Guerilla mit demonstrativem Verständnis für ihre Anliegen und mit pathetischen Friedensbotschaften zu überschütten und so – mit der Macht im Rücken – ihrer Lichtgestalt die Rolle des nationalen Erneuerers öffentlich streitig zu machen:
„Ein neues Licht scheint in Mexiko, das Licht der Wahrheit, das Licht der Liebe. Geben wir dem Frieden eine Chance… Freiheit, Frieden, Einigkeit, Gerechtigkeit und Entwicklung werden herrschen, wenn keinem Mexikaner die Möglichkeiten verweigert werden und die Freiheiten eines jeden Mexikaners respektiert werden… Der Zapatismo soll gewinnen! Der Subcomandante soll gewinnen! Der Kongress soll gewinnen! Die Abgeordneten sollen gewinnen! Das ist unser Motto: gewinnen, gewinnen, gewinnen.“ (Botschaften an das Volk vom 2.3., 9.3., 10.3.)
Dabei bietet er den Indio-Vertretern genau das als ihre
materielle Zukunftsperspektive an, wogegen die einmal
aufgestanden sind – die radikale Fortsetzung eines
nationalen Fortschritts- und Entwicklungsprogramms im
Rahmen der Nafta. Was die Regierung an Förderung der
Infrastruktur im Süden projektiert – Eisenbahnen,
Pipelines, Überlandleitungen, Häfen und Flughäfen
(Botschaft vom 8.3.), sowie
ein großes Kanalprojekt als Alternative zum Panama-Kanal
– das ist nicht auf eine bessere kapitalistische
Erschließung des Südens berechnet, der die indigene
Bevölkerung nur im Wege ist:
„Der Plan Puebla-Panama (ein Programm zur Förderung der Infrastruktur) wird den Indigenen weder Territorium noch Chancen, noch natürliche Ressourcen, und schon gar nicht die Würde rauben.“ (El País, 1.3.)
Nein: Dieses nationale Vorhaben dient, richtig
verstanden, dem Zweck, die Indios endlich am in Mexiko ja
ansonsten schon so blühenden zivilisatorischen
Fortschritt – Arbeitsplätze… Gesundheitswesen und das
soziale Netz… Kliniken und Kinderhorte… Kranken- und
Rentenversicherungen
– teilhaben zu lassen. Also ist
ihre Sorge völlig unbegründet.
Praktisch verspricht sich der neue Präsident von der Gewährung eines politischen Autonomiestatus, den schon die alte Regierung als eine Option im Programm hatte, eine Befriedung der Region, die den ungestörten Zugriff der Regierung und der geschäftlichen Interessen erlaubt, die sie für Mexiko neu gewinnen will. Diese politische Initiative ist Teil des Vorhabens, das Land attraktiver zu machen für das internationale Kapital und mehr Investoren aus dem Ausland für Anlagen in Mexiko zu gewinnen – ein Programm, in dem der nach dem Geschmack der Regierung noch längst nicht genügend erschlossenen ‚Krisenregion Chiapas‘ eine besondere Rolle zugedacht ist. Deswegen darf die Guerilla mit Erlaubnis des Präsidenten durch das Land ziehen, sich als Kraft der nationalen Erneuerung präsentieren, dem Parlament mit großer Geste ihr Anliegen ans Herz legen – soll sich mit all dem dann aber auch zufrieden geben und den weiteren Gang der Dinge den Zuständigen in Mexiko überlassen.
6.
Das machen die alternativen Volksanwälte dann auch.
Nachdem sie den gewählten Volksvertretern bei ihrem
Auftritt vor dem Parlament die Beschlussfassung über das
schon vor Jahren ausgehandelte Autonomiestatut ans Herz
gelegt haben, ziehen sie wieder heim, der Dinge harrend,
die das Parlament in ihrer Angelegenheit beschließen
wird. Prompt kommt es, wie es kommen muss. Ohne und gegen
sie geht es so weiter wie bisher, denn Übereinstimmung
zwischen ihnen und den gewählten Volksvertretern über der
Wahrnehmung der neuen Chance zur Versöhnung
herrscht ja nach wie vor überhaupt nicht. Die
Gesetzesvorlage wird in entscheidenden Punkten –
insbesondere das Bodeneigentum betreffend – revidiert,
weil die Parlamentsmehrheit alles verhindern will, was
auch nur entfernt nach einem einklagbaren materiellen
Recht für die lästigen Indios aussehen könnte.
Schließlich wollen die Zuständigen mit einem
Autonomiestatut nicht irgendwelchen Erwartungen an ein
bescheidenes, aber selbstbestimmtes Eingeborenenleben
Recht gegeben; schon gar nicht sollen die Interessen der
Großgrundbesitzer und die staatlichen Verfügungsansprüche
durch eine weitreichende Indio-Verwaltung relativiert
werden; vielmehr sollen die lästigen Indios zur Ruhe
gebracht, reservatmäßig verstaut und so das staatliche
Kommando über die Provinz wieder ordentlich hergestellt
werden. Und ebenso prompt melden sich die kämpferischen
Friedensmarschierer wieder aus ihrem Urwaldcamp, geben
ihrer Verbitterung Ausdruck, dass hier die einmalige
Chance zu gemeinsamen Friedensanstrengungen verpasst
worden ist, und rufen einmal mehr alle wohlgesinnten
nationalen Kräfte und die Weltöffentlichkeit auf, die
Regierenden in Mexiko moralisch unter Druck zu setzen und
„dafür zu demonstrieren, dass die mexikanische Regierung sich korrigiere und den Anspruch auf die tatsächliche Verankerung der indigenen Rechte und Kultur in der Verfassung erfülle.“ (NZZ, 2.5.)
Sonst bleibt den guten Armen in Chiapas nämlich weiterhin das verwehrt, was sie am allerdringlichsten brauchen: Ihre alteingesessenen Eigenarten und Gemeinschaftsformen, in denen sie ihre Not aushalten, auch noch in den Rang eines Verfassungsguts erhoben zu bekommen. Sich nicht als echter Mexikaner in seinen elenden Verhältnissen häuslich einrichten zu dürfen – was für ein Verbrechen gegenüber Indios!