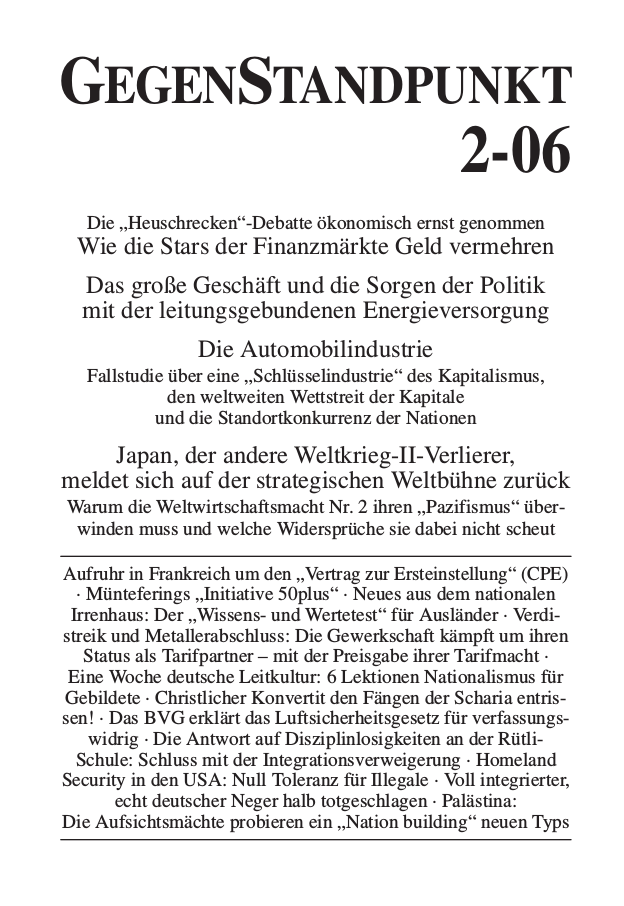Aus der Reihe „Chronik - kein Kommentar!“
Eine Woche deutsche Leitkultur:
6 Lektionen Nationalismus für Gebildete
Mit größter Selbstverständlichkeit und unter Wahrung jeden Respekts vor der privaten Urteilsbildung vereinnahmt die „vierte Gewalt“ ihr Publikum für den Standpunkt, von dem aus hierzulande wichtig und unwichtig geschieden, sachgerecht kommentiert und vernünftig gemeint gehört. Für einen nationalistischen Blick aufs Weltgeschehen wirbt sie nicht – sie praktiziert ihn. Und macht zum Beispiel aus einer beliebigen Woche im März einen ziemlich kompletten Grundkurs in deutscher Welt-Anschauung. In „Süddeutscher“ in unserem Beispielsfall.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Eine Woche deutsche
Leitkultur:
6 Lektionen Nationalismus für
Gebildete
So richtigen bösen Nationalismus kennt unsere demokratische deutsche Leitkultur bekanntlich nicht. Politische Vorurteile sind ihr überhaupt fremd. Ihre Leitsterne sind objektive Information und freie Meinungsbildung. Um beides kümmert sich professionell eine freiheitliche, weltoffene Presse. Die berichtet sachlich und unterscheidet objektiv Wichtiges vom Unwichtigen; und bei der Herstellung einer gebildeten Meinung lässt sie ihre Leserschaft auch nicht im Stich. Sie begleitet ihre Berichterstattung mit Interpretationsangeboten, drängt niemandem etwas auf – und vollbringt damit eine Leistung, von der staatliche Propagandaministerien nur träumen können: Mit größter Selbstverständlichkeit und unter Wahrung jeden Respekts vor der privaten Urteilsbildung vereinnahmt die „vierte Gewalt“ ihr Publikum für den Standpunkt, von dem aus hierzulande wichtig und unwichtig geschieden, sachgerecht kommentiert und vernünftig gemeint gehört. Für einen nationalistischen Blick aufs Weltgeschehen wirbt sie nicht – sie praktiziert ihn. Und macht zum Beispiel aus einer beliebigen Woche im März einen ziemlich kompletten Grundkurs in deutscher Welt-Anschauung. In „Süddeutscher“ in unserem Beispielsfall.
Montag, 13.3.
Milošević ist tot. Schon Samstag wurde
er leblos in seiner Gefängniszelle in Den Haag gefunden.
Wen geht das was an? Warum ist das wichtig? Die
Schlagzeile sagt es: Der Tod des längst abgehalfterten
Belgrader Staatschefs bringt UN-Tribunal in
Bedrängnis
. Das kann ihn nicht mehr rechtswirksam
verurteilen. Und das ist blöd – für das Gericht, das sich
offenbar genau das vorgenommen hatte. In diesem Sinne
informiert auch gleich die Unterzeile: Juristen
beklagen Prozessführung von Carla Del Ponte
. Die
Anklägerin hat den Mann nämlich gleich wegen drei Kriegen
bei der Zerlegung Jugoslawiens – in Kroatien, in Bosnien
und im Kosovo – verurteilen lassen wollen; statt erst mal
in einem überschaubaren Einzelfall die Kriminalisierung
des Ex-Staatschefs gerichtsfest zu vollenden. Insofern
ist sie gescheitert; und das sieht sie auch selber so:
Chefanklägerin spricht von ‚völliger Niederlage‘
;
teilt die Fortsetzung der Unterzeile mit.
Schon damit ist der Leser aufs richtige Gleis gesetzt; und das verlässt der Artikel auch nicht mehr. Der Standpunkt ist der des „Tribunals“; oder besser: einer Parteinahme für die Sache des Tribunals, die nicht bloß mit dem unplanmäßigen Abbruch des Verfahrens, sondern auch mit der Art und Weise unzufrieden ist, wie der Gerichtshof seine Sache gehandhabt hat. Ganz ohne Aktenkenntnis, ohne Einblick in die Rechtslage, dafür mit einem Farbfoto des Angeklagten in herrisch-arroganter Pose zwischen zwei Bewachern versorgt, findet sich der Leser in der Position der richtenden Instanz, für die die Schuld des Angeklagten längst feststeht und die darüber enttäuscht ist, dass das tatsächlich zuständige Gericht ihr den entsprechenden Schuldspruch schuldig bleibt.
Letztlich nimmt das sachkundige Weltblatt, stellvertretend für seine Leser, das natürlich nicht dem UN-Tribunal und auch nicht der Chefanklägerin übel, sondern dem Angeklagten, der sich durch seinen Tod seiner Aburteilung entzogen hat. Das ändert zwar nichts an der moralischen Gewissheit, dass Milošević ein Kriegsverbrecher war. Dem Publikum entgeht damit aber nicht bloß der Genuss einer förmlichen, von einem wirklichen Strafgericht verhängten Ächtung und Bestrafung eines großen Bösewichts. Im Kleingedruckten wird ihm erläutert, dass an Milošević ein Exempel statuiert und einem weltpolitischen Prinzip zum Durchbruch verholfen werden sollte: der Legitimation kriegerischen Eingreifens der befugten Weltmächte, der NATO in dem Fall, als wirkliches internationales Strafgericht. Dass diese Art der Rechtfertigung grenzüberschreitender Gewaltanwendung gefällt und allgemeinen Beifall findet, wird schlicht vorausgesetzt, der Leser eingeladen, sich in die Position einer allzuständigen Weltordnungsmacht zu versetzen, für eine allgemeine Verfügungsgewalt über die Staatenwelt Partei zu ergreifen und das Ausbleiben eines nachträglichen förmlichen Richterspruchs zu bedauern. Dass die eigene Nation zu den Inhabern, nie und nimmer zu den Adressaten und Opfern einer solchen gerechten Verfügungsgewalt gehört, geht völlig fraglos in diese Parteinahme mit ein.
Von diesem Standpunkt aus wird dem Erinnerungsvermögen
der Leserschaft mit einer Rekapitulation der politischen
Verbrechen des Slobodan Milošević auf die Sprünge
geholfen. Den Kollegen aus Frankfurt gelingt da die
prägnanteste Zusammenfassung: Passend illustriert durch
dasselbe Bild des kaltschnäuzigen Diktators, verkündet
die Schlagzeile der FAZ auf Seite 3: Die Welt
herausgefordert
und erläutert in der Unterzeile ohne
jeden Anflug von Ironie: Der frühere Machthaber in
Jugoslawien zwang zuerst die Nato und dann sogar die
Bundeswehr zum Krieg.
Alle Gründe, aus denen EU, NATO
und die Befehlshaber der Bundeswehr seinerzeit die
Zerlegung Jugoslawiens unbedingt zu ihrer Sache machen
mussten, gehen auf in der zwar völlig deplatzierten, aber
moralisch zutiefst befriedigenden Selbstverständlichkeit,
dass ein weißer Ritter einfach nicht zusehen kann, auch
nicht untätig bleiben darf, wenn unschuldige Kinder
ermordet und Jungfrauen geschändet werden: Keine
nationale Leitkultur, die das nicht schon ihren Kindern
beibringt. Und dass „wir“ zuständig sind, wenn sich in
der Nachbarschaft interessante Machtverschiebungen und
sogar Staats-Neugründungen anbahnen, versteht sich für
ein gebildetes Publikum ohnehin von selbst.
Zurück zum eigentlichen Thema des Tages: Der Schurke hat
sich seinem gesetzlichen Richter entzogen; der Verdacht
der Chefanklägerin, er hätte das mit Absicht getan, per
Selbstmord, verdient es daher, gleich auf Seite 1
mitgeteilt zu werden – ein ausbaufähiger Einfall;
schließlich steht schon seit langem fest, dass der Mann
seine Herzkrankheit pflegt, um den Prozess zu verzögern;
sein Antrag auf eine Herzoperation in Moskau wird gleich
als einschlägige Finte durchschaut; vielleicht – mutmaßt
der Kommentator der „Tagesthemen“ – hat er einmal zu oft
seine gerichtlich verordneten Herz-Medikamente ins Klo
gespült. Über Verschwörungstheorien serbischer Gazetten,
die von Mord statt Selbstmord wissen wollen, kann ein
aufgeklärtes deutsches Publikum umgekehrt gar nicht genug
den Kopf schütteln: Diese Serben! Lassen sich schon
wieder einen Anlass für serbische
Gewissenserforschung
(FAZ) entgehen, ohne die sie doch keine
Chance auf EU-Mitgliedschaft haben. Über die Ziele, die
Mittel und die Methoden deutscher und europäischer
Balkanpolitik heute braucht sich der Leser so wenig
sachkundig zu machen wie über die kriegerischen 90er
Jahre – an Sachkunde reicht die Vorstellung, dass „wir“
es in Serbien mit einer starken nationalistischen
Schicht
zu tun haben, welche die europäische
Perspektive ablehnt
(FAZ). Dass die „europäische
Perspektive“, worin auch immer sie besteht, auch für die
Serben das einzig Wahre ist, bedarf für eine
vorurteilsfrei urteilende europäische Öffentlichkeit
keiner Begründung.
Im Feuilleton der SZ vom 13.3. wird die Affäre noch kurz
ins Polit-Psychologische vertieft: Der stille Gatte –
Wie das Ehepaar Milošević regierte
, erläutert ein
schwedischer Journalist dem gebildeten Publikum, das
seine Verachtung für Balkan-Bewohner gerne noch etwas
ausgemalt haben möchte. Bitte sehr: auf dem Balkan …
sehen wir einen Mann an der Macht, doch im
Hintergrund
zieht eine Frau die Fäden, und schon ist
diese innige Gemeinschaft der Macht … geprägt von
einer Art leichtem Wahnsinn, von Nepotismus, allerhand
bizarren und phantastischen Projekten, von Astrologie,
Okkultismus und, falls notwendig, von einem Fanatismus,
der die Gewalt nicht scheut.
Man muss das nicht Wort
für Wort glauben; man kann das Feuilleton auch gleich
überblättern. Aber wer auf der Suche nach Vielfalt und
Liberalität in der demokratischen Feindbildpflege ist,
der wird bedient: Aus der Rolle des ideellen Straf- und
Scharfrichters darf man in die des psychoanalytisch
aufgeklärten Kenners der seelischen Abgründe wechseln,
die nach der NATO als einzig sachgerechter Therapie
rufen. Die deutsche Zeitungslandschaft – ein
pluralistisches Tribunal über allen wirklichen Tribunalen
dieser Welt, das in seinem Verurteilungsvermögen durch
nichts und niemanden „in Bedrängnis“ zu bringen ist!
Im Innern der Nation ist heute auch einiges los.
Thema des Tages im Wirtschaftsteil:
Merck will Schering kaufen
, und
zwar im Stil einer „feindlichen Übernahme“, wie die
Oberzeile der Schlagzeile verrät. Aber letzteres ist
eigentlich nicht der Witz an der Sache. Wirklich wichtig
ist: Durch die Übernahme entstünde ein neuer deutscher
Pharmariese.
Und den brauchen wir nach Auffassung der
sachkundigen Mannschaft der
Süddeutschen-Wirtschaftsredaktion dringender denn je. Der
Kommentar, der die Kernaussagen des Artikels schön
übersichtlich zusammenfasst, klärt unter der Überschrift
„Viel Mut zum Risiko“ auf, warum:
„Die deutschen Pharmafirmen stecken seit längerem in der Klemme. Etwa sieben größere Unternehmen tummeln sich auf dem Markt – doch keines von ihnen erlöst mehr als neun Milliarden Euro pro Jahr. Lediglich der nicht börsennotierte Familienkonzern Boehringer Ingelheim schafft es, bei den renommierten Pharmakonzernen weltweit vorne mitzuspielen. Alle anderen sind zwar profitabel, aber zu klein – ihr Erfolg basiert vor allem auf umsatzstarken Nischenpräparaten.“
Es handelt sich hier offensichtlich um einen mittleren Skandal: Die große deutsche Pharmaindustrie – auf Nischenplätzen! Wer bisher gemeint hatte, dass es im Leben schlimmere „Klemmen“ gibt, als mit jährlichen Erlösen knapp unter 9 Milliarden Euro dazustehen, wird eines Besseren belehrt: Ein Witz ist das! Deutsches Kapital ist zu klein – zum „Mitspielen“! Und warum müssen deutsche Pharmakonzerne „weltweit vorne mitspielen“ – bei welchem „Spiel“ eigentlich? Fehlanzeige, keine Antwort weder im Artikel noch im Kommentar, das versteht sich irgendwie von selbst – jedenfalls für Frau Kristina Läsker, die nicht im Mindesten daran zweifelt, dass auch ihre Leser ohne Wenn und Aber diese Sichtweise teilen. Der ökonomische Sachverstand, den es dafür braucht, überfordert auch tatsächlich niemanden: Es genügt ein „Deutschland vor!“
„Schon längst sind die deutschen Forschungslabore nicht mehr die innovativsten der Welt – dieser Ruf gehört den USA. Und wer als Arzneimittelhersteller zu wenig innovativ ist, aber wie Schering attraktive Medikamente hat, ist angreifbar für Übernahmen.“
Man hat also begriffen: Wenn Deutschlands Unternehmen nicht vorne dran sind, dann sind die „der anderen“ vorn. Und warum ist das schlimm? Gibt es wenigstens eine Andeutung, warum es nützlich und gut ist, wenn deutsche Konzerne die Gewinner sind beim „weltweiten Spiel“? Profitieren die Kranken? Ach nein: Wir befinden uns im Wirtschaftsteil, da gibt es kein menschenfreundliches Gesäusel von wegen ‚aufopferungsvolle Forschung der Pharmaindustrie im Dienste der leidenden Menschheit‘ und dergleichen. Hier werden ganz sachgerecht und ohne falsche Sentimentalität Innovationen begutachtet: Sie stehen im Dienste des Börsenwerts der forschenden Firma. Deswegen nochmal:
„Trotz einem Rekordüberschuss von 619 Millionen Euro und einem Ergebnisplus von 23 Prozent ist Schering angreifbar für Übernahmeversuche, solange die Firma allein nicht innovativ genug ist.“
Profitieren wenigstens die Angestellten der Firmen? Davon kann auch keine Rede sein; wer vorne „mitspielen“ will, der kann auf Einzelschicksale keine Rücksicht nehmen:
„Trotz eines Sparprogramms – knapp 2000 Stellen hat der Konzern kürzlich gestrichen – bleibt die Lage mittelfristig schwierig.“
Und bei „schwieriger Lage“ droht eine Übernahme, die dann die bekannten „Synergieeffekte“, sprich: weitere Entlassungen bringt. Aber die sind nun wirklich nicht weiter erwähnenswert. Viel heikler ist folgendes:
„Doch Vorsicht: Synergien gäbe es nur im Geschäft mit Krebsmitteln, doch eine derart kombinierte Sparte würde nur ein Zehntel zum Umsatz beisteuern. Merck würde mit der Übernahme weiter ein bunt gemischter Konzern bleiben. …..wäre unter den erfolgreichen Pharmakonzernen der einzige, der seine Mischstruktur nicht auflöst, sondern fortsetzt. Ein ungewöhnlicher Weg, den wohl nur ein Familien-dominiertes Unternehmen gehen kann – mit viel Mut zum Risiko.“
Vorsicht ist also geboten – bloß für wen? Sollen die Merck-Manager sich vorsehen? Dann hätte die Frau von der SZ-Wirtschaftsredaktion besser denen einen Brief geschrieben. Oder geht die Mahnung an den interessierten Leser? Aber wobei soll der sich vorsehen? Was gehen den Mischkalkulationen und deren Risiko an? Soll er die Merck-Manager für ihren Mut bewundern? Oder soll er sich bloß merken, wie richtig die SZ mit ihren weisen Mahnungen gelegen hat, wenn die Sache hinterher irgendwie schief geht? Fest steht jedenfalls: Das wäre dann schade. Nicht bloß für die Merck-Familie, sondern für den deutschen Pharmastandort und sein Zeitung lesendes Publikum.
Dienstag, 14.3.
Schlagzeile heute: Konflikt im öffentlichen Dienst
entzweit die Länder – Tarifstreit
entfacht politischen Machtkampf
Dankenswerterweise
erfährt man gleich durch die Überschrift, was wirklich
wichtig ist am Streik im öffentlichen Dienst, der
mittlerweile in seine 6. Woche geht. Im fett gedruckten
Vorspann zum Artikel heißt es:
„In dem festgefahrenen Streit ist derzeit keine Lösung in Sicht, was für die Bürger weitere wochenlange Streiks bedeuten könnte.“
Welche Forderungen in diesem Streik auf dem Tisch liegen, worum die Gewerkschaft überhaupt kämpft, all das wird im Artikel gar nicht erst erwähnt – nur zur Erinnerung: Es handelt sich um eine Auseinandersetzung, in der die öffentlichen Arbeitgeber längere Arbeitszeiten bei weniger Lohn für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes durchsetzen wollen; und das gleich exemplarisch als Vorreiter für alle Branchen des Wirtschaftsstandorts. Der Artikel findet das, wie gesagt, keine Erwähnung wert. Er macht stattdessen die Bürger ganz unvoreingenommen darauf aufmerksam, dass sie womöglich von der Gegenwehr der Angestellten betroffen sind, um anschließend den Blick konsequent aufs politische Management der ganzen Angelegenheit hinzulenken. Auf der Ebene kennt man sich aus als politischer Redakteur; hier liegen die wirklich wichtigen und spannenden Probleme der Zeitgeschichte, über die der mündige Bürger auf dem Laufenden gehalten werden muss:
„Der Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst hat zum ersten großen Streit seit der Bundestagswahl zwischen den Ministerpräsidenten von Union und SPD geführt.“
Es knirscht in der großen Koalition: Die SPD ist für Schlichtung, die CDU dagegen. Und damit ist, viel mehr als durch den Streik selbst, „die Ruhe im Land vorbei“ – meint jedenfalls Heribert Prantl in seinem Kommentar zum Thema auf Seite 4. Woher die Unruhe kommt, erklärt wiederum sehr sachgerecht der Hauptartikel:
„Beide Seiten werfen sich zudem vor, den Arbeitskampf für die Wahlkämpfe in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt zu instrumentalisieren. In den drei Ländern wird am 26. März gewählt.“
Bei dieser Sorte Unruhe ist der demokratische
Sachverstand aufgeklärter Journalisten voll in seinem
Element. Dass ein Tarifstreit – wie im Übrigen auch so
ziemlich jeder andere politische Streit im Lande – voll
und ganz subsumiert ist unter die politischen
Berechnungen und Kungeleien der Parteien, die um die
Macht im Lande konkurrieren und in der Sache selbst
ohnehin meist nahe beieinander liegen, halten sie für das
Entscheidende an der ganzen Affäre. Nie und nimmer käme
ihnen in den Sinn, dass diese Tatsache gegen die von
ihnen so verehrte Demokratie sprechen könnte. Wenn sie
nicht gerade damit beschäftigt sind, die Kontrahenten im
Machtgerangel fürs interessierte Publikum liebevoll zu
porträtieren – im Profil auf Seite 4 der SZ vom 14.3.:
Ralf Stegner: Heißsporn im Kieler Kabinett und bei den
Tarifverhandlungen … der Freund gestärkter Hemden und
kecker Fliegen
–, plagen sie sich als
verantwortungsvolle „vierte Gewalt“ viel eher mit der
Sorge, ob die Profilierungssucht der demokratischen
Machthaber nicht letztlich dem Großen, Ganzen, Schönen
unseres demokratischen Gemeinwesens schaden könnte.
Heribert Prantl lässt jedenfalls auf Seite 4 direkt über
dem Portrait vom kecken Fliegenträger Stegner kein gutes
Haar an den Herrschaften:
„die ungeschickte Brachial-Diplomatie des niedersächsischen CDU-Finanzministers Möllring … Sein übertrieben selbstbewusstes Verhandlungsgebaren und die martialische Reaktion des Kieler SPD-Innenministers Stegner darauf sind gut für Selbstprofilierung, aber schlecht für die Sache.“
Und was ist die Sache?
„Man muss auf Biegen verhandeln und nicht auf Brechen. In einem heiklen Stadium des Tarifkonflikts – sechs Wochen Streik könnte sich im produzierenden Gewerbe keine Seite leisten – verspielen die öffentlichen Arbeitergeber ihre bisherigen Vorteile im Kampf um die öffentliche Meinung.“
Und warum ist es schädlich, wenn die öffentlichen Arbeitgeber ihre Vorteile bei der öffentlichen Meinung – z. B. bei einem Leitartikelschreiber der SZ – durch ihren brachialen Verhandlungsstil verspielen? Vielleicht wäre es ja gerecht, wenn die „öffentliche Meinung“ endlich einmal ihre verständnisvolle Sorge für die Hüter der „öffentlichen Kassen“ ad acta legen würde. Soll die „öffentliche Meinung“ doch ab jetzt ihre Vorteile an die Gewerkschaftsseite austeilen… Doch das ist ein völlig abwegiger Gedanke für einen Journalisten, der strikt überparteilich nachzudenken gewohnt ist:
„Die Verhandlungsstrategie des CDU-Ministers Möllring führt in letzter Konsequenz zum Auseinanderfallen des öffentlichen Dienstes in Deutschland – eine Gefahr, die durch die geplante Kompetenzverlagerung im Beamtenrecht auf die Länder (wie das die Föderalismusreform vorsieht) noch größer wird.“
Eine irgendwie offensichtlich grauenhafte Vorstellung – zumindest für Herrn Prantl, der ganz selbstverständlich davon ausgeht, dass dann zwischen den verschiedenen politischen Instanzen des geschätzten demokratischen Gemeinwesens ein einziges Hauen und Stechen losbricht. Was aber auch keine Einwände gegen diese Sorte Gemeinwesen begründet, sondern Anlass gibt, dem Leser mitzuteilen, dass das Wichtigste am Streik im Öffentlichen Dienst die föderale Verfassung der BRD ist – und dass noch alles gut werden kann, wenn nur alle sich auf das wirklich Wesentliche besinnen:
„Dem inneren Frieden im Lande wird das nicht gut tun. Es ist also Zeit für eine Schlichtung im aktuellen Tarifkonflikt – und es ist auch noch Zeit dafür, die Fehler der Föderalismusreform zu korrigieren.“
Im Wirtschaftsteil tobt derweil der
Übernahmekampf Merck gegen Schering
weiter: Merck will Widerstand von Schering
brechen.
Hintergrundinformationen zum Pharmamarkt
werden geliefert; Frau Läsker hat gut recherchiert und
herausgefunden, dass der Nachschub von
Arzneimitteln
so seine Tücken hat. Unter der
Überschrift Vom Traum, ganz vorne mitzuspielen
erfährt der Leser:
„Größe wird immer mehr zu einem wichtigen Erfolgsfaktor, und viele Analysten denken daher, dass der Konsolidierungsdruck in der Pharmabrache anhält. In den kommenden Jahren laufen viele Patente auf umsatzstarke Originalarzneimittel aus. Damit wächst der Anspruch, neue Präparate auf den Markt zu bringen. Doch der Nachschub, die so genannte Medikamentenpipeline, ist bei vielen Firmen dünn …Nach wie vor schafft es nur eines von zehn Medikamenten auf den Markt. Eine Firma mit vielen Testkandidaten kann daher Risiken besser balancieren, was Merck wohl auch zu einem Angebot bewogen hat: Die neue Firma hätte gut 30 Produktkandidaten.“
Eine schöne Auskunft über die Fortschritte der Heilkunst.
Erstens: Sinkende Preise für Medikamente sind schlecht.
Zweitens: Der Bedarf nach neuen Medikamenten ergibt sich
aus dem Profitanspruch der Pharmakonzerne; wer vorne
mitspielen will
, der muss sein Sortiment ständig
umbauen und darauf achten, dass er nie ohne Mittel im
patentgeschützten Hochpreissektor dasteht. Drittens:
Wogegen oder wofür diese Mittel gut sein sollen, ist
zweitrangig – Hauptsache, sie versprechen Umsatzstärke.
Alles völlig normal, alles hochgradig vernünftig, wie es
da so schön sachlich dasteht im Wirtschaftsteil und dem
ökonomisch interessierten Leser zum Abnicken vorgelegt
wird. Der kann, wenn er dazu aufgelegt ist, sich auf der
Seite nebenan noch mehr Hintergrundinformationen abholen.
Diesmal über die Strippenzieher von Merck
, bei
denen es sich übrigens um weit verstreute Erben der
Gründerfamilie
handelt.
Auf Seite 5 im Politik-Teil kann er dann noch nachlesen,
dass gut unterrichtete Kreise die SZ darüber informiert
haben, wie es in Sachen
Gesundheitsreform weitergehen könnte.
Von einer kleinen Kopfpauschale
ist die Rede, die
den politischen Charme hat, die Ideen von Union und
SPD zu verbinden
; außerdem soll sie den Vorteil
haben, für mehr Wettbewerb unter den (Kranken)Kassen
zu sorgen
. Und mehr Wettbewerb führt – zumindest nach
einem ehernen Dogma des marktwirtschaftlichen
Sachverstands – irgendwie dazu, dass alles, warum also
nicht auch die Kosten für die Gesundheit, immer billiger
wird. Wenn das so ist, dann wird alles gut mit der
Gesundheit und ihrer Bezahlung. Natürlich hat die
Verbilligung der Gesundheit ihren Preis, das ist klar;
schließlich müssen ja die Pharmakonzerne aus dem
Wirtschaftsteil auf ihre Kosten kommen. Aber von den
Nutznießern des Geschäfts mit der Gesundheit ist jetzt
gerade mal nicht die Rede. Hier geht es um die Versuche
der für Gesundheit zuständigen SPD-Ministerin und ihrer
einschlägigen Experten, völlig vorurteilsfrei nach
Finanzierungswegen zu suchen, damit „mehr Geld ins
System“ kommt. Die SPD, so hat die SZ gehört, ist im
Rahmen dieser Suche auf die wegweisende Idee gekommen,
den Bürgern die Kopfpauschale der CDU mit dem Hinweis
schmackhaft zu machen, es handle sich um eine
„kleine Kopfpauschale“. Das wirklich Spannende
an diesem Thema ist im Übrigen wieder die sauinteressante
Frage, ob die Regierungsparteien es wohl schaffen, sich
zusammenzuraufen. Denn:
„Tatsächlich ist die Reform schwierig für die Koalition, weil die Parteien mit verschiedenen Ideen geworben haben.“
Angesichts des erklärten Vorhabens der Regierung, die Leute für ihre Gesundheitsversorgung noch viel stärker als bisher schon zur Kasse zu bitten, die Frage zu ventilieren, ob die beiden Koalitionspartner ihre Schwierigkeiten miteinander und in Sachen eigener Selbstdarstellung bewältigen werden, das zeugt schon von einer vorbildlichen demokratischen Reife.
Mittwoch, 15.3.
Die Schlagzeile und noch oben drüber ein breites Foto vom
Ort des Geschehens nehmen den Leser mit an den
tagesaktuellen Brennpunkt des
israelisch-palästinensischen
Kriegsalltags: Truppen stürmen Gefängnis in
Jericho
, teilt die Oberzeile mit, und der Haupttitel
lenkt die Aufmerksamkeit auf die Folgen, die für die
Zeitungsredaktion offenbar das eigentlich Mitteilenswerte
sind: Militäreinsatz Israels löst Welle der Gewalt
aus
– nämlich, wie die Unterzeile erläutert:
Radikale Palästinenser greifen im Gaza-Streifen
ausländische Einrichtungen an und entführen Europäer
.
Die Berichterstattung ist ausgewogen. Man erfährt: Die
Erstürmung des Gefängnisses geschieht durch reguläre
Truppen – das Titelbild teilt deren Blick auf gefesselte
halbnackte Häftlinge aus dem Hintergrund –, ist insofern
selber keine „Gewalt“ im Sinne der dadurch „ausgelösten“
„Welle“ – auch wenn ein palästinensischer Polizist und
ein Gefängnisinsasse dabei getötet werden. Sie dient im
Übrigen einem an sich verständlichen Anliegen: dem
Zugriff der israelischen Justiz auf die Mörder
–
die mutmaßlichen
, so viel Respekt vor der
rechtsstaatlichen Unschuldsvermutung bis zum regulären
Schuldspruch muss sein – des 2001 umgebrachten
israelischen Tourismusministers. Diese Burschen wären
sonst womöglich von der neuen palästinensischen
‚Regierung‘ freigelassen worden; ungehörig viele
Freiheiten haben sie in ihrem von Briten und Amerikanern
überwachten Knast ohnehin schon genossen. Ausgelöst
werden Gewalttaten, für die dem Bericht entschieden jedes
Verständnis abgeht: Radikale vergreifen sich an
Ausländern, gar an Europäern, den letzten uneigennützigen
Helfern der Palästinenser, also sowohl in den Mitteln als
auch total in der Adresse.
Immerhin: Zwar keine Mitschuld, aber eben dieser
Auslöseeffekt ist Israels Militäraktion schon
anzukreiden: Die Redaktion in München, wenn sie gefragt
worden wäre, hätte den verantwortlichen Befehlshabern
eher abgeraten. Und wenn sie schon nicht gefragt worden
ist – die Position des interessierten, weil durch die
„Welle der Gewalt“ ideell mit-betroffenen Gutachters
lässt sie sich und ihrer Leserschaft nicht nehmen. Als
solcher kämpft sie selbstverständlich in Gedanken mit
gegen jegliche terroristische Gewalt, die von radikalen
Kämpfern ohne regulären Truppenstatus ausgeht; auf
welcher Seite sie steht, ist insofern klar. Eben deswegen
muss sie aber die Frage in den Raum stellen, ob die
Aktion klug war, zweckmäßig für das schöne Ziel, in dem
man sich mit allen Menschen guten Willens und natürlich
auch mit den Israelis einig weiß: dass es darum geht,
nicht nur den Rachedurst
, den nur allzu
verständlichen, zu stillen, sondern auch … die Region
zu befrieden.
Der Kommentar im Innern des Blattes
wirft diese Frage ausdrücklich auf und vertieft die
fälligen Bedenken mit dem bemerkenswerten Hinweis:
„Zudem geschah die Militäraktion derart knapp vor der israelischen Parlamentswahl, dass er als Eigen-PR des amtierenden Regierungschefs Ehud Olmert interpretiert werden muss. Der uncharismatische Nachfolger von Ariel Sharon will dessen Ruf als Hardliner und Vater der Nation übernehmen … ein Wahlspot.“ Und so weiter.
Was will der Autor „mitz“ uns damit sagen? Vorsicht vor demokratischen Völkern, vor Wahlen wollen die Blut sehen, die honorieren mit ihrer Wahlstimme Härte und Leichen auf der richtigen Seite? Oder: Warnung vor Politikern mit Charisma, denn das ist nichts anderes als zum Charakter gewordene Skrupellosigkeit beim Gebrauch von Gewalt, und doppelte Warnung vor Machthabern ohne diese Tugend, denn die bemühen sich erst recht, mit skrupelloser Gewaltanwendung bei ihrem Volk Anklang zu finden? Will der Mann die Demokratie schlecht machen, weil sie mit ihrer heiligsten Legitimationsveranstaltung, der freien Wahl von Machthabern, die Brutalisierung der Politik fördert?
Es läuft wohl doch mehr auf die zwei Botschaften hinaus, die ein kundiges Publikum von seiner demokratischen Informationskultur gewohnt ist und ohnehin erwartet. Erstens:
„Olmert mag mit dem gestrigen Tag Stimmen gewonnen haben“ –
denn wir kennen uns nämlich aus in den Hintergründen, den doppelbödigen Berechnungen, dem Erfolgskalkül von Politikern; da macht uns niemand was vor. Wir wollen das auch gar nicht kritisieren, wir finden das irgendwie normal. Als verantwortungsbewusste Mitdenker müssen wir in dem Fall aber zu bedenken geben:
„Sicher ist aber auch eine Reaktion palästinensischer Terroristen.“
Und das heißt: Gerade aus Solidarität mit der Sache Israels können wir uns Zweifel an der Weisheit der Wahlkampfstrategie der Zuständigen, denen wir ansonsten nur das Allerbeste zutrauen, nicht verkneifen.
Über Israel, die Palästinenser, deren Konflikte, geschweige denn über die Demokratie – nichts dazugelernt. Aber was auch, und wozu! Die Zeitung und ihr Publikum stehen moralisch auf der richtigen Seite und hätten für alles und jeden den richtigen guten Rat: Die Gewissheit hat mal wieder Futter bekommen. Was will der Leser mehr?
Den Leitartikel treibt heute ein
brisantes Thema um: Die Angst vor dem
Kind
. Bekanntlich sterben die Deutschen aus,
und das ist furchtbar. Die Ursache des dramatischen
Deutschen-Schwunds liegt in einem typisch deutschen
Charakterfehler: Zukunftsangst
. Ein völlig
irrationales Gefühl; denn:
„Heute sind die Deutschen so reich wie nie, aber der gefühlte Wohlstand geht zurück. The german angst, wie Amerikaner (SZ-Redakteure kennen sich aus in der großen weiten Welt) die deutsche Grundstimmung ein wenig höhnisch nennen, verstärkt sich. Und wer hat, der will behalten.“
Wir lernen also: Aus völlig grundlosem Egoismus, weil eigentlich reich genug, verweigert der Deutsche die Nachwuchsproduktion. Und warum sind die Deutschen so grundlos egoistisch? Eine Frage von so gewichtigem Tiefsinn, dass dafür ein Geistesriese vom Kaliber des Philosophen Peter Sloterdijk einmal kurz als Pate erwähnt werden muss (SZ-Redakteure kennen sich aus in der Welt der Geistesriesen). Es geht also weiter mit der Ursachenforschung:
„Kinder passen nicht … sie sind Risikofaktoren, sie kosten Geld, sie kosten Zeit, sie brauchen Stabilität. Sie brauchen Zuversicht und bedeuten Verzicht. Zuversicht und Verzicht sind aber nicht in Mode.“
Wir lernen also gleich zwei wichtige Sachen. Nämlich einerseits, wenn man die Sache nüchtern und ohne sentimentales Getue von wegen Kinderglück betrachtet: Kinder sind eine Last für ihre Erzeuger; wer Kinder hat, muss Verzicht üben. Andererseits: Eltern dürfen sich bei ihrem verzichtreichen Leben auf keinen Fall die gute Laune verderben lassen. Zuversicht müssen sie ausstrahlen für die Kleinen, sie auf keinen Fall merken lassen, welche Last sie darstellen. Und warum müssen Eltern sich dieser doppelten Mühe unterziehen? Weil es sonst gerade mit dem Wohlstand, an den sie sich klammern, auf Dauer ziemlich mau aussieht:
„Denn wo keine Kinder geboren werden, da werden aus Kindern auch keine Arbeitskräfte, welche die Wirtschaft am Laufen halten. Diese Rechnung ist banal, das Ergebnis desaströs: Die Deutschen, die zur Wohlstandswahrung eine Gegenwart ohne Kinder bevorzugen, gehen in eine Zukunft ohne Wohlstand.“
Verzicht wegen Wohlstand; Zuversicht, damit Arbeitskräfte nachwachsen: Für bürgerliche Familienmenschen reimt sich das offenbar ganz prima zusammen. Dabei weiß man auch in der SZ-Redaktion durchaus von gewissen Friktionen, vom Hörensagen jedenfalls:
„Wer deutsche Arbeitnehmer danach fragt, wovor sie sich am meisten fürchten, hört als Antwort: Jobverlust. Kein Wunder, selbst Unternehmen mit steigenden Gewinnen entlassen viele Menschen…Wer nicht weiß, ob er bald schon von 345 Euro ALG II plus Wohngeld leben muss, der überlegt sich zweimal, ob er Kinder in die Welt setzt.“
Ob die Verarmung so mancher Durchschnittsfamilie am Ende doch nicht bloß eine „gefühlte“ ist? Ob es vielleicht mit einer schönen Zukunft heutiger Kinder als Arbeitskräfte von morgen gar nicht so weit her ist? Ob sich nicht womöglich der wirkliche Wohlstand selbst ein wenig ungleich verteilt: auf die Minderheit ohne begründete Zukunftsangst und eine Mehrheit mit dauernd gefährdeten mageren Jobs? Aber sei’s drum, die Botschaft des Leitartikels ist klar und trotz aller zwischendurch aufgegriffenen Bedenklichkeiten erfreulich eindeutig. Auf die Zuversicht kommt es an. Bloß wegen Jobverlust und ALG II braucht sich niemand so ins Hemd zu machen, dass er gleich der deutschen Wirtschaft die Produktion von Nachwuchs-Arbeitskräften verweigert, die die dann im Interesse des nationalen, also ihres eigenen gar nicht nur gefühlten Wohlstands einstellt oder entlässt, wie es die steigenden Gewinne gerade gebieten. Denn so viel steht fest: Der künftige Reichtum der Nation sind ihre Kinder – egal wovon sie und ihre Eltern leben. Deshalb tut der Leitartikel zum Schluss auch selbst etwas für die nötige gute Stimmung: Er entdeckt einen
„Hoffnungsschimmer: In Dresden etwa, wo die Geburtenrate wie überall im Osten stetig fiel, steigt sie wieder leicht. Vielleicht, weil es dort wieder etwas mehr Arbeit gibt.“
Vielleicht steigt aber auch die Arbeitsplatzrate, weil es wieder etwas mehr Kinder gibt – wer weiß das schon?
Weiter hinten: Bevölkerungspolitik noch
einmal andersherum. Nicht Knappheit ist dort das Problem,
sondern Überfluss: Test und Eid für
Einbürgerungswillige
lautet die Überschrift; das Land
Hessen schlägt Wissens- und Werteprüfung vor
für
einwanderungswillige Ausländer. Auf Seite 4 musste man
sich noch Sorgen machen, ob nicht in naher Zukunft der
deutschen Wirtschaft die Wohlstand schaffenden
Arbeitskräfte ausgehen; auf Seite 7 darf der aufmerksame
Leser sich in die Schwierigkeiten hineindenken, wie man
eine korrekte, im Sinne unserer menschenrechtswürdigen
Verfassung hieb- und stichfeste Überprüfungsmethode
konstruiert, um die Gesinnung von einwanderungswilligen
Ausländern zu testen. Dass das sein muss, steht außer
Frage: Deutschland kann schließlich weder „bloße
Wirtschaftsimmigranten“ – mit denen jeder denkbare
Arbeitskräftemangel im Lande zweifellos zu beheben wäre –
gebrauchen noch Leute, die schon durch ihren Lebensstil
als „undeutsch“ – „Parallelgesellschaft“ nennt man das
heute – auffallen. Allerdings: Kann man Fremdländern
trauen, die überhaupt nicht mehr als solche auffallen?
Die sich womöglich berechnend verstellen? Wie kitzelt man
aus solchen Burschen mittels geschickter Befragung
heraus, ob ihre „innere Hinwendung“ zu Deutschland
unseren Ansprüchen an unsere Neubürger genügt? Mit diesen
Fragen darf der aufgeklärte Leser die einschlägig
engagierten Experten nicht allein lassen. Denn eines ist
klar: Wir Deutsche sind eine Wertegemeinschaft.
Kein Haufen verängstigter Arbeitsplatzbesitzer, schon gar
keine Kapitalstandortbesatzung mit reicher Elite und
einer Masse, die bestenfalls über eingebildeten Wohlstand
verfügt. Nein, wir sind die Eingeborenen einer Heimstätte
des Wahren, Guten und Schönen, einer christlichen
Leitkultur und dergleichen mehr. Woraus knallhart folgt:
Ausländer, die nicht zu uns passen, haben keine Werte,
jedenfalls nicht die richtigen, und müssen weg.
Diskriminierung ist das natürlich nicht; das würde zu unseren Werten ja gar nicht passen. Falls doch einmal gewissen politischen Kräften im Eifer des Gefechts gegen Überfremdung ein bisschen Diskriminierung unterläuft, dann wird das selbstverständlich sofort kritisiert. Dafür gibt es sogar extra Experten im Lande:
„Der baden-württembergische Einbürgerungsleitfaden ist nach einem Gutachten des Heidelberger Max-Planck-Instituts für ausländisches öffentliches Recht und für Völkerrecht rechtswidrig. In dem am Dienstag von der Stadt Heidelberg vorgelegten Gutachten heißt es, der Gesprächsleitfaden verstoße in seiner gegenwärtigen Form gegen die Rassendiskriminierungskonvention.“
In so heiklen Fragen der Werteordnung und einer gerechten Selektion lassen wir nachdenken, sogar auf Max-Planck-Niveau; wir haben da in Heidelberg eine Stiftung Warentest für Rassendiskriminierung. Die prüft ganz überparteilich natürlich nicht den politischen Sinn und Zweck, die Arroganz und die Gemeinheit des geplanten Ausländerüberprüfungsverfahrens, sondern dessen Übereinstimmung mit den bewährten Regeln einer einschlägigen Konvention. Denn schließlich braucht die deutsche Wertegemeinschaft nicht bloß eine Selektion unter den Zuwanderern; sie hat auch ein Recht auf ein amtlich beglaubigtes gutes Gewissen beim Selektieren.
Der liberale SZ-Leser kann also zufrieden sein: Die gegenwärtige Form der von den CDU-Scharfmachern vorgelegten Überprüfungsverfahren ist noch nicht das letzte Wort. Über die Verbesserungen der Einbürgerungsleitlinien wird er auf dem Laufenden gehalten werden.
Donnerstag, 16.3.
Die Schlagzeile wartet heute mit einer Alarmmeldung auf:
Klinikärzte streiken in ganz
Deutschland
. Die Apokalypse stellt sich im
Folgenden sehr rasch als ziemlich zurückhaltendes
Donnerwetter heraus: Für 1 Tag erhält die Ärzteschaft in
8 Uni-Kliniken nur mehr Notdienst und Intensivstationen
aufrecht; nach Auskunft des Hauptgeschäftsführers des
Marburger Bundes könnten von den 22.000 Klinikärzten
‚mit Sicherheit 7.500 streiken‘.
Und: ‚Am Freitag
werden alle Ärztinnen und Ärzte demonstrativ ihre Arbeit
wieder aufnehmen, um den Arbeitgebern den guten Willen
der Mediziner zu verdeutlichen.‘
Eher eine
Good-Will-Aktion also als ein Arbeitskampf; doch das
nimmt von der spitzenmäßigen Bedeutung, die die SZ diesem
Kampf für bessere Arbeitsbedingungen und mehr Geld
(so die Oberüberschrift) beimisst, nichts zurück. Die
Zeitung tut das Ihre, ihr Publikum dafür zu
interessieren; und das ganz ausnahmsweise in einem
durchaus positiven Sinn: Sie lässt den Mann vom Marburger
Bund alle Sorgen beschwichtigen, ein Patient könnte
irgendwie Schaden nehmen, bevor sie die Arbeitgeberseite
mit ihrer Warnung vor einem ‚großflächigen
Zusammenbruch der Patientenversorgung‘
zu Wort kommen
lässt; ganz wertneutral gibt sie die Argumente wieder,
mit denen die Ärztegewerkschaft ihre Forderung nach sage
und schreibe 30% mehr Gehalt, Beschränkungen des
Schichtdienstes und verbesserten Arbeitsbedingungen
rechtfertigt – Weihnachtsgeld ist schon gekürzt, das
Urlaubsgeld gestrichen, Zusatzarbeit bis zu 80 Stunden
pro Woche wird geleistet, ohne Vergütung… –, bevor der
Verhandlungsführer der Gegenseite, der notorische
Finanzminister aus Niedersachsen, die 30% als
unbezahlbar
bezeichnen und das politische
Interesse an einer Senkung der Lohnnebenkosten in
Erinnerung rufen darf, dem eine Anhebung der
Kassenbeiträge zwecks besserer Ärztebezahlung
zuwider
laufen würde; was auch alles andere als
jenes ‚Njet‘ ist, das man von Herrn Möllrings Umgang mit
Verdi gewöhnt ist. Die Streik-freundliche Tendenz findet
im Kommentar ihre Fortsetzung: Unter der geradezu
agitatorischen Überschrift System Ausbeutung
deutet Heidrun Graupner an, wie es in Deutschlands
marktwirtschaftlich modernisiertem Klinikbetrieb zugeht
und was der Grund dafür ist:
„Die Arbeitsintensität ist immens, weil immer mehr kranke Menschen immer schneller behandelt werden müssen, nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten.“
In die angekündigte „System“-Kritik artet der Kommentar
freilich nicht aus – er will ja nur, wie der Untertitel
ankündigt, plausibel machen, warum der Streik der
Klinikärzte verständlich und notwendig ist.
Und um
das Verständnis der SZ-Redaktion zu finden und auf das
ihrer Leser hoffen zu können, muss streikenden
Angestellten erstens schon besonders übel mitgespielt
werden, und zweitens langt auch das nicht – mit
Arbeitshetze und unbezahlter Arbeit wegen
„wirtschaftlicher“ Interessen der Arbeitgeber könnte
heutzutage hierzulande ja jeder daherkommen… Um bei den
Klinikärzten eine wohlwollende Ausnahme zu machen und
deren für hiesige Verhältnisse exorbitante
Forderung zwar nicht in der Höhe, aber in der Tendenz
richtig zu finden, braucht es schon noch mehr als den
Hinweis auf das „System Ausbeutung“, das ja wirklich
nicht auf die Kliniken beschränkt ist, sondern gerade
wegen seiner Allgemeinheit unter anderem auch zu dem
„Phänomen“ führt, dass Mediziner unter den Bedingungen
sinkender „Lohnnebenkosten“ „immer mehr kranke Menschen“
zu behandeln haben. Das entscheidende Zusatzargument des
Kommentars lautet schlicht: Deutschlands Elite.
Klinikärzte sind eben keine gewöhnlichen Arbeitnehmer,
bei denen gewöhnliche Ausbeutung „nach wirtschaftlichen
Gesichtspunkten“ in Ordnung geht, sondern Träger des
Medizin-Standorts Deutschland. Also erstens schon mal
überhaupt was Besseres, und zweitens unentbehrlich für
ein gutes Stück der deutschen Spitzenstellung in der
Konkurrenz der Nationen:
„Noch wird die deutsche Medizin, gerade in den Uni-Kliniken, gerühmt, weltweit. Noch.“
Gefahr droht, wenn das Ausland uns unsere Spitzenkräfte mit besserer Bezahlung wegkauft. Dieser Gefahr einen Riegel vorzuschieben, ist ein Akt nationaler Verantwortung. Deswegen sind 30% mehr Gehalt zwar noch lange nicht bezahlbar, meint Frau Graupner. Aber:
„In diesem Tarifstreit geht es um sehr viel mehr als um eine Gehaltsforderung von Ärzten.“
Nämlich um einen Konkurrenzkampf gegen den Rest der Welt
um die weltweite Nachfrage nach deutscher Medizin.
Noch
, mahnt der Artikel, liegt Deutschland da gut
im Rennen; aber jetzt kommt es darauf an:
„Es hängt von diesem Tarifstreit ab, ob das so bleibt.“
Und diesmal eben nicht, wie sonst immer und überall, davon, dass die Arbeitgeberseite sich durchsetzt. Sondern ob die Angestellten ihre kostbare Arbeitskraft weiter im Inland verkaufen. Auch und gerade beim Heilen und Helfen und dem Geld dafür kommt es nämlich nicht auf die Wohlfahrt an, weder die der Ärzte noch erst recht auf die der Patienten. Sondern auf die Nationalfarbe des Geschäfts, das mit der Krankheit zu machen ist.
International auf dem Spiel steht im Übrigen auch der
deutsche Fußball. Nach dem schmachvollen
1:4 gegen Italien ist der in der Krise!
Die ständige Sorge: Wo ist eigentlich der Bundestrainer?
Dann droht auch noch eine – vermutlich ausländische –
Wettmafia den Ruf des deutschen Fußballs zu
unterminieren! Da tut es gut, wenn mitten im Hauptartikel
an prominenter Stelle auf Seite 1 ein großes Farbfoto –
unter dem Motto Aufgestellt
– Hoffnung ausstrahlt.
Die Bild-Legende erläutert:
„Kanzlerin Angela Merkel, bekennender Fußballfan, hat Bundestrainer Jürgen Klinsmann knapp drei Monate von der Weltmeisterschaft Mut gemacht. Er habe ‚alte Zöpfe abgeschnitten‘ und Reformen gewagt, sagte sie bei einem Treffen mit dem WM-Organisationskomitee in Berlin. Deutschland sei immer eine Turniermannschaft gewesen.“
Schön hat sie das gesagt, das mit den „Reformen“ und den „alten Zöpfen“ – da kennt sie sich aus, so redet sie schließlich auch auf jedem CDU-Parteitag daher. Und die Sache mit der „Turniermannschaft“ kommt auch gut an. Denn das heißt doch wohl: Die Jungs werden sich schon durchbeißen und -holzen. Auftrag und Ermunterung also von höchster Stelle; denn schließlich spricht hier nicht einfach Angela, der Fußballfan, wie der Text suggeriert, was auch die SZ aber kaum für mitteilenswert befunden hätte, sondern die Chefin des ganzen Ladens reklamiert ein Recht auf nationalen Erfolg – auch und gerade bei dieser „schönsten Nebensache der Welt“. Wofür schmeißen wir denn auch sonst das ganze Geld ’raus und heucheln Gastfreundschaft für „die Welt“?!
Dass der durchschnittliche vernunftbegabte Leser selbstverständlich mitfiebert, wenn es um die Erfolge „unserer nationalen Sportgrößen“ geht, ja dass er unbedingt informiert werden will noch über den letzten Furz, den der Bundestrainer in Sachen Mannschaftsaufstellung lässt und über die aktuellen zwischenmenschlichen Beziehungen zwischen Klinsmann und Beckenbauer – das versteht sich von selbst. Falls dem einen oder anderen feinsinnigen Leser die Sache mit dem deutschen „WM-Fieber“ zu dick aufgetragen vorkommt, dann muss er sich entweder bis zum Leitartikel vom kommenden Samstag gedulden, oder er sucht im Sportteil die wunderbar sensiblen Hintergrundberichte über „unsere Athleten“, die bei der Behinderten-Olympiade „beachtliche Medaillenränge“ erreicht haben, jedoch „oft leider und völlig zu Unrecht nicht so viel öffentliche Beachtung finden“ wie unsere völlig gesunden Sportkrüppel.
So gut die Kanzlerin heute auf Seite 1 beim
„WM-Gipfeltreffen“ gefallen hat, auf Seite 4 im
Leitartikel gefällt sie nur noch halb so
gut. Deshalb heißt er auch Die halbe
Kanzlerin
und handelt davon, dass man in der
Redaktion der SZ langsam ungeduldig wird mit Frau Merkel.
Man vermisst das versprochene „Durchregieren“.
„Entscheiden“ soll die Frau und dem Volk und ihrer Partei
endlich „klare Ansagen“ machen, wo es lang geht, das
erwartet man als aufgeklärter Bürger von seiner
Führungsfrau. Keine falsche Zurückhaltung bitte beim
Durchsetzen der „notwendigen Härten“, sonst wird das nie
was mit dem deutschen Standort – nicht nur fußballmäßig!
Freitag, 17.3.
Nach 14 Jahren Planung und Rechtsstreit
ist es
heute endlich so weit: Berliner Großflughafen
darf gebaut werden
. Ob er jetzt erleichtert
aufatmet, das bleibt jedem Leser selbst überlassen; der
Bedeutung der Angelegenheit sollte er sich aber nicht
entziehen. Worin die besteht, dafür zitiert die Zeitung
Politik und Wirtschaft
, die laut Unterzeile die
Entscheidung
begrüßen
. Seltsamerweise zitiert
sie die wichtigen Leute mit den denkbar dämlichsten
Sprüchen:
– Wowereit sprach von der ‚wichtigsten
Entscheidung, seit ich Bürgermeister bin‘
– ein
selbstbezüglicher Superlativ, der eigentlich gar nichts
anderes zum Ausdruck bringt als die Wichtigkeit, die der
Mann sich beimisst.
– Platzeck meinte, der Großflughafen sei ‚die
Startbahn in die Zukunft. Das ist unser Brandenburger Tor
zur Welt.‘
Naja. Inzwischen weiß man: Den Mann
entschuldigt ein Nervenzusammenbruch.
– Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) meinte, nun
sei der ‚Weg für einen modernen, international leistungs-
und wettbewerbsfähigen Flughafen‘ frei
– zu welchem
„internationalen Wettbewerb“ der neue Flughafen „fähig“
sein soll, teilt die leitende Dame der Republik nicht
mit, braucht das aber auch gar nicht. Denn wenn sie als
Bundeskanzlerin die Worte „modern“ und „international
wettbewerbsfähig“ in den Mund nimmt, dann meint sie und
wird auch unbesehen so verstanden, dass es um den Rang
Deutschlands im immerwährenden, allgegenwärtigen,
umfassenden Konkurrenzkampf der Nationen geht, von dem
man nicht mehr wissen muss, als dass wir Deutschen ihn
gewinnen müssen. Diejenigen Deutschen, die für siegreiche
internationale Konkurrenzkämpfe im zivilen Sektor
zuständig sind, melden sich auch prompt im gleichen Sinn
zu Wort:
– ‚Für ganz Deutschland ist es ein guter Tag,
wenn ein solches Leuchtturmprojekt realisiert werden
kann,‘ sagte Industriepräsident Jürgen Thumann
– denn
dann fließt viel Geld, das von seinen
Industriekapitalisten verdient werden kann; außerdem
braucht, wenn auch sonst niemand, das große Geld in der
Hauptstadt seines Standorts attraktive
Standortbedingungen. Deswegen denkt der Industriekapitän
bei „Leuchtturm“ auch nicht an die Warnung vor
gefährlichen Klippen, sondern an so etwas wie einen
leuchtenden Turm…
Freilich liegt dem Weltblatt aus München jede
denunziatorische Absicht fern, wenn es die Zufriedenheit
von Politik und Wirtschaft
mit ausgewählten
Albernheiten in wörtlicher Rede illustriert. Die Zeitung
hält es einfach für entscheidend für die freie
Urteilsbildung ihrer Leser, wie sehr alle wichtigen
Instanzen der Republik mit der gerichtlichen Lizenz für
den neuen Flughafen zufrieden sind. Damit die Leserschaft
sich auch noch ihr ganz eigenes Urteil bilden kann, wird
sie im Fettgedruckten außerdem über Prognosen
informiert, denen zufolge … durch den Airport in der
strukturschwachen Region bis zu 40.000 Arbeitsplätze
entstehen
werden. Klar, dass das unbedingt und ganz
nachdrücklich für den Flughafen spricht: Es
braucht ihn allein schon und vor allem für die Arbeit,
die an ihm verrichtet wird.
Doch natürlich ist das Blatt nicht einseitig. Vom
Interesse der Flughafengegner, die die Gerichte bemüht
und dadurch mitgeholfen haben, die „Startbahn in die
Zukunft“ um 14 Jahre zu verzögern, erfährt man als erstes
das etwas rätselhafte Argument
, der Standort
sei aus ‚politischen Gründen‘ gewählt worden
– aus
welchen denn sonst, möchte man fragen; aber offenbar
versteht es sich, dass es neben politischen Gründen, die
ungültig gewesen wären, auch andere gibt, die gerichtlich
in Ordnung gehen. Zum Beispiel den – so viel Einblick
gibt der Bericht in die Urteilsbegründung des
Vorsitzenden Richters, der mit Vornamen Stefan heißt –,
dass man von Berlin aus gut hinkommt zu dem neuen
„Brandenburger Tor zur Welt“. Dass der Fluglärm in
etlichen Flugzonen nicht auszuhalten ist, sieht das
Bundesverwaltungsgericht für die Zeit zwischen
Mitternacht und 5 Uhr früh immerhin ein, untersagt
Flugbewegungen in dieser Zeit und verärgert damit
Lufthansa und Air Berlin, die dann volle 5 Stunden am Tag
nichts verdienen können. Trotzdem sind die Kläger
enttäuscht; ihr Anwalt will den Beschluss jetzt ‚sehr
genau prüfen‘, um gegebenenfalls wegen Verletzung der
Grundrechte Klage beim Bundesverfassungsgericht
einzureichen.
Fragt sich nur, weshalb man sich auch noch dafür
interessieren soll. Die Antwort bekommt der gespannte
Leser im Leitartikel auf Seite 4: Heribert Prantl doziert
über die Segnungen einer rechtsstaatlichen
Verwaltungsgerichtsbarkeit. Dort repariert die
Staatsmacht nämlich – manchmal schon allein durch die
Zeit, die das Gericht sich nimmt – bürger-, umwelt- und
sonst wie menschenfeindliche Entscheidungen ihrer allzu
beflissen wirtschaftsfreundlichen Planungsbehörden;
jedenfalls ab und zu. Und das einfach dadurch, dass sie
dort überprüft, ob diese Behörden sich an ihre eigenen
Planungsrichtlinien gehalten haben. Das findet der
Kommentator, ohne jeden Anflug von Ironie, ganz einfach
großartig: Politik und Wirtschaft
, einig in dem
Willen, das Kapital mit einem strukturstarken,
international konkurrenztüchtigen Standort zu verwöhnen –
und natürlich mit einem Seitenblick auf die steuer- und
abgabenpflichtigen lohnabhängigen Anhängsel des Kapitals
–, geraten mit elementaren Bedürfnissen ihrer Bevölkerung
aneinander; wenn die sich zur Wehr setzt, wird sie auf
den Klageweg verwiesen; der „Interessensausgleich“ findet
vor Gericht in der Weise statt, dass die Jury nachschaut,
ob die Herrschaft auch immer korrekt nach ihren
Verfahrensgrundsätzen vorgegangen ist. Das lobt der
Leitartikel – und was das Schönste ist: Er wendet sich
mit dieser Belehrung gar nicht tröstend an die Leute,
deren Interessen auf die Art in die ihrer Obrigkeit und
des Kapitals eingepasst werden; Prantl richtet sich, ganz
Mentor und ideeller Großwesir der Macht, an die
praktizierenden Machthaber mit ihren Planungsbehörden,
denen ihre selbstgeschaffenen Verfahrensregeln neuerdings
immer mehr als Hindernisse für international
wettbewerbsfähiges
Durchregieren vorkommen.
Die sollen den Zwang zu formeller Korrektheit
nicht gering achten – er nützt, letztlich ihnen:
„Die erste und die zweite Gewalt im Staat können sich also … durchaus einmal bei der dritten Gewalt bedanken.“
Weil die nämlich manchmal immanent Unsinniges verhindert und bei Interessenskonflikten für Rechtsfrieden sorgt. Befindet die vierte Gewalt in ihrer oberhoheitlichen Sicht der Dinge – im Namen ihres beifällig murmelnden Publikums…
Kritik und Humor kommen heute auch wieder nicht zu kurz: Im Streiflicht darf geschmunzelt werden über den Übereifer und die Weltfremdheit der nationalistischen Knalltüten, die die Fragen des hessischen Ausländertests erfunden haben. Im Unterschied zu denen kennen Streiflicht-Autoren sich nämlich aus mit dem Geisteszustand des guten deutschen Volks. Man selber, studierter Bildungsbürger, der man ist, kann die 100 Fragen des hessischen Innenministeriums gerade noch beantworten, aber der große Rest der durchschnittlichen Bild-Leser? Da langt man sich doch ans Hirn, wenn man sich vorstellt, wie die am Unterschied zwischen Robert und Roland Koch herumdoktern. Wohingegen ein Ausländer, der das ganze Zeug bloß auswendig lernt…?! So nicht! lautet die humoristische Botschaft: So kriegen wir nie raus, wer hierher passt und wer draußen bleiben muss. Brüllkomisch!
Weiter hinten im Blatt, auf Seite 7, wird das
Migranten-Problem unter der locker-flockigen Überschrift
Die große Überfahrt
noch einmal
nach einer anderen Seite hin durchgenommen: Tausende
Migranten versuchen von Mauretanien aus, die Kanaren zu
erreichen – viele sterben auf dem Seeweg
. Man wird
darüber in Kenntnis gesetzt, dass der Urlaub auf den
kanarischen Inseln auch nicht mehr das ist, was er einmal
war, seit dort so unverhüllt
wie kaum anderswo
arme und reiche Welt aufeinander prallen
:
bleiche europäische Winterflüchtlinge
lässt der
launige Berichterstatter an den Stränden auf
Armutsflüchtlinge aus Schwarzafrika
treffen. Die
menschliche Problematik dieses Zusammentreffens wird
ansonsten aber nicht weiter vertieft, die Befassung mit
den Ursachen des doppelten Irrsinns erst recht vermieden
– die Verhältnisse sind so, wie sie sind; von Interesse
allenfalls Details wie die GPS-Ortungssysteme, die man
bei 25 Ertrunkenen gefunden hat. Wichtig und näherer
Befassung wert sind dem Weltblatt die Probleme, die nicht
etwa die „Armutsflüchtlinge“, sondern die spanischen
Behörden mit ihnen haben: Es sind einfach zu
viele, nämlich mehr als die 1600 bereitgestellten
Lagerplätze; weil die Schlauberger ihre Herkunft
verschleiern, bleibt den Behörden nichts anderes
übrig…, als viele Migranten auf das spanische Festland zu
fliegen – ihrem Ziel
; dass die konservative
Opposition deswegen und wegen der 1 Milliarde Euro, die
die Flüchtlingsbetreuung inzwischen kostet, der
sozialistischen Regierung im Parlament die Hölle heiß
macht, gehört zum seriösen Teil der Problemlage. Am Ende
lässt der Bericht den spanischen Außenminister
feststellen, dass auf Dauer nur eines helfe: eine
wirksame Bekämpfung der Armut in Afrika.
Womit
erstens klar ist, aus welcher Sorte Berechnung
europäische Hilfe gegen das afrikanische Elend erfolgen
würde, wenn nicht zweitens genauso klar wäre,
dass es mit der noch ganz schön dauern dürfte.
Sollte sich jetzt ein Leser durch das vertraute Stichwort
Bekämpfung der Armut in Afrika
moralisch
herausgefordert fühlen, etwas für eine bessere Welt zu
tun, dann kann ihm ein kleiner Artikel gleich daneben
weiter helfen: Töpfer hält Kriege um
Wasser für möglich
, meldet die Überschrift;
deswegen hat der Direktor des UN-Umweltprogramms im
Bayerischen Rundfunk eine vorsichtige Verwendung der
Ressource
angemahnt
, und die SZ gibt den Tipp
weiter. Weniger Wasser verschwenden für den Frieden: Mit
dem praktischen Vorhaben mag der über das Elend der Welt
schonungslos aufgeklärte Leser ins Wochenende gehen.
Samstag, 18.3.
In Frankreich brennt es wieder; im
Pariser Quartier Latin gibt es nächtliche Randale: Davon
erzählt in düsteren Farben das wieder ganz nach oben
gerückte Seite-1-Foto. Den Anlass der Randale rufen die
kleinen Titelzeilen mit den Stichworten vereinfachte
Kündigungsregeln
und Arbeitsmarktreform
in
Erinnerung – einigermaßen wohlwollende Etikettierungen
eines Gesetzes, das den Arbeitgebern die Einstellung
Jugendlicher bis 26 Jahre dadurch schmackhaft machen
will, dass sie die Jungs und Mädels bei Nicht-Gefallen
ohne Weiteres wieder ’rausschmeißen dürfen. Doch das
versteht sich für moderne Weltbürger sowieso längst von
selbst, dass Schutzvorschriften für Lohnabhängige,
welcher Art auch immer, in der modernen Welt schon
deswegen nichts mehr zu suchen haben, weil eine
lohnabhängige Existenz überhaupt nur noch unter den
Bedingungen größter Existenzunsicherheit zu haben ist;
deswegen geht die Beseitigung letzter Sicherheiten als
Reform
in Ordnung und verdient als
Vereinfachung
herrschender Regeln
Anerkennung.
Weniger eindeutig fällt die verbale Einordnung des
Aufbegehrens gegen das neue Gesetz aus. Aus
Demonstrationen
in der Oberzeile und neuen
Massenprotesten
, zu denen in der Unterzeile
Studenten und Gewerkschaften
aufrufen
,
werden in der Hauptschlagzeile
Krawalle
. Das macht Sinn, weil
die Zeitung vor allem mitteilen will, dass
Frankreichs Regierung
dem Aufruhr
trotzen will
: Zu so einem
mannhaften Beschluss passen Krawalle einfach besser als
massenhafte Latschdemos, die einen anständigen Souverän
eher kalt lassen. Außerdem gibt es von schweren
Ausschreitungen
nach Kundgebungen in Paris und
anderen Städten
zu berichten sowie von einem
Innenminister, der – eine Mitteilung ohne jeden Anflug
von Ironie – nichts Geringeres als das
Demonstrationsrecht hat verteidigen lassen:
gegen wen, wenn nicht gegen Krawallmacher!
„‚Mein Job war es, dass die Demonstranten mit aller Sicherheit demonstrieren konnten und dass die Ganoven festgesetzt wurden,‘ sagte Sarkozy.“
Die Parteinahme für die öffentliche Ordnung im großen
westlichen Nachbarland steht damit jedenfalls außer Frage
– anders als im Fall Weißrussland, dessen Opposition
schon die ganze Woche hindurch und auch heute wieder im
Innern des Blattes heftig dafür bedauert wird, dass sie
es einfach nicht hinkriegt, die Hauptstadt Minsk mal
richtig aufzumischen oder lahmzulegen und so die
verordnete Wiederwahl
des Präsidenten Lukaschenko
zu hintertreiben, den im Westen niemand leiden kann und
haben will; aber das steht auf dem Titelblatt heute nicht
zur Debatte. Dort wird erst einmal in Frankreich dem
Krawall getrotzt.
Ab da hält sich die Parteilichkeit für die Regierung in
Paris allerdings sehr in Grenzen. Immerhin sind
keineswegs bloß und nicht einmal eigentlich böse
Randalierer gegen das Gesetz, sondern die studierende
Elite, die Gewerkschaften, zwei Drittel der anständigen
Bevölkerung sowie ehrbare etablierte Oppositionskräfte,
die noch dazu über so ungemein ehrenwerte Einwände
verfügen wie z.B. die mögliche
Präsidentschaftskandidatin
der Sozialisten, deren
berechnenden Blödsinn die SZ auch noch für mitteilenswert
befindet: Premierminister Villepin hätte nicht
begriffen, dass die Jungen den CPE als ‚Entwertung und
Zurückweisung ihrer Arbeit‘ sähen
. Sogar der Premier
selber will sein Gesetz nicht mehr unbedingt durchpowern,
heißt es – Grund genug für eine ausgewogene
Berichterstattung, die in diesem Hin und Her ihr
eigentlich wichtiges Thema findet:
„Während Opposition und Gewerkschaften den Druck auf Villepin erhöhen, lässt die Solidarität innerhalb der Regierungspartei UMP offenbar nach. Nur wenige Abgeordnete treten öffentlich für das Gesetz ein.“ Usw.
Da spielt sich also der eigentliche Machtkampf ab, während auf den Großstadtstraßen ein bisschen randaliert und ordnungsstiftend durchgegriffen wird; und auf den stürzt sich natürlich eine seriöse Presse.
Aus rechtsrheinischer Perspektive müssen dazu allerdings
doch noch ein paar weitergehende kritische Einschätzungen
abgeliefert werden. Zuständig dafür ist heute, zum
Wochenende, das Feuilleton. Dessen Chef, in französischen
Dingen besonders bewandert und kompetent, kann den
Pariser Machthabern den Vorwurf nicht ersparen, dass es
um ihr Verhältnis zu den Regierten noch mehr als
anderswo
genauso bestellt ist, wie es sich souverän
regierenden Demokraten überall nachsagen ließe:
„Politik gleicht in Frankreich mehr als anderswo einem Glasperlenspiel, das von einem überschaubaren Kreis von Mandarinen gespielt wird und dessen Prinzip weniger die Förderung der Wohlfahrt aller zu sein scheint als vielmehr die Umverteilung von Macht und Einfluss im Kreis der Mitspieler.“ „… die politischen Parteien (sind) nicht mehr als untereinander zerstrittene Wahlvereine, die sich vor allem damit beschäftigen, in erbitterter Konkurrenz ihrer unterschiedlichen Strömungen einen Kandidaten zu ermitteln, den sie dann in das Rennen um die Präsidentschaft schicken können.“
Was an solchen Kämpfen, die immerhin um die Macht im
Staat geführt werden, so harmlos sein soll wie ein
Glasperlenspiel, verrät der Autor nicht. Er will aber
auch nur darauf hinaus, dass die Politiker, die es
treiben, durch das Aufbegehren der studierenden Jugend
gestört werden, obwohl den Berichten weiter vorn
eher eine Belebung der erzdemokratischen
Intrigenwirtschaft zu entnehmen wäre – und obwohl er
selbst in dem ganzen Aufruhr nichts weiter am Werk sieht
als Frankreichs zum x-ten Mal beschworenen
„Revolutionsmythos“. Immerhin konfrontiert der Autor die
angebliche glasperlenspielerische Selbstbezogenheit der
politischen Klasse Frankreichs andeutungsweise mit der
desolaten Lage des nationalen Nachwuchses – keinerlei
beruhigende Aussichten auf eine sozial gesicherte
Existenz
, verstörende Unsicherheit
,
existenzielle Verunsicherung
–, um dann freilich
in einem logisch etwas rätselhaften, ideologisch jedoch
sehr geradlinigen Gedankengang beide Seiten, die
verunsichert-revoluzzende Jugend zusammen mit
ihren Machthabern, die nun auf einmal gar nicht mehr als
Glasperlenspieler, sondern als Repräsentanten einer ganz
besonders französischen sozialen Gesinnung
apostrophiert werden, auf den Misthaufen der modernen
Weltgeschichte zu schmeißen:
„In der Demonstration der Jugend, so hat es den Anschein, empört sich Frankreich gegen den Einbruch einer globalisierten Wirklichkeit, von der die Politiker allzu lange glaubten, sie mittels des von ihnen gefeierten und aller Welt als vorbildlich gepriesenen sozialen Modells Frankreich den blau-weiß-roten Grenzpfählen fern halten zu können.“
Die Regierung ist also nicht besser als die Jugend, die
gegen sie aufbegehrt, und umgekehrt. Ganz Frankreich
sperrt sich nicht bloß gegen ‚die Globalisierung‘, von
der man in Deutschland längst weiß, dass sie „Realität“
und insofern weder zu kritisieren noch zu korrigieren ist
– schon gar nicht mit aufgeplusterten blau-weiß-roten
Sozialmodellen –; es sperrt sich überhaupt gegen die
Realität
persönlich, über die Herr Willms
herausgefunden hat, dass sie selber globalisiert
worden ist und deswegen weder mit Gewalt noch mit
Glasperlenspielen aus einer einzelnen Nation ausgesperrt
werden kann. Tief gedacht. Und auch wenn ihm nicht gleich
alles klar wird, die Gewissheit kann der SZ-Leser mit ins
Wochenende nehmen: Im Unterschied zu den Papp-Franzosen –
das zeigt sich sogar anlässlich einer sozialpolitischen
Gemeinheit der Pariser Regierung und einer Protestwelle
dagegen – befindet sich der abgebrühte,
realitätstüchtige, globalisierungsgestählte Deutsche voll
im Einklang mit dem kapitalistischen Weltgeist.
Der Leitartikel trägt heute den Titel
Weltmeister im Geiste
und kündet
davon, dass es Wolfgang Roth zu viel geworden ist mit dem
deutschen „WM-Fieber“:
„Noch 83 Tage bis… zur Verheißung, zum Weltuntergang, zum ewigen Frieden? Nein, die Tage sind gezählt bis hin zu einem Ereignis, das, wenn man den anschwellenden medialen Gesängen glauben darf, ähnlich schicksalhafte Bedeutung hat: die Fußball-Weltmeisterschaft auf deutschem Boden. Dass die heimische Elf das Endspiel gewinnen muss, ist dabei ausgemachte Sache. … Aber es soll um viel mehr gehen für das Land. Es soll ein Signal ausgehen von diesem Erfolg, ein Signal gegen Erstarrung, für Wachstum und neue Zuversicht. … Wer derart überdreht, der dreht leicht durch. Deshalb ist sehr angebracht, all das anzuführen, was dieses Ereignis nicht ist, und das, was es nicht sein muss. Die deutsche Mannschaft muss nicht Weltmeister werden… Dass die Fußballfans das in der Masse anders sehen, ist völlig normal, denn die eigene Mannschaft wird in fast jedem Land der Erde überschätzt.“
Das ist gut: Zuerst beschreibt der Mann den
galoppierenden nationalistischen Wahnsinn, der im Lande
anlässlich des bevorstehenden Nationen-Kampfs der Kicker
verbreitet wird. Dann schließt er die lapidare
Feststellung an, dass das für Fans der Nationalmannschaft
völlig normal
ist – und zwar ausgerechnet deshalb,
weil dieser Irrsinn offensichtlich in allen anständigen
Nationen gepflegt wird. Der Gedanke, dass das dann
womöglich grundsätzlich gegen den international
verbreiteten Nationalstolz der diversen Volksmannschaften
auf ihre jeweils ganz besondere Vorzüglichkeit, die „ganz
normal“ eine gewisse „Überschätzung“ der nationalen
Sportgrößen einschließt, sprechen könnte, fällt einem
verantwortungsvollen Journalisten im Leben nicht ein. Er
sorgt sich vielmehr um das rechte Maß an
Nationalstolz und weiß genau, wofür wir uns – zumindest
eigentlich – zu schade sein sollten:
„Warum um alles in der Welt muss eine Nation wie Deutschland unbedingt Weltmeister werden oder bei Olympischen Spielen die meisten Medaillen einheimsen? Sind es nicht die totalitären Staaten, die auf Ausbeutung angelegten Regime, die immer wieder aufs Neue mit sportlichen Erfolgen beweisen müssen, dass ihre Bevölkerung gefälligst stolz und glücklich zu sein habe? Haben die Deutschen das nötig? Nein, das sollten wir eigentlich nicht nötig haben, jetzt, da die DDR und ihre Dopingpraktiken fast schon Geschichte sind. Eine solche Haltung zu vermitteln, wäre die Aufgabe der Politiker. Leider partizipieren sie gern am sportlichen Erfolg und zeigen vermeintliche Volksnähe bis hin zur Lächerlichkeit.“
So geht die Kunst, das „Eigentliche“ zu denken: Wenn wir
bei auswärtigen oder den verflossenen
real-sozialistischen Regimen widerlichen Sportkult
entdecken, wissen wir, was los ist: Die Bevölkerung hat
nichts zu lachen, die Obrigkeit braucht also
nationalistischen Pomp um Musterathleten
, um sie
bei Laune zu halten. Wenn wir dann feststellen müssen,
dass sich hierzulande so ziemlich dasselbe Theater
abspielt, dann gibt uns das nie und nimmer in die
Richtung hin zu denken, ob vielleicht auch der hiesige
Laden irgendwie auf Ausbeutung angelegt
ist. Nein,
dann denken wir ganz entschieden nur daran, dass das
eigentlich überhaupt nicht zu unserem
wunderbaren, demokratischen Staatswesen passt. Was man
spätestens daran sieht, dass es eigentlich die
Aufgabe unserer Politiker wäre, solchen Unsinn
zu verhindern, auch und gerade dann, wenn sie sich
immerzu so aufführen, wie wir es eigentlich nur
von lächerlichen Despoten erwarten. So kann man den
ganzen nationalistischen Auftrieb rund um die WM
ausmalen, lächerlich bis abstoßend finden, ohne auch nur
einen kritischen Ton gegen die Nation und ihr
freiheitlich-demokratisches Gemeinwesen zu verlieren, in
deren Namen ein Volk von fanatisierten Fußballguckern
durchdreht.
Die Zurückweisung des nationalistischen Sport-Irrsinns ist allerdings nicht das letzte Wort von Herrn Roth. Neben seinem Abscheu davor ist ihm nämlich noch folgender Gesichtspunkt eingefallen:
„Heute müssen die Deutschen sich und anderen nicht mehr viel beweisen, sieht man davon ab, das sie sich mühsam an jene globalen Veränderungen anzupassen haben, die auch ihren Nachbarn zu schaffen machen. … Wenn die letzten Elfmeter geschossen, die siegreichen Helden in ihren Hauptstädten gefeiert sind … Es bleiben hohe Arbeitslosenzahlen und all die anderen Probleme, die eine alternde Gesellschaft hat, wenn sie die Lasten gerecht verteilen will. Bei diesen Verteilungskämpfen wird dann schnell vergessen sein, wie vereint die Nation einmal war, als sie ihrer Fußballmannschaft die Daumen drückte.“
Was will er uns damit sagen? Zuerst war die
nationalistische Sportbegeisterung ein Trostpflaster für
Unterdrückung und Ausbeutung, das gut zu totalitären
Regimen passt. Und jetzt sollen unsere demokratischen
Verteilungskämpfe
so gewaltig sein, dass das
Trostpflaster, das in den schlimmsten Diktaturen seinen
Dienst tut, eine viel zu geringe Volks-Beruhigungs-Dosis
enthält? Muss man sich als freier verteilungskämpfender
demokratischer Bürger etwa nach der vergleichsweise
harmlosen Ausbeutung in totalitären Regimen sehnen? Oder
anders gefragt: Wäre Herr Roth mit dem Fußball-Fanatismus
versöhnt, wenn sich die durch ihn gestiftete Einheit der
Nation als so haltbar erweisen würde, wie er es bei
Diktaturen unterstellt? Oder will er sagen: Wir Deutschen
sind schon längst wieder so prominent im Weltgeschehen,
dass uns ein primitiver Nationalismus bei der Bewältigung
unserer Probleme nichts nutzt? Eine Nation von unserer
Größe mit unseren Ansprüchen braucht ein Volk mit einem
besseren, belastungsfähigeren Nationalismus – das ist
jedenfalls sein letztes Wort.
Aber noch nicht das der Wochenendausgabe. Als Gemeinde
genussfreudiger Privatpersonen kommt die Leserschaft auch
noch auf ihre Kosten. Diesmal nicht bloß, wie jede Woche,
die Männer mit ihrem eingebildeten oder sogar tatsächlich
vorhandenen automobilen Sachverstand und
Geschmacksurteil. Diesmal ganz speziell und ausführlich
die Weiblichkeit mit einer 6-seitigen Beilage
Mode
.
Der Haupttitel nennt den Sinn der Sache – nicht bloß der
neuen Mode für Frühjahr/Sommer 2006
, sondern der
Mode überhaupt wie der Beilage, die sie zum Thema macht –
in schnörkelloser Direktheit und schonungsloser Offenheit
beim Namen: Raus aus dem Alltag, rein ins
Abenteuer
– und nochmal für Begriffsstutzige in der
Unterzeile:
„Die Damenmode weckt in der kommenden Saison Träume von exotischen Ländern, macht Lust auf Urlaub und tröstet auch diejenigen, die zu Hause bleiben.“
Was heißt hier schon der kommenden Saison
?! Mit
dem Griff zur Beilage darf die Leserschaft tun, was den
höheren Zweck weiblicher Klamotten überhaupt, immer und
überall in der bürgerlichen Welt ausmacht: in die Welt
des schönen Scheins eintauchen, in die Sphäre der
Freiheit, sich und anderen zu gefallen; die Scheiße des
Alltags, den ‚Ernst des Lebens‘, die Hässlichkeit der
üblichen Strapazen einmal hinter sich lassen;
abstrahieren vom ‚Reich der Notwendigkeit‘. Damit ganz
nebenbei auch die düstere Ahnung beiseite lassen, dass
„Mode“ nicht bloß ein, sondern das
Geschäftsmittel eines Gewerbes ist, das Umsatz und Gewinn
mit dem Unterfangen macht, Jahr für Jahr zweimal die
gesamte zahlungsfähige Weiberwelt neu einzukleiden, und
das deswegen von der Kunst lebt, den Adressatinnen das
Bedürfnis nach permanenter Revolution im Kleiderschrank
beizubringen. Keine Frage: Ohne Überhöhung der Gewänder
zu unentbehrlichen Transportmitteln eines
entschädigenden Lebensgenusses ist das nicht
hinzukriegen. Aber ebenso keine Frage: Die Branche hat es
hingekriegt. Der Wahn genussvoller Selbstverwirklichung
durch Mode – die Begleit-Kolumne preist unverfroren das
von Figuren wie Madonna zur Nachahmung vorgemachte
Invent Yourself
als Inbegriff modernen
Mode-Bewusstseins, fern aller angeblichen Mode-Tyrannei
früherer Jahrzehnte – ist zum Gemeingut eines
ideellen Gemeinwesens der besonderen Art geworden: eines
weiblichen ‚Wir‘ – der Artikel über Handtaschen
z.B. verrät: wenn etwas zu uns Frauen zurückkommt,
dann das Kleid
…
Die bürgerliche Privatperson im weiblichen Körper wird mit der „Beilage Mode“ bedient. Sie wird ermuntert, gleichzeitig und nebeneinander – Frauen können bekanntlich drei und mehr Dinge auf einmal – mit ihrem unnachahmlichen Kleidergeschmack zu konkurrieren, sich expertenmäßig über die Kriterien dieser Konkurrenz informieren zu lassen und auszutauschen und sich einzubilden, genau das wäre ein einziger Freiheitsgenuss. Sie wird betört mit ausgiebigen Schilderungen neuester Gewandungen, denen eben dies: Freiheit und Abenteuer, Ausbruch aus der öden Alltagswelt, als ihr wahrer goldener Schnitt attestiert wird:
„Wer denkt bei Farbkompositionen aus Henna, Safran und Cayenne nicht an indische Gewürzmärkte?“
Ja, wer tut das nicht? Es müssen, ja es sollten gar nicht
die wirklichen sein: Es geht um den Duft eines erträumten
Abenteuers, das nie ein Ende nehmen sollte
.
Vielleicht
, flüstert der Hauptartikel zum Schluss,
als wollte er noch der letzten dummen Nuss den banalen
Witz der kompensatorischen Funktion der Privatsphäre
erklären und die letzten Illusionen über Sinn und Zweck
von Illusionen nehmen: Vielleicht ist dieser Wunsch
nun in Erfüllung gegangen.
Kauf dir das beglückende
Abenteuer im Kleidergeschäft – so einfach kann ein
erfülltes Leben sein …
*
Eine seriöse Zeitung nimmt ihre journalistische Verantwortung bis ins Letzte bitter ernst. Dieses hohe Ethos gebietet als erstes sachliche Information. Das bedeutet vor allem – schließlich geht es nicht um Naturereignisse, sondern um gesellschaftliche Vorgänge –: Information aus erster Hand. Man lässt daher die jeweils Zuständigen, die im jeweiligen Zusammenhang wichtigen Leute zu Wort kommen; lässt sie, die Macher, in möglichst komprimierter Form, aber auch schon mal in langen Interviews authentisch erläutern, wie, nämlich wie gut sie meinen, was sie tun, und wie wichtig es für die jeweils betroffene Allgemeinheit ist, dass ihnen gelingt, was sie sich vornehmen. Zu diesem ersten Gebot objektiver Berichterstattung aus dem Zentrum des Geschehens heraus kommt als nicht minder bedeutendes zweites Gebot das kritische Hinterfragen. Das fängt damit an, dass man auch den jeweils zweitwichtigsten Personen des jeweiligen Stückchens Weltgeschehen das Wort gibt und sie erklären lässt, wie schlecht die aktuell Verantwortlichen ihre Sache machen und um wie viel besser die bei ihnen aufgehoben wäre. Im Widerstreit dieser Meinungen schälen sich die Kriterien heraus, nach denen der Gang der Dinge zu beurteilen ist: das Kriterium des Erfolgs der Macher, des Gelingens ihrer Vorhaben im Allgemeinen sowie dessen Nutzanwendungen auf Einzelfälle.
Diese Pflicht zu überparteilicher Information erledigt, schreitet der verantwortungsbewusste Journalist zu eigenen Lagebeurteilungen. Die betreffen einerseits die ewig junge Frage, ob die Verantwortlichen es mit dem Good Will, den sie ihren Taten attestieren, auch wirklich ernst meinen: Man misst das Tun und Lassen der Macher an deren eigenen Erfolgskriterien. Doch natürlich bleibt es dabei nicht. Journalisten denken sich auch selbständig in die Sachlage hinein, über die sie berichten, nehmen selber den Standpunkt der Sorge um deren Gelingen ein und machen den zum Leitfaden ihrer Berichterstattung. Dabei scheuen sie vor den Widersprüchen nicht zurück, die sich notwendigerweise einstellen, wenn sie die theoretisch betreute Angelegenheit mal in dem einen und mal in dem anderen größeren Zusammenhang begutachten. So lässt sich beispielsweise ein Streik – sofern er nicht überhaupt verboten ist und insgesamt als ordnungsfeindlicher Übergriff verworfen werden muss – danach beurteilen, ob er seinen Veranstaltern gelingt, ob die Mobilisierung klappt, ob die Stimmung stimmt usw.; daneben – die Aufteilung einer seriösen Zeitung in verschiedene „Bücher“ tut hier gute Dienste, es geht aber auch in ein und demselben Artikel – kommt dann die Einschätzung zu ihrem Recht, ob und wie sehr derselbe Streik die Branche schädigt, deren Erfolg insoweit als Urteilskriterium dient; das Ergebnis muss sich dann noch nicht einmal mit der Beantwortung der nächsten sorgenvollen Frage decken, welchen Schaden womöglich der nationale Wirtschaftsstandort erleidet oder, noch ein anderer Gesichtspunkt, der soziale Frieden im Land. Oder, anderes Beispiel: Es gibt von einem weltpolitisch wichtigen Rüstungsprojekt einer Nation wie Iran zu erzählen. Da wird erst quasi stellvertretend für das dortige Kriegsministerium die Frage beantwortet, wie es um die Erfolgsaussichten des Vorhabens steht, ob es fürs nationale Militär zweckmäßig und für die nationalen Finanzen verkraftbar ist; als nächstes erfolgt die Prüfung, was daraus für die von verschiedenen Mächten beschworene Stabilität der Region folgt; dann wird die Affäre aus noch höherer Warte in ein vorgestelltes oder aus Washington übernommenes Gesamtkonzept globaler Sicherheit eingeordnet und sorgenvoll gefragt, wie es um dessen Erfolgsaussichten steht – wobei in solchen Fälle freilich nicht selten die Kunstfertigkeit zu bewundern ist, mit der ein Bericht seinen übergeordneten Standpunkt auf die immanente Beurteilung des Unternehmens abfärben lässt, nach dem Motto: Was fürs ganz große Ganze dysfunktional bis schädlich ist, kann auch für sich genommen nicht richtig gelungen sein… Das gleiche Muster kommt in der etwas kleineren Welt etwa des öffentlichen Nahverkehrs zur Anwendung oder in Berichten aus der Fußball-Liga, die dasselbe Geschehen nacheinander als die Sache eines einzelnen Vereins, als Frage der Spannung im Gesamtwettbewerb, vom Standpunkt der Nationalmannschaft und als Sorgenfall des Spielermarkts behandeln.
In der Auswahl ihres Standpunkts, des „Rahmens“, innerhalb dessen sie Erfolg oder Misslingen einer Sache diagnostizieren, sind Journalisten im Prinzip frei. Wie von selbst bleiben sie mit dem „Wir“, in dessen Namen sie das Weltgeschehen betrachten und um dessen gemeinsame Sache sie sich kümmern, jedoch regelmäßig an jenem größten Ganzen hängen, das für sie und ihr Publikum praktisch verbindlich ist. In letzter Instanz reimen sie alles auf die „Sache“, nämlich den Erfolg ihrer Nation: des Volkes, als dessen öffentliches Wahrnehmungsorgan und Urteilsvermögen sie sich begreifen, und des Staatswesens, als dessen „4. Gewalt“ sie Anerkennung finden wollen – nicht zuletzt in Form von Auflage und Absatzzahlen. Am liebsten stellen sie sich gleich wie allzuständige Regierungssprecher auf, achten dabei aber sehr auf kritische Distanz zu den Verlautbarungen der wirklichen Machthaber, denen sie in ihrer Berichterstattung ja schon den gehörigen Platz einräumen. Mal erlauben sie sich einen kritischen Idealismus, konfrontieren das große und kleinere Weltgeschehen mit moralisch hochstehenden Vorstellungen von einer heilen Volks- und Völkergemeinschaft und vermissen Schritte zur Einlösung einschlägiger Verheißungen, niedergelegt etwa in der UNO-Charta oder der Präambel eines Regierungsprogramms. Dann geben sie wieder dem Standpunkt des kritischen Realismus den Vorzug, geißeln jedes Stück Sozialpolitik als unsinnige Geldverschwendung und benutzen den Ausdruck „Weltverbesserung“ als Schimpfwort. Den Rahmen des allgemein Akzeptierten, des national Üblichen, der staatsbürgerlichen Sittlichkeit verlässt ein verantwortungsvoller Journalismus dabei so gut wie nie; Verstöße dagegen muss er umgekehrt oft genug den wirklich Verantwortlichen, aber auch den Regierten zum Vorwurf machen. Anbiederung an die Regierenden ist seine Sache nicht; dazu sind Journalisten zu sehr Anwälte des Volkes. Populismus ist ihnen genauso fremd; dazu liegt ihnen eine funktionierende Staatsgewalt zu sehr am Herzen. Von Opportunismus findet sich im journalistischen Ethos insofern keine Spur.
Mit ihrem Einsatz weiß die Gilde der Meinungsmacher sich in einer doppelten Pflicht, die sie gerne in einem Aufwasch erledigt. Auf der einen Seite will sie dem Volk die Welt erklären, den Betroffenen die Maßstäbe vermitteln, nach denen sie gerechterweise zu beurteilen haben, wie ihnen mitgespielt wird; deswegen stellen sie dem Publikum die Probleme vor, an denen ihr Gemeinwesen laboriert und an deren Bewältigung die Politik – Staat, Wirtschaft, Vereinspräsidenten… – sich abmüht, und werben um Verständnis für alles, wofür sie selbst Verständnis haben. Auf der anderen Seite liegt einem freien Journalismus daran, allen Verantwortlichen auf die Finger zu schauen, Warnungen entgegenzuschleudern, Mahnungen mit auf den Weg zu geben, auch schon mal Ermunterung zuteil werden zu lassen und insgesamt klar zu machen, dass sie ihre Sache erfolgreich zu machen haben, weil sie deren gutes Gelingen keinem Geringeren als ihrem guten Volk schulden. In dessen Namen monieren Journalisten Defizite in der Tätigkeit wie in der Selbstdarstellung der Machthaber und der gesellschaftlichen Prominenz überhaupt; sie lassen durchblicken oder geben auch direkt Tipps, wie beides, das Engagement der Maßgeblichen für ihre Aufgabe wie für ihr Image, zu verbessern wäre, und erteilen Tag für Tag Zensuren. Damit wirken sie natürlich geschmacks- und urteilsbildend auf das Publikum zurück, in dessen Namen sie den wichtigen Leuten den Spiegel vorhalten. Das darf sich nicht bloß als ideeller Schiedsrichter in allen Weltaffären vorkommen, sondern als mitdenkender Ratgeber der Macher gut vertreten fühlen.
So stiftet guter Journalismus die Einheit des Nationalismus von oben mit dem Nationalismus von unten und umgekehrt.