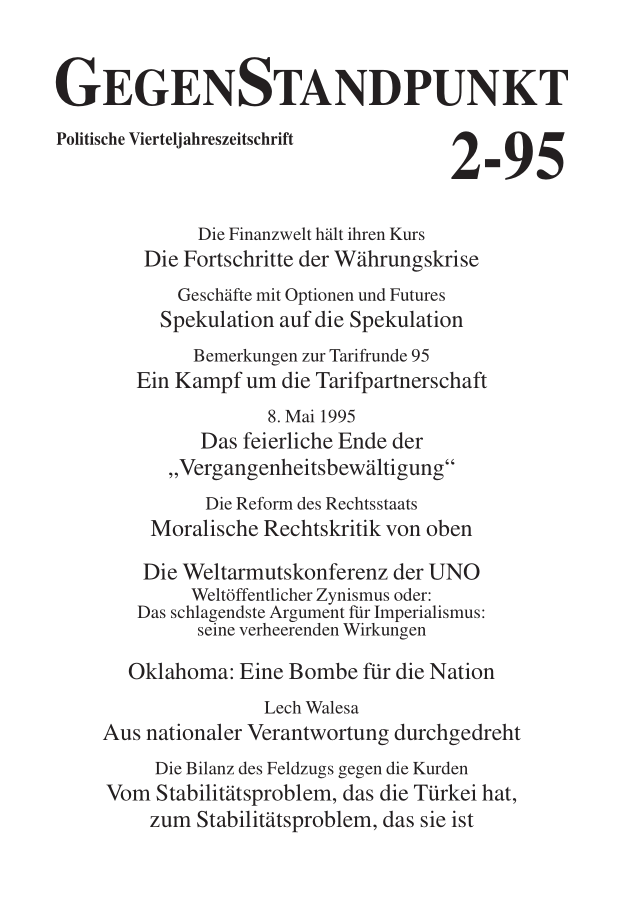Die Weltarmutskonferenz der UNO
Weltöffentlicher Zynismus
oder:
Das schlagendste Argument für Imperialismus: seine verheerenden Wirkungen
Die weltweite Armut als imperialistischer Betreuungsfall: Armutsdiagnosen und Therapievorschläge – und ein Streit zwischen den verantwortlichen Mächten weltweiter Armutsbetreuung und ihren Objekten: EU und AKP-Staaten.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Die Weltarmutskonferenz der UNO
Weltöffentlicher Zynismus oder:
Das schlagendste Argument für Imperialismus: seine verheerenden Wirkungen
Beinahe zeitgleich gingen im Frühjahr zwei Konferenzen über die weltpolitische Bühne, die sich mit dem weltweiten Elend befaßten. Im März gelobten Staatschefs aus mehr als 170 Ländern in Kopenhagen einmütig, „alles in unseren Kräften stehende für die weltweite Bekämpfung und Abschaffung der Armut zu tun“. Kurz vorher verhandelten die Finanzminister der EU in Brüssel anläßlich der Halbzeitrevision des Lomé IV-Abkommens über die Kürzung der EU-Haushaltsposten für die sog. Entwicklungsländer und gerieten sich in die Wolle, wo am meisten gespart werden soll. Wie paßt das zusammen?
1. Die weltweit geschaffene Armut – ein imperialistischer Betreuungsfall und sonst nichts
Erstmalig in ihrer Geschichte hat die Staatengemeinschaft der Armut eine offizielle Konferenz gewidmet. Das bezeichnen viele als einen ersten Erfolg. Skeptiker dagegen bemängeln die Unverbindlichkeit des Weltsozialgipfels. Darüber übersehen beide, worauf sich in Kopenhagen, durchaus verbindlich, verständigt wurde: Auf die Hunger- und Armutsmoral einer kapitalistischen Weltwirtschaft, die sich zu ihren Verlierern bekennt.
Was Beobachter als erstaunlich „unideologisiertes“ Tagungsklima erlebten, dokumentiert der Sache nach nämlich Einhelligkeit in drei grundsätzlichen Punkten. Vom Vizepräsidenten der USA und deutschen Arbeitsminister über den afrikanischen Diktator bis zu den islamischen Fundamentalisten waren sich die versammelten Staatsoberhäupter und Experten einig
- über die
sozialen Zustände
in der3. Welt
. Ungeschminkt referierten sie den Stand der Dinge und bewiesen dabei einen bemerkenswert solidarischen Unwillen, zwischen der „sozialen Lage“ von Nationen und dem massenhaften Elend ihrer Insassen zu unterscheiden. Unter dem Firmenschild „Armut“ wurde neben der wachsenden Not der Leute, die das Pech haben, in diesen Landstrichen zu leben, nämlich noch ganz andere Phänomene verbucht: niedrigere Erträge der Drittweltstaaten aus dem Verkauf von Rohstoffen und Agrarprodukten, entsprechend geringerer Devisenerlös, sinkende Importe, steigende Staatsverschuldung bei ständig fallendem Anteil am internationalen Handel sowie spärlicher fließende Entwicklungsgelder . Das ist die „erfreulich unideologische Bestandsaufnahme“ nach dem Sieg des Kapitalismus über den Kommunismus: Das ökonomische Desaster in den Verlierernationen des Weltmarkts nimmt zu; Leidtragende sind die Herrschaften vor Ort; und als ein Beleg dafür firmieren die Hungertoten in der Peripherie, aber auch die ausgemusterten Paupers in den Metropolen der Marktwirtschaft. Sie sind eine im Grunde marginale Fußnote, die allerdings ausgiebig betränt wird; denn dieses Elend ist für manche Klarstellung gut. - darüber, daß an diesem Zustand nichts zu ändern ist. Die feierliche Deklaration eines Teils der Staatenwelt und Erdbevölkerung zum
Sozialfall
zeigt, daß man sich auf die Unbrauchbarkeit ganzer Landstriche, die Überflüssigkeit ganzer Völker, die Unhaltbarkeit ganzer Staaten eingestellt hat und mit einer keinesfalls sinkenden Zahl solcher Dauerfälle rechnet. Damit bekennen die reichen Nationen der Ersten Welt bzw. bekräftigen ihre längst feststehende politische Leitlinie, daß sie entgegen früheren Behauptungen für die „Entwicklung“ der Armen-Schlucker-Staaten zu ökonomisch konkurrenzfähigen Gebilden nichts tun können bzw. wollen. Als endgültige Verlierer des Weltmarkts kümmert man sich um sie; das haben sie verdient, alles andere aber wäre abwegig, unnütz, ja schädlich. - darüber, daß es an der Ursache dieses Zustands, dem System der Marktwirtschaft, nichts zu rütteln gibt. Ohne Furcht vor Tautologien empfahlen die Delegierten des Sozialgipfels den Ländern der Dritten Welt ihr „Rezept“ zur „Behebung der Armut“: Wachstum! Nicht die Eingliederung der früheren Kolonien in einen Weltmarkt, auf dem das Kapital ihrer ehemaligen Mutterländer akkumuliert; nicht die vollständige Zurichtung ihrer Produktion für die Märkte und Warenbörsen der freien Welt, nicht der immerzu vorab zu ihren Ungunsten entschiedene Vergleich mit den kapitalistischen Nationalökonomien auswärts: mit dem Geld, mit Kapitalgrößen und Gewinnspannen der Zentren der Weltwirtschaft sollen dafür gesorgt haben, daß die beschworene und erhoffte „Entwicklung“ nie stattgefunden hat, sondern zu wenig Engagement für ein in $, DM oder Franc bemessenes Wirtschaftswachstum. Staudammruinen in Mozambik, Pestepidemien in Indien, Währungskrisen in Mexiko belegen nach dieser Logik nur eines:
Strukturelle Mängel
– eine Metapher, die sich erst recht nach dem Abgang des Realen Sozialismus umstandslos als Defizit anMarktwirtschaft
buchstabiert. Die Ursachenforschung der verantwortlichen Subjekte der Ersten Welt stellt klar, wie mit der Dritten nach dem Wegfall der Zweiten verfahren werden soll: Weiter voran auf exakt dem Weg, der nicht wenige dieser Länder an den Rand des Ruins gebracht hat: Ihr Heil sollen sie ganz in der funktionellen Rolle für die Reichtumsvermehrung anderswo suchen. Auch und gerade wenn Erträge sich weder einstellen noch in Aussicht gestellt werden: Kein Staat wird wegen Bankrott aus dem Weltmarkt entlassen. Das ist der Totalitarismus des Weltmarkts, den seine Nutznießer und staatlichen Macher gegenüber dem Rest der Welt vertreten.
Armut – ein Thema für Staatsmänner
Vorstellungen, gar Forderungen, der Gipfel müsse etwas gegen die Armut unternehmen, wurden darum von vornherein ins Reich gefährlicher Phantasien verwiesen. Die Frage, was die versammelten Staaten dann womöglich für die Herstellung der Armut tun, sollte aber auch niemand stellen.[1] Stattdessen sollte man unbeschadet aller demonstrativen Absagen den guten Willen der Staatsführer, insbesondere der Macherstaaten, die in der UNO das Sagen haben, würdigen. In diesem Sinne erließ Juan Somavia, „Erfinder“ des Weltsozialgipfels und nach übereinstimmenden Presseberichten ein herzensguter Mensch, eine dankenswerte Richtigstellung:
„Wer den Sozialgipfel an Zahlen mißt, hat ihn nicht verstanden. Das Besondere des Weltsozialgipfels ist das hohe Niveau, auf dem die soziale Frage behandelt wird. Staatschefs haben noch nie gesagt: ‚Wir schaffen Armut ab‘. Die Verpflichtung dazu ist etwa so viel wert, wie Anfang dieses Jahrhunderts das Versprechen ‚Bildung für alle‘. Man kann Armut nicht durch Gesetze abschaffen. Der Gipfel ist ein erster Schritt, um eine gemeinsame Sprache zu finden.“
Was hier wie eine abgeklärt-realistische Erkenntnis daher kommt – wir wissen doch, daß Staatsmänner keine Retter von Witwen und Waisen sind, wir wissen doch, daß Staatsmänner mit der Bekämpfung von Armut nichts am Hut haben! –, ist in Wahrheit eine einzige Immunisierung gegen Kritik. Das „Niveau“, auf dem die Delegierten des Sozialgipfels – durch die Bank sog. „Verantwortungsträger“ – diskutieren, haben sie vorsorglich so „hoch“ gehängt, daß ihr Geschäft gleich gar nicht mehr erreichbar ist: Weil Staatschefs noch nie versprochen haben, Armut abzuschaffen, darf man sie daran auch nicht messen; weil Gesetze
noch nie dazu da waren, Armut abzuschaffen, ist sie gar nicht abzuschaffen.[2] So streichen sie jetzt propagandistisch ihre Propaganda von früher, es ginge um „Entwicklung“ und die mit ihr einhergehende Beseitigung der „Kluft zwischen reichen und armen Ländern“: Das sei ein unhaltbares Versprechen, das sie deswegen auch nie so abgegeben hätten; bzw. wenn, dann sei das eben der Fehler gewesen.
Mit dieser schäbigen Logik war die Leitlinie der Konferenz festgelegt. Die „erfreuliche“ Botschaft – 170 Staaten haben sich des Armutsproblems angenommen! – transportiert sogleich die Auskunft: Dagegen ist kein Kraut gewachsen. Die Zuständigen des freien Weltmarktes machen das Produkt ihres eigenen Wirkens zum Thema; bezüglich der Behebung der unschönen Folgen jedoch plädieren sie auf: Nicht zuständig! Zur Verständigung auf dieses Motto benötigten Gewinner wie Verlierer der Weltwirtschaft – Amerikaner, Japaner, Hutus, die in Kopenhagen eine „gemeinsame Sprache“ fanden – nicht einmal einen Simultandolmetscher: Ein anderes Wort als „Marktwirtschaft“ kennen sie nicht; zu deren Weltgeltung gibt es keine Alternative.[3]
Armuts-Diagnosen und Therapieempfehlungen
zeigen, wie unbeeindruckt die Hüter der Weltwirtschaft der beschworenen „Zeitbombe von Tod, Armut und Überbevölkerung“[4] tatsächlich gegenüberstehen.
Zunächst brachte der amerikanische Vizepräsident Al Gore in seiner „vielbeachteten Rede“ die Dialektik von Ursachenforschung, moralischer Anklage und Freispruch des Systems auf den Punkt:
„Statistiken bluten nicht. Zahlen erfassen nicht die Pein obdachloser Kinder, nicht den Schmerz von Eltern, deren Kind in Ruanda verhungert. Sie erfassen auch nicht die düstere Verzweiflung der obdachlosen Frau, die zusammengerollt über einem Lüftungsschacht in Washington, nur ein paar Häuserblocks vom Weißen Haus entfernt, schläft.“
Gerade das letzte Beispiel ist genial gewählt. Diese Nähe der mittellosen Pennerin zum Weißen Haus, dem Zentrum der Macht und Hort des Wohlstands, das gibt zu denken. Bloß was?!
„Das alles sind persönliche Tragödien, aber jede von ihnen ist zum Teil auf unser Versagen als menschliche Familie zurückzuführen.“
Gores familiäre Menschheitsmoral ist typisch. Fein säuberlich wird die Armut in zwei Hälften zerlegt, fertig ist die Perspektive, durch die ein moderner Weltbürger die „Schattenseite“ der Klassengesellschaft und der internationalen Konkurrenz betrachtet: Armut ist schlimm, Armut ist Schicksal, an dessen Eintreten alle möglichen Umstände, Wechselfälle und wer weiß was alles schuld sind und an dem die armen Betroffenen als brave, hilflose Opfer schwer zu tragen haben. Für die andere Hälfte aber, für das Kümmern um die Armen, übernehmen „wir“ die Verantwortung, das fiktive Subjekt „Menschheit“, das Politiker immer im Munde führen, wenn sie ihre Zuständigkeit für die Welt, für deren Zustand sie sich zugleich nicht verantwortlich erklären, herausstreichen wollen. Da machen „wir“ keine Unterschiede. Denn „wir“ haben versagt. Vielleicht haben wir die Obdachlosen und die Slumkinder zu wenig „wahrgenommen“, ihnen zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt und zu wenig „Problembewußtsein“ spendiert. Dafür verdienen die Hungernden unser aller Mitgefühl. Und das wiegt offenkundig umso schwerer, wenn es aus dem Munde eines Mannes kommt, der bekanntlich fürs Regieren, für weltweite Militäraktionen, für Amerikas Weltaufsichtsmacht, für Dollars und Irak-Sanktionen, kurz: fürs Weltordnen zuständig ist, nicht aber für Mildtätigkeit gegenüber den Opfern…
Der zweite Mann der USA bringt die politische Moral des Mitleids auf ihren zynischen Begriff. In ihrer Eigenschaft als Arme leiden wir im Geiste mit ihnen; dies schließt materielle Leistungen, die auf eine Änderung ihrer Lage berechnet wären, ebenso aus wie den Wortsinn von im Geiste
ein. So, wiederum im wahrsten Sinne des Wortes, fertig sind die kapitalistischen Führungsmächte mit den von ihnen produzierten Zuständen in der „3. Welt“[5], daß sie ihr praktiziertes Desinteresse, diesen Ländern aus dem ökonomischen Schlamassel zu helfen, in das sie 30 Jahre Maßnehmen am Weltmarkt geritten hat, wie eine Erkenntnis verkaufen, deren Befolgung sie denen da unten einfach schuldig sind: Mitgefühl eimerweise, praktische Abhilfe nein! Und diese Botschaft richten die Staatsvertreter der „reichen Nationen“ an die Staatsvertreter der „armen Nationen“, erteilen also denen damit eine Auskunft: Sie geben weltöffentlich zu Protokoll, daß sie deren elendes Staatsinventar nicht mehr als Anspruchstitel dieser Staaten auf ihre politische und finanzielle Unterstützung anerkennen. Schließlich sind es lauter diplomatische Botschaften, die hier ins Gewand menschlicher Betroffenheit gekleidet daherkommen. Und da steht von vornherein fest: Mitleid ist nicht die Bekundung von Handlungsbedarf, sondern von Nichtbetroffenheit: Machtfragen, wesentliche Staatsinteressen stehen nicht auf dem Spiel.
Also präsentierten die versammelten Experten des Westens ihren politischen Willen – die Betreuung der Looser der Weltwirtschaftsordnung soll weniger kosten – als Aha-Effekt aus drei Dekaden Entwicklung
: Auf keinen Fall dürfen „die Reichen“ „den Armen“ ihre Hilfe aufzwingen, sie schon gar nicht mit Geld behelligen. Zum weltöffentlichen Beweis, wie richtig sie damit liegen, bemühte der Sozialgipfel folgende süße Logik: Weil die erfolgreichen Nationen des Weltmarktes es für fragwürdig befunden haben, diese Länder wie bisher politisch und ökonomisch brauchbar zuzurichten und zu erhalten, nennen sie ihre Unterstützung von gestern heute „Aushalten“. Und schon redet Massa Spranger von der CSU, als habe er einen Sprachkurs an der Waldorf-Schule belegt: Der farbige Erdenmensch muß „Subjekt“ werden! Bevor wir den Neger satt und zufrieden machen, muß er sich schon selber helfen (wollen); am mangelnden Willen, nicht an fehlenden Mitteln liegt es doch, ihr Elend; und dieser Wille, nicht mehr zu hungern, wird durch Gelder aus dem Norden doch nicht gefördert, sondern untergraben:
„Beteiligung und Selbsthilfe bilden für mich die Kernelemente der Armutsbekämpfung. Menschen müssen eine Verbesserung ihrer Lebenssituation erst einmal selber wollen. Sie müssen Handelnde und nicht Objekte der Entwicklung sein“ (Regierungs-Bulletin, 15.3.95)
Weil die „Entwicklungspolitiker“ die paar Schulen und Krankenhäuser für Neger, die sie finanziert haben, heute für überflüssigen Luxus halten, stellen sie plötzlich die Frage, ob Lesenlernen und Impfen die Schwarzen vor dem Verhungern bewahrt hat. Dafür waren Missionarsschulen und Urwaldkliniken zwar nie da[6], dennoch lautet der Befund: Zweck verfehlt! Also – so der messerscharfe Schluß, wegen dem das Beweisverfahren überhaupt angestrengt wird – braucht man sie auch nicht mehr so viel zu unterrichten und zu impfen! Und schon beschleicht einen deutschen Professor
„der polemische Verdacht, daß die katastrophale Entwicklung der 3. Welt sich nicht trotz, sondern wegen der seit Jahrzehnten betriebenen Entwicklungshilfe eingestellt hat.“ (Dr. A. Schuller, Welt am Sonntag)
Was früher nur Marxisten sagten, ihnen aber keiner glaubte – Zweck der „Entwicklungshilfe“ ist nicht, Menschen in der Dritten Welt wenigstens ein bißchen Wohlstand und die Aussicht auf Verbesserung ihrer Lebensverhältnisse oder auch nur den einschlägigen Staaten ein halbwegs geordnetes Innenleben zu bescheren; also belegt das nie verschwundene und neu auftretende Elend der Bevölkerung auch kein Versagen von „Entwicklungspolitik“, sondern ist deren notwendiges Resultat –, das wird heute von offizieller Seite als ehrliche, realistische Auskunft verkündet, um die Einsicht zu verbreiten, daß den Armen mit materiellen Gütern gar nicht geholfen werden kann. Die geltenden politischen Berechnungen beim Kreditieren und Beaufsichtigen der Armenhäuser des Globus werden als negative Sachzwänge vorstellig gemacht: Es nutzt nichts. Ergo: Bleiben lassen![7] – Ein globales Fürsorgeobjekt namens Armut auszurufen, dessen Betreuung kein Geld kosten darf: Diesen Kunstgriff hat die Kopenhagener Konferenz amtlich gemacht.
Das Rezept, das die maßgeblichen Nationen der Weltöffentlichkeit in die Notizblöcke diktierten, paßte zu dieser Diagnose:
„Es besteht heute weltweites Einverständnis, daß wirtschaftliches Wachstum die notwendige Bedingung für die Armutsminderung ist.“ (Bulletin)
Damit ist nicht gemeint, daß man alles dafür zu tun verspricht, daß die Staaten, die es mit ihrer Einbeziehung in den Weltmarkt zu einem nationalen Wachstum nicht gebracht haben, sondern mit ihren Rohstoffen und Naturprodukten das Wachstum woanders beflügeln, durch Beherzigung dieses weisen Ratschlages doch noch irgendeinen „Anteil“ am „Kuchen“ ergattern könnten und daß sie dabei von Seiten der Weltmarktgewinner Unterstützung erfahren sollen. Diese Lesart wandert ja mit der Absage an einen „falschen Entwicklungsidealismus“ gerade auf den Misthaufen der Geschichte im Zeitalter des Ost-West-Gegensatzes. Das „Rezept“ besteht in dem schlichten Verlangen, sich zur Alternativlosigkeit des marktwirtschaftlichen Systems zu bekennen; beharrt wird darauf, daß die Ergebnisse des Weltmarkts nach den Regeln des Kapitalismus in Ordnung gehen; das Resultat des Wettbewerbs ist in jedem Fall unwiderruflich und unumkehrbar; also sind staatliche „Korrekturen“ an diesen Ergebnissen bloß verfälschend und sinnlos.[8] Spiegelbildlich geben die überlegenen Nationen mit der monotonen Floskel „Ein Patentrezept zur Bekämpfung der Armut gibt es nicht“ (Spranger) unmißverständlich zu Protokoll, daß sie für Staatsbankrotte und Hungerepidemien, also für die todsicher eintretenden Ergebnisse der Weltmarktkonkurrenz, keineswegs haftbar gemacht werden können. Sollte sich die notwendige Bedingung – kümmert Euch um Wachstum! – als nicht hinreichend erweisen, haben wir jedenfalls unser Bestes gegeben.
„Nur wo Freiheit herrscht, ist wahrer sozialer Fortschritt möglich!“ (Kohl auf der Armutskonferenz)
Unter diesem Schlachtruf wurde in Kopenhagen die gewöhnliche Moral des Elends – wir alle tragen „Verantwortung“, geben am „Tag für Afrika“ eine Runde Hirsebrei aus und sorgen uns mit der Caritas um die Hungernden dieser Welt! – endgültig in einen Rechtstitel für imperialistische Einmischung überführt.
Ausbeutung in den Armenregionen – ein untragbarer Wettbewerbsvorteil
So fanden sich in Dänemark interessanterweise ausgerechnet diejenigen Länder auf der Anklagebank wieder, von denen wohlmeinende Gemüter denken könnten, es handle sich um die Unterprivilegierten des Weltmarktes: Indien, Pakistan, Brasilien, Nepal… Ein häßliches Wort machte die Runde: Sozialdumping. Da wurden Leute wie Blüm, die ansonsten jeden Azubi am liebsten um 3 Uhr früh in der Backstube sehen, urplötzlich zum Kämpfer gegen Kinderarbeit und Ausbeutung:
„Produkte, die mit dem gesundheitlichen Ruin von Kindern oder gar mit dem Tod der Kinder verbunden sind, dürfen keine Kunden finden. Morden kann man mit dem Beil. Morden kann man aber auch mit Ausbeutung.“
Mit dem Vorwurf „Sozialdumping“ bringt der Arbeitsminister, Brecht zitierend, den Moralismus der Weltarmutskonferenz auf seinen harten nationalistischen Kern. Waren aus Ländern, die sich durch besonders extensiven und billigen Einsatz von Arbeitskraft auszeichnen, dürfen auf dem Weltmarkt eigentlich keinen Abnehmer bzw. keinen freien Marktzugang finden. Wo die Grenze zwischen zumutbaren und unzumutbaren Arbeitsbedingungen verläuft, ist kein Geheimnis: Per definitionem fängt Ausbeutung da an, wo der „hohe Sozialstandard“, der dem Standort Deutschland lieb und (zu) teuer ist, aufhört. Indische Mädchen knüpfen Teppiche für zwei Pfennige am Tag, brasilianische Jungs vegetieren in Eisenerzminen – was fällt uns da ein? Die wollen uns, die wir solche Barbareien nicht nötig haben, mit Dumpinglöhnern doch glatt den Markt kaputtmachen! Ohne jeden falsch verstandenen Humanismus werden die Ausbeutungspraktiken in den Ländern, die über ein konkurrenzlos billiges Heer von „Beschäftigungswilligen“, aber sonst nichts verfügen und diesen einzigen Standortvorteil dem internationalen Kapital zur Benutzung anbieten, als unerlaubte Wettbewerbsverzerrung gegenüber den zivilisierten Nationen angeprangert, die sich solche Rücksichtslosigkeit versagen, weil in ihnen die Lohnarbeiterin mit Arbeitsschutzbestimmung und Sozialversicherung verschlissen wird und Kinderarbeit erst mit 14 beginnt. Vom Standpunkt des Standorts Deutschland aus, der ein Recht auf Markterfolg, nationale Kapitalvermehrung und erfolgreiche Benutzung deutscher Arbeitskräfte hat, kann Blüm dann sogar mal das erfolgreiche Wirken auch deutscher Unternehmen in aller Welt unter ‚rücksichtslose Ausbeutungspraktiken internationaler Geschäftemacher‘ einordnen – um die auswärtigen Standortverwalter des unlauteren Wettbewerbs zu bezichtigen.[9]
So zynisch der Einwand, so angemessen ist er dem Gegenstand, den die Zuständigen für Wirtschaft und Soziales unter diesem Stichwort verhandeln. Mit der Anklage „Sozialdumping“ beharren kapitalistisch potente Hartwährungsländer und Welthandelsnationen auf dem Standpunkt, daß die ihnen unterlegenen Staaten sich mit den eingerissenen Kräfteverhältnissen abzufinden haben. Den „Ausweg“, sich im Vergleich der Weltmarktstandards in Sachen Kapitalgröße und -produktivität auf das einzige Mittel zu verlegen, das diesen Standorten überhaupt zur Verfügung steht, die Senkung des Kostpreises durch billige Lohnsklaven, Frauen und Kinder, will man diesen Ländern nicht zugestehen. So bestehen die Garantiemächte und Profiteure des Weltmarktes im Namen und vor den Augen der Völkergemeinschaft auf der Moral, daß so etwas gegen die Menschenwürde verstößt und eigentlich – von wem wohl? – „verboten“ (Blüm) gehört.[10]
Das öffentliche Echo: Vertrauensvolle Skepsis
Die Botschaft, die die berufenen Armutsverwalter von ihrem Sozialgipfel in die Welt hinausfunkten – wir kümmern uns um das Problem! – ist von der Öffentlichkeit auf der richtigen Frequenz empfangen worden. Zwar beherrschte lauthals geäußerter Zweifel die Szenerie in Presse, Funk und Fernsehen, ob die Antworten, die die Staatsmänner auf das „Armutsproblem“ gegeben haben, „das Papier wert waren, auf das sie gedruckt wurden“. Doch entpuppte sich dieser Zweifel sehr schnell als Zutrauen in die schwierige Aufgabe, der die Regierenden sich – immerhin – gestellt hätten. Schließlich hat kein Leitartikler, der den Sozialgipfel als großangelegten „Flop“ kritisierte, je geargwöhnt, daß die Staatsmänner gar keine Antworten auf die Armut schuldig geblieben sind, sondern das „Problem“ selber gestellt haben.
So ähnelte die Debatte um die Deutung der Armutskonferenz nicht zufällig dem Streit zwischen dem Optimisten und dem Pessimisten, ob das Glas halb voll oder halb leer ist.[11] Die einen strapazierten gnadenlos den semantischen Gehalt des bedeutungsschweren Wörtchens immerhin
und entdeckten folgerichtig einen ersten und darum löblichen „Anfang“; die anderen hielten sich an die spiegelverkehrte Betonung bloß
und bekundeten in ihrer verhaltenen Enttäuschung doch nur, wie letztlich unenttäuschbar das Vertrauen in die vermeintliche Fürsorgepflicht der Regierenden für die Opfer ihrer Wirtschaftsordnung ist. So schieden sich die Geister: in die Vertreter des affirmativen „Realismus“, der dem Gipfel die Auskunft abgelauscht hat, daß man „praktische Erfolge nicht unbedingt erwarten darf, jedenfalls nicht sofort“; und in die Vertreter des unerschütterlichen Glaubens „unsere Verantwortung“, die auf dem verantwortungsvollen Auftrag der „reichen Staaten“, die Armut zu bekämpfen, umso mehr herumreiten, je weniger etwas davon zu erkennen ist.[12]
In diesem Sinne waren hinterher alle einig wie zuvor: Das Kümmern um die Armut gehört in die Hände ihrer Produzenten. Ein Fortschritt ist in dieser Elendsmoral der Neunziger Jahre dennoch unverkennbar: Das nackte Bekenntnis zur Zuständigkeit der Staaten für das „Armutsproblem“ hat jeden Schein von Zweifel und Einwand getilgt; es hat den Charakter eines ein- oder zumindest anklagbaren Versprechens verloren, das „Phänomen“ des Hungers sei so etwas wie eine vorübergehende Erscheinung; der Anspruch, die Gewinner des Weltmarkts für dessen Abschaffung in die Pflicht zu nehmen, ist unwiderruflich abserviert; Klagen über eine einseitige, unfertige, eben noch im Sinne der Armenländer umzugestaltenden Weltmarktverfassung sind kein Thema mehr; und erst recht erledigt ist jeder leiseste Verdacht, die in die Verantwortung für das „Armutsproblem“ Eingesetzten seien dafür nicht gerade die Geeigneten, weil selber Nutznießer dieser „ungerechten Weltordnung“.
2. Die Betreuung der Armenhäuser durch die Zuständigen – weltöffentlich und praktisch
Der Weltsozialgipfel der UNO markiert einen weiteren Meilenstein in Sachen Ende der Entwicklung(sideale). Daß dieser Standpunkt eine eigene Konferenz wert war, zeigt, daß damit keineswegs ein Ende der Zuständigkeit der Weltmächte eingeläutet ist. Wahrgenommen wird diese Zuständigkeit allerdings woanders.
Die allenthalben beklagte Unverbindlichkeit
der Konferenzbeschlüsse steht, der Sache nach, für etwas ganz anderes und weist über die Bedeutung des Sozialgipfels hinaus. Sie belegt zum einen, daß das Interesse der großen Wirtschaftsnationen an der Verwaltung des Staaten-Elends im Rest der Welt noch ein Stück bedingter geworden ist als zuvor. Das liegt daran, daß die zu Zeiten der Ost-West-Konkurrenz zu sichernden „Einflußsphären“ in der „3. Welt“ heute alternativlos eingerichtet und einsortiert sind, umgekehrt aber ihr Nutzen gar nicht mehr überall zu bestimmen ist: teils, weil diverse Landstriche schlicht ausgeplündert sind; teils, weil die Front, für die rund um den Globus um Einfluß gerungen wurde, erfolgreich abgewickelt wurde. Mit dem Ost-West-Gegensatz, der noch dem hinterletzten Fleckchen Erde seinen politischen Daseinszweck einhauchte, erlischt die alte Nutzendefinition der Instandsetzung und Wartung abhängiger Staaten und Regionen, ohne daß automatisch eine neue an ihre Stelle tritt.
Es ist deshalb zum anderen auch nicht so, daß sich die Staatsoberhäupter in Kopenhagen „trotz“ erheblichen Getöses auf „nichts Konkretes“ einigen konnten; vielmehr ist gar nicht abzusehen, warum sie dies hätten tun sollen. Das Verfahren, das „Problem“ der Armut an die UNO zu delegieren, ist der diplomatische Weg, wie die Staaten sich für dessen „Lösung“ unzuständig erklären, also den früher einmal gültigen Gesichtspunkt streichen, es gelte sich um die Stabilität und politische Orientierung solcher Länder zu kümmern, damit sie zuverlässig auf den Westen ausgerichtet blieben oder würden. Wo sie umgekehrt heute Zuständigkeit ausüben möchten, wollen sie diese gerade nicht den Vereinten Nationen überlassen, sondern in eigener nationaler Regie wahrnehmen. Damit „entwerten“ sie die UNO zu einer Konferenzbörse, deren Kompetenz mit der öffentlichen Zurschaustellung imperialistischen Problem-Bewußtseins endet.[13] Als ein Instrument für gemeinsame Aufräumaktionen à la Irak oder Somalia ist die UNO durch die Konkurrenz ihrer führenden Mitglieder ziemlich beschädigt und wird sie inzwischen von den Aufsichtsmächten immer mehr als nicht brauchbar behandelt; überall dort, wo materiell wirklich etwas entschieden werden soll, wo die Konkurrenzinteressen der Nationen auf dem Spiel stehen und damit die Frage, wer die Federführung in der Betreuung anderer Länder und Regionen übernimmt, setzen die Nationen zusehends auf bilaterale Kontakte. Dann sind Dritte nämlich schon mal draußen.
Ein aktueller Parade- und Streitfall imperialistischer Zuständigkeit: Die EU und ihre AKP-Staaten
Der eingangs erwähnte Streit innerhalb der EU aus Anlaß der turnusmäßig fälligen, sog. „Halbzeitrevision“ des vierten Lomé-Abkommens ist in beiderlei Hinsichten einschlägig. Dieser Vertrag, mit dem sich die europäische Gemeinschaft die Anbindung der AKP-Länder an ihren Markt und so manchen exklusiven, preisgünstigen Zugriff auf Eisenerze, Kokosnüsse oder Kaba gestattete, war den vereinten Europäern den bisherigen Aufwand nicht mehr wert:
„Während der jetzt auslaufende siebte Europäische Entwicklungsfond (EEF) gegenüber seinem Vorgänger noch um 45% aufgestockt worden war, müßte die Summe nach Ansicht der EU-Kommission angesichts der Geldentwertung und der Erweiterung der Union um die drei wohlhabenden Länder Schweden, Finnland und Österreich künftig gut 27 Milliarden DM betragen. Deutschland und Großbritannien wollen jedoch erheblich weniger zahlen. Die aus aller Welt angereisten Vertreter der 70 afrikanischen, karibischen und pazifischen Staaten zeigten sich enttäuscht.“ (Frankfurter Rundschau, 17.2.95)
Der Gedanke, daß Preisverfall, Devisenmangel und Schuldenklemme ihrer auf 70 angewachsenen Schar von Mündeln eine massive und rapide Erhöhung der Unterstützung erfordern könnten, war nie Thema. Soweit war Europa d’accord. Der Streit über die Kosten der Förderung zeigt, daß alle sich der Frage nach dem Ertrag stellen: Jedes Entwicklungsdarlehen an die über den ganzen Globus verteilte AKP-„Region“ muß sich daran messen lassen, wie weit es den – fragwürdig gewordenen – Nutzen seiner Geber sichert.
Daß beide Seiten des Widerspruchs in Brüssel als eine Art nationales Rollenspiel mit verteilten Sprechern aufgeführt wurden – der Franzose warb für den Nutzen, der Deutsche und der Engländer übernahmen den Part des Zweiflers –, zeigt zweitens, daß es um mehr geht als ums liebe Geld. Angesichts der Probleme ihrer Schutzbefohlenen, deren Staatshaushalt ja nur aus den ständig sinkenden Rohstoffeinnahmen und aus den EU-Geldern besteht, haben beide Seiten nicht nur die Frage aufgeworfen, was es überhaupt noch bringt, AKP-Staaten „auszuhalten“, also einigermaßen als funktionierende Herrschaft zu erhalten, sondern, was es ihnen bringt. Damit lag der Verdacht auf dem Tisch, für Entwicklungsprojekte und Einflußsphären anderer lediglich mitzuzahlen, ohne selber etwas davon zu haben. Diese Debatte unter den Partnern ist ebenso neu wie prinzipienreiterisch. Bisher waren die EU-Verhandlungsführer sich einig und sicher, daß Lomé I bis IV einen zwar nicht unbedingt gleichen, dennoch gemeinsamen Nutzen stiftet; die traditionelle politische Chefrolle Frankreichs in Afrika hat Deutsche und Briten nie ernsthaft gestört. Sie wollen diese auch heute nicht ernsthaft übernehmen; nur eins wollen sie nicht mehr: französische „Abenteuer“ in Afrika mitfinanzieren, also mit „ihren“ EU-Geldern den Einfluß Frankreichs in irgendeinem Land finanzieren, egal wofür der gut sein mag. In Form einer allgemeinen Nützlichkeitserwägung werfen sie ihren nationalen Vorbehalt in den Ring:
„Die neue Haltung Londons und Bonns offenbart einen radikalen Kurswechsel gegenüber der multilateralen, gemeinschaftlichen Entwicklungshilfe. Sie gilt als ineffizient und überholt. Sie liege auch nicht mehr im nationalen Interesse, heißt es“ (Süddeutsche Zeitung, 17.2.95)
Auch
ist gut! Weil nicht im nationalen Interesse, deshalb überholt und ineffizient, muß es wohl heißen. Doch Frankreich beherrscht die Kunst der Diplomatensprache – jeden Egoismus in einen höheren Titel zu verpacken – genauso und appelliert im Namen des weltweiten Engagements der Union an die Partner, sein Afrika nicht fallen zu lassen:
„Angesichts kürzlich beschlossener EU-Hilfsprogramme für Staaten Mittel- und Osteuropas, Lateinamerikas und Asiens warnt Frankreich davor, die traditionelle Solidarität der Gemeinschaft zum AKP-Raum zur Disposition zu stellen. Ein ‚Rückzug aus Afrika‘ werde zudem die Bemühungen beeinträchtigen, bei den Entwicklungspartnern auf die Einhaltung von Menschenrechten zu dringen“ (Handelsblatt, 6.2.95).
Warnen die Franzosen ihre europäischen Freunde vor einem Verlust an gemeinsamen Einmischungsrechten und -titeln, für die bisher sie im Tschad, in Ruanda und anderswo geradestanden, kommt postwendend das Echo: Das ist es ja gerade, was uns stört.
„Der EEF war von vornherein als Werkzeug für Frankreichs nachkoloniale Afrika-Politik konzipiert. Die EU-Entwicklungshilfe fließt zu knapp 60% nach Schwarzafrika, für das Paris sich im besonderen verantwortlich fühlt.“ (SZ, 17.2.95)
Kaum zu überhören, wofür die Entlarvung des Fonds européen de dévelopement als Tarnorganisation französischer Machtpolitik, wofür das bissige Aufrechnen für Europa „wichtiger“ Regionen, wofür die Grundsatzfrage nach dem „Sinn multilateraler Kooperation“ stehen: Jede europäische Führungsmacht versucht, die andere auf eine gemeinsame Regionalpolitik zu verpflichten, die den je eigenen wirtschaftlichen bzw. geostrategischen Ambitionen und Vorzugsprojekten entspricht. Die Deutschen zielen vorrangig auf Mittel- und Osteuropa; die Franzosen auf Nord- und Schwarzafrika. Für diese nationalen Vorzugsprojekte soll die EU zum Hebel gemacht, daran sollen die Partner finanziell beteiligt werden – als Zahler, nicht als Nutznießer, versteht sich.[14] Mit diesen gegensätzlichen Instrumentalisierungsansprüchen ist zugleich die Frage nach der Haltbarkeit der EU gestellt:
„Französische Diplomaten kritisieren, die Bundesregierung beabsichtige das bisherige ‚Grundverständnis‘ zwischen Bonn und Paris aufzukündigen.“ (HB 6.2.95)
Da haben sie irgendwie schon recht. Mit der sturen Beteuerung, Deutschland habe kein Geld für die AKP-Gruppe, weil deutsche Kredite für Osteuropaprojekte vorgesehen seien, stellt Waigel Frankreich ja vor die harte Alternative: Entweder die Franzosen akzeptieren die gegen ihre Interessen gerichtete deutsche Verlagerung der Prioritätenliste für Europa oder sie lassen den ganzen Fonds platzen, auf den es ihnen insbesondere ankommt. Wie man hört, ist die Sache noch nicht entschieden. Daß der Streit überhaupt stattfindet, hat aber bereits etwas entschieden:
Das neue Betreuungsprinzip: Zuständig aber uneins
Wenn im europäischen Block bei jeder Investition in Drittstaaten eine Debatte anhebt, ob der gemeinsame Topf keine Zweckentfremdung zugunsten nationaler Nutznießerschaft darstellt; wenn bei der Weltbank eingezahlte $-Milliarden ungenutzt herumliegen, weil sich ihre Mitglieder auf keinen „passenden“ Empfänger einigen können; wenn also bei jeder multilateralen Beziehung die interessierte Frage nach der Monopolisierung des Ertrags aufkommt – dann ist das bisher gepflogene und für nützlich erachtete Prinzip international betreuter Aufrechterhaltung von Staatlichkeit in der früheren „3. Welt“ am Ende. Das Mißtrauen in jede Beteiligung an den überkommenen gemeinschaftlichen Gremien des Westens wächst, weil die Basis, die die kapitalistischen Führungsmächte zu dem Westen schmiedete, nicht mehr vorhanden ist.
Für diesen Beweis waren die „Verdammten dieser Erde“ diesmal gut.
[1] So hatte selbst der leiseste Verdacht, die Staaten könnten womöglich durch eine falsche Politik ihr Scherflein zur Entstehung des „Problems“ beigetragen haben, auf dem Gipfel keinen Platz. Früher schicke Rechnungen, die eine falsche Verteilung der Staatsfinanzen für das Elend verantwortlich machen, wie diese: Mit dem Geld, das z.B. Indien für 20 MiG-29-Flugzeuge aus Rußland gekauft hat, hätte man 15 Millionen indischen Mädchen den Schulbesuch finanzieren können, die derzeit ohne Ausbildung aufwachsen
(der Ex-Präsident von Costa Rica, Oscar Arias, SZ, 4.3.95), wurden bereits im Vorfeld scharf kritisiert. Von den Grundsätzen imperialistischer Politik, die mit den weltweiten Geschäften sowohl die dafür nützliche Armut wie auch das Elend der Millionen dafür überflüssiger Menschen organisiert, war nicht die Rede. Die Interessen einer Herrschaft, die die Anschaffung teuren Kriegsgerätes notwendig, die Lesekünste junger Frauen dagegen überflüssig machen, waren sowieso kein Thema, weil sakrosankt.
[2] Die „taz“ irrt also, wenn sie unter der launigen Überschrift Wenn der Staat den Löffel abgibt
berichtet: „So bescheiden hat man Regierungsvertreter selten erlebt. ‚Wir können nicht auf den Staat hoffen zur Beseitigung der Arbeitslosigkeit‘, erklärte etwa Norbert Blüm, deutscher Delegationsleiter. ‚Wo er’s versucht hat, ist es schiefgegangen‘“ Ganz unbescheiden hat der Minister vielmehr erklärt, daß er für seine Arbeitslosen nicht haftbar gemacht werden will. Dafür verdoppelt er sich in die 1. Person Plural, die reuig einsieht, daß die 3. Person Singular namens Staat zwar wollen täte, aber vernünftigerweise nicht kann.
[3] Selbst der Welt „dienstältester“ Bösewicht Fidel Castro hielt sich mit Angriffen gegen eine „imperialistische Weltwirtschaftsordnung“ zurück und warb lieber mit Hinweis auf die sozialen Errungenschaften in seinem Land um Sympathien für sein, von den USA zu Unrecht bekämpftes Kuba.
[4] Während manche Non Government Organization (NGO) die Konferenz für eine passende Gelegenheit hielt, um mit anklagendem Zeigefinger auf die Lebensbedingungen zu deuten, in die die wachsende Zahl der Menschen hineingeboren wird, symbolisierte die fortlaufend tickende „Zeitbombe“, die die Zahl der während der Konferenz weltweit Neugeborenen anzeigte, eine ganz andere Sorge der offiziellen Regierungsvertreter: Ihnen sind die Menschen zu viel. Blüm: „Wenn die Bombe des Hungers platzt, wird ihre Sprengwirkung stärker sein als alle bisherigen und zukünftigen Explosionen der Atombombe. Die Welt wird in einem Chaos von Völkerwanderungen versinken.“ Klar, was den Mann an Hungerbäuchen stört? Näheres zu diesem Thema: „Wer ist hier zuviel? Bemerkungen zur Weltbevölkerungskonferenz der UNO“, GegenStandpunkt 4-94, S.40.
[5] Der aktuelle Verfall der Länder, die unter dem Namen „3. Welt“ bekannt wurden, kommt daher, daß ihre Souveränität immer schon eine alimentierte war. Ihre staatliche Grundlage stand und fiel mit dem Interesse, das der Bund der kapitalistisch erfolgreichen Nationen an ihnen entwickelte. Die steile Karriere ehemaliger Kolonien zu selbständigen Südfrüchtelieferanten, Rohstoffabtransportländern, Giftmülldeponien und Militärstützpunkten war ein Werk des Westens, wurde durch Kreditgelder & Waffenhilfe aus dessen Metropolen ermöglicht und vorangetrieben; insofern war ihre Souveränität von jeher eine Schimäre. 30 bis 40 Jahre Erfüllung dieses polit-ökonomischen Dienstes an der Freien Welt waren für sich schon zerstörerisch genug; zu einer eigenen weltmarkttauglichen Wirtschaft hat es in den seltensten Fällen gereicht. Also fällt heute das Kunstprodukt „Dritte Welt“, das seine Schuldigkeit gegen die zweite im Osten getan hat, mit der Änderung bzw. dem Schwinden des auswärtigen Interesses, das ihr einziges Lebensmittel war, zusammen wie ein Kartenhaus. Siehe dazu: „Der Verfall der Dritten Welt“, GegenStandpunkt 4-92, S.175
[6] Wie auch? Schließlich krepieren die Leute auch in Afrika nicht daran, daß sie zu häufig krank sind. Und aus Mangel an christlicher Gesinnung ist eh noch keiner gestorben.
[7] Als Beweis genügt ein rhetorischer Fingerzeig: Jedenfalls steht fest, daß dort, wo die Entwicklungshilfe am massivsten war, die Not jetzt am größten ist: in Afrika
(Prof. Schuller).
[8] Das haben sich die führenden kapitalistischen Nationen im Zuge der „Uruguay-Runde“ sogar schriftlich geben lassen: Jede Forderung der hoffnungslos abgehängten Länder des Südens nach „fairen Wettbewerbsbedingungen“und einer „gerechteren Weltwirtschaftsordnung“ wurde im Zuge des neuen WTO-Abkommens für nicht verhandelbar und damit für gegenstandslos erklärt.
[9] Kostenvorteile in Drittweltländern schädigen die Gesellschaften des Nordens
, weiß Der Spiegel (10/95). Das untergräbt den Wohlstand von Millionen Arbeitnehmern in den Industrieländern.
So erlebt die alte Moral ‚Wir essen den Negerkindern alles weg‘, mit der westliche Idealisten sich und nicht die Produktionsweise ihrer Nationen für das Elend der Schwarzen und Indios verantwortlich machten, ihre zeitgeistgemäße Umdrehung. Wer mag da eigentlich noch für UNICEF spenden, wenn ihm der kulleräugige José aus Rio plötzlich als „Ausbeuter“ vorgestellt wird, der „uns“ mit seinem Hungerlohn den Kaviar vom Teller nimmt?
[10] Der deutsche „Vorstoß“, Kinderarbeit weltweit zu ächten, löste am Rande des Sozialgipfels einen Streit aus, der in seiner Mischung aus Zynismus und Absurdität kaum zu überbieten ist. Wo das internationale Kinderhilfswerk Terre des Hommes dem Kanzler vorwirft, Kinderarbeiter auf die Straße setzen zu wollen
und ihnen so das Geld(!) wegzunehmen – für einen Monatslohn von 2 Mark 50 ist die berühmte Schale Reis zu haben –, wittert der deutsche Arbeitsminister Systemveränderung und macht im Gegenzug den Kritiker für das Elend verantwortlich: Ja, ich kenne die Ausreden. Sie werden seit Generationen wiederholt. Erst müsse das System verändert werden, erst dann gäbe es auch die Chance, die Kinderarbeit zu verdrängen. Die Systemtheoretiker werden noch weitere 100 Jahre ihre klugen Diskurse führen, derweil verrecken Hunderttausende Kinder
(Norbert Blüms Indisches Tagebuch, Welt am Sonntag).
[11] Die deutsche Presse verwurstete in der Regel beide Gesichtspunkte – Zuversicht und Enttäuschung – zu einem Kommentar. Einer für alle: Kein Kind mehr ist in Kopenhagen aus Armut und Unterentwicklung befreit worden, kein Leben zusätzlich vor Hunger und Tod gerettet. Und doch ist der Sozialgipfel der UNO kein Fehlschlag … Auf diesem Gipfel allein war die Welt nicht zu retten … Zum ersten Mal seit Jahren haben sich Staats- und Regierungschefs darauf verständigt, beim Aufbau einer neuen Weltordnung umzusteuern … Eine Art Weltregierung beginnt sich zu etablieren. Ob das der richtige Weg ist, muß sich erst noch zeigen
(Westdeutsche Allgemeine Zeitung, 13.3.95).
[12] Die Redewendung von dem berüchtigten „Tropfen auf den heißen Stein“ ist die hierfür passende Metapher. Sagen die einen „Hilfe“, rufen die anderen „bloß ein Tropfen“, darauf die ersteren: „aber allemal ein Tropfen“. Kritiker der imperialistischen Hungeropern sollten sich an diesem beliebten Gesellschaftsspiel lieber nicht beteiligen. Wer über das Maß der Hilfe rechtet, hat deren Zweck nämlich schon unterschrieben.
[13] Nach diesem Muster sind z. Zt. alle UNO-Konferenzen gestrickt. Mit dem Klimagipfel
in Berlin widmeten die Nationen auch noch der zweiten Springquelle allen Reichtums
, die sie mit Vereinten Kräften strapaziert haben, eine Tagung: Problem groß; Verursacher unbekannt; es sei denn, sie sitzen im Ausland und pusten für deutschen Geschmack zu viel Dreck in die Luft; Deutschland dagegen unternimmt ernsthafte Anstrengungen zur Beschränkung der Schäden,die aber leider von anderen zu wenig unterstützt werden, so daß Deutschland zu einem Alleingang gezwungen wäre, der natürlich nicht… Und mit dem „Kriminalitätsgipfel“ haben die Zuständigen auch noch ihren Anspruch auf eine gesicherte innere Ordnung und den Standpunkt, daß die immerzu durch organisiertes Verbrechen von auswärts gefährdet sei, zur demonstrativen internationalen Beratungsmasse gemacht. So durften sich alle möglichen Armenländer zur Abwechslung einmal als Quelle von Drogenhandel, als Brutstätten der Jugendkriminalität und Problemfälle internationaler Verbrechensbekämpfung verhandeln lassen und sich nach Kräften daran beteiligen. Jedenfalls widmete ihnen die Welt(organisation) auf diese Weise schon wieder ganz viel Aufmerksamkeit.
[14] Wie weit das eifersüchtige Beäugen der Konkurrenten bereits gediehen ist, zeigen Entlarvungen der europäischen „Partner“ wie die folgende: Für die Bundesregierung kommt noch ein langfristiger Aspekt ihrer Europapolitik hinzu. Sie beobachtet, daß die EU-Partner mit Deutschlands wachsenden finanziellen Leistungen für Osteuropa rechnen und deshalb schon vorsorglich Gegenpositionen aufbauen. So hat Frankreich bereits eine neue Mittelmeerpolitik mit einem 5-Jahres-Etat von umgerechnet 11 Milliarden DM durchgesetzt.
(SZ 17.2.95) Klar, daß die Franzosen, nur um sich Gemeinschaftsgeld an Land zu ziehen, eine extra kostspielige Mittelmeerpolitik erfinden, weil sie den Deutschen den Osten mißgönnen und Deutschlands Ostpolitik torpedieren wollen, die natürlich jeden Gemeinschaftskredit wert, weil ganz im höheren Sinne der Gemeinschaft ist. So stellt sich für SZ-Beobachter das deutsche Programm dar, sich mit Zustimmung zu einem Mittelmeerprogramm der EU, das im besonderen Interesse Frankreichs, Italiens und Spaniens liegt, die Europa-Priorität für seine Osterweiterungsperspektiven zu sichern.