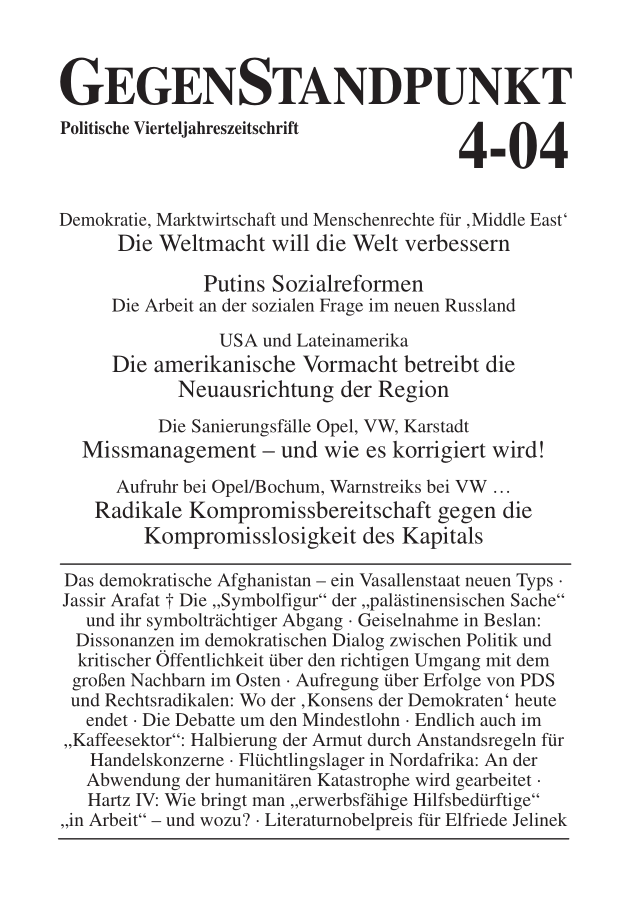USA und Lateinamerika
Die amerikanische Vormacht betreibt die Neuausrichtung der Region
Die Vereinigten Staaten von Nordamerika sind – wieder einmal, wie schon öfters in der Vergangenheit – dabei, ihre Beziehungen zu „den anderen Amerikas“, den Ländern im Süden, wo die Menschen in lateinischen Dialekten reden, neu zu ordnen. Grund genug haben sie dafür. Statt wunschgemäß zu funktionieren, machen manche Staaten bankrott; andere oder sogar dieselben geben sich widerspenstig; das Elend treibt Wirtschaftsflüchtlinge in unerwünschter Masse über den Zaun an der Südgrenze der USA; illegitime Kräfte verdienen mit Rauschgift am „American Dream“; schwache Regierungen, die ihr Land nicht richtig unter Kontrolle haben, stellen im Zeitalter des globalen „Kriegs gegen den Terrorismus“ ein untragbares Sicherheitsrisiko dar.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Gliederung
- I. Washington und seine „Hemisphäre“
- II. Amerikas Kampf um eine ‚echte Gemeinschaft von Nationen‘
- 1. Die amerikanische Diagnose
- 2. Der alltägliche Kampf gegen ‚bad governance‘ und ‚corruption‘
- 3. Das strategische Programm einer neuen Staatenordnung in Lateinamerika: Die Institutionalisierung der US-amerikanischen Vorherrschaft
- a) Das Projekt einer „gesamtamerikanischen Freihandelszone“ (FTAA/ALCA): Die Festschreibung eines ökonomischen Besitzstandes der USA mit strategischen Perspektiven
- b) Die Demokratiecharta: eine kollektive Verpflichtung zum ‚guten Regieren‘ unter US-Aufsicht
- c) Die Arbeit der USA an einer ‚kollektiven Sicherheitsarchitektur‘
USA und Lateinamerika
Die amerikanische Vormacht betreibt die Neuausrichtung der Region
Die Vereinigten Staaten von Nordamerika sind – wieder einmal, wie schon öfters in der Vergangenheit – dabei, ihre Beziehungen zu „den anderen Amerikas“, den Ländern im Süden, wo die Menschen in lateinischen Dialekten reden, neu zu ordnen. Grund genug haben sie dafür. Statt wunschgemäß zu funktionieren, machen manche Staaten bankrott; andere oder sogar dieselben geben sich widerspenstig; das Elend treibt Wirtschaftsflüchtlinge in unerwünschter Masse über den Zaun an der Südgrenze der USA; illegitime Kräfte verdienen mit Rauschgift am „American Dream“; schwache Regierungen, die ihr Land nicht richtig unter Kontrolle haben, stellen im Zeitalter des globalen „Kriegs gegen den Terrorismus“ ein untragbares Sicherheitsrisiko dar. Außerdem mischen sich Europäer und Ostasiaten ungebeten und über Gebühr in der Region ein. Also hat man sich in Washington vorgenommen, für echten ökonomischen und sozialen Fortschritt in den amerikanischen Ländern
zu sorgen und zwischen den USA und Lateinamerika eine Gemeinschaft von Nationen aufzubauen, zusammengeschweißt durch unsere Freiheitsliebe, gefestigt durch die Herrschaft des Rechts und gemeinsam prosperierend durch freien Handel.
(R. Noriega, UN-Botschafter der USA und Stellvertretender Staatssekretär für die Angelegenheiten der westlichen Hemisphäre, in einer Rede im World Trade Center Chicago am 17.1.03)
Mit Projekten, die unter so hochtönenden Titeln daherkommen, beglücken US-Präsidenten seit jeher, und die aktuell regierenden anti-terroristischen Weltverbesserer schon gleich, gerne die verschiedensten Problemzonen auf dem Globus. Was die USA mit und in Lateinamerika anstellen und sich für die Region vornehmen, ist aber – auch das schon immer – von besonderem Format. Der Rest ihres Doppelkontinents ist für sie ihre Hemisphäre, die politische Kontrolle darüber und der ökonomische Zugriff darauf ein Besitzstand eigener Art, der bedingungslos gegen jede Gefährdung verteidigt und gegen jede Infragestellung abgesichert werden muss.[1] Dementsprechend gehen sie ans Werk und haben es dabei auch weit gebracht: Lateinamerika ist tatsächlich keine Weltgegend wie andere auch. Die Staatenwelt südlich des Rio Grande ist durch ihre Zugehörigkeit zur „Hemisphäre“ der Yankees politökonomisch definiert und ordnungspolitisch festgelegt.
I. Washington und seine „Hemisphäre“
(1) Seit die USA eine eigene, selbständig ausgreifende Außenpolitik treiben, beanspruchen sie die politische Alleinzuständigkeit für den gesamten amerikanischen Doppelkontinent, das Monopol auf grenzüberschreitende Ordnungspolitik. Nach ihrer eigenen Befreiung von der britischen Obrigkeit haben sie ihren eigennützigen Beitrag zur Ablösung der europäischen Kolonialherrschaft geleistet, „Amerika den Amerikanern“ übereignet und die gesamte Region als eine naturgegebene politische Einheit definiert, die sie gegen jede Einmischung von außen abzuschirmen haben. Sie selber mischen sich nicht ein, schon gar nicht in fremde Angelegenheiten, wenn sie in anderen Ländern des Doppelkontinents nach dem Rechten sehen, politische „Weichenstellungen“ verlangen oder gleich selber vornehmen, nötigenfalls komplette Regierungen ab- oder einsetzen, Landstriche okkupieren oder einen ganzen Staat neu gründen wie Panama; da nehmen sie vielmehr nur die „inneren Angelegenheiten“ Amerikas, letztlich also ihre eigenen, in die Hand. Deswegen können sie es auch gar nicht leiden, wenn sich in der buntscheckigen Staatenwelt südlich des Rio Grande Tendenzen zu einer autonomen Bündnispolitik entwickeln: Die Stoßrichtung gegen „die Yankees“ spüren sie sofort heraus und schreiten dagegen ein, indem sie nachbarschaftliche Rivalitäten ermuntern, auch Kriegen, wie sie die Erben der spanischen Kolonialherrschaft nicht zu knapp gegeneinander geführt haben, nicht unbedingt ablehnend gegenüberstehen, spezielle Beziehungen anbieten oder auch eine Sonderbehandlung androhen. Notfalls wahren sie mit Gewalt die politische Einheit der großen Weltgegend, die nach ihrem Willen ihr natürliches Gravitationszentrum ein für alle Mal dort hat, wo der größte Reichtum weit und breit und die stärksten Militärkräfte überhaupt zu Hause sind.
Dem politischen Alleinvertretungsanspruch der US-Regierungen für ihre „Hemisphäre“ haben Nordamerikas Dollar-Kapitalisten die ökonomische Beschlagnahmung des restlichen Amerika auf dem Fuße folgen lassen. Mit ihrem guten Geld kaufen sie – in Konkurrenz mit den einstigen europäischen Kolonialherren sowie mit neuen Interessenten – Rohstoffe aller Art, Mineralien und Agrargüter ein, richten ganze Landstriche zu Plantagen und Minengelände her und holen die exotische Ware ab, um daheim und weltweit damit zu verdienen. Lateinamerika liefert; und wer dadurch dort an US-Dollars kommt – eine exklusive Klasse von Großgrundbesitzern vor allem, und die nicht zu knapp –, fungiert sogleich wieder als zahlungskräftiger Absatzmarkt für nordamerikanische Waren. Dieser gesamtkontinentale Wirtschaftskreislauf ist mit dem Ende des quasi-kolonialen Imperiums von Gesellschaften wie der ‚United Fruit‘ und mit der Verstaatlichung von Erzgruben und Erdölquellen keineswegs zum Erliegen gekommen. Natürlich präsentieren sich die lateinamerikanischen Nationen mittlerweile – von ein paar karibischen Mini-Staaten abgesehen – als souveräne, autonom kalkulierende und wirtschaftende Subjekte des Weltmarkts. Die Potenzen jedoch, mit denen sie sich berechnend in die moderne internationale Dollar-Wirtschaft einklinken, bestehen zum großen Teil nach wie vor in den natürlichen Ressourcen, mit denen sie sich als Lieferanten, und in den dafür erlösten Dollars, mit denen sie sich als Kundschaft für das kapitalistische Wachstum im Norden und anderswo nützlich machen.
Dass der Großteil der eingeborenen Bevölkerung von diesem schön rund laufenden Geschäftsverkehr ausgeschlossen ist und bleibt, geht dessen Profiteure, ob sie nun lateinische oder englische Dialekte sprechen, nichts an.
(2) Volksfreundlich gesinnte sowie national ehrgeizige lateinamerikanische Politiker sind mit dieser Sorte „Volkswirtschaft“ allerdings seit jeher unzufrieden. Sobald sie an die Macht kommen, betreiben sie in immer neuen Anläufen den nationalen Aufbau. Was das heißt und wie so etwas geht, das entnehmen sie dem Vorbild der Nation, deren Kaufleute aus ihren Ländern für sich so viel Nützliches herausholen: Eine Kapitalakkumulation in nationalem Maßstab gilt es in Gang zu bringen, ein von sich aus funktionstüchtiges, national flächendeckendes Geschäftsleben, das das Volk nützlich und den Staat reich und mächtig macht. Weil bzw. soweit die einheimische Geldelite in dieser Hinsicht zu wünschen übrig lässt, beim kapitalistischen Aufbau versagt oder – je nach kritischer Sichtweise – sich versagt, nimmt die Staatsmacht mit ihrer Kommandogewalt über den Warenverkehr sowie über die Zahlungsmittel der Nation, nämlich mit ihrer Vollmacht zur Kreditgeldschöpfung, die Sache selbst in die Hand.
Dagegen hat der große nordamerikanische Partner erst einmal gar nichts einzuwenden. Dessen Geschäftswelt findet sich mit ihrem umfassenden Warenangebot mehr denn je und in ganz neuer Größenordnung gefragt. Sie sieht die Chance und ergreift sie gern, mit ihren guten Dollars auch als Investor in den mit den Mitteln staatlicher Gewalt und Geldhoheit angeschobenen Prozess einer landesweiten Kapitalakkumulation einzusteigen. Sie hat keine Bedenken, den Großprojekten ehrgeiziger Entwicklungspolitiker mit Angeboten für eine machtvolle Anschubfinanzierung beizustehen – es ist ja ihr südlicher Geschäftsbereich, der da entwickelt werden soll. In demselben Sinn findet die aufsichtsführende Staatsgewalt in Washington nichts weiter dabei, dass gewisse potente Mitglieder ihrer „Hemisphäre“ national eigennützig planen, rechnen, wirtschaften und Schulden machen: Nach den Maßstäben, die sie selber in die moderne Weltwirtschaft einführt, soll durchaus auch in Lateinamerika frei, ungehindert, mit allen Mitteln und von jedermann Geld verdient werden. Dass sich die Staaten dort in diesem Sinne anstrengen, geht in Ordnung; ebenso, dass sie sich in aller Welt nach Geschäftspartnern umtun und dass umgekehrt auch Akteure „von außerhalb“ ins Lateinamerika-Geschäft einsteigen – die Zuständigen in Washington sind sich mindestens ebenso sicher wie ihre Multis, dass sie auf ihren lateinamerikanischen Waren-, Kredit- und Kapitalmärkten letztlich ohnehin konkurrenzlos dastehen. Denn dass es sich bei dem anderen Amerika um ihre angestammte Dollar-Quelle handelt: von dem Standpunkt rücken die USA überhaupt nicht ab, wenn sie diese Sphäre unter die allgemeinen Regeln des freien internationalen Geschäftsverkehrs subsumieren. Genau das erscheint ihnen vielmehr als die zweckmäßigste Methode, um sich den Nutzen aus den Entwicklungsbemühungen der lateinamerikanischen Aufsteiger und „Schwellenländer“ zu sichern.[2]
Deswegen sind sie allerdings strikt gegen alle Tendenzen bei ihren hoffnungsvollen Partnern im Süden, nationale Aufbauprojekte und neu geschaffene Unternehmen durch Abschirmung gegen die allemal überlegene Konkurrenz aus dem Norden voranzubringen. Entwicklungsprogramme werden dann gerne gefördert, aber auch nur dann geduldet, wenn sie prinzipiell und von Beginn an dem Zugriff interessierter Kapitalisten aus aller Welt, also aus dem Norden offen stehen. Mit ernsthaften Konkurrenten haben die in ganz Lateinamerika wenig bis gar nicht zu rechnen. Dass die engagierten Entwicklungspolitiker es ja erst zu einer konkurrenztüchtigen Klassengesellschaft, deren ausbeutende Elite sich neben der nordamerikanischen und gegen deren finanzielle Übermacht auf einem freien Weltmarkt zu behaupten vermag, überhaupt bringen wollen, das geht die internationalen Investoren nichts an und begründet für die Südländer nicht etwa irgendein Recht auf Maßnahmen zum Schutz ihrer Aufbauprojekte, sondern bloß das unbezweifelbare Recht der erfolgreichen Multis aus dem Norden, ihre Überlegenheit auszuspielen und Lateinamerika als erweitertes Betätigungsfeld ihrer Markteroberungs- und Kapitalanlage-Strategien zu nutzen, auch wenn die bestenfalls zufällig und punktuell zum Programm eines kompletten eigenständigen Kapitalkreislaufs in dem jeweiligen Land passen und ansonsten einheimischen Unternehmungen schaden. Alles andere wird als Protektionismus bekämpft: als fundamentaler Fehler, mit dem die Latinos bloß sich selber schaden, nämlich die Vorteile eines wahrhaft freien Welthandels verscherzen. Wo umgekehrt die verlangte Freiheit herrscht, und unter dem Druck aus dem Norden wird sie regelmäßig alsbald gewährt, da sind Dollar-Kapitalisten flott dabei, neu geschaffene Märkte auszunutzen und einheimische Arbeitskräfte auszubeuten; am Ende lassen sich ihre teils herausgeholten, teils re-investierten Gewinne nicht selten zu ansehnlichen lateinamerikanischen Gesamt-Wachstumsraten zusammenzählen.
Dass im Endeffekt außerdem ein großer Teil der einheimischen Gesellschaft von jeder kapitalistischen Benutzung ausgeschlossen wird oder bleibt und es noch nicht einmal zu einer regionalspezifischen proletarischen Armut bringt, geht die Nutznießer des neu eröffneten Geschäftslebens, die vor Ort und die im Norden schon gleich, nichts weiter an.
(3) Die Bedingung, sich als Teil des von den USA gestifteten freien Weltgeschäfts im Allgemeinen und der von den USA dominierten panamerikanischen Dollar-„Hemisphäre“ im Besonderen zu bewähren, noch ehe sie über eine konkurrenztüchtige Nationalökonomie verfügen, drängt die aufstrebenden Nationen Lateinamerikas auf einen eigentümlichen Entwicklungsweg. Was bei ihnen an Kapitalakkumulation zustande kommt, macht deren Urheber und Eigentümer, Dollar-Kapitalisten aus den USA vor allem und andere auswärtige Händler und Geldanleger, immer reicher, verhilft ihnen selber aber nicht zum Status eines Kapitalstandorts, der mit der Masse seines nationalakkumulierten Kapitals im globalen Wettbewerb erfolgreich mithalten könnte.[3] Für die zuständigen Regierungen macht sich dieses prinzipielle Defizit an den beiden Seiten ihres Staatshaushalts geltend: Was ihnen von dem national erwirtschafteten Überschuss bleibt, trägt die Ausgaben nicht, die sie sich leisten und leisten müssen, um dem Ziel eines nationalen Kapitalismus auf konkurrenzfähigem Niveau näher zu kommen. Getätigt werden die Ausgaben trotzdem: Nach dem Vorbild jeder modernen kapitalistischen Herrschaft – derjenigen der USA schon gleich – „schöpfen“ sie in nationalem Maßstab Kredit, den sie ihrer Gesellschaft in Form von gesetzlichen Zahlungsmitteln zur Weiterverwendung aufnötigen. Doch was damit an Kapitalwachstum angestoßen wird und im Land verbleibt, rechtfertigt diese Kreditgeldschöpfung nicht: Statt akkumulierenden kapitalistischen Reichtum in dem von den obersten Geldhütern intendierten Umfang zu repräsentieren, wird das nationale Geld durch Entwertung seiner Untauglichkeit als kapitalistisches Geschäftsmittel überführt. Ein ums andere Mal probieren ehrgeizige Machthaber, vor allem in den potenten „Schwellenländern“, die Kopie einer durch selbstgestiftetes Kreditgeld alimentierten Wachstumspolitik, wie sie den USA und deren gleichwertigen Konkurrenten zu Gebote steht, und scheitern damit.
Für die USA freilich und für die in diesen Ländern engagierten auswärtigen Kapitalisten, wenigstens für die, ist der wiederholte Bankrott lokaler Währungen weiter kein Problem. Ihr berechnendes Einverständnis mit den diversen nationalen Aufbauprogrammen ist nie so weit gegangen und bedeutet überhaupt nicht, dass sie die Geldhoheit der zuständigen Staaten als für sich verbindlich anerkannt, den dort von Staats wegen in Umlauf gebrachten Zahlungsmitteln den Rang eines respektablen Weltgeldes zugebilligt und die lokale Währung wie Dollars benutzt hätten. Was den Sinn und Zweck all ihrer lateinamerikanischen Geschäfte, nämlich das dort zu verdienende Geld betrifft, so sind und bleiben dessen nationale Standorte auswärtige Provinzen der Dollar-„Hemisphäre“. Formell gelten natürlich auch für diese Länder die maßgeblich von den USA aufgestellten und weltweit durchgesetzten Regeln des internationalen Geldhandels, des praktischen Vergleichs sämtlicher nationalen Gelder, einschließlich der im IWF institutionalisierten Aufsicht über die nationalen Schuldenbilanzen. In der ökonomischen Realität hat Nordamerikas Geschäftswelt es aber gar nicht dahin kommen lassen, dass die immer wieder extrem inflationären Bewegungen lateinamerikanischer Währungen den Gang ihrer Geschäfte beeinflusst hätten. Sie hat sich nie genötigt gesehen und lehnt es seit jeher ab, lateinische Pesos, Sucres, Reales oder dergleichen Spielgeld als Geschäftsmittel in Betracht zu ziehen, dem sie ernsthaft ihr Allerheiligstes, ein Stück ihres Dollarvermögens, anvertrauen könnte.[4] Wenn sie sich Handel treibend, investierend oder kreditierend an der Kapitalakkumulation im Süden beteiligt, sie sogar vorantreibt, dann schießt sie Dollars vor und will als Ergebnis nichts andres als Dollars sehen. Als Faktor der Kalkulation, erst recht als Bestimmungsgröße für den erwirtschafteten Reichtum – so wie zwischen Wirtschaftsmächten der besseren Güteklasse mit einer als Weltgeld anerkannten Valuta – spielen die vor Ort zirkulierenden Währungen keine Rolle: Gerechnet und abgerechnet wird in Dollar.
Diese klaren Verhältnisse haben selbstverständlich auch die Kapitalexporteure aus Europa, die sich über die Jahrzehnte der Nachkriegszeit im Wettbewerb mit ihren US-Kollegen zunehmend ins lateinamerikanische Geschäft eingemischt haben, kein bisschen relativiert, vielmehr in der gleichen Weise ausgenutzt. Auch die EU-Staaten haben ihr Engagement in Südamerikas „Schwellenländern“ überhaupt nicht mit der Bereitschaft verknüpft, deren hauseigenen Zahlungsmitteln irgendeine Verbindlichkeit für das Geschäft mit und in ihnen zuzuerkennen, sondern auf Erträgen in Devisenform bestanden. Als Schmarotzer an den von den USA etablierten geldwirtschaftlichen Verhältnissen sind Europas Kapitalisten unter der Prämisse nach Lateinamerika gegangen und bleiben mit dem selbstverständlichen Anspruch dort, dass sie sich im Grunde gar nicht auf fremdes Währungsgebiet begeben, sondern mit Mark, Pfund, Peseta oder neuerdings Euro in eine Sphäre der Vermehrung ihres Dollar-gleichen Weltgeldes einsteigen.
(4) Für diesen Anspruch, für die Eliminierung der nationalen Währungen aus allen kapitalistischen Rechnungen, für die Einlösung der Prämisse, dass auch im Süden Amerikas mit jedem Stück Profit und Kapitalakkumulation Dollars verdient werden, muss natürlich irgendwer geradestehen; und natürlich ist von vornherein zweifelsfrei klar, wer: Die Staaten, die so eifrigen Zuspruch der Geschäftswelt aus dem Norden finden, stehen in der Pflicht, dem bei ihnen tätigen Dollar-Kapital jeden Profit und jeden Zuwachs, den es sich in ihrem Ländern erwirtschaftet, in Dollars zu vergüten bzw. eben dies zu garantieren. Die Verfügung über ein Weltgeld wird ihnen abverlangt, das sie mangels durchschlagender nationaler Konkurrenzfähigkeit mit ihrer heimatlichen Währungshoheit nicht hinkriegen, das sie sich also im Außenhandel erwerben müssen; dies freilich in einer Größenordnung, dass dafür die wackligen Exporterlöse ihres Rohstoffsektors und die stets sehr bescheidenen Außenhandelserfolge ihrer sonstigen Produkte, an denen sich ohnehin erst einmal eine ganze Eigentümerklasse bereichert, bei weitem nicht reichen. Gefordert sind umfängliche Konkurrenzerfolge im Außenhandel, zu denen die aufstrebenden Nationen es gerade erst bringen wollen – und für die sie auf dem freien Weltmarkt Produktionsmittel mit genau dem Weltgeld einkaufen müssen, das sie erst einnehmen müssen. Anders gesagt: Staaten ohne anerkanntes Geld müssen die auswärtige Geschäftswelt, die sie als Standort für die Vermehrung ihres guten Geldes würdigt, mit der Bereitstellung von Devisen, die sie auch nicht haben, dafür schadlos halten, dass ihr eigenes Geld von eben dieser Geschäftswelt nicht als Weltgeld anerkannt wird – keine ganz einfache Aufgabe.
Für Kapitalisten aus den Heimatländern des guten Geldes ist das jedoch selbstverständliche Voraussetzung jeden Engagements und unerbittliche Forderung aus jedem getätigten Engagement. Das Problem, vor das sie ihre lateinamerikanischen Standortverwalter damit stellen, ist nicht ihr Problem; dafür können sie damit gleich wieder etwas anfangen, nämlich die nächste Eskalationsstufe ihres Lateinamerika-Geschäfts anzetteln: Geldanleger leihen den Staaten im Süden die Dollars, die die brauchen und nicht haben. Dabei ziehen sie natürlich ins Kalkül, dass sie mit solchen Krediten nicht mehr einen auf nationales Wachstum berechneten Finanzbedarf bedienen, sondern an einer Finanznot verdienen, die aus dem tatsächlich stattfindenden Wachstum auswärtigen Dollar-Kapitals resultiert: Für so was berechnet der anständige Finanzkapitalist höhere Zinsen; umso höher, je mehr er der Fähigkeit der kreditierten Nation misstraut, ihre kostspieligen Schulden auch zu bedienen.
(5) Die Existenznöte der Masse der Bevölkerung, die aus dieser nationalen Entwicklungspolitik resultieren – der normale Latino hat keine Chance, sich gegen die Entwertung der Zahlungsmittel abzusichern, auf die er angewiesen ist, verarmt also wie von selbst und wird zusätzlich zum Opfer der staatlichen Bemühungen, dem Verfall des Geldwerts durch Effektivierung des noch konkurrenzuntauglichen nationalen Kapitalismus sowie durch eine Haushaltspolitik der Sparsamkeit bei unproduktiven Ausgaben und der Konzentration aller Mittel auf Wachstumsförderung, auf Attraktion ausländischen Kapitals und auf positive Außenhandelsbilanzen entgegenzuwirken –, finden bei den politischen Arrangeuren und den kritischen Nutznießern des subkontinentalen Aufbauwerks durchaus Beachtung. Der verschärfte Ausschluss produktiv benutzter wie für den kapitalistischen Fortschritt überflüssiger Landesbewohner vom akkumulierenden Reichtum der engagierten Geschäftemacher bleibt nicht eine belanglose Nebenwirkung: Verelendung wird zum Programm. Sie muss sein, darf aber nicht stören; sie muss also unter Kontrolle gehalten und so organisiert werden, dass Dollar-schwere Interessenten aus aller Welt inmitten oder neben aller Armut Rechtssicherheit für ihr Kapital, gewinnträchtig ausnutzbare Märkte, eine funktionstüchtige Infrastruktur und außerdem problemlos verfügbare Arbeitskraft in jeder aktuell gewünschten Menge mit guter Moral und der jeweils gefragten Qualifikation vorfinden. Auch das ist keine leicht zu bewältigende Anforderung an die zuständige Herrschaft, zumal es neben einiger Skrupellosigkeit bisweilen auch eine Portion nationaler Selbstverleugnung braucht, um sie zu erfüllen. Verlangt ist nämlich nicht nur die Unterwerfung der Gesellschaft unter die „Sachzwänge“ einer möglichst ausgedehnten kapitalistischen Ausbeutung, wie es zur Agenda jeder bürgerlichen Ordnungsgewalt gehört, sondern eine Menge unproduktiver Unterdrückung, was auch ansonsten durchaus kooperationsbereite Mitglieder der „politischen Klasse“ irritieren kann. Denn auch wenn deren Empörung über das selbstgeschaffene Elend als solches sich in Grenzen hält: Dass dem Aufwand dafür kein nationaler Nutzen auf der anderen Seite entspricht – stattdessen folgt eine Währungspleite der andern, die Auslandsschulden des Staates steigen ins Unabsehbare, die Aufrechterhaltung der Staatsgewalt selber gerät zum Finanzierungsproblem, und die Erträge sammeln sich auf Bankkonten im Norden –, das verstimmt Patrioten, die sich die Entwicklung hin zu einem flächendeckend funktionierenden nationalen „Aufschwung“ irgendwie anders vorgestellt haben.
Tatsächlich haben im vergangenen halben Jahrhundert sehr viele lateinamerikanische Intellektuelle, darunter eine ganze Fraktion des katholischen Klerus, Gewerkschafter und andere enttäuschte Patrioten zeitweise sogar eine ganz andere, nämlich eine sozialistische Alternative für ihr Land im Sinn gehabt und dafür nicht ohne Erfolg mobil gemacht. In dem prominenten Fall Chiles ist eine solche Linke ganz rechtsförmlich an die Macht gekommen. In etlichen anderen Ländern haben sozialrevolutionäre Umtriebe die etablierte, systemkonform pro-amerikanische Herrschaft in Gefahr gebracht. Mit Hilfe der Sowjetunion, die sich eine Zeit lang bemüht hat, im „Hinterhof“ ihres strategischen Hauptfeindes Fuß zu fassen und mit Verbündeten und Stützpunkten eine Gegendrohung gegen ihre Umklammerung durch die Bündnissysteme der USA aufzubauen, haben Castros Revolutionäre auf Kuba nicht bloß gewonnen, sondern sich sogar halten können.[5]
(6) Die USA haben sich durch solche Umtriebe doppelt herausgefordert gesehen und entsprechend reagiert. Zur Sicherung ihres Kernlandes sowie zur Verteidigung ihres panamerikanischen Alleinvertretungsanspruchs gegen sowjetische Einmischungsversuche haben sie im Fall Kuba bekanntlich den atomaren Weltkrieg riskiert und den weltpolitischen Gegner in die Schranken gewiesen, die „Befreiung“ der Insel nicht geschafft; das weiterhin kommunistisch regierte Land wird seither als ein einziger erratischer Verstoß gegen die amerikanische Norm und Normalität unerbittlich geächtet, boykottiert und ausgegrenzt, bis es sich irgendwann wieder in seine eigentliche Heimat, die amerikanische „Hemisphäre“, eingliedern lässt. Im Fall Allende – auch der galt als „trojanisches Pferd“ der Sowjetmacht – hat Washington einen Militärputsch bestellt, unterstützt und den Erfolg diplomatisch abgesichert. In Nicaragua haben die USA gut ein Jahrzehnt lang einen Bürgerkrieg gegen die Sandinisten finanziert, damit alle Ansätze zu einer sozialen Besserstellung der Bevölkerung ad absurdum geführt und so das Land zu freien Wahlen, und zwar der richtigen Kräfte, reif gemacht. Die Farce zur Tragödie hat dann Präsident Reagan mit seiner machtvollen Intervention gegen einen sowjetkommunistischen Flughafen-Ausbau auf der Karibik-Insel Grenada nachgereicht; da war der Kalte Krieg in Amerikas „Hemisphäre“ freilich bereits entschieden, schon vor dem epochemachenden Selbstmord des Moskauer „Reichs des Bösen“. Gegen Versuche zum Umsturz der inneren Ordnung in den Staaten ihrer Region sind die USA ansonsten überall mit einer recht erfolgreichen Kombination von Gewalt und Kredit vorgegangen. Zusammen mit den entschlossensten antikommunistischen Fraktionen der jeweiligen nationalen Geld- und Machtelite, in gedeihlicher Zusammenarbeit insbesondere mit einem von freiheitlichem Sendungsbewusstsein durchdrungenen militärischen Unterdrückungsapparat, haben sie alle „sozialen Fragen“ grundsätzlich beantwortet und jeden linken Widerstand, des Widerstands verdächtige Linke in beträchtlicher Anzahl ad personam, liquidieren lassen. Passende nationale Aufbaubemühungen ihrer rechten lateinamerikanischen Geschöpfe und Kollegen haben die Oberaufseher aus Washington zugleich mit Geld und Kreditgarantien unterstützt, so dass die Haltbarkeit des Dollarschuldengebäudes, zu dem der Aufbau Lateinamerikas mit systematischer Folgerichtigkeit immer wieder gerät, lange Zeit überhaupt nicht problematisch erscheinen musste: die optimale Steilvorlage für amerikanische Investoren. Zur Betreuung und Befriedung des speziellen lateinamerikanischen Pauperismus haben sie zudem ein „Friedenscorps“ entsandt, in dem viele junge nordamerikanische Friedens- und Fortschritts-Idealisten sich für die Sache der Freiheit im Süden „ihres“ Doppelkontinents eingesetzt haben, ohne zu begreifen, worin diese „Sache“ überhaupt besteht. Tatsächlich haben die USA auf die Art ihre südliche Dollar-Sphäre mit all ihren eingebauten politökonomischen Widersprüchen und mit sämtlichen daraus resultierenden sozialen Gegensätzen und Gemeinheiten haltbar gemacht.[6]
An diesem Fortschrittswerk haben die Europäer sich gerne beteiligt. Die von den Nordamerikanern gestiftete Ordnung auf dem Subkontinent haben sie ebenso begrüßt und ausgenutzt wie die Ordnungsstiftung durch die spendable Supermacht: erstere als bequeme Sicherheitsgarantie für ihren mit den US-Multis konkurrierenden Waren- und Kapitalexport, letztere als Haltbarkeitsgarantie für die Spekulation der eigenen Finanzkapitalisten und Investoren auf Lateinamerika als unerschöpfliche Dollar-Quelle. Daneben haben sie sich die Freiheit genommen, an Washingtons brutalsten Gorillas herumzukritisieren und auf diese heuchlerische Art Einwände gegen das Ordnungsmonopol der USA anzumelden. Der Ruf nach demokratischeren Verhältnissen, für deren Funktionstüchtigkeit im Sinne der nötigen Unterdrückung sie absehbarerweise nie einzustehen brauchten, sollte den „Gemäßigten“ in Lateinamerikas „politischer Klasse“ signalisieren, dass sie in Europa eine alternative Adresse hätten – für genau dasselbe Abhängigkeitsverhältnis, in dem ihre Länder zu dem großen Paten im Norden stehen. Der Abneigung gegen die Yankees, die im lateinischen Teil der amerikanischen „Hemisphäre“ gerade wegen der überwältigenden Dominanz des Nordens zum guten Ton gehört, hat das sicher gut getan.
(7) Mit ihrem Sieg über die einheimische Linke in den wichtigsten Staaten im Süden und vor allem mit dem vorzeitigen Ende sowjetischer Bemühungen um eigene Verbündete in Lateinamerika sind die USA eine Sorge und mit der Sorge eine Last losgeworden: Den Aufwand für den Unterhalt funktionstüchtiger antikommunistischer Regimes in Lateinamerika und eine durchgreifende Kontrolle über Land und Leute können sie sich allmählich sparen; ihre blutrünstigsten Kreaturen und Partner können sie gefahrlos fallen lassen und Hilfsgelder sowie Kredite streichen, die sie allein zum Zwecke stabiler Unterdrückungsverhältnisse für nötig befunden haben. Washington duldet, fordert in etlichen Fällen sogar die Rückkehr zu einer zivilen Herrschaft und den Übergang zu demokratischen Wahlen, soweit deren Ergebnis durch keine linksradikale Opposition mehr ernstlich durcheinander gebracht werden kann. Wer jetzt an die Macht kommt, dem hat die Zustimmung seiner Wähler einen guten Teil der Alimentierung seines Staatshaushalts durch Dollars aus den USA zu ersetzen – der findet sich also in neuer Schärfe mit dem peinlichen Umstand konfrontiert, dass er eine Nation ohne wirkliches Geld regiert.
Noch viel härter findet sich die Geschäftswelt betroffen, die auf allen Ebenen, vom Rohstoffhandel bis zur Kreditspekulation, in Lateinamerika so prächtig Dollars verdient. Nicht nur, dass sie sich für den Schutz ihrer hochheiligen Eigentumsrechte von den vertrauten Ordnungshütern in Militäruniform auf neue, noch unerprobte, womöglich zu zimperliche zivile Gewalthaber umstellen muss. Mit dem Auslaufen des politischen Tauschhandels ‚Dollar-Hilfen gegen Antikommunismus‘ kommt ihr eine bedeutende finanzielle Sicherheit abhanden, auf die sie sich bei ihren spekulativen Investitionen in eine Kapitalakkumulation, für deren Realisierung in Weltgeld die nationalen Standorthüter unverbrüchlich haften würden, immer verlassen hat. Das heißt keineswegs, dass sie ihre spekulativen Engagements sofort beenden oder zurückfahren. Dass in der Region weiterhin ganz unmittelbar Dollars zu verdienen sind, davon gehen Kaufleute und Kapitalanleger aus dem Norden nach wie vor wie von einer elementaren Selbstverständlichkeit aus. Eben deswegen kommen sie aber nicht umhin, nach langen Jahren der massiv zunehmenden Kreditierung ihre staatlichen Schuldner – so wie jeden Kreditnehmer – auf Zahlungsmoral und Fähigkeit zur Schuldenbedienung zu überprüfen und an deren Seriosität so strenge Maßstäbe anzulegen, wie der Gang ihrer weltweiten Geschäfte insgesamt es gebietet. Wann immer das Weiterwirtschaften kritisch wird, der Welthandel stagniert, US-amerikanische und andere Finanzkapitalisten Geldanlagen abschreiben müssen, weil sie aus ihnen nichts mehr herausholen; wann und wo immer also maßgebliche kapitalistische Rechnungen wacklig werden: da wachsen folglich automatisch die Zweifel an der Zuverlässigkeit der eigenen Spekulation auf Lateinamerika als unbeschränkt leistungsfähige Dollar-Vermehrungsmaschine. Sobald deswegen der Nachschub an Weltgeld-Krediten stockt, erst recht wenn Dollar-Forderungen eingetrieben und Geldanlagen abgezogen werden, ist schlagartig auch für die zuständigen Finanzmärkte offenkundig: Sie haben es mit Nationen ohne wirkliches Geld zu tun.
(8) Dieser Offenbarungseid fällt etwas anders aus als eine „Liquiditätskrise“ von Staaten, die mit einer respektierten Geldhoheit und einer anerkannten Valuta im globalen Kapitalismus mitmischen und dabei schlechte Bilanzen akkumulieren. In solchen Fällen, die dem modernen Weltmarkt keineswegs fremd sind, begutachtet der internationale Geldhandel zunehmend kritisch, was sich mit dem Geld einer solchen Nation absehbarerweise geschäftlich anstellen lässt. Er gelangt zu einer immer negativeren Antwort auf seine immerwährende Frage, wo in der Konkurrenz der Wirtschaftsmächte das betreffende Land mit der Masse und Rate seines nationalen Wachstums und mit seiner schwindenden Potenz zum Zugriff auf die Leistungen anderer Nationen steht. Er fällt dieses Urteil praktisch und mit der praktischen Konsequenz, dass er die fragliche Währung immer schlechter bewertet, damit das internationale Gewicht des kapitalistischen Reichtums der ganzen Nation mindert und ihre internationale Zahlungsfähigkeit reduziert; am Ende auf das, was sie an Devisen vorzuweisen hat. Spätestens dann schaltet sich – nach den Regeln von ‚Bretton Woods‘ – der Internationale Währungs-Fonds ein, verordnet der tendenziell zahlungsunfähigen Nation die Sanierung ihres Zahlungsmittels vermittels Sanierung ihres Gesamthaushalts und stattet sie im Gegenzug mit Devisen aus, die der kapitalistischen Geschäftswelt gegenüber die Kreditwürdigkeit des Landes verbürgen – vorübergehend, bis die Nation sich und ihrem Geld wieder eine anerkennenswerte Konkurrenzposition im Weltgeschäft erwirtschaftet hat.[7]
Wenn die Gläubiger eines lateinamerikanischen Staates ihr Engagement kritisch überprüfen, eine Abrechnung auf die Tagesordnung setzen und damit einen Offenbarungseid provozieren, dann geht es anders zu. Weil das nationale Geld der Lateinamerikaner auswärts nie Gegenstand einer sorgenvollen Begutachtung im obigen Sinne war, kürzt sich alles Herumrechnen mit fallenden Wechselkursen, Bandbreiten für Währungsschwankungen, Manövern zur Rettung des nationalen Kreditgelds und dergleichen aus einer solchen angesagten Zahlungskrise heraus. So, wie das Geschäft mit dem Land schon immer gelaufen ist, nämlich als Dollar-Akkumulation unabhängig von der Bewirtschaftung des eigenen Nationalkredits durch den dafür zuständigen Staat, so findet auch die krisenhafte Unterbrechung der laufenden Geschäfte statt: als Einfordern der Dollar-Garantie, die die Geschäftswelt von ihrem Partner, den verantwortlichen Regenten der ausgenutzten Geldanlagesphäre, gefordert und bekommen hat; als Kündigung von Krediten und als Konkursverfahren, bei dem es ganz direkt ums Schulden-Bezahlen und sonst gar nichts geht. Freilich wird auch dabei – im Vorfeld zur Abwendung eines solchen Bankrotts, im eingetretenen Ernstfall zu seiner Abwicklung – der IWF eingeschaltet; entgegen seiner ursprünglichen Aufgabenstellung aber nicht, um einen international ins Hintertreffen geratenen Staat als potenten Kreditschöpfer und Garanten eines weltweit benutzbaren Kreditgeldes wiederherzustellen, sondern um auf supranationaler Basis eine Refinanzierung der uneinbringlichen Dollar-Schulden einer Nation ohne Weltgeld zu organisieren und für deren Haushalts- und Schuldenpolitik Auflagen zu erlassen, die sie wieder kreditwürdig erscheinen lassen.
Mit dem Recht des – schon wirklich oder absehbarerweise – geschädigten Gläubigers sind bei derartigen Aktionen die Europäer immer mit dabei; in Konkurrenz mit den USA haben sie eigene öffentliche und private Forderungen anzumelden. Umgekehrt beteiligt Washington sie gerne an den Lasten, die die Macher der Weltwirtschaft auf sich nehmen müssen, um lateinamerikanische Pleite-Länder wieder zu geschäftsfähigen Bestandteilen der amerikanischen Dollar-„Hemisphäre“ zu machen bzw. als solche zu retten. Denn so viel ist klar: Die Internationalisierung derartiger lokaler Krisen, ihre Behandlung im Rahmen der ‚Bretton Woods‘-Institutionen und nach deren allgemein geltenden Regeln, bedeutet keineswegs die Entlassung der bankrotten Nation aus der Sonderzuständigkeit der USA, sondern gibt eben dieser – oder umgekehrt dem Status Lateinamerikas als Ansammlung fragwürdiger Süd-Provinzen des US-Dollar-Geschäfts – ihre moderne Verlaufsform. An der Abwicklung der jeweils auf die Agenda geratenen Schuldenaffäre und dem Programm zur Bewältigung der allemal bleibenden Zahlungsnöte macht sich das auch praktisch geltend: Washington hat und behält die Federführung bei der Konstruktion neuer Sicherheiten für die Spekulation auf Lateinamerika; und auf die Rehabilitation des jeweiligen Kandidaten als Dollar-Quelle sind die „maßgeschneiderten Lösungen“ angelegt, die nordamerikanische Experten sich für jeden einzelnen Problemfall ausdenken.
So ist der erste einschlägige „Schock“, die Schuldenkrise Mexikos, dadurch bewältigt worden, dass die US-Regierung – ihr Finanzminister Brady hat sich da verewigt – einen Teil der andernfalls völlig wertlosen Verbindlichkeiten des Staates mit ‚Bonds‘ zu Lasten des eigenen Haushalts unterfüttert hat; in der Gewissheit, dass diese Großzügigkeit sich durch den damit gesicherten Zugriff auf das Erdöl des großen südlichen Nachbarn sowie auf dessen spottbillige Arbeitskraft auf Dauer kapitalistisch mehr als bezahlt machen würde. Zum Musterfall ist dann die „Rosskur“ geworden, der in den 1990er-Jahren das früher einmal als ziemlich „wohlhabend“ eingestufte „Schwellenland“ Argentinien unterzogen worden ist. Nach dem Vorbild Chiles, das gleich nach der gewaltsamen Beendigung seines sozialistischen Irrwegs bereits mit einem „monetaristischen“ Geldregime ausgestattet worden ist, mit dem sämtliche Ressourcen des Landes zur Bereicherung der Dollar besitzenden Geschäftswelt freigegeben und dem ausschließlichen Ziel der Dollar-Erwirtschaftung subsumiert wurden, ist im Argentinien der Menem-Ära bis zur letzten Konsequenz das Experiment durchgezogen worden, eine ganze Nationalökonomie auf den Kopf – bzw. aus Amerikas maßgeblicher Sicht: vom Kopf auf die Füße – zu stellen: Basis allen Wirtschaften sind die Dollars, die das Land einnimmt oder die spekulativ hineingesteckt werden; einheimische Zahlungsmittel sollen nur in dem Umfang überhaupt emittiert werden und zirkulieren, wie sich im Land die Dollars vermehren; so wird sichergestellt, dass an wirtschaftlichen Aktivitäten nur das stattfindet, was private Unternehmer mit gutem Geld für lohnend befinden, und das genau so lange, wie die damit ein lohnendes Dollar-Geschäft hinkriegen; mit dem, was auf die Art an Produktion und Einkommen zustande kommt, muss die Staatsgewalt zurechtkommen und am Ende auch noch das argentinische Volk sein Auskommen finden. Das, darüber sind die USA, Argentinien, der IWF, interessierte Kapitalisten, Europas Lateinamerika-Politiker, italienische Anlageberater, deutsche Banker und überhaupt alle einschlägig Sachverständigen sich einig geworden, ist Dollar-„Hemisphäre“ in Vollendung: Eine ganze Nation funktioniert, ein ganzes Volk subsistiert nur in dem Maße, wie dadurch unmittelbar Dollar-Kapitalisten reicher werden.[8]
(9) Das alles geht. Wo es nicht so leicht geht, hilft ein bisschen zusätzliche Ordnungsgewalt. Für deren rechten Einsatz steht Washington mit Rat und Tat bereit: Die selbstauferlegte Verantwortung für seinen Doppelkontinent lässt es sich nicht nehmen. So ganz ohne Friktionen funktioniert allerdings auch dieses Stück Neue Weltordnung nicht.
So haben sich die USA mit der Regulierung ihres politökonomischen Besitzstandes in den Formen des internationalen Freihandels dann doch einen Haufen fremder Einflüsse eingehandelt, die sich mit ihrem Monopolanspruch auf Ordnungspolitik in der Region schlecht vertragen. Europa konkurriert als Kapitalexporteur und Handelspartner und will mit dem Recht seiner ökonomischen Einmischung sogar Politik machen. Zwischen dem Subkontinent und Ostasien tun sich Handels- und sogar Kreditbeziehungen auf, die glatt an den USA vorbeilaufen. Immer wieder bündeln Staaten der Region auch untereinander und brauchen das gar nicht Yankee-feindlich zu meinen, um in Washington so verstanden zu werden.
Was die innere Ordnung der lateinamerikanischen Länder betrifft, so ist immerhin der linksradikale Oppositionsgeist auf ein systemneutrales Maß reduziert; ganz nebenbei hat auch die katholische Kirche mit den Anhängern einer geradezu Marxismus-verdächtigen „Theologie der Befreiung“ aufgeräumt. Andere sozialrevolutionäre Bewegungen sind oder werden ziemlich erfolgreich dezimiert. Was die Weltmacht nicht gleichzeitig hingekriegt hat, das ist die Unterbindung von Emanzipationsbestrebungen und nationalkapitalistischen Aufbau-Experimenten jenseits der aus Washington vorgegebenen „argentinischen“ Generallinie; Protagonisten eines eigenen, eigenständigen lateinamerikanischen Entwicklungswegs kommen immer wieder zu Zug. Das ist auch kein Wunder. Denn die Politik der vorsorglichen Krisenvermeidung und nachträglichen Schuldenbewältigung, die die USA ihren südlichen Partnern aufs Auge drücken, hat ihre Härten: Wo sie so radikal durchgeführt wird wie in den 90er-Jahren in Argentinien, untergräbt sie die Tauglichkeit einer vergleichsweise entwickelten und potenten Nation sogar für die Dollargeschäfte, die mit ihr angestellt werden und die im Zeichen der umfassenden Privatisierung, des Ausverkaufs aller ökonomischen Ressourcen und Aktivitäten des Landes an Devisen-Kapitalisten, erst einmal kräftig aufleben; denn wenn nur noch funktionieren soll, woran auswärtige Investoren sich bereichern, und die Ressourcen des Landes dafür verschwendet werden, deren Ansprüche auf Bereicherung in Dollarform einzulösen, da funktioniert am Ende auch das nicht mehr. Auch imperialistisch belehrte Nationalpolitiker können das nicht so einfach hinnehmen. So richtig grobe Eigenmächtigkeiten haben sich freilich auch die gerne so genannten „Links-Nationalisten“ abgewöhnt. Sie leisten zwar nicht umstandslos und prompt jeder Ermahnung aus Washington Folge, fügen sich im Endeffekt aber ein in einen panamerikanischen Konsens über die Maßstäbe richtigen Regierens; einen Konsens, der sich wie von selbst am Willen der in jeder Hinsicht übermächtigen Führungsmacht ausrichtet. Ein paar halbe Ausnahmen bestätigen die Regel.
Die Mischung aus botmäßigen und „gemäßigten“ Regierungen garantiert freilich noch nicht, dass deren Herrschaft auch durchgreifend und nach Wunsch funktioniert. Immerhin ist in der Hinsicht zumindest einerseits eine Sache gelungen, die sich den angelsächsisch-demokratischen Betreuern der Latinos oft genug als ein ziemlich gewagtes Experiment dargestellt hat: Nach und nach ist in allen Staaten der Region – Kuba wird mehr denn je auch unter diesem Gesichtspunkt als unerträgliche Ausnahme geächtet – Demokratie durchgesetzt worden: die mehr oder weniger freie Konkurrenz politischer Figuren und Parteien, in aller Regel aus ein und derselben „politischen Klasse“, um den Zugriff auf Reichtümer und Machtmittel des Staates und die freie Entscheidung der wahlfähigen Bürger zwischen den gebotenen Alternativen. Dem Volk werden die herrschenden Zustände einschließlich seines eigenen Elends als Folge des Versagens, der Pflichtvergessenheit und der Korruptheit der jeweils Regierenden verdolmetscht resp. als nationale Notlage, die man unmöglich den korrupten Versagern von der Opposition anvertrauen könne; seine Unzufriedenheit darf es in Wahlen austoben, die unweigerlich die nächste Enttäuschung und deren konstruktive Verarbeitung im nächsten öffentlich ausgetragenen Machtkampf nach sich ziehen. Auch in Lateinamerika klappt diese Herrschaftstechnik nicht schlecht. Andererseits mobilisieren die periodisch fälligen Wahlkämpfe dann doch jedes Mal die Unzufriedenheit der Massen; und bei deren erbärmlicher Lage lässt sich auch durch professionelle Werbung aus dem Heimatland der freiheitlichen Wahlpropaganda nicht unbedingt sicherstellen, dass die Volksstimmung sich in ein Votum für einen passenden Kandidaten verwandelt; zumal sich eben doch immer wieder Parteien finden, die sich als radikale Alternative präsentieren, und eingeborene Politiker, die es mit ihrer Alternative zu ernst meinen. Solche Ausreißer müssen dann eingefangen und auf Respekt vor den „Realitäten“ festgenagelt werden.
So bleibt für die Aufsichtsmacht aus dem Norden immer genug zu tun: aufzupassen, unter Kontrolle zu halten, Ordnung zu stiften, Wohlverhalten zu fördern oder zu erpressen. Und das alles seit „9/11“ ganz besonders, obwohl sich durch dieses Datum in Lateinamerika nun wirklich nichts geändert hat.
II. Amerikas Kampf um eine ‚echte Gemeinschaft von Nationen‘
1. Die amerikanische Diagnose
Washington sieht das anders. Die lateinamerikanischen Staaten sind ihm nämlich im Zeichen des weltweiten Antiterrorkampfs der USA ganz besondere Dienste schuldig:
„Allein wegen unserer ökonomischen Interessen… würde die Region unsere volle Aufmerksamkeit erfordern. Aber unsere politischen und Sicherheitsinteressen an den Amerikas sind ebenfalls vital. Da wir den globalen Krieg gegen den Terror führen, ist es unerlässlich, dass wir starke demokratische Nachbarn haben, die mit uns zusammenarbeiten, um unsere Grenzen zu sichern und unsere gemeinsamen Interessen und geteilten Werte zu verteidigen – sowohl zu Hause wie auswärts.“ (Noriega, a.a.O.)
Die Staaten Lateinamerikas sollen mithin als eine nach innen gefestigte und nach außen geschlossene Dauer-‚Koalition der Willigen‘ funktionieren, als eine feste Bastion amerikanischer Sicherheit, die Amerika einen ‚terrorismusfreien‘ Kontinent garantiert, also für die Erledigung von allem sorgt, was die USA als Bedrohung amerikanischer Interessen ausfindig machen: unsichere Herrschaftsverhältnisse, durchlässige Grenzen, eigene nationale Vorstellungen und Interessen… Dieser Maßstab ist zwar gerade in Bezug auf Lateinamerika nicht neu, eher ist es so, dass die USA ihn nun auf die ganze Welt ausdehnen. Aber nach dem Abgang der Sowjetunion besteht man in Washington auf dem Monopol auf Weltaufsicht und macht sich überall daran, dieses amerikanische Vorrecht weltweit gegen alle antiamerikanischen Umtriebe und Konkurrenzbestrebungen durchzusetzen. Im Gefolge davon gerät auch die angestammte Region amerikanischer Dominanz neu und kritisch in den Blick – als eine Ansammlung von lauter Problemfällen:
„Sogar einige unserer befreundeten Staaten und Alliierten sind im Innern aufgewühlt. In einigen Ländern kämpfen gewählte Führer mit hartnäckigen politischen, ökonomischen, sozialen und in manchen Fällen ethnischen Problemen. Verschiedene Länder sehen sich schweren Bedrohungen der Sicherheit – wegen Narco-Terrorismus oder Gewaltverbrechen – gegenüber, die die Herrschaft des Gesetzes untergraben. Die gegenwärtigen ökonomischen Wachstumsraten sind nicht ausreichend, um genügend Jobs zu schaffen für eine wachsende Bevölkerung, der daher chronische Armut droht. Korruption und Ineffektivität haben in vielen Ländern die ökonomische Entwicklung zum Stillstand gebracht und Enttäuschung gegenüber dem Markenzeichen ‚Freie-Markt-Reformen‘ erzeugt. Alle diese Faktoren zusammen haben die Unzufriedenheit des Volkes angestachelt und, in manchen Fällen, Gewaltausbrüche provoziert, die unter Kontrolle zu bringen relativ schwachen Regierungsinstitutionen schwerfällt…“ (Noriega, a.a.O.)
Für die Verantwortlichen in Washington steht fest: Am Herumfuhrwerken ihres Kapitals und der US-Macht in dieser Hemisphäre kann es einfach nicht liegen, wenn sich allenthalben Unzufriedenheit regt und Länder verfallen. Es gibt dafür überhaupt keinen Grund außer einem einzigen, der mit kapitalistischem Weltmarkt, ökonomischem Zugriff auf diese Länder und US-Eingriffen in ihre Verhältnisse nun aber auch gar nichts zu tun hat: Die politischen Führungen versagen einfach auf der ganzen Linie; sie bringen die Wachstumsraten nicht hin, die der Weltmarkt für sie doch bereit hielte; sie schaffen es nicht, ihre Völker von den Segnungen der Privatisierungen und des Freien Marktes zu überzeugen, die doch auf der Hand liegen; sie sind nicht imstande, ihre Völker verlässlich hinter sich und die USA zu bringen, wie es doch eigentlich selbstverständlich wäre; und sie bringen die staatliche Gewalt nicht auf, die notwendig wäre, um Ruhe und Ordnung gegen Störenfriede dieses Einvernehmens herzustellen. Kurz: Es mangelt da unten an einem ordentlichen Verhältnis von Volk und Führung. Die Regierenden provozieren Unzufriedenheit und Aufruhr im Land; nicht weil sie sich mehrheitlich darauf verlegt haben, ihr nationales Vorankommen mit rücksichtslosem Eingehen auf die Anforderungen des Weltmarkts und seiner Organisatoren zu verfolgen, sondern weil sie genau das unterlassen. Statt im gebotenen US-Sinn wirtschaften und regieren sie genau entgegengesetzt; verantwortungslos also: ‚korrupt‘ eben und ‚ineffektiv‘, was beides ungefähr dasselbe ist.
Während die nationale Kritik in diesen Ländern den regierenden Politikern Bereicherung auf Kosten des Volks und Bedienung auswärtiger statt nationaler Interessen ankreidet, beschuldigen die USA die lateinamerikanischen Regierungen des gegenteiligen Vergehens: Bereicherung und Geldverschwendung auf Kosten der USA. Wenn die lateinamerikanischen Länder nicht für ausreichendes Dollar-Wachstum taugen, dann haben sie sich zu wenig auf die Bedürfnisse der Dollarsubjekte ausgerichtet. Die lokalen Herrschaften leisten sich ökonomisch einfach zu viel und deshalb für die USA zu wenig Und sie leisten sich überhaupt viel zu viel an nationalen Eigenmächtigkeiten. Das ist die zweite Lesart von ‚Korruption‘, die die einschlägigen Vorwürfe, die in diesen Ländern gegen ‚nationalvergessene‘ und ‚yankee‘-hörige Politiker kursieren, schon wieder gründlich auf den Kopf stellt.
Also, so amerikanische Logik, ist es auch kein Wunder, dass die Völker nicht zufrieden sind. Wenn sich die Herrschaften da unten nämlich nur entschieden genug die amerikanische Lesart ihres Vorankommens zu eigen machen und sie nach innen endlich gegen alle Widerstände durchsetzen würden, dann ginge es auch mit dem Land garantiert voran, mit der Armut ebenso garantiert zurück, und dann könnte auch die Zufriedenheit des Volkes gar nicht ausbleiben. Ein gutes Volk hat nämlich nur ein Interesse und Recht: proamerikanisch regiert, dollargemäß sortiert und mit einer ordentlichen Herrschaftsgewalt auf diesen nationalen Weg verpflichtet zu werden. Die Herren vor Ort schaffen es einfach nicht, Amerikas Erwartungen an gelungenes Regieren zu erfüllen und sich dafür bleibende Zustimmung im Land zu sichern. Von da her sind die internen Auseinandersetzungen in diesen Ländern über den schlechten Zustand der Nation und die Schuldigen daran schon gleich ein stetiger Beweis für die Berechtigung der amerikanischen Unzufriedenheit mit dem Zustand der politischen Herrschaften dort. Wenn interne Kritiker an die Macht kommen, werfen sie für die USA immer die Frage auf, wie ernst sie ihren Veränderungswillen meinen und wie weit sie dabei mit ihrer Weigerung gehen wollen, sich an die von auswärts angemeldeten Richtlinien zu halten. Anlass zur Kritik geben aber auch die Figuren, die sich zum Fortschritt mit und durch Amerika bekennen, wenn sie sich damit im Land Opposition einhandeln und mit der nicht fertig werden.
Der Sache nach heißt das, dass die Zentrale für ‚ordentliches Regieren‘ darauf besteht, dass sich die Regierenden in Lateinamerika von ihrer nationalen Betroffenheit, von ihren widerstreitenden politischen Berechnungen und staatlichen Nöten, und von den Nöten und der Kritik ihrer Bevölkerung schon gleich, nicht beirren lassen und für all die Dienste einstehen sollen, die die USA von ihnen erwartet, und zwar so funktional, so reibungslos und rücksichtslos nach innen, wie es sich nun einmal nach amerikanischem Geschmack gehört – auch und gerade dann, wenn die größeren und kleineren Staaten dabei zunehmend verkommen und sich mit diesen Diensten schon deshalb schwer tun. Für die Regierung in Washington sind Armut, Wirtschaftskrise, nationaler Aufruhr, Drogenhandel alles ein und dasselbe – eine Gefährdung ‚amerikanischer Sicherheit‘ in einem ganz elementaren Sinn: Ihre Kontrolle über die lateinamerikanischen Staatenverhältnisse ist bedroht. Selbstkritisch ziehen sie aus dem Zustand ihrer imperialistischen Sonderzone daher den Schluss, dass sie sich viel zu wenig darum gekümmert, stattdessen viel zu sehr darauf verlassen haben, dass ihre Hemisphäre sich quasi automatisch an ihren Interessen ausrichtet und sie bedient, dass sie es also an Ausrichtung haben fehlen lassen.
Das gilt es zu korrigieren, konkurrierende Vorstellungen und Ambitionen auszuschalten, die eigenen endlich durchzusetzen: Wenn man die Region neu und überhaupt zum ersten Mal richtig in eine imperialistische Sonderzone der USA verwandelt, so die weltmachtgemäße Auffassung, dann, aber auch nur dann kann der erwartete Nutzen nicht ausbleiben. Gemäß dieser Devise macht sich Washington seit einiger Zeit daran, mit all den Mitteln und Hebeln, die ihm dank seiner Vormachtstellung zu Gebote stehen, und mit dem Bewusstsein allenthalben verletzter Vorrechte die Abhängigkeitsverhältnisse endlich alternativlos gültig zu machen und dadurch die Brauchbarkeit der Region wieder herzustellen. Kein Wunder, dass diese Anstrengungen mit irgendeiner Form von Instandsetzung der Staaten dort nicht zu verwechseln sind.
2. Der alltägliche Kampf gegen ‚bad governance‘ und ‚corruption‘
- Was die Milliardenkredite angeht, die die Staaten nach US-Lesart mit ihrem falschen Haushalten laufend in den Sand setzen, so hat die US-Regierung im Verein mit dem IWF im Fall Argentinien ein Exempel statuiert mit dem Beschluss, guter US-Kredit solle nicht weiter für ein Land geopfert werden, das ihn gar nicht verdient. Mit diesem Beschluss, den Zweifeln der Anleger in die Zahlungsfähigkeit des Staates durch die Verweigerung weiterer Kredite höchstoffiziell recht zu geben und auf Abrechnen zu bestehen, haben sie maßgeblich den Staatsbankrott Argentiniens herbeigeführt. Zugleich haben sie dem Fall weiteren Handlungsbedarf entnommen: Gegen solche Fälle von Kredit‚verschwendung‘ braucht es einfach bessere Hebel. Solche Kandidaten müssen endlich zu den einschneidenden Sanierungs-Maßnahmen gezwungen werden und haushaltsmäßige Zurückhaltung an den Tag legen. Wenn Washington schon mit seinem Kredit darüber entscheidet, was sich diese Länder noch leisten können und im Interesse des Kreditgebers leisten sollen, dann kann man das Prinzip, dass sich Staatsaufwendungen für innere Bedürfnisse nicht gehören, sondern nur nach Maßgabe der Dollarbedürfnisse und für deren Absicherung genehm sind, gar nicht verbindlich genug als gültige Leitlinie ihrer Kreditierung festschreiben. Deshalb wollen die USA die politischen Kreditgarantien verschärfen und ein geregeltes internationales Konkursverfahren für solche bankrotte Staaten im IWF durchsetzen. Die Schuldenregelungen sollen damit auch formell den Charakter eines Diktats gegenüber diesen Nationen bekommen. Inhaltlich heißt das, dass die Kreditwürdigkeit solcher Länder generell herabgestuft wird, mit dem Anspruch, dass so ein ‚Zuviel‘ an Kredit verhindert, umgekehrt das Lohnen vergebener Kredite garantiert wird. Das muss doch wohl unter richtiger Anleitung zu haben sein, dass solche IWF-Kandidaten das Kunststück fertig bringen, mit einer rigorosen Beschneidung der staatlichen Finanzen eine ordentliche Bedienung ihrer Dollarschulden auf die Beine zu stellen und mit verminderter internationaler Kreditausstattung und dezimierten nationalen Erträgen wieder für eine ordentliche Dollarakkumulation einzustehen.
- Vor allem bei der Privatisierungspolitik, diesem Herzstück der ‚Freie-Markt-Reformen‘ gibt es immer wieder Friktionen, Widerstände und politische Auseinandersetzungen; auch und gerade dort, wo es um elementare stoffliche Grundlagen kapitalistischen Wachstums wie Öl und Erdgas geht, aber auch bei der staatlichen Regelung der Konditionen für die Strom-, Wasser- und anderen Unternehmen, die inzwischen in internationaler Kapitalistenhand sind oder zu möglichst lohnenden Bedingungen dorthin gelangen sollen. Dafür sollte z.B. das ausgehandelte Abkommen mit Bolivien über die weitere Exploration der Erdgasvorkommen wegweisend sein, nach der Erschöpfung der bolivianischen Zinnminen so ziemlich das einzig weltmarktträchtige Angebot des Landes. Ein internationales Konsortium unter Führung von US-Kapital wollte die erweiterte Exploration und die vertraglich fest fixierte Lieferung in die USA übernehmen – zu geschäftlichen Sonderkonditionen. Der bolivianische Staat sollte und wollte sich mit einer besonders niedrigen Gewinnsteuer begnügen – nach dem Grundsatz, dass sich für die Erhaltung der Kreditwürdigkeit des Landes, das auf Schuldenerlass und neuen Kredit angewiesen ist, letztlich nicht die möglichst lukrative Beteiligung an solchen Geschäften auszahlt, sondern das Wohlwollen der Investoren und Kreditgeber. So hätte alles gepasst.
Und dann scheitert dieses rundum gelungene Projekt am Widerstand der bolivianischen Bevölkerung gegen den ‚nationalen Ausverkauf‘ an die USA! Die Regierung und das Militär fallen nach gewaltsamem Vorgehen gegen die Protestierenden schließlich um, der Präsident tritt zurück, die neue bolivianische Regierung gibt dem Volkszorn allen Drohungen aus der Zentrale der ‚Amerikas‘ zum Trotz berechnend nach, laviert und versucht erfolgreich, mit einem Referendum die aufgebrachten Nationalisten mit ihren Forderungen nach einer ‚Nationalisierung‘ der eigenen Ressourcen zu befrieden und sich zugleich Rückendeckung für Neuverhandlungen über eine bessere staatliche Beteiligung an der Unternehmung zu verschaffen. In den Augen der USA ein eklatanter Rechtsbruch und ein eindeutiger Verstoß gegen die Pflichten einer auswärtigen Regierung. Ein Anschlag auf die heiligen Grundsätze der Investitionsfreiheit und des Eigentums. Ein Fall für US-Schadenersatzforderungen und für Entzug von Kredit – der ist nämlich für die Förderung dieses Projekts und die Belohnung entsprechenden politischen Wohlverhaltens reserviert. Vor allem aber: ein Beweis, dass solche Projekte und die ganze Privatisierungspolitik überhaupt dem nationalen Für und Wider entzogen und ein für alle Mal der freien Entscheidung der Dollaranleger überantwortet werden müssen.
- Ausgerechnet in Venezuela, dem wichtigsten Öllieferanten der USA in der Region, liegt ein noch viel gravierenderer Fall von ‚bad governance‘ vor. Ausgerechnet dort ist Chávez an die Macht gewählt worden, den die USA verdächtigen, den Antiamerikanismus zum nationalen Programm erhoben zu haben, ein Mann , der die herrschenden Weltmarktverhältnisse für ungerecht ansieht, der Auffassung ist, dass sein Land trotz seines Ölreichtums zunehmend verkommt, dieser Reichtum also falsch, weil nicht für ein nationales Vorankommen verwendet wird. In diesem Sinne macht er sich für ein nationales Aufbauprogramm stark und an einer Korrektur der eingerichteten Verhältnisse zu schaffen, veranstaltet Volksbildungs- und andere soziale Kampagnen, unternimmt also lauter Anstrengungen, die für sich schon von einem falschen nationalen Ehrgeiz zeugen und die herrschenden Kreise mit ihren eingefahrenen Beziehungen zu den USA stören. Statt das Vorankommen der Ölindustrie und ihrer Profiteure, Garanten einer an den Interessen der USA ausgerichteten Geschäftspolitik, zu befördern, stellt er die Ölindustrie verstärkt unter staatliche Kontrolle und verschwendet einen Gutteil der Öleinnahmen, also gute US-Dollars, für seine nationalen Fortschrittsambitionen. Statt sich von den US-Einsprüchen beeindrucken zu lassen, droht er damit, das Öl als politische Waffe gegen die USA einzusetzen und agitiert innerhalb der Opec gegen deren Unterwerfung unter US-Interessen. Außerdem unterläuft er das US-Progamm zur Erledigung Castros, indem er Cuba mit Öl beliefert und sich in aller diplomatischen Form mit ihm solidarisiert. Überhaupt fordert er ganz Lateinamerika zu mehr nationaler ‚Würde‘ und gemeinsamer Emanzipation von der US-‚Bevormundung‘ auf. Kurz, er führt sich in allen Belangen als bekennender Antiamerikaner auf.
Also ist dringend Einwirkung geboten, schon wegen des wichtigen Guts, von dessen Verfügbarkeit der reibungslose Gang des Produzierens und überhaupt des ganzen kapitalistischen Getriebes abhängt, das so ein Ölland daher nicht wie sein frei verfügbares Eigentum behandeln darf. Dass auch Chávez mit seinen nationalen Ambitionen auf Einkünfte aus dem Weltmarkt setzt, auf ihm, nicht gegen ihn agieren will, das reicht überhaupt nicht, um das Kontrollbedürfnis der Weltführungsmacht über dieses strategische Gut zufrieden zu stellen. Solche Länder haben dafür zu sorgen und zu garantieren, dass die Versorgung reibungslos funktioniert, dass die Konditionen stimmen und dass die Einkünfte den Unternehmen und den Figuren im Land zugute kommen, die für ein gutes Verhältnis zu Washington einstehen. Dieses Geschäft darf keinesfalls störenden Berechnungen der Staaten unterliegen, in deren Boden der Rohstoff zufällig lagert, und schon gar nicht dürfen die Dollareinnahmen für eine Politik missbraucht werden, die sich ausdrücklich gegen dieses Recht der kapitalistischen Führungsmacht richtet. So etwas darf keine Schule machen und womöglich antiamerikanische Bestrebungen anderswo ermuntern.[9]
An Einwirkung lassen es die USA denn auch nicht fehlen. Chávez wird diplomatisch angefeindet und geächtet, die Opposition mehr oder weniger offen ermuntert und gefördert; die arbeitet offen auf einen Sturz hin, inszeniert erst einen Putsch, versucht nach dessen Scheitern die Ölindustrie lahmzulegen, strengt schließlich – von Chávez zugelassen – ein Referendum zu seiner Abwahl an und droht nach dessen Scheitern wieder mit offenem Aufruhr… Es hilft nichts, alle diese Versuche taugen zwar dazu, dass keine Ruhe einkehrt, aber eine Mehrheit des Volks und des Militärs hält zum Präsidenten – obwohl die USA doch deutlich genug auf seine Ablösung gedrungen haben. Also ist die US-Administration außer mit Chávez nun auch mit der untauglichen Opposition unzufrieden, zumal auch bei den nächsten Wahlen eine verlässliche Erledigung nicht abzusehen ist. Diese Art von Demokratie ist keine. Das Land destabilisieren, das geht zwar und wird ja auch nach Kräften betrieben, aber das ist selbstverständlich keine ordentliche Lösung für den Kontrollbedarf der USA. Im Gegenteil: Solche Schwierigkeiten, das selbstverständliche Anrecht auf passendes Regieren zur Geltung zu bringen und Eigenmächtigkeiten zu unterbinden, sind ein schlagender Beweis, dass es an geeigneten Einwirkungsmöglichkeiten in diese Länder fehlt. Nur ‚von außen‘ mit dem ganzen Gewicht der Vormacht auf richtiges Regieren hinzuarbeiten, das genügt den Anforderungen an die nationale Ausrichtung solcher Länder nicht. Die USA müssen unmittelbarer und umfassender in die inneren Staatenverhältnisse ihrer Hemisphäre hineinwirken können, solche Fälle möglichst schon im vorhinein unterbinden, sie zumindest aber viel verlässlicher korrigieren können – diesen Bedarf entnimmt man in Washington solchen Störfällen.
- Gleich mehrere Staaten versagen den USA beim Antidrogenkampf den Dienst – so jedenfalls die berufene Ansicht aus dem Hauptland des Drogenkonsums und Drogengeschäfts. In vielen lateinamerikanischen Staaten wächst nämlich der Drogenanbau und -handel trotz Einspruchs aus Washington. Ökonomisch fungiert dieses Geschäft für die Länder dort als ein Ersatz für ausbleibende produktive, staatsdienliche Leistungen der Gesellschaft: Es stiftet die Überlebensbasis von Bauern, die ansonsten nichts zählbares zu produzieren vermögen, aber auch nicht unbehelligt auf eigenem Land ihre Subsistenz fristen können; es ist verlässliches Geschäft für Händler und ‚Drogenbarone‘, die aus der Armut dieser Bauern und der nie versiegenden zahlungskräftigen Nachfrage nach Drogen, die die bürgerlichen Verhältnisse in den USA und anderen zivilisierten Nationen stiften, Profit schlagen; sonstige geschäftliche und politische Kreise im Land profitieren direkt oder indirekt mit davon, dass das Geschäft Dollars ins Land spült; es ist sogar besonders einträglich und konjunkturunabhängig – aber eben: verboten. Das macht es für die politisch Zuständigen im Land zu einer zweischneidigen Sache, der sie sich mit einer Mischung aus Berechnung und relativer Ohnmacht – nach innen wie gegenüber den USA – widmen.
Damit stellen sie ein wachsendes Ärgernis für die USA dar. Erstens weil das den US-Staat störende und von ihm kriminalisierte Laster seiner Gesellschaft bekämpft werden muss, und zwar an der ‚Wurzel‘ – vor Ort in Lateinamerika, wo sonst; die dortigen Zuständigen haben die Pflicht, die US-Jugend, Hauptmarkt für diesen Geschäftsartikel, vor Drogen zu schützen, statt sich an einem nicht erwünschten Geschäft zu bereichern. Zweitens und vor allem aber, weil aus dem Drogengeschäft auch politische Feinde der USA Mittel beziehen. Guerilla- und Indigenenbewegungen stützen sich auf Kokabauern, lassen sich von Drogenhändlern Tribut zahlen und finanzieren sich so. Also handelt es sich bei diesen Bewegungen um eine besonders gefährliche, nämlich politisch motivierte Form von organisierter Kriminalität und beim organisierten Drogenhandel nicht bloß um ein kriminelles Geschäft, sondern um die Quelle antiamerikanischer Gewalt vor der Haustür der USA – beides so oder anders herum gesehen ein und dasselbe: ‚Narcoterrorismus‘.
Natürlich wissen auch amerikanische Politiker, dass Drogengeschäfte und politische Auflehnung gegen die herrschenden Interessen und die staatliche Gewalt in diesen Ländern und damit auch gegen das Wirken der USA nicht dasselbe sind. Aber nach der Logik, dass es sich beide Male um amerikafeindliche Umtriebe handelt, die auch noch Hand in Hand arbeiten, gehört beides zusammen. Dieser Zusammenschluss ist nicht bloß erfunden, um in Wahrheit ‚soziale Bewegungen‘ zu diskreditieren und sich einen Vorwand für die Bekämpfung der Guerilla zurechtzulegen, wie Kritiker meinen – als ob die USA gegenüber erklärten Feinden solche Vorwände bräuchten! – Er ist die praktisch gültige Sichtweise, mit der die USA sowohl die oppositionellen Bewegungen zu erledigen trachten wie auf den Drogenanbau vor Ort losgehen. Und diese Sichtweise haben sie sich nicht erst mit dem 11. September zugelegt.[10] Die Betrachtung und Behandlung der verbliebenen Guerillakämpfer in Lateinamerika – allen voran die FARC und ELN in Kolumbien – als ‚Terrorismus‘ steht für Washington schon länger fest, ist quasi der erste Dauerfall für den ‚Kampf gegen den Terrorismus‘, noch bevor Bush dieses Programm zur allgemeinen Agenda US-amerikanischer Weltpolitik erhoben hat. Mit diesem weltpolitischen Übergang sind die lateinamerikanischen Gegner dann aber auch in eine größere Front eingereiht. Linke kolumbianische Guerilleros wollen zwar sicher anderes als islamische ‚Fundamentalisten‘, anderes auch als Saddam Hussein, aber sie widersetzen sich mit ihrem Widerstand gegen die kolumbianische Zentralregierung den Ordnungsvorstellungen der USA für die Region, bedrohen damit diese selbst, haben dafür sogar gewisse Mittel – also gehören sie zum weltweiten Lager der Feinde Amerikas, das es auszurotten gilt.[11]
Deshalb geraten sowohl die Berechnungen wie die Ohnmacht der örtlichen Regierungen, des doppelten ‚Sumpfs‘ Herr zu werden, ins Visier der US-Regierung. Das trifft alle Länder, die als Anbaugebiet, Durchgangsland oder Anrainerstaat und Ausweichgebiet für das Drogengeschäft fungieren – also so ziemlich alle. Dass es sich hier um einen dauerhaften, länderübergreifenden Krieg handelt, an dem sich die Staaten zu beteiligen, den sie unter Anleitung der USA auf ihrem Boden ohne Rücksicht zu führen haben, wenn sie sich nicht der Duldung und Unterstützung von ‚Terrorismus‘ schuldig machen wollen, das ist die Auffassung, zu der Washington sich entschlossen hat und die es den lateinamerikanischen Regierungen abverlangt; Regierungen, die ihrerseits eine mit Gewalt oder berechnenden Zugeständnissen zu befriedende Guerilla keineswegs in eins setzen mit einer Drogenmafia, zu der mancher aus den politischen Kreisen nicht die schlechtesten Beziehungen unterhält und deren Beitrag zum ‚Bruttosozialprodukt‘ sie im gegebenen Fall durchaus zu würdigen wissen. Jedenfalls ist die US-Regierung dazu übergegangen, entsprechendes Wohlverhalten verstärkt einzufordern und die Beziehungen von entsprechenden Taten abhängig zu machen – allein 14 lateinamerikanische Staaten unterliegen einem jährlichen „Zertifizierungsverfahren für die Kooperation bei der Bekämpfung des Drogenhandels durch ausländische Regierungen“. Verlangt und auch von allen einschlägigen Ländern praktiziert wird die Zerstörung von Anbauflächen, damit auch von bäuerlichen Existenzen, weil es für sie in jeder Hinsicht keinen Ersatz gibt. Länderübergreifend sollen die Transportwege geschlossen, Grenzen und Geldströme kontrolliert werden, so dass sich selbst ein proamerikanischer Vorzugspartner wie die Regierung Panamas den Vorwurf der Untätigkeit zuzieht, weil Drogenbarone dorthin ausweichen und FARC-Kämpfer den Grenzdschungel als Rückzugsgebiet benutzen. Überlassen wird der Kampf den Ländern nicht; sie erhalten von den USA logistische und materielle Unterstützung, Ausbildung von militärischen Kräften, gemeinsame Luft- und Seeüberwachung, Beteiligung an militärischen Aktionen usw., eine Hilfe, die Washington die Rolle der Koordination und Überwachung sichern soll.[12] Der Kampf findet also unter seiner Regie statt; die Folgen der bürgerkriegsähnlichen Übergänge haben die Staaten selber zu verwalten.
Vor allem gefordert, in diesem Sinne dann auch gefördert, ist Kolumbien, erklärte Zentrale der unseligen Allianz von Drogen und Terrorismus. Die USA wissen, woran es dort ganz besonders fehlt: an einer Staatsgewalt, die dem ‚Narcoterrorismus‘ durch ihre machtvolle Existenz den Boden entzieht.[13] Auf deren Zustandekommen dringen sie jetzt mit Entschiedenheit. Worauf die sich gründen soll, ist keine Frage: auf die Schlagkraft des ordentlichen Militärs statt auf die in den Augen Washingtons unzuverlässige und ineffektive Privatmacht der Paramilitärs; auf US-Unterstützung beim Krieg gegen die Guerillabewegungen. Was sie sich vornehmen soll, ist ebenso klar: sich endlich im Land ordentlich durchsetzen und rücksichtslos mit der Guerilla aufräumen. In diesem Sinne sind die USA aktiv geworden und haben schon mit Kolumbiens Vorgängerregierung ein entsprechendes Vorgehen beschlossen. Der ‚Plan Colombia‘ verband den militärischen Auftrag zur Erledigung des ‚Narcoterrorismus‘ mit dem berechnenden Angebot zu Friedensverhandlungen mit der Guerilla sowie dem Versprechen, die Zerschlagung der Drogenökonomie würde mit einem sozialen Ersatz- und nationalen Aufbauprogramm einhergehen.[14] Inzwischen sind diese leeren Versprechen eines ‚Friedensprozesses‘ und irgendeines ökonomischen Ersatzes für die Zerstörung der Drogenökonomie als falsche Zugeständnisse an den Terrorismus gestrichen und die gewaltsame Befriedung offiziell zur obersten und einzigen Leitlinie erhoben worden. Der kolumbianische Präsidenten Uribe reiht sich offensiv in die antiterroristische Front der USA ein, forciert im Innern den Dauerkrieg gegen die linken Kräfte und bietet im selben Maße, wie er die Guerilla bekriegt, den Paramilitärs Wege, sich irgendwie ins normale ‚zivile‘ Leben und die Armee zu integrieren. Dafür fordert er laufend und rechnet auf Unterstützung aus Washington. So wird die Sache auf ihren Kern gebracht: die Durchsetzung des flächendeckenden staatlichen Gewaltmonopols gegen alle inneren Widerstände und Gegner, also gegen die halbe Gesellschaft, mit den Mitteln und Methoden, die dafür nun einmal angemessen sind. Für dieses Kampfprogramm sind die USA auch bereit, sich verstärkt mit Geld und Gewaltmitteln zu engagieren und das kolumbianische Militär in deren sachgerechten Gebrauch einzuweisen.[15] Zufrieden sellt sie das nicht. Die Notwendigkeit, sich laufend um das Zuschlagen gegen den ‚Drogensumpf‘ in verschiedenen Ländern kümmern zu müssen, beweist, dass es allenthalben an ausreichend entschlossenen und schlagkräftigen Regierungen, v.a. aber an länderübergreifender Kooperation und durchgesetzter militärischer Kontrolle der ganzen Region unter US-Regiefehlt.
Schon gleich unerträglich ist es vom Standpunkt der US-Aufsichtsmacht, wenn vor ihrer ‚Haustür‘ staatliche Habenichtse und Anhängsel von US-Hilfsgeldern wie Haiti die erforderliche politische Stabilität und Einhegung des Elends schuldig bleiben und stattdessen zum Flüchtlings- und Drogenumschlagplatz verkommen.[16] Ausgerechnet in diesem unbedeutenden Elendsquartier geht ohne laufende Intervention der USA nichts, weil es kein einigendes Staatsinteresse und keine funktionierende Staatsgewalt gibt und daher im Innern immer wieder gewaltsame Unruhen ausbrechen. Auch hier ist dringend Abhilfe geboten. Wenn schon von außen laufend ordnende Gewalt nötig ist, dann muss die wenigstens so geregelt werden, dass die USA die Aufsicht führen, aber nicht laufend die Lasten für die Befriedung völlig nutzloser Gewaltauseinandersetzungen zu tragen haben.
Allen diesen Fällen tätiger Aufsicht und Ausrichtung entnimmt die US-Regierung das, was ihr Vertreter in dem zitierten Generalurteil über den problematischen Zustand der Region kundtut: dass es überall an Ordnung fehlt, dass es mithin an ihrer durchschlagenden und anerkannten Ordnungsgewalt in ihrer Hemisphäre mangelt. Von daher sind die Verantwortlichen für Recht und Ordnung, Marktwirtschaft und Demokratie Lateinamerikas in Washington zu der Auffassung gelangt, dass sie ihre Vormacht nicht entschieden und verlässlich genug zum Einsatz bringen und bringen können, dass sie für die Durchsetzung ‚guten Regierens‘ in der Region ein besseres, ein umfassenderes und wirksameres Instrumentarium brauchen. Deshalb verfolgen sie seit einiger Zeit das Programm, die zunehmend verspürten Hindernisse und Friktionen ihrer ‚Ordnungspolitik‘ los zu werden, besser gesagt: ihr Einwirken, Drohen, Erpressen, Intervenieren auf eine neue Grundlage zu stellen.
3. Das strategische Programm einer neuen Staatenordnung in Lateinamerika: Die Institutionalisierung der US-amerikanischen Vorherrschaft
Die USA sind es leid, als Vormacht ihre Interessen immer erst anmelden, gegen Widerstände dieser Länder und die Ambitionen von Konkurrenten durchsetzen zu müssen. Sie wollen ihre Vormachtstellung und das, was daraus an Rechten für sie und an Pflichten für die regionalen Herrschaften folgt, als gültigen Kanon festlegen, als dem jeweiligen Staatswillen entzogene anerkannte Staatenordnung festschreiben und deren Durchsetzung neu organisieren. Innerhalb der Region soll der Nationalismus der lokalen Souveräne ein für alle Mal auf Amerikatauglichkeit festgelegt werden. Zugleich wollen die USA damit auch nach außen, gegenüber den imperialistischen Konkurrenten die Konkurrenz um Aufsicht und Benutzung dieser Staaten neu für sich entscheiden. Die ausdrückliche Verwandlung der Region in eine den USA verpflichtete Sonderzone, eine Art US-Besitzstand für Aufsicht und Dollargeschäfte – das halten die USA für geboten. Sie dringen auf ein umfassendes Regelungswerk, das Lateinamerika in eine verlässliche Sonderzone unter US-Regie verwandeln soll.
a) Das Projekt einer „gesamtamerikanischen Freihandelszone“ (FTAA/ALCA): Die Festschreibung eines ökonomischen Besitzstandes der USA mit strategischen Perspektiven
Bei diesem Projekt handelt es sich in keiner Hinsicht um einen Freihandelsvertrag in dem Sinn, dass da Staaten den Austausch von Waren und Dienstleistungen von gewissen beiderseitigen staatlichen Schranken befreien, weil sie jeweils vom Markt der anderen mehr profitieren wollen, deswegen aber auch um eigene Zugeständnisse nicht herumkommen. Was die Form einer zwischenstaatlichen Übereinkunft über wechselseitige Rechte und Pflichten, also Vertragsform hat, ist erstens seinem ökonomischen Inhalt nach eine alle Bereiche nationaler Standortpolitik umfassende einseitige Festlegung des geschäftlichen Verkehrs zwischen den beteiligten Nationen. Zweitens reicht das Abkommen über ein Wirtschaftsabkommen entschieden hinaus. Zudem zeigt die Art, wie sie sich mit ihren ‚Partnern‘ über dieses Vertragswerk auseinandersetzen, dass es sich in diesem Fall – imperialistisch sachgerecht – um ein Diktat in Vertragsform handelt, das die Festschreibung einer Monopolstellung zum Inhalt hat.
(1) An Deutlichkeit lassen ihre Verlautbarungen nichts zu wünschen übrig:
„Mit der FTAA verfolgen wir das Ziel, den nordamerikanischen Unternehmen die Gewalt über ein Gebiet, das sich vom Nordpol bis zum Südpol erstreckt, zu geben und ihnen auf der gesamten Hemisphäre ungehinderten Zugang für ihre Produkte, Dienstleistungen, Technologien und Kapital zu garantieren.“ (US-Außenminister Powell , zitiert aus: „Im Vorfeld von Cancun – Multilaterale Verhandlungen zu Freihandelsabkommen und der FTAA“, Heinrich-Böll-Stiftung)
Washington ist der Auffassung, dass es, wenn amerikanisches Kapital auf dem Weltmarkt die beanspruchten Wachstumsraten nicht mehr zustandebringt, an ‚freiem Handel‘ fehlt. Die US-Vertreter gehen nämlich von der Sonderstellung ihres Kapitals aus:
„Die Amerikaner sind immer noch der größte Erfinder neuer Technologien der Welt und der größte Auslandsinvestor der Welt. Wir sind der effizienteste Nahrungsmittelerzeuger der Welt und die führende Quelle für Informationen und Unterhaltung der Welt.“ (Bush)
Wenn diese Überlegenheit nicht wunschgemäß zum Zuge kommt, dann kann es folglich nur an der ungerechtfertigten Abschottung auswärtiger Staaten liegen. Also arbeiten die USA daran, ihrer kapitalistischen Überlegenheit durch eine Veränderung der politischen Geschäftsbedingungen für alle lateinamerikanischen Staaten Geltung zu verschaffen, wie wenn sie ihren Unternehmen ein Reich lohnender Anlagen erst neu erobern müssten:
„Wir streben an, in den FTAA-Ländern Regelungen zu implementieren, die künstliche oder handelshemmende Barrieren für US-Investitionen reduzieren oder ganz unmöglich machen – während gleichzeitig sicherzustellen ist, dass Investoren von anderen FTAA-Staaten in den USA keine größeren substantiellen Rechte, den Investitionsschutz betreffend, zugebilligt bekommen als US-Investoren in den USA. Für US-Investoren in anderen FTAA-Staaten sind Rechte sicherzustellen, die vergleichbar sind mit denen unter US-Rechtsprinzipien und Praktiken.“ (US-Handelsbeauftragter Zoellick, Strategiepapier 2002)
Die ökonomischen Bestimmungen des Vertragswerks lassen an Klarheit nichts zu wünschen übrig. Hier geht es nicht um Leistung und Gegenleistung, hier dekretieren die USA ihren Bedürfnissen entsprechend die Freiheit ihrer Kapitalisten auf den lateinamerikanischen Standorten – und zwar so einseitig und umfassend und so rücksichtslos gegen widerstreitende Berechnungen, wie es die Unzufriedenheit mit den Ergebnissen dieses Zugriffs gebietet:
Das schlägt sich einerseits nieder in Marktregelungen, die den Warenverkehr betreffen. US-Gütern einschließlich Agrar- und Billigprodukten wird freier Zugang in diese Länder gestattet; umgekehrt werden die Hauptexportgüter der Südländer – v.a. Agrarprodukte sowie Stahlprodukte – im Prinzip nur soweit zugelassen, wie sie US-Kapital mit Billigrohstoffen bedienen.[17] Ergänzung und Beitrag zum amerikanischen Geschäft, nicht aber Zulassung zur Konkurrenz gegen es, ist da das Prinzip. Deshalb werden dann auch die Anstrengungen, mit Ruinierung heimischer Arbeitskraft und Umwelt den Mangel an konkurrenzfähigem Kapital auszugleichen, durch die wohldosierte Verpflichtung auf Sozial- und Umweltstandards diskriminiert.[18] Das ist es dann aber auch schon, das ganze Angebot an die lateinamerikanischen Nationen: ein paar beschränkte Verbesserungen beim Warenexport als Gegenleistung für die endgültige Ruinierung der nationalen Konsumgüterproduktion durch US-Massengüter – soweit sie nicht schon als in diese Staaten ausgelagerte Billiglohnabteilungen nordamerikanischer Textil- ,Elektronik- und anderer Unternehmen fungiert.[19]
Alles andere im Vertrag ist ein weitreichender Forderungskatalog, der die Freiheiten des Kapitalverkehrs betrifft, also ausschließlich die Stellung amerikanischen Kapitals auf den auswärtigen Standorten, denn die haben es selber zum Kapitalexport ja nicht gebracht: Die Länder sind angehalten, diesem US-Geschäftsartikel schlechthin alle Hindernisse aus dem Weg zu räumen, die eine irgendwie noch autonome staatliche Standortpolitik in den Augen der USA darstellen. Jede Bevorzugung heimischer Bewerber bei Staatsaufträgen soll unterbleiben, Staatsunternehmen müssen sich dem ‚freien Wettbewerb‘ stellen, ein ‚gleichberechtigter‘, d.h. dank seiner Kapitalmacht bevorzugter Zugang für US-Kapitalisten zu allen staatlich eröffneten Geschäftsgelegenheiten soll gewährleistet werden; Bildung, Gesundheit, Wasser, Strom, Telekommunikation und Banken müssen frei ‚handelbare Güter‘ sein; der Privatisierungsauftrag wird also generell auf alle das US-Kapital interessierenden staatlichen Infrastrukturabteilungen ausgeweitet; die Verwandlung in privates Geschäft hat dann unwiderruflich zu gelten, eine Wiederverstaatlichung soll ausgeschlossen sein. Auch und gerade die staatlich beaufsichtigten Grundlagen nationalen Produzierens sollen in rechtlich verpflichtender Form ohne Rücksicht auf staatliche Bedenken und Standortwirkungen als Geschäftsquellen definiert werden.[20]
Vertraglich werden damit die dortigen Standorte als freies Betätigungsfeld für amerikanisches Kapital definiert ohne die Dazwischenkunft einer vor Ort zuständigen Staatsgewalt, die gemäß eigenen Standortbedürfnissen Aufträge vergibt, die mit ihrer Hoheit nationale Unternehmungen zu fördern versucht oder selber dort aufzieht, wo die Schaffung von allgemeinen Standortvoraussetzungen sich nicht mit dem Maßstab der Rentabilität deckt, die sich aus Berechnung oder Not gewisse Schutzvorkehrungen gegen auswärtige Konkurrenz leistet oder auch als Staat aus deren Geschäft Nutzen ziehen will – alles das, was diese Staaten sich bei ihrem Konkurrenzkampf um die Attraktion von Weltgeschäft immer noch ‚herausnehmen‘ oder zumindest vorbehalten möchten, fällt unter ‚Diskriminierung‘, ‚unerlaubte Wettbewerbsverzerrung‘, ‚Protektionismus‘, ‚Beschränkung der Unternehmensfreiheit‘. Insoweit wird mit dem Urteil, dort herrsche bisher kein wirklich freier Handel, radikal ernst gemacht. Das Interesse der lateinamerikanischen Staaten an nationalem Vorankommen durch auswärtigen Kapitalzufluss wird damit auf den Kopf gestellt: Das Interesse des amerikanischen Kapitals an diesen Standorten gibt die Normen vor, die diese Staaten zu ihrem Interesse zu machen haben unabhängig davon, ob sie damit vorankommen. Es soll nicht nur faktisch eine Sonderstellung einnehmen, sondern das existente, seiner kapitalistischen Natur nach einseitige Verhältnis zwischen der ökonomischen Vormacht der USA und dem erweiterten lateinamerikanischen Dollargeschäftsraum soll die Gestalt eines gültigen Vorrechts erhalten. US-Kapital und seine Agenten sollen sich dort wie unter US-Hoheit bewegen können. Die US-Aufsicht darüber schließt ein, dass die dortigen Standorthüter sich daran halten. Die Durchsetzung und Sicherung dieser Ordnung und die Entscheidung der daraus resultierenden Streitigkeiten um die Rechte von US-Kapitalisten soll dem Einfluss der dortigen Staaten entzogen und nach US-Recht und -Interesse gewährleistet werden.[21] Die daraus erwachsenden Konsequenzen für diese Staaten werden an sie zurückverwiesen. In der Rolle des Garanten für den freien Zugriff von US-Kapital, dessen Schutz der auswärtige Souverän auch gegen seine eigenen Standortbedürfnisse verpflichtet ist, werden sie dagegen weiterhin und ganz neu beansprucht.
(2) Das richtet sich einerseits gegen die Anstrengungen lateinamerikanischer Länder, in den existenten Abhängigkeiten für die Verbesserung ihrer nationalen Reichtumsbilanz alles in ihrer Macht Stehende zu tun und, soweit es eben geht, auf nationalen Nutzen aus internationalen Kapitalengagements zu achten. Insofern zielt dieser Vertrag vornehmlich auf die Nationen Lateinamerikas, die sich überhaupt einen eigenen Standpunkt nationalen Vorankommens durch eine staatliche Einflussnahme auf die ökonomischen Abhängigkeitsverhältnisse leisten können und auch immer wieder leisten. Ländern wie Brasilien und Argentinien werden damit Bemühungen, die sie für ihre Besserstellung im Weltmarkt angesichts ihrer ständig prekären nationalen Bilanzen für nötig und gerecht halten, nicht nur faktisch durchkreuzt, sondern förmlich bestritten. Ein besserer Zugang zum Weltmarkt, Abbau von Zollschranken und Agrarprotektionismus insbesondere der USA wie auch Europas, Änderung der WTO-Regeln in ihrem Sinne, das ist es ja gerade, was sie sich als die Hebel vorstellen und zu erreichen versuchen, um aus dem Status von Weltgeldschuldnern herauszukommen, der sie zu ziemlich erpressbaren Kandidaten von IWF und Kreditgebernationen macht. Gerade diese beiden wichtigsten Länder – Mexiko hat sich ja schon aufgrund seiner besonderen ökonomischen Stellung als Nachbar der USA mit der NAFTA, dem Vorbild des gesamtamerikanischen Projekts der USA, in der Rolle einer in Lateinamerika damit immerhin privilegierten Sonderzone des Dollar-Kapitalismus eingerichtet – suchen nach alternativen Wegen weltmarktmäßiger Besserstellung durch die Schaffung einer eigenen lateinamerikanischen Wirtschaftszone. Der Mercosur – und die entsprechenden Wirtschaftsbündnisse kleinerer Staaten sowieso – kommen zwar nie so recht voran, weil sie ihr Handikap des nationalen Kapitalmangels auch gemeinsam nicht los werden, für einander also nicht einmal als die entscheidenden Märkte, geschweige denn als Anlagesphäre resp. Kapitalexporteur oder Kreditgeber fungieren, insofern immerzu gegeneinander um das Kapital und die Märkte ganz anderer Nationen konkurrieren und sich deswegen auch selten auf substantielle Gemeinsamkeiten ökonomischen Vorankommens miteinander einigen. Aber sie bemühen sich gleichwohl darum, diesem ‚lateinamerikanischen‘ Weg mehr Gewicht zu verschaffen, andere – ebenfalls unzufriedene – Nachbarstaaten mit einzubeziehen und darüber dann auch mehr Gewicht für ihre Revisionsanträge in den Verhandlungen der Weltmarktagenturen gegen die großen Kapitalnationen zu erlangen.
Das Einigungsprojekt der USA richtet sich zugleich gegen Konkurrenten von außerhalb der amerikanischen ‚Hemisphäre‘. Das wird auch unverblümt ausgesprochen:
„Bush erklärte anlässlich des Gipfels von Quebec, die FTAA werde es den USA erlauben, von der Basis eines starken regionalen Integrationsraums aus besser gegen Ostasien und Europa konkurrieren zu können.“ [22]
Die Staaten Lateinamerikas sind nicht einfach – so, wie die USA es für andere Weltgegenden erfolgreich durchgesetzt haben oder noch anstreben – Schauplätze eines offenen Konkurrenzkampfes, den potente Mächte unter Einsatz ihrer jeweiligen Mittel um ökonomischen Nutzen und politischen Einfluss führen; sie sind zuerst und grundsätzlich integrale Bestandteile – teils bloße Peripherie, teils durchaus ernsthafte Mitglieder – einer gesamtamerikanischen Wirtschaftsmacht, mit der die USA gegen die zwei anderen regionalen Zentren des Weltkapitalismus zur Konkurrenz um den Nutzen aus dem Weltgeschäft überhaupt und um die Macht über dessen Geschäftsordnung antreten: Dieses Verhältnis will die US-Regierung förmlich institutionalisieren und allgemein als verbindlich anerkannt haben. Ausländische Wirtschaftsinteressen an und in Lateinamerika sind damit keineswegs ausgeschlossen – so wenig wie entsprechende auswärtige Interessen an den USA von der Teilhabe am Wirtschaftsleben innerhalb der US-Grenzen; hier wie da sind Beiträge ausländischen Kapitals zu Amerikas Wirtschaftswachstum und Verträge, die das regeln, durchaus willkommen; aber eben unter genau dieser Prämisse: dass Europäer und Ostasiaten, wenn sie sich um Geschäftserfolge in und mit Lateinamerika bemühen, nicht in gleichberechtigter Konkurrenz zu Nordamerika in offene nationale Geschäftssphären einsteigen, sondern als externe Interessenten auf einem rechtsförmlich integrierten Gesamt-Standort US-amerikanischer Wirtschaftsmacht zugelassen werden. Ungefähr so, wie die EU sich als supranationaler Binnenmarkt organisiert hat, auch nach denselben WTO-Regeln über regionale Sonderbündnisse als Ausnahmen von der „Meistbegünstigung“, der Grundregel des modernen kapitalistischen Freihandels, wollen die USA die ‚Hemisphäre‘, die sie ohnehin zu der Ihren gemacht haben, ausdrücklich und vertraglich zu ihrem erweiterten Geschäftsfeld definieren: zu einer Wirtschaftsunion ohne den entscheidenden Mangel der EU, nämlich ohne ungeklärte Unterordnungsverhältnisse zwischen den beteiligten „Souveränen“. Als derart unierter Block wollen die USA dann auch in den Organisationen des freien Welthandels auftreten können, um mit Hilfe ihrer „Schwellen-“ und „Entwicklungsländer“ fällige Streitfragen und diplomatische Handelskriege gegen ihre Konkurrenten und gegen den Rest der Welt zu entscheiden.
(3) Von den lateinamerikanischen Staaten ist dieses Angebot einer neugestalteten standortpolitischen ‚Kooperation‘ nicht bestellt worden – aber auch nicht schadlos abzulehnen. Schließlich wissen sie sich in allen nationalen ökonomischen Belangen vorrangig auf die Dollar-Macht verwiesen, rechnen alle auf wachsende Dollargeschäfte und erfahren aus Washington jetzt höchst offiziell, dass anders die guten wirtschaftlichen ‚Beziehungen‘ nicht mehr zu haben sein sollen. Eine Herausforderung für Nationalisten, die sich an den USA als ihrer Hauptgeschäftsadresse und in allen nationalen Affären zu berücksichtigender Vormacht ohnehin immerzu abarbeiten. So auch jetzt. Sie knüpfen an die neuen Konditionen lauter gegensätzliche Berechnungen, je nach dem, was sie sich an ausnutzbaren ökonomischen Potenzen in den existenten Verhältnissen zurechnen, wie sie ihre nationale Wirtschaft und ihre gesamte Wirtschaftspolitik unter den Dollar subsumiert haben, was an nationaler Gestaltungsmöglichkeit und Nutzen sie sich im Einstellen auf oder in Opposition gegen die Dollar-Zentrale und unbestrittene Vormacht gemäß ihren nationalen Gegebenheiten ausrechnen. Das ergibt ein buntes Sammelsurium an Erwartungen und Bedenken, die alle von einem zeugen: Die Herren ihrer Berechnungen sind sie dabei ganz und gar nicht, weder Staaten wie Mexiko, das eine solche Anbindung an die US-Ökonomie schon hinter sich hat, oder Chile, das ohnehin als Vorreiter eines strikt proamerikanischen Wirtschaftswegs rechnet, noch Staaten wie Venezuela, dessen Präsident allen Anlass hat, das Hegemoniestreben der USA an den Pranger zu stellen, oder Argentinien und Brasilien, die um ihre beschädigte Rolle als ‚emerging market‘ ringen und gleichzeitig um regionale Führerschaft konkurrieren und sich jetzt Bedingungen aufnötigen lassen sollen, die sie nur als Anschlag auf ihre Bedürfnis nach Weltmarktkorrekturen in ganz anderem Sinn und als schwer erträglichen Souveränitätsverzicht verstehen können.[23]
Diese Gegensätze werden diplomatisch in der Form eines Streits um die Bedingungen des Vertragswerks ausgetragen, der naturgemäß ziemlich feindselig und ‚asymmetrisch‘ ausfällt. Brasilien und andere sind auf Schadensbegrenzung aus und pochen darauf, dass gerade wegen der US-Überlegenheit „wechselseitige und nicht einseitige Öffnung“ vonnöten wäre, landen aber unweigerlich beim Kern der Sache – dass sie sich keinem ‚Diktat‘ unterwerfen wollen, etwas anderes ihnen aber gar nicht geboten wird. Die US-Regierung ihrerseits lässt nämlich keinen Zweifel, das es sich um ein Vorhaben handelt, das in der Sache nicht verhandelbar ist, dass hier Unterwerfung unter ihre Standortanforderungen an den Süden verlangt ist.[24] Entsprechend handelt sie auch, indem sie die neuen zwischenstaatlichen Vertragsverhältnisse, die mit dem FTAA-Programm für alle Staaten Lateinamerikas gültig gemacht werden sollen, in Gestalt von Sonderverträgen getrennt von den FTAA/ALCA-Fortschritten überall dort durchsetzt, wo sich dafür aus Berechnung oder Machtlosigkeit in der Region passende Adressen finden: Mexiko ist mit seiner NAFTA-Zugehörigkeit ohnehin Vorreiter dieses Fortschritts an ‚Weltmarktintegration‘, damit auch Anschauungsmaterial für die Folgen der internationalen ‚Arbeitsteilung‘, die die USA dem restlichen Lateinamerika jetzt anbieten und aufnötigen. Chile hat ein entsprechendes Abkommen abgeschlossen. Mit den restlichen Anden-Staaten finden entsprechende Sonderverhandlungen statt. Und die mittelamerikanischen Anhängsel der USA müssen ohnehin nicht zu einer ‚CAFTA‘ groß genötigt werden. Damit treibt Washington konsequent die Isolierung der drei Staaten voran, auf deren einseitigere Ausrichtung es ihm ganz besonders ankommt.[25]
Die Bemühungen von Brasilien und Argentinien, den Mercorsur – jetzt als Gegengewicht und Rückhalt in der Auseinandersetzung um die FTAA – neu zu ‚beleben‘, d.h. auf eine gemeinsame Linie zu bringen und damit so etwas wie eine Gegenmacht zu bilden, offenbaren jetzt erst recht die Schranken dieser ‚eigenständigen‘ Alternative. Eine brauchbare Einheitsfront, die vor allem Brasilien mit dem Verweis auf die ‚lateinamerikanische Identität‘ beschwört, kommt nicht zustande. So kommt auch ohne eine fertige FTAA/ALCA die Neuformierung der Region voran und der ‚Geist‘ dieses Abkommens voll zum Tragen.
Damit haben dann auch und gerade die eigentlichen Konkurrenten der USA zu schaffen. Mit dem Zugriffswillen der USA wird auch ihren Bemühungen um diese Länder der Weg gewiesen:
„Für die EU könnte die Errichtung einer panamerikanischen Freihandelszone ohne Abkommen über die Handelsliberalisierung mit den vorrangigen Partnern in Lateinamerika die europäischen Positionen in den Wirtschaftssystemen des Cono Sur gegenüber den US-amerikanischen Konkurrenten ernsthaft schwächen und die Tendenzen beschleunigen, die sich in den letzten Jahren in den Handelsbeziehungen abgezeichnet haben. Es ist in diesem Zusammenhang an die Tatsache zu erinnern, dass ein wichtiger Grund für die Verhandlungen über die Assoziierungsabkommen mit dem Mercosur und Chile war, dass die FTAA nicht zu einem ähnlichen Rückgang der Marktquoten führe, wie er im Handel mit Mexiko nach Inkrafttreten des Nordamerikanischen Freihandelsabkommens (NAFTA) festzustellen war.“ (Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften, 09/2001)
Sie sprechen die Gefahr einer Monopolisierung des Lateinamerika-Geschäfts sorgenvoll aus, weil sie als konkurrierende Weltwirtschaftsmacht um ihre inzwischen errungenen Positionen in Lateinamerika fürchten. Dem Bestreben der USA, diese Region in eine verlässlich bevorrechtigte Sphäre des Dollarkapitals zu verwandeln, setzen sie ihr eigenes entgegen, sich die gleichen Zugriffsfreiheiten zu erobern. Sie bieten den Lateinamerikanern ein eigenes ‚Freihandelsabkommen‘ an, das ganz dem Muster der FTAA folgt: beschränkter Marktzugang hier, freies Agieren des Kapitals dort. So weit wird die Konkurrenz um Lateinamerika als Kapitalstandort auswärtiger Nationen mit den gleichen Waffen und mit den gleichen Konsequenzen für die dortigen Länder geführt. Unter dem Firmenschild „mehr Freihandel“ unter Führung der USA bzw. im Verein mit der EU findet ein politischer Kampf um die Aneignung auswärtiger Geschäftsquellen statt. Dabei setzen die Europäer darauf, dass diese Länder europäisches Kapital und europäischen Kredit, die sich ihrer Geschäftsgelegenheiten bemächtigen, als eine Alternative zu ihrer Dollarabhängigkeit benötigen und schätzen und sich davon auch eine Relativierung der Unterordnung unter Washingtons weiterreichende strategische Ansprüche ausrechnen. Deswegen propagieren sie ihr Begehren, sich die gleichen Kapitalfreiheiten wie die USA zu sichern, auch ausdrücklich im Namen der Beseitigung des Nord-Süd-Gefälles und der Schaffung einer multipolaren Welt und versehen es mit dem Gütesiegel, im Unterschied zu den USA keine ‚hegemonialen‘ Absichten zu verfolgen. Das ist ziemlich geheuchelt, schließlich wollen sie diese Staaten nicht aus dem ‚hegemonialen‘ Einfluss der USA befreien, sondern ihren eigenen stärken.[26] Was in dieser europäischen Lesart zur Sprache kommt, ist allerdings das imperialistische Handicap, mit dem sich Europa insbesondere im Bezug auf diese Region herumschlägt. Der Lateinamerikapolitik der EU fehlt die ‚Kompetenz‘, d.h. die Macht, ihre konkurrierenden Bemühungen um eine politökonomische Zusortierung Lateinamerikas zu Europa mit der Aufsichtsgewalt zu versehen und abzusichern, die die USA seit je und mit größter Selbstverständlichkeit dort zum Einsatz bringen.
Die neue Ausgestaltung dieses Privilegs machen die USA zum Hebel und Zweck ihrer Neuordnung der Region.
b) Die Demokratiecharta: eine kollektive Verpflichtung zum ‚guten Regieren‘ unter US-Aufsicht
Die Perspektiven dieser Art von ‚Freihandelsvertrag‘ sind an und für sich schon eine fundamentale Herausforderung an die Staaten, die sich da als pure Objekte US-amerikanischer Standortanforderungen verstehen sollen, und an die anderen, die sich in diesem Begehren mit den USA messen. Die USA aber zielen mit ihm auf mehr. Sie stellen den Vertrag ausdrücklich unter die Vorgabe und das strategische Ziel, die Staaten der Region insgesamt auf proamerikanisches Regieren festzulegen. Sie subsumieren das Vertragswerk programmatisch unter den ‚Kampf gegen den Terrorismus‘[27] und gestalten es dem Motto gemäß aus; freilich nicht in dem Sinne, dass der ‚freie Handel‘ vorangetrieben wird – wie sollte der auch ein Heilmittel gegen ‚Terrorismus‘ sein –, sondern andersherum: Die unter dem Schlagwort ‚Freihandel‘ betriebene Festlegung der politökonomischen Richtlinien dieser Nationen ist nur ein entscheidendes Element eines umfassenderen Programms zur Durchsetzung von ‚good governance‘, also einer politischen Gesamtordnung der lateinamerikanischen Staaten unter US-Regie. Im Sinne einer solchen strategischen Ausrichtung formuliert der FTAA/ALCA-Vertrag nicht nur einschlägige Verpflichtungen wie den Kampf gegen den Drogenhandel und gegen ‚Korruption‘, sondern stellt allen Bestimmungen ein generelles Demokratiegebot voran:
„Die Völker Amerikas haben ein Recht auf Demokratie und deren Regierungen die Verpflichtung, diese zu fördern und zu verteidigen.“ (Präambel ALCA-Vertrag)
Das ist von den USA nicht bloß als diplomatische Floskel, sondern als Verpflichtung ernst gemeint. Als Voraussetzung für die Neuordnung der Beziehungen haben sie deshalb die Unterzeichnung einer Demokratiecharta verlangt, um deren Gehalt und vertragliche Konsequenzen weiterhin hart gerungen wird:
„Wir erkennen an, dass die Werte und Praktiken der Demokratie für das Verfolgen all unserer Ziele grundlegend sind. Die Aufrechterhaltung und Stärkung der Rechtsstaatlichkeit und strikte Achtung des demokratischen Systems sind gleichzeitig Ziel und Gegenstand des gemeinsamen Engagements sowie eine wesentliche Bedingung für unsere Präsenz auf diesem und zukünftigen Gipfeln. Dies heißt somit, dass jede nicht verfassungsgemäße Veränderung oder Unterbrechung der demokratischen Ordnung in einem Staat der Hemisphäre ein unüberwindbares Hindernis für die Teilnahme der Regierung dieses Staates am Prozess des Gipfels der Amerikas darstellt. Unter gebührender Berücksichtigung der bestehenden Mechanismen in der Hemisphäre, den Regionen und Subregionen, kommen wir überein Beratungen aufzunehmen, falls es zu einer Störung des demokratischen Systems in einem Teilnehmerland des Gipfelprozesses kommen sollte.“ (Erklärung der Staats- und Regierungschefs auf dem III. Gipfel der Amerikas vom 22. April 2001 in Quebec)
Gefordert ist nicht weniger als die Unterschrift der lateinamerikanischen Staaten unter die Definition der Region als einer Ansammlung in ihrer demokratischen Ausrichtung ständig gefährdeter Herrschaften. Die USA – bei denen von den genannten ‚Veränderungen‘ und ‚Unterbrechungen‘ ja wirklich nicht die Rede sein kann – werden damit automatisch zum Vorbild und zugleich obersten Wächter ernannt, die restlichen Länder in den Status von Objekten auswärtiger Beaufsichtigung versetzt und gleichzeitig aufs Mitmachen bei der einseitig-wechselseitigen Beaufsichtigung verpflichtet. Wer da zur Beaufsichtigung ansteht und wer bei der gemeinschaftlichen Beratung das Sagen hat, ist keine Frage. Jeder Vertragspartner weiß, dass die USA die Entscheidung über ‚good‘ und ‚bad governance‘ fällen, während der Rest den dauernden Beweis schuldig ist, diesem Maßstab zu genügen. Der amerikanische Präsident persönlich dringt denn auch auf jedem Gipfeltreffen mit Nachdruck darauf, dass sich seine lateinamerikanischen Gegenüber auf die Verurteilung und die aktive Bekämpfung ‚korrupter und undemokratischer Regierungen‘, also potentiell von sich selber, festzulegen hätten. Die Zuständigkeit, die sich die USA immer ungefragt herausgenommen haben, soll damit als eine von allen Beteiligten anerkannte völkerrechtliche Beziehung festgeschrieben werden – mit entsprechenden Konsequenzen:
Die von der OAS verabschiedeten Resolutionen sind keine bloße Rhetorik. Sie legen den Handlungsrahmen und die politischen Optionen der OAS-Mitgliedsstaaten fest.
[28]
Die USA beanspruchen also in aller Form ein Recht auf Intervention. Das wird von den zur Zustimmung aufgeforderten Staaten nur zu gut verstanden. Der kollektiven Verurteilung korrupten Regierens stimmen sie deshalb zu, der Forderung, praktische Konsequenzen der Ächtung für alle verbindlich zu beschließen, nicht.
Die US-Regierung belässt es aber ohnehin nicht dabei, um förmliche Zustimmung nachzufragen. Sie ist längst dabei, ihre praktische Aufsichtsgewalt neu zu organisieren. Diesem Zweck dient
c) Die Arbeit der USA an einer ‚kollektiven Sicherheitsarchitektur‘
Die Grundlagen für die Erfüllung seines ausgreifenden Bedürfnisses nach Sicherheit braucht Washington nicht erst zu erfinden und der Region zu implantieren. Sie sind seit den Tagen des Kalten Krieges vorhanden. Die Interventionen und Operationen der USA, im Kampf gegen kommunistische ‚Subversion‘ und die drohende Gefahr der Errichtung von ‚sowjetischen Satellitenstaaten‘ durch Militärverbindungen der USA zu allen Staaten der Region materiell untermauert, wurden von den nationalen Militärs, die ihren Staat gegen linke Kräfte und falsche demokratische Entwicklungen sichern sollten und wollten, mitgetragen; und durch die ‚Organisation Amerikanischer Staaten‘ (OAS) und einen regionalen ‚Beistandspakt‘ waren sie außerdem diplomatisch abgesichert. Nach der weitgehenden Erledigung des linken Widerstandes und vor allem der sowjetischen Einmischungsversuche haben die USA dann zwar nützlich gewesene Militärjuntas, die zum Teil auch entschieden zu viel nationalen Selbständigkeitsdrang an den Tag zu legen begannen – die regierenden Generäle Brasiliens haben sich zu dem Projekt einer lateinamerikanischen Atombombe verstiegen, die argentinischen Kollegen mit der Eroberung der britischen Malvinas ihren Aufstieg zum eigenständigen Partner der USA vollenden wollen –, aus der Macht und zur Einführung demokratischer Herrschaftsmethoden gedrängt; die sollten – so wie anderswo auch – passenden Führerfiguren den zivilen Gehorsam ihrer zu Wählern ernannten Untertanen sichern, auch ohne den permanenten Bereitschaftsdienst des militärischen Unterdrückungsapparats. Das war aber beileibe nicht so gemeint und hat auch nirgends dazu geführt, dass die Uniformierten sich allen Ernstes aus dem politischen Leben herausgehalten und ‚in die Kasernen zurückgezogen‘ hätten: Gerade damit Demokratie in Lateinamerika nicht zu einem unkontrollierbaren ‚Wagnis‘ gerät, sondern nach Wunsch funktionieren kann und nichts ‚aus dem Ruder läuft‘, die Massen friedlich bleiben und kein Falscher sich, bloß weil das Volk ihn mal gewählt hat, an der Macht halten kann – also um einer richtigen Demokratie willen kommt es den USA ebenso wie der zu zivilen Sitten bekehrten ‚politischen Klasse‘ in den Ländern der Region auf einen funktionstüchtigen Gewaltapparat an. Den hat Washington daher auch immerzu gepflegt, unterstützt, ausgerüstet und angeleitet.
Und auf einen solchen sicheren Rückhalt der demokratischen Macht legt die Bush-Regierung erst recht allergrößten Wert, seit sie mit ihrem Weltkrieg gegen ‚den Terrorismus‘ die Messlatte für Amerikas Sicherheit ganz hoch gelegt hat. Für Lateinamerika, darauf hat sie sich mit den restlichen Staaten ihrer ‚Hemisphäre‘ geeinigt, bedeutet das nämlich Folgendes:
„Die Verbindungen zwischen Terrorismus, verbotenem Waffenhandel, Geldwäsche, organisiertem Verbrechen und Drogenhandel stellen eine Hauptbedrohung der Sicherheit in der Hemisphäre dar.“ (OAS-Erklärung, 29.10.2003)
Dass manche Regierungen ihr Gewaltmonopol nicht flächendeckend durchgesetzt kriegen, andere den Rauschgifthandel womöglich gar nicht entschieden genug bekämpfen mögen und überhaupt gute US-Dollars in dunkle Kanäle fließen, stört die Ordnungsmacht des Doppelkontinents schon lange. Die Verknüpfung dieser Unsitten mit ‚dem Terrorismus‘, die die USA nun herstellen, macht die Lage aber in neuer Weise brisant; nicht nur in der Sicht der Anti-Terror-Krieger in Washington, sondern für die Staaten selbst, denen ihr desolates Innenleben jetzt als Sicherheitsrisiko, und zwar gleich für die ganze Erdhalbkugel, angekreidet wird. Denn damit kündigt die US-Regierung eine Eskalation ihres Vorgehens gegen die altbekannten internen Übel bei ihren Partnern, kompromisslose Härte in der Bekämpfung verbotener Umtriebe und ‚rechtsfreier Räume‘, einen Kampf gegen ‚Narco-Terroristen‘ und Indigenen-Bewegungen nach dem Muster und als Teil des weltweiten Kriegs ‚gegen den Terror‘ an; und ein paar neue Ziele kommen gleich mit auf die Agenda, wenn Pentagon und Weißes Haus im Dreiländereck zwischen Paraguay, Argentinien und Brasilien Rückzugsgebiete islamistischer Terroristen und in Gegenden, die sich der Kontrolle der Staatsmacht entzogen haben, in Kolumbien etwa, eine ‚autochthone‘ lateinamerikanische Terrorismusgefahr entdecken.
Das Militär der lateinamerikanischen Staaten ist damit in neuer Weise gefordert. Zuerst und vor allem nach innen als verlässlicher Garant stabiler Staatlichkeit, der weder ‚herrschaftsfreie Zonen‘ noch falsche nationale ‚Freiräume‘ zulässt. So mahnt Washington die Aufhebung der für eine effektive Volkskontrolle völlig unzweckmäßigen Trennung zwischen militärischen und polizeilichen Aufgaben an,[29] entbindet die Militärkräfte damit ausdrücklich von dem Gebot innerer Zurückhaltung und kümmert sich um die entsprechenden Fähigkeiten zum Zuschlagen gegen antiamerikanische Umtriebe, sei es in Form organisierten Verbrechens, sozialen Aufruhrs oder drohender politischer Massenbewegungen. Die Militärhilfe wird intensiviert, US-Militärs organisieren die Einübung in Antidrogenkampf und Niederschlagung ethnischer Konflikte. Die immer schon fest institutionalisierte Ausbildung lateinamerikanischer Militärs in den USA wird wieder verstärkt; so zieht das Pentagon sich verlässliche Figuren in den Armeen der Partnerländer heran, die sich nicht nur bestens auf ihr Handwerk verstehen, sondern auch wissen, in welchem Geiste sie es zu verrichten haben, also für den politischen Willen zur gewaltsamen Bereinigung nationaler Sicherheitsrisiken einstehen, in diesem Sinne nötigenfalls auch ihre gewählten Regierungen auf den richtigen Weg bringen oder im Ernstfall gegen die zivilen Instanzen ihrer Nation den Sicherheitsbedarf der USA bedienen.[30]
Grenzüberschreitende Aufgaben sind für eine personell und technisch derart auf den neuesten Stand gebrachte Latino-Armee auch vorgesehen: Ordentlich funktionierende Staaten sollen sich, von Washington in die entsprechende ‚zwischenstaatliche Kooperation‘ eingebunden, um Nachbarländer kümmern, deren Regierende sei es aus Unvermögen, sei es aus mangelndem Einsatzwillen die verlangte flächendeckende Ordnung nicht hinkriegen, und denen auf die Beine helfen.[31] Für die allfälligen Interventionen, die nach dem Drehbuch der USA so unterschiedliche Fälle wie den Kampf gegen Drogenhandel und andere amerikafeindliche Umtriebe, die Betreuung ungefestigter Staatengebilde wie Haiti und am Ende auch den besagten Schutz der Demokratie gegen Staatsstreiche betreffen, verfolgt Washington das Projekt einer von mehreren Staaten gebildeten festen Eingreiftruppe unter US-Führung mit Brasilien und Argentinien in der Rolle privilegierter Beteiligter, die dafür Unterstützung bei ihrer nationalen Aufrüstung geboten bekommen. So betreiben die Verantwortlichen in Washington mit ihren Schritten zu einer ‚neuen Sicherheitsarchitektur‘ auch die Scheidung zwischen Nationen, deren Militär erst einmal im Innern den Kampf gegen die Gesetzlosigkeit zu gewinnen hat, und anderen, deren bewaffnete Macht für den komplexen Aufsichtsbedarf der ganzen Region gefordert ist und gefördert wird.
Mit diesem Programm einer neuen regionalen Sicherheitsstruktur entfallen für die lateinamerikanischen Staaten auf der anderen Seite etliche militärische Aufgaben. Nämlich alle, die die USA für obsolet bis störend erklären. So vor allem der Dienst, den ein nationales Militär ganz grundsätzlich, jenseits aller besonderen Verwendungszwecke, seinem Souverän zu leisten hat; nämlich: dessen ‚unveräußerliches‘ Recht auf Selbstbehauptung gegen seinesgleichen zu gewährleisten. Eine Rüstung, die an diesem schönen Grundrecht staatlicher Herrschaft Maß nimmt, erklären die Fachleute aus Washington im Falle der übrigen Staaten ihrer ‚Hemisphäre‘ zur nutzlosen Spielerei – deutlicher ist kaum auszudrücken, wie bedeutungslos für die USA die hochheilige Souveränität ihrer südlichen Nachbarn ist. Eine eigenmächtige Anwendung der dann doch irgendwie erworbenen oder gelieferten militärischen Pracht für autonom beschlossene Kriegsabenteuer kommt selbstverständlich erst recht nicht mehr in Frage,[32] wenn militärische Auswärtsspiele zwar jederzeit, aber auch nur im Rahmen einer von Washington geleiteten Kooperation zur brüderlichen Stabilisierungs- und Demokratisierungshilfe fällig werden. Zu diesem Veto gegen ‚falsch verstandene‘ nationale Souveränität gehört umgekehrt der Einspruch der USA, wann immer irgendwelche lateinamerikanischen Staaten auf eine nicht von der Vormacht inspirierte strategische Kooperation aus sind und etwa Bündnisprojekte wie die ‚Vereinigten Staaten von Lateinamerika‘ ins Auge fassen: Souveränität über Grundfragen ihrer nationalen Existenz gestehen die USA den Mitgliedern ihrer ‚Hemisphäre‘ einfach nicht zu.
Insofern unterscheidet sich die Disziplin, der Washington im Zeichen seines Anti-Terror-Kriegs seine südlichen Nachbarn unterwirft, fundamental von den „Koalitionen der Willigen“, die die Bush-Regierung sonst bedarfsweise einrichtet und weiter einzurichten gedenkt. Lateinamerika gehört zum Besitzstand der USA; was es an Ordnungskräften besitzt, rangiert ganz grundsätzlich als – untergeordneter, für die Region aber bedeutsamer – Teil der Militärmacht, mit der die USA den Globus unter Kontrolle halten bzw. mit ihrem Weltkrieg gegen ‚den Terrorismus‘ definitiv unter ihre Kontrolle zu bringen gedenken. Für dieses exklusive Verhältnis ist es anscheinend noch nicht einmal zwingend notwendig, dass alle lateinamerikanischen Staaten zustimmen und sich zur Verfügung stellen, wenn die USA nach dem Motto „Der Zweck begründet das Bündnis“ für ihr kriegerisches Vorhaben im Nahen Osten Mitmacher rekrutieren: Absagen aus Lateinamerika an den Irakkrieg ändern nichts daran, dass die USA das lateinamerikanische Militär als Hilfsorgane der Sicherheitspolitik verbuchen, die sie für ihre ‚Amerikas‘ entwerfen und verwirklichen.
*
Das alles: ein Stück Aufteilung der Welt, das ihnen den exklusiven Zugriff auf den Rest des amerikanischen Doppelkontinents sichert, meinen die USA jetzt in aller Form vertraglich festschreiben zu müssen. Grund dafür ist einerseits ihr gehobenes Anspruchsniveau, auf dessen selbstverständliche, quasi automatische Durchsetzung sie sich andererseits ihrer eigenen Einschätzung nach nicht – mehr – verlassen können.
[1] Unser nationales Interesse an dieser Hemisphäre wird gebildet durch die simple Tatsache, that it is our home. Wir haben bedeutende ökonomische, politische und Sicherheitsbeziehungen mit unseren Nachbarn… Die Geographie, die wir teilen, kreiert natürliche ökonomische Beziehungen. Drei von unseren vier führenden auswärtigen Energie-Lieferanten stammen aus der Hemisphäre. U.S. Exporte nach Latein-Amerika sind in der vergangenen Dekade um fast 100 Prozent gewachsen, während unsere Exporte in den Rest der Welt weniger als 50% Zuwachs erreicht haben. Kanada und Mexiko sind unser erst- und zweitgrößter Handelspartner. Die USA sind der führende Handelspartner jeder Nation in der westlichen Hemisphäre ausgenommen Castros Cuba.
(R. Noriega, a.a.O.)
[2] Der Einsatz der USA für ein allgemeines freihändlerisches Regelwerk für einen globalen Kapitalismus, von dessen Nutzen für ihre Geschäftswelt sie felsenfest ausgehen, trifft auf unterschiedliche politökonomische Verhältnisse und hat je nach dem einen anderen politökonomischen Inhalt. Im Verhältnis zu den paar anderen potenten kapitalistischen Nationen geht es um das Paradox eines Einvernehmens über die Abwicklung unnachgiebig geführter Konkurrenzkämpfe, mit denen die aufeinander angewiesenen Handelspartner einander zugleich ernstlichen Schaden zufügen. Die Subsumtion der Staatenwelt, die aus der Liquidierung der Kolonialreiche Europas nach dem 2. Weltkrieg entstanden ist, unter die Regularien des modernen Weltmarkts dient der Erschließung neuer Geschäftssphären für amerikanisches Kapital und der Sicherung eines gleichberechtigten Zugriffs aller, die dazu ökonomisch in der Lage sind, auf Reichtumsquellen anderswo. Im Umgang mit Lateinamerika ist weder Öffnung in diesem Sinn noch Konkurrenz unter Gleichrangigen das Thema: Hier probieren die USA – mit Erfolg – das dialektische Kunststück aus, vermittels allgemeiner Freihandelsgrundsätze ihre Position als vorrangiger Geschäftspartner und dominierender Nutznießer auch noch der Aufbau- und Entwicklungsanstrengungen aufstrebender Nachbarländer zu festigen, fortzuschreiben und auszubauen.
[3] Anders als einige europäische Länder in der Nachkriegszeit hatten die lateinamerikanischen nie das Glück, dass ihnen aus politstrategischen Gründen der (Wieder-)Aufbau eines nationalen Kapitalstandorts kreditiert worden und ihre Entwicklung zu konkurrenztüchtigen Mitmachern auf dem Weltmarkt gefordert und gefördert worden ist.
[4] Dieser Rechnungsweise sich anzuschließen, haben nicht zuletzt die landeseigenen Kapitalisten als ihr ureigenes Recht und Interesse angesehen und auch für ihre Gewinne den Umtausch in Dollar in Anspruch genommen. „Kapitalflucht“ hat so in schöner Regelmäßigkeit ihren Beitrag zum Ruin der Währungen geleistet.
[5] Das hat bei auch bei anderen alternativen lateinamerikanischen Nationalisten – in Chile, Argentinien u.a. – eine Weile die vergebliche Hoffnung genährt, das strategische Interesse der SU für das eigene sozial-reformerische Anliegen benutzen zu können.
[6] Für diesen Zweck rief Kennedy eigens die „Allianz für den Fortschritt“ ins Leben, in deren Rahmen den Lateinamerikanern jede Menge Versprechen gemacht wurde, von der Schulspeisung bis zur Wirtschaftshilfe. Ergänzt und schließlich hinausgelaufen ist der propagierte „Kampf gegen die Armut“ aber dann doch wieder auf den Einsatz der bewährten Mittel: Ein Schlüsselelement der Allianz war die US-Militärhilfe an befreundete Staaten in der Region, ein Aspekt, der an Bedeutung gewann mit dem Amtsantritt von Präsident Lyndon B. Johnson Ende 1963 (während die anderen Bestandteile der Allianz an Bedeutung verloren).
(www.state.gov/r/pa)
[7] Die Logik des Währungsvergleichs, die hier kurz rekapituliert wird – Ausführlicheres dazu steht in dem Artikel Weltmarkt und Geldmarkt: Die Währung und ihr Wert
in GegenStandpunkt 4-94, S.137 –, setzt Nationen mit einem prinzipiell anerkannten nationalen Weltgeld voraus. Diese Voraussetzung erfüllen nicht viele Länder – die VR China vielleicht demnächst, die Mitglieder der Euro-Zone treten als kollektives Weltgeld-Subjekt zum Währungsvergleich an –, freilich die weltwirtschaftlich entscheidenden. In deren Konkurrenzkämpfen machen sich die angedeuteten Prinzipien in der Weise geltend, dass die Beteiligten alles tun, um deren Wirkungen zu eigenen Gunsten hinzudrehen, notfalls auf den Kopf zu stellen, wenn sie z.B. – wie derzeit die Europäer – wegen der relativen Stärke ihrer Valuta einen Konkurrenznachteil befürchten oder wenn – zur Zeit bei den USA – eindeutige Dominanz im Weltgeschäft mit Abwertungstendenzen einhergeht. Im Fall Lateinamerikas – und nur darum geht es hier – wird allenfalls der Form nach so verfahren, wie es sich für Staaten mit eigener anerkannter Geldhoheit gehört; tatsächliche politökonomische Entscheidungsgrundlage für die Einleitung und Abwicklung eines Bankrottverfahrens ist allein die Frage, wie es um ihren Devisenschatz im Verhältnis zu ihren Schuldendienstverpflichtungen steht – und wie sich trotz groteskem Missverhältnis zwischen beiden Größen weiterhin gutes Geld an ihnen verdienen lässt.
[8] Dass Argentinien es auch mit der Verschuldung in Euro und Yen probiert und auf deren Wertanstieg im Verhältnis zum Dollar hofft, ändert überhaupt nichts am Vorrang seiner Verschuldung in Dollar und damit seiner Abhängigkeit gegenüber IWF, Weltbank und anderen einzig in Dollar rechnenden und unter US-Kontrolle stehenden Instituten. An der Spekulation, dass Argentinien seinen Verpflichtungen gegenüber dem Dollar standhält, dürfen sich Europäer und Japaner gern beteiligen und sich jetzt auch mit den Argentiniern darüber streiten, wieviel Verlust sie bei ihren Engagements in Kauf zu nehmen haben, damit der IWF Argentinien eine neue Kreditbasis spendiert.
[9] In verschiedenen Ländern regen sich ja Indigenen- und andere ‚Volksbewegungen‘. Ihre Akteure entnehmen der wachsende Armut, dass die Politik die Betroffenen nicht als das würdigt, was sie sind, ein Teil – und zwar ein eigener und der eigentliche – des Staatsvolks, der eine andere, sozialere Behandlung verdient hätte. Für Washington allemal Grund für abgrundtiefes Misstrauen. Chávez und solche Volksbewegungen anderswo werden von Washington als eine drohende antiamerikanische Einheitsfront betrachtet und behandelt. Der Kampf gegen Kuba, das Überbleibsel des Kalten Krieges, soll deshalb auch als abschreckendes Exempel dienen, was einem Land droht, wenn es sich einem falschen nationalen Weg verschreibt.
[10] Bereits 1997 wurden die FARC und die ELN auf die Liste der gefährlichen internationalen Terrororganisationen gesetzt und mit dem Begriff des narcoterrorism auf ihre Bedeutung in der Drogenökonomie reduziert.
(Detlev Nolte/Nika Oettler: Lateinamerika: Der vergessene Hinterhof der USA?, Aus Politik und Zeitgeschichte 38-39/2003, S.25)
[11] Ein US-General bringt es auf den Punkt mit dem Hinweis, „dass jedes Jahr ca. 19.000 Amerikaner direkt aufgrund von Drogenmissbrauch sterben, indirekt möglicherweise noch einmal 55000. Die Drogen seien somit mit Massenvernichtungswaffen vergleichbar (und folglich ähnlich zu bekämpfen).“ (a.a.O.)
[12] Unter George W. Bush wurde eine erweiterte offizielle Drogenbekämpfungsstrategie formuliert und im Mai 2001 unter dem Titel ‚Andean Regional Initiative‘ präsentiert… 2003 wurden 928 Millionen US-Dollar für Drogenbekämpfungsmaßnahmen, den Aufbau demokratischer Strukturen und für Entwicklungshilfe bewilligt, die Bolivien, Brasilien, Ecuador, Kolumbien, Panama, Peru und Venezuela zugute kommen sollen.
(a.a.O.)
[13] Verteidigungsminister Rumsfeld: Weil Terroristen rechtsfreie, nicht beherrschte Gebiete als Rückzugsgebiete nutzen, liegt es in der Verantwortung der demokratischen Regierungen, … die effektive Staatsgewalt auf dem gesamten Territorium auszuüben… In diesem Sinn wollen ‚die USA, gemeinsam mit unseren internationalen und regionalen Partnern darauf hinarbeiten, eine effektive Regierungsgewalt in unregierten Gebieten sicherzustellen, die Terroristen eine Zuflucht bieten können.‘
(National Strategy for Combating Terrorism, zitiert in: Brennpunkt Lateinamerika 7/2004, S.79)
[14] Vgl. „Hilfe zur Selbsthilfe beim ‚war on drugs‘“, GegenStandpunkt 4-2000, S.5
[15] Die Bekämpfung des Drogenhandels konzentriert sich auf Kolumbien, dem für den US-Markt mit einem Anteil von ca. 90 Prozent bei weitem bedeutendsten Exporteur von Kokain und Heroin. Dabei wurde das Geflecht von organisierter Kriminalität, Drogenanbau und -handel und der kolumbianischen Aufstandsbewegung als besondere Gefahr erkannt… Über die Hälfte der Mittel (für die ‚Andean Regional Initative‘) ist für Kolumbien vorgesehen… Beschlossen wurde 2003 ferner ein militärischer Zusatzhaushalt, der auch einen Betrag von 105 Millionen US-Dollar für das kolumbianische Militär enthielt… Der ‚Kampf gegen Drogen‘ konzentriert sich auf die militärische Bekämpfung von ‚narcotráfico‘ und ‚narcoterrorismo‘ und die gleichzeitige biologisch-chemische Reduzierung der Anbauflächen von Koka und Schlafmohn… Unter Präsident George W. Bush wurde die Unterscheidung zwischen Drogen- und Guerillabekämpfung endgültig aufgehoben. US-Rüstungsgüter, Ausbildungsprogramme und geheimdienstliche Informationen können vom kolumbianischen Militär für beides eingesetzt werden.
(Der vergessene Hinterhof, a.a.O.) Ein unmittelbares Engagement der USA ist gesetzlich auf 400 US-Soldaten und 400 Zivilpersonen beschränkt, allemal das, was nötig ist zur Anleitung eines solchen Großprojekts.
[16] Vgl. „Haiti-Kosovo-Afghanistan: Imperialismus als humanitäre Aktion“, GegenStandpunkt 2-04, S.58
[17] Es wird der Abbau von Zöllen und anderen Handelsbestimmungen festgelegt, in denen die USA ein ‚Handelshemmnis‘ für ihre Produkte auf den lateinamerikanischen Märkten sehen. Gleichzeitig behalten sie sich v.a. bei Agrarprodukten und Stahl eine weitere Subventionierung und Kontingentierung vor: Es sollen die Subventionen für die Agrarexporte im Handel innerhalb der Hemisphäre abgebaut werden und es soll ein Plan ausgearbeitet werden, der den US-Standpunkt in der WTO bzgl. des Subventionsabbaus auf Agrargüter unterstützt, während das Recht der USA auf Unterstützung der BONA FIDA – Nahrungsmittelhilfe unangetastet bleiben soll und die Entwicklung des US-Agrarmarktes und der Export-Kreditprogramme weiterhin geschützt bleiben sollen.
(Strategiepapier des US-Handelsbeauftragten Zoellick zur FTAA) Beispielcharakter hat hier der kürzlich abgeschlossene Freihandelsvertrags der USA mit Chile: Der hat zum Ergebnis, „dass die USA u.a. darauf bestehen, ihre landwirtschaftlichen Produkte zu bezuschussen (erst kürzlich wurden Bush vom Kongress 180 Milliarden US-Dollar für diesen Zweck bewilligt), während chilenischen Produzenten jegliche Bezuschussung verboten wird. Für chilenische Spitzenexport-Produkte wie Avocados und Trauben ist eine Zollgebührenentlastung erst in 15 Jahren vorgesehen, für den Exportschlager Wein sind es sieben Jahre. Während Chile eine Quote von 2000 Tonnen Frischfleisch zum Export in die USA gebührenfrei zugebilligt wird, ist umgekehrt die Menge nordamerikanischen Fleisches, das nach Chile ausgeführt wird, unbegrenzt.“ (Condor 2002)
[18] Die USA zielen darauf ab, mit einer starken Verpflichtung unsere Umweltstandards zu schützen und die der Arbeit auszuweiten.
Zoellick fügt gleichzeitig hinzu, man würde es nicht zulassen, den Geist des Freihandels durch Umwelt- und Arbeitsstandards zu zerstören.
Ein schönes Beispiel für den Zynismus des „Freihandels“: nicht Zerstörung oder Ausbeutung, sondern die damit unfair angeeigneten Erträge werden inkriminiert. Armut geht schon in Ordnung, wenn sie für die Reichtumsmehrung der richtigen Nation nützlich ist; schließlich profitiert das US-Kapital mit seiner ausgelagerten Maquila-Industrie in Mexico und anderswo von Arbeits- und Lohnverhältnissen, für die Tagelöhnerei und Lohnsklaverei ein durchaus treffender Begriff ist. Sonst ist sie natürlich ein Verbrechen, erstens am Menschen und zweitens am Freihandel.
[19] Dass die Verhandlungen die Form der Gegenleistung haben – auch die USA öffnen ihren Markt weiter als bisher – provoziert in den USA Kritik, z.B. von Seiten des vormaligen Präsidentschaftskandidaten Kerry und der Gewerkschaften, die Abmachungen seien insgesamt ein falsches Zugeständnis an auswärtige Konkurrenten, das ‚amerikanische Arbeitsplätze‘ gefährde. Die Tatsache, dass die Nutznießer dieser begrenzten Öffnung großenteils schon wieder amerikanische Unternehmen mit ihren auswärtigen Dependencen sind, zählt hier einmal nicht gegenüber dem Standortgesichtspunkt des ‚eigenen Markts‘, der für ‚nationale Beschäftigung‘ da zu sein hat, und angesichts des Verdachts, dass Staaten, die als Dollargeschäftsquelle zu fungieren haben, als Konkurrenten Nutzen auf Kosten Amerikas aus dem Vertrag ziehen könnten.
[20] Die einschlägigen Bestimmungen in der Darstellung des US-Handelsbeauftragten: Diskriminierungen und Handelsbarrieren auf dem Dienstleistungsmarkt der anderen FTAA-Staaten sollen fallen – inklusive der notwendigen Verbesserungen im Zugang zu Telekommunikation, Finanzdienstleistungen, Privatisierung von Staatsbetrieben. … Das heißt, die in vielen lateinamerikanischen Ländern noch stark staatlich protegierten nationalen Märkte zu liberalisieren, die teilweise verfassungsmäßig verankerte Bevorzugung staatlicher Unternehmen bei der Auftragsvergabe abzuschaffen und die Privatisierung des öffentlichen Dienstleistungssektors voranzutreiben. Dies soll durch das Gleichbehandlungsprinzip für ausländische und inländische Produkte und Unternehmen gewährleistet und mit der Anwendung der so genannten Nichtdiskriminierungsklausel auf Dienstleistungen, Märkte und Investitionen durchgesetzt werden. Kern dieses normativen Rahmens ist Kapitel elf der NAFTA-Verträge, mit Hilfe dessen ein ausländischer Konzern gegenüber einer Regierung seine Gleichbehandlung mit einheimischen Unternehmen oder sogar Entschädigung für potenzielle Gewinnverluste einklagen kann.
Jede Renationalisierung privatisierter Unternehmen und Dienstleistungen wird ausdrücklich im vorhinein ausgeschlossen. Beim Schutz geistigen Eigentums und von Patenten (vor allem auch die umstrittenen amerikanischen Patente auf Pflanzen-Gene) soll das US-Recht Geltung bekommen: In Feldern wie dem Patentschutz und dem Schutz ‚undisclosed Information‘ streben wir an, dass andere FTAA-Staaten, sich mehr an das US-Recht und dessen Praktiken anpassen… Wir streben an, dass die anderen FTAA-Staaten Maßnahmen ergreifen sollen, um das Patentrecht in diesem Sinne durchzusetzen.
Freiheit für amerikanisches Kapital und seine Dienstleister, aber keine Freiheit für ungenehme Einwanderer: Einreiseerlaubnisse für US-Dienstleistungspersonal sollen sichergestellt sein. Umgekehrt sollen die anderen Staaten dafür Sorge tragen, dass die Einreise von deren Dienstleistungspersonal dem US-Ausländerrecht entspricht und keine Einwanderung angestrebt wird bzw. dauerhaft die Arbeitserlaubnis erteilt wird.
(Zoellick-Strategiepapier 2002) Unter vielen ein weiteres und gleichzeitig heikles Thema… ist jenes der genauen Definition des sogenannten Paragraphen 11. Im Rahmen des Nafta-Regelwerkes (das Regelwerk des Vorläufer-Wirtschaftsbündnisses zwischen USA, Kanada, Mexiko) regelt dieser Abschnitt grundsätzlich, dass ausländische Investoren in allen drei Ländern gleich wie Inländer behandelt werden müssen. Werden sie trotzdem diskriminiert, so haben sie ein Klagerecht gegen die jeweilige Regierung. Das hat in jüngster Zeit zu einer Reihe von Prozessen vorab amerikanischer Unternehmen geführt, die Ottawa und Mexiko erhebliches Geld gekostet haben oder noch kosten könnten. Gegner einer gesamtamerikanischen Freihandelszone bzw. des Nafta-Abkommens haben deshalb wiederholt darauf hingewiesen, steigende ‚corporate power‘ höhle in zunehmendem und gefährlichem Maße die souveräne Verfügungsgewalt der jeweiligen Staaten aus.
(NZZ, 21.4.2001) Es kommt eben darauf an, um welchen Staat es sich handelt und wessen Kapital da mit welcher Macht im Rücken die ‚power‘ entwickelt.
[21] Die Auskunft: Durch die Regelungen der Freihandelsverträge werden ökonomische Strukturen geschaffen, die über den nationalen Gesetzgebungen stehen und die dem Einfluss staatlicher Institutionen weitgehend entzogen sind.
(Freihandel und Widerstand, S.9), stimmt insofern nicht ganz. Es kommt schon noch darauf an, wer da der ‚Vertrags‘-Stifter ist, der die ökonomischen Strukturen schafft, und wer diesen ‚Strukturen‘ unterworfen ist.
[22] Stiftung Wissenschaft und Politik, 2001
[23] Begutachter der imperialistischen Szene laufen zu großer Form auf, wenn es gilt, die Positionen zu ‚bestimmen‘: Brasilien hat sich mit Erfolg gegen einen FTAA/ALCA-Beginn bereits 2003 gewehrt, letztlich aber dem Start für 2005 zugestimmt. Die Überlegung von Präsident Cardoso ist vorrangig davon bestimmt, dass die brasilianische Industrie teilweise noch eine Schonfrist braucht, bevor sie dem offenen Wettbewerb durch Industrieimporte ausgesetzt wird. Zudem möchte Brasilien, das eigentliche Gegengewicht zu den USA bei den Verhandlungen, zunächst seine Position durch die Gefolgschaft anderer lateinamerikanischer Staaten stärken, um für die Exporte Lateinamerikas in die USA bessere Konditionen aushandeln zu können. Bei der Vorkonferenz in Buenos Aires hat Brasilien bereits erreicht, dass die Sozialstandards im Arbeitsrecht, Umweltschutzbestimmungen und andere nicht-tarifäre Handelsbedingungen, die auf Drängen der USA Vertragsbestandteil werden sollten, bei Nichteinhaltung nicht zu Sanktionen führen werden. Brasilien legt zur Zeit noch großen Wert auf eine gemeinsame MERCOSUR-Position in den FTAA/ALCA-Verhandlungen. Ein Alleingang ist auch wenig erfolgversprechend, weil Brasilien sich nicht in eine ähnlich enge Bindung an die USA begeben möchte, wie Mexiko dies durch NAFTA tat. … Chile steht der FTAA/ALCA besonders aufgeschlossen gegenüber. Ebenfalls sehr positiv zu FTAA/ ALCA steht Uruguay, wo sich die anfängliche Begeisterung für den MERCOSUR aufgrund der Handelshindernisse Brasiliens merklich abgekühlt hat. Venezuela hat eine mehr ideologisch bestimmte Position gegen die USA und fühlt sich durch die Zurückhaltung Brasiliens und das kürzliche Treffen der Präsidenten Cardoso und Chávez gestärkt. Zudem braucht es dank des Erdöls und der großen Mineralienlager im Orinoco-Becken die USA als Markt nicht im gleichen Maße wie andere lateinamerikanische Staaten. Eine generell positive Haltung zu den USA und somit auch zur FTAA/ALCA-Initiative hat Kolumbien, weil man zur Abwehr der Guerrilla-Bedrohung und zur Bekämpfung des Drogenhandels den von den USA geförderten Plan Colombia braucht. Zwiespältig ist die Haltung Argentiniens… So ist es nicht verwunderlich, dass sich Argentinien ‚hinter Brasilien versteckt‘ und eine Stärkung des MERCOSUR für vorrangig hält. Ein Angebot der USA, getrennte Verhandlungen über Handelserleichterungen zu führen, wurde Anfang Mai von Präsident De la Rúa zurückgewiesen, könnte aber bei Verschärfung der Krise eine unterschiedliche Wertung erfahren, … Mexiko hingegen kommt – ähnlich wie Brasilien – eine Schlüsselrolle zu. Es hat durch das Nordamerikanische Freihandelsabkommen NAFTA bereits wesentliche Handels- und Investitionsvorteile erreicht und wickelt ca. 85% seines Außenhandels mit den USA und Kanada ab. Man sieht aber auch, dass die starke Abhängigkeit von der US-Konjunktur ‚ungesund‘ ist; wenn die USA einen Schnupfen haben, bekommt Mexiko eine Lungenentzündung, so die bisherige Erfahrung.
(Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. – W. Bernecke)
[24] Während des Präsidentschaftswahlkampfes hatte ‚Lula‘ die ALCA-Vorschläge der USA als ‚Politik der Annexion‘ bezeichnet und versprochen, dass sich Brasilien nicht annektieren lassen werde… Brasilien fordert deutlichere Zugeständnisse der USA.
(Kommt eine ALCA light?, Brennpunkt Lateinamerika, 24-03, S.252f) Angesichts der brasilianischen Widerstände gegen ein umfassendes panamerikanisches Freihandelsabkommen hat der United States Trade Representative einen seiner Mitarbeiter an die brasilianische Adresse gerichtet verkünden lassen, dass es eine ALCA mit oder ohne Brasilien geben werde, und sollte Brasilien auf seiner harten Position beharren, werde es schließlich nur noch mit der Antarktis verhandeln können. Die Antwort Brasiliens kam umwendend: Der brasilianische Außenminister Celso Amorim bezeichnete die Drohung der USA, Brasilien mit bilateralen Freihandelsofferten an die anderen lateinamerikanischen Länder zu isolieren, als pure Zeitverschwendung.
(Brennpunkt LA 24-03, S.250)
[25] Für die USA besteht rein wirtschaftlich gesehen keine unmittelbar zwingende Notwendigkeit für das Zustandekommen des ALCA-Vertrages in der ursprünglich angestrebten Form. Auch ohne ein umfassendes gesamtamerikanisches Freihandelsabkommen haben die USA ihre merkantilen Interessen in der Region bereits in zahlreichen bilateralen Freihandelsabkommen abgesichert und durch massive Direktinvestitionen flankiert… Durch die Intensivierung bilateraler Handelsgespräche mit einer Vielzahl von Ländern in Lateinamerika und der Karibik parallel zu den ALCA-Verhandlungen wollen die USA offensichtlich auch Brasiliens Bemühungen unterlaufen, einen lateinamerikanischen Handelsblock zu schaffen.
(Brennpunkt LA 24-03, S.251f) Zu erwarten ist eine Proliferation bi- und plurilateraler Freihandelsabkommen zwischen der größten Volkswirtschaft der Welt und den Ländern Lateinamerikas und der Karibik. Vom ‚two-track approach‘, der Strategie des gleichzeitigen Aushandelns multi- und bilateraler Verträge versprechen sich die USA offensichtlich Vorteile gegenüber der Strategie des Multilateralismus. Denn in bilateralen Verhandlungen mit den schwachen lateinamerikanischen Ökonomien werden die Unterhändler der USA ihre Interessen leichter durchsetzen können.
(Brennpunkt LA, 24-03, S.254)
[26] So wie die USA die Neuregelung der ökonomischen Beziehungen als Teil amerikanischer ‚Sicherheitspolitik‘, also als Element des strategischen Gesamtprogramms einer amerikanisch beaufsichtigten Staatenordnung in ihrer Hemisphäre behandeln, so betreibt auch Europa sein Interesse am Handel und Wandel in Lateinamerika, das es so gern als „Beispiel für eine vorbildliche“, weil „auf Hegemonieansprüche verzichtende interregionale Zusammenarbeit“ betrachtet wissen will, unter weiterreichenden Perspektiven: Für die europäische Union wäre die Intensivierung der bestehenden Kontakte zum Mercosur und zu Chile ein Beweis für die Fähigkeit, die Ziele ihrer Gemeinsamen Außen-und Sicherheitspolitik (GASP) in verbindliche Absprachen umzuwandeln und die internationale Identität der Union zu bekräftigen.
(Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften, 09/2001)
[27] Seit es den Krieg gegen den Terror gibt, beherrschen in den Vereinigten Staaten andere Themen den öffentlichen Diskurs, und Freihandel ist vor allem ein Instrument der Außenpolitik und Terrorbekämpfung geworden… Offene Märkte, sagt George Bushs Handelsbeauftragter Robert Zoellick, müssten heute auch dazu dienen, dem Terrorismus seinen Nährboden zu nehmen.
(SZ,11/02)
[28] (Noriega, 20.1.2001, zitiert in Le monde diplomatique, 15.2.2002) Vorgesehen sind von Amerika „Beistand zur Erhaltung der Demokratie“, v.a. gegen jeden Versuch eines Staatsstreichs, zu leisten und geeignete Maßnahmen zur Erhaltung oder Stärkung der institutionellen Demokratie zu ergreifen
. Der OAS-Generalsekretär Gaviria sagte anlässlich der Eröffnungssitzung in Lima, man besitze nun ein Instrument, um Bedrohungen der Demokratie mit einer klaren kollektiven Antwort zu begegnen. Den potenziellen Putschisten und autoritären Herrschern schrieb Gaviria ins Stammbuch, dass diese in Zukunft nicht auf Nachsicht zählen können.
Ganz im diesem Sinne wird Kuba vorab als einziges lateinamerikanisches Land aus dem Einigungsprozess der ‚Amerikas‘ ausgeschlossen – eine ‚ordnungspolitische‘ Leistung eines noch gar nicht abgeschlossenen Vertragswerks.
[29] Wo die rechtlichen Grenzen (der Polizei- und Militärkompetenzen) aufgrund der augenblicklichen Bedrohungen keinen Sinn machen, sollten sie mit ihren demokratisch gewählten Regierungen in einen ehrlichen Dialog eintreten, um festzustellen, ob die Gesetze und Beschränkungen einer Revision bedürfen.
(Der Oberbefehlshaber des US-Southern Command, General Hill)
[30] Von einer Gefahr, dass die realen Probleme Lateinamerikas der vereinfachenden Sichtweise der USA untergeordnet, den Lateinamerikanern inadäquate Lösungen oktroyiert und vorschnelle militärische Lösungen ohne eine langfristige Planung gesucht werden
(Neue Bedrohungsszenarien als Grundlage für eine neue Sicherheitsarchitektur in den Amerikas?, Brennpunkt Lateinamerika 7-2004, S.29), von der Gefahr einer Remilitarisierung sozialer Konflikte
also, kann schon deswegen nicht gesprochen werden, weil die Militärs ihre Rolle als ‚Garanten der Demokratie‘ nie verloren haben; dass die ‚sozialen Konflikte‘ in erster Linie Ordnungs- und Sicherheitsprobleme aufwerfen, darin sind sich die Regierungen in Washington mit der Mehrheit der nationalen Politiker immer schon einig. Im Übrigen nicht nur mit denen! Auch Europa, in dessen Namen der Kritiker spricht, teilt die Diagnose – politische, wirtschaftliche und soziale Instabilität, Drogenhandel sowie Terrorismus, Unsicherheit, Gewalt und zunehmende Kriminalität
(Regionales Strategiepapier der EU-Kommission) – und teilt deshalb auch die ‚Lösungsansätze‘: Der EU-Kommissar für die Außenbeziehungen, Chris Patten, hat kürzlich darauf hingewiesen, dass die EU bei militärischer ‚hard power‘ bei weitem nicht an die USA heranreicht, aber eine Menge an ‚soft power‘ zu bieten habe, wenn es um die Frage der Stabilisierung politischer und zivilgesellschaftlicher Strukturen gehe.
(a.a.O., S.28) Mangelnder strategischer Einfluss, das ist also der Grund für die Suche nach ‚besseren Alternativen‘; und „Kooperation bei der Polizeiausbildung“, das ist die äußerst komplexe, adäquate und langfristige europäische Antwort – nämlich die Weise, sich als konkurrierende Ordnungsmacht unter den gegebenen eindeutigen Vormachtverhältnissen zur Geltung zu bringen.
[31] Das betrifft, wie schon gesagt, den Antidrogenkampf in Kolumbien und anderswo; aber z.B. auch „3+1“-Beziehungen der USA mit Paraguay, Brasilien und Argentinien zur Kontrolle des „islamistischen Dreiecks“ an deren gemeinsamer Grenze. Mexiko wird zum Aufbau einer Antiterror-Spezialeinheit zur Überwachung des Grenzgebiets zu Guatemala angehalten, um ‚unkontrollierte Migration‘ zu verhindern, die Indigenenbestrebungen unter Kontrolle und überhaupt dieses Gebiet wegen seiner wirtschaftlichen und strategischen Bedeutung im Griff zu halten, usw.
[32] Schon Argentiniens Falkland-Krieg hat diese Klarstellung herausgefordert. Indem sie ihrem „special friend“ Großbritannien zum Sieg verholfen haben, haben die USA seinerzeit der Militärjunta in Buenos Aires die wichtigste Bedeutung des Grundsatzes „Amerika den Amerikanern“ vorbuchstabiert: Im Hinterhof der USA herrscht Disziplin!