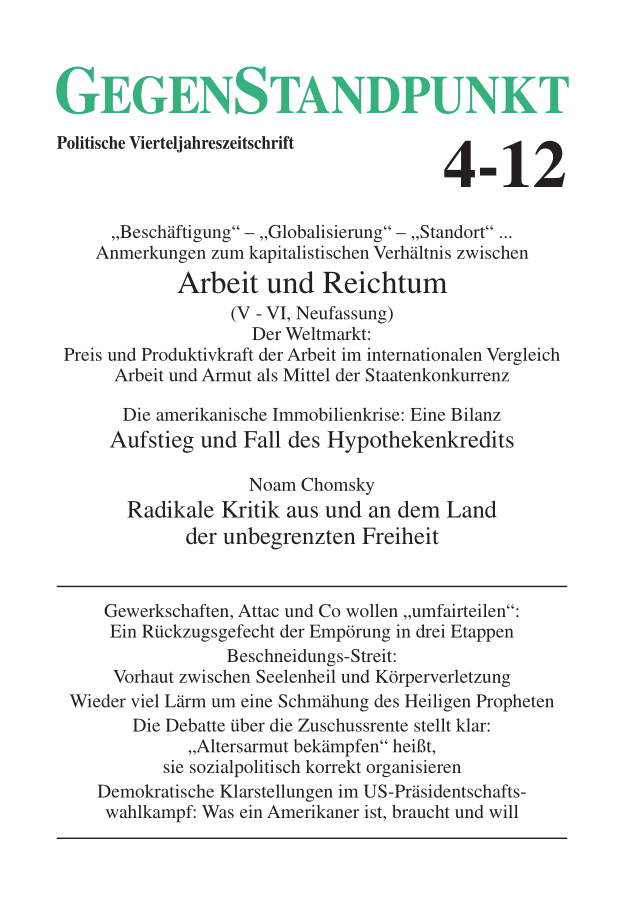Aus der Reihe „Chronik - kein Kommentar!“
Demokratische Klarstellungen im US-Präsidentschaftswahlkampf:
Was ein Amerikaner ist, braucht und will
Die Bürger von „God’s own Country“ haben den Präsidenten gewählt. Der Wahlkampf war – wie es sich für die größte und mächtigste unter den freien Demokratien gehört – wieder einmal vorbildlich. Das betrifft weniger die mustergültige Art und Weise, in der die Kandidaten vorgeführt haben, wie sehr dieser Höhepunkt demokratischer Volkssouveränität eine Angelegenheit organisierter Geldmacht der jeweiligen Parteien ist, die diese für ihre Propaganda-Inszenierungen aufzubieten vermögen. Das betrifft auch nicht in erster Linie die von allen öffentlich-journalistischen Beobachtern genussvoll aufbereiteten weltrekordverdächtigen Orgien an politischem Fundamentalismus, Bigotterie, Heuchelei und Gehässigkeit, mit denen der demokratische und der republikanische Präsidentschaftsanwärter sich bei ihrem Stimmvolk in Szene gesetzt haben, um sich als Führer glänzend und den Gegner jämmerlich aussehen zu lassen. Es ist vielmehr die typisch amerikanische Schnörkellosigkeit, mit der Obama und sein Herausforderer von den Republikanern ausgebreitet haben, was der ganze Inhalt der demokratischen Freiheit ist, die alle Wähler während und zwischen den Wahlen ausleben dürfen.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Siehe auch
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Demokratische Klarstellungen im
US-Präsidentschaftswahlkampf:
Was ein Amerikaner ist,
braucht und will
Die Bürger von God’s own Country
haben den
Präsidenten gewählt. Der Wahlkampf war – wie es sich für
die größte und mächtigste unter den freien Demokratien
gehört – wieder einmal vorbildlich. Das betrifft weniger
die mustergültige Art und Weise, in der die Kandidaten
vorgeführt haben, wie sehr dieser Höhepunkt
demokratischer Volkssouveränität eine Angelegenheit
organisierter Geldmacht der jeweiligen Parteien ist, die
diese für ihre Propaganda-Inszenierungen aufzubieten
vermögen. Das betrifft auch nicht in erster Linie die von
allen öffentlich-journalistischen Beobachtern genussvoll
aufbereiteten weltrekordverdächtigen Orgien an
politischem Fundamentalismus, Bigotterie, Heuchelei und
Gehässigkeit, mit denen der demokratische und der
republikanische Präsidentschaftsanwärter sich bei ihrem
Stimmvolk in Szene gesetzt haben, um sich als Führer
glänzend und den Gegner jämmerlich aussehen zu lassen. Es
ist vielmehr die typisch amerikanische
Schnörkellosigkeit, mit der Obama und sein Herausforderer
von den Republikanern ausgebreitet haben, was der ganze
Inhalt der demokratischen Freiheit ist, die alle Wähler
während und zwischen den Wahlen ausleben dürfen.
Die hat in Amerika drei Namen: Jobs, Jobs, Jobs!
Ein job
– das ist der Inbegriff gelebter
amerikanischer Freiheit. Einen solchen zu suchen, zu
finden und nach Kräften auszufüllen, ist das Recht jedes
freien Amerikaners – schon gleich, wenn im Land Krise
ist. So kümmert er sich um nichts als sich selbst und
alles, was ihm wichtig ist: Das im Job erworbene
Einkommen ist, egal wie hoch oder niedrig es ausfällt,
sein Eigentum, von dem er mit seiner family
autonom lebt. Abgesehen von der Bank, an die er seine
Kredite abstottert, ist er der Herr über sein per
Einkommen aus seinem Job bezahltes home, welches
sein castle und das mit seiner gun zu
verteidigen sein verfassungsmäßiges Recht ist.
Als diesen autonomen Schmied seiner happiness sprechen ihn die Präsidentschaftskandidaten an, und sie versprechen ihm, dass sie mit all der Macht, die in dem von ihnen verteidigten bzw. angestrebten Amt liegt, dafür sorgen werden, dass der hardworking American auch die opportunities bekommt, sich einen job zu suchen, in dem er dann hart arbeiten und Geld verdienen kann. Das ist eine Ansage von entwaffnender Klarheit.
Anders, als dass mächtige Männer sich ihrer annehmen, ist
diese ganz private Autonomie freier Eigentümer
anscheinend überhaupt nicht zu leben. Die Wahlkämpfer
wenden sich in ihrer Werbung an das Wahlvolk als eine
Ansammlung ohnmächtiger Gesellen, von Hanswursten, die
auch und gerade in ihrem elementarsten Lebensinhalt – dem
Konkurrenzkampf um einen Job, ohne den im Reich
marktwirtschaftlicher Freiheit keine Existenz zu haben
ist – vollständig abhängig sind von den Bedingungen, die
die Politik ihnen dafür serviert. „Für euren Job
braucht ihr mich an der Macht“ – so sprechen
Obama und Romney die Adressaten ihrer Wahlkampagnen als
abhängige Objekte der Entscheidungen staatlicher
Amtsträger an, die über nichts von dem selbst zu
bestimmen haben, was ihnen an Umständen und Mitteln ihres
Lebenskampfes entgegentritt. Regiert werden die
Lebensverhältnisse von den Mächtigen der Politik, die
ihre Macht dafür einzusetzen versprechen, dass der gute
Amerikaner in seiner Ohnmacht wieder eine Perspektive hat
und Jobs geschaffen
werden – von tüchtigen
amerikanischen Unternehmern. Das ist die zweite,
ebenso fundamentale und umfassende Abhängigkeit, auf die
Obama und Romney ihr Publikum mit allem Nachdruck
gestoßen haben: Die ganze zupackende Art, die die
Amerikaner in ihren eigenen Augen so sympathisch macht,
lebt davon, dass sie sich für irgendeinen
kapitalistischen Profiteur nützlich macht. Ohne einen
Kapitalisten, der ihn für sein business benutzen
kann, steht der Amerikaner dumm da und auf der Straße –
mit all seinem Tatendrang, seiner unverletzlichen
Freiheit und mitten in dem ganzen Reichtum des reichsten
Landes der Welt. Das spricht aber überhaupt nicht gegen
diese Unterordnung aller Anstrengungen unter die
Gewinnkalkulation kapitalistischer Unternehmen, sondern
dafür, dass die Unternehmer dann auch alles vorfinden,
was sie brauchen, um ihrem Dienst als nationale
Job-Maschine nachzugehen.
Damit ist der Inhalt des Wahlkampf auch schon fix und
fertig: Obama und Romney haben ihre autonomen Amis darauf
angesprochen, dass sie nichts weiter sind als
unselbständige Anhängsel staatlicher Macht und
privatkapitalistischer Gewinnrechnungen; dass mithin das
ganze Lebensglück, das aus ihrer gelebten amerikanischen
Freiheit herausspringt, nichts weiter ist als ein
Derivat staatlicher und unternehmerischer
Definitions- und Entscheidungsmacht. Und
sie haben ihrem Volk diesen Status nicht nur hingerieben
als sein ureigenes Bedürfnis nach jobs
:
In dem darf es sich glücklich vereint sehen mit allem,
was auch seine Herren für ihre Zwecke benötigen
– Amerika braucht Arbeitsplätze
(Romney). Insofern braucht nicht nur
jeder Amerikaner seinen job, sondern macht mit
seinem Bedürfnis zugleich sein eingeborenes Recht auf die
Konkurrenzüberlegenheit amerikanischer Unternehmen und
die totale Überlegenheit und Unangreifbarkeit
amerikanischer Staatsmacht weltweit geltend: Die
Kandidaten haben sich darin überboten vorzuführen, dass
in ihren – und nur in ihren – Händen die Gleichung
zwischen dem ganz persönlichen pursuit of
happiness jeden Amerikaners und der durchschlagenden
Macht amerikanischer Kapitale und amerikanischer Gewalt
auf dem gesamten Globus gewährleistet ist.
Was das im Einzelnen ist, wie das im
Detail funktionieren soll, war dabei absolut
nebensächlich. Mit irgendwelchen schwierigen
Zusammenhängen zwischen den Zwängen, Erfolgen und
Misserfolgen, die jeder Ami beim Ausgestalten seiner
Freiheit zu spüren bekommt, und dem, was Staats- und
Wirtschaftsbosse kalkulieren, entscheiden und
herbeikommandieren wollen, haben die Wahlkämpfer ihr
Stimmvolk jedenfalls nicht groß belästigt. Sie haben sich
darauf beschränkt, ihren Bürgern vorzusagen, dass sie
nichts anderes wollen und brauchen als
Machthaber, die ihre Macht genau so zu gebrauchen wissen,
wie es ein jeder Ami von ihnen verlangen darf: Total
mächtig eben, wenig irritiert von irgendwelchen
Bedenklichkeiten oder gar Rücksichtnahmen worauf oder auf
wen auch immer, einzig orientiert am Wohl von our
great nation
und ihrem starken Kapitalismus.
Das war die einzige Vermittlung zwischen den privaten Nöten und Notwendigkeiten und der weltweiten Entfaltung amerikanischer Größe und Macht, die der Präsident und sein Herausforderer dafür umso nachdrücklicher angeboten haben: in Gestalt ihrer unbedingten persönlichen Glaubwürdigkeit, nichts weiter zu sein als Exekutoren dieser Gleichung. Dafür haben sie sich auf allen Kanälen rund um die Uhr inszeniert als personifizierte Einheit von Sachkenntnis über die Abhängigkeiten, auf die der normale hardworking American von Staat und Wirtschaft festgelegt wird – und im selben Zug als professionals der Ausübung von Gewalt ihren unbedingten Willen demonstriert, die Macht der größten Supermacht weiter zu pflegen und zu mehren – wo und wann gerade notwendig.
Eines fürs andere sprechen zu lassen: Dafür hat Romney
sich als smarten, auf Erfolg abonnierten
Finanzunternehmer vorgeführt, der sich in Gelddingen und
beim Job-Schaffen auskennt, in Sachen Wirtschaft und
Handel für jede Beendigung irgendwelcher Rücksichten auf
Klima oder China eintritt – und seine ökonomische
Sachkompetenz mit der des Gewalthabers in spe
untermauert, indem er sich für höhere Militärausgaben
verwendet und sich für die militärische Lösung der
Iranfrage
stark macht. Dafür hat sich umgekehrt Obama
als Kenner der Nöte seiner von der Krise gebeutelten
Amerikaner in Szene gesetzt, der mit aller
geldpolitischen Macht fürs gute Klima beim Job-Schaffen
sorgen will, ihnen sogar eine Krankenversicherung
verschafft hat – und selbstverständlich auch im Kampf
gegen den Terror und für den Respekt der ganzen Welt vor
der amerikanischen Supermacht nichts anbrennen lässt.
In diesem Quidproquo haben die zwei Kontrahenten – die
sich nach Aussage kenntnisreicher Beobachter den
teuersten, härtesten und schmutzigsten US-Wahlkampf
der Geschichte
lieferten – so ziemlich bei jedem
Thema zusammengefunden und etwa an der Frage des
nationalen Energiehaushalts deutlich gemacht, wofür es da
unbedingt eine Unabhängigkeit der USA von
Energieimporten
braucht – einfach für alles, was
einem Amerikaner an Amerika das Wichtigste ist, sein
Job und seine Zugehörigkeit zum mächtigen
land of the free: Öl und Gas made in the USA
sind der Hebel, die Ökonomie anzukurbeln und neue Jobs
zu schaffen …
, und entscheidend ... für die
nationale Sicherheit
– als ob jedes für sich und
beides zusammen das Selbstverständlichste von der Welt
wäre.
Auf den Punkt gebracht hat diese vom wählenden Ami
verlangte Dialektik von Einsicht in die totale
Abhängigkeit und grenzenlosem Stolz auf alles, wovon er
abhängt, der wunderschöne Satz: Osama bin Laden is
dead and General Motors is alive.
Das braucht und
will der Amerikaner, hardworker und
patriot, der er ist und als den seine
politischen Herren ihn feiern.