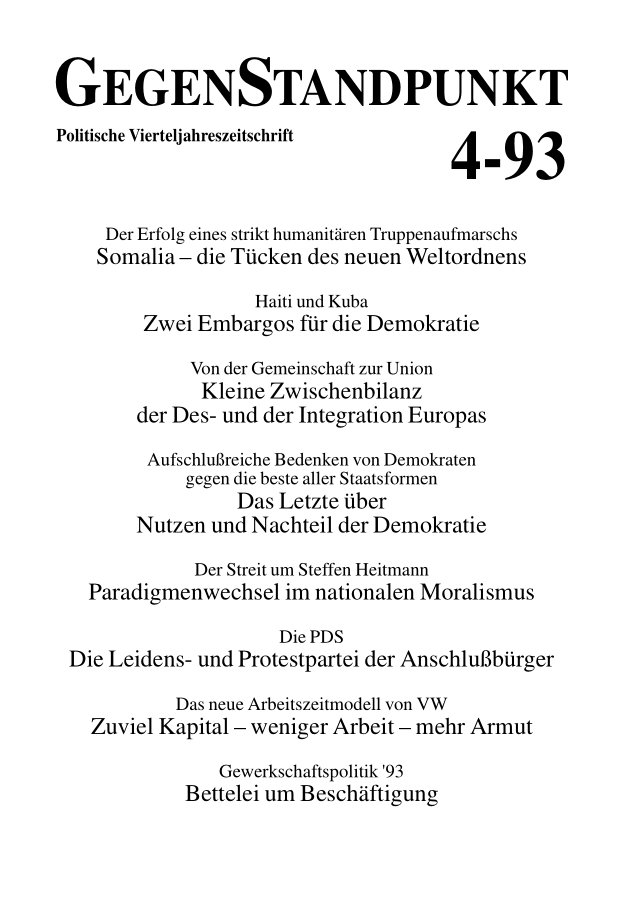Der Streit um Steffen Heitmann
Paradigmenwechsel im nationalen Moralismus
Mit der Aufstellung Heitmanns als Präsidentschaftskandidat eröffnet die CDU einen Streit um Alternativen der nationalen Moral, um sie an den Imperialismus des vereinten Deutschlands anzupassen und dadurch für ihn produktiver zu machen: Gegen die Nachkriegs-Staatsmoral eines demokratisch geläuterten Patriotismus verkörpert ihr Kandidat den Willen zum nationalen Neubeginn des vereinten Deutschland und vertritt einen grund- und bedingungslosen Nationalismus. Die Opposition besteht auf der einigenden Kraft des bewährten Nationalismus und blamiert Heitmann am Ideal unbestrittener Meinungsführerschaft, indem sie ihm diese bestreitet.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Gliederung
- Wofür Heitmann steht: Die Moral des puren Nationalismus
- Heitmanns Feindbild: „Intellektuelle“ contra „Normalbürger“
- Wogegen Heitmann aufsteht: Der Moralismus des demokratisch funktionellen, antifaschistisch gebesserten Vaterlands
- Heitmann – der personifizierte Wille zum nationalen Neubeginn mit gründlich verschobener nationaler „Debattenlage“
- Was gegen Heitmann sprechen soll: „Versöhnen statt spalten“ – Mit dem Ideal der nationalen Gleichschaltung gegen das Ideal eines gleichgeschalteten Nationalismus
- Der politische Sinn des „Kulturkampfs“ um Heitmann: Durchaus auch „ein Stück Machtwechsel“
Der Streit um Steffen
Heitmann
Paradigmenwechsel im nationalen
Moralismus
„Warum diese ganze Aufregung um Heitmann? Warum diese Kampagne, in der sich politische Killer-Instinkte ungehemmt austoben? Man hat den Eindruck, als ginge es für ihre Protagonisten ums Überleben. Vielleicht täuscht dieser Eindruck ja nicht. Der Streit um Heitmann trägt die Züge eines Kulturkampfes. Es geht um die Herrschaft über die Diskurse, also darum, wer wen zwingen kann, politische Aussagen moralisch zu legitimieren.“ (Eckhard Fuhr in der Frankfurter Allgemeinen vom 29.9.93)
Der Mann hat’s erfaßt. Darum geht es – Heitmann und denen, die ihn als Bundespräsidenten durchsetzen, ebenso wie denen, die ihn verhindern wollen: um den „Zeitgeist“ in seiner ganzen intellektuellen Schäbigkeit. Nämlich um die neue Entscheidung der eigentümlichen Machtfrage, von der der FAZ-Kommentator ganz unbefangen berichtet, daß sie – und nicht etwa das bessere Argument – den Geist diktiert, in welchem hierzulande öffentlich und mit Aussicht auf Gehör geredet, gedacht und gemeint wird, Talkshows abgehalten, Leitartikel verfaßt, Moralpredigten gehalten werden. Der Mann weiß, wovon erspricht; er selbst ist schließlich drin im Geschäft des Meinungsmachens; und er sagt, wie das geht. Was wie ein Austausch von Argumenten aussieht, ist in Wahrheit ein Ringen um die Etablierung von Selbstverständlichkeiten, für die gar nicht erst argumentiert werden muß, auf die man sich vielmehr anerkanntermaßen berufen kann; ein Ringen noch nicht einmal um moralische Rechtfertigungen, sondern darum, wer wen moralisch in die Defensive bringt, welcher Standpunkt gar nicht mehr gerechtfertigt zu werden braucht und welcher als abweichend, moralisch rechtfertigungsbedürftig, also fragwürdig bis zwielichtig gilt. Ein Kampf, der logischerweise gar nicht im „Diskurs“ entschieden werden kann, weil es ja um die „Herrschaft über die Diskurse“ geht; der vielmehr auf dem Feld der öffentlich anerkannten oder bestrittenen Ehrbarkeit der Meinungsträger, mit den Mitteln der Propaganda und den Waffen der Diffamierung, sogar unter Einsatz publizistischer „Killer-Instinkte“ ausgetragen wird. Die Durchsetzung eines Bundespräsidenten mit den Mitteln der Wahlarithmetik und Fraktionsdisziplin gilt da mehr als tausend Argumente, weil sie zur Klarstellung beiträgt, welche Meinung per se als Argument gilt und welche gar kein Argument wert ist. In der Tat, so funktioniert sie, die demokratische Öffentlichkeit mit ihrem vielgepriesenen Pluralismus.
Heitmann steht für moralische Grund- und Vorentscheidungen, die dem FAZ-Kommentator besser gefallen als diejenigen, unter denen er bislang gelitten hat – denn auch das muß man ihm schon glauben: Für die politischen Standpunkte der FAZ moralische Rechtfertigungen zu ersinnen, das hat dieser Geist als Zwang empfunden. Er freut sich darauf, diese Last vielleicht bald endgültig loszuwerden. Wenn Heitmann erst Präsident ist – meint er –, dann ist er an der Reihe und darf allen fremden, ihm unsympathischen Auffassungen moralisch den Prozeß machen.
Um welche politische Moral geht es da?
Wofür Heitmann steht: Die Moral des puren Nationalismus
Der Süddeutschen Zeitung gegenüber erklärt der Kandidat sich so:
„Das Merkwürdige ist in der Bundesrepublik Deutschland, daß es ein paar Bereiche gibt, die sind tabuisiert. Es gibt eine intellektuelle Debattenlage, die nicht unbedingt dem Empfinden der Mehrheit der Bürger entspricht, die man aber nicht ungestraft verlassen kann. Und dazu gehört das Thema Ausländer; dazu gehört das Thema Vergangenheit Deutschlands, die Nazi-Vergangenheit; dazu gehört das Thema Frauen. Ich glaube, daß man diese Debatten auch aufbrechen muß, selbst auf die Gefahr hin, daß man dann in bestimmte Ecken gestellt wird, in denen man sich gar nicht wohl fühlt. Ich glaube, man muß versuchen, auch dem Normalbürger eine Stimme zu geben in diesen Debatten.“ (SZ, 18.9.93)
Der Mann empfindet genauso wie die FAZ: Politische Stellungnahmen zu gewissen Themen sind hierzulande mit moralischen Vorentscheidungen belastet, die selber nicht zur Debatte stehen. Daß die ihm nicht passen, sagt er gar nicht so; schon gar nicht argumentiert er inhaltlich dagegen – das wäre auch gar nicht sein Job, da versteht er das Bundespräsidentenamt schon ganz richtig. Er lehnt die „intellektuelle Debattenlage“ grundsätzlich ab, will „dem Normalbürger eine Stimme geben“ dürfen, ohne sich gleich gegen den Verdacht ungewollter oder gar beabsichtigter Rechtslastigkeit – denn darum geht es bei den genannten „Ecken“ – rechtfertigen zu müssen. Er will also auch nicht eine unvoreingenommene Debatte darüber eröffnen, ob das, was er dem stimmlosen „Normalbürger“ ablauscht, also in den Mund legt, damit er endlich eine Stimme hat, rechtslastig ist, geschweige denn, ob und inwiefern das schlecht wäre. Er will sich einfach nicht dumm anquatschen und unhöflich befragen lassen müssen – bloß weil sich ihm z.B., Thema Ausländer, angesichts der Türkendichte in westdeutschen Großstädten unabweisbar die Frage aufdrängt, ob er überhaupt noch in Deutschland ist. Dieses Gefühl der Entfremdung im eigenen Land läßt er sich nicht „intellektuell“ kaputtdebattieren; die Alternative, die ihm da doch bloß angetragen wird: sich „multikulturell“ zu den Fremdlingen zu stellen, empfindet er, stellvertretend für den „Normalbürger“, als Zumutung – nein, nicht ganz: als „verordnet“ und schon insofern politisch verkehrt. Verordnen kann man den Bürgern nämlich vieles, von Sozialabgaben bis zum Mietrecht und von der Nachbarschaft giftiger Fabriken bis zu Bundeswehreinsätzen; aber daß man Leute von auswärts mit seinen national-rechtsbewußten gehässigen Meinungen einfach in Ruhe läßt, das „kann allenfalls von unten wachsen“, und wenn es nicht wächst, dann ist da nichts zu machen. Im übrigen hat Heitmann schon dazugelernt und sich an „integrierte Ausländer“ – „SZ: Wobei ja für diese Menschen ohnehin der Name Ausländer falsch ist… Heitmann: …inzwischen schon fast unsinnig…“ – gewöhnt: die „sind doch nicht das Problem“. Das sieht er eher, deckungsgleich mit der verfassungsändernden Bundestagsmehrheit, in den Massen von Asylbewerbern. Daß diese Sicht der Dinge sich zufällig auch mit der der Rechtsradikalen deckt, soll man gefälligst nicht ihm und seinem stellvertretenden Volksempfinden anlasten.
Den Einwand „bloß von oben verordnet, deswegen politisch falsch“ bringt Heitmann, darin ebenfalls deckungsgleich mit einem Standpunkt, den bislang bloß die Republikaner und die Stoiber/Gauweiler-Fraktion in der CSU so offensiv vertreten haben, auch – Thema Europa – gegen den Vertrag von Maastricht vor. Daß dessen Bestimmungen überhaupt nichts anderes betreffen als das Handeln von Regierungen und anderen staatlichen Behörden, also Sachen, die allemal „von oben verordnet“ werden – für den sächsischen Justizminister sicher keine ganz fremdartige Verfahrensweise –, hindert den Mann nicht an der Auffassung, die vereinbarten Maßnahmen ließen sich nur „mit Leben erfüllen, wenn die Menschen mitgehen.“ Was er damit meint, ist klar: Er verlangt die Rechtfertigung des Projekts einer Europäischen Union vor dem nationalen Gemüt, als welches er sich dasjenige des „Normalbürgers“ vorstellt, und will nicht umgekehrt um eine supranational-europaidealistische Rechtfertigung seiner „nationalen Identität“ angegangen werden.
Die – Thema Deutschland – mag er nämlich ohne jede weitere Begründung sehr und zeigt sich betrübt, daß es den Rechtsextremisten genauso geht:
„SZ: Was bedeutet das Nationale für Sie? Heitmann: Als Deutscher ist man da immer gespalten. Mich schreckt der Begriff nicht, mich schreckt nur sein Mißbrauch. Es fällt mir schwer, darüber zu reden – weil es den Ausspruch gibt ‚Ich bin stolz, ein Deutscher zu sein‘. Diesen Satz höre ich in einer Weise und mit einem Hintergrund gebraucht, wie ich ihn nicht gebrauchen kann. Nur, was es für uns, die wir in der DDR gelebt haben, bedeutet, auf unsere Meldezettel nicht mehr DDR schreiben zu müssen, sondern schlicht deutsch, das kann wahrscheinlich jemand im Westen sich schwer vorstellen.“
Der Mann ist schlicht selig, daß das Undeutsche der alten DDR endlich von ihm abgefallen ist – immerhin eine Klarstellung, worunter er dort und damals eigentlich gelitten hat; denn was er sonst noch gewollt und getrieben hat, Kirchenrecht z.B., das hat er ja gedurft. Gar nicht so undeutsch, im Gegenteil als unveräußerlicher Teil „unserer“ deutsch-nationalen Geschichte kommt ihm demgegenüber, Thema Nazi-Vergangenheit, die vor-sozialistische und vor-bundesdeutsche Epoche seiner Heimat vor: Den Nationalsozialismus möchte er in sein nationales „Wir“ und „Unser“ einbeziehen dürfen, ohne sich zu einer völlig unnormalen fortdauernden moralischen Erschütterung bekennen zu müssen. Auch in dieser Hinsicht hat die „Wiedervereinigung“ ihm ein Befreiungserlebnis beschert:
„Nach der Einheit hatte ich zum erstenmal Gelegenheit, mit Juden zu reden, und es hatte für mich etwas Befreiendes, von ihnen zu hören: Hört doch auf, eure Geschichte dauernd als Monstranz vor euch herzutragen. Wir müssen lernen, mit dieser Geschichte, die wir haben, umzugehen.“
Nun wäre ja das mit der „Monstranz“, wenn das denn üblich gewesen sein soll, auch eine Art, „mit dieser Geschichte umzugehen“. Heitmann fordert schon einen anderen Umgang damit als den demonstrativ-moralischen, von dem er sich durch echte Juden hat freisprechen lassen:
„SZ: ‚Normal‘ umgehen? Wie soll man normal umgehen mit Millionen Morden? Heitmann: Das ist richtig. Nur muß man sehen, daß auch dies ein geschichtlicher Prozeß ist, in dem wir uns befinden. Ich möchte warnen vor der intellektuellen Sonderrolle, die einige von uns sich anmaßen aus der Vergangenheit herleiten zu können, die gewissermaßen die bessere Moral verkörpern wollen.“
Man sollte also lieber die Geschichte – statt anmaßenderweise den Intellekt – darüber entscheiden lassen, was aus der Nazi-Geschichte zu folgern ist. Von intellektuellen Moralisten will Heitmann sich jedenfalls nicht ein schlechtes deutsches Gewissen einreden lassen müssen:
„SZ: Nazi-Vergangenheit darf keine Dauerhypothek sein…? Heitmann: Ja. Kulminiert ist ja dieses Problem schon in dem sogenannten Historikerstreit. Der muß überholt sein.“
Der Kandidat plädiert also für Nicht-Befassung mit der die bundesdeutsche Nachkriegs-Ideologie erschütternden Debatte, ob Großdeutschlands Völkermord an den Juden mehr als Fall von etwas Allgemeinem einzuordnen sei – damit wäre er, nach gemeinsamer Auffassung aller Diskussionsteilnehmer, schon zur guten Hälfte entschuldigt, jedenfalls irgendetwas Weitverbreitetes dafür haftbar gemacht und die „nationale Identität“ der Deutschen als solche freigesprochen –, oder ob er als einzigartige Untat, als beispiellose Leistung sui generis der Deutschen gelten müsse – damit hätte die „deutsche Identität“, gleichfalls nach Auffassung aller engagierten Post-Faschisten, ihren unauslöschlichen Makel weg.[1] Die SZ glaubt Heitmann zu Recht nicht, daß ihn diese heiße Alternative überhaupt nicht interessiert:
„Auf welcher Seite des Historikerstreits stehen Sie? Heitmann: Ich glaube, daß der organisierte Tod von Millionen Juden in Gaskammern tatsächlich einmalig ist“ (was gibt es da eigentlich zu „glauben“?) „– so wie es viele historisch einmalige Vorgänge gibt. Wiederholung gibt es in der Geschichte ohnehin nicht.“
Eine salomonische Lösung, die Heitmann unbedingt zum Weizsäcker-Nachfolger qualifiziert: Die Einmaligkeit ist doch gerade das Allgemeine an historischen Ereignissen; insofern bestätigt die zweite Lesart der Judenmorde – die Einzigartigkeits-These – die erste – die, wonach es keinen Grund gibt, die deutsche Nation nicht als einen Normalfall von „geschichtlichem Prozeß“ zu akzeptieren. Damit das auch jeder versteht:
„Ich glaube aber nicht, daß daraus eine Sonderrolle Deutschlands abzuleiten ist bis ans Ende der Geschichte. Es ist der Zeitpunkt gekommen – die Nachkriegszeit ist mit der deutschen Einheit endgültig zu Ende gegangen –, dieses Ereignis einzuordnen.“
Nochmal derselbe Argumentationstrick: als wäre die bisherige „Einordnung“ keine gewesen; als wäre es einfach ein Gebot der Unbefangenheit und ein Recht des historischen Prozesses, die Nazi-Vergangenheit anders „einzuordnen“ „in unsere Gesamtgeschichte, die wir als Volk haben“. Nämlich so, daß sie nicht fortwährend, noch über das glücklich siegreiche „Ende der Nachkriegszeit“ hinaus, einen besonderen moralischen Rechtfertigungsbedarf begründet; schon gar nicht für so nützliche Unternehmungen wie Bundeswehr-Einsätze mit UNO-Segen – unter anderem hat Heitmann hier nämlich „die Blauhelmdebatte“ im Auge. Also dreht er den moralischen Spieß herum und setzt den bundesdeutschen Antifaschismus mit seinem Gestus des Entsetzens und seiner Heuchelei nationaler Zurückhaltung ins Unrecht, indem er ausgerechnet die erzwungene Selbstbeschränkung der Nation und ihr bißchen Distanzierung von Hitler unter dem wundervoll abstrakten Stichwort „Sonderrolle“ mit Hitlers Großdeutschland-Projekt identifiziert:
„Die deutsche Nachkriegssonderrolle war ja in gewisser Weise eine Fortsetzung der angemaßten Sonderrolle der Nazi-Zeit. Das ist zu Ende.“
Ab sofort bescheidet sich Deutschland damit, so national aufzutrumpfen, als wäre nie etwas gewesen. Das muß sogar so sein; alles andere wäre gefährlich: Diese Lehre entnimmt Heitmann – Thema Nationalismus – den Bürgerkriegen in Jugoslawien. Dort ist nämlich zu sehen, daß nur ein gesunder Nationalismus seine eigenen blutigen Konsequenzen verhindert:
„SZ: Wohin Nationalismen führen, sehen wir auf blutigste Weise in Jugoslawien. Ist der Begriff Nation nicht diskreditiert? Heitmann: Das erscheint uns jetzt so, weil dort diese furchtbaren Auseinandersetzungen aufbranden. Aber die sind Folgen eines negativen Nationenbegriffs, Folge einer Unterdrückung eines normalen Empfindens der Menschen. Die sind doch zusammengepreßt worden in der Sowjetunion, in Jugoslawien, in den anderen Ostblockstaaten. Nationale Unterschiede sind verharmlost (?!) und brutal unterdrückt worden, wo sie sich Raum zu schaffen versuchten.“
Mit anderen Nationalitäten unter einer Regierung „zusammengepreßt“ zu werden, das hält das normale Empfinden der Menschen nicht aus. Dieses Empfinden, mit dem die Menschen sich mit Haut und Haaren unter ihre Nationalität subsumieren, greift ganz natürlich zum Mittel des Gemetzels, wenn man seinen Sortierungswahn bremst, wo er sich gerade Raum zu schaffen sucht. Was mag daran „normal“ sein? Heitmann antwortet mit einem persönlichen Bekenntnis:
„Deutsch sein ist mein Schicksal. Ich bin hier hereingeboren, das hab ich mir nicht ausgesucht.“
Und wäre das nicht Grund genug, sich einmal frei zu diesem „Schicksal“ zu stellen, klar zu unterscheiden zwischen dem Zufall des Geburtsorts und dem wüsten traditions-, nämlich opferreichen Nationalinteresse, das an diesem Geburtsort regiert, und sich die Anerkennung der Nation und ihrer gewalttätigen Geschichte gerade nicht als „schicksalhafte“ Konsequenz des eigenen Geburtsorts aufnötigen zu lassen? Ganz im Gegenteil, meint der Kandidat:
„Das ist wie meine Familie, in die ich hineingeboren bin, die mir vorgegeben ist und von der ich mich allenfalls lossagen kann. Aber auch dadurch werde ich meine Herkunft nicht los. Und das heißt für mich, ich muß mit der Vergangenheit und Herkunft leben, ob ich will oder nicht.“
Man mag Heitmann ja gar nicht fragen, wieviele Äonen diese Herkunft dauern muß, um dermaßen verpflichtend zu sein: Seine DDR-Geschichte ist er doch sehr flott und fröhlich losgeworden. Ein bißchen Wahl und freiwilliges Bekenntnis wird doch schon mit dabeisein, wenn ein denkender Mensch sich gar so sehr seinen „Vorgegebenheiten“ unterordnet. Aber das ist gerade der Witz: Heitmann ergreift Partei für eine Befangenheit, die aus dem Naturzusammenhang der Geburt gar nicht folgt; denn „Herkunft“ in diesem naturwüchsigen Sinn und die Unterwerfung unter eine familiäre oder nationale „Identität“ in dem Sinn, daß man sein Selbstverständnis aus solchen Kollektiven bezieht, ist ein für allemal nicht dasselbe. Auseinanderhalten soll der Mensch es aber gerade nicht, vielmehr Nationalität und Familienbande im Namen des Zufalls, irgendwo „hineingeboren“ zu sein, gleich auch noch als unentrinnbares Schicksal akzeptieren. Ein Plädoyer für „identitätsstiftende“ Unfreiheit, mit dem das nationale Bekenntnis sich von jedem Rechtfertigungszwang freispricht: Weder an Deutschland noch am national parteilichen Deutschen gibt es etwas in Frage zu stellen, wenn einem Deutschen sein Deutschland angeboren ist wie ein Muttermal und beide Seiten „schicksalhaft“ füreinander bestimmt sind.
Natürlich – Thema Frauen –, das kann gar nicht ausbleiben: Dieses Mysterium der angeborenen volksgemeinschaftsstiftenden Befangenheit wirft ein tiefsinniges Licht auf die Figur, durch die der Mensch in Familie und Nation hineingeboren wird. Wenn der Mensch aus seiner natürlichen Herkunft gleich seine „Identität“ als deutscher Volkskörper bezieht, dann ist Mutterschaft soviel wie nationale Sinnstiftung; dann ist jede Frau auf dem Holzweg, die ihre Selbstverwirklichung woanders als in ihren Kindern sucht; dann lassen sinkende Geburtenraten auf eine gemeinschaftsfeindliche, zukunftslose, von Egoismus geprägte Single-Kultur schließen.[2] Wegen dieser eindeutigen Diagnose läßt sich Heitmann aber noch lange nicht nachsagen, sein „Frauenbild“ wäre durch die Trias „Kinder, Küche, Kirche“ bestimmt – er „argumentiert“, wie er sagt, bloß „vom Kind her“, und wenn Kinder Argumente sind, dann ergibt es sich ganz von selbst, daß „die Frau“ am Ende als ziemlich symbiotische Figur dasteht, die ihre Identität in ihren Leibesfrüchten hat und dem Dienst, den sie mit denen dem Volkstum leistet. Nur böser Wille kann das als Emanzipations- oder Frauenfeindlichkeit mißdeuten.
Heitmanns Feindbild: „Intellektuelle“ contra „Normalbürger“
Von solch bösem Willen sieht der Kandidat sich freilich allenthalben umgeben; von Leuten, die ihm z.B. auch den ganz natürlichen Wunsch, Deutschland den Deutschen – und einigen integrierten „Schon-nicht-mehr“-Ausländern – vorzubehalten, als Ausländerfeindschaft auslegen oder an seinem Plädoyer auf ein Ende des antifaschistischen Moralismus der BRD nichts besseres zu entdecken wissen als die Übereinstimmung mit Republikanern und DVU.
Den Ursprung dieser Böswilligkeit orten Heitmann und seine Mitstreiter in einer von „Intellektuellen“ bestimmten „Debattenlage“, die nicht bloß ihnen, sondern dem „Normalbürger“ überhaupt Unrecht tut und den Mund verbietet. Eine gewisse Deckungsgleichheit mit dem rechtsradikalen Weltbild ist freilich auch hier nicht zu übersehen: Gründliche Nationalisten verstehen sich allemal als Anwälte des „einfachen Volkes“ – nicht, weil sie dessen Meinung erforscht und herausgefunden hätten, wie rechts und richtig der Volksmund liegt; sie sind sich ganz prinzipiell sicher, daß „das Volk“ schnörkellos fürs Vaterland ist. Und zwar ausgerechnet deswegen, weil von irgendeiner Berechnung, die für den „Normalbürger“ in und mit seiner Nation aufginge, von irgendeinem Vorteil, der alle Opfer lohnen würde, ja wirklich nichts zu sehen ist. Solange die „einfachen Leute“ trotzdem mitmachen, sehen rechte Volksfreunde sich voll im Recht, wenn sie dem nationalen Menschenmaterial nachsagen, daß es berechnungslos und ohne Grund, also aus „natürlichem Empfinden“ heraus dem Vaterland die Treue hält. Das ist zwar zynisch gedacht, aber lieb und dankbar gemeint. Ebenso prinzipiell mißtrauen die Rechtsgesinnten „den Intellektuellen“ – nicht, weil sie unter Deutschlands Dichtern und Denkern einen Hang zur Demontage nationaler Werte ermittelt hätten; sie entdecken vielmehr schon im Nachfragen den Zweifel, im Wunsch nach moralischen Rechtfertigungen die moralische Distanz, im Gestus der Kritik den Verrat an der guten nationalen Sache.
Für Heitmann ist die Sache aber noch anders gelagert. Er führt ja keinen Feldzug gegen „zersetzende Intellektuelle“, sondern gegen „Tabus“, die er eigentümlich „bundesdeutsch“ findet. Ihn stört nicht eine intellektuelle Amoralität in der Nation, sondern ein spezieller westdeutscher Moralismus. Was ist da dran? War seine Sicht der Dinge in der alten BRD und ist sie noch immer so in der moralischen Defensive?
Wogegen Heitmann aufsteht: Der Moralismus des demokratisch funktionellen, antifaschistisch gebesserten Vaterlands
Man muß es ja nicht gleich so übertreiben wie der Kulturkämpfer von der FAZ; aber das stimmt schon: Im maßgeblichen Feuilletonismus der westdeutschen Republik, in ihrer Präsidenten- und Festredenkultur usw. hatten bislang andere Töne die Oberhand. Nicht als ob die Parteilichkeit für die „deutsche Sache“ fraglich gewesen wäre. Aber diese Sache war nicht rein deutsch-national definiert, und deswegen kannte der Patriotismus seine vaterlandsübergreifenden Gesichtspunkte, die sich sogar so (miß)verstehen ließen, als wären damit Bedingungen für die deutschnationale Parteilichkeit aufgestellt – was sich mit einem vollgültigen Patriotismus nun wirklich nicht verträgt.
So hatte sich der Nato-Frontstaat der vollständigen, auch ideologischen „Westintegration“ verschrieben; an dieser Staatsräson und dem entsprechenden nationalen Antikommunismus waren weniger Zweifel erlaubt als an der im engeren Sinn nationalen Sache der „Wiedervereinigung“; auch die SPD hatte ihren gesamtdeutschen Elan, mit dem sie zu Anfang Adenauer als „Kanzler der Alliierten“ beschimpft hatte, überwunden. Es sah so aus und sollte auch durchaus so aussehen, als wäre die „Freiheitlich-Demokratische Grundordnung“ die Seele der BRD und nicht umgekehrt die Nation der tiefste Sinn einer antikommunistischen Verfassung. Die „intellektuelle Debattenlage“ befaßte sich gutwillig mit so abseitigen Konzepten wie einem funktionalistischen „Verfassungspatriotismus“, wonach der „mündige Bürger“ eben nicht bedingungslos für seine Nation Partei zu ergreifen hätte, sondern bloß insoweit sie eine vorbildliche Verwirklichung abstrakter Verfassungsgrundsätze wäre – ein völliger Widerspruch, denn solche Grundsätze geben niemals eine Unterscheidung zwischen In- und Ausland, eine „nationale Identität“, eine Selbstdefinition von Staat und Bürgern über den nationalen Eigennamen her, also nichts von dem, was Patriotismus ausmacht.
Aber sogar auf der Ebene des nationalen Eigennamens, der Identifizierung des Objekts vaterländischer Parteilichkeit, bot die EG-Macht BRD ihren Bürgern ziemlich ernsthaft eine Alternative zum deutschen Wesen: Europa sollte es sein. Gute Deutsche sollten sich mit der Vorstellung anfreunden, der „alte“ Nationalstaat wäre angesichts der weltumspannenden Aufgaben, die eine namhafte Regierung heutzutage zu erfüllen habe, irgendwie überholt; und für diese Ideologie gab es sogar einen handfesten Grund: Die eigene Nation war, weil „geteilt“, tatsächlich zu klein für ihren nationalen Ehrgeiz, dafür andererseits in Bündnissen engagiert, die den Ehrgeiz bedienten, aber die Nationalität relativierten. So konnte es dahin kommen, daß ein quasi vorweggenommener neuer Nationalismus, der sich auf ein geeintes Westeuropa als neues nationales Subjekt bezieht, in Konkurrenz zum deutschen Nationalismus trat, dem sein wahres Subjekt, die große deutsche Nation, in der politischen Realität abhanden gekommen war. Patrioten, die sich gar nichts anderes wünschten als ein Vaterland mit qualitativ größerer Macht als die kleine BRD – und insofern nichts anderes, als was Hitler seinen Deutschen als Kriegsbeute versprochen hatte –, sollten und, noch eigenartiger, konnten sich mit der „Europa-Idee“ befreunden.
Durch den in manchen Punkten der Wirtschafts- und der Militärpolitik tatsächlich praktizierten Supra-Nationalismus der BRD war sogar die grundsätzlichste aller staatsbürgerlichen Unterscheidungen glatt ein wenig relativiert: Neben der patriotischen Urweisheit, daß Ausländer „Fremde“ sind, die im Inland im Grunde nichts verloren und auf nichts ein Recht haben, rangierte beinahe gleichrangig der funktionalistische Gesichtspunkt, daß sie als „Beschützer“ willkommen zu sein hätten und als „Gastarbeiter“ wohlwollend geduldet werden müßten. Von soviel Funktionalismus in den intimsten Fragen der nationalen Identität blieb auf Dauer noch nicht einmal die Ideologie der nationalen Keimzelle verschont: Statt den Familienzwang einfach nur als Elementarform einer verpflichtenden Schicksalsgemeinschaft zu verhimmeln, deutete die bundesdeutsche demokratische Debattenlage ihn um in einen Exerzierplatz abstrakter Verfassungsprinzipien wie „Gleichberechtigung“; der Feminismus machte eine ungeahnte Karriere vom Protest gegen die Tyrannei des Ehevertrags zur allgemein akzeptierten Forderung nach freier Geschlechterkonkurrenz; Pille und Arbeitskräftebedarf taten ein Übriges an der gesellschaftlichen Basis – und am Ende hätte der Gesetzgeber um ein Haar der Abtreibung ihren Unrechtscharakter genommen.
Das alles wäre ja noch angegangen; einiges von diesem Geist hat sich ja auch in den ungeteilt erhaltenen Nachbarnationen durchgesetzt und das staatsbürgerliche Denken und nationale Empfinden dort zwar auch vor manche Probleme gestellt, aber nicht moralisch in Frage gestellt. Der bundesdeutsche Patriotismus dagegen hat, über alle funktionalistischen Modernisierungen und Verwässerungen hinaus, in seiner öffentlichen Selbstdarstellung eben ein solches Moment von moralischer Relativierung enthalten: die obligate Erinnerung an die Nazi-Vergangenheit – unter die der nationale Geist im Grunde schon längst einen Schlußstrich gezogen wissen will; denn so etwas hält er wirklich schwer aus. Immerhin gesteht die Nation da nicht bloß einen epochalen Flop ein, sondern legt immer von neuem und sogar durch den Mund ihrer höchsten Repräsentanten das Bekenntnis ab, einmal gründlich im Unrecht gewesen zu sein – eigentlich unmöglich für eine Nation, die doch Subjekt und letzter Zweck des Rechtszustands nach innen wie auch Urheber und Inhaber unveräußerlicher Rechte nach außen ist. Und eine harte Nuß für jeden Patriotismus: zugeben zu müssen, daß er sich einmal in der deutschen Geschichte nicht bloß vertan hat, sondern ein unsittlicher Mißgriff war.
Gewiß, der Nationalismus in der BRD ist daran nicht zugrunde gegangen. Es braucht ihn ja schon, damit überhaupt ein Nachfahre der Nazi-Generation deren Großtaten moralisch auf sich bezieht: Da muß der Mensch sich schon sehr als ziemliches Teilchen ins große Ganze der deutschen Nation und ihrer Geschichte eingeordnet haben und auf seine dadurch definierte „nationale Identität“ große Stücke halten. Nur wer mit seiner Zugehörigkeit zum nationalen Kollektiv namens „Volk“ untrennbar identisch sein und auch noch Ehre einlegen will, ist bereit, sich – statt es zu kritisieren! – für das zu schämen, was Deutschland unter Hitlers Führung angerichtet hat. Und umgekehrt: Wer so national solidarisch reagiert – statt zu begreifen, in was für ein furchtbares Kollektiv er sich da hineindefiniert, und sich gegen diese Sorte Gemeinschaftlichkeit zu stellen –, der findet auch unweigerlich einen Weg zurück von der Beschämung zum Stolz. Die „intellektuelle Debattenlage“ der BRD ist angefüllt mit Gesichtspunkten der Entschuldigung und der Rehabilitation; angefangen bei der elementaren Unterscheidung zwischen dem im Kern guten und gut gebliebenen Nationalgefühl und seinem verbrecherischen Mißbrauch durch Hitler bis hin zu dem nationalen Selbstbewußtsein, als Deutscher über die möglichen Abgründe des Nationalismus belehrt, gründlich bekehrt und fortan besser als andere dagegen gefeit zu sein. Letzteres wird natürlich nie so geradeheraus ausgesprochen, sondern lieber in der bescheidenen Form der Mahnung an die eigene Adresse, gerade als deutscher Patriot müsse man sich zurückhalten und immerdar der „Gefahren“ eines „unreflektierten“ Deutsch-Nationalismus eingedenk sein – dann, so die unausgesprochene, aber stets mitgedachte Fortsetzung, darf man natürlich, ja muß man sogar um so mehr seinem „problematischen“ Vaterland die Treue halten…
Genau diese sublimierte Art von patriotischem Stolz, dieser abgeklärte Nationalismus mit seinem arroganten Gestus, über jede „Deutschtümelei“ und jeden „blinden“ „-ismus“ erhaben zu sein, mit seiner berechnenden Berufung auf ein angeblich höher zu bewertendes demokratisches und Europa-Bewußtsein, mit seinen entschuldigenden Anführungszeichen: der ist nun freilich nicht jedermanns Sache. Und das wirklich nicht, weil diese Manier zu intellektuell wäre – auch wenn man den Intellektuellen schon nachsagen muß, daß sie ihren Patriotismus in der Regel dann am meisten genießen, wenn sie unter ihrer Nation, nämlich deren Grobheiten und Mißgriffen, leiden. Geradlinige Patrioten jedenfalls, egal ob intellektuell oder nicht, bemerken an der Geste der Entschuldigung unweigerlich das Schuldbekenntnis, am Umweg zum guten Gewissen das Eingeständnis eines schlechten, an der gelungensten Rechtfertigung die beleidigende Notwendigkeit, sich als Deutscher für seine Vaterlandsliebe zu rechtfertigen. Das mag sich aus dem Munde des als Bundespräsident amtierenden Adligen von Weizsäcker noch so angenehm anhören, der Nationalismus per Umweg noch so sehr den für manche Geschmäcker schönen Schein der Wohlabgewogenheit gewinnen – der Tonfall des offiziellen deutschen Nationalstolzes bleibt von moralischer Distanzierung und Relativierung überschattet; er kommt mehr allgemeinmenschlich daher als einfach nur deutsch.
Gegen diese Regel durfte man in der BRD in der Tat nicht verstoßen – auch darin haben die FAZ und ihr Kandidat mehr recht, als sie meinen: Der Standpunkt des distanzierten Nationalismus war nie durch so etwas wie stichhaltige Argumente (durch welche auch!) begründet, ist auch nie zur aus guten Gründen geteilten Überzeugung des „Normalbürgers“ geworden, stattdessen zur Gewohnheit. Er hatte stets die Qualität einer aus Autoritätsgründen akzeptierten Sprachregelung, die in allen offiziellen Zusammenhängen und fürs öffentliche Meinen und Meinungsbilden bindend war. Er ist die gepflegte Lebenslüge des spezifisch bundesdeutschen Nationalstolzes geworden.[3]
Heitmann – der personifizierte Wille zum nationalen Neubeginn mit gründlich verschobener nationaler „Debattenlage“
Die Heuchelei der bundesdeutschen „Vergangenheitsbewältigung“ ist penetrant; sie fordert Kritik geradezu heraus. Wenn schon Erinnerung an die grandiosen Mordaktionen der Nazis, dann könnte man sich daran ja auch klarmachen, daß Parteilichkeit für die Nation sich überhaupt verbietet und auch dann nicht in Ordnung geht, wenn ihr ein pflichtschuldigst entsetzter Blick auf die Opfer vorangeschickt wird – denn mehr als pflichtschuldigst geheuchelt kann dieser Blick gar nicht sein, wenn es anschließend doch gleich wieder um das Weitermachen und die Zukunft genau des „geschichtlichen Subjekts“ gehen soll, der deutschen Nation nämlich, über die man doch gerade in Erinnerung gerufen haben will, wozu so ein „Subjekt“ fähig ist.
Heitmann stört sich an der bundesdeutschen Heuchelei, ohne es offen so zu sagen; aber er ist der letzte, der darüber zum Kritiker würde und auf einen besseren Gedanken käme. Er ärgert sich daran unter seinem nationalistisch-affirmativen Gesichtspunkt: Er begehrt dagegen auf, daß der Nationalismus im neuen Deutschland diese verlogene Manier der Selbstreinigung noch immer nötig haben soll. Er beharrt auf dem Recht der Deutschen auf ein „normales“ Verhältnis zu ihrem Vaterland; und darunter versteht er eine Parteilichkeit, die keinen Gesichtspunkt anerkennt, unter dem sie unter Rechtfertigungszwang gesetzt werden könnte. Dabei verfällt Heitmann keineswegs in den Fehler der ganz Rechten, den Völkermord an den Juden verkleinern zu wollen oder abzuleugnen, um Deutschland wieder bedingungslos gut finden zu können. Ohne das Geringste von den Fakten und ihrer Scheußlichkeit abzustreichen, plädiert Heitmann gegen die demonstrative Fassungslosigkeit – anders als geheuchelt und „wie eine Monstranz“ dahergetragen kennt er sie sowieso nicht –, mit der die Bundesdeutschen sich ihr Bekenntnis zu ihrem Deutschtum meinen verdienen zu müssen; er plädiert gegen den gepflegten Schein – denn anders ist ihm diese moralische Denkfigur in seinem neuen Vaterland ohnehin nicht untergekommen –, die Deutschen würden sich für ihr heutiges Auftreten in der Weltpolitik an moralischen Folgerungen aus den einstigen Greueln orientieren. Damit will er weder dem „Vergessen“ Vorschub leisten noch einer neuen Judenfeindschaft. Heitmann kann einfach die alte Manier der bundesdeutschen Politmoral nicht leiden, weil er darin ein moralisches Alibi für ein im Grunde unmoralisches, nämlich distanziertes, pragmatisches, gar berechnendes Verhalten der bundesdeutschen Bürger zu ihrem Staat ausgemacht hat und die Grundlage für lauter Debatten, mit denen die deutsche Politik sich mehr behindert als voranbringt.
Nun gibt es zweifellos viele verdiente CDU/CSUler – und nicht nur solche –, die die moralische Lage der Nation genauso sehen und schon längst so zu korrigieren wünschen wie Heitmann. Der hat aber entscheidend mehr zu bieten als bloß die richtige Gesinnung. Für den Kanzler und die Union, die ihn als Präsidenten haben wollen, erfüllt er mit seiner Person den Tatbestand eines Arguments für die ideologische Botschaft, die er drauf hat; er ist ein leibhaftiger guter Grund dafür, daß die „intellektuelle Debattenlage“ der Nation im besagten Sinn korrigiert gehört. Denn er kommt aus Deutschlands frisch annektiertem Osten – erklärtermaßen seine wichtigste persönliche Qualifikation –, und diese Tatsache soll der Nation einiges sagen; zwar auf der allerabstraktesten methodischen Ebene, auf der es um politische und moralische Inhalte gar nicht mehr geht, aber durchaus im Hinblick auf die Maximen, die der Kandidat vertritt. Nämlich erstens: daß es mit der BRD im alten Sinn vorbei ist. Zweitens: daß es gerecht ist, wenn auch die Bundesdeutschen sich umstellen und von alten ideologischen Gewohnheiten ablassen; schließlich ist es den Zonis genauso gegangen. Drittens: daß man den neuen Tönen aus dem Osten jenseits aller Inhalte schon allein deswegen Respekt schuldet, weil sie nun einmal den Geist, genauer: das Beste von dem Geist repräsentieren, mit dem der alte bundesdeutsche nun einmal zum neuen gesamtdeutschen Geist zusammenwachsen muß. Viertens: daß also letztlich die von allen wohlmeinenden Deutschen ersehnte geistig-moralische Wiedervereinigung des Vaterlands eine Umorientierung der nationalen Ideen- und Tabu-Welt im Heitmannschen Sinn erfordert. Mit einem Wort: Der Kandidat verlangt nicht bloß den Schlußstrich unter ein tabubeladenes, moralisch relativiertes, pragmatisch-berechnendes Verhältnis zu einem halbierten, fremdbestimmten Deutschland; als Ostdeutscher im Bundespräsidentenamt ist er, was er verlangt, nämlich der leibhaftige Schlußstrich unter diese unselige Nachkriegsgeschichte.
Andersherum: Kein bundesdeutscher Reaktionär könnte eine so radikale Alternative zum Weizsäckerismus verkünden, ohne daß ein jeder schon längst wüßte, in welche exzentrische Schublade – noch jenseits von Philipp Jenninger… – der Typ gehört. Mit Heitmann wird eine völlig neue Schublade eröffnet, die Gattung des stur evangelisch-national denkenden Ost-Intellektuellen in die ideologische Szene der Republik eingeführt. Das Ziel ist, um seine Botschaften herum das gesamte politmoralische Schubladensystem der Nation mit seinen Unterscheidungen zwischen rechts und links, selbstverständlich und abseitig, normal und abweichend neu zu organisieren.
Was gegen Heitmann sprechen soll: „Versöhnen statt spalten“ – Mit dem Ideal der nationalen Gleichschaltung gegen das Ideal eines gleichgeschalteten Nationalismus
Diese „kulturrevolutionäre“ Absicht trifft auf Widerstände. Allerdings nicht auf Kritik in dem Sinn. Von einem ernsthaften sachlichen Einwand kann nämlich nicht die Rede sein, wenn Heitmanns Ansichten zur Diskussionskultur der Nation mit heftigem Stirnrunzeln unter die Rubrik „rechts“ und „nationalkonservativ“ eingeordnet werden – „national“ und „wertkonservativ“ will der Mann ja ausdrücklich sein, und vom Beifall aus dem rechten Lager distanziert er sich. Nicht genug, meinen seine Gegner – als wären seine Standpunkte andere, wenn er noch ausdrücklicher zu Protokoll gibt, die Zustimmung der radikalen Rechten dazu wäre ihm peinlich. Aber so will es eben der feinfühlige demokratische Geist der alten BRD: Ohne Polemik gegen die Rechtsradikalen keine Erlaubnis, deren Positionen zu vertreten.
Ein Chefkommentator der Süddeutschen Zeitung bringt die Heuchelei, die die bundesdeutsche Öffentlichkeit da gebieterisch einfordert, auf den Punkt – und bringt es fertig, sie gleichwohl selber zu vertreten:
„Umgekehrt fehlt es Heitmann offensichtlich an Erfahrung und Verständnis für die politischen Rituale Westdeutschlands… Wer klug ist, vermeidet Reizwörter und gefährliche Tabus oder macht zumindest einen verbalen Kotau vor deren Hohenpriestern.“
Mehr ist also nicht daran, selbst nach Meinung eines gelernten bundesdeutschen Meinungsmachers, wenn hierzulande um Dinge wie „das Ausländerthema“ oder „die Frauenfrage“ oder „die Nazi-Vergangenheit“ geziert-moralisch herumgeredet wird.
„Für einen ‚Ossi‘, der gerade ein als verlogen empfundenes System überlebt hat, mag es schwer sein, sich an etwas zu gewöhnen, was er als neue Verlogenheit und Heuchelei empfindet.“
Und wie empfindet ein erfahrener ‚Wessi‘?
„Die Unbefangenheit, mit der Heitmann ebenso über Ausländer … oder die Nation … redet, übersieht freilich, daß wir mit dem Begriff der Normalität noch ringen.“
Mit dem Begriff? Um ihre Normalität jedenfalls „ringen“ gelernte Demokraten offenbar am besten, indem sie ihre wirklichen An- und Absichten mit entschuldigenden Sprachregelungen kamouflieren. Das ist zwar verlogen –
„Aber so direkt in diesen Prozeß eingreifen, wie es Heitmann tut, steht vielleicht einem Kandidaten für die Weizsäcker-Nachfolge nicht an.“ (Dieter Schröder, SZ 21.9.93)
Vielleicht sogar ehrlich, aber genau deswegen auch so unsäglich unprofessionell…: Ob bei der Kritik wenigstens dem Meister der hierzulande geltenden „stark formalisierten Politiker-Sprache“ in der Villa Hammerschmidt die Ohren klingen?
Sachlich bleibt von den Einwänden gegen Heitmanns Positionen mehr gar nicht übrig als das alberne Verdikt, daß sich bei ihm vieles ganz anders anhört als gewohnt – nur folgerichtig, daß es als seriöser Einwand gegen den Mann gilt, er könne sich nicht gewandt ausdrücken und ließe es an Weltläufigkeit fehlen; und daß die CDU ihm eine Person zur Kontrolle seiner öffentlichen Einlassungen beigegeben hat, ist im Land der Profil-Designer und Image-Konstrukteure Anlaß zu unendlicher Belustigung.
Vergleichsweise viel Mühe gibt sich da noch der CDU-Mann Friedbert Pflüger, letzte Bastion des Weizsäcker-Tonfalls in der Unionsfraktion, mit seinem Nachweis, daß Heitmann gegen die Sprachregelungen verstößt, die der Kanzler höchstpersönlich in Sachen Europa, Vergangenheitsbewältigung, Frauen- und Ausländerpolitik bislang benutzt hat. Er kommt am Ende zu dem Schluß:
„… die Wahl des sächsischen Ministers zum Staatsoberhaupt richtete sich … gegen das politische Wertesystem von Adenauer über Brandt bis Kohl, von Heuss über Heinemann bis Weizsäcker.“
Nun ist auch das kein sehr glanzvoller Einwand gegen einen Mann, der es gerade als sein ideologisches Ziel definiert, die „Debattenlage“ der endlich abgeschlossenen Nachkriegszeit „aufzubrechen“ – und der im Übrigen von dem zitierten Kohl selbst, und wohl kaum in einem Anfall von Selbstvergessenheit, zum Kandidaten für die Präsidentschaft aufgebaut worden ist. Deswegen werden zusätzliche Gesichtspunkte aufgebracht, unter denen dieser Traditionsbruch doch unbestreitbar schlimm sein soll; das Auslandsecho z.B., das immer so negativ auf deutsch-nationale Töne reagiert – das allerdings, so die kongeniale Zurückweisung, nur deshalb so schlecht ausfällt, weil der Kandidat im eigenen Land und Lager so schlecht behandelt wird… Einen Trumpf haben Heitmanns Gegner, besonders die aus seiner eigenen Partei, aber doch. Stark fühlen sie sich mit folgendem Einwand:
Der Kandidat „integriert nicht, er polarisiert. Jede Äußerung eine Kontroverse. Wer Tabus aufbrechen will, … will Konfrontation.“
Und weshalb ist das schlimm?
„Das ist legitim. Aber nicht als Programm für eine Präsidentschaft. Ein Präsident aber soll – ohne zum politischen Neutrum zu verkommen – zusammenführen. Gerade in einer Zeit der Umbrüche, der unsichtbaren Mauern zwischen Ost und West und des Vertrauensverlustes der Bürger gegenüber den Parteien müssen sich im Präsidenten möglichst alle wiederfinden.“
Da halten sich Heitmanns Gegner für unschlagbar: wenn sie den Kandidaten auf der höheren Ebene der staatsdienlichen Funktion seiner Meinungen stellen können und ihn am funktionalen Ideal staatsdienlichen Denkens messen: der ideologischen Einheit der Nation, die keine Parteien kennt und der keine Partei sich entziehen kann. Denn dafür, daß Heitmann vor diesem Kriterium versagt, können sie selber sorgen, indem sie aufgeregt um ihn streiten. Sie haben dafür außerdem einen noch schlagenderen Beweis, der mit einem Argument endgültig nichts mehr zu tun hat, eben deswegen aber auch für den Kanzler und seine Fraktion Gewicht besitzt: die Mehrheitsverhältnisse in der Bundesversammlung, nachdem die FDP klargestellt hat, daß sie lieber mit einer eigenen Kandidatin taktiert:
„Eine emotionalisierte Kampfkandidatur wäre – selbst wenn es zum Schluß zu einer knappen Mehrheit reichen sollte – kein Erfolg für unser Land. Übrigens auch nicht für die Union. … Schon einmal, 1969, hat die Union mit der Aufstellung des falschen Kandidaten die FDP in das Bündnis mit den Sozialdemokraten getrieben.“ (Pflüger in: Die Zeit, 8.10.93)
Zweifellos ist es perfide, nun umgedreht aus dem schieren Faktum der Sitzverteilung im Wahlgremium ein Argument gegen den Wahlkandidaten und seine Qualifikation zu machen. Aber so zu denken, ist die zweite Natur gestandener, wahlkampferprobter Demokraten; und genau so funktioniert eben der „Kulturkampf“ um die „Herrschaft über die Diskurse“, den die FAZ sehr richtig diagnostiziert hat. So greifen also Pflüger und seine Mitstreiter mit dem Verweis auf die schlechten Wahlchancen Heitmanns und der Warnung vor koalitionspolitischen Konsequenzen dessen Eignung an, ihrem Ideal vom Präsidenten als unbestrittenem nationalem Meinungsführer zu entsprechen.[4] Dagegen können die Protagonisten Heitmanns zwar wieder auf die Herkunft ihres Mannes verweisen und behaupten, mit der Nicht-Wahl des Sachsen würde die heimliche Spaltung der Nation verewigt, weil der östliche Volksteil schon wieder einmal von höchsten politischen Ämtern ausgeschlossen – und dagegen können wiederum die anderen Meinungsumfragen aus dem Osten zitieren, wonach die Ostbürger selbst gar nicht so scharf auf einen der Ihren als Präsidenten sind …; doch sie wissen selbst am besten, daß dieses wunderbare Argument von der Spaltung, die nur durch einen zu überwinden sei, den dessen Gegner für einen Spalter halten, nur stichhaltig wäre, wenn sie sich der Wahl ihres Mannes sicher sein könnten. Unter demselben Mangel leidet ja auch auf der anderen Seite der Kandidat der oppositionellen Konkurrenzpartei, Landesvater Johannes Rau als Inkarnation des Gleichschaltungsideals „Versöhnen statt spalten!“: Die SPD verfügt erst recht nicht über die Mehrheit, die nötig wäre, um zu beweisen, daß ihr Mann die Fähigkeit zur nationalen Versöhnung mitbringt. Angesichts dieser Mehrheitsverhältnisse kann es gar nicht ausbleiben, daß der Ruf nach einem parteiübergreifenden Einheitskandidaten an Gewicht gewinnt – so daß sich wiederum dem Kandidaten Heitmann die Gelegenheit bietet zu zeigen, was er mittlerweile an demokratischer Perfidie gelernt hat: Er wirft seinen innerparteilichen Gegnern ein „merkwürdiges Demokratieverständnis“ vor; „er persönlich fühle sich eher ‚peinlich berührt‘, wenn es für ein wichtiges Staatsamt nur einen Kandidaten gebe.“ (SZ 8.11.93) Übermäßig wuchtig ist diese Replik freilich auch wieder nicht: Schließlich ist die gesamte Werbung für ihn ja ihrerseits auf der Beschwörung des nationalen Grundbedürfnisses „Ein Volk – ein Staat – ein Präsident“ aufgebaut…
So ist Heitmann vielleicht schon bald die längste Zeit CDU/CSU-Kandidat gewesen. Die Kontroverse um ihn hat aber immerhin klargestellt, um welche Alternative in der offiziellen Repräsentation der nationalen politischen Moral es im heutigen Deutschland geht. Das Angebot der ersten Wahl ist ein Ostdeutscher, der an der nationalen Einheit das Nationale betont; der als Ostbürger für ein Deutschtum ohne störende Adjektive als neuen nationalen Grundkonsens einsteht, in den aller Meinungspluralismus einzumünden hat; und der damit die Botschaft vermittelt, daß das vergrößerte Deutschland auch ideologisch durchaus nicht mehr das alte ist. Dagegen steht der alte „liberale Grundkonsens“ mit seiner supranationalen Attitüde; allerdings gar nicht im Sinne einer Gegenposition gegen Heitmanns Glauben an die Nation als Schicksal, sondern allein mit dem Recht der bislang unbestrittenen nationalen Einheitslinie und mit der verlogenen Botschaft – nicht zuletzt ans Ausland –, in und mit dem neuen größeren Deutschland ginge im Grunde alles genauso weiter, wie man es bislang von der BRD gewohnt war. Überzeugender als durch Heitmann soll damit allein das funktionalistische Präsidentschaftsideal eingelöst sein, wonach die Staatsspitze – letztlich egal wie – ein unstrittiges Bild von der Moral der Deutschen abzugeben hat. Dagegen wiederum hat Heitmanns „Kampfkandidatur“ bereits erreicht, daß ein unbestrittener moralischer Konsens im alten Sinn nicht mehr besteht, eine parteiübergreifende ideologische Einheit jedenfalls ohne respektvolle Berücksichtigung seiner Alternative, des Nationalismus ohne entschuldigende Gesten und pragmatische Aufweichungen, nicht mehr zu haben ist. Die moralisch verbürgte Kontinuität zwischen ehemaliger BRD und neuem Deutschland ist insoweit bereits dementiert, auch wenn Heitmann nun doch den Mehrheiten in der Bundesversammlung geopfert wird und ein altbundesdeutscher Mehrheitskandidat das gute Gewissen repräsentieren darf, mit dem die deutsche Nation in ihre nächste Zukunft marschiert.
Der politische Sinn des „Kulturkampfs“ um Heitmann: Durchaus auch „ein Stück Machtwechsel“
Ob Heitmann oder ein anderer besser wäre: aus der Frage sollte man sich in jeder Hinsicht heraushalten. Von einem gewissen sachlichen Interesse ist hingegen der andere Punkt: was die christlichen Regierungsparteien mit der Kandidatur dieses Mannes bezweckt haben.
Denn eins ist ja klar: So wie notorische Kulturkämpfer vom Schlage der FAZ-Redaktion bei allen Entscheidungen über das Personal der Macht an die kulturbildenden Vorurteile denken, die sie verwalten, so haben Politiker vom Schlage Kohls bei Entscheidungen über die Repräsentation der nationalen Moral und Politkultur die Macht im Auge, die sie in und über Deutschland haben und die sie aus ihrer Republik machen wollen. Und das bedeutet in diesem Fall: So wie die Agenten des feuilletonistischen Überbaus der Nation die Gleichung aufmachen, daß, wenn mehr großdeutsch regiert wird, dann auch mehr schwarz-rot-golden gemeint werden muß[5], so kennen und praktizieren die Funktionäre des nationalen Schicksals die umgekehrte Gleichung: Wenn ihr Volk wirksamer auf eindeutig schwarz-rot-goldene Überzeugungen eingeschworen wird, dann regiert es sich auch anders.
Bei allen ihren Regierungsentscheidungen stehen sie ja vor allerlei Alternativen – selten grundsätzlichen; aber fürs Regierungsgeschäft in der Demokratie, mit einem profilierungssüchtigen Koalitionspartner an der Seite und einer Opposition im Rücken, sind sie allemal wichtig genug. Mit ihren Entscheidungen schließen die Machthaber alle anderen, von irgendwelchen Konkurrenten vertretenen Optionen aus und setzen ihre Linie durch. Dafür ist es schon hinderlich genug, wenn sie sich fortwährend mit Kriterien für eine anständige deutsche Politik auseinandersetzen müssen, die z.B. eine etwas andere Lastenverteilung beim nationalen „Sparprogramm“ und andere Akzente beim „Umbau des Sozialstaats“, eine weniger rigorose ethnische Säuberung Deutschlands von Asylbewerbern, bescheidenere oder auch offensivere Einsatzpläne für die Bundeswehr usw. als auch moralisch vertretbar erscheinen lassen. Ertönt womöglich aus der Villa Hammerschmidt eine moralische Dienstanweisung, die die politischen Gegner der Regierung für ihre Alternativvorstellungen in Anspruch nehmen können – Krieg nur unterm Blauhelm, Lauschangriff nur nach richterlicher Genehmigung usw. –, dann sieht sich eine demokratische Staatsführung geradezu in ihrer Entscheidungsfreiheit behindert. Umgekehrt führt eine parlamentarische Opposition sich vorsichtiger auf, das Regieren im Sinne der beschlossenen Linie wird leichter, und es wird dann nicht bloß lockerer, sondern auch ein wenig anders, härter im Sinne der letztlich verfolgten Leitlinie regiert, wenn gewisse Einwände von vornherein moralisch ins Unrecht gesetzt, bestimmte Alternativen als nicht beachtlich oder abseitig ausgeschlossen sind. Ohne stereotype Erinnerung an den verlogenen Pazifismus der alten BRD und dessen Herkunft aus der Schmach des untergegangenen 3. Reiches, stattdessen mit der Moral weltweiter Verpflichtungen als konkurrenzlosem Kriterium einer anständigen deutschen Weltpolitik, kann es zum Beispiel mit der Umrüstung der Bundeswehr, ihrer Heranführung an Interventionsaufgaben und der Gewöhnung des Volkes an neue Kriegsopfer leichter vorangehen. Das immerwährende Feilschen um Nutzen und Lasten „Europas“ wird härter, zieht gewisse Zugeständnisse erst gar nicht in Betracht und operiert mit neuen Forderungen, wenn nicht mehr ein überkommener Europa-Idealismus den nationalen Blick für die verfügbaren Optionen trübt, sondern eine pauschale Mißtrauenserklärung an „Brüssel“ im Namen einer Volksstimmung, die erst noch „wachsen“ müsse, ihn schärft. Arbeitslose werden der Regierung in Wahlkämpfen je nach dem zur Last gelegt, werden ihr also auch je nach dem zur Last, ob sie in erster Linie unter dem Ideal der sozialen Gerechtigkeit als Skandal oder unter dem Blickwinkel des nationalen Standorts als notwendige Opfer gelten, und lassen sich je nach dem auch anders anfassen. Und so weiter. Insofern ist die Übereinstimmung der öffentlichen Moral mit den nationalen Vorhaben der Regierung – auf der die militanten Zeitgeister aus Gründen der bloßen Rechthaberei bestehen – für regierende Demokraten ein Machtmittel.
Als solches haben sich Kohl und die C-Parteien ihren Heitmann gedacht und eingeplant. Für die beschlossene „Runderneuerung“ Deutschlands und für ihre neue „weltweite Verantwortung“ brauchen und wollen sie eine öffentliche Meinung, die das Recht auf eine distanzierte Stellung zur Nation moralisch bestreitet, die umgekehrt den einzigen Lohn des Patriotismus, den „Stolz, ein Deutscher zu sein“, nicht länger den Rechtsabweichlern überläßt. Die Regierung braucht und will hartgesottene, bedingungslos parteiliche Nationalisten, weil sie weiß, daß das Deutschland, an dem sie arbeitet, nur für solche Moralisten akzeptabel ist und nicht für die andern, die sich nicht von der Gewohnheit lösen können, Deutschland nur im Namen supranationaler Werte und Ideale gut zu finden – und darauf, gut gefunden zu werden, hat dieses neue Deutschland nicht bloß ein allerhöchstes Recht; es gelingt der Regierung auch um so besser, je weniger moralischen Rückhalt andere Vorstellungen von Deutschlands schöner neuer Welt haben.
Ein Machtmittel der neuen deutschen Staatsräson wird der Mann natürlich nur, wenn er gewählt wird. Eben weil es um ein Stück Macht in Deutschland und sonst nichts geht, kommt es für die regierenden Christen zuerst darauf an, daß sie gewinnen; mit wem, in der Frage sind sie notgedrungen flexibel. Wenn also einmal klar ist, daß für Heitmann die Mehrheit nicht reicht, wird sie ganz von selbst immer kleiner. Und der Kandidat bekommt Gelegenheit zu einem „ehrenvollen“ Abgang, mit dem er die „menschliche Größe“ beweisen kann, das Kalkül seiner Partei nicht länger zu behindern.
[1] Es dürfte unschwer herauszuhören sein, daß wir diese Debatte mitsamt beiden Positionen für albern halten. Die Alternative ist aber auch bezeichnend: Daß der Nationalismus, wie man ihn kennt und in seinen zivilisierten Formen schätzt, allemal für Krieg und „ethnische Säuberungen“ gut ist und daß diese staatsbürgerliche Tugend im Judenmord der Deutschen einen grausigen Höhepunkt erreicht hat, will keine der beiden streitenden Parteien wahrhaben: Die einen verharmlosen den nazi-deutschen Nationalismus im Namen seiner Allgemeinheit, die andern verharmlosen den Nationalismus überhaupt, indem sie den nazi-deutschen für etwas ganz anderes halten.
[2] Selbstverständlich ohne daß das rückwirkend irgendein günstiges Licht auf die DDR mit ihrem Geburtenüberschuß wirft. Es geht ja nur darum, ganz grundsätzlich den Standpunkt der Berechnung und Planung beim Kinderkriegen zu verurteilen – auch und gerade dann, wenn diese Kalkulationen unter soviel materiellem Druck angestellt werden wie derzeit in Deutschlands neuer Ostzone und nicht nur dort. So dezidiert hat sich Heitmann übrigens nicht in der SZ geäußert; er ist sich darüber in Sat 1 mit dem Ex-BR-Journalisten Mertes und einem gleichlautenden Zitat seines Präsidentschafts-Konkurrenten Jens Reich von der „alternativen“ Truppe einig geworden. Die Adenauer-Stiftung seiner Partei hat der Kandidat mittlerweile mit der weitergehenden Erkenntnis überrascht, daß die Frau den Embryo 9 Monate in sich trägt und schließlich zur Welt bringt. Deswegen, so die Folgerung, habe sie von Natur eine Einstellung zum Kind und seiner Erziehung, die der Mann erst lernen muß und doch nie hinkriegt – bei ihm bleibe es letztlich bei einer Art „Adoptionsverhältnis“ zu „diesem kleinen Bündel“. Was also beim Mann ein Willensverhältnis ist, und zwar ein unerreichbarer Idealfall von Hingabe, das – so hätte Heitmann es gern – kommt bei der Frau buchstäblich aus dem Bauch; was beim Mann moralische Pflicht, ist beim Weib Natur. Und das degradiert die Frau nicht etwa zum Muttertier, das macht vielmehr ihren Adel aus. Etwas Schöneres können Moralisten sich eben gar nicht denken, als daß ein bürgerlicher Zwang, den sie schätzen, den Betroffenen im Blut liegt. Mit diesem Ideal ersparen sie sich gleich auch noch die Mühe eines Arguments: Wen 9 Monate Schwangerschaft nicht rühren, der ist einfach ein schlechter Mensch.
[3] Kein geringerer als der vorletzte Bundestagspräsident Philipp Jenninger hat das vor nunmehr fünf Jahren zu spüren bekommen: Mit seiner abweichenden Gedenkansprache zum 50. Jahrestag der „Reichspogromnacht“ hat er sich um sein Amt geredet. Dabei hat er bloß gemeint, das 3. Reich sei eine zu großen Teilen normal funktionierende Nation gewesen und der patriotische Opportunismus der ehemaligen Volksgenossen auch nicht viel anders beschaffen als der der heutigen. In der Sache hat ihm auch gar niemand ernsthaft widersprochen – er hätte aber merken müssen, daß es darum gar nicht ging, sondern um die Inszenierung des großen „Nie wieder!“, ohne das dem neuen deutschen Nationalismus nun einmal das unerläßliche moralische Gütesiegel fehlt. Er hätte, notfalls wider besseres Wissen, den moralischen Abgrund beschwören müssen, der das Hitlerreich angeblich von jeder normalen Staatlichkeit trennt; damit hätte er den ideologischen Preis gezahlt, das schwarz-rot-goldene Gemüt mit einer unauslöschlichen Schuld zu belasten, um eben damit einmal mehr seine Läuterung zu demonstrieren. Das hat er vor seinem eigens hierzu versammelten Bundestag verpatzt; als dessen Präsident war er damit untragbar geworden.
[4] Beinahe im Klartext
führt ein Kommentar der Bild am Sonntag die gesamte
Schlußfolgerung von den fehlenden Wahlstimmen auf die
Zwietracht stiftenden und daher falschen Ansichten
Heitmanns vor: Der Kandidat für das Amt des
Bundespräsidenten ist so gut wie gescheitert. …für ihn
und seine umstrittenen Ansichten gibt es in Deutschland
keine Mehrheit. Selbst aus der CDU müßte Heitmann in
der Bundesversammlung mit mindestens 50 Gegenstimmen
rechnen.
Also: keine Mehrheit in der
Bundesversammlung – keine Mehrheit in der Nation –
keine Einheitsmeinung, wie sie erforderlich wäre:
„Heitmann ist gescheitert, weil seine Ansichten dem
liberalen Grundkonsens in der Bundesrepublik
widersprechen. Es war ein schwerer Fehler, in einer
Zeit, in der das Volk ohnehin zerrissen ist,
ausgerechnet für das Amt des Bundespräsidenten einen
Kandidaten zu präsentieren, der von weiten Teilen der
Gesellschaft als Kampfansage verstanden werden
muß.“ (Michael Spreng in
BamS, 10.10.93)
[5] Der eingangs zitiert
Eckhard Fuhr hält eine meinungsbeherrschende Figur vom
Schlage Heitmanns ganz einfach für fällig, weil die
alten Ideologien sich an der neuen Zeit blamieren:
Seit der Wiedervereinigung bröckelt die
linksliberale Hegemonie in der
politisch-intellektuellen Öffentlichkeit. Linke und
Liberale merken das, auch wenn sie fälschlicherweise
die altbekannte ‚Rechte‘ auf dem Vormarsch sehen. Ihre
Begrifflichkeit ist stumpf für das, was geschieht… Das
Verhältnis zur nationalen Einheit war die erste große
Bruchlinie. Es folgte der Golfkrieg, der Pazifisten und
Bellizisten schied. Eng damit zusammen hing die
schmerzhafte Erkenntnis, daß die Besinnung auf die
NS-Vergangenheit keine verbindlichen politischen
Maßstäbe für Gegenwart und Zukunft erbringt. Das
grassierende Übel jugendlicher Gewalt schließlich ließ
auch den Glauben an die emanzipatorische Pädagogik
schal werden. Die bedeutenden Intellektuellen des
Landes bedienen längst nicht mehr den linksliberalen
Mainstream… Enzensberger … Strauß … Walser … Eine
Kandidatur Heitmanns, gar seine Wahl zum
Bundespräsidenten, wäre ein Zeichen dafür, daß die
kulturelle Veränderung in Deutschland nicht nur auch
die politische Klasse erreicht hat, sondern im höchsten
Staatsamt Ausdruck findet.
Ganz so
geschichtsdeterministisch, daß das neue nationale Sein
sich unwiderstehlich sein affirmatives Bewußtsein
schafft, geht es zwar nicht zu, noch nicht einmal im
gesamtbundesdeutschen Geistesleben. Den
Opportunismus der hierzulande öffentlich
predigenden Moralisten schätzt der Intellektuelle von
der FAZ aber durchaus richtig ein. Wenn die Nation
wieder frei ist von der Not der Beschränkung, aus der
die deutschen Kanzler die Tugend der berechnenden
Einordnung in supranationale Bündnissysteme gemacht
haben, dann bildet sich schon der „Mainstream“, der das
Nationale auch wieder zur höchsten Idee befördert. Wenn
endlich wieder der zweckmäßige Gebrauch des Militärs
angesagt wird, dann ist es der öffentlichen Meinung ein
Ehre, Gesichtspunkte für einen gerechten Krieg
beizusteuern. Wenn der Zweite Weltkrieg von den
Deutschen im Nachhinein gewonnen wird, dann werden auch
die moralischen Lehren aus der ehemaligen Niederlage
neu gezogen. Wenn die Sitten in der Gesellschaft rauher
werden, dann bekommt die Pädagogik des gewaltsamen
Draufhauens Auftrieb. Und für den nationalen
Autoritätsglauben stehen allemal Vorbilder bereit, auf
die er sich berufen kann. In dem Sinn ist Heitmann ein
Gebot der politischen Verhältnisse, die seine
Partei federführend herbeiregiert hat.