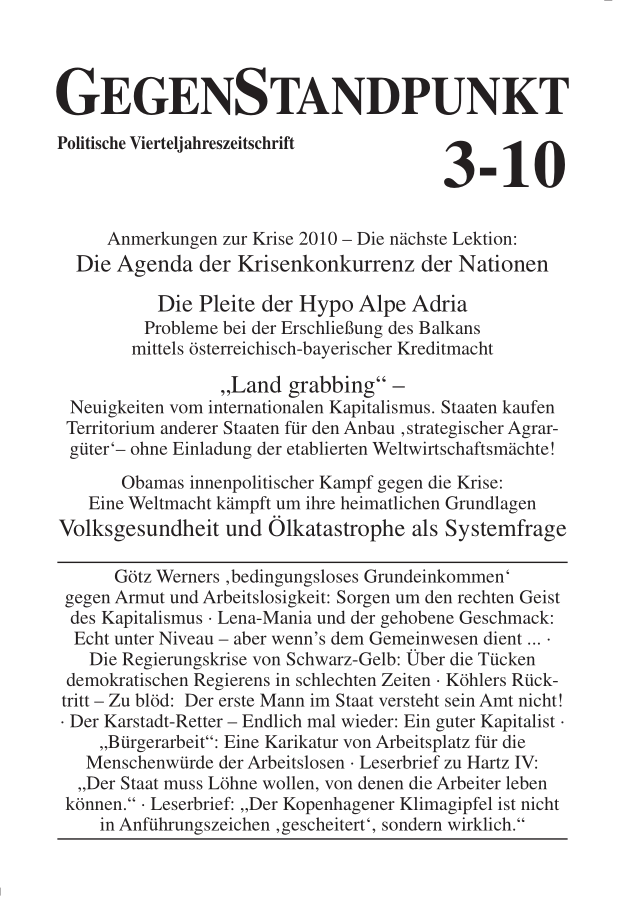Aus der Reihe „Chronik - kein Kommentar!“
Die Regierungskrise von Schwarz-Gelb:
Über die Tücken demokratischen Regierens in schlechten Zeiten
Das politisierte Deutschland ist unzufrieden. Die Nation steckt mitten in der Krise, steht vor großen ‚Herausforderungen‘, wie man so sagt – und die Regierung, die doch eine stabile Mehrheit hat? Sie regiert nicht, oder zumindest miserabel, meinen durch die Bank die öffentlichen Anwälte Deutschlands. Die schwarz-gelbe Koalition, angetreten als „Wunschbündnis“, „zerfällt“ (alle Zitate sind den einschlägigen Medien wie SZ, FAZ, Spiegel, ARD usw. im Zeitraum Mai bis Juli 2010 entnommen), die Wochen im Mai und Juni würden als „Chronik des Versagens“ in die deutsche Geschichte eingehen, das erste Nachrichtenmagazin der Republik seufzt nach guter Führung und ruft gequält: „Aufhören!“
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Die Regierungskrise von Schwarz-Gelb:
Über die Tücken demokratischen Regierens in schlechten
Zeiten
Das politisierte Deutschland ist unzufrieden. Die Nation
steckt mitten in der Krise, steht vor großen
‚Herausforderungen‘, wie man so sagt – und die Regierung,
die doch eine stabile Mehrheit hat? Sie regiert nicht,
oder zumindest miserabel, meinen durch die Bank die
öffentlichen Anwälte Deutschlands. Die schwarz-gelbe
Koalition, angetreten als Wunschbündnis
,
zerfällt
(alle Zitate sind
den einschlägigen Medien wie SZ, FAZ, Spiegel, ARD usw.
im Zeitraum Mai bis Juli 2010 entnommen), die
Wochen im Mai und Juni würden als Chronik des
Versagens
in die deutsche Geschichte eingehen, das
erste Nachrichtenmagazin der Republik seufzt nach guter
Führung und ruft gequält: Aufhören!
Um eine Diagnose, warum da den regierenden
Ministern und ihrer Chefin im Jahre 2010 so gar nichts
mehr gelingen will, sind die aufgebrachten Zeitgenossen
nicht verlegen: Das Regierungspersonal versagt, weil es
unfähig ist. Die Regierung kann es
einfach nicht!, lautet der ebenso einfältige wie vielfach
vorgetragene Vorwurf, ob es nun um Steuerfragen, die
Defizite bei den Krankenkassen, um die
Laufzeitverlängerung von Atomkraftwerken oder die Frage
der Zukunft der Bundeswehr geht.
Diese demokratische Ungehörigkeit gegenüber dem höheren
Führungspersonal ist in einer Hinsicht die sehr
angemessene Quittung für dessen Angewohnheit, sich als
zum Erfolg veranlagte Herrscherfiguren zu präsentieren.
Dementsprechend treten die Damen und Herren vom
nationalen Lenkungsausschuss mit dem Gestus vor ihr Volk,
dass sie im Prinzip alles und alle im Griff
haben – die Sachthemen der Nation und ihre inner- und
außerparteilichen Konkurrenten. Schließlich haben sie den
ersten und wichtigsten Test auf ihre Führungsfähigkeit
schon bestanden: Sie haben sich in der demokratischen
Konkurrenz durchgesetzt und sich als Sieger von Wahlen
die Kompetenz zur Macht erworben. Sie sind für
alles und alle zuständig, und das ist in der
Demokratie das Fundament für die Lebenslüge
politischer Führerfiguren: Mit ihrer Zuständigkeit
verfügten sie auch über die nötige
Sachkompetenz, ihre Politik sozusagen
unausweichlich zum Erfolg zu führen: Tag für Tag
präsentieren Merkel, Westerwelle und Co. ihre politischen
Re- und Konzepte
und inszenieren sich ihrem
Publikum als unwiderstehliche Erfolgstypen.
Wenn der nationale Erfolg ausbleibt oder unsicher wird, dann hapert es allerdings oft mit der glaubwürdigen Inszenierung des „Machers“: Die Rezepte gehen nicht auf, innerparteiliche Kritiker melden sich penetrant mit Alternativen zu Wort, der regierungsinterne Streit findet kein Ende – und mit der dergestalt angegriffenen Erfolgstüchtigkeit wird auch die Sachkompetenz der handelnden Personen fraglich. Die Öffentlichkeit liest die bornierte Gleichung von Erfolg und politischer Kompetenz des Regierenden mit umgekehrtem Vorzeichen und fordert bessere Anführer, die die Nation aus der Krise führen.
Der Sache der Politik wird diese schöne
demokratische Kultur, in der die staatliche Politik als
Erfolgsfrage des Führungspersonals von oben inszeniert
und von unten kritisch beurteilt wird, nicht ganz
gerecht. Die politischen Erfolgsbedingungen der
Nation richten sich dann doch nach etwas anderen
Gesichtspunkten als denen, ob der richtige Minister mit
dem passenden Konzept
gut dasteht. Steuerpolitik,
die Wachstumsbranche ‚Gesundheit‘ oder nationale
Energiefragen halten für die demokratische Politik so
manche objektive Tücke bereit, vor allem dann,
wenn sich die Widersprüche und Interessengegensätze des
nationalen Kapitalismus gerade etwas zuspitzen.
1.
Die Regierung liegt im
Steuerstreit, im Frühsommer
2010 nicht nur mit den besser verdienenden
Steuerflüchtlingen, sondern in der Hauptsache mit sich
selbst. Trotz wegbrechender Steuereinnahmen und
sich anbahnender Rekordverschuldung beharren der
Wahlsieger Westerwelle und seine FDP auf der Einlösung
ihres zentralen Wahlversprechens, die Bürger um 16
Mrd. € zu entlasten.
Steuersenkung, in gewöhnlichen
Zeiten ein schönes Angebot der Regierenden an die Geld
verdienende Mittelschicht
, mit dem Politiker ein
durchaus respektables wirtschaftspolitisches Instrument
handhaben – wenn die politische Kalkulation mit
ihm aufgeht: Wenn in der Nation dann tatsächlich soviel
mehr verdient wird, dass der Fiskus bei gesenktem
Steuersatz seine Verluste kompensiert; und wenn die
Wirtschaft am Ende gar um soviel mehr wächst, dass die
Staatskasse insgesamt sogar mehr einnimmt, dann
empfängt die Einlösung eines zunächst kritisch beäugten,
des Populismus verdächtigten Wahlversprechens die höhere
Weihe der steuerpolitischen Kompetenz des
Politikers, der es gemacht hat.
Gekommen ist es im Frühjahr 2010 anders: Westerwelle, der
große Steuerexperte, steckt mit seinem „Rezept“ in einem
objektiven Dilemma der deutschen Staatsfinanzen:
Seine Koalition will unter dem Eindruck von Euro- und
Staatsschuldenkrise nämlich auch raus aus dem
Schuldenstaat
, also die gerade beschlossene
Rekord-Neuverschuldung um ein Signal der
Sanierung der Staatsfinanzen ergänzen. Deshalb
haben Kanzlerin und Finanzminister dem Außenminister
machtvoll widersprochen – Steuersenkungen seien
angesichts der Haushaltslage
unfinanzierbar –, so dass sich die
Steuersenkungspartei FDP am Ende nur mit der absurden
Schwundstufe Senkung des vollen MwSt.-Satzes für
Hotelübernachtungen
im Umfang von 1 Mrd. schmücken
kann. Nicht gerade ein Ergebnis, mit dem sich ein
Politiker glaubwürdig als Gestalter des
Wirtschaftserfolgs einer potenten Nation wie Deutschland
inszeniert, schon gleich nicht, wenn später die eigene
Partei der öffentlichen Kritik recht gibt und den Rückzug
antritt: Mit dem politischen Misserfolg ist
endgültig bewiesen, dass Westerwelle und Lindner nicht
Wirtschaftskompetenz
praktizieren, sondern bloße
Klientelpolitik
, also die Kumpanei der Politik mit
Sonderinteressen betreiben.
Die steile Karriere Westerwelles vom
Steuerexperten, der in der Koalition die Linie
vorgibt, zum bloßen Ideologen, der sich
finanzpolitischen Realitäten verweigert
, ist insofern
einerseits ein kleines Lehrstück über die Kompetenz von
Politikern: Die hängt offenbar ganz an der glaubwürdigen
Inszenierung von Erfolgstüchtigkeit, und deren erstes
Gebot ist die Durchsetzung in der Konkurrenz um die
Definitionshoheit über den Gebrauch der staatlichen
Macht. Interessanter ist andererseits an diesem Fall,
dass sich in Sachen „Steuerpolitik“ in der gesamten
Regierung niemand so richtig als Erfolgsfigur in
Szene zu setzen weiß: Immerhin haben Kanzlerin und
Finanzminister dem lächerlichen Koalitionsbeschluss, mit
einer Förderung des Hotelgewerbes irgendwie das Wachstum
am Standort D wieder anzukurbeln, zugestimmt. Der
umgekehrte Weg zur Sanierung des Haushalts, die
Einnahmeseite zu verbessern, wird in der
Regierung ja genauso ausgeschlossen:
Steuererhöhungen gehen schon gleich nicht, wenn
am Standort schon zu wenig verdient wird, denn damit
würde gewiss jedes erwartbare Wachstum a priori kaputt
gemacht.
Offenbar misslingt in dieser finanzpolitischen Lage die
Profilierung mit Steuerkonzepten
nicht deshalb,
weil es den Regierenden an Tatkraft
u.Ä. gebricht,
sondern weil sie mit ihrem Streit auf ein objektives
Dilemma ihrer politischen Lage stoßen: Sie
misstrauen den beiden Optionen ihrer Macht, die
Staatskasse zu sanieren, weil die privatwirtschaftliche
Grundlage, von der die staatliche Gewalt lebt, momentan
zu wenig Wachstum dafür hergibt.
2.
Im Gesundheitsressort ist der
Arzt und Politiker Rösler mit einem gewissen Aplomb
angetreten und hat sein politisches Schicksal mit der
Durchsetzung einer grundlegenden Strukturreform
des Gesundheitswesens verknüpft – der
Systemwechsel
müsse her, um den Dauerpatienten
Gesundheitswesen finanziell langfristig zu
stabilisieren.
Die großartige Idee der FDP und ihres
Ministers heißt Kopfpauschale.
Jeder Bürger zahlt
gleich viel für seine Gesundheit!, lautet der
gesundheitspolitische Anfall von Egalitarismus, mit dem
die Wurzel des Übels gepackt ist: das System
der
einkommensorientierten Beiträge, mit dem der Staat zu
viel Rücksicht auf unterschiedliche Einkommen nimmt, eine
ungerechte Umverteilung zwischen Sekretärin und Direktor
organisiert und sich mit den kleinen Beiträgen der
Niedrigverdiener die chronischen Defizite im System
schafft. Alles andere im System kann bleiben,
aber das muss sich ändern. Die Arbeitgeber
überweisen ihren bisherigen Anteil den Arbeitnehmern,
dann geht sie die Gesundheit ihrer Belegschaft nichts
mehr an, die Gesundheitskosten sind endlich von den
Arbeitskosten entkoppelt
– und fertig ist die
Laube!
Gekommen ist es auch hier etwas anders. Schon die
schlichte Berechnung eines derartigen Pro-Kopf-Beitrags –
die Gesamtheit der Umsätze in der Gesundheitsbranche
geteilt durch die Gesamtzahl der Kassenmitglieder –
ergibt einen Betrag, der einen großen Teil der Einkommen
der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten
auffrisst. So müssen auch Rösler und seine FDP einräumen,
dass zur Herstellung eines bezahlbaren Beitragsniveaus
ein steuerfinanzierter Sozialausgleich
notwendig
ist. Dieser wiederum, so rechnet ihm dann der
Finanzminister vor, würde soviel kosten, dass zu seiner
Finanzierung der Einkommenssteuersatz auf 70 % steigen
müsste. Der Gesundheitsminister bringt also die
große
auf eine kleine Kopfpauschale
herunter: Nun geht es nur noch um die pauschalierte
Erhöhung der Zusatzbeiträge
, welche die Kassen
erheben dürfen, doch auch diese 30 € pro Kopf und Monat
sind für ansehnliche Teile der Beitragszahler bereits
zuviel, so dass Rösler auch da einen
Sozialausgleich
einbaut. Das lehnt nun die CSU
endgültig ab: Soviel Bürokratie! Für sowenig
Effekt!! – so dass sich am Ende der große Reformwille und
die Sachkompetenz
des Ministers in eine
stinknormale Beitragserhöhung um knapp ein Prozent und
eine Entschränkung der Zusatzbeiträge, die allein die
Kassenmitglieder zu tragen haben, auflösen. Der
Öffentlichkeit ist klar, dass die Hoffnung auf einen
Befreiungsschlag
im Gesundheitswesen entweder am
zu großen Ehrgeiz eines reformfreudigen,
jungen Ministers
oder an reformunfähigen,
risikoscheuen Politikern
oder an zu wenig Mut
gegenüber den mächtigen Lobby-Interessen zuschanden
geworden ist, weshalb anstelle einer
Strukturreform
mal wieder nur der
Beitragszahler zur Kasse gebeten wird.
Und
das müsste jedenfalls nicht sein, wenn nur mal
gescheit regiert werden würde, lautet kurz gefasst die
öffentliche konstruktive Kritik, die sich nicht darum
kümmert, dass sich in der chronischen Unbezahlbarkeit von
Gesundheit der Aberwitz ausdrückt, dass der Gebrauchswert
‚Gesundheit‘ erfolgreich machtvollen Geldinteressen
unterworfen ist.
Rösler, Söder, Seehofer und Co führen nämlich ein
sozialpolitisches Experiment fort, das deutsche
Regierungen seit gut einem halben Jahrhundert
unverdrossen betreiben: Die deutsche Politik ringt ihrer
Gesellschaft, die auf Geldvermehrung und sonst nichts aus
ist, nicht weniger als den staatlich gewollten Nutzen
einer flächendeckenden, (noch) jedermann zugänglichen
Volksgesundheit ab, die sich im Prinzip am Stand der
Technik und Wissenschaft orientiert. Dafür brauchte es
schon immer ganz viel bürokratische Gewalt des Staates,
weil sehr unversöhnliche Interessen konstruktiv
im Sinne dieser einen großen sozialstaatlichen Leistung
aufeinander bezogen werden müssen. Auf der einen Seite
stehen nämlich – so hat es die Politik gewollt und
verfügt – als Anbieter und Lieferanten von
Gesundheitsleistungen nur privatwirtschaftliche
Interessen, die ganz schlicht auf die Behandlung von
Krankheit als Quelle der Mehrung ihres Geldvermögens
setzen. Auf der anderen Seite stehen als Einnahmen im
Gesundheitswesen – zumindest im Prinzip – nur die vom
deutschen Sozialstaat beschlagnahmten Lohnanteile all
derer, die sich in der Marktwirtschaft als Arbeitnehmer
verdient machen dürfen. Eine gewagte Kombination, aus der
immerhin nicht weniger als ein halbwegs gesundes,
jedenfalls allzeit leistungsbereites und –fähiges Volk
als nationale Arbeitskraft herauskommen soll. Gewagt
insofern, als die privatwirtschaftlichen Erfolge
den im System verankerten Widerspruch chronisch
zuspitzen: Die Gesundheitsunternehmen wachsen,
nehmen also immer mehr an Geld in Beschlag – und
treffen als Quelle ihrer Bereicherung auf in
Krankenkassen zusammengeschlossene Arbeitnehmer, deren
nationales Gesamteinkommen tendenziell weniger
wird, weil die werten Arbeitgeber ihrerseits ihre
Personalkosten – noch ein Erfolg – permanent reduzieren,
indem sie Niedriglöhne bezahlen, Belegschaften
verkleinern und überhaupt soweit wie möglich
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung
abschaffen. Die Regierung selbst hat all das gefördert.
Die Krise ihrerseits untergräbt mit Kurz- und Leiharbeit
die Einnahmequelle des Systems nochmals. Das momentane
Ergebnis dieses Experiments ist bekannt: Die
Volksgesundheit, so wie sie die Politik in ihren
Sachleistungskatalogen definiert, ist mal wieder und
eigentlich immer: zu teuer.
Daraus folgt für die Koalitionäre nur eines: Die
existierende Finanzquelle muss ergiebiger werden, und so
testen die schwarz-gelben Gesundheitspolitiker auch 2010
aus, was das vermehrt in Beschlag genommene
Nettoeinkommen der bedürftigen Patienten
hergibt, um die marktwirtschaftliche Angebotsseite der
Gesundheit bei Laune zu halten. Keines der
gültigen widerstreitenden Interessen in diesem System
soll nämlich aufgegeben werden, und trotzdem soll es
seinen nationalen Dienst tun: Der selbstbewusste Ärzte-
und Apothekerstand soll zufrieden sein, die
Gesundheitsindustrie weltmarktfähig bleiben, die
Arbeitskosten dürfen nicht teurer werden, ‚Gesundheit‘
soll aber dennoch nicht einfach nach Kassenlage
rationiert werden. In der demokratischen Konkurrenz um
die Fortführung dieses Widerspruchs mit einer
großartigen Alternative, einem
Systemwechsel
aufzutreten, der ein für allemal die
Probleme löst
, das ist und bleibt die so große wie
absurde Versuchung eines jeden Ministers, die freilich
seinen politischen Konkurrenten die große Chance bietet,
ihn als inkompetenten Amtsinhaber zu blamieren…
3.
Norbert Röttgen, Amtsleiter im
Bundesumweltministerium,
verfolgt ehrgeizige Klimaziele
, was man so hört:
Die Energie-Auflagen für die deutsche Wirtschaft sollen
verschärft werden, den im Koalitionsvertrag beschlossenen
Laufzeitverlängerungen für AKWs sollen enge Grenzen
gezogen werden, die mit den abgeschriebenen Kraftwerken
dieser Brückentechnologie
verdienten Profite soll
im Wesentlichen der Staat abschöpfen, um mit den
Milliarden alternative Energien zu fördern. Eigentlich
eine schöne Herausforderung
für einen Minister,
also eine Gelegenheit, seine Kompetenz in seinem
Schlüsselressort
herauszustellen und sich damit im
Kabinett durchzusetzen, v.a. dann, wenn man zur
politischen Führung einer Nation gehört, die sich als
Vorreiter
im Klimaschutz versteht, in der die
Umstellung der nationalen Energieversorgung also oberste
Priorität hat. Aufgestachelt hat Röttgen mit seinen
Vorschlägen und Initiativen nur Widersacher, in
der Regierung, der eigenen Partei und den Vertretern
mächtiger Kapitalinteressen in den Energiekonzernen.
Gegenstand des recht unversöhnlich geführten Streits sind
zwei Fragen: Wie soll die bereits beschlossene
Laufzeitverlängerung der AKWs ausfallen –moderat
oder eben ein paar Jahre länger –, und in welcher
Weise beteiligt sich der Staat an den dadurch anfallenden
Gewinnen: Gibt es eine Brennelementesteuer und/oder eine
andere Art der Gewinnabschöpfung? Eigentlich eher zweit-
bis drittrangige Fragen, möchte man denken, angesichts
der nationalen Schicksalsfrage, von der die genannten
Alternativen bloß Facetten
sind, wie Röttgen
meint.
Immerhin geht es insgesamt um nicht weniger als die
Umwälzung einer entscheidenden Produktionsbedingung des
gesamten deutschen Kapitalismus, die selber ein globales
Geschäft in größtem Maßstab einschließt: Die Versorgung
des gesamten Standorts mit Energie, die jeder braucht,
alle etwas kostet und deshalb eine nationale
Reichtumsquelle erster Güte darstellt, soll umgestellt
werden. Bis gestern gab es dafür ein
Konzept
, das in der Nation ziemlich fraglos
gebilligt war: Deutschland sollte weltweit eine
Vorreiterrolle
im Klimaschutz spielen. Im Zuge
dieses anspruchsvollen Vorhabens sollte bekanntlich mit
staatlich mobilisierten Milliardensubventionen die
heimische Energieproduktion von Öl, Gas und Atom in
gewichtigen Anteilen auf Wind, Sonne und Biomaterial
umgestellt werden, ausgehend von der Kalkulation, dass
die überkommenen Energieträger künftig zu teuer
und zu unsicher verfügbar würden. Deutschland
sollte sich dabei einen technischen Vorsprung
verschaffen, damit Tempo und Umfang der Umstellung
bestimmen und so den anderen Staaten auf dem
internationalen Konkurrenzfeld der
CO2-Reduktion Wettbewerbsdaten
vorgeben, an denen sich alle zu orientieren
hätten. Je schneller und umfassender – so die Berechnung
– Deutschland seine Energieproduktion umstellt, umso mehr
kann es dem Rest der Welt mithilfe der EU Vorschriften
machen und den zukünftigen Weltmarkt mit alternativen
Energien strategisch dominieren. Wahrlich eine
weitreichende imperialistische Perspektive, die jedoch
zweifelhaft geworden zu sein scheint, wenn der
Umweltminister der Klimanation Nr. 1
mit seiner
Zukunftsoption
öffentlich demontiert
wird.
Wenn der baden-württembergische CDU-Standorthüter von
vier AKWs dem Umweltminister wegen der viel zu eng
begrenzten Laufzeitverlängerung den Rücktritt nahe legt,
dann macht er den Standpunkt geltend, dass seine
Atomkraftwerke jetzt und nicht erst in
spekulativer Zukunft konkurrenzlos billig und weitgehend
unabhängig vom Ausland Strom liefern. Sie sind ein
Bombengeschäft in Baden-Württemberg. Fraglich ist nur,
weshalb die Fraktion, die für eine längere Nutzung dieser
Energiequelle eintritt, dem nationalen Projekt, für das
Röttgen steht, nun so feindlich und einflussreich
entgegen tritt. Offenbar gibt es in Teilen der
politischen Führung Zweifel an der führenden
Konkurrenzposition Deutschlands beim großen, globalen
Zukunftsgeschäft mit den Techniken der regenerativen
Energie, die auf dem Klima-Gipfel in Kopenhagen nicht
weniger geworden sind. In dieser Lage halten sie die
Abschaltung einer funktionierenden
energiepolitischen Standortwaffe für ganz
unverantwortlich, zumindest solange der Erfolg der
neuen noch gar nicht gesichert ist. Andererseits
wird deren zukunftsträchtiger Erfolg gerade durch die
länger laufenden AKWs behindert: Eine erhebliche
Verlängerung der Atomlizenz beschädigt angeblich die
Investitionsbereitschaft in neue Energien und bringt die
Rentabilität von bereits getätigten Investitionen in
Kraftwerke der Zukunft
in Gefahr: Der Atomstrom
ist zu billig, zumal die Regierung gerade ihre
Subventionen in Solar- und Windindustrie abbaut und damit
die regenerative Energie verteuert. Die
Alternative, dann auch den Atomstrom durch neue Abgaben
erheblich zu verteuern und aus Teilen dieser
Einkünfte wiederum die Regenerativen zu fördern,
bringt die vier AKW-Betreiber gegen die Regierung auf:
Zusätzlich zur schon beschlossenen Atomstromabgabe will
der Finanzminister zusätzlich eine Brennelementesteuer
als Beitrag der Wirtschaft
zur Sanierung der
Staatsfinanzen erheben. Damit, darauf verweisen EON & Co
ausdrücklich, wird genau das private Geschäft geschädigt,
aus dessen Gewinnen die Finanzmacht kommen soll, aus der
die Zukunftstechnologien
global konkurrenzfähig
gemacht werden sollen ...
Folgerichtig tritt der Standpunkt des gegenwärtigen
Geschäfts auch Röttgens Konzept
entgegen, den
deutschen Standort durch eine Verschärfung der
staatlichen Sachzwänge in der CO2-Reduktion
voranzubringen. Der Wirtschaftsminister, der beim
Klimaschutz bremst
, betätigt sich als Sachwalter
dieses Standpunktes: Die Aufgabe und vermehrte Belastung
der bisherigen Energieträger verursacht jetzt
ganz allgemein nichts als Kosten, die – nicht
erst seit der Wirtschaftskrise, aber da erst recht – dem
deutschen Kapitalismus nicht zuzumuten sind. Schon gleich
nicht, wenn immer deutlicher wird, dass sich die Staaten,
die in der Konkurrenz um das zukünftige Geschäft mit der
Energie auf Augenhöhe mit Deutschland sind, von
Deutschland und seinen CO2-Standards gar keine
Vorschriften machen lassen: Das haben China, Brasilien
oder die USA hinreichend klargestellt, und in technischer
Hinsicht sind sie bei der Umstellung der Energieträger
und dem daraus folgenden Geschäft auf Deutschlands
Technologie und Kapital nicht angewiesen. Insgesamt also
auch das keine guten Umstände, um sich als
Brückentechnologieminister
glanzvoll in Szene zu
setzen…
4.
Unser beliebtester Mann in Berlin ist jetzt Verteidigungsminister. Die knapp 150 toten Afghanen am Kundusfluss hat er mit tatkräftigem Krisenmanagement gut überstanden, und mit seinen volkstümlichen Einlassungen, er könne schon verstehen, dass Deutschlands Soldaten die Zustände und Vorgänge in Afghanistan als Krieg erlebten, hat er sogar richtig Punkte gemacht, ganz ohne selbst sagen zu müssen, dass sich die Nation in einem Krieg befinde. Damit hat Guttenberg das Bedürfnis der Öffentlichkeit und des Volkes nach Ehrlichkeit der Führung in Kriegsfragen mit der verlogenen deutschen Kriegslegende, Deutschland diene dort recht eigentlich einem internationalen zivilen Aufbauprogramm, vorerst etwas versöhnt.
An diese schöne Profilierung in einem anerkanntermaßen
schwierigen Ressort knüpft Guttenberg mit seiner Debatte
um die Abschaffung der Wehrpflicht an. Er weiß
natürlich, dass er da an etwas Wichtiges im politischen
Alltag Deutschlands rührt: Immerhin geht es ja um den
kompletten Umbau der deutschen Armee, wie sie seit 60
Jahren organisiert ist. Etwas sonderbar an seiner
politischen Initiative ist dann allerdings die Art und
Weise, mit der er den sicherheitspolitischen Reformbedarf
anmeldet. Guttenberg argumentiert gar nicht
militärstrategisch, sondern macht in seiner
sicherheitspolitischen Grundsatzrede
, mit der er
die Nation etwas aufregt, vor seiner versammelten
Generalität ausgerechnet den vom Finanzminister
verhängten Sparzwang im Haushalt zum
Ausgangspunkt seiner Überlegungen zur Zukunft der
Bundeswehr
:
„Der mittelfristig höchste strategische Parameter, quasi als conditio sine qua non, unter dem die Zukunft der Bundeswehr gestaltet werden muss, ist die von mir schon apostrophierte Schuldenbremse, ist das globalökonomisch gebotene und im Verfassungsrang verankerte Staatsziel der Haushaltskonsolidierung.“ (Guttenberg am 26.5.)
Die Bundeswehr soll umgekrempelt werden, und der
politische Chef des Militärs ruft die
Schuldenbremse
, ein finanzpolitisches
Manöver der deutschen Regierung, mit dem man die
Geldspekulanten beeindrucken will, zum höchsten
strategischen Parameter
des deutschen Militärs aus.
Schon eigenartig, dass der Verteidigungsminister seine
Tatkraft und Sachkompetenz ausgerechnet als
Sparkommissar in Szene setzt, der die Vorgaben
des Finanzministers pflichtschuldigst erfüllt, so dass
der neue sicherheitspolitische Bedarf der Nation –
festgemacht an der Abschaffung der Wehrpflicht – quasi
als Abfallprodukt haushälterischer Sparsamkeit
zustande kommen soll. Das finden die werten Kabinetts-
und Parteikollegen untragbar: Keine Sicherheitspolitik
nach Kassenlage
, lautet der erste Einwand gegen
Guttenberg, womit Kauder, Ramsauer und die anderen aber
gar nicht zur Sache kommen. Stattdessen versuchen sie,
den reformfreudigen, jungen Minister
zu
entzaubern
, indem sie seine Art, wie er die
Dringlichkeit des Anliegens präsentiert, schlecht machen
– und dabei noch viel absurder über die Sache
reden, als Guttenberg selbst: Wo bleiben die
Zivildienstleistenden, wenn die Wehrpflicht weg
ist?! „Für die Kosten von 40 Kilometer Autobahn“
kann man doch nicht einen Eckpfeiler unseres
Gemeinwesens mal eben kippen
, usw. usf. – Beiträge zu
einer strategischen Planung der Nation sind das
eher nicht. Fast möchte man glauben, die politische
Führung lenkt mit dieser Art Wehrpflichtdebatte mehr von
der Sache ab, als sich ihr zu stellen, wenn sie
ausgerechnet da, wo man eine imperialistisch zielführende
Debatte um die wuchtigsten Gewaltmittel der Nation
erwartet, ein formvollendetes Ränkespiel um die
Zurechtweisung eines erfolgreichen Ministers aufführt.
Was ist da eigentlich los, wenn Deutschlands Politiker
derart verlogen und mit abseitigen Begründungen ihren
zukünftigen militärstrategischen Gewalthaushalt auf die
Tagesordnung setzen?
Klar ist, dass die Regierung Reformbedarf in Sachen Armee hat. Die Bundeswehr schleppt immer noch Merkmale eines Volksheers mit zigtausend schlecht ausgebildeten Rekruten mit, die einer Weltkriegsoption entstammen, die seit 20 Jahren passé ist. Für die gegenwärtigen, sog. internationalen Einsätze, taugt sie nur bedingt: Die Klagen über die Mängel einer Armee, die mit einer Sollstärke von 250 000 Mann an ihre Grenzen stößt, wenn 8000 Soldaten im Einsatz rund um den Globus sind, sind notorisch.
Eben diese längst geläufige Praxis – Truppen zu stellen
für NATO- oder UN-geführte Einsätze – gibt denn auch in
etwa die Blaupause für die Strukturreform
ab, die
Guttenberg im Auge hat: Ca. 100 000 Mann weniger, dafür
hochprofessionell, flexibel und natürlich mit bestem
mobilem Gerät. Nur: Genau die Kriegseinsätze, mit denen
die jetzige Bundeswehr als Interventionsarmee
schon in Afghanistan, im Kosovo oder vor der
libanesischen Küste agiert, sind gar nicht die
strategische Option, die deutsche Regierungen mit allem
Nachdruck verfolgen und von denen sie zufrieden gestellt
würden. Vielmehr werden die Beschaffungsmaßnahmen dafür
erheblich gekürzt, und auch den Verlautbarungen
Guttenbergs selbst zum Afghanistan-Krieg ist zu
entnehmen, wie bedingt die Regierung zu diesem
Krieg steht, von dem man noch nicht einmal klar sagen
darf, dass er ein Krieg sei; und von dem nur soviel klar
ist, dass er nicht wirklich „unser Krieg“ ist.
CDU-Sicherheitspolitiker geben deshalb auch bei
Gelegenheit zu verstehen, dass die Rolle des
Truppenstellers in der Art eines militärischen
Dienstleisters für begrenzte, fremdbestimmte Aufgaben und
eine ganz darauf zugeschnittene, deutlich verkleinerte
Bundeswehr nicht den Ansprüchen deutscher
Politik an Kriegsfähigkeit genügt:
„Eine signifikante Reduzierung der Bundeswehr entspricht weder dem Stellenwert noch dem Selbstverständnis Deutschlands noch den Erwartungen, die unsere Verbündeten an uns stellen.“ (E.-R. Beck, sicherheitspolitischer Sprecher der CDU/CSU, FAZ, 12.7.)
Was einer Welthandelsmacht und militärischen
Mittelmacht wie Deutschland an Kriegs- und Militäroption
entsprechen
würde, ist kein Geheimnis: Eine Rolle,
die sich nicht einfach in der Stellung von Truppen unter
fremdem Kommando erschöpft, sondern in der man selbst als
Interventionsmacht Einsätze bestimmt und Einsatzzweck und
Lagedefinitionen nach eigenem Ermessen beschließt. Bloß:
Ein politisches Bekenntnis dazu ist andererseits von der
deutschen Regierung auch nicht zu hören. Die
Bündnisfähigkeit
und Einsatzfähigkeit
der
Bundeswehr als Reformziele und die politischen
Kontroversen über deren Erreichung sind insoweit die
angemessen abstrakte Ausdrucks- und unsachliche
Verfahrensweise für die unbeantwortete Frage, auf
welche Kriege die Nation, die sich über ihren
wirklichen strategischen Status im Unklaren ist, sich in
Zukunft vorzubereiten hat. Mit diesen Reformzielen wird
der Schein einer selbstbestimmten militärstrategischen
Perspektive erweckt, die zu definieren und zu
praktizieren Deutschland aber tatsächlich gar nicht in
der Lage ist. Das Ziel der Bündnisfähigkeit
der
Bundeswehr für NATO oder EU sieht vornehm von den real
existierenden Differenzen und Vorbehalten ab, wie sie die
Regierung im Bündnisalltag bei jedem Einsatz unter
amerikanischem Oberkommando rund um den Globus im Streit
um Truppenkontingente, Bündnislasten oder
Abzugsperspektiven austrägt. Die Formel kündet davon,
dass sich die deutsche Regierung dazu keine nationale
oder europäische Alternative vornimmt, also keine
ausdrückliche Aufkündigung der kaum mehr
gemeinsamen Sache mit den USA in Frage kommt, obwohl
keine der militärischen Optionen in den
Bündnissen die Ansprüche der Nation wirklich zufrieden
stellt. In diesem strategischen Dilemma der
deutschen Sicherheitspolitik ist die Frage nach dem
Fortbestand der Wehrpflicht eine eher abseitige
Gretchenfrage
(Guttenberg) für die deutsche Wehrmacht.
Insofern hat er von der Kanzlerin schon den passenden
Auftrag bekommen: Ohne Denkverbote
soll er über
die Zukunft der Bundeswehr
nachdenken…