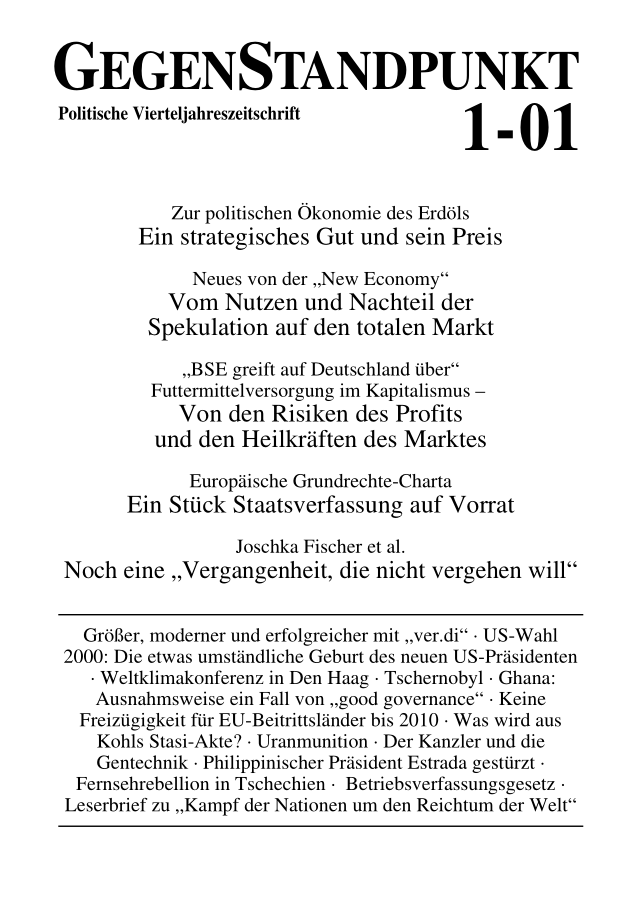Aus der Reihe „Chronik - kein Kommentar!“
Zur Reform des Betriebsverfassungsgesetzes:
Stärkung der Betriebsratsrechte zwecks Standortvorteil „sozialer Friede“ in den deutschen Betrieben
Rotgrün will das Institut des Betriebsrats, passend zu den inzwischen eingerissenen Zuständen in den Betrieben, tauglicher machen für seinen bewährten Einsatz zur Erhaltung des Arbeitsfriedens und zugleich einspannen für rotgrüne Interessen auf Betriebsebene: Kampf gegen Ausländerfeinde, Einsatz für den Umweltschutz, für Jugend- und Frauenrechte etc. Die Gewerkschaft begrüßt das Angebot der Regierung, sich verstärkt für die Versöhnung des Gegensatzes von Kapital und Arbeit engagieren zu dürfen, während die Unternehmer das alles auch ohne Betriebsrat und die Kosten dafür längst gesichert sehen.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Zur Reform des
Betriebsverfassungsgesetzes:
Stärkung der Betriebsratsrechte
zwecks Standortvorteil „sozialer Friede“ in den deutschen
Betrieben
Anfang Dezember kommt ein vergleichsweise weniger wichtiges Gesetzgebungsvorhaben der rotgrünen Regierung langsam in die Gänge: die Novellierung des Betriebsverfassungsgesetzes, einer Besonderheit des deutschen Arbeitsrechts. Die rotgrünen Sozialpolitiker wollen verhindern, dass das von ihnen für nützlich erachtete Institut des Betriebsrats so langsam veraltet und aus der Mode kommt:
„Die Strukturen in den Betrieben haben sich grundlegend geändert. Zunehmender Konkurrenzdruck und der damit verbundene Zwang zur Kosteneinsparung und zur Flexibilität am Markt hat die Unternehmen veranlasst, neue Organisationsformen zu finden…“ „Während noch 1981 der Anteil der Beschäftigten in Betrieben mit Betriebsrat 50,6% betragen hat, ist er bis 1994 auf 39,5% zurückgegangen.“ (aus der Begründung des Gesetzentwurfs)
In den Augen dieser Sozialpolitiker entzieht sich ein immer größerer Teil der Arbeitswelt ihrer „Verfassungs“-Ordnung; und das soll so nicht weitergehen. Die Regelung, die der deutsche Sozialstaat diesem Bereich verpasst hat, soll fortgeschrieben werden. Es geht um den ordnungspolitischen Dienst, den die gesetzlich vorgeschriebenen Betriebsräte bisher für Staat und Kapital erbringen – Leute mit einem langen Gedächtnis mögen sich dabei der Zeiten „wilder“ Streiks erinnern, ein heute regierender Sozialdemokrat hat dafür ein näherliegendes Beispiel bei der Hand:
„Den Nutzen von Betriebsräten auch für die Unternehmensleitung illustrierte der Arbeitsminister am Beispiel der Krise in der Metallindustrie in den 90er Jahren. Sie habe nur deshalb so gut bewältigt werden können, weil sich auch die Betriebsräte gegenüber den Beschäftigten für notwendige Umstrukturierungen stark gemacht hätten.“ (Handelsblatt, 21.11.00)
Der deutsche Sozialstaat denkt also sehr grundsätzlich, wenn er den Betrieben eine „Verfassung“ verordnet. Er macht sich nichts vor über den fundamentalen Gegensatz zwischen Kapital, um dessen Wachstum es ihm geht, und Arbeit, die dafür angewandt wird; er weiß, dass dieser Gegensatz nur solange produktiv ist, wie die Seite, die den Schaden hat, ihn friedlich aushält; dafür, dass sie das tut, setzt er sich ein. Ob der „soziale Friede“ in unserer streikfreien Republik tatsächlich eine Leistung des Gesetzes ist, das ihn vorschreibt, oder mehr dem falschen Bewußtsein zu verdanken ist, das vom Gegensatz und Schaden nichts wissen will, sei mal dahingestellt. Der Staat jedenfalls hält seine deutsche Betriebsverfassung für einen erhaltenswerten deutschen Standortvorteil.
1.
Objekt des Gesetzes ist der Betrieb: die „organisatorische Einheit, innerhalb deren ein Arbeitgeber allein oder mit seinen Arbeitnehmern mit Hilfe von sächlichen oder immateriellen Mitteln bestimmte arbeitstechnische Zwecke fortgesetzt verfolgt, die sich nicht in der Befriedigung des Eigenbedarfs erschöpfen“ (BAG).
Wenn der Bundesarbeitsminister lobt, dass sich die
Mitbestimmung als friedlicher unternehmensinterner
Interessensausgleich in den Betrieben bewährt hat
(Informationsbroschüre des BMA,
Oktober 2000), und wenn als Grundgedanke des
Betriebsverfassungsrechts die „Regelung der
Zusammenarbeit zwischen dem Arbeitgeber und der
Belegschaft des Betriebs“ und als dessen Grundanliegen
die Absicht hervorgehoben wird,
„dem Betrieb eine Ordnung zu geben, in der einerseits die berechtigten Belange der Belegschaft geltend gemacht werden können und in der andererseits die wirtschaftliche Entscheidungsfreiheit des Arbeitgebers im Grundsatz gewahrt bleibt“ (Übersicht über das Arbeitsrecht, hg. vom BMA),
dann ist klar, dass da ein sozialer Konflikt
ins
Auge gefasst und eine Verfassung erlassen wird, nach der
dieser zu bewältigen ist. Der Staat reagiert damit auf
einen Interessengegensatz, den er selber in die Welt
setzt: Er lizenziert die Freiheit des Eigentums, sich
durch Anwendung der Arbeitskraft der Arbeitnehmer zu
vermehren; er verleiht den Unternehmern das Recht und
damit die private Macht, Lohnarbeiter als Werkzeuge ihrer
Bereicherung einzusetzen; er organisiert so die
gesellschaftliche Arbeit als innerbetriebliches
Herrschaftsverhältnis – und dann widmet er sich in
allseits wohlmeinender Absicht den unausweichlichen
Folgen. Zuerst und grundsätzlich in der Weise, dass er
dem Kommando der Eigentümer wie der Unterordnung der
Dienstkräfte die Form eines rechtlich geregelten
Vertragsverhältnisses verpasst: So nimmt er der Macht der
Arbeitgeber das Moment dysfunktionaler subjektiver
Willkür, ohne an der Instrumentalisierung der Arbeit für
den Nutzen der Unternehmer etwas zu ändern, und spendiert
den Arbeitnehmern volle Gleichberechtigung, damit sie als
freie Menschen ihre Arbeitskraft zur Verfügung stellen.
Dass dieses egalitäre Rechtsverhältnis nicht die
Überwindung, sondern die Eröffnung eines
Gegensatzes der vertraglich verknüpften
Interessen von Lohnzahlern und Lohnempfängern ist und die
Lohnarbeiter dabei gegen das Recht des Eigentums wenig
Chancen haben: darüber macht sich der Sozialstaat
gleichfalls nichts vor. Der schwächeren Seite gewährt er
deshalb das Recht, sich nach – gleich mit kodifizierten –
restriktiven Regeln arbeitskämpferisch gegen ein Übermaß
an Ausnutzung zur Wehr zu setzen; das gehört zum Kanon
des bürgerlichen Klassenstaats.
Über dieses Regelwerk zur produktiven Einhegung von kapitalistischer Ausbeutung und Gegenwehr der Betroffenen geht das Betriebsverfassungsgesetz einen entscheidenden Schritt hinaus: Mit ihm reflektiert der Sozialstaat – nicht jeder, aber jedenfalls der deutsche – auf die Ausbeutungsverhältnisse in den Betrieben, an deren ökonomischer Funktionalität und gedeihlichen Abwicklung ihm gelegen ist. Er belässt es nicht dabei, dem gewaltträchtigen Gegensatz überhaupt eine Rechtsform zu geben, in der er abzuwickeln ist: Dort, wo es aufs produktive Zusammenwirken von Unternehmensführung und Belegschaft ankommt, macht er es sich zum Anliegen, ihn definitiv zu versöhnen. Gerade weil er sich im Rahmen der Verrechtung des Ausbeutungsverhältnisses zur Anerkennung der Gewerkschaft als kollektiver Interessenvertretung der Arbeitnehmer und zu einer einschränkenden Erlaubnis des Arbeitskampfes herbeigelassen hat, verordnet er den Betrieben eine Verfassung, mit der er ganz egalitär beide Seiten gleichermaßen darauf verpflichtet, den proletarischen Arbeitskampf aus den Betrieben herauszuhalten. An dessen Stelle spendiert er den Arbeitnehmern ein zusätzliches Recht; darauf nämlich, in Gestalt gewählter Vertreter beim Arbeitgeber Gehör zu finden und – ohne den oder jedenfalls vor dem umständlichen Gang zum Arbeitsgericht – Rechtspositionen geltend zu machen.
Wo Arbeitnehmer sich für ihr Interesse gar nicht mehr erwarten, als dass ihnen Respekt entgegengebracht wird und Recht geschieht, gerät der Betriebsrat damit schon in die Rolle des einzigen „Organs“, das dafür da und in der Lage ist, „für die Leute was ‚rauszuholen‘“. Mit einer kämpferischen oder überhaupt nur parteilichen Verfolgung geschädigter Arbeiterinteressen hat er allerdings betriebsverfassungsgemäß nichts zu tun. Bereits die ersten Paragraphen des Gesetzes lassen da keinen Zweifel:
„Arbeitgeber und Betriebsrat arbeiten unter Beachtung der geltenden Tarifverträge vertrauensvoll… zum Wohl der Arbeitnehmer und des Betriebes zusammen.“ (§2.1 BetrVG)
Sie haben, wie spätere §§ dekretieren,
„über strittige Fragen mit dem ernsten Willen zur Einigung zu verhandeln.“ (§74.1, Grundsätze für die Zusammenarbeit); „Maßnahmen des Arbeitskampfes zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat sind unzulässig.“ (§74.2)
Man sieht, der Gesetzgeber glaubt keineswegs an die Interessenharmonie, die er dekretiert; er rechnet fest mit fortdauernden Interessengegensätzen und „strittigen Fragen“ – wie überhaupt und überall in seinem Recht. Anders als sonst grenzt er hier aber nicht bloß berechtigte Ansprüche formell gegeneinander ab, um per Ermächtigung und Beschränkung ein Zusammenwirken im Gegensatz zu erzwingen. Er schreibt vielmehr allen Ernstes den „ernsten Willen“ zur Überwindung des Konflikts vor, den er unterstellt; die notwendigerweise auftretenden „Streitfragen“ sollen nicht bloß zivilisiert ausgetragen, sondern im Gemeinwohl des Unternehmens aufgelöst werden. Deswegen stellt er es der Betriebsbelegschaft auch nicht anheim, sich zum Zwecke kollektiver Interessenvertretung zu organisieren. Er organisiert sie gewissermaßen selber, gibt nämlich eine Organisation – einschließlich genauer Kriterien für die Zugehörigkeit zum Betrieb – vor, die die Arbeitnehmer mit dem Entschluss zur Wahl eines Betriebsrats nur noch auszufüllen brauchen. Betriebsverfassungsrechtlich definiert er die lohnabhängige Mannschaft – statt als interessierte Partei – als integralen Bestandteil des Unternehmens, versetzt sie in den Stand einer Körperschaft, der das Betriebswohl als konstitutiver Zweck, die Unterwerfung jedes partiellen Interesses unter den Gesamterfolg des Unternehmens als eigenes Anliegen einbeschrieben ist. Genau das jedenfalls repräsentiert der frei gewählte Betriebsrat; ganz unabhängig davon, was sich diejenigen, die ihn wählen, für ihr Interesse davon erwarten. Komplementär dazu erlegt die Betriebsverfassung dem Unternehmen die interessante Pflicht auf, die Belegschaft in Gestalt des gewählten Betriebsrats im gesetzlich vorgegebenen Sinn, nämlich als konstitutiven, konstruktiv mitwirkenden und mitwirken wollenden Bestandteil des Unternehmens, als Teil-Körperschaft des Betriebsganzen ernst zu nehmen: Das Unternehmen muss den Betriebsrat in gewissem Umfang über Stand und weitere Planung des Geschäfts informieren, bei Umorganisation des Zugriffs auf die Belegschaft sowie bei Entlassungen seine Zustimmung einholen, Beschwerden und Verbesserungsvorschläge entgegennehmen und dergleichen mehr – und ihn dafür sogar finanzieren. Was es dafür bekommt, das ist eben dies: eine Belegschaftsvertretung, die qua Amt dafür einsteht, dass die Beschäftigten die Verpflichtung aufs betriebliche Gemeinwohl auch anerkennen und auf jede andere Art der Einflussnahme aufs Betriebsgeschehen, somit auf jede parteiliche Interessenvertretung innerhalb des Unternehmens verzichten.
Der Staat greift also mit seinem Betriebsverfassungsgesetz in das betriebliche Ausbeutungsverhältnis in der Weise ein, dass er es in den Stand eines körperschaftlichen Zusammenwirkens erhebt und Benutzer wie Benutzte auf das kapitalistisch Funktionale an der Lohnarbeit festlegt. Insbesondere ermächtigt er die Arbeitnehmerseite in Gestalt eines gewählten Betriebsrats dazu, peinlichst darauf zu achten, dass den Arbeitnehmern nichts als dem Betriebszweck dienliche Maßnahmen abverlangt werden; dabei und dafür darf die Belegschaftsvertretung diverse Informations-, Anhörungs-, Vorschlags- und Mitwirkungsrechte geltend machen und auch initiativ werden. Damit ist den Anliegen der Belegschaft dann aber auch prinzipiell Genüge getan – was vor den Arbeitsgerichten nach den Grundsätzen der vorgerichtlichen gütlichen Einigung, in der das „Einschalten“ des Betriebsrats „auf jeden Fall empfehlenswert“ ist, nicht wenig zählt. Das den von ihm Vertretenen zu vermitteln, gehört selbstverständlich und gar nicht zuletzt auch zum Auftrag eines Betriebsrats.
2.
Die rotgrüne Regierung will nun das seit fast drei Jahrzehnten unveränderte Gesetz novellieren. Der Reformbedarf wird mit „den tiefgreifenden Veränderungen, die die Arbeits- und Wirtschaftswelt in den letzten Jahrzehnten erfahren hat“, begründet. Es soll „die betriebliche Mitbestimmung zukunftsfähig“ gemacht werden, weil „die Beteiligung der Beschäftigten und die Sicherung ihrer Rechte durch repräsentative Institutionen nicht Hindernisse, sondern im Gegenteil produktive Ressourcen sind und einen Standortvorteil bilden.“
a) Die Gesetzesnovelle ist zunächst einmal die Reaktion darauf, dass in der modernen Arbeitswelt die Körperschaft, auf die es dem Staat ankommt, im Verschwinden begriffen ist. Der Staat registriert, dass die formale Anwendung der von ihm erlassenen Regelungen, die Subsumtion der Belegschaften und Betriebe unter das Regime des Gesetzes, auf immer mehr Hindernisse stößt. Die Unternehmen fusionieren, diversifizieren, verschlanken sich, lagern Betriebsbestandteile aus, out-sourcen etc. pp. Sie verändern also laufend sehr frei aus Gründen ihres Konkurrenzinteresses ihre Rechtsform und Betriebsstruktur und hebeln so nebenbei den bisherigen Betriebsrat aus. Dessen „Arbeit läuft ins Leere“, wenn ihm das Kollektiv, das er vertreten soll, langsam abhanden kommt. Die „Stammbelegschaften“ wurden in den letzten Jahren bekanntlich drastisch abgespeckt; das moderne Institut einer „Randbelegschaft“ der Betriebe – das sind Leiharbeiter, Tagelöhner, Scheinselbständige, Telearbeiter u.a. – fällt aus dem Geltungsbereich des bisherigen Gesetzes und damit aus der Zuständigkeit von Betriebsräten heraus. Oder die Mitarbeiter halten einen Betriebsrat für schlicht überflüssig; sei es, weil sie es selbst so sehen, dass „ihr“ Unternehmen mit einer corporate identity besser fährt als mit Mitbestimmungsrechten am Arbeitsplatz; sei es, weil schlagkräftigere Argumente sie davon überzeugt haben. In dieser sozial so befriedeten Arbeitswelt, dieser Idylle an Sozialpartnerschaft, führt nämlich die andere Seite unverdrossen ihren Kampf – eben nicht nur den in der Konkurrenz, sondern nicht zu knapp auch den um Rechte, und zwar für die Freiheit des Eigentums. Verwöhnt durch Jahrzehnte zunehmend bedingungsloser Anerkennung ihres Interesses durch Staat, Öffentlichkeit und sogar die Gewerkschaften selber, sehen die Unternehmer diese ihre kostbare Freiheit durch die gesetzlich elaborierte Anerkennung des betrieblichen Gemeinwohls mehr reglementiert, also beschränkt als gesichert. Deswegen wollen sie, schon aus Prinzip, grundsätzlich keinen Betriebsrat, mit dem sie sich fortwährend ins Benehmen setzen und den sie dafür sogar noch finanzieren müssen. Und deswegen gehen viele arbeitsplatzschaffende Leistungsträger unserer sozialen Marktwirtschaft unter großzügiger Ausschöpfung der Gesetzeslage mit allerlei Repressalien gleich schon gegen die Wahl von Betriebsräten vor – in den letzten Jahren offensichtlich mit viel Erfolg.
Deswegen ergreift der Gesetzgeber die Initiative. Er will es nicht hinnehmen, dass seinem betriebsverfassungsrechtlichen Hineinwirken in die Betriebe zunehmend die Grundlage entzogen wird. Zehn wesentliche Neuregelungen sind vorgesehen, mit denen die rotgrünen Sozialpolitiker das staatliche Interesse an einer kollektiven Vertretung der Belegschaften bekräftigen und deren Kompetenzen neu abgrenzen. Sie wollen:
– „Moderne und anpassungsfähige Betriebsratsstrukturen schaffen“ (1)
Anpassung der Gesetzeslage an die moderne Unternehmenskultur tut Not. Zumal sich die Regierung der Tatsache voll bewusst ist, dass „die sozialen Auswirkungen, die Umstrukturierungen mit sich bringen, im Zentrum der täglichen Arbeit der Betriebsräte“ stehen, die Unternehmer also laufend für neuen Stoff sorgen, den die Belegschaften zu verdauen, die Belegschaftsvertreter also ihren Leuten sozialfriedlich beizubiegen haben: Die Unternehmen organisieren sich laufend neu, wegen „des Konkurrenzdrucks und des damit verbundenen Zwangs zur Kosteneinsparung“, wie es in der Begründung des Referentenentwurfs heißt; da verstehen sich die „sozialen Auswirkungen“, die Schäden, die die andere Seite zu tragen hat, für die Regierung völlig sachgerecht dermaßen von selbst, dass es für deren rechtliche Betreuung und ordnungspolitische Einfriedung im betrieblichen Vorfeld der Arbeitsgerichtsbarkeit und sonstiger sozialstaatlicher Abwicklungsstellen keinen „weißen Flecken auf der Landkarte der betrieblichen Mitbestimmung“ geben darf. Folglich braucht es einen „modern“ und „anpassungsfähig“ strukturierten Betriebsrat – eine schöne Klarstellung über Grund und Zweck dieser arbeitnehmerfreundlichen Institution.
Von diesem Standpunkt lässt sich die Regierung auch nicht durch Unternehmer abbringen, die den staatlichen Bemühungen um ihr wohlverstandenes Eigeninteresse überhaupt nicht aufgeschlossen gegenüberstehen, sie vielmehr nach Kräften hintertreiben. Denen wird im Gegenteil eine Neuerung aufs Auge gedrückt, die die
– „Bildung von Betriebsräten erleichtern / Wahlverfahren vereinfachen“ (2)
soll. Der Sozialstaat macht sich da nichts vor: Er muss der interessierten Arbeitnehmerschaft durch Verfahrensvorschriften und Schutzrechte die Möglichkeit verschaffen, ihr Recht auf Einrichtung eines Betriebsrats auch wirklich wahrzunehmen, damit sein Interesse an ihrer körperschaftlichen Formierung zum Tragen kommt. Dabei geht es des Weiteren insbesondere um die
– „Einbeziehung neuer Beschäftigungsformen“ (3)
ins gesetzlich verfasste Betriebskollektiv. Es soll in den Betrieben nicht nur überhaupt einen Betriebsrat geben, sondern ausdrücklich einen, der auf möglichst breiter Basis „die kollektiven Interessen aller Arbeitnehmer des Betriebs wahr(nimmt)“. Unabhängig davon, in welche der diversen neuen Beschäftigungsformen es sie verschlagen hat, unabhängig auch davon, ob ihnen in denen ausgerechnet die gesetzlich vorgesehene Vertretungsinstanz abgegangen ist, werden die Beschäftigten alle gleichermaßen einem Betriebsrat zugeordnet, der sie dann gegenüber dem Betrieb vertritt. Dem Betriebsrat sollen darüber nach dem Willen des Gesetzgebers Mitbestimmungsrechte über Bereiche zuwachsen, für die er bislang nicht zuständig war – und mit denen weitreichende Entscheidungsrechte über die Interessen derjenigen, die er vertritt.
Denn die Betriebsräte sind ja, vor allem in den großen Betrieben, schon längst in echte Managementaufgaben der unteren Ebene hineingewachsen. Und da haben sie sich in den Augen der Regierung als Instanz bewährt, die sich ganz besonders kompetent mit der Umwälzung der Arbeitszeitordnung und neuen Arbeitsformen in den Betrieben auseinandersetzt. Von ihnen „werden heute zusätzlich planerische und gestalterische Aufgaben wahrgenommen. Eigene Vorschläge und Lösungsalternativen werden entwickelt und prozessorientiert umgesetzt“, wofür manche Fabrik bei VW und anderswo schon ein leuchtendes Beispiel gibt. Dabei betätigt sich der Betriebsrat auch schon längst, und gar nicht nur nebenbei, als Schiedsinstanz zwischen den Arbeitnehmern, deren Interessen über Veränderungen der Arbeitsplatzgestaltung und der Arbeitszeitordnung in Widerstreit geraten; was allemal einschließt, dass er sich laufend gegen besondere Interessen der geschätzten Arbeitnehmer zu wenden hat.
b) Das alles sind für die rotgrüne Regierung schon Gründe genug, per Gesetz auf eine
– „Verbesserung und Modernisierung der Arbeitsmöglichkeiten des Betriebsrats“ (4)
zu drängen. Sie hat dabei aber eine noch viel gewichtigere Entwicklung im Blick:
„Zusätzlich in Anspruch genommen werden Betriebsräte durch die zunehmende Verbetrieblichung der Tarifpolitik in Form von betrieblichen Öffnungsklauseln.“
Dass die Unternehmer sich heute zur Unterschrift unter Tarifverträge nur noch unter der Bedingung herbeilassen, dass diese ihnen weitreichende Freiheiten in der betrieblichen Tarifgestaltung einräumen; dass die Gewerkschaft auf der anderen Seite sich mit dem Argument der „zu sichernden Arbeitsplätze“ zur Unterschrift unter derartige Verträge drängen lässt, mit denen sie ihre Klientel schutzlos der Unternehmermacht ausliefert; dass auf dieser Grundlage in den Betrieben eine Lohnfindung um sich greift, bei der die vereinbarten Tarife nur noch als locker zu interpretierende Richtgrößen für den tatsächlich gezahlten Lohn in Betracht gezogen werden – all dem steht die rot-grüne Regierung überaus aufgeschlossen gegenüber. Sie bekennt sich zu der Verlagerung des Tarifkampfes weg von den Gewerkschaften, die ihn schon längst nicht mehr führen, hinein in die Betriebe, wo ihn die Unternehmer führen. Wurde der Betriebsrat von Staats wegen einmal mit der antigewerkschaftlichen Zielsetzung ins Leben gerufen, die Arbeitnehmerinteressen im Betrieb so zu formieren, dass der Arbeitskampf aus dem Betrieb draußenbleibt – dabei soll es selbstverständlich bleiben –, so versieht ihn der Staat in Gestalt einer sozialdemokratisch geführten Regierung heute darüber hinaus mit dem Auftrag, innerbetrieblich ganz sozialfriedlich und überparteilich zu revidieren, was die Gewerkschaft als Tarifpartei aushandelt, und für das betriebliche Belegschaftskollektiv alles zu unterschreiben, was der schwer konkurrenzkämpfende Arbeitgeber ihm zur Unterschrift vorlegt.
Die Frage ist nur: Soll im Rahmen dieser „Verbetrieblichung der Tarifpolitik“ das „Günstigkeitsprinzip“, das nach bisheriger Lesart innerbetriebliche Abmachungen über schlechtere als die im Tarifvertrag festgelegten Lohn- und Arbeitsbedingungen eigentlich nicht zulässt, bei der Neudefinition der Betriebsrats-Kompetenzen explizit dahingehend umdefiniert werden, dass unter dem Titel „Beschäftigungssicherung“ alles zugelassen ist, weil für Lohnarbeiter wenig Lohn allemal „günstiger“ ist als keine Arbeit – so die Opposition und die Arbeitgeber? Oder – so die Gewerkschaften – braucht es das gar nicht, weil moderne Tarifverträge und deren praktische Anwendung im Betrieb sowieso schon längst so gehandhabt werden? Um einen eindeutigen Klartext drückt sich die Gesetzesnovelle der Regierung herum – und ist doch klar genug. Sie will
– „Beschäftigungssicherung und Qualifizierung in der Betriebsverfassung verankern“ (5)
und weist damit ganz unmissverständlich dem Betriebsrat die Aufgabe zu, gegebenenfalls zwischen den tarifvertraglich vereinbarten Löhnen und dem mit Kündigungswarnungen unterfütterten Unternehmerwunsch nach Lohnminderung eine verantwortliche Abwägung zu treffen.
Umgekehrt bekommt er dafür auch ein schönes neues Recht: Die Gesetzesnovelle verpflichtet die Betriebe, sich mit ihren Betriebsräten, die bisher schon, allerdings ganz unverbindlich, jede Menge „Beschäftigung sichernde Maßnahmen“ austüfteln und vorschlagen, in einen „intensiven sozialen Dialog“ zu begeben. In dem soll sich die eine Seite, die zwecks „Gewinn orientierter“ Beschäftigung laufend die Arbeitszeitordnung und Arbeitsformen in den Betrieben arbeitskräftesparend umkrempelt, mit der anderen Seite, der an der Einführung „Beschäftigung sichernder“ Arbeitszeitmodelle gelegen ist, darüber verständigen, ob nicht das Gewinn- mit dem Beschäftigungsinteresse zu versöhnen ist, unnötige Entlassungen vermieden werden können und der Betrieb so auf seine Rechnung kommt – dann könnte sich nämlich der Betriebsrat als Agent des politischen Interesses an niedrigeren Arbeitslosenzahlen bewähren. Deswegen wird sein bisheriges Engagement zum „Initiativrecht“ aufgewertet.
c) Die Novelle wäre nicht vollständig, würde die rotgrüne Regierung ihr nicht ihre unverwechselbare rotgrüne Handschrift verleihen. Also werden Umwelt und Kampf gegen Ausländerfeinde in der Betriebsverfassung verankert; und Sondergruppen, die heutzutage unvermeidlich immer vorkommen müssen, wo etwas Soziales geregelt wird, finden als extra zu stärkende und jedenfalls zu berücksichtigende Betroffene Erwähnung: Frauen, Jugend sowie das Individuum, um das sich sowieso alles dreht. Also heißt es:
– „Betriebliches Wissen für den betrieblichen Umweltschutz nutzen“ (8)
Denn: „Der Umweltschutz spielt auch in den Betrieben und Unternehmen eine immer wichtigere Rolle“ – schließlich ist deren Umgang mit den Exkrementen ihrer Produktion die Quelle eines staatlichen Problems. Ebenfalls klar ist, dass es „eine unmittelbare Wechselwirkung zwischen Arbeitnehmerschutz und Umweltschutz“ gibt – immerhin sind die Beschäftigten in den Betrieben die Ersten, die den in die Umwelt entlassenen Schadstoffen ausgesetzt sind. Da liegt also ein weites Aufgabenfeld für die berufenen Vertreter des Arbeitnehmerrechts auf Belastungen, die sich im Rahmen des konkurrenzkampftaktisch Unvermeidlichen halten. Die rotgrüne Regierung kann sich gut vorstellen, dass Betriebsräte „praxisnahe Vorschläge machen, um Umweltbelastungen zu vermeiden“, und dass sie damit dem Unternehmen sogar nützen – denn:
„Umweltschutz ist mittlerweile ein bedeutsamer, betriebswirtschaftlicher Faktor geworden, der auch Auswirkungen auf die wirtschaftliche Situation des Unternehmens hat.“
Andererseits kann man sich im Berliner Arbeitsministerium allerdings noch viel besser höchst unliebsame Konsequenzen vorstellen, wenn man es mit den betriebsrätlichen Kompetenzen an dieser Stelle übertreibt:
„Eine generelle Ausdehnung auf den allgemeinen Umweltschutz würde Betriebsräte in vielen Fällen in einen kaum auflösbaren Zielkonflikt zwischen den wirtschaftlichen Interessen des Betriebs und allgemeinen Umweltschutzinteressen führen“ –
und ein solcher Konflikt müsste den Betriebsrat einfach zerreißen, weil der ja die Inkarnation sämtlicher legitimen Arbeitnehmerinteressen im Unternehmen ist und als Institution für die Identität dieser Interessen mit dem Unternehmenserfolg steht, für den nach Bedarf Betriebspersonal und Umgebung verschlissen werden. Noch schlimmer, wenn irgendwelche Belegschaftsvertreter sich durch eine unbedachte gesetzliche Ermächtigung herausgefordert fänden, den eigenen Zielkonflikt zu einem solchen mit der Unternehmensleitung zu machen:
„Die Funktion einer Umweltpolizei würde die vertrauensvolle Zusammenarbeit von Betriebsrat und Arbeitgeber nicht nur im Bereich des betrieblichen Umweltschutzes erheblich gefährden.“
Schön, wie offen der Gesetzgeber hier ganz nebenbei eingesteht, wie geläufig und selbstverständlich ihm nicht bloß die Versauung der geschätzten Umwelt durch die „wirtschaftlichen Interessen“ seiner Unternehmer ist, sondern auch deren Gewohnheit, sich dabei über die offiziell geltende Rechtslage hinwegzusetzen; nett auch das implizite Eingeständnis, dass er ihnen hier vieles verzeiht. Auf alle Fälle ist ihm betriebsverfassungsrechtlich an einem guten Betriebsklima weit mehr gelegen als an einer Kontrolle, die die Unternehmer in ihrer Praxis der geschäftsdienlichen Umweltzerstörung nur stören würde. Solche prekären Befugnisse werden dem Betriebsrat daher gar nicht erst übertragen. Mit der Erarbeitung von Vorschlägen, die sich betriebswirtschaftlich rechnen, hat er schon genug zu tun: Das ist gelebter Umweltschutz im Sinne der rotgrünen Koalition.
Als Statthalter eines politischen Interesses im Betrieb sind dessen Räte auch noch in einer anderen Hinsicht gefragt:
– „Gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit – die Betriebe machen mit“ (10)
Dass die Unternehmer ihre Arbeitskräfte nach Lohnkosten und Tauglichkeitsgesichtspunkten für den Gewinn ziemlich hautfarbenneutral einstellen, ist allgemein zu besichtigen. Dass die deutschen Arbeitnehmer die dazu passende moralische Differenzierungskunst schon drauf hätten, steht ziemlich in Zweifel. Die Unterscheidung zwischen nützlichen Ausländern, die ‚unsere‘ Wirtschaft braucht, und unnützen, die nicht hierher gehören, müssen sie erst noch lernen. Dafür will die rotgrüne Regierung den Betriebsrat einspannen: Der Arbeitsplatz als Schule der Nation für richtigen Nationalismus. Die moralische Wucht seines politischen Anliegens unterfüttert der Gesetzgeber in diesem Fall mit der Zuweisung einer handgreiflichen Kompetenz an den Betriebsrat: Der „kann die Entfernung solcher Arbeitnehmer fordern, die den Betriebsfrieden wiederholt durch rassistische oder fremdenfeindliche Betätigungen ernstlich stören“. Ob ein Ausländer hier arbeiten darf oder nicht, das entscheidet nach wie vor allein der Staat, ob aber ein Ausländerfeind hier arbeiten darf, das entscheidet künftig der Betriebsrat mit.
Zu den edlen emanzipatorischen Anliegen der Gesetzesnovelle zählen schließlich noch:
– „Stärkere Teilhabe der einzelnen Arbeitnehmer an der Betriebsverfassung“ (6)
– „Engagement von Frauen im BR stärken“ (7)
– „Jugend- und Auszubildendenvertretungen stärken“ (9)
Ihr spezielles Interesse an sittlichen Arbeitsverhältnissen in Deutschlands Betrieben will die Regierung denen, die sich körperschaftlich organisiert vertreten lassen sollen, ganz persönlich nahe bringen. Sie wartet nicht darauf, dass die Betriebsangehörigen ihr Interesse anmelden, sondern fordert sie auf, sich für die Körperschaft zu interessieren und zu engagieren, an der ihr gelegen ist. Dabei knüpft sie an die weniger erfreulichen Erfahrungen an, die sich Frauen und Azubis im Betrieb gefallen lassen müssen, und empfiehlt ihre erneuerte Betriebsverfassung als Chance, mit „Engagement“ Diskriminierung und Mobbing zu überwinden.
3.
Der Gesetzgeber will sein Anliegen den Unternehmern am Ende seiner Entwurfsbegründung noch einmal zusammenfassend als deren Vorteil nahe bringen:
„Der Kostenbelastung der Unternehmen durch die Betriebsratsarbeit sind die Vorteile der betrieblichen Mitbestimmung gegenüberzustellen. Mitbestimmung stellt Vertrauen her. Und dieses Vertrauen ermöglicht flexiblere und prozessoffene Formen der Zusammenarbeit und senkt dadurch z.B. die am Arbeitsplatz entstehenden Transaktionskosten. Hinzu kommt, dass Arbeitnehmer, die ihre Belange im Betrieb vertreten wissen, und Betriebsräte, die diese Belange in Unternehmensentscheidungen einbringen können, die Produktivität von Unternehmen und damit die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft steigern.“
Die gemeinten Nutznießer des Gesetzes aber sehen das ein wenig anders und gehen in die Offensive. Sie halten das Gesetz für – na was wohl? – ein
„Abschreckungsprogramm gegen die Schaffung von Arbeitsplätzen. Demokratie kann nur gestärkt werden, wenn auch der Verzicht der Belegschaft auf einen Betriebsrat wirklich respektiert wird. Aufgeblähte Betriebsratsgremien sind der traurige Beweis für fehlendes Kostenbewusstsein und Bürokratieverliebtheit. Einen Co-Unternehmer Betriebsrat darf es nicht geben. Wenn schon Gesetzesänderungen vorgenommen werden, dann muss die Betriebsverfassung modernisiert werden durch mehr Flexibilisierung, Beschleunigung und Deregulierung… Betriebliche Gestaltungsspielräume müssen gestärkt werden… Bündnisse für Arbeit in den Betrieben… Klarstellung des Günstigkeitsprinzips… Mitbestimmungsbürokratie… Wir brauchen dringend die Deregulierung des Arbeitsrechtsdschungels, um Freiraum für neue Arbeitsplätze zu schaffen.“ (Aus der gemeinsamen Erklärung der Spitzenverbände der Deutschen Wirtschaft, 14.01.2001)
Von den Bemühungen des Staats, ihnen die Vorteile der Kooperation zwischen Betriebsleitung und Belegschaft per Betriebsrat zu sichern, halten die Unternehmer grundsätzlich überhaupt nichts. Sie stehen auf dem Standpunkt, dass diese Kooperation zweckmäßig, nämlich in ihrem Interesse, allein durch sie, per Herrschaft über den Betrieb, herzustellen ist. Die Formierung der Belegschaft zu einer schlagkräftigen, dem Betriebswohl verpflichteten Mannschaft ist für sie eine Angelegenheit, die sie und nur sie mit ihrem Direktionsrecht erledigen. Dass sie dafür Leute zahlen sollen, die für sie überhaupt nicht arbeiten, halten sie für absurd; dass sie sich mit denen auch noch ins Benehmen zu setzen haben, für eine Zumutung. Sie sehen darin eine Fessel ihrer Entscheidungsfreiheit. Und dass nun der Betriebsrat auch noch aufgewertet werden soll, geht für sie endgültig zu weit. Namentlich die vorgeschlagene Streichung zweier einschränkender Formulierungen – gegen Änderungen der Arbeitsplätze, des Arbeitsablaufs oder der Arbeitsumgebung kann der Betriebsrat bislang nur Widerspruch einlegen, wenn sie „offensichtlich“ den gesicherten Erkenntnissen der Arbeitswissenschaft widersprechen und Arbeitnehmer „in besonderer Weise“ belasten –, löst bei ihnen die Horrorvorstellung vom „Co-Unternehmer“ aus, der sie dauernd am Gewinnemachen hindert. Wenn es in der regierungsamtlichen Begründung dieser Streichungen heißt, durch sie solle erreicht werden, dass der Betriebsrat das „korrigierende Mitbestimmungsrecht auch tatsächlich ausüben kann“, dann ist eben das für sie der Skandal: Bislang war dieses Recht so schön garantiert wirkungslos – nun soll der Betriebsrat auf einmal im Rahmen seiner Rechte tatsächlich tätig werden können!
Wenn schon Gesetzesnovelle, dann bitte schön eine, die in die richtige Richtung geht: in Richtung Aufräumen mit dem „Arbeitsrechtsdschungel“, der ihre Entscheidungsfreiheit beschränkt; eine, die Platz für die richtigen „Bündnisse für Arbeit“ schafft, solche nämlich, in denen nicht immer erst um die Selbstverständlichkeit gestritten werden muss, dass der „Günstigkeitsgrundsatz“, demzufolge betriebliche Regelungen nur zu Gunsten der Beschäftigten von den Tarifverträgen abweichen dürfen, dahingehend auszulegen ist, dass die werten Mitarbeiter mit einem unter Tarif bezahlten Arbeitsplatz besser fahren als mit der permanenten Drohung, wegrationalisiert zu werden – tatsächlich wegrationalisiert werden sie allemal noch früh genug…
4.
Die Gewerkschaft hingegen begrüßt die Novelle. Den prinzipiell anti-gewerkschaftlichen Standpunkt des Gesetzes nimmt sie überhaupt nicht wahr. So, wie sie beieinander ist – sie hängt ja längst nicht mehr verstaubtem Klassendenken und einseitig parteiischer Interessenvertretung an, sondern will in unserer modernen Arbeitswelt mitgestalten, schon wegen der Arbeitsplätze –, sieht sie im Institut Betriebsrat alles andere als den auf Friedenspflicht festgelegten Erfüllungsgehilfen des Betriebs. Sie sieht ihn vielmehr mit ungefähr haargenau dem Auftrag zu verantwortungsvoller Mitbestimmung betraut, den sie immer schon gerne ausfüllt. Und weil das Betriebsverfassungsgesetz ihr immer schon ein Recht auf entsprechend konstruktives Mitwirken einräumt, erkennt sie in dem gesetzlichen Diktat, das aus dem betrieblich ausgenutzten „Faktor Arbeit“ eine ehrenwerte Teilkörperschaft des Unternehmensorganismus macht, eine Riesenchance, sich legal Zugang zu den Betrieben und den Arbeitskräften zu verschaffen. Was sie dort will, ist klar. Erstens: Den Unternehmern als Partner zur Verfügung stehen, wo die einen unterschriftsberechtigten Partner brauchen:
„Die Arbeitgeber forderten immer: Warum können wir nicht mehr Fragen direkt mit den Betriebsräten aushandeln, statt immer gleich mit der Gewerkschaftsspitze reden zu müssen? Bitte schön, die Reform bietet die Möglichkeiten dafür.“ (Schulte, SZ, 20.12.2000)
Abverlangt wird ihnen dafür nur, dass sie aufhören, die
unbeschränkten Herren im Haus sein zu wollen
. Ihre
umgekehrte Befürchtung jedenfalls, Gewerkschafter wollten
sich als „Co-Unternehmer“ aufspielen, ist völlig
unberechtigt:
„Wir wollen nur mitreden“, „nichts vorschreiben“.
Das langt schon – für den zweiten wichtigen Hauptzweck nämlich, den die Gewerkschaft mit ihrem betriebsrätlichen Engagement verfolgt:
„Klar verbessert eine Reform natürlich (!) unsere Chancen, Mitglieder zu werben. Dieses Motiv spielt für uns bei der Reform eine Rolle.“
Natürlich! Das will sie sein, die deutsche Gewerkschaft: Korporation von Staats wegen; anerkannt und berechtigt als eine vom betrieblichen wie öffentlichen Wohl nicht wegzudenkende konstruktive gesellschaftliche Kraft; eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, quasi; mit beinahe automatischer Mitgliedschaft derer, die sich nach Recht und Gesetz von einem Betriebsrat vertreten lassen. Das – wenn schon sonst nichts – brächte ihr die Mitglieder, deren Schwund in ihrer Kartei durch die übrig gebliebenen Leichen einfach nicht mehr zu kaschieren geht.
5.
Je näher der Termin der Beschlussfassung im Kabinett rückt, desto mehr eskaliert der Streit über die Novelle. Die Unternehmer rechnen aus den geplanten vermehrten Freistellungen astronomische Kosten hoch, sehen ihre Betriebsidylle durch subversive Kräfte „von außen“ unterwandert und führen sich auf, als sollten sie enteignet werden. Im Gegenzug bestehen die Gewerkschaften darauf, dass sich an den paar Neuerungen des Gesetzentwurfs das Schicksal der Arbeiterbewegung in Schröders neuem Deutschland entscheidet. Von „Unruhe in den Betrieben“ wird gemurmelt. Im Gegenzug wiederum gehen bayrische Jungunternehmer demonstrierend auf die Straße. Fast sieht es so aus, als würde der tiefe soziale Friede der Nation ausgerechnet an der Neufassung des Gesetzes zerbrechen, das ihn institutionalisiert – beinahe eine Ironie der Geschichte und doch auch wieder sehr logisch. Denn tatsächlich wissen sich Deutschlands Arbeitgeber so unangefochten in einer dermaßen starken, politisch in jeder Hinsicht anerkannten Position, dass für sie schon die bloße Tatsache eines Gesetzes über ihre innerbetrieblichen Verhältnisse den Tatbestand der Fremdbestimmung und „Überregulierung“ erfüllt; erst recht kommt ihnen jede Mark, die sie zahlen, jedes Gehör, das sie gewähren sollen, wie ein Raubmord an ihrer Zeit und ihrem Geld vor, auch wenn es sich in Wahrheit um Billigstpreise für einen Höchstertrag an sozialfriedlicher Gleichschaltung ihrer Betriebsbelegschaften handelt.
Irgendwann ist es dann so weit: Die Regierung greift ein; mit sinnreich verteilten Rollen macht sie die Klassenkampf-Farce zum kabinettsinternen Konflikt. Der Wirtschaftsminister repräsentiert eine gesittete Fassung der Unternehmerbedenken – „Der Arbeitsminister erhebt die Bürokratisierung zum Prinzip“ – und ergreift ohne Sorge vor Lobbyismus-Vorwürfen Partei: „Diesem Gesetz stimme ich nicht zu!“ Der Arbeitsminister lässt sich weder sein schönes Gesetz zerlegen noch sein Renommée als alter Gewerkschafter ankratzen. „Alles läuft auf ein Machtwort des Kanzlers hinaus“ – womit die öffentliche Aufmerksamkeit sich wieder einmal auf die eigentlich spannenden Fragen konzentriert: Wie entscheidet der Kanzler den Streit „mit Blick auf die kommenden Wahlen“? Kann er seine Regierungsmannschaft noch zusammenhalten? Hält diese Regierung? Ist sie überhaupt noch Herr der Lage?
Und siehe da: Sie ist es! Sie hält! Riester braucht nur wenig zu ändern, Müller weder zurückzutreten noch sein Gesicht zu verlieren, der Kanzler kein Machtwort zu sprechen. Und wie es aussieht, dürften sich sogar die kapitalistischen Klassenkämpfer gegen gewerkschaftsstaatliche Versklavung unschuldigen Eigentums irgendwann wieder abregen.