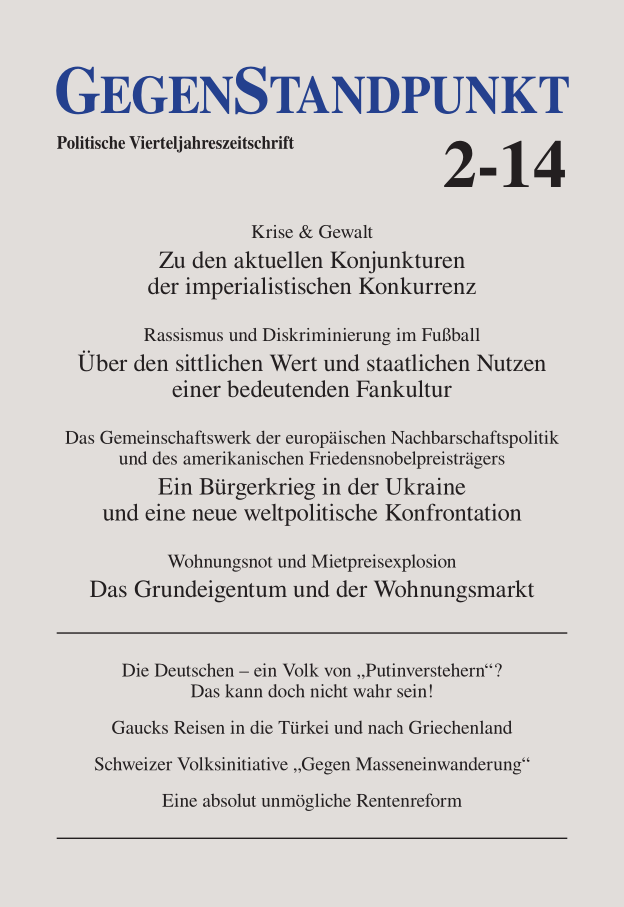„Euer Hass ist unser Stolz!“ – Rassismus und Diskriminierung im Fußball
Über den sittlichen Wert und staatlichen Nutzen einer bedeutenden Fankultur
Rassismus und Diskriminierung sind im Fußball zu Hause. In aller Öffentlichkeit „schwule Sau“ brüllen, Menschen mit dunkler Hautfarbe Bananen hinterherwerfen, Militanz gegen die Anhänger anderer Vereine – all das ist in den modernen Fußballstadien an der Tagesordnung. Die westlichen Zivilgesellschaften sind es sich allerdings auch schuldig, heutzutage in aller Deutlichkeit dagegen vorzugehen: Die UEFA platziert an prominenter Stelle im Fernsehen Spots gegen Rassismus ( „No to racism – Respect“); die Vereine werden offiziell in die Pflicht genommen, indem sie Fanbeauftragte finanzieren und mit zahllosen Fanprojekten („Unsere Kurve – kein Platz für Rassismus!“) erzieherisch tätig werden; und wenn verbale oder tätliche Übergriffe aktenkundig werden, sind Strafen fällig, auch für die Fußball-Vereine selbst, die von den Fußball-Verbänden für die Untaten ihres Anhangs haftbar gemacht werden.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
„Euer Hass ist unser Stolz!“ –
Rassismus und Diskriminierung im Fußball
Über den sittlichen Wert und
staatlichen Nutzen einer bedeutenden Fankultur
Rassismus und Diskriminierung sind im Fußball zu Hause. In aller Öffentlichkeit „schwule Sau“ brüllen, Menschen mit dunkler Hautfarbe Bananen hinterherwerfen, Militanz gegen die Anhänger anderer Vereine – all das ist in den modernen Fußballstadien an der Tagesordnung. Die westlichen Zivilgesellschaften sind es sich allerdings auch schuldig, heutzutage in aller Deutlichkeit dagegen vorzugehen: Die UEFA platziert an prominenter Stelle im Fernsehen Spots gegen Rassismus ( „No to racism – Respect“); die Vereine werden offiziell in die Pflicht genommen, indem sie Fanbeauftragte finanzieren und mit zahllosen Fanprojekten („Unsere Kurve – kein Platz für Rassismus!“) erzieherisch tätig werden; und wenn verbale oder tätliche Übergriffe aktenkundig werden, sind Strafen fällig, auch für die Fußball-Vereine selbst, die von den Fußball-Verbänden für die Untaten ihres Anhangs haftbar gemacht werden.
Der offizielle Antirassismus hat da jahrein jahraus eine Menge zu tun. Der Gedanke, dass die unschönen Vorfälle, die nie aussterben wollen, irgend etwas mit der ganzen Sphäre zu tun haben könnten, ist für alle Verantwortlichen in diesem Metier abwegig. Immer wenn mal in Sachen Rassismus etwas passiert, sind sich alle in einem einig und ganz sicher, dass das mit der eigentlich guten Sache Fußball nichts zu tun hat. Dann waren es sogenannte „Ausschreitungen“, also Exzesse von einigen „verrückten Gewaltbereiten“ oder rechtsradikalen Trittbrettfahrern, die das eigentlich harmlose Fanwesen in Verruf bringen. Offenbar gibt es da für die demokratischen Gesellschaften mit dieser unermüdlichen Erziehungsarbeit für Toleranz und gegen Rassismus etwas zu retten, was man an der Nationalsportart Fußball und der dazugehörigen Fankultur schätzt. Bleibt die Frage, warum ausgerechnet diese „Kultur“ dermaßen für die Übergänge in den Rassismus anfällig ist. Womöglich hat es doch etwas mit der Sache selbst zu tun, die man immerzu vor ihren Übertreibungen schützen will...
1. Der Fußballfan und seine Vereinskultur
Deutschland ist wie andere Länder auch „Fußballnation“, und das heißt nicht bloß, dass in diesem Lande in tausenden eingetragenen Vereinen landauf landab gekickt wird. „König Fußball“ hat sich auch in der Gunst des Publikums durchgesetzt und ist Zuschauersport Nummer 1, und das bedeutet für eine Sportart in heutigen Staaten einiges: Unter der regen Beteiligung der Öffentlichkeit wird aus einem Sportspiel die hypertrophe Sphäre einer Nationalsportart. An der ist alles bis zur kaputten Syndesmose eines Spielers interessant, darüber wird in einem medialen Dauerregen Tag und Nacht berichtet, und in der wird europa- und weltweit ein Bombengeschäft abgewickelt. Die Massen wollen es offenbar so, ohne deren interessierte Anteilnahme zu Hause vor den Bildschirmen oder eben vor Ort in den Stadien wäre das alles nichts. So aber betreiben die sportlichen Subjekte des Ganzen einen schönen Erfolgszirkel: Je erfolgreicher sich ein Verein und seine erste Mannschaft in der hierarchischen Konkurrenz von etwa einem Dutzend Ligen nach oben dribbelt, umso attraktiver wird der Verein für Fußballfans, die materiell und ideell für den weiteren sportlichen Erfolg mobilisiert werden. An der Spitze dieses aberwitzigen Unternehmens stehen Vereine, deren Mitgliederzahlen in die Größenordnungen mittlerer Großstädte vorstoßen, und deren Anhang im Stadion ist und bleibt gefragt als Basis und Kulisse des sportlichen und geschäftlichen Erfolgs, auf den sich das ganze Milliarden-Geschäft mit TV-Rechten und Werbung draufpflanzt.
Ein Genuss an der Konkurrenz …
Diese aktiven Fußballanhänger, wenn man es mal so paradox sagen will, die ins Stadion gehen und ihre Mannschaft ‚haben‘, haben sich zu einer Art Anhänglichkeit entschlossen, der das beschauliche Vergnügen – wenn man schon sonst nichts Besseres zu tun hat – , dem Ball und 22 Spielern 90 Minuten lang hinterherzuschauen und sich an dem mehr oder weniger ansehnlichen Kicken zu erfreuen, entschieden zu wenig ist. Sie wollen unbedingt mit ihrer Mannschaft gewinnen, von der Tribüne aus oder notfalls per Handy im Livestream.
Diese Begeisterung für die sportliche Auseinandersetzung um Ball und Tore ist schon eine besondere Art der Zuneigung. Nur mal die Daumen drücken für jemand, den man kennt auf dem Platz, das ist es ja nicht. Fußballfans, die etwas auf sich halten, suchen ihren Spaß ganz in der aktiven Parteilichkeit für eine Mannschaft. Mitfiebern und anfeuern für den Sieg, das bereitet ihnen Vergnügen. Als Zuschauer an einem Kampf teilhaben, in dem Kraft, Geschick, taktische Disziplin und, das vor allem, Willenshärte gefragt sind und wo speziell diese letztere Kampfestugend Nr. 1 nicht nur gefragt, sondern nach allgemeiner Überzeugung mehr als alles andere entscheidend ist: Das wollen Fußballfans in ihrer Freizeit erleben und als gar nicht stille Teilhaber mal so richtig ungebremst ausleben. Als ob es ihnen in ihrem Alltag ausgerechnet an „Lebenskampf“ fehlen würde! Aber das ist es offenbar gerade: Durchsetzungsfähigkeit, diese abstrakte Fähigkeit aller Fähigkeiten, die ist in ihrem Alltag nicht weniger vonnöten als auf dem Fußballplatz. Nur sind die Siege, die der Normalmensch damit zu erzielen vermag, in aller Regel nicht nur klein, sondern rar und fad und nie von der Art, dass Aufwand und Ertrag in einem erkennbar lohnenden Verhältnis stehen. Sei es am Arbeitsplatz, sei es auf dem Arbeitsamt: Die Erwartung, die der modernen Menschheit auf ihren Lebensweg mitgegeben wird, dass Leistung sich auszahlt, blamiert sich regelmäßig an der Tatsache, dass in Wahrheit von anderen Instanzen als vom gutwilligen Fußvolk und im Sinne anderer Interessen als zu dessen Nutzen über geforderte Leistung, verdienten Lohn und die Lebenskarriere überhaupt befunden wird. Konkurrenzanstrengungen werden unablässig verlangt; der Normalmensch verlangt sie sich auch ab; doch die Ergebnisse reichen an das Erfolgsversprechen, an das man glaubt und unverwüstlich glauben soll, nie wirklich heran. Doch was nicht ist, lässt sich immerhin fingieren – dafür hat der Mensch ja seine Freizeit und dort die Freiheit, wenigstens in seiner tätigen Phantasie und wenigstens im Prinzip die Rechnung zwischen Aufwand und Ertrag aufgehen zu lassen, die im bürgerlichen Leben notorisch offenbleibt, und den gerechten Lohn für bewiesene Willensstärke einzukassieren, der tatsächlich ein bloßes Ideal bleibt. Dafür braucht man sich heutzutage noch nicht einmal selber groß was auszudenken: Angebote für den doofen Genuss, in der Sphäre des Belanglosen Konkurrenzerfolge einzusammeln, gibt es mehr als genug. Der Fußballfan findet sich bedient durch einen echten Mannschaftskampf, den nicht er selbst austrägt, an dessen Austragung er aber Anteil nimmt, als ginge es um ihn: um seinen Willenseinsatz, sein Durchhaltevermögen und als Lohn dafür um seinen Sieg. Jenseits der unbefriedigenden Härten des Alltags winkt da die Chance auf einen Einsatz, der sich in einem eindeutigen Sieg auszahlt; und das in einer Sphäre jenseits der Benimmregeln, die das reale bürgerliche Leben normieren, nämlich den anständigen Menschen darauf festlegen, Konkurrenzniederlagen auch dann wegzustecken, wenn er sie für furchtbar ungerecht hält, und auch die Erbitterung herunterzuschlucken, mit der bürgerliche Persönlichkeiten ihre Enttäuschungen zu quittieren pflegen, um anschließend im Sinne derselben Täuschungen weiterzumachen. Im Fanatismus der Parteinahme für eine Kicker-Mannschaft wird der Kampf um gerechten Erfolg delegiert, um in der Vorstellung auf dem Wege lebhaften Mitfieberns ungehemmt geführt zu werden, durch Niederlagen und Siege hindurch: So funktioniert hier Konkurrenz als Freizeitvergnügen.
… in einer echten Gemeinschaft
So richtig genießen wollen Fußball-Anhänger ihre große Leidenschaft für den richtigen Kampfgeist mit Gleichgesinnten, als Mitglied einer verschworenen Gemeinschaft, die wie Pech und Schwefel zusammenhält. Den Verein dafür müssen sie nicht lange suchen. Üblicherweise werden sie in dem Vereinsheim fündig, das sich in ihrem heimatlichen Umfeld befindet und einem anderen Bedürfnis des Normalsterblichen sehr entgegenkommt. ‚Auf Schalke‘, an der Hafenstraße oder am Millerntor finden lokalpatriotisch gesinnte Menschen den lebendigen Stoff vor, an dem sich ihr Vergnügen am Ausleben eines sportlichen Kampfs mit der Liebe zur Heimat trifft. Diese edle bürgerliche Tugend praktizieren sie: Sie nehmen den heimatlichen Ort inklusive seiner darin ansässigen Menschen insgesamt als urwüchsige Gemeinschaft aller Einheimischen, so dass das Stadtviertel, die Stadt oder Region, in die es einen hinverschlagen hat, als mein Gelsenkirchen, Essen oder St. Pauli moralisch hochgehalten wird. Lokalpatrioten leiten aus ihrer Befangenheit im gewohnten Lebens- und Arbeitsumfeld eine wichtige Identität ihrer Persönlichkeit ab.
Dabei sprechen die kapitalistischen Metropolen, in denen die großen Vereine beheimatet sind, in ihrem marktwirtschaftlich-sozialen Leben eine etwas andere Sprache als die eines harmonisch-idyllischen Gemeinschaftswerks. Hier sind die Bürger mit den ihr materielles Leben bestimmenden Gegensätzen einer staatlich geordneten Klassengesellschaft konfrontiert, die sie nicht austragen und schon gleich nicht erledigen wollen. Sie wollen mit ihnen zurechtkommen, darin Erfolg haben, und das nach Maßgabe der Rechtsordnung, wie sie eben „bei uns“ gilt. Auf diesem Weg erklären heimatverbundene Menschen die harten Seiten ihrer Lebenswirklichkeit zu einem ‚Zwar‘, dem ein mindestens gleichgewichtiges ‚Aber‘ gegenübersteht, nämlich in Gestalt der Vorstellung, dass das ihre ureigene Ordnung ist, die ihre grundsätzlich positive Einstellung jenseits aller trüben Erfahrungen damit verdient. Diese Abstraktionsleistung, mit der Bürger in der Konkurrenzgesellschaft heimisch werden, sucht sich Anhaltspunkte und Gelegenheiten; Menschen mit Neigung zum Fußball werden dahingehend unter Umständen in ihrem Verein fündig und nehmen dessen fix und fertig vorliegendes Angebot wahr, dem Leben zu verleihen, was ein Verein als „Heimvorteil“ schätzt – eine parteiische Kulisse von Lokalpatrioten. Die für ihre Ausschreitungen berüchtigten Lokalderbys legen beredtes Zeugnis ab von dieser gutbürgerlichen Lebensart, in der oft schon an der Grenze des Stadtviertels die Parteilichkeit für den eigenen Haufen umschlägt in Neid, Missgunst und Konkurrenzfeindschaft gegen die anderen.
… mit Tugenden, Rechten und Pflichten
Für den Fußballfan, diesen lokalpatriotisch eingefärbten und aufgestachelten Konkurrenzgeist, wird mit tausenden anderen Gleichgesinnten im Stadion ein doppelter Traum wahr: Erstens haben sie frei und die Mühen ihres Alltags hinter sich gelassen, und zweitens geht jetzt ihr Lieblingsspiel Fußball los, wie sie es wollen: jetzt sind sie mal gefragt, als Aktivisten des Vereins legen sie sich ins Zeug für den Sieg der eigenen Mannschaft und praktizieren kämpferische Parteilichkeit. Darin genießen die Fans die Tugend, die ihr Verein vielleicht sogar im Namen trägt und die sie sonst bei ihren Zeitgenossen immerzu vermissen: die Eintracht der Mitglieder für das gemeinsame Ziel, über das es hier wirklich keinen Dissens gibt. Offenbar ein großes Vergnügen für Leute, die diese Tugend im Alltag eher immer einklagen müssen oder als Anspruch der anderen gegen sie erleben, als Anspruch auf Selbstbeschränkung und anständiges Benehmen und Zurückhaltung in Betrieb oder Familie. Hier, im Spiel, triumphiert die Einigkeit des Kollektivs über ein anderes, steht die ganze Gemeinde wie ein Mann hinter der Mannschaft und der Gemeinsinn lebt als kämpferische Tugend.
Deren einziger Inhalt und Zweck bleibt zwar der erbärmliche parteiliche Fanatismus für „uns“, aber der wächst sich beim wahren Vereinsanhänger zum vielleicht wichtigsten Teil seiner Lebenspraxis und Persönlichkeit aus, so dass am Ende der Spielplan der eigenen Mannschaft über Glück und Unglück mehr entscheidet als der Schichtplan am Arbeitsplatz. Fans richten sich Altäre mit „ihren“ Spielern ein, kleiden sich mit Schals und Trikot, gehen vielleicht in den Farben ihres Vereins zu Bett und geben damit zu erkennen, dass sie als Individuum vollkommen in der Parteilichkeit für den Verein, der nun ganz der ihre ist, verschwinden, also aufgehen wollen. Was im Militär mit Uniform und Zapfenstreich erzwungen wird, in der Religion das Ritual der Gläubigen ist, das treiben moderne Fans mit ihrem nicht unerheblichen zeitlichen und materiellen Aufwand als Freizeitvergnügen: Sie inszenieren sich als Mitglieder eines Kollektivs, von dem sie sich ihr Verhalten und Aussehen, ihren Lebensrhythmus und ihre Gesinnung dermaßen vorgeben lassen, bis sie sich selbst als eine Art eigener Menschenschlag begreifen, der sich von allen anderen ganz grundsätzlich unterscheidet: „Bin kein Mensch und bin kein Tier, bin ein Fan von S 04 ...“
Die andere Seite dieses genussvollen Zusammenschlusses mit einer Art frei gewählter Schicksalsgemeinschaft ist die Anspruchshaltung, mit der Vereinsanhänger für ihre Borussia oder Eintracht bedingungslosen Respekt und Anerkennung verlangen. Mit der Gewissheit, in ihrem Verein eine unwiderstehliche Gemeinschaft im Rücken zu haben, legen sie ein eher angsteinflößendes Selbstbewusstsein an den Tag, dem spätestens die nächste Mannschaft und deren Anhang massiv in die Quere kommen. Das offensive Auftreten von Fans vor, während und nach dem Spiel lebt erkennbar von deren angemaßtem Rechtsanspruch auf Sieg, den ihnen ihr gemeinsames „Wir“ verleiht: Die Fans reklamieren allen Ernstes in der sportlichen Auseinandersetzung ein klares Recht auf Erfolg, das durch die Anwesenheit der anderen Mannschaft etwas verkompliziert wird. Hier entscheidet sich weit mehr als ein paar verschossene oder getroffene Tore. Siege geraten zum Triumph über die anderen, werden zelebriert als Beweis der Überlegenheit des eigenen Haufens, und die Spieler werden als Helden verehrt, denen die Fans in der Siegeslaune großmütig ihre Millionengehälter gönnen.
Niederlagen sind dementsprechend tief gefühlte Blamagen, die man nicht auf sich und dem Verein sitzen lassen kann, weshalb die Gewaltfrage im Fußball dauernd auf dem Tisch ist, das Recht selbst in die Hand genommen wird und die Konkurrenz auf dem Rasen inner- und außerhalb der Stadien mit handgreiflichen Mitteln fortgesetzt wird. Gerade in den schweren Zeiten von Niederlagen und Abstieg(-sgefahr) bewährt sich eine große Tugend des wahren Fans: Mit seiner Treue gegenüber dem Verein wähnt er sich unverzichtbar für den unerschütterlichen Zusammenhalt und damit den sportlichen Erfolg. Er amtiert als ideeller Sittenwächter und fahndet im Kollektiv nach Schuldigen für den Misserfolg: Der Wechsel von Vereinssöldnern, die mal wieder „nur“ ihre Karriere und ihren Marktwert im Auge haben, grenzt an Vaterlandsverrat; Spieler haben vor dem Anhang auf den Tribünen eine moralische Bringschuld und geraten in den Verdacht, nicht alles gegeben und deshalb das Geld nicht verdient zu haben, das sie verdienen; der Ruf nach einer besseren Führung des Vereins wird laut.
Lächerlich macht sich mit dieser Tugendpraxis keine einzige Fangemeinschaft. Neben dem Lohn des Siegs – falls er denn errungen wird – finden die Anhänger die öffentliche Anerkennung, die sie suchen: Noch im Stadion zum Spielende erhalten sie den Beifall der Spieler, die darauf getrimmt werden, als Elite von oben her dem Fußvolk dessen ideellen Zusammenschluss mit der Mannschaft demonstrativ zu bestätigen. Ihr Verein selbst, heute oft genug eine moderne Aktiengesellschaft, stiftet den Stoff, der seinen Anhängern wichtig ist: Er lässt für den Personenkult um die Spieler die jeweils angesagten Devotionalien produzieren und macht mit deren Verkauf unter den Fans ein Bombengeschäft. Damit nimmt der Verein nicht nur das Geld seiner Mitglieder als bleibende materielle Grundlage seines Erfolgs in Beschlag, sondern er setzt damit das in die Welt, was unter Idealisten des Sports gelegentlich als „Kommerzialisierung des Sports“ bedauert wird. Dabei wächst mit dieser milliardenschweren Sphäre, welche die großen, potenten Vereine im Zusammenwirken mit Verbänden, Sponsoren und Ausrüstern schaffen, genau das marktwirtschaftliche Angebot heran, welches das moralische Bedürfnis der Fans bedient und erst zur bedeutenden, gesellschaftlich anerkannten „Fankultur Fußball“ heranreifen lässt. Der nach allen Regeln des großen Geschäfts gefütterte und aufgeblasene Kult um Verein, Spieler und Mitglieder fällt dann nach dem Dafürhalten etwas gebildeterer Beobachter in seiner Rohheit ziemlich proletenmäßig aus. An den politökonomischen Status einer Klasse, die für Lohn arbeiten muss, denkt dabei allerdings niemand mehr. Die Massen, die den Kult begeistert mitmachen, tun es ja auch nicht – sie haben ihre proletarische Identität in der Abstraktion von ihrer gemeinsamen materiellen Lage gefunden: in einer Teilhabe an einem ideellen Triumph, in dem ihnen wildfremde Tribünennachbarn, erfolgshungrige Vereinsmanager und Spielermillionäre allemal viel näher sind als etwa ihre Arbeitskollegen, zumal wenn die dem falschen Fußballverein angehören.
… gerade so wie ein kleines Volk im Großen: selbstgerecht und rassistisch
Fußballfans sind wirklich gut: Wenn sie schon mal frei haben und jenseits der Pflichten des Alltags ein Interesse ins Auge fassen, dann fällt ihnen nichts Besseres ein, als eine ‚Gemeinsamkeit‘ zu praktizieren, in der schon wieder die einschlägigen Modalverben den Takt bestimmen: Was darf, was muss ich und vor allem jedes andere Mitglied tun, damit „unsere“ Gemeinschaft und ihr fragloses Recht auf Erfolg sich durchsetzt? Sie fingieren eine freiwillige Unterordnung unter ein Kollektiv, das ihnen einen ganzen Katalog von Ritualen, Pflichten und Schuldigkeiten der Mitglieder untereinander vorgibt, zu dem sie sich begeistert und demonstrativ als ihrem Schicksal bekennen. So stilisieren sie ihre Anhänglichkeit an eine Mannschaft glatt zu einer Art auserwählter Gemeinschaft, einem einzig wahren Kollektiv, dem sie in der kämpferischen Auseinandersetzung dienen wollen und müssen. Da, im Kampf gegen andere, wird die eigene Gemeinschaft nämlich überhaupt erst so richtig fühlbar, und das macht für Fans dann auch den Reiz am Spiel um Tore aus: Sie nehmen es als Selbstbehauptung der eigenen Schicksalsgemeinschaft, deren Ehre sie sich zum ganz persönlichen Anliegen machen. Jubel oder Niedergeschlagenheit des Menschen ist komplett das Derivat davon, wie die eigene Gemeinschaft in der Konkurrenz gegen die andern dasteht.
Mit dieser schönen Freizeitbeschäftigung freier Menschen ist die Einstellung fix und fertig, welche notorisch die unschönen Praktiken hervorbringt, die unter Umständen von offizieller Seite als Rassismus gegeißelt werden. Fans sind eben der festen Überzeugung, einem ehrenwerten Kollektiv anzugehören, das die moralische Gesinnung all seiner Mitglieder eint und von daher alle anderen prinzipiell ausgrenzt. Die offiziell geächteten Hässlichkeiten im Fußball dann mit Appellen zu mehr Toleranz, mit bunten TV-Bildern zu bekämpfen, in denen mit dem Trikottausch Aussehen und Hautfarbe der Person wechseln, geht an der Sache vorbei. Über die Hautfarbe als Merkmal der scharfen Abgrenzung von „uns“ gegen die andern sind moderne Fans im globalisierten Fußballgeschäft nämlich oft hinaus. Wenn es mal einen dunkelhäutigen Österreicher von der Westküste Afrikas in die eigene Mannschaft verschlägt, ist auch der recht – wenn er Tore schießt oder verhindert, gehört er echt zu „uns“. Als „Rasse“-Merkmal reicht heute die eigene Vereinsfahne, die die Zugehörigkeit zur richtigen Gemeinschaft symbolisiert...
2. Die höhere Weihe der Fankultur: Fußball als gelebter Nationalismus
Dass auf diese Weise ein „Wir“ Konturen annimmt, das wie ein Volk alle Insignien einer Sittengemeinschaft trägt, dass sich der Fußball-Fan also zu seinem Verein wie der Staatsbürger aus patriotischem Anlass zu seinem Vaterland verhält, das muss keiner von ihnen wissen. In ihrem Bewusstsein sind die amtlichen Vertreter der Staatsgewalt entweder blöde Bürokraten, die mit ihren restriktiven Sicherheitskonzepten die ganze gute Stimmung im Stadion kaputtmachen, oder die „Bullenschweine“, die ihnen im Ausleben ihrer Vereinstreue in die Quere kommen und sie zu einer ebenso bedeutenden Schlacht herausfordern wie die gegnerischen Anhänger.
Die wirklichen oder eingebildeten Volkserzieher, die sich um zivilisiertere Fans bemühen und deren Rassismus bekämpfen, wissen schon, was Staat und Gesellschaft an dem allwöchentlichen Zirkus haben. Wenn sie an die Millionen Fans denken und auf das marktwirtschaftliche Elend der Lebensverhältnisse vieler unter ihnen in Gelsenkirchen oder Liverpool deuten, ist das selbstverständlich nicht der Auftakt einer Kritik dieser Verhältnisse, sondern sie entdecken an der Fangesinnung eine nützliche Funktion: „Immerhin“ hätten die Menschen in ihrem Verein eine „Identität“, wenn sie schon sonst nichts haben, und die sei positiv, weil die entsprechenden Leute ihre Armut angeblich besser aushalten, wenn sie in der Anhänglichkeit an Idole und Vereine einen Lebensinhalt gefunden haben, von dem sie zwar nicht leben können, der aber dem sozialen Frieden in „unseren“ Gesellschaften dient. Dabei haben Demokraten in der Rede von „Brot und Spielen“ durchaus ein kritisches Bewusstsein von dem Zusammenhang zwischen der Begeisterung für solche Spektakel, gesellschaftlicher Massenarmut und bürgerlicher Fügsamkeit – bei anderen Gemeinwesen, versteht sich. Da sprechen „circenses“ eher gegen die politischen Herren: weit früher in der Antike und heute bei tendenziell undemokratischen Herrschern, die es nötig haben, sich der Loyalität ihrer Massen auf diese etwas schäbige Art zu vergewissern...
Die Staatsgewalt selbst sorgt auf ihre Weise dafür, dass das Volksvergnügen Nr. 1 in diesem Sinne voll in Ordnung geht: Stadien werden nach staatlichen Richtlinien zu Hochsicherheitstrakten ausgebaut, einmal die Woche findet in zig Städten ein generalstabsmäßig geplanter Aufmarsch der Polizei statt, damit das öffentliche Leben halbwegs unbeschadet davonkommt, wenn Innenstädte im Griff der Fußballfans sind. Was sie in anderen Fällen – politischen Demonstrationen usw. – als nicht zu duldende Störung der öffentlichen Ordnung, unter Umständen als Angriff auf ihr Gewaltmonopol bewertet und dementsprechend verbietet und unterbindet, genehmigt die Staatsgewalt ausdrücklich als Teil ihres inneren Lebens und trägt mit erheblichem polizeilichem und zivilem Aufwand zum Gelingen der Angelegenheit bei.
Und nicht nur das. Die Sache Fußball ist mit 34 Spieltagen, zahlreichen Pokalrunden, Champions- und Europa-League noch nicht ausgestanden. Die Staaten selbst leisten sich den sonderbaren Scherz, neben ihren politökonomischen Affären auch noch als Fußball-Mannschaften gegeneinander anzutreten, wo es weder Macht zu gewinnen gibt noch Geld. Ganz im Unterschied zu den privaten Vereinen, deren Daseinszweck in der sportlichen Konkurrenz und dem damit verbundenen Geschäft besteht, ist Fußball bei den politischen Herrschaften tatsächlich Nebensache – der unbefangene Spaß an Spiel und Sport kehrt deshalb aber nicht zurück, im Gegenteil. Die Staaten nehmen die einschlägigen Turniere bitterernst und lassen auch mal Milliarden für die besondere Ehre springen, sie ausrichten zu dürfen. Die Staaten präsentieren sich als Sportnationen, weil sie mit der Leistungsfähigkeit ihres Volkes resp. dessen sportlicher Elite Eindruck machen wollen. Die staatliche Angeberei mit der Ehre des Erfolgs bei EM oder WM ist in erster Linie auf ihr eigenes Volk gemünzt und in zweiter auf die vielen fremden Völker in der Welt. Das ideologische Angebot, die eigene Nation unter diesem höheren Gesichtspunkt ihrer sportlichen Tüchtigkeit zu würdigen, hat bei allen Fußball-Völkern leider grandios eingeschlagen. Untereinander pflegen sie das „völkerverbindende Element“ ihrer Sportart, indem sie sich wechselseitig missgünstig bis herablassend, je nach internationalem Tabellenplatz ihrer Nation, beurteilen. Nach innen nimmt zu den Zeiten der großen internationalen Meisterschaften die Anteilnahme des Volkes am Schicksal der eigenen Mannschaft Formen an, als habe sich die Reihenfolge von Haupt- und Nebensache eines modernen kapitalistischen Staates umgedreht: Eifersüchtig wachen die Öffentlichkeit und das von ihr bediente Volk Tag und Nacht darüber, dass alles Richtige dafür getan wird, dass „wir“ gewinnen, „uns“ der Sieg nicht gestohlen wird, den „wir“ eigentlich verdienen. Die wirklichen oder angemaßten Fußball-Experten der Nation wissen dann schon genau, welcher internationale Tabellenplatz „uns“ gebührt. Die Mannschaft und ihr Trainerstab werden an diesem Anspruchsniveau gemessen, und eine ansehnliche Art des Spielens reicht da einem deutschen Publikum nicht; nach 24 Jahren ohne Titel bei Weltmeisterschaften ist der Turniersieg 2014 einfach fällig.
Dieses verlogene Theater der Staaten, sich als Fußball-Nationen zu inszenieren, und sein starkes Echo bei Öffentlichkeit und fußballbegeistertem Volk ist in seinem heutigen Umfang und seiner Bedeutung zur herausragenden Materie für die Idealisierung der staatlichen Ordnung geworden, die auf ein grundverkehrtes staatsbürgerliches Bedürfnis trifft. Wer an einem Länderspieltag seiner Mannschaft mit elf Auswahlspielern die Daumen drückt, begeistert sich nicht für die Merkel-Regierung oder die politischen Institutionen, also die ausführende staatliche Ordnungsgewalt, die ihm die restlichen 364 Tage des Jahres eben die Verhältnisse einbrockt, die dem Bürger übers ganze Jahr die Nöte mit seinem ganzen materiellen Leben einbringen. Genießen und frenetisch bejubeln lässt sich das nicht, darüber schimpfen die Menschen das ganze Jahr, haben ihre mehr oder weniger schlechte Meinung, freilich auf die eigentümliche Art, dass daraus nie etwas folgt. Aber alle schlechten Erfahrungen, die ganze Nörgelei kann der Begeisterung für das Deutschland, das sie gerade im Stadion oder vor dem Fernseher anfeuern, nichts anhaben, weil sie ihre täglich erlebte Unzufriedenheit mit dem Staat, für den sie Steuern zahlen, in dem sie Arbeitslosigkeit oder Altersarmut erleben, von dem ganz grundsätzlich positiven Bezug ihres Willens auf dasselbe Gemeinwesen abtrennen. Der heißt dann: meine Nation – das Kürzel dafür, wie die Bürger eines Staates alle Schwierigkeiten, im Leben zurechtzukommen, ignorieren und unerbittlich daran festhalten, dass sie alle, das Volk, und ihr Staat eine unverbrüchliche Einheit sind: ein Zusammenschluss sehr fundamentaler Art, nicht weiter der Begründung bedürftig, von keiner Schikane eines Sozialamts oder Arbeitgebers zu erschüttern.
Erste Adresse der Länderspiele sind die Fußball-Fans, deren Freizeitpraxis hier die höhere Weihe erhält: Jetzt sind sie mal als nationale Experten gefragt, EM und WM – das ist ihre nationale Frage, in der sie ihr im Vereinsleben erworbenes Expertentum einbringen können. Sorge, Kritik, Jubel und Trauer, das ganze Spektrum ihrer distanzlosen Anhänglichkeit gilt jetzt der wirklichen politischen Gewalt, oder besser gesagt: dem eben, was im Stadion in der Vorstellung der Fans davon übrig ist: „Wir“ gegen die andern im Kampf um den Sieg, und dieses „Wir“ ist das wichtigste Kollektiv, die gültige Klammer von „uns“ allen: die eigene Nation.
Umgekehrt sind die Auftritte der Nationalmannschaft, spätestens wenn es um internationale Titel geht, auch ein Angebot für das ganze Volk. Das muss man selbst als Deutscher, also als Angehöriger einer anspruchsvollen Fußballnation, nicht unbedingt annehmen. Die Abstraktion von den wirklichen Zwecken und harten Gegensätzen im staatlichen Leben, mit der die Bürger ein inniges Verhältnis zu ihrer Nation als ehrenwertem sittlichen Kollektiv gewinnen, geht auch mit Kunst, Sprache und Kultur deutscher Provenienz oder wie auch immer. Aber eines muss man der Nationalsportart Fußball und der Fankultur darum herum lassen. Sie hat gewaltigen Erfolg. Zahllose stinknormale Staatsbürger, auch solche, die ihre Anhänglichkeit zur Nation sonst als gebildete Attitüde pflegen, werden als Deutsche Fußballfans und erleben im Spiel der Nationalmannschaft das Höchste der Gefühle. Dementsprechend sieht das dann aus: Die findige nationale Geschäftswelt weiß, was für ein Volk sie da vor sich hat, und legt punktgenau die dafür passenden Waren auf Lager, so dass jedermann sein ganz persönliches Bekenntnis zu seiner Nation als uniformen Fimmel der Persönlichkeit ausleben kann: Schminke, Fahne am Balkon oder Autorückspiegel in Schwarz-Rot-Gold. Die staatliche Verwaltung spendiert Ausnahmen von der ansonsten verordneten Nachtruhe sowie den öffentlichen Raum, wo sich das ganze Volk in den Armen liegen kann, sozusagen zur sportlichen Neugründung der ganzen Nation im public viewing.
Angesichts dessen, wie das Volk und die Öffentlichkeit für den Erfolgsanspruch ihres Landes durchdrehen, üben sich die wirklichen nationalen Führer vergleichsweise in vornehmer Zurückhaltung. Die wissen in der nüchternen Kalkulation der staatlichen Zwecke schon noch, wo sich Wohl und Wehe ihres Staates wirklich entscheiden; und Politikern wie der deutschen Kanzlerin wird in einem Fußballturnier das Wort von der Ehre der Nation eher nicht entfahren. Wenn es zur aktuellen politischen Lage passt, machen sie allerdings sehr deutlich, wofür Sport im Allgemeinen und Fußball im Speziellen auch taugen, wenn ihn die Staaten zu ihrer Sache gemacht haben: Sie bauen ihn in ihre wirklichen politischen Affären als Gegenstand ihrer Diplomatie ein: Ob Deutschland und seine Partner dem russischen Staat die Ehre der Ausrichtung der WM 2018 noch zuerkennen wollen, steht mit der aktuellen weltpolitischen Auseinandersetzung um die Ukraine unter Umständen schwer in Frage...
Auf der anderen Seite lassen sich die demokratischen Herrschaften – die wahren Profiteure des internationalen Fußballwesens und der sich daran anheftenden nationalen Massenbegeisterung – diese sittlich wertvolle Begeisterung nationaler Fußball-Fans für ihren Staat, in der die praktischen Verpflichtungen der Bürger durch ihre Politiker zumindest gefühlt ganz weit weg sind, verständlicherweise nur selten entgehen. Deren Fehler, sich an der trostreichen ideellen Teilhabe an einem kollektiven Unternehmen zu berauschen, machen sie demonstrativ mit. Auf der Tribüne machen sie sich als Fußball-Fans mit ihrem Volk gemein und leben so die Lüge vor, dass die Einheit von Bürger und Politiker in der privaten Begeisterung für die gleiche Sache, die Leidenschaft für den Fußball, zweifelsfrei bewiesen wäre. Sobald die Spiele vorüber sind, machen die Politiker von der Solidarität des Volkes dann wieder auf ihre Art Gebrauch: Sie spannen ihre Bürger materiell für das Staatsprogramm ein, verlangen Gehorsam gegenüber der inneren Rechtsordnung und die allzeit bereite Gesinnung, für die Rechte der Nation gegenüber dem Rest der Welt praktisch einzustehen.
Kein Wunder daher, dass mit Blick auf den massenhaften Genuss am weltweit verbreiteten Nationalsport eindringlich vor dem Überhang zu manifestem Rassismus gewarnt werden muss. Er liegt ja so nahe, wird nicht bloß herausgefordert, sondern regelrecht kultiviert: der Wahn, als Angehöriger einer Nation, die etwas Unverwechselbares und unbedingt Wertvolles auf der Welt darstellt und dies auf dem Feld der Ehre, die jedermanns patriotisches Gefühlsleben in Anspruch nimmt, mit allen Mitteln unter Beweis stellt, zu einem ganz ausgezeichneten Menschenschlag zu gehören – dass Zugehörigkeit zu einer Nation im Alltag kein Zuckerschlecken ist, kann da den Standpunkt, auf deren Großartigkeit ein ganz persönliches und ganz starkes Anrecht zu haben, nur befeuern. Und wenn mit der Begeisterung für den sportlichen Erfolg des eigenen Kollektivs die Lizenz verbunden ist, sich über die Forderungen sittsamen Betragens im Alltag hinwegzusetzen und hemmungslos parteilich zu sein; wenn dazu Institutionen wie das öffentlich-rechtliche Fernsehen nicht bloß den Personenkult um nationale Repräsentanten pflegen, sondern Gefühlsausbrüche des Publikums von der widerlichsten Art wohlwollend ins Bild und damit moralisch ins Recht setzen: dann gibt es für den angestachelten Nationalstolz erst einmal alle Freiheiten, sich so aggressiv in Szene zu setzen und zu betätigen, wie der kundige Fußballfan es von der Mannschaft seiner Wahl erwartet, und sich dafür seine Kampfplätze zu suchen. Dann findet der Patriot auch Gelegenheiten genug, mit seinen Gehässigkeiten gegen unterlegene und vor allem gegen nicht pflichtschuldigst unterlegene Gegner den Beweis anzutreten, dass moderner Rassismus keine Frage der Rasse, sondern eine Frucht des gereizten nationalen Rechtsbewusstseins ist. Vom Gebrauch dieser Geisteshaltung haben freilich exaltierte Fans und die wirklichen Herren und Größen der Sportnation etwas unterschiedliche Vorstellungen. Für die Letzteren ist es schon wichtig, dass der Einsatz der nationalen Fanclubs auf dem Feld der sportlichen Ehre nicht in Respektlosigkeiten gegen die Gegner umschlägt, die das gute Image, das die Nation abgeben will, beschädigen und im Extremfall darauf hinauslaufen, dass man mit denen nicht mehr spielen mag bzw. die nicht mehr mitspielen mögen. So kommen die Verantwortlichen nicht um den Widerspruch herum, die Konsequenzen der Begeisterung zu bremsen, die sie wachrufen und bedienen und derer sie sich so gerne bedienen.
Aber man sieht’s ja: Der Widerspruch macht denen überhaupt nichts aus.