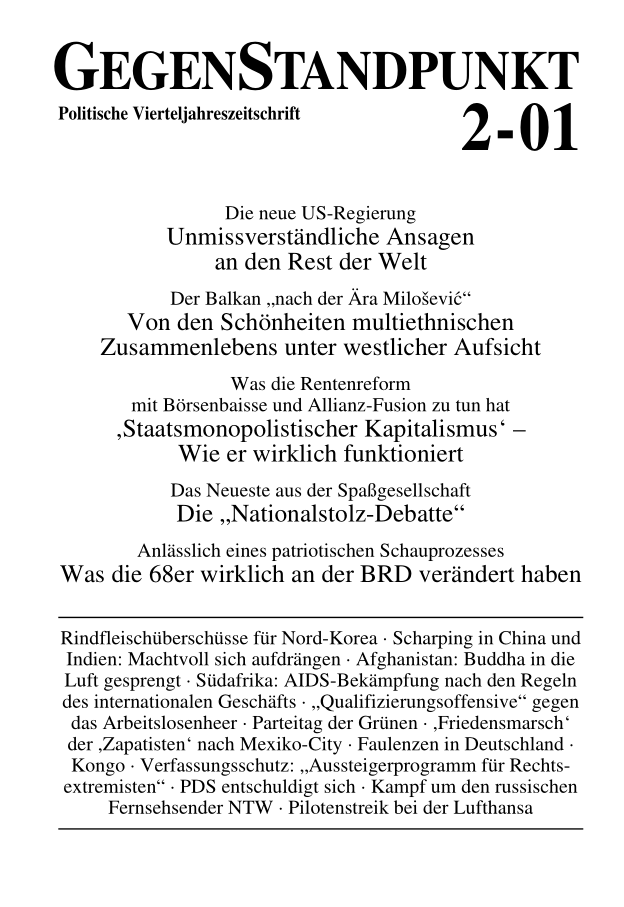Aus der Reihe „Chronik - kein Kommentar!“
Pharmakonzerne klagen gegen die Republik Südafrika:
Aidsbekämpfung nach den Regeln des internationalen Geschäfts
In Pretoria wollen 41 Pharmakonzerne gegen die RSA klagen, weil sie den Patentschutz missachten will, um an billige Aids-Medikamente zu kommen. Die UNO unterstützt das Anliegen der RSA, soweit es dieser nur um billige Medikamente gegen Aids von armen Negern geht. Zu viele Aidskranke bedrohen die Stabilität und damit die Funktionalität des Kontinents.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Pharmakonzerne klagen gegen die
Republik Südafrika:
Aidsbekämpfung nach den Regeln des
internationalen Geschäfts
1.
Vor dem Obersten Gerichtshof in Pretoria findet ein Prozess von 41 Pharmafirmen gegen die Republik Südafrika statt. Die Regierung hatte 1997 ein Gesetz verabschiedet, mit dem sie Zwangslizenzen und Parallelimporte zuließ, um Medikamente für Aidspatienten billiger anbieten zu können. Gegen dieses Gesetz klagt die Pharmaindustrie, weil sie in der Freigabe von Nachahmerpräparaten (sog. Generika) eine Verletzung ihrer Patentrechte sieht. Schließlich stellt sie ihre Heilmittel her, um Krankheiten nicht einfach zu bekämpfen, sondern um an der Krankheitsbekämpfung zu verdienen. Und da sind Seuchen, die eine zahlungsfähige, weil entsprechend krankenversicherte Kundschaft betreffen, ein wahrer Segen, nämlich eine optimale Geschäftsgelegenheit, die man sich nicht durch konkurrierende Billiganbieter kaputtmachen lässt. Auch dort nicht, wo geschäftlich nicht viel zu holen ist, weil es mangels „Massenkaufkraft“ auch im öffentlichen Gesundheitswesen an Finanzmitteln fehlt, wie in der RSA – vom restlichen Afrika ganz zu schweigen: Irgendetwas geht dort immer; und selbst wenn nichts geht, geht es doch um so mehr ums Prinzip – wo käme die globale Marktwirtschaft hin, wenn ihr Allerheiligstes, das Recht auf Eigentum und dessen profitliche Nutzung, auf irgendeinem Flecken des Globus ausgehebelt werden könnte! Dass den „Sachzwängen“ des Geschäfts flächendeckend rund um die Welt mit aller Macht Geltung verschafft werden muss, haben schließlich die politischen Machthaber, auf die es ankommt in der Welt, selber so festgesetzt und vereinbart: Nach den ehernen Grundregeln der WTO haben Patentrechte in allen Staaten zu gelten; ausschließende Eigentumsrechte haben noch im letzten Erdenwinkel, also auch im hinterletzten Sterbe-Hospiz respektiert zu werden.
Also gehen die betroffenen Pharma-Firmen gegen die Ausnahme vor, die die RSA sich gestattet hat. Mit den Rechtsmitteln, auf die die Staatsgewalt dieser Republik sich selbst verpflichtet hat – und mit der weltweit anerkannten Privatmacht ihrer marktbeherrschenden Stellung.
2.
Dennoch: Im Rechtsstreit der Pharma-Multis mit der Republik Südafrika findet der Standpunkt der Regierung in Pretoria viel Verständnis. Nicht nur die notorischen „Ärzte ohne Grenzen“ und Idealisten der Aids-Hilfe lehnen die „Geldgier“ der Arzneimittelhersteller ab und plädieren auf Klageabweisung zugunsten der Millionen Kranken, die zu den geforderten Preisen unmöglich versorgt werden können. Auch offizielle Instanzen, die in der marktwirtschaftlich geordneten Staatenwelt etwas gelten, die UNO z.B. und die Entwicklungshilfeministerien mancher bedeutender Nationen, mögen sich der Einsicht nicht verschließen, dass im Süden Afrikas Krankheit und Armut in so katastrophaler Weise zusammentreffen, dass die strikte Befolgung marktwirtschaftlicher Grundsätze hier eventuell doch nicht passend wäre – nicht bloß hartherzig, sondern glatt irgendwie kontraproduktiv.
Dieses Wohlwollen ist bemerkenswert, weil es die
passende, quasi komplementäre Ergänzung zu der weltweiten
Empörung darstellt, die sich dieselbe südafrikanische
Regierung, speziell: Staatspräsident Mbeki, vor einem
knappen Jahr auf der Welt-Aids-Konferenz in seinem Land
mit der Behauptung zugezogen hat, die
Immunschwäche-Epidemie wäre in der Tat nicht eigentlich
wegen der „Heimtücke“ des beteiligten Virus, sondern aus
Gründen der nationalen Armut zur flächendeckenden
Katastrophe geraten; ihre Bekämpfung hätte deswegen auch
letztlich bei den Ursachen der Verelendung Schwarzafrikas
anzusetzen. UNO-Diplomaten und Weltgesundheitsexperten
waren sich da sofort einig: Mit seinem Hinweis, dass
Aids, ebenso wie andere Infektionskrankheiten, die man
anderswo im Griff oder auf Einzelfälle reduziert hat, in
Afrika nur deswegen so massenhaft Kranke und Tote
produzieren, weil die Leute arm sind und Geld für
Vorsorge und Behandlung fehlt, wolle er vom Problem der
Aidsbekämpfung nur ablenken; in beinahe schon sträflich
unverantwortlicher Manier würde dieser inkompetente Laie
medizinische Fehldiagnosen in Umlauf bringen – und
gemeint hat die internationale Fachwelt für
Aidsbekämpfung damit selbstverständlich die absolut
deplazierte politische Stoßrichtung, die sie aus der
Wortmeldung des südafrikanischen Präsidenten damals
heraushörte. So stellen die beiden unterschiedlichen
Stellungnahmen zur südafrikanischen
Aids-Bekämpfungspolitik auf ihre Weise klar, welches
Vorgehen von den für den Weltmarkt des Kapitals
Verantwortlichen beim „Kampf gegen Aids“ für legitim und
welches für illegitim gehalten wird: Unbeliebt machen
sich Regierungen, die den Kampf gegen
Infektionskrankheiten mit der sozialen Lage verknüpfen,
die zu deren massenhafter Ausbreitung führt, und für
diese soziale Lage auch noch die weltweit durchgesetzten
kapitalistischen Geschäftsverhältnisse verantwortlich
machen. Wer, wie Mbeki, auch nur zur Sprache bringt, dass
ohne die Beseitigung der Armut auch die Gesundheit der
Leute nicht zu haben ist; wer sich dann auch noch an die
Spitze einer afrikanischen Initiative stellt, die sich um
Unterstützung beim Kampf gegen Aids u.a. durch
stärkere Investitionen aus dem Norden, Schuldenerlass und
erweiterten Marktzugang für Afrikas Exporte bemüht
(SADOCC, Southern Africa
Documentation and Cooperation Centre), der gilt
als Spinner, der die Existenz des Aidsvirus leugnen, und
als Gauner, der dem Westen unter humanitären Vorwänden
Geld aus der Tasche ziehen will. Von Seiten der
maßgeblichen Instanzen beharrt man eisern auf einer
sauberen Trennung: Die Kredit- und Handelsbeziehungen
sind das eine, Armut und Massenepidemien das andere,
beides in irgendeiner Weise miteinander in Verbindung zu
bringen, sehen die „Spielregeln“ des Imperialismus nicht
vor. An diese haben sich die Politiker Afrikas gefälligst
zu halten, also die Armut in ihren Ländern zu akzeptieren
und die landesweite Verbreitung von Infektionskrankheiten
als Folge menschlichen Fehlverhaltens angesichts einer
schicksalhaften Virusattacke zu begreifen. Dann – und nur
dann – kommt möglicherweise eine Ausnahme von der Regel
in Frage.
3.
Für deren Gewährung muss dann allerdings wirklich mehr
auf dem Spiel stehen als nur das Siechtum von ein paar
armen Leuten: Um auf maßgeblicher Seite wirklich zu
beeindrucken, muss das Elend der Neger schon Dimensionen
annehmen, die an einen nationalen Notstand
heranreichen. Und selbst dann kommt eine schlichte
Außerkraftsetzung der geltenden Geschäftsregeln
keinesfalls in Frage. Jede Menge Vorsicht ist bei einem
denkbaren Eingriff in die heiligen Grundsätze der
privaten Bereicherung geboten, und wenn er erwogen wird,
verdienen die Belange der Pharma-Industrie
selbstverständlich zuallererst Rücksichtnahme. Dabei
beten nicht bloß deren Anwälte und die journalistischen
Apologeten der Marktwirtschaft die Standard-Legitimation
für die dicken Profite im Arzneimittelgeschäft her – auch
die UNO lässt über Heilkräfte, die sich ausschließlich im
Zuge der geschäftlichen Ausnutzung eines Monopols
entfalten, nichts kommen: Kofi Annan stellte klar:
‚Die UNO unterstützt das Trips Abkommen (Das WTO-Abkommen
über den grenzüberschreitenden Schutz der Patente) voll.‘
Denn ‚der Schutz geistigen Eigentums ist der Schlüssel
zur Entwicklung neuer Medikamente, Impfstoffe und
Diagnoseprozesse.‘
(taz,
7.4.01) Berücksichtigenswert sind
selbstverständlich auch die marktpflegerischen
Gesichtspunkte, die den Kennern des internationalen
Geschäftslebens einschließlich seiner Tricks und
Schlichen augenblicklich einfallen, kaum denken sie
daran, Produktion und Vertrieb der erlesenen
pharmazeutischen Produkte könnten von einem afrikanischen
Staat in eigener Regie betrieben werden. Womöglich
versucht der dann mit Re-Importen sein Geschäft zu
machen, und versaut so den Pharma-Unternehmen nicht nur
in Schwarzafrika, sondern auch mit „schwarzen Märkten“
hierzulande ihr Geschäft. Das alles will sorgfältig
bedacht und abgewogen sein, weswegen der Antrag an die
Adresse der Unternehmen, bei allem gesunden Geschäftssinn
doch auch den nationalen Notstand mancher Länder
in Südafrika zu berücksichtigen, mit dem wohlmeinenden
Rat an die den Notstand verwaltenden Regierungen vor Ort
einhergeht, in jedem Fall auf die Notwendigkeiten des
Geschäfts Rücksicht zu nehmen und nicht gegen die
Konzerne, sondern mit ihnen gemeinsam
gegen Aids
vorzugehen: Bundesentwicklungsministerin Heidemarie
Wieczorek-Zeul forderte die Pharmaindustrie zum Rückzug
ihrer Klage auf. ‚Südafrika muss eine nationale
Katastrophe abwenden‘, begründete die Ministerin ihren
Appell in Berlin. Sie verwies auf das
Welthandelsabkommen. Es sehe ausdrücklich vor, dass
Länder bei einer nationalen Notlage den Patentschutz für
Medikamente lockern könnten und Generika produzieren und
importieren dürften. Statt zu prozessieren sollten die
Pharmaunternehmen gemeinsam mit den Entwicklungsländern
praktikable Wege finden, wie Aids-Kranke in den armen
Regionen der Welt mit bezahlbaren Medikamenten versorgt
werden können.
(NN, 6.3.)
Wenn sie mit den Pharmaunternehmen über „bezahlbare“
Medikamente kontrahiert, also in jedem Fall konstruktiv
mithilft, dass deren Geschäftsinteressen gesichert
bleiben, vermag die Regierung Südafrikas auch den
Image-Verlust zu vermeiden, der ihr andernfalls – da
kennt man sich in den maßgeblichen Investitionsstandorten
gut aus – gedroht hätte: Das Gerichtsverfahren (à)
stellt Pretoria vor ein Dilemma. Gewinnt die Regierung,
fiele ihr die Behandlung der 4,2 Millionen Aids-Kranken,
etwa ein Zehntel der Bevölkerung, finanziell leichter.
Südafrika könnte legal generische Substanzen einführen.
Dann aber wäre der Ruf Südafrikas als sicherer
Investitionsstandort, in dem die Regeln der
Welthandelsorganisation voll beachtet werden,
gefährdet.
(FAZ, 8.3.)
4.
Auf diese Weise rückversichert, sind die Unternehmen
glatt zu Abwägungen bereit: Am südafrikanischen Elend ist
für sie ohnehin nicht viel zu verdienen; wenn sie mit
Südafrika „kooperieren, statt prozessieren“, wie man es
ihnen so fürsorglich nahe legt, verdienen sie eventuell
sogar mehr als bei einem verlorenen oder auch gewonnenen
Prozess; außerdem ist es schon auch ihrem Image bei ihrer
eigenen Aids-Kundschaft ein wenig abträglich, wenn sie
den Gebrauchswert ihrer lebensverlängernden Produkte so
erbarmungslos dem Dienst hintanstellen, den sie für ihren
Profit zu erbringen haben. Nachdem auch die
südafrikanische Regierung vom UNO-Chef endlich
erfolgreich darüber belehrt wird, was in ihrem Fall an
Modifikationen des internationalen Geschäftsverkehrs
allenfalls denkbar ist und was auf keinen Fall, lenken
die Konzerne ein und entschließen sich zur „Kooperation“
– mit den Entwicklungsländern überhaupt und mit der RSA
speziell. Die 6 führenden Pharmakonzerne versprechen der
UNO, ihre Preise für die 48 ärmsten Länder der Welt zu
senken
(taz, 7.4.), und
ihre Sammelklage gegen die RSA ziehen sie zurück. Auf
außergerichtlichem Wege wollen sie nun mit der Regierung
Südafrikas über die Details und praktische
Umsetzung
des Gesetzes verhandeln, an dem sie Anstoß
nehmen, also dafür Sorge tragen, dass bei allem, was in
diesem Staat zur Bekämpfung von Aids unternommen wird,
ihre Rechtsposition jedenfalls nicht ausgehebelt wird:
Wenn ihr Recht auf weltweites Verdienen an jeder
Behandlung eines Aids-Kranken im Prinzip gewahrt bleibt,
sind sie durchaus zu Preisnachlässen bereit. Im Prinzip
zumindest, denn Rabatte können zwar sie sich gut leisten,
die Neger in Afrika aber nicht einmal ihre Pillen zum
Sonderpreis. Nicht nur deswegen nicht, weil – wie die WHO
euphemistisch meint – auch die reduzierten Preise nur
von einem sehr kleinen Teil der Bedürftigen aufgebracht
werden
können. Es scheint in diesem Land so
zuzugehen, dass diese Bedürftigen
oft gar nicht
erst in die Verlegenheit geraten, von dem, was sie
benötigen, wegen ihrer mangelnden Zahlungskraft
ausgeschlossen zu werden. Selbst wenn die Konzerne in
ihrer Großmut containerweise Medizin nach Südafrika
verschiffen – der Staat vor Ort hat mit der Verrichtung
der medizinischen Hilfe, die er sich vorgenommen hat,
noch ganz andere Probleme als das, einen auch noch so
verbilligten Preis für sie bezahlen zu müssen. Und seine
Kranken wissen offensichtlich nicht einmal, wo und an wen
sie das Geld für ihre Medizin abliefern sollten, hätten
sie es denn überhaupt: Sprecher des
Gesundheitsministeriums sagten, die Regierung müsse erst
sicherstellen, dass alle Landesteile über die nötige
Infrastruktur verfügen, um die Medikamente an die
Kliniken und Spitäler verteilen und an die Kranken
verabreichen zu können.
(NZZ,
20.4.) So wird es wohl noch eine Zeit dauern, bis
das geschützte geistige Eigentum einem Neger im Busch das
Leben verlängert.
PS.
Von deutscher Seite hat sich nicht nur die Frau
Entwicklungsministerin für die Gesundheit im südlichen
Afrika engagiert – Aidsbekämpfung
ist überhaupt
ein zentrales Ziel deutscher Afrika-Politik
(FAZ, 12.4). Vom
apokalyptischen Ausmaß
der Epidemie gibt man sich,
wie der Staatsminister des Auswärtigen Amtes erläutert,
betroffen, weil sie immer mehr die politische
Stabilität der ganzen Region
bedrohe. In einigen
Ländern seien bis zu 80 Prozent der
Universitätsabsolventen infiziert. Damit werde eine ganze
Generation der künftigen Führungselite ausgedünnt.
Auch so erfährt man etwas über den Kontinent und über
das, was an dem noch politisch von Interesse ist. Wenn
die politischen Gebilde, die es auf ihm gibt, von den
Sachverständigen der hiesigen Außenpolitik nur noch als
Krankheitsherde wahrgenommen werden, die man eindämmen
muss, dann wird diesen Staatswesen von den eigenen
Ziehvätern beschieden, dass sie am Endpunkt ihrer
Karriere eines „Entwicklungslandes“ angelangt sind. Zu
mehr, als sich für das kapitalistische Weltgeschäft
nützlich zu machen, hat man sie nicht entwickelt; jetzt,
wo sie ihren Nutzen abliefern, sind sie als das, was sie
ansonsten noch als gescheiterte Projekte einer eigenen
Staatlichkeit repräsentieren, einfach nur noch eine
einzige Infektionsquelle – für Neger sowieso, aber eben
auch und vor allem für die politische Stabilität der
Region
. Als solche gilt es sie dann abzuwickeln, denn
wenn das Übel, das der Virus dem Kontinent bereitet,
vornehmlich darin besteht, den politischen
Führungsnachwuchs zu dezimieren, so wünscht man sich in
Berlin von den Regenten Afrikas eben auch nur noch eines:
Dafür Sorge zu tragen, dass ihre Bevölkerungen in ihrem
Elend und auch noch bei ihrer Ausdünnung
durch
Aids nicht weiter störend auffallen, die
Menschenrechte wahren
und Flüchtlingsströme
verhindern
– das wäre der an sich fällige
Herrschaftsauftrag für die politischen Hoffnungsträger
der afrikanischen Elite. Aber auch die stirbt einfach
verantwortungslos vor sich hin.