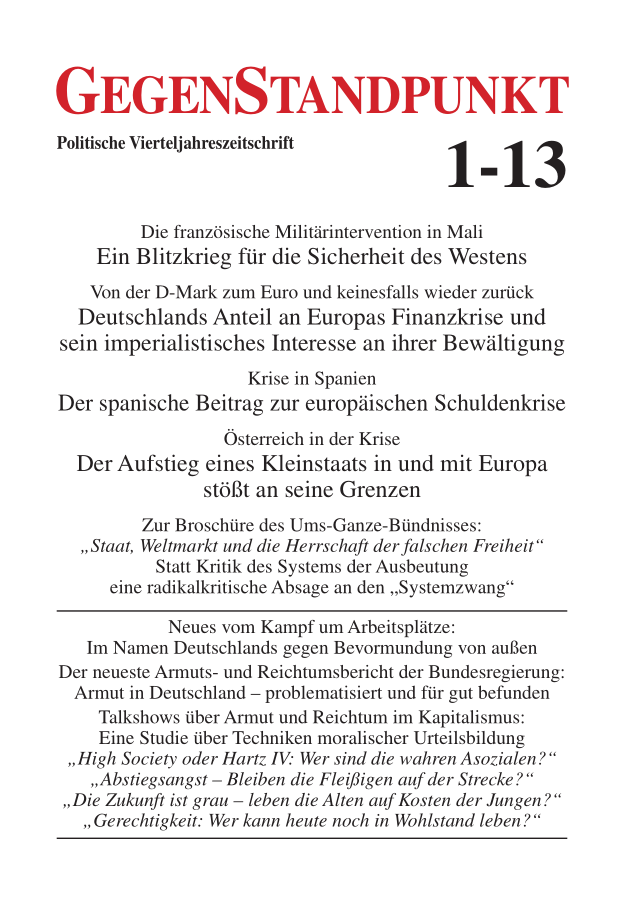Österreich in der Krise
Der Aufstieg eines Kleinstaats in und mit Europa stößt an seine Grenzen
Seit Herbst 2012 macht sich in Österreich eine gewisse selbstzufriedene Entspannung, gepaart mit Selbstlob und Häme über die südländischen Schuldenkaiser, breit. Die Politik berühmt sich ihres erfolgreichen Krisenmanagements und präsentiert sich den europäischen Sorgenkindern als leuchtendes Vorbild.
Noch bis ins Frühjahr 2012 prägten Schreckensbilder von für Österreich bedrohlichen ungarischen Finanzrisiken, der vielbeklagte Klau eines A durch eine Ratingagentur und ein drohender Staatsbankrott das öffentliche Selbstbild. Auch sind die ökonomischen Daten bislang nicht entschärft, die bis neulich das Material für die Katastrophenmeldungen abgaben. Aber seit der ESM-Rettungsfonds endgültig beschlossen ist, die EZB angekündigt hat, wenn nötig ‚unbegrenzt‘ Staatsanleihen zu kaufen, sich im Gefolge davon die Lage bei der Finanzierung europäischer Staatsschulden etwas entspannt und auch der österreichische Staat wieder an Bonität auf den Finanzmärkten gewonnen hat – seitdem hat sich die nationale Stimmungslage wieder gehoben: Die Regierung schreibt die „guten Wirtschaftsdaten“ ihren staatlichen Sparbemühungen, also sich gut, und die Öffentlichkeit bilanziert anerkennend, dass sich ‚die Lage‘ gebessert hat, und fordert und hofft auf Fortsetzung...
Dabei geht ziemlich unter, was das eigentlich für eine ‚Lage‘ ist, an der sich Österreichs Politik abarbeitet, wie Österreich also mit seinem kapitalistischen Wachstum vom Wachstum in Europa gelebt und welchen Beitrag es zur europäischen Akkumulation und Überakkumulation geleistet hat.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Gliederung
- Österreichs Beitrag zur europäischen Überakkumulation: Das österreichische „Wirtschaftswunder“
- Der Umschlag vom „Wirtschaftswunder“ zum „Klumpenrisiko“
- Österreichs Anstrengungen zur Rettung seines alternativlosen Ostengagements
- Ein nationales Sparprogramm als Beweis staatlicher Garantiemacht für ein internationalisiertes Bankenwesen
- Österreich – ein vorläufig Begünstigter des finanzkapitalistischen Risikovergleichs
- Österreichs politische Krisenlage und das Ringen um seinen nationalen Status in Europa
Österreich in der Krise
Der Aufstieg eines Kleinstaats in und
mit Europa stößt an seine Grenzen
„In welchem europäischen Land hat man derzeit die besten Chancen, einen Arbeitsplatz zu finden? Wo ist die Jugendarbeitslosigkeit am niedrigsten – und wo verbessert sich die Lage für langzeitarbeitslose junge Menschen am stärksten? Und wer bekämpft am besten die Kinderarmut? Österreich, lautet die Antwort. Ein Blick in die jüngsten Statistiken der Europäischen Kommission berechtigt zur Feststellung, dass wir in Sachen Arbeitsmarkt, Wohlstand und sozialer Zusammenhalt Europameister sind. Während die Griechen und Spanier dabei zuschauen müssen, wie ihr auf Kredit gekaufter trügerischer Wohlstand in der Schuldenkrise zerbröselt, herrscht in Österreich Rekordbeschäftigung, suchen Unternehmen händeringend nach Arbeitnehmern… Österreich geht es also sehr gut. Unsere Politiker wissen das. Und sie sind ziemlich stolz darauf. Kaum ein EU-Gipfeltreffen vergeht ohne eine Runde Selbstlobs des Bundeskanzlers. Hätte Werner Faymann die berühmte dritte Hand, müsste man sich Sorgen machen, dass er sich selbst vor lauter Schulterklopfen das Schlüsselbein bricht.“ (Die Presse, 1.10.12)
Seit Herbst 2012 macht sich in Österreich eine gewisse selbstzufriedene Entspannung, gepaart mit Selbstlob und Häme über die südländischen Schuldenkaiser, breit. Die Politik berühmt sich ihres erfolgreichen Krisenmanagements und präsentiert sich den europäischen Sorgenkindern als leuchtendes Vorbild.
Noch bis ins Frühjahr 2012 prägten Schreckensbilder von für Österreich bedrohlichen ungarischen Finanzrisiken, der vielbeklagte Klau eines A durch eine Ratingagentur und ein drohender Staatsbankrott das öffentliche Selbstbild. Auch sind die ökonomischen Daten bislang nicht entschärft, die bis neulich das Material für die Katastrophenmeldungen abgaben.[1] Aber seit der ESM-Rettungsfonds endgültig beschlossen ist, die EZB angekündigt hat, wenn nötig ‚unbegrenzt‘ Staatsanleihen zu kaufen, sich im Gefolge davon die Lage bei der Finanzierung europäischer Staatsschulden etwas entspannt und auch der österreichische Staat wieder an Bonität auf den Finanzmärkten gewonnen hat – seitdem hat sich die nationale Stimmungslage wieder gehoben: Die Regierung schreibt die „guten Wirtschaftsdaten“ ihren staatlichen Sparbemühungen, also sich gut, und die Öffentlichkeit bilanziert anerkennend, dass sich ‚die Lage‘ gebessert hat, und fordert und hofft auf Fortsetzung...
Dabei geht ziemlich unter, was das eigentlich für eine ‚Lage‘ ist, an der sich Österreichs Politik abarbeitet, wie Österreich also mit seinem kapitalistischen Wachstum vom Wachstum in Europa gelebt und welchen Beitrag es zur europäischen Akkumulation und Überakkumulation geleistet hat.
Österreichs Beitrag zur europäischen Überakkumulation: Das österreichische „Wirtschaftswunder“
Ihren Ursprung haben die Krise des österreichischen Bankensektors, die sanierungsbedingt angewachsenen Staatsschulden und das zinstreibende zeitweilige Misstrauen der internationalen Finanzmärkte im „rot-weiß-roten Wirtschaftswunder“ der letzten 18 Jahre, in denen sich Österreich als Hauptbeteiligter und Profiteur des politischen Anschlusses und der politökonomischen Eingemeindung Mittelost- und Südosteuropas positionierte. In Umsetzung des euroimperialistischen Erweiterungsinteresses wurde aus den vormaligen „Satelliten“ der Sowjetunion eine ganze Staatenperipherie der Europäischen Union geschaffen; diese Neuschöpfungen wurden in Ermangelung eigenen produktiven Kapitals, nationaler Kredit- und staatlicher Finanzmacht durch die Anbindung an und Beitrittsbeihilfen aus Europa mit Kreditwürdigkeit ausgestattet und zwecks Kapitalisierung als Anlagesphäre des Eurokredits ausgewiesen.
Bei diesem flächendeckenden kapitalistischen Erschließungsprogramm war Österreich zeitlich und was den Umfang seines Geschäfts- und Kreditengagements angeht, der Primus. Ausgestattet mit dem europäischen Weltgeld, mit aufrechten Kontakten aus dem Osthandel und mit eigenen politischen Fördermaßnahmen für seine expansionsfreudige Geschäftswelt nutzte Österreich das durch euroimperialistischen Beschluss geschaffene und abgesicherte, kapitalisierungswillige Osteuropa als seinen ‚Emerging Market‘. Seit Einführung des Euro hat Österreich im Europavergleich deshalb ein überdurchschnittliches Wachstum und seit 2003 jährliche Leistungsbilanzüberschüsse zu verzeichnen. Ein Gutteil des Exportwachstums verdankt sich dabei dem kapitalistischen Nachholbedarf in den neuen Mitgliedsstaaten, den Beitrittskandidaten und weiteren Nachbarn inklusive Russland.[2] Dieses anhaltende Wachstum der heimischen Wirtschaft hat zu einer vermehrten Attraktivität für ausländisches Kapital, damit zu einem die Konkurrenzfähigkeit fördernden Ausbau des Kapitalstandorts geführt und den Kapitalexport signifikant gesteigert.[3] Die gestiegene Kreditwürdigkeit und die niedrigen Zinsen für Staatsanleihen – vor dem EU-Beitritt um die 6 % – haben die Verschuldungskosten der Republik ökonomisiert und damit die Handlungsfähigkeit der Nation befördert.
Vor allem der österreichische Bankensektor nutzte den historischen Glücksfall einer erweiterten an die EU angebundenen, international betreuten Kapitalsphäre ohne ausreichendes heimisches Kapital, also mit riesigem Kreditbedarf für einen finanzkapitalistischen Eroberungsfeldzug, von der Schweizer Fachwelt schönfärberisch als Fall von ‚Integration‘ ausgedrückt:
„Finanzhäuser in inländischem Eigentum sind derweil kaum noch anzutreffen. In keiner anderen Weltregion hat die finanzielle Integration zu einem ähnlich hohen Anteil ausländischer – und vor allem westeuropäischer – Bankbesitzer geführt wie in Ostmitteleuropa… Im Durchschnitt werden rund 80 % des ostmittel- und südosteuropäischen Bankenmarkts durch ausländische Konzerne kontrolliert.“ (NZZ, 20.12.11) „Kein anderes Land hat einen so großen Anteil seiner Bankgeschäfte in dieser Region. Österreich führt mit weitem Abstand.“ (Wiener Zeitung, 10.10.11)
Für den österreichischen Finanzsektor erwies sich die Kapitalisierung des Ostens auch als entscheidendes Überlebensmittel in einem verschärften Konkurrenzkampf am europäischen Kapitalmarkt. Zwar wurde die willkommene Erweiterung der Finanzkapitalmacht durch ausländische Großbanken mit dem Verlust der Eigenständigkeit einiger führender österreichischer Institute bezahlt. Mit dem Ostengagement ist aber nicht nur der Erhalt des Bankplatzes gelungen, sondern auch die Herstellung der nötigen Kapitalgröße österreichischer Banken, um sich in diesem Konkurrenzkampf zu behaupten.[4]
Für das österreichische Finanzkapital bedeutet das Ostgeschäft nicht bloß die Erweiterung und Vervielfachung seines Geschäfts, sondern einen qualitativen Fortschritt. Zuvor waren die heimischen Finanzinstitute vor allem national investierte ‚local players‘, deren Kreditgeschäfte vorwiegend vom begrenzten österreichischen Kapitalstandort, dem staatlichen Bedarf nach Kredit und – als Steueroase mit Bankgeheimnis – von den Schwarzgeldern vor allem deutscher Steuerflüchtlinge abhing. Mit der Bedienung des Investitions- und Konsumbedarfs der neuen Standorte im Osten, des enormen Finanzbedarfs der jungen kapitalistischen Staaten und des Geldbedarfs von deren Massen wuchs das Finanzkapital der Alpenrepublik zu einem ‚regionalen Player‘ und die Hauptstadt Wien zu einem wichtigen europäischen Finanzplatz, der das ‚Emerging Europe‘, aber auch das übrige Europa als seine Geschäftssphäre nutzt.
Dieser Erfolg bewirkte eine grundsätzliche Änderung der ökonomischen Identität Österreichs. Das internationale Finanzgeschäft wurde zum entscheidenden Motor des nationalen Wachstums:
„Österreichs wichtigste Banken haben in ganz Europa Kredite von fast 300 Milliarden EUR vergeben. Das ist ein Betrag größer als das österreichische Bruttoinlandsprodukt (BIP). In den meisten Ländern Osteuropas sind die Banken aus der Alpenrepublik die Marktführer.“ (Handelsblatt, 26.1.12)
Umgekehrt spielen damit für das Wachstum und die Bewertung der Finanzmärkte die Geschäfte am Heimatstandort, die Profite der VOEST, Siemens Österreich, der heimischen Autozulieferer, des Maschinenbaus und der Tourismusbranche sowie die Schwarzgeldkonten nicht mehr die vormals dominante Rolle. Mit dem auf Ost- und Südosteuropa konzentrierten finanzkapitalistischen Auswärtsspiel in einer Höhe nahe am jährlichen Nationalprodukt hängen das Wachstum und die Kreditwürdigkeit Österreichs nun essentiell von der wirtschaftlichen Entwicklung dieser europäischen Peripherie, also von der Einschätzung und Nutzung dieser Geschäftssphäre durch die Finanzmärkte ab.
Der österreichische Staat hat das alles als florierendes nationales Wachstum bilanziert, gefördert und bei sich als entsprechend gewachsene Finanzmacht verbucht. Und die Finanzmärkte haben sich bis 2008 diesem Urteil angeschlossen, Österreich mit einer positiven Spekulation auf weiteres Wachstum in ‚Emerging Europe‘ belohnt und damit das Wachstum zusätzlich befeuert. Noch zu Beginn der Krise erwies sich die – später so verrufene – hohe Konzentration österreichischer Banken auf dem osteuropäischen Markt und die vergleichsweise geringe Veranlagung in den südlichen Euro-Problemstaaten als Konstituente für das finanzkapitalistische Vertrauen:
„Bis zum Herbst 2008 gingen die meisten Experten davon aus, dass die starke Präsenz in den mittelost- und südosteuropäischen Ländern (MOSOEL) Österreich vor der Krise schützen würde, weil sich der Außenhandel damit ein zweites Standbein aufgebaut hat... Bald wurden die Risiken in der MOSOEL jedoch schlechter beurteilt und damit negative Vertrauenseffekte hervorgerufen.“ (Frank, Stephanie, Wirtschaftskrise(n) 2007 bis 2010, Frankfurt 2012, S.98)
Diese durch Konzentration auf den Osten eroberte und als „Wirtschaftswunder“ hochgelobte Reichtumsquelle hat eben einen Preis: Sobald sie finanzkapitalistisch kritisch bewertet wird, verwandelt sie sich schlagartig in eine „Ansteckungsgefahr“ für den hochgradig abhängigen österreichischen Finanzstandort. Das bringt Österreich trotz der guten Wirtschaftsdaten am Heimatstandort eine negative Bewertung und Vorausschau durch die einschlägigen Agenturen ein.
Der Umschlag vom „Wirtschaftswunder“ zum „Klumpenrisiko“
In der ideologischen Bewältigung des für die österreichischen Banken bedrohlichen Kreditgeschäfts wird die Schuld den Verantwortungsträgern im Osten zugewiesen, die durch wirtschaftspolitisches Fehlverhalten und – im Fall des ungarischen Premiers Orban – durch europakritische Unbotmäßigkeiten, vor allem aber durch einen fahrlässigen Umgang mit Kredit, die österreichischen Anlagesphären in die Krise gezogen haben. Die Wahrheit ist eine andere: Als Derivat des europäischen Kredits ist die Region Objekt der Eurokrise und der europäischen Krisensanierung. Es sind schließlich die Finanzinstitute aus den Zentren Europas, die diese Gegend erst zu einem ‚emerging market‘ hoch- und dann, im Gefolge der Lehman-Krise 2008, wegen ihres Sanierungsbedarfs wieder herunterspekuliert haben. Nachdem die Herren des Verfahrens, die Agenturen des Finanzkapitals mit dem Misstrauen gegen ihr eigenes Geschäft den weltweiten Zusammenbruch einer ganzen Sparte ihrer Finanzprodukte herbeigeführt haben, leiten sie eine neue Krisenetappe mit dem Bemühen um Konsolidierung ihres Geschäfts ein: Sie unterscheiden verschärft nach Kriterien von Kreditsicherheit, Verlässlichkeit staatlicher Schulden, also nationalen Wachstumsgrundlagen und -ziffern, führen demgemäß eine Neubewertung ihrer Kundschaft und von deren Risiken durch, schränken die Vergabe von Krediten ein und ziehen veranlagtes Kapital ab; und in Europa trifft das eben die gesamte Staatenwelt im europäischen Osten, der die Finanzwelt im Vergleich mit den Eurostandorten eine zwar je nach Staat unterschiedliche, aber insgesamt geringere Kreditwürdigkeit attestiert.
So schlagen wesentliche Teile des vormaligen ‚Emerging Europe‘ und damit das österreichische Kreditwachstum in ihr Gegenteil um: Eine ganze vormals bevorzugte Wachstumsregion wird vom europäischen Finanzkapital als Problemzone bilanziert und entsprechend behandelt. Das betrifft vor allem die Masse an Fremdwährungskrediten, insbesondere „zinsgünstige“ Frankenkredite in Milliardenhöhe, mit denen sich nicht zuletzt die österreichischen Banken im Osten eine ausgedehnte private Kundschaft erschlossen haben. Mit ihrem skeptischen Urteil über die östliche Anlagesphäre und dem Abzug von Kapital bewirkt die Finanzwelt auch einen Einbruch der dortigen Währungen, betreibt gleichzeitig eine massive Kapitalverlagerung in die Schweizer „Fluchtwährung“, so dass sich die in Franken bemessene Schuld schlagartig vergrößert, ein Gutteil dieser Kundschaft zahlungsunfähig wird und die vormals wohlfeilen Frankenkredite tendenziell zu uneinbringlichen Schadensfällen mutieren. Darüber hinaus bewirken die Spar- und Krisenbekämpfungsprogramme in Kerneuropa und der Eurozone einen Exporteinbruch und massive Einnahmeverluste bei den neuen EU-Mitgliedsstaaten, deren Wirtschaftswachstum entscheidend vom Export in den Euroraum abhängt. Der Kreditentzug durch die Finanzmärkte, die Krisenlage auf dem europäischen Markt und die Sparpolitik der europäischen Kernstaaten verwandeln die östlichen Kreditnehmer so in das feinsinnig imperialistisch benannte „Klumpenrisiko“: in einen Haufen von problematischen Schulden und Schuldnern, von der zahlungsunfähigen privaten Kundschaft bis zu den staatlichen Sanierungsfällen, die der negativen Spekulation ziemlich ohnmächtig ausgeliefert sind.
Betroffen und geschädigt sehen sich damit insbesondere
die bisherigen Profiteure der europäischen
Osterweiterung, Österreich und dessen Banken, denen jetzt
der Verlust ihrer Kreditfähigkeit droht.[5] Die einschlägigen Posten,
deren Werthaltigkeit angezweifelt wird, der Beitrag der
Austrobanken zur Herstellung eines ‚Emerging Europe‘,
bilden ja die Hauptmasse der österreichischen
Bankvermögen. Im Unterschied zu Finanzsektoren anderer
Nationen, deren Auswärtsspiele diversifiziert auf
verschiedensten Märkten veranlagt sind, stehen im Falle
Österreichs aufgrund der hohen Konzentration auf die
Ostregion gleich der gesamte, in eine europäische
Geschäftsdimension hineingewachsene Finanzsektor und
damit auch das auf diesen finanzkapitalistischen
Fortschritt gründende nationale Kapitalwachstum und die
staatliche Kreditwürdigkeit auf dem Spiel.[6] Schon aufgrund der
schieren Masse des Kreditengagements und der damit
gesetzten „Systemrelevanz“ für Österreich ist die
Fortsetzung des finanzkapitalistischen Engagements in der
Region daher alternativlos, ein umfassender Rückzug der
österreichischen Banken aus dem „Klumpenrisiko“ – wie er
etwa seit einiger Zeit aus den aus politischen Gründen
prekären weißrussischen und ukrainischen Märkten
vollzogen wird – und die flächendeckende Abschreibung der
Kredite ausgeschlossen. Zudem verweist die
Finanzministerin darauf, dass unsere Banken in Ungarn
immer noch mehr verdienen als am Heimmarkt
. Vor allem
aber will die Regierung in Wien trotz aller Rückschläge
und Imponderabilien die mühsam erkämpfte Rolle als
Finanzplatz mit europäischen Dimensionen erhalten.
Österreichs Anstrengungen zur Rettung seines alternativlosen Ostengagements
Daher steht die österreichische Regierung vor der doppelten Aufgabe, den Zusammenbruch ihres den nationalen Schranken entwachsenen Finanzsektors zu verhindern und sich um die Rettung von dessen östlicher Geschäftssphäre, insbesondere um die Verhinderung von Staatsbankrotten in den einschlägigen Staaten zu kümmern, die mit dem Versiegen von deren auswärtigen Kreditquellen drohen. Beides überfordert den österreichischen Staat.
Nationale Bankenrettung mit Staatskredit
Weil der Bankensektor als primärer nationaler Wachstumsfaktor jetzt zum primären nationalen Krisenfall geworden ist, sieht sich der österreichische Staat genötigt, für die Sanierung der systemrelevanten Banken Staatskredit einzuschießen und außerdem einige Institute ganz oder teilweise zu verstaatlichen oder zumindest für deren Ausfallrisiken zu garantieren.[7] Der Preis dafür ist ein enormer Anstieg der Staatsverschuldung:
„Nach der Finanzkrise hatte der österreichische Staat seine Verschuldungsquote deutlich erhöht. Verantwortlich war dafür vor allem das Bankenhilfsprogramm. Vor fünf Jahren lag die Staatsschuldenquote noch bei 60 %, 2011 waren es schon 73 Prozent.“ (Handelsblatt, 26.1.12)
So essentiell die Bankenrettung mit Staatskredit ist, so sehr wird dadurch das Misstrauen in die österreichische Kreditwürdigkeit befeuert; schließlich handelt es sich bei dieser Sorte Verschuldung um keinen Wachstumshebel, sondern ausschließlich um die Inwerthaltung toxischer Papiere, also jetzt uneinbringlicher Schulden durch die Vermehrung der Staatsschuld. Ab 2009 steigen die Kosten staatlicher Kreditaufnahme, am Höhepunkt 2011 auf 4 %, also das Doppelte, und der „spread“ österreichischer Staatsanleihen erreicht gegenüber Deutschland zeitweise 120 Basispunkte. Ihre Kreditgarantien ergänzt die Regierung mit Auflagen für die Banken, die vor allem auf deren notleidende Ostengagements berechnet sind – Erhöhung der Eigenkapitalquote, Begrenzung der Kreditvergabe, insbesondere von Fremdwährungskrediten. Dadurch sollen deren vormals glänzende, jetzt „exzessive“ Kreditgeschäfte auf eine solidere Basis gestellt, die Banken wieder geschäftsfähig gemacht und der Staat entlastet werden. Diese Sanierungsauflagen des staatlichen Bankenrettungspakets führen allerdings dazu, dass die Banken ihre Ostengagements weiter zurückfahren.[8]
Interessierte Beteiligung an der internationalen Krisenbetreuung der Oststaaten
Was den Umgang mit den Oststaaten angeht, an deren Sanierung Österreich ein existenzielles Interesse hat, sieht sich die Regierung darauf verwiesen und kalkuliert damit, dass die Bewältigung des Schuldenbergs in erster Linie von den Bemühungen der europäischen und supranationalen Institutionen um die Aufrechterhaltung der Kreditfähigkeit der Oststaaten abhängt. Deswegen beteiligen sich österreichische Bankinstitute und staatliche Institutionen an den einschlägigen politisch initiierten Kreditrettungsprogrammen in Gestalt einer ersten und inzwischen in die Wege geleiteten zweiten „Wiener Initiative“. Dieses Gemeinschaftswerk zielt darauf, durch Kredithilfen der Europäischen Union und des IWF, durch daran gekoppelte harte Sparvorgaben für die betroffenen Staaten und Übereinkünfte mit den engagierten Banken die absehbare, in ihren negativen Auswirkungen unberechenbare Abwärtsspirale aus Abschreibung toxischer Kreditpapiere, andauerndem Kreditabzug und im Gefolge davon drohenden Staatsbankrotten zu vermeiden. Die unvermeidliche Schadensabwicklung soll international beaufsichtigt und in einer konzertierten Aktion ‚geordnet‘ geregelt werden, da sonst ein erweiterter politischer und ökonomischer Besitzstand der EU wegbrechen würde.[9]
Dessen Rettung gerät allerdings zu einer Daueraufgabe für
die europäischen und internationalen politischen
Kreditinstanzen und deren Auftraggeber, die sie im
Dauerstreit mit den einschlägigen Objekten ihrer Hilfen
vor Ort erledigen, deren Überleben an den mit harten
Sparvorgaben angereicherten Kredithilfen der Europäischen
Union und des IWF hängt. Gerade beim auch für Österreichs
Ostbilanz entscheidenden Schadensfall Ungarn ist die
Krisenbewältigung zu einem andauernden politischen Kampf
zwischen IWF, EU und der dortigen Regierung gediehen: Die
als Bedingung weiterer Kredite geforderte Senkung der
Staatsverschuldung hat die Fidesz-Regierung zwar durch
die Erhöhung der Bankabgabe und die Schaffung einer
Bankentransaktionsteuer erfolgreich exekutiert. Das hat
der Orban-Regierung aber gleichzeitig heftige Kritik des
westlichen Bankkapitals und einen weiteren Credit Crunch
eingebracht.[10] Wie die ungarische
Regierung die verlangte Reduktion ihres Haushaltsdefizits
überhaupt hinbekommen soll, liegt zwar einerseits ganz in
deren Verantwortung. Wenn sie aber meint, ausgerechnet
die Banken und ausgerechnet Großunternehmen für diesen
Zweck mit Steuern belegen zu müssen, zieht sie sich
umgehend die Verurteilung von EU-Kommission und IWF zu:
Die erklären die Budgetsanierung Ungarns für nicht
nachhaltig. Kritik üben sie insbesondere an den diversen
Sondersteuern für bestimmte Branchen. Eine nachhaltige
Sanierung des Budgets müsse anders aussehen, so die
Conclusio.
(Ungarn ringt mit EU
und IWF ums Defizit, Wirtschaftsblatt, 30.01.13)
Am Fortgang solcher Auseinandersetzungen hängt dann ganz entscheidend, was aus den Engagements der österreichischen Banken und damit aus dem österreichischen Finanzsektor insgesamt wird.
Streit über die Ausgestaltung der Gemeinschaftsinitiativen zur organisierten Schuldenabwicklung, also darum, wer in welchem Ausmaß die unvermeidlichen Entwertungskosten der Spekulationsblase zu schultern hat, wer von der Kreditrettung national wie profitiert, welche Konditionen und Kostenbeteiligung man deswegen den Banken, welche den ohnehin finanzmaroden Staaten abverlangen soll, gibt es aber vor allem auch zwischen den engagierten Gläubigerstaaten selber. In der strittigen Frage, wie das spekulative Geschäft der Banken solider, zugleich aber die Ostländer nicht durch Kreditentzug zahlungsunfähig gemacht werden, sorgt insbesondere Österreich wegen seiner im nationalen Alleingang beschlossenen Bankenvorschriften bei den Mitinitiatoren, allen voran der Osteuropaförderbank EBRD, für böses Blut. Damit verstößt Wien gegen die Vereinbarung, die Regelungen koordiniert zu beschließen und die fällige Schuldenabwicklung möglichst organisiert durchzuführen, um einen ruinösen nationalen Wettlauf um Kreditrettung zu vermeiden. Zugleich kalkulieren die Zuständigen in Wien damit, dass die in der Initiative versammelten Gläubigerstaaten und -Institutionen auch weiterhin für die Zahlungsfähigkeit der Oststaaten einstehen werden.
So entwickelt der österreichische Nationalbankgouverneur das Ideal, durch eine dosierte Sanierung des „Kreditklumpens“ das österreichische Finanzkapital zu retten und die Oststaaten als österreichische Geschäftsquelle zu erhalten. Ganz selbstverständlich und konsequent bespricht er deren Wirtschaftswachstum als Unterfutter seines Bankenwesens:
„Es geht darum, die Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells der österreichischen Banken zu stärken. Natürlich müssen Fehlentwicklungen korrigiert werden, daran arbeiten wir. Aber wir müssen die Konjunktur der betroffenen Länder im Auge behalten und dürfen die Kreditvergabe nicht rasant abwürgen.“ (Notenbankgouverneur Ewald Nowotny, Die Presse, 28.1.12)
Die Berechnung auf das Wachstumspotential, das der Chef der Nationalbank den Oststaaten nach wie vor attestiert,[11] gilt de facto den EU-Mitteln, mit denen diese Sorte Mitglieder rechnen kann. Er verlässt sich darauf, dass die eigene Geschäftssphäre in der Krise vermehrt von den EU-Institutionen finanziert wird, also auf das übergeordnete euroimperialistische Interesse an der südosteuropäischen Peripherie.
Und bei allem Streit sehen sich die EU-Staaten auch wirklich genötigt, der finanzpolitischen Bezweiflung ihres osteuropäischen Zugewinns Schranken zu setzen. Dem Abfluss privaten Kapitals wird gemeinsam mit dem IWF im Rahmen der Wiener Initiative II neuer politischer Kredit durch die Europäische Bank für Wachstum und Entwicklung (EBWE) und die Europäische Investitionsbank entgegengestellt; die EU macht außerdem noch andere Mittel locker. Damit erhält Europa nicht nur den krisengebeutelten Armenhäusern im Osten die Aussicht, sich vielleicht einmal wieder als Wachstumspotential für die EU-Kapitale bewähren zu können; es verschafft auch seinen und v.a. den österreichischen Banken die Gelegenheit zu einer vergleichsweise geordneten Abschreibung ihrer faulen Kredite.[12] Daher die für Österreichs Banken und Politiker erfreuliche aktuelle Erfolgsmeldung:
„Die Region ist jetzt weniger von der globalen Abschwächung der Kapitalflüsse betroffen als während der Krise 2008, weil die Länder ihren Bedarf an Außenfinanzierung massiv verringert hätten. Das Risiko für Osteuropa sei nun ‚begrenzt‘. Wozu auch beigetragen hat, dass sich der Nettofluss von EU-Geld in die Region in den letzten drei Jahren verdoppelt hat.“ (Die Presse, 8.11.12)
Österreichs nationale Krisensorgen sind damit freilich nicht bereinigt.
Ein nationales Sparprogramm als Beweis staatlicher Garantiemacht für ein internationalisiertes Bankenwesen
Mit den nationalen staatlichen Garantien für sein Finanzkapital, das sich mit seinen internationalen Engagements über die nationalen Schranken hinaus und in die Krise hineingewirtschaftet hat, strapaziert der österreichische Staat seine Kreditwürdigkeit. Er muss mit den Lasten seiner schlagartig gestiegenen Verschuldung fertig werden, sich um seinen Kredit sorgen – kurz: Er hat sich mit der Bankenrettung seine eigene Staatsschuldenkrise produziert.
Die Regierung steht deshalb vor der Notwendigkeit, um die staatliche Finanzmacht zu kämpfen – und das heißt, mit anderen Euro-Nationen um das Vertrauen der Finanzmärkte zu konkurrieren und sich von denen abzusetzen: Österreich gehört zu den soliden, finanzkräftigen Ländern. Das gilt es zu beweisen, denn angesichts der Schulden reichen auch positive ‚Fundamentaldaten‘, vermehrte Steuereinnahmen und gewöhnliche Wachstumszahlen keineswegs hin, die Zweifel an der Solidität der schlagartig aufgeblähten Staatsschulden auszuräumen, wie die verschlechterten Konditionen für die staatliche Finanzierung zeigen. Die negative Kalkulation des Finanzkapitals mit seinem angehäuften Ostkreditrisiko und dessen Folgen für den Staat, der für die Haltbarkeit der Bankkredite mit einem Schuldenberg bürgt, der alle gewöhnlichen Haushaltsrechnungen mit Schulden und mit Erträgen aus dem heimischen Standort sprengt, ist mit dem Hinweis auf gelungene Ausbeutungsraten und gestiegene Steuereinnahmen nicht zu entkräften.
Der Regierung ist von daher klar, dass es handfeste staatliche Anstrengungen zur Haushaltssanierung braucht, um Österreich das Vertrauen des Finanzkapitals in den zukünftigen Schuldendienst der öffentlichen Hand zu sichern: Der für die Bankenrettung rücksichtslos beanspruchten Kreditwürdigkeit des Staats muss durch finanzpolitischen Rigorismus bei den sonstigen Haushaltsposten wieder aufgeholfen werden. Sie beschließt deswegen ein großangelegtes Sparprogramm. Bis 2015 soll das strukturelle Defizit von derzeit 3 % auf Null gesenkt, die Staatsschuldenquote um 27 Mrd. Euro zurückgeführt werden. Dafür verordnet Wien dem Land ein umfassendes auf Dauer berechnetes staatliches Sparprogramm auf allen Verwaltungsebenen:
„Im Mai 2012 wurde zwischen Bund, Ländern und kommunalen Spitzenverbänden ein sogenannter Stabilitätspakt geschlossen, mit dem sich alle staatlichen Ebenen zu einer soliden und nachhaltigen Finanzwirtschaft verpflichten. Dazu wurde ein Sanktionssystem eingeführt, durch das – nach Beteiligung des statistischen Amts und des Rechnungshofs – Geldbußen gegen öffentliche Körperschaften verhängt werden können, deren Haushaltsführung mit dem Pakt nicht in Einklang steht.“ (www.auswaertiges-amt.de, Länderinfo Österreich 2012/13, S.2)[13]
Von daher kommt die Politik auf das Volk und die nationale Arbeit als die Größen zurück, an denen der Staat ‚unproduktive‘ Kosten einsparen und deren lohnende Dienste sie darüber verbessern kann: Das zeitlich unbefristete Austeritätsprogramm will zumindest 10 Mrd. Euro durch Aufnahmestopp und Nulllohnrunde bei den Beamten und die Eindämmung der Frühpensionen durch ein ausgeklügeltes Bonus-Malus-System einsparen. Durch den Abbau der ‚Doppelgleisigkeiten im besten Gesundheitssystem der Welt‘ soll eine weitere Schuldenreduktion in Milliardenhöhe erreicht werden usw. Mit einem mehr symbolischen Beitrag zur sozialen Gerechtigkeit, einer wohldosierten ‚Reichen- und Vermögenssteuer‘ will die Regierung an die Privatschatulle der oberen Zehntausend heran und mit einer konzertierten europäischen Transaktionssteuer an den Zinsgewinnen der vielgescholtenen Spekulanten partizipieren.
Österreich – ein vorläufig Begünstigter des finanzkapitalistischen Risikovergleichs
Die laufenden rot-weiß-roten Sanierungsanstrengungen werden ab Mitte 2012 durch eine ‚austrophile‘ Stimmung auf dem europäischen Kreditmarkt belohnt. Noch zwei Jahre zuvor wurde das wachsende Misstrauen aufgrund des angeschlagenen südosteuropäischen Engagements österreichischer Banken und des staatlichen Schuldenanstiegs infolge der Bankenrettung in erhöhte Zinsforderungen eingepreist. Im Jänner 2013 berappt Österreich nun mit 1,35 % bei zehnjährigen Anleihen die allzeit niedrigsten Zinsen, genießt dadurch auch eine erhebliche Ökonomisierung seiner alten Zinslasten, damit deutlich verbesserte Chancen zum Schuldenabbau und steht wieder in einer Reihe mit den als solvent gehandelten Eurostandorten. Den südosteuropäischen „Klumpenrisiken“ des österreichischen Bankensektors wird zwar weiterhin der Kredit durch die Finanzmärkte entzogen. Aber seitdem sich höhere politische Instanzen, die EU sowie der IWF zuständig gemacht haben für den Umgang mit diesen Risiken und seitdem dank der Ausweitung der politischen Kreditgarantien innerhalb der Euro-Zone das Finanzkapital nicht mehr so sehr mit der Sorge eines allgemeinen Zusammenbruchs des Euro-Kredits spekuliert, profitiert Österreich wieder vom Vergleich der finanzkapitalistischen Kreditagenturen. Der österreichische Risikoklumpen ist um kein Deka leichter geworden. Aber an ihm wird zwischen schlechten Schuldnern und gutem Gläubiger neu geschieden. Die internationalen Finanzmärkte verschaffen einerseits Österreich mit seinen Staatsschulden eine Aufwertung und eine Erleichterung der Rückzahlungskonditionen. Andererseits unterminieren sie mit ihren praktischen Zweifeln an der Kreditwürdigkeit Ungarns, Rumäniens, Sloweniens und mittlerweile auch Kroatiens weiterhin die Kreditfähigkeit dieser Staaten, an denen Österreichs Ostfinanzgeschäfte hängen. Österreichs wieder gewachsene Kreditwürdigkeit basiert also auf der finanzkapitalistischen Trennung des österreichischen Kredits von seinen ausländischen Risiken. Auf dieser Basis profitiert der Staat dann auch von dem praktischen Vergleich, den die Kreditagenturen an den verschuldeten Euro-Staaten mit der Begutachtung von nationalem Schuldenstand und nationalen Wachstumsziffern und -aussichten vornehmen. Wo die Herren des Kredits zwischen kreditwürdigen und Risiko-Staaten unterscheiden, damit den Kreditmangel der einen verschärfen, die Kreditmacht der anderen erweitern, gehört Österreich im Vergleich mit Staaten wie Griechenland, Spanien, Italien und Portugal zu den Gewinnern.
So kann sich Wien mit Berufung auf den finanzkapitalistischen Zuspruch dafür rühmen, aus eigener Kraft, mit konsequenter Austeritätspolitik – ein Programm, dass alle abgewerteten Problemstaaten noch viel rigoroser umsetzen – seine verbesserten Kreditkonditionen zurückerobert zu haben und zu Recht zu den soliden, das meint: zu den vom Finanzkapital als verlässliche Quelle für seine Kreditgeschäfte eingestuften Staaten zu gehören. Das Finanzkapital gibt ihm ja recht.
Österreichs politische Krisenlage und das Ringen um seinen nationalen Status in Europa
Mit ihren Anstrengungen, auch in der Krise den ökonomischen Status eines kreditwürdigen Landes innerhalb der EU-Länder zu verteidigen, ringt die österreichische Regierung zugleich um den politischen Einfluss Österreichs in der politischen Krisenkonkurrenz um die Rettung des Euro-Kredits und damit um den Status Österreichs in der EU überhaupt. Die Finanzministerin merkt an, dass bei der Konsolidierung des Staatshaushalts in der Krise für ihr Land mehr auf dem Spiel steht: ob Österreich nämlich seine politökonomische Handlungsfreiheit verliert oder umgekehrt zu den Mitgestaltern bei den anstehenden grundsätzlichen Korrekturen der Euro-Staatengemeinschaft gehört:
„Österreich muss sich entscheiden. Wollen wir zu den Staaten gehören, die aufgrund ihrer Schuldenmacherei von der EU abgestraft werden und wo letztlich die Europäische Union über ihre Budget- und Wirtschaftspolitik bestimmt. Oder wollen wir zu den wirtschaftlich verantwortlichen Staaten gehören, die mit dem Fiskalpakt auch die Möglichkeit bekommen, die Architektur des neuen Europas mitzubestimmen.“ (Maria Fekter, Ö1, 19.1.12)
Die Ministerin begreift die Konsolidierung des
Staatshaushalts als unerlässliche Bedingung, damit aber
auch als Auftrag, Österreich eine angemessene Rolle in
den innereuropäischen Auseinandersetzungen um eine
Neuordnung Europas zu erobern. Auf ihre Art verweist sie
damit auf die Zwangslage, in der Österreich sich mit der
Finanzkrise und der Krisenbewältigungspolitik der
Euro-Staaten befindet: Das Land muss um seinen Status in
Europa kämpfen. Denn es hat zu Europa und dem
Euro keine Alternative – die Möglichkeit eines
Ausscheidens, um auf eigene Faust sein ökonomisches und
politisches Schicksal zu gestalten, zieht die
Budget-Ministerin so wenig wie die Regierung insgesamt
überhaupt in Betracht. Und in Europa und dem
Euro-Raum hat das Land auch keine Wahl, hat nämlich die
Alternative, vor die es gestellt ist, gar nicht selbst in
der Hand: Um nicht zum bevormundeten Schuldenmacher und
abhängigen Anhängsel degradiert zu werden, muss
Österreich nach Richtlinien mitmachen, die es nicht
selber bestimmt, und Anforderungen in Sachen finanzieller
Solidität genügen, die ihm vorgegeben sind. Es muss sich
darum bemühen und kann es allenfalls dahin bringen, zu
den wirtschaftlich verantwortlichen Staaten
der EU
dazuzugehören; die Instanz, die die Kriterien einer
„verantwortlichen“ Politik definiert und ihre Verletzung
„abstraft“, ist es nicht.
Was an diesem Drangsal deutlich wird, ist der widersprüchliche politische und ökonomische Status eines kleinen europäischen Landes, das sich auf die Einladung zum Mitmachen im Projekt eines neuen europäischen Imperialismus eingelassen hat. Mit seinem ökonomischen Bestand und seiner politischen Geltung ist Österreich inzwischen auf ein Europa angewiesen, das nach imperialistischen Regeln und Erfolgskriterien funktioniert, die sich seiner Verfügungsmacht entziehen; es ist um der Erhaltung seiner nationalen Macht willen genötigt, selber im Sinne dieser vorgegebenen Maßstäbe erfolgreich zu sein; es muss daher für einen europäischen Gesamterfolg eintreten und sich dienstbar machen, der mit seinem eigenen nationalen Erfolg gar nicht zusammenfällt, dafür aber die unumgängliche Voraussetzung und bleibende Bedingung ist. Das Land ist eben weder ökonomisch potent noch politisch bedeutend genug, um den Supranationalismus der Union, ihre imperialistische Räson, maßgeblich festzulegen und für sich zum Mittel zu machen; zugleich kommt es davon nicht los, weil seine ökonomische Potenz und seine politische Bedeutung dank seiner Beteiligung am europäischen Imperialismus und als dessen Bestandteil größer ist als alles, was es alleine, von sich aus leisten könnte.
Dieses Verhältnis selber ist natürlich nicht erst in der, geschweige denn durch die Krise entstanden. Mit seinem Beitritt zur EU und mit der Übernahme der Gemeinschaftswährung ist Österreich genau dieses Verhältnis der abhängigen Teilhaberschaft eingegangen, um über seine eigenen Fähigkeiten hinauszuwachsen. Und in diesem Sinne hat sich seine Europapolitik auch jahrelang als nationaler Erfolgsweg bewährt. Die Abhängigkeit vom tatkräftigen Interesse und Zugriff seiner Partner – nicht zuletzt übrigens des jetzt so locker unter die ‚ökonomisch unverantwortlichen Schuldenmacher‘ eingereihten Italien – hat nicht gestört, weil Österreich in Einklang mit der Union als ganzer ökonomisches Wachstum und einen Zuwachs an politischer Bedeutung zu verzeichnen hatte, die Interessen der Nation und ihrer Partner im Endeffekt also deckungsgleich waren. Österreich hat sich einen Aufstieg erwirtschaftet, den es aus eigener Kraft nicht nur nicht hingekriegt hätte, sondern dessen Bedingungen und dessen Logik es nie selbst in der Hand hatte und dessen Ergebnis es aus eigener Kraft und auf eigene Rechnung gar nicht haltbar machen kann. Dieser Erfolg fällt dem Land jetzt in der Krise gewissermaßen auf die Füße: Österreich ist dank der Gemeinschaftswährung zu reich geworden, um die fällige Entwertung seines kapitalistischen Reichtums selbst bewältigen zu können, also um seine Krise ohne eine gelingende gesamteuropäische Krisenbewältigung durchzustehen. Und es ist erst recht politisch zu schwach und ökonomisch zu unbedeutend, um die europäische Krisenbewältigungspolitik auf die eigenen nationalen Bedürfnisse und Nöte zuzuschneiden und so für sich zu funktionalisieren. Die Richtlinien dieser Politik werden maßgeblich von Deutschland, der Führungsmacht des imperialistischen Bündnisses bestimmt; Österreich muss schauen, dass es aus der Unterwerfung unter die Generallinie die Chancen und die Mittel herauswirtschaftet, die es für die Rettung seines Reichtums und für die Wahrung seines politischen Einflusses braucht.
Und es müht sich: Aus der Zwangslage der Nation versucht die Regierung in Wien das Beste zu machen.
Das Programm der Regierung: Entschiedenes Mitmachen als Erfolgskonzept
Dass für ein Land vom Kaliber Österreichs ohne bzw. gegen Deutschland in der auf den Weg gebrachten neuen europäischen ‚Architektur‘ nichts geht, davon geht die Wiener Regierung aus. Durch Maastrichtkonformität und bewiesene Kreditwürdigkeit will sie sich deshalb als natürlicher Ansprechpartner des großen Nachbarn bei der Krisenbewältigung profilieren. So ringt sie darum, als Betroffener der neuen Europa-Übergänge, die Deutschland in Auseinandersetzung mit den großen EU-Staaten durchsetzt, deren Aktivist zu sein – immer entlang den Übergängen, Fortschritten und Konjunkturen der Euro-Krise und innereuropäischen Krisenpolitik. Erfolgreiches Mitmachen soll auch Mitsprache gewährleisen.
Deswegen strengt die Regierung den Beweis ihrer Zugehörigkeit zu den soliden Nationen an; deswegen stellt sie – wie am Anfang zitiert – unentwegt die Erfolge österreichischer Wirtschaftspolitik in den Vordergrund, stuft die prekäre ökonomische Lage zum abtrennbaren, ja recht besehen durchaus schon wieder zukunftsträchtigen Ost-‘Risiko‘ herab, grenzt Österreich immer wieder ausdrücklich von den Problemstaaten ab, zeigt sich, mit Verweis auf den Zuspruch des Finanzkapitals, ostentativ selbstzufrieden, weil Österreich im Unterschied zu anderen seine Verhältnisse im Griff hat und insofern zu den Vorreitern gesamteuropäisch erfolgreicher Krisenpolitik zu zählen ist.
Aus der Position eines kreditwürdigen Gläubigerstaats tritt die Wiener Regierung als Vorreiter eines durchschlagskräftigen europäischen Sparregimes für rigorose Diktate gegenüber den einschlägigen Krisenstaaten ein, umgekehrt macht sie sich für einen ebenso rigorosen Umgang mit Abweichlern aus den Reihen der als Gläubiger geforderten Staaten stark.[14] Bei der politischen Betreuung Osteuropas durch EU und internationale Institutionen profiliert sie sich als Anwalt von mehr Haushaltsdisziplin und strikterer Ausrichtung an EU-Vorgaben.[15] Ohnehin daran interessiert, dass die Euro-Problemstaaten zur Konsolidierung genötigt werden, stellt sich die Regierung demonstrativ hinter den Fiskalpakt. Vor allem macht sie die europäische Durchsetzung einer Finanztransaktionssteuer, an der sie wegen der immensen staatlichen Kosten der Bankenrettung ein Interesse hat, zu ihrem besonderen nationalen Anliegen und feiert den einschlägigen Gemeinschaftsbeschluss dann auch als ihren ganz besonderen nationalen Erfolg: Hier hat Österreich Europa auf den richtigen Weg gebracht![16]
Gleichzeitig meldet Wien aber auch demonstrativ Kritik an und fordert im Namen Europas abweichende Maßnahmen und Korrekturen. Es betätigt sich auch schon einmal als ‚ehrlicher Makler‘, der Ungarn gegen ungerechtfertigte Anwürfe und Sanktionen in Schutz nimmt und mehr europäische Rücksicht auf die ungarischen Kreditnöte – also auf Österreichs gefährdete Kreditengagements in diesen Ländern – fordert:
„Österreichs Finanzministerin Maria Fekter hat drohende EU-Sanktionen gegen das benachbarte Ungarn wegen seines Haushaltsdefizits kritisiert. Fekter merkte am Dienstag vor Beratungen der EU-Finanzminister in Brüssel ‚sehr kritisch‘ an, ‚dass es uns besser gefallen hätte, wenn man den Ungarn noch Zeit lässt, das anzupassen‘. Da Spanien in diesem Jahr ein höheres Defizit erlaubt werde, ‚habe ich doch das Gefühl, dass mit zweierlei Maß gemessen wird‘, sagte sie.“ (focus, 13.3.12)
Solche Beschwerden, dass die Krisenverlierer innerhalb des Euro-Verbunds unverdient viel Berücksichtigung erfahren, während die Konsolidierungsbemühungen anderer, für Österreich wichtiger Länder außerhalb des Euro mit Kreditentzug bestraft würden, zeugen vom Leiden an einer europäischen Krisenpolitik, die Österreich braucht und mitträgt, aber nicht im Sinne seiner Interessen entscheidend beeinflussen kann. Deswegen geht die Regierung dann auch auf Distanz zur deutschen ‚Sparkanzlerin‘. An deren Adresse meldet sie im Verein mit anderen Ländern inzwischen den Bedarf nach europäischer Wachstumsförderung an und bekommt postwendend zu spüren, dass es ihr angesichts deutscher Entschlossenheit, Europa in seinem Sinne ‚neu zu ordnen‘, an Macht fehlt, diesen Appellen mehr Nachdruck zu verleihen, als es deutschen Berechnungen entspricht.
Entsprechend zwiespältig fallen Vorstellungen und
Vorschläge aus, die Wien für die von der Finanzministerin
beschworene neue künftige ‚Architektur‘ Europas
ventiliert. Die orientieren sich einerseits ganz an den
deutschen Verlautbarungen über die Notwendigkeit, in
Europa mehr Aufsicht über die Haushaltsdisziplin der
Staaten zu institutionalisieren. In diesem Sinne tritt
die österreichische Regierung öffentlich für einen Aus-
und Umbau der europäischen Institutionen ein und macht
sich mit einem Bekenntnis zur Notwendigkeit des
Souveränitätstransfers an Brüssel
und der
Forderung nach mehr Macht und Befugnissen des
Währungskommissars
und der Schaffung einer
europäischen Wirtschaftsregierung
(Spindelegger) für eine weiterreichende
Unterordnung der Eurostaaten unter ein dem Euro
verpflichtetes Gemeinschaftskommando stark. Dass sich der
Einsatz für mehr Vergemeinschaftung zugleich dem Wunsch
verdankt, der Dominanz der großen Euro-Mächte Deutschland
und Frankreich irgendwie abzuhelfen, wird allerdings in
den gelegentlich in österreichischen Regierungskreisen
geäußerten Perspektiven einer ‚echten‘ institutionellen
Europa-Reform auch deutlich:
„Was Michael Spindelegger in der Europa-Politik will, ist ein Tabubruch. Der Außenminister fordert ‚schlankere EU-Gremien und weniger EU-Kommissare‘. Er tritt für ein Rotationsprinzip in der Kommission ein. Das bedeutet für Österreich den Verzicht auf einen eigenen und ständigen Kommissar. Bislang beharrte die Regierung auf einem eigenen Kommissar und war bei den Verhandlungen zum Lissabon-Vertrag sogar bereit, ein Veto einzulegen, sollte sie auf den Kommissar verzichten müssen… Nach dem Verzicht auf einen eigenen Kommissar verlangt Spindelegger zweitens die ‚Stärkung der Gemeinschaftsmethode und kein Direktorium gewisser Staaten‘. Damit sagt er Berlin und Paris den Kampf an. ‚Stark sind wir gemeinsam und nicht durch das, was zwei vorgeben‘… Drittens will der Außenminister das Prinzip der Einstimmigkeit – bis auf Vertragsänderungen – aufheben. Veto-Möglichkeiten und Blockaden sind somit für sämtliche Politikbereiche ausgeschlossen.“ (Kurier, 5.12.11)
Der hier angedachte Vorschlag, unter Verzicht auf einen
bisherigen ‚Besitzstand‘ mehr verpflichtende
Gemeinsamkeit zu stiften, geht von der Einsicht aus, dass
durch die von den Vormächten in der europäischen
Krisenkonkurrenz praktizierten erpresserischen Methoden
‚gemeinsamer Beschlussfassung‘ und durch die auf diese
Weise durchgesetzten Fortschritte in der EU die
bisherigen institutionellen Besitzstände einer
‚Mitgestaltung‘ Europas durch Kleinstaaten wie Österreich
ohnehin entwertet sind. Das ist die realistische Seite.
Die Idee, durch Übertragung von Souveränitätsrechten an
die EU-Staatengemeinschaft könnte das Kommando der großen
Euro-Mächte, das Direktorium gewisser Staaten
(Spindelegger),
institutionell aufgefangen und ausgebremst werden, ist
der dazugehörige Idealismus. Der „Tabubruch“ ist insofern
alles andere als eine praktische ‚Kampfansage‘ an Berlin
und Paris, sondern die praktisch folgenlose Bekundung der
Unzufriedenheit, dass die österreichische Regierung als
national interessierter Mitmacher gesamteuropäischer
Krisenpolitik zugleich Leidtragender
deutsch-französischer Europa-Dominanz ist.
Die Alternativen der Opposition für ein neues Österreich in Europa
Die politische Notlage eines zweitrangigen EU-Mitglieds, das in der innereuropäischen Krisenkonkurrenz auf die Schranken seines ökonomischen Vorankommens wie seiner politischen Mitgestaltungsmacht im Euro-Verbund gestoßen wird, fordert die Opposition heraus, die Frage nach einem geeigneten Weg Österreichs in Europa aufzuwerfen. Auch sie arbeitet sich, auf ihre Art, an dem Widerspruch der EU- und Euro-Mitgliedschaft Österreichs ab, der in der Krise zur Zwangslage geworden ist, nämlich zu einem Kampf um Selbstbehauptung nach fremdbestimmten Regeln und Erfolgskriterien nötigt: dem Widerspruch, dass das Land seine Staatsräson auf die Teilhaberschaft an einem imperialistischen Projekt von Dimensionen jenseits der Reichweite seiner nationalen Potenzen abgestellt und sich durch sein national erfolgreiches Mitmachen von politischen und ökonomischen Erfolgsbedingungen abhängig gemacht hat, die von anderen nicht nur definiert und vorgegeben, sondern auch realisiert oder nicht realisiert werden.
Die Oppositionsparteien arbeiten sich daran ab, wie es sich in der Demokratie für eine Opposition gehört. Wo die Regierung mit dem guten Stand Österreichs und der damit gewonnenen Handlungsfreiheit angibt und auf ihren Willen und ihre Fähigkeit verweist, im Gefolge Deutschlands europäische Krisenpolitik nicht zu erleiden, sondern souverän mitzugestalten, sich also auf das Rezept ‚mehr Schein als Sein‘ verlegt, diagnostizieren Grüne und Freiheitliche ein großes Versagen der Verantwortlichen: Die Regierenden schaffen es nicht, in der Krise Autonomie und Nutzen der Nation zu wahren und gegen die nationalen Interessen der Krisenländer sowie auf Augenhöhe mit den Großen als kompetente Platz- und Dienstanweiser im Euro-Raum aufzutreten; stattdessen agieren sie, unterwürfig und an falscher Stelle nachgiebig, als bloße Erfüllungsgehilfen der maßgeblichen Mächte. Sich selbst empfehlen die Oppositionsparteien als die bessere Antwort auf die schwierige Lage, indem sie das Ideal einer neuen glücklichen Deckungsgleichheit der nationalen Vorteilssuche und Machtentfaltung mit der europäischen Unions-Räson beschwören. Denn einig sind sich beide Seiten, auch mit der Regierung, darin, dass es für Österreich zur EU keine Alternative gibt. Fürs Mitmachen in der EU kaprizieren sie sich auf entgegengesetzte Positionen: Die Freiheitlichen bestehen mit viel patriotischem Nachdruck, bedarfsweise hetzerisch, auf dem Ideal, das sich mit der Krise so offenkundig als die Lebenslüge der österreichischen Europapolitik erwiesen hat, nämlich der gesicherten Funktionalisierung der Union für Österreich und seine Belange. Die Grünen verhimmeln den Offenbarungseid über den nachgeordneten Stellenwert Österreichs im Europa-Projekt der Mächtigen zu dem paradoxen Ideal eines nationalen Macht- und Bedeutungsgewinns durch konsequenten Supranationalismus.
Österreichs grüne Europäer
gehen davon aus, dass angesichts der Wucht des internationalen Spekulationskapitals und der konkurrierenden Euro-Mächte eine Politik, die bei allen anstehenden Streitfragen gesamteuropäischer Krisenbewältigung stur auf Wahrung der nationalen Souveränität bedacht ist, nur scheitern kann:
„Gerade die Krise zeigt, dass Europa großteilige Lösungen braucht. Mit der Fortschreibung der Nationalstaaterei kommen wir jedenfalls nicht weiter.“ (Johannes Voggenhuber, ORF, 29.11.11)
Die zukunftsweisende Perspektive sehen sie in der Aufgabe
des ‚kleinlichen‘ Nationalstaatsstandpunkt einer ohnehin
mediokren Macht. Österreich soll den Vorreiter machen,
dass alle europäischen Staaten nationale Vorbehalte
aufgeben zugunsten des Großprojekts eines noch viel
weitergehend vereinten, dadurch erst politisch
handlungsfähigen Europa. Die Krise soll als Sachzwang
fungieren, eine politische Gemeinschaft zu schaffen, die
es erlaubt, die Finanzmärkte wirklich zu kontrollieren,
gesamteuropäisches Wachstum durch Gemeinschaftskredite
anzustoßen, die Entmachtung
der EU durch das
deutsch-französische Führungsdirektorium genauso wie die
kurzsichtige Besitzstandswahrung
und
Vetomentalität
der Mitmacherstaaten zu
unterbinden. Dass Österreich ohne die EU nicht
vorankommt, in ihr aber als Kleinstaat aktuell laufend
auf seine Schranken gestoßen wird, diesen Widerspruch
wollen die Grünen mit ihrem Plädoyer für weniger
nationale Bedenklichkeit und mehr gesamteuropäischem
Staatsbewusstsein also offensiv auflösen. Sie halten das
nationale Leiden von einer höheren, gesamteuropäischen
Warte aus für verkehrt und kontraproduktiv und erheben
das Ideal einer Überwindung der inneuropäischen
Staatenkonkurrenz zum Programm, die Österreich in einem
größeren politischen Subjekt aufgehen lässt, das durch
die nationale Entmachtung an machtvoller politischer
‚Gestaltungskraft‘ gewinnt und den globalen
‚Herausforderungen‘ gewachsen ist.[17]
Die freiheitliche österreichische „Heimatpartei“ in Europa
sieht das umgekehrt, nämlich vom Standpunkt der
angegriffenen nationalen Souveränität, die es zu
verteidigen gilt. Wo die Regierung mit ihrer
Aktivistenrolle bei der Durchsetzung von Fiskalpakt und
Haushaltsaufsicht angibt, bemerkt und verurteilt die FPÖ
den Verlust staatlicher Handlungsfreiheit und die
Nötigung zur nationalen Ausrichtung an einer keineswegs
frei gewählten europäischen Krisenpolitik. Das legt sie
der Regierung als Verrat an Österreich, als
nationalvergessene Auslieferung an fremde Interessen zur
Last: Österreich hat mit seiner Beteiligung an der
Krisenbewältigungspolitik Lasten zu tragen, die, so die
Sicht, der Misswirtschaft anderer Länder,
südländischer Nehmerkultur
geschuldet sind. Die
auf die Sicherung des Euro berechneten
Kreditrettungsanstrengungen sind eine Belohnung für
Pleitestaaten, die die Krise verschuldet haben;
Österreich dagegen wird mit der Inpflichtnahme für die
Rettungsfonds für deren Pleiten auch noch bestraft. Dass
der Euro als gesamteuropäisches Reichtumsmittel
bewirtschaftet wird und deshalb mit gemeinschaftlichen
Rettungsfonds um die Kreditwürdigkeit auch der
Euro-Nationen gerungen wird, die zuvor innereuropäisch
niederkonkurriert worden sind, ist ESM-und
EFSF-Haftungswahnsinn
(FPÖ-Anzeige).[18]
Diese Klagen über eine Österreich schädigende europäische
Krisenpolitik bebildern einen Vorwurf grundsätzlicherer
Natur, auf den die FPÖ alles zuspitzt: Österreich ist
nicht mehr Herr seiner Verhältnisse; erstens weil die
Regierung sich nicht zu deren Herrn, sondern zum
willfährigen Exekutor der Befehle der deutschen
Bundeskanzlerin
(Strache,
Parlamentsdebatte 14.12.11) macht; zweitens wegen
einer fundamental falschen Ausrichtung Europas, die in
der aktuellen Krise auch noch verstärkt, statt korrigiert
wird. Jetzt, wo die bisherigen Sicherheiten für ein
Vorankommen Österreichs in und mit Europa dahin sind und
der Staat auf die Schranken seiner politischen
Mitbestimmungsmacht gestoßen wird bzw. neue erfährt,
bestätigen sich für die FPÖ alle Vorbehalte und
Befürchtungen, die sie bezüglich Europas immer schon
angemeldet hat.
Wo es um die politische Grundfrage geht, wieweit die
konkurrierenden Staaten sich im nationalen Interesse zur
Abtretung nationaler Bestimmungsrechte an die Brüsseler
Zentrale durchringen oder hindrängen lassen, ist für
diese Partei die Antwort klar: Eine Ausdehnung der
Kompetenzen der EU-Institutionen, das ist noch mehr
Diktatur des bürokratischen Wahnsinns durch den
Machtapparat der Europäischen Kommission
(ebd., S. 274). Dem setzt die FPÖ
programmatisch die Forderung nach einer
Renationalisierung der Europäischen Union
entgegen: nach einem Europa, in dem die mit
größtmöglicher Souveränität ausgestatteten
Nationalstaaten die Herren des Verfahrens sind und
bleiben:
„Ein europäischer Staatenbund kann nur bei gleichzeitiger Renationalisierung verwirklicht werden… Die Verfassungen der souveränen Mitgliedsstaaten müssen absoluten Vorrang vor dem Recht der Union haben.“ (FPÖ-Handbuch, S. 274)
Die auf Verteidigung von Österreichs Souveränität bedachte politische Kraft macht sich also dafür stark, das Verhältnis des Landes zur EU umzukehren, die Mitgliedschaft so einzurichten, dass es seine Europa-Beteiligung ganz nach seinen nationalen Vorgaben und Vorbehalten ausgestalten kann. Sie vertritt den Standpunkt, dass Österreichs Politiker sich nur zu einer nationalbewussteren Stellung zur EU entschließen müssten, um die fundamentale Frage, was aus Österreich in der EU wird, in ihrem Sinne zu entscheiden. Durch Distanz und Neinsagen zu Europa muss und kann die Politik dafür sorgen, dass Österreich Herr der Lage bleibt und Europa für sein nationales Vorankommen funktionalisiert. Ein solch widersprüchliches Programm zeugt schon wieder von der Not, in den aktuellen Fortschritten der Staatenkonkurrenz keine zufriedenstellenden Perspektiven für den Status Österreichs in Europa auszumachen; es zeugt zugleich von der unverdrossenen Überzeugung ambitionierter Nationalisten, mit entsprechendem Willen könnte Österreich sich ganz anders gegen die Zumutungen einer Unterordnung unter die großen EU-Mächte wehren und souveräner in Europa agieren.[19]
Angesichts der fortdauernden Krise und der anhaltenden Auseinandersetzungen um ihre europäische Bewältigung meldet sich als Anwalt grundsätzlicher Unzufriedenheit mit der österreichischen und europäischen Krisenbewältigungspolitik
Noch eine ‚neue politische Kraft‘: das Team Stronach
Mit dem Nimbus ökonomischer Kompetenz eines
konkurrenztüchtigen Unternehmers (Ich bin der weltweit
größte Autobauer
) und prinzipieller Distanz zur
etablierten Riege ‚unfähiger Politiker‘ (Ich war nie
Politiker, sondern Verantwortlicher für einen der größten
Privatbetriebe der Welt.
) repräsentiert der
weltläufige Kapitalist mit seinem ‚Team‘ ein
Rettungsprogramm, das sich um die Fragen der beschädigten
politischer Souveränität gar nicht kümmert. Er definiert
die Problemlage Österreichs streng ökonomisch, als
Versagen vor den Anforderungen erfolgreichen
Wirtschaftens und Haushaltens und fordert und verspricht
eine Abhilfe, die dieser Diagnose entspricht – eine
politische Rückbesinnung auf die Prinzipien
kapitalistischen Unternehmertums und deren sachkundige
Verfolgung: Einen Staat muss man wie ein
Wirtschaftsunternehmen führen und da habe ich die beste
Erfahrung.
Professionelles ökonomisches
Staatsmanagement statt politischer Gschaftlhuberei und
Kumpanei; erfolgreich die Krise wegwirtschaften, statt
dem Staat Schulden für gescheiterte Spekulation und
europäische Misswirtschaften aufbürden; Neuverhandlung
des Euro, statt österreichischer Beteiligung an der
Rettung unrettbar schlechter Euro-Schulden. Kurz: Freie
Bahn für erfolgreichen österreichischen Kapitalismus in
und gegen Europa! Mit diesem politischen Schlachtruf
sollen alle Probleme, vor die sich Österreich in der
Krisenkonkurrenz um den gemeinsamen Euro gestellt sieht,
erledigt sein.
*
Ob die Oppositionsparteien nun die Vision von der ‚Finalisierung‘ der Europäischen Gemeinschaft verkünden, ob sie die Abspaltung des guten Nordeuropa vom maroden Süden und eine Renationalisierung nach Art der Londoner Politik befürworten, ob sie auf mehr nationale Kapitalfreiheit setzen – vorausgesetzt bleibt, und Motor dieser Visionen einer anderen Stellung Österreichs in und zu Europa ist die politische Krisenlage der Nation innerhalb Europas: dass Österreich nicht zu den Machtsubjekten gehört, die darüber bestimmen, wie es in der Krise mit ‚Europa‘ weitergeht, dieses ‚Europa‘ aber die entscheidende Bedingung seines nationalen Reichtums und seiner Macht ist. Die Regierung verteidigt deshalb auch ihre Politik mit dem Hinweis auf die Sachzwänge, die mit einer EU-Mitgliedschaft verbunden und im österreichischen Interesse zu berücksichtigen und zu managen wären. Zur Bewährung an und zum möglichst aktiven Mitmachen bei europäischer Krisenpolitik sieht sie keine Alternative.
[1] In Österreich
tickt eine ‚Haftungsbombe‘. Nur in Irland ist der
Anteil öffentlicher Garantien und Haftungen am BIP noch
höher als in Österreich, sagt eine Eurostat-Studie. Das
Bedrohungspotenzial erreicht schon die Hälfte der
‚offiziellen‘ Staatsschuld.
(Presse, 27.7.12)
[2] Ohne Osteuropa
hätte das Exportplus zwischen 2003 und 2009 statt 7,2 %
nur 4,9 % betragen.
(Wiener
Zeitung, 10.10.11)
[3] Die direkten
Auslandsinvestitionen Österreichs sind heute 14-mal
höher als 1995 (EU-Beitritt), die direkten
Investitionen nach Österreich achtmal so hoch.
Österreich ist zum Exportstar geworden.
(Mc Kinseystudie, Standard.at,
10.1.12)
[4] Der CEO der Erste
Group, Andreas Treichl, wird nicht müde zu wiederholen,
dass es ohne das Ostgeschäft keine österreichischen
Banken mehr gäbe.
(NZZ,
30.4.10)
Das Engagement in Osteuropa ist generell eine
Erfolgsstory. Es hat den Instituten geholfen eine Größe
zu erreichen, von der sie profitieren.
(Notenbankgouverneur Nowotny, Presse,
28.1.12)
[5] Die schlechter
werdende Bewertung der Märkte MOSOEs im Zuge der Krise
zog schließlich auch die Bewertungen österreichischer
Banken hinab. Die hohe Einschätzung der Risiken und die
hohe Unsicherheit wirkten sich besonders auf die
Marktbewertung der beiden größten börsennotierten
Banken aus. Die Erste Bank verlor bis 2009, im
Vergleich zum Höchststand im zweiten Quartal 2007, rund
81 Prozent ihres Marktwerts und Raiffeisen
International, im Vergleich zum Höchststand im dritten
Quartal 2007, rund 88 Prozent.
(Frank, Stephanie, Wirtschaftskrise(n) 2007
bis 2010, 2012, S.91)
[6] Ausschlaggebend
für die (negative) Entscheidung der Rating Agentur ist
die ungeklärte Entwicklung der österreichischen Banken,
die stark in Osteuropa engagiert sind. Etwa eine
Staatspleite in Ungarn könnte Millionenabschreibungen
bei den großen Banken wie Raiffeisen oder Erste Bank
nach sich ziehen.
(Handelsblatt, 26.1.12)
[7] Für Österreichs
Volkswirtschaft ist das Funktionieren des heimischen
Bankensystems ob seiner Größe von immanenter Relevanz.
Im Oktober 2008 beschloss das Parlament ein
Maßnahmenpaket zur Sicherung und Stabilisierung des
österreichischen Finanzmarktes. Es umfasste einen
Maximalbetrag von 90 Mrd. Euro und entsprach damit
31,93 % des BIPs von 2008, respektive dem 1,31-Fachen
der gesamten Budgeteinnahmen 2008. Im Vergleich: Die
deutsche Regierung spannte im Oktober 2008 einen
Rettungsschirm in der Höhe von 20,09 % des BIPs von
2008.
(Die Presse,
19.5.10) Im November 2009 wurde die
Kommunalkredit verstaatlicht, die vor allem über die
Anhäufung griechischer Staatsanleihen bankrottierte.
2009 wurde die Hypo Alpe Adria ob ihrer gescheiterten
Balkaninvestments notverstaatlicht (siehe dazu
GegenStandpunkt 3-10). Seither tobt der Kampf zwischen
Wien und München um die Aufteilung der
Entwertungskosten. 2011 kam es nach einem umfassend
gescheiterten Ostengagement zur Teilverstaatlichung der
Volksbanken AG und zum Notverkauf an die russische
Sberbank.
[8] Auf die Bremse
treten nicht nur Banken, sondern auch Regulatoren. Mit
Besorgnis zur Kenntnis genommen wird in Osteuropa etwa
ein im November von Österreichs Behörden verordnetes
Maßnahmenpaket. Dabei wird den österreichischen Banken,
die seit Jahren den größten Teil ihrer Erträge in
Osteuropa erwirtschaften, die Vergabe neuer Kredite im
Auslandsgeschäft eingeschränkt. Gemäß einer Weisung der
ÖNB und der Finanzmarktaufsichtsbehörde darf in Zukunft
nur noch ein Gesamtbetrag in der maximalen Höhe von
110 % (in der Wachstumsphase waren es 200 %) der lokal
vorhandenen Spareinlagen als Neukredit vergeben
werden.
(NZZ, 20.12.11)
Die im Frühjahr 2010 von der Finanzmarktaufsicht
und der Österreichischen Nationalbank veröffentlichten
‚Guiding Principles‘ zur Begrenzung der Neuvergabe von
Fremdwährungskrediten (FWK) ... fordern eine Beendigung
von besonders riskanten FWK-Formen wie z.B. von nicht
währungsgesicherten Krediten in Schweizer Franken an
private Haushalte oder kleine und mittlere Unternehmen
sowie von Konsumkrediten in Euro an private Haushalte
mit geringer Bonität. Künftig wird eine Ausweitung des
Geltungsbereichs der ‚Guiding Principles‘, wie etwa auf
Euro-Hypothekarkredite, ins Auge gefasst.
(ÖNB, Fakten zu Österreich und
seinen Banken, 2012-2013)
[9] Dabei handelt es
sich um einen 2009 von der Europäischen Bank für
Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) ins Leben gerufenen
Zusammenschluss. Beteiligt sind auch die EU, der
Internationale Währungsfonds (IWF), die Weltbank und
die Europäische Investitionsbank. Ein Ziel der
Vereinigung ist es, einen unkoordinierten Abzug von
Geldern aus der Region zu verhindern. Dieser erscheint
deshalb als Gefahr, weil der Bankensektor der Region
schwergewichtig durch ausländische Institute
kontrolliert wird. Letztere kämpfen indes mit
strengeren Eigenkapitalvorschriften und der
Notwendigkeit eines Schuldenabbaus, worunter auch die
Unterstützung für Tochtergesellschaften im Osten leiden
könnte.
(NZZ, 5.5.12)
[10] Zwischen
September 2011 und Juni 2012 haben die internationalen
Banken ihr Engagement in Ungarn um 18 Milliarden Dollar
(14 Milliarden Euro) gekürzt. Das waren 14 Prozent des
ungarischen Bruttoinlandsprodukts (BIP). Damit sind auf
Ungarn 40 Prozent aller Abflüsse aus der Region
(Kroatien, Polen, Rumänien, Slowakei, Tschechische
Republik, Ungarn) entfallen.
(FAZ, 13.11.12)
[11] Obwohl viele
zentral- und südosteuropäische Länder in den letzten
beiden Jahrzehnten einen beachtlichen wirtschaftlichen
Aufholprozess durchlaufen haben, liegen die
Volkswirtschaften dieser Region im Kennzahlenvergleich
nach wie vor unter dem Niveau der meisten EU-15 Länder.
Es besteht also großes Potenzial für
überdurchschnittliches Wachstum, nicht nur in der
Region selbst, sondern auch in den Ländern, die
intensive Wirtschaftsbeziehungen mit diesen Ländern
unterhalten. (Dank der großen geografischen Nähe und
der historisch bedingten Verbundenheit mit der Region
ist die österreichische Wirtschaft (und damit auch der
österreichische Bankensektor) besonders gut
positioniert, um von diesem Wachstumsprozess zu
profitieren.)
(Österreichische
Nationalbank, Fakten zu Österreich und seinen Banken,
Feb. 2012)
[12] Westliche
Banken ziehen unvermindert Kapital aus Osteuropa ab.
Die Summen, die hier zurückfließen, seien aber gering
im Vergleich zu den Abflüssen, die die
Euro-Krisenländer Griechenland, Spanien und Irland
derzeit erleiden. Zu diesem Schluss kommt eine gestern,
Donnerstag, veröffentlichte ‚Deleveraging-Studie‘ der
Erste Group.
(Die Presse,
8.11.12)
[13] An sich selbst spart der Staat vor allem beim Bundesheer; da sollen 600 Millionen gestrichen werden. Als weiterer, eher symbolischer Beitrag soll die Anzahl der Parlamentsabgeordneten von 183 auf 165 reduziert werden. Die Neugestaltung des Bundesrats und die Zusammenlegung von Gemeinden und Regionen sollen folgen.
[14] Im Fall
Griechenland verweigert Österreich bis zuletzt die in
der EU mehrheitlich für notwendig gehaltene
Fristverlängerung für den Schuldendienst. Angesichts
der Vorbehalte der Slowakei gegen den
Euro-Rettungsfonds spricht sich der österreichische
Außenminister hingegen entschieden dafür aus, im
Ernstfall den Rettungsschirm ohne die Slowakei
aufzuspannen.
(Spindelegger,
Wiener Zeitung, 11.11.11)
[15] Von Ungarn verlangt die Finanzministerin schon aus eigenem Interesse unter anderem eine Kostenteilung bei den Abschreibungen der von den Banken vergebenen Frankenkredite, die vollständige rechtliche Gleichstellung ausländischer Grundeigentümer in Ungarn, die Abschaffung der Sondersteuer für ausländische Unternehmen sowie die Rücknahme nicht EU-konformer Gesetze. Österreich schließt sich damit den Beschwerden und Forderungen Deutschlands und der EU an und setzt darauf, dass es mit denen gemeinsam die widerspenstige Orban-Regierung zur ‚Räson‘ bringt.
[16] Ein großer
Verhandlungserfolg für Osterreich
, so die
Finanzministerin; ein Schritt in die richtige
Richtung
, so der Kanzler. (Kurier, 15.2.13) Schon
2011 lobt sich die Regierung für den Vorschlag der
Europäischen Kommission für eine EU-weite
Finanztransaktionssteuer: Der Vorschlag entspricht
weitestgehend dem, was Österreich seit 2008 fordert.
Die Finanzmärkte werden damit endlich mehr für die
Stabilität der Staatshaushalte beitragen.
(Bundeskanzler Faymann,
28.9.11)
[17] Die
Machtprojektionen, mit denen die Grünen für
europäischen Supranationalismus eintreten, reichen bis
zu Perspektiven einer politischen und militärischen
Stärkung Europas
für eine selbstbewusste,
europäische Außenpolitik
in Konkurrenz zu den USA.
(Homepage des grünen Wehrsprechers Peter Pilz).
[18] Das ist nicht nur volkstümliche Propaganda; die FPÖ meint es ernst mit der Sortierung und fordert den Ausschluss der ‚Bankrottkandidaten‘ aus der, dann endlich ‚homogenen‘ und ‚wirtschaftlich schlagkräftigen‘ EU – im ‚wohlverstandenen Interesse aller‘, versteht sich:
Nach gewissen vorübergehenden
Stabilisierungsmaßnahmen ist der für die FPÖ einzig
gangbare Lösungsansatz, dass wirtschaftlich schwächere
Staaten die Währungsunion verlassen und zu ihren
angestammten Währungen zurückkehren – ein Ansatz, der
in letzter Zeit von immer mehr Kommentatoren und
Wissenschaftlern vertreten wird. Dieser Schritt
ermöglicht es den Betroffenen, für ihre jeweiligen
Anforderungen maßgeschneiderte Geld- und
Währungspolitik zu betreiben, durch Abwertungen ihre
wettbewerbs- und produktivitätspolitischen Defizite zu
kompensieren und mittelfristig ihre Leitungsbilanz
wieder in Ordnung zu bringen, während die
wirtschaftlichen Leitnationen der EU die Mittel zur
Förderung ihrer eigenen Positionen im globalen
Wettbewerb wesentlich produktiver und zum Vorteil aller
investieren können. Nicht die schiere Größe der
Eurozone entscheidet über ihren Erfolg, sondern ihre
Homogenität und wirtschaftliche Schlagkraft. Diese zu
optimieren ist das Ziel der FPÖ.
(FPÖ-Handbuch, S.271)
[19] Deshalb entdeckt
die Partei allenthalben auswärtige Bevormundung und
ausländische Fremdbestimmung und verbindet das
schöpferisch mit der Beschwörung der Gefahr
österreichischer Überfremdung. Fürs Volk, das seine
unbefriedigende soziale Lage nationalistisch deutet,
liefern die Freiheitlichen entsprechende Parolen:
Heimatliebe statt Marokkaner-Diebe.
Die
Ausländerfeindschaft der Partei verdankt sich aber
nicht sozialen Problemlagen, derer sie sich als
politischen Auftrag zu schärferer nationaler Sortierung
annimmt, sondern entspringt dem nationalistischen
Leiden an den Beschränkungen des Staats selber .