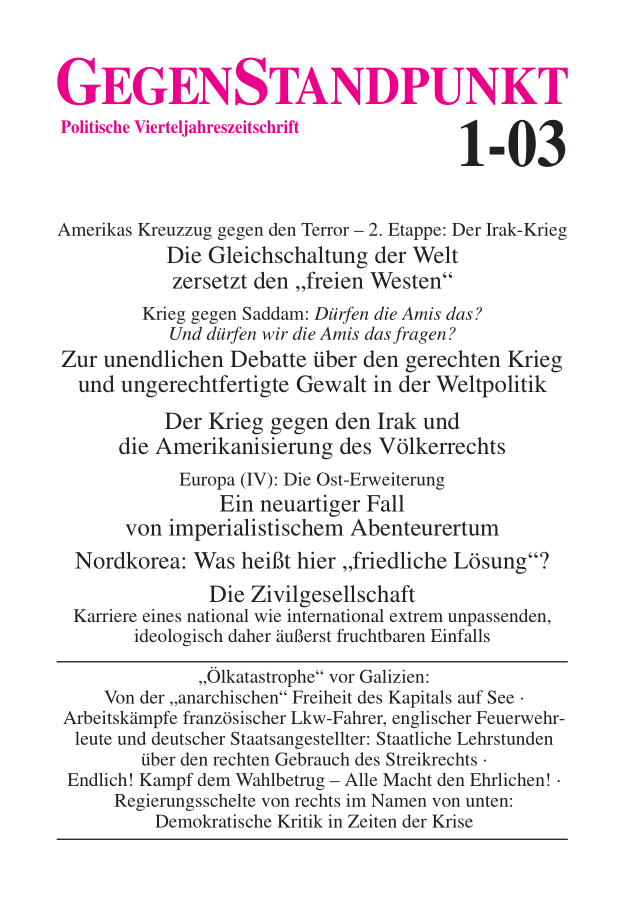Aus der Reihe „Chronik - kein Kommentar!“
„Ölkatastrophe“ vor Galizien:
Von der „anarchischen“ Freiheit des Kapitals auf See
Hunderte von Kilometern der galizischen Küste sind auf Jahre hin asphaltiert, weitere Teppiche aus Millionen von Ölklumpen schwimmen auf die französischen Atlantikküsten zu. Ursache ist die Havarie und der Untergang des Öltankers „Prestige“, der seine giftige Ladung auf unabsehbare Zeit an das Meer abgeben wird.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
„Ölkatastrophe“ vor
Galizien:
Von der „anarchischen“ Freiheit des
Kapitals auf See
Hunderte von Kilometern der galizischen Küste sind auf Jahre hin asphaltiert, weitere Teppiche aus Millionen von Ölklumpen schwimmen auf die französischen Atlantikküsten zu. Ursache ist die Havarie und der Untergang des Öltankers „Prestige“, der seine giftige Ladung auf unabsehbare Zeit an das Meer abgeben wird. ‚Schon wieder!‘, ruft die Öffentlichkeit, ist entsetzt über das Ausmaß des Schadens – und wundert sich doch überhaupt nicht darüber, dass „es“ schon wieder passiert ist. Ein großes Geheimnis sind die unfallträchtigen Eigenheiten der modernen Seeschifffahrt an sich nämlich nicht, ebenso wenig wie die ökonomischen Interessen, denen sie sich verdanken: Transportschiffe werden immer größer, weil Geschäftsleute das „Gesetz der Größendegression“ – bei wachsender Schiffsgröße sinken aufgrund des degressiv ansteigenden Schiffswiderstandes in bestimmten Grenzen sowohl die Transportkosten je Tonne Öl als auch die Bau- und Betriebskosten je Tonne Tragfähigkeit – ausgiebig als Hebel ihrer Profitmacherei in Anspruch nehmen. Die verbietet es auch, den Vorteil des degressiv ansteigenden Schiffswiderstandes durch das Gewicht des Schiffes wieder kaputt zu machen, also dürfen dessen Wände nicht zu dick sein. So pflügen Pötte mit dem Dauersignal „manövrierbehindert“ durch die Weltmeere, deren Kapitäne darauf setzen, dass ihnen nicht nur kleinere Schiffe, sondern schon auch Stürme und Untiefen ausweichen werden. Unterwegs sind sie mit ihren „schwimmenden Zeitbomben“ bekanntlich auch deswegen so viel, weil der Preis ihrer kostbaren Fracht Gegenstand einer täglichen Spekulation an den internationalen Energiebörsen ist: Aus der ergibt sich, wo und wann das Öl wieder abgepumpt wird, das sie an Bord haben, so dass die Eigentümer mit ihren Schiffen eine spekulative Vorratshaltung auf den Meeren aufbauen und sie zum richtigen Zeitpunkt dorthin dirigieren, wo für die Ladung der beste Preis zu erzielen ist. Das alles ist kapitalistischer Normalzustand, und abgebrühte Kenner der Szene wundern sich schon längst nicht mehr über Unfälle, sondern darüber, „dass nicht viel öfter was passiert“ (ein Verkehrsfachmann für die Ostsee).
*
Darüber, dass reichlich viele von diesen „schwimmenden
Zeitbomben“ auf den Meeren herumfahren, pflegt man sich
erst dann aufzuregen – das dafür aber regelmäßig –, wenn
wieder mal eine dieser „Ölkatastrophen“ „passiert“. Dann
macht man sich auf die Suche nach einer Ursache, die vom
kapitalistischen Grund der herrschenden
Risikofreudigkeit auf den Weltmeeren nichts wissen will,
weil sie nur die Schuldigen ausfindig machen
will, welche für die Störung des reibungslosen
Geschäftsgangs auf der Hohen See verantwortlich sind. So
ermittelt man den „betrunkenen Kapitän“ oder den
„skrupellosen Reeder“, der „an der Wartung gespart“ hat,
oder entdeckt gleich „kriminelle Energie“, und stößt
damit zielstrebig zur immer gleichen Quelle allen
„Versagens“ vor: Der Staat habe nicht richtig
aufgepasst; er hätte die „Mängel“ schon „im Vorfeld“
verbieten und auf ihre Beseitigung achten müssen; er
hätte die allenthalben üblichen „Verstöße“ gegen seine
Auflagen „konsequenter“ verfolgen, seine Vorschriften
„verschärfen“, die „Übeltäter“ „härter“ bestrafen, kurz:
für mehr Recht und Ordnung
in diesem
Geschäftszweig sorgen müssen. Er hat es also an
Kontrolle fehlen lassen – und die ist
es, die unbedingt verbessert gehört. Denn im Grunde kann
es diese „Welt voll schrecklicher Gefahren“ doch nur
geben, weil die Instanz nicht recht präsent ist, die dazu
auserkoren ist, alles zum Guten zu wenden:
„Leider herrscht auf dem Wasser oftmals die reine Anarchie, wo jeder tun kann, was er will.“ (FR, 27.11.02)
Schon interessant, wann bürgerliche Köpfe anfangen, sich Sorgen zu machen, und welchem Umstand die dann gelten. Dass die Freiheit eines kapitalistischen Geschäftsmanns, der „tun kann, was er will“, offenbar jede Menge an praktizierter Rücksichtslosigkeit einschließt, scheint diesem Bedenkenträger von Haus aus selbstverständlich zu sein. Seine Kritik jedenfalls gilt nicht den Kalkulationen der Profitmacherei, sondern einer allzu eigenmächtigen „Entfaltung“ des marktwirtschaftlichen Geschäftssinnes, der sich da an aller staatlichen Kontrollaufsicht vorbei auf dem Wasser austoben soll. Und wenn es kapitalistische „Anarchie“ ist, die der Allgemeinheit Katastrophen beschert, so steht damit umgekehrt auch schon fest, wie die allein zu verhindern sind. Der Staat hat diesen ‚rechtsfreien Raum‘ in seinen Griff zu nehmen.
Dieses Ansinnen stellt Grund und Folge vollends auf denn Kopf. Denn dass die kapitalistische Konkurrenz staatliches Werk ist, gilt auch auf Hoher See. Auch in der „freien Seeschifffahrt“ kann sich der kapitalistische Geschäftsgeist nur auf der vom Staat gesetzten rechtlichen Grundlage entfalten, kommt ohne den Staat kein einziges Wirtschaftsinteresse zur Geltung und geht jede ‚Eigenmächtigkeit‘ der Geschäftsleute auf seine Lizenz zurück. Denn wenn Staaten – im Großen und Ganzen – großzügig darauf verzichten, die Meere jenseits ihrer hoheitlichen 12- bzw. 200-sm-Zone in Besitz zu nehmen, so heißt das nicht, dass auf dem Meer ein rechtloser Zustand herrschen würde. Vielmehr haben sich die 163 Staaten der „International Maritime Organisation“ (IMO) auf ein gemeinschaftliches Hoheitsgebiet geeinigt und eine für dieses geltende internationale Rechtsordnung etabliert. Leitlinie dieser Rechtsordnung ist die staatlich gewollte und eingerichtete „Freiheit des Welthandels“, zu der selbstverständlich auch Freiheiten für die ‚internationale Wettbewerbsfähigkeit‘ des Transportkapitals gehören: Die sind es, die bei der Konstruktion einer ‚internationalen Rechtsordnung‘ auf der See manche Rücksichtnahme auf den Gesichtspunkt der Kostensenkung und daher Befreiung von kostentreibenden staatlichen Auflagen gebieten. Denn was im zwischenstaatlichen Streit um international geltende Rechte und Pflichten der Seefahrt – neben dem Interesse am Nutzen der ‚internationalen Rechtsordnung‘ für die jeweils eigene Nation – allen Parteien gemeinsam ist, ist die tiefe Abneigung gegenüber „übertriebenen“ Sicherheitsvorschriften – und das sind allemal solche, die das Geschäft mit zu hohen Kosten belasten. Wenn, dann herrscht darüber Konsens zwischen den Staaten, so dass sie es hinsichtlich der Rechtsregeln für die Sicherheit der freien kapitalistischen Schifffahrt im Wesentlichen bei den bewährten Kollisionsverhütungsregeln – KVR belassen. Diese Regeln zur Kollisionsverhütung gibt es seit 1834, und sie helfen den Kapitänen und insbesondere den Eigentümern bei der Abwicklung der Rechtsfragen im Schadensfall, ansonsten halten die Initiatoren und Aufpasser der internationalen Konkurrenz das Interesse an Sicherheit im Wesentlichen im Eigeninteresse der Eigentümer bzw. der Versicherer für bestens aufgehoben: Sie überlassen die Schiffsprüfungen den Klassifikationsgesellschaften, die einst von den Schiffsversicherungen zur Absicherung ihres Geschäfts eingerichtet und dann unter staatliche Aufsicht gestellt wurden, und setzen für die „Hafenstaatsüberprüfungen“ eine Überprüfungsquote von 25% fest. Diese „Belastung“ lässt sich sofort wieder in ein – staatliches – Mittel der Konkurrenz übersetzen, was z.B. der französische Staat vorführt, der auch 9% überprüfte Schiffe für ausreichend hält; das senkt seine Kontrollkosten und macht die französischen Häfen attraktiver – eine Praxis, die so einzigartig nicht ist, wie die seit Jahren in der EU diskutierte Uneinigkeit über die laxe Verfolgung der Überprüfungsquoten zeigt:
„Der eine Hafenstaat profitiert davon, dass ein anderer gemieden wird, weil dieser strengere Maßstäbe anlegt.“ (SZ, 20.11.02)
*
Dass eine laxe Überwachsungspraxis eingerissen sei, kann man auch dem so genannten ‚Billigflaggensystem‘ nicht nachsagen. Zwar bildet sich die Öffentlichkeit anlässlich von Havarien, bei denen Schiffe unter ‚Billigflaggen‘ beteiligt sind, gerne ein, den Grund für das Unglück gefunden zu haben: Diese Schiffe hätten sich strengeren nationalen Vorschriften entzogen – und denken soll man: „Seelenverkäufer“. Allerdings: Wenn deutsche Reeder drei Viertel ihrer Schiffe unter ‚Billigflagge‘ laufen lassen, werden sie dem TÜV in Tobago oder Panama schon vertrauen, wie auch übrigens die Bundeswehr, die ihr Transportgut von liberianischen ‚Billig‘-Schiffen transportieren lässt. Vor allem aber ignoriert auch diese Deutung wieder, dass sich das Billigflaggensystem ebenfalls einem Beschluss der IMO-Staaten verdankt, die den auf den Weltmeeren dahinfahrenden Sonderfall exterritorialer nationaler Rechtshoheit einvernehmlich geregelt haben: Reeder und Konzerne werden in gewissem Umfang aus der nationalen Aufsicht und Rechtsprechung entlassen, um ihnen zu einer grundlegenden Senkung der Betriebskosten (Ausbildung und Lohn der Besatzung, Sozialkosten), der Steuern und der im Unglücksfall zu erwartenden Schwierigkeiten zu verhelfen. Und diese Schiffe sind deswegen so häufig an Unfällen beteiligt, weil von diesem Recht reichlich Gebrauch gemacht wird und gemacht werden soll. Weil es die Staaten so eingerichtet haben, halten sie sich – selbst wenn sie als Seeanrainer dadurch immer wieder von kleineren oder größeren „Umweltkatastrophen“ „betroffen“ werden – an ihren gemeinsamen Beschluss. Das kann man auch als Respekt vor einem über ihnen stehenden Gut ausdrücken:
„Aus Respekt vor den Grundsätzen des liberalisierten internationalen Kapitalverkehrs scheut die internationale Staatengemeinschaft aber davor zurück, das System der freien Flaggenwahl anzutasten.“ (FR, 27.11.02)
Wenn schon ‚Sicherheit auf dem Meer‘ eine sehr relative,
von den kapitalfördernden Kalkulationen der beteiligten
Staaten abhängige Angelegenheit ist, so ergeht es der
lieben Umwelt
schon gleich nicht besser. Auch
dieses hohe Gut steht zu dem anderen, „den Grundsätzen
des liberalisierten internationalen Kapitalverkehrs“, in
einem gewissen Widerspruch, und wenn die Staaten das
Meer zu einem gemeinschaftlich zu nutzenden und
kostenlosen ‚Gut‘ erklärt haben, dann steht mit der
dekretierten Güterhierarchie auch fürs Wasser fest:
Auch hier gelten die höherrangigen Völkerrechts-Normen
der freien Schifffahrt
, und die sehen eine Schonung
des Meeres einfach nicht vor: Ein Gut ohne Eigentümer hat
Eigentümern nicht Kosten zu verursachen, sondern ihnen
und dem Gewinn bringenden Gebrauch ihres Eigentums
kostenlos zur Verfügung zu stehen, ist also zur
Ruinierung freigegeben. Falls diese Freiheit andere
Eigentümer, die genau so denken, in Mitleidenschaft
zieht, sind die Konsequenzen zu regeln: Zur
rechtlichen Folgenbewirtschaftung der
kapitalistischen Freiheit auf See gibt es daher
„Ölverschmutzungsabkommen“ und „Ölhaftungsabkommen“. Das
Reinigen von Tanks auf hoher See fällt nicht mit
darunter, sofern ein „Sicherheitsabstand“ eingehalten
wird, und auch für das Verklappen von Chemikalien gibt es
einen rechtlichen Rahmen. Zu ihrem Recht kommt die
„Umwelt“ dann, wenn keine ökonomischen Interessen im
Spiel sind: Jeder Freizeit-Segler muss nach dem Maritime
Pollution Abkommen (MARPOL) im Mittelmeer oder in der
Ostsee mit empfindlichen Strafen rechnen, wenn er
innerhalb der 12-sm-Zone zerkleinerte Lebensmittel mit
einer Kantenlänge von mehr als 25 mm über Bord wirft, und
jeder Urlaubskapitän muss die türkische Küste absuchen
nach einer Absaugstation für den organischen Inhalt
seiner Fäkalientanks. Ein „Ölunfall“ gilt hingegen als
„unbeabsichtigtes Einleiten von Öl“ und unterliegt damit
lediglich einer Meldepflicht.
*
„Nachdenken“ und „Respekt vor der Natur“ setzt freilich ein, wenn mal wieder ordentlich Küstenstriche eingesaut worden sind und ein Staat sich fragen muss, ob nicht er zum Betroffenen geworden ist. Wenn die Beschädigung des Eigentums so weit geht, dass sie nicht mehr so einfach als normaler Versicherungsfall abzuwickeln ist, wenn ungeplante Ölanlieferungen an der Küste Grundlagen des kapitalistischen Geschäftemachens gefährden und sogar den Staatshaushalt angreifen, gewinnt der „Schutz der Umwelt“ einen eigenen Stellenwert. Der setzt freilich keine einzige kapitalistisch übliche Rechnungsweise außer Kraft, und auch an der Risikofreude, die die Staaten schon in punkto ‚Sicherheit‘ an den Tag gelegt haben, ändert sich nichts. Denn jetzt gilt das Prinzip der möglichst kostengünstigen „Bewältigung“ des Schadens, der von Staats wegen nicht zu vernachlässigen ist, weil er nationalen Handel und Wandel und damit alle möglichen Staatsrechnungen selber betrifft. Was die „Schadensvorsorge“ betrifft, versuchen die politischen Hüter des betroffenen Standorts vor allem, die eigene Betroffenheit auch anderen Staaten als deren und so als allgemeine Betroffenheit nahe zu legen und sie darüber zu gemeinsamen Vorkehrungen zu bewegen. Die so in Gang gebrachten zwischenstaatlichen Verhandlungen über deren Kosten orientieren sich ganz an der Logik, die schon bei den Beschlüssen bezüglich der ‚Sicherheit‘ für das rechte Augenmaß sorgt: Wenn es um die „gerechte“ Aufteilung von Kosten für Küsten-Schutzmaßnahmen u. dergl. geht, steht von vornherein fest, dass ein Konkurrenznachteil auf keinen Fall entstehen darf, vielmehr die Kosten der „Allgemeinheit“ möglichst auf andere abzuwälzen sind. Generell ist ausgemacht, dass „voreilige“, mit Kosten verbundene Aktionen gegen noch gar nicht abzusehende Schäden dem nationalen Kapital schon jetzt Schaden in seiner ‚internationalen Wettbewerbsfähigkeit‘ zufügen, also tunlichst zu unterbleiben haben. Dementsprechend sehen die Lehren dann aus, die Staaten unter dem Eindruck schwerer Tankerunfälle ziehen: Wie schnell die Dickschiffe bersten können, wissen sie; verhindern wollen sie es nicht, weil ihnen die „Freiheit der Weltmeere“ über alles geht; aber die „Katastrophen“ würden sich vielleicht nicht so häufen, wenn man – so der schlaue Einfall – den Schiffen eine zweite Hülle verpasst; doch diese Tanker müssen erstens erst noch gebaut werden, zweitens hat man doch schon voll funktionsfähige ‚Einhüllentanker‘; die außer Dienst zu stellen, ist den Konzernen nicht zuzumuten; hinzu kommt der finanzielle Nachteil für die Häfen, die solchen Schiffen die Einfahrt verweigern müssten… So verblassen vor den wirtschaftlichen Folgen eines „Alleingangs“ in Sachen „Sicherheit im Havariefall“ dann auch die wirtschaftlichen Folgen eines besonders großen Schadens, wie die EU dies nach dem Erika-Unglück 1999 vor der Bretagne beispielhaft vorgeführt hat: Das in der ersten Aufregung beschlossene Verbot von Einhüllentankern in EU-Gewässern wurde wieder auf das von der IMO weltweit vorgeschlagene Datum von 2015 vertagt, damit keine „Exklusivität“ der EU-Regelung gegenüber anderen Küstenstaaten entsteht. So können die Reeder den natürlichen Verschleiß ihrer Tanker abwarten – die Versicherungsprämie für die eine oder andere Ölkatastrophe eingerechnet –, und alle europäischen Häfen konkurrieren untereinander weiterhin unter denselben Bedingungen um einlaufende Schiffe mit einer dünnen Hülle um ganz viel Öl herum.
*
Jetzt ist ‚es‘ also wieder einmal zu einer „Katastrophe“
gekommen, diesmal vor Spaniens Küste. Also ist der
spanische Staat als „Katastrophenbewältiger“ gefragt –
und gerät in dieser Rolle prompt in die Kritik
einer nationalen und internationalen Öffentlichkeit, die
jetzt wieder einmal – zum wie vielten Mal eigentlich –
nur staatliches „Versagen“ und „Schlamperei“ feststellen
kann. Nach dem Auseinanderbrechen des Öltankers
„Prestige“ melden sich Nord- und Ostseeanrainer und
können gar nicht verstehen, warum der spanische Staat
keine Öl-Notfallschiffe stationiert hat, die
ausfließendes Öl absaugen können – wo sie doch über
solche Geräte verfügen. Die Besitzer der Muschelbänke an
der galizischen Küste kommen ausgiebig zu Wort: Wo bleibt
die staatliche Hilfe beim Aufräumen, und – viel schlimmer
– der spanische Ministerpräsident lässt sich erst spät am
Tatort blicken; stattdessen schaut zuerst nur der
Kronprinz vorbei, um demonstrativ ein paar Muscheln zu
verspeisen – was wiederum dem Königshaus hoch anzurechnen
ist; das sorgt sich doch wenigstens um sein betroffenes
Volk. Die Empörung vor Ort teilt die spanische
Öffentlichkeit voll und ganz, muss sie doch enttäuscht
feststellen, dass die Regierung sich so gar nicht als
„Krisenmanager“ ins Zeug legt, also den Glücksfall, sich
in einer „Katastrophe“ durch „entschlossenes Handeln“
Bonuspunkte in Sachen ‚Führungsstärke‘ verdienen zu
können, unverständlicherweise nicht ausbeutet –
Arroganz des spanischen Krisenmanagements
(6.12.) nennt das die
„Süddeutsche“, einig mit ihren spanischen Kollegen und
ein wenig stolz auf den eigenen Kanzler.
Das ist nicht gerecht – die Bewältigung der Havarie gehorcht schließlich genau der Logik der dem Unglück zugrunde liegenden Kalkulationen und Interessen aller maßgeblich Beteiligten: Der spanische Staat unterhält keine Öl-Notfallschiffe, weil er ein weites und tiefes Meer – eine ideale kostengünstige Deponie mithin – vor der Haustür hat. Im Notfall muss es ihm nur gelingen, havarierte Schiffe rechtzeitig und weit genug hinaus zu schleppen, und genau das versucht das spanische Krisenmanagement: Es untersagt dem Havaristen, La Coruna anzulaufen, wo man das Öl hätte abpumpen können, und lässt das lecke Schiff auf die exterritoriale Hohe See zerren. Nachbar Portugal, der dem Schiff ebenfalls die Einfahrt in seine Häfen verbietet, schickt ein Kanonenboot, um den Tanker von den eigenen Hoheitsgewässern fern zu halten. Pech zwar, dass schweres Wetter das Schiff vorzeitig auseinanderbrechen lässt, aber jede „Notmaßnahme“ birgt eben ein gewisses „Risiko“ und immerhin ist der Tanker ja so weit hinausgeschleppt worden, dass mehr als die bekannten Muschelbänke und das Einkommen der dort ansässigen Bevölkerung nicht ruiniert werden – zumindest absehbarer Weise. Langzeitschäden stehen zwar fest, nicht aber, wen sie in welchem Maße treffen, und schon gleich nicht, ob sich aus ihnen irgendein Anspruch gegen den spanischen Staat ableiten lässt. Die spanische Justiz jedenfalls hat ihre Pflicht getan und den Kapitän eingesperrt – schließlich ist er ja seit Jahrhunderten auf See der rechtlich Verantwortliche.
*
Der spanische Staat stellt mit all dem klar und sorgt sich entsprechend darum, dass diese „Katastrophe“ für ihn von Beginn an keine ist. Eine ernsthafte Beeinträchtigung der „natürlichen Lebensbedingungen“ seines nationalen Kapitalkreislaufs kann er nicht entdecken; die Belastung seines Haushalts beschränkt sich im Wesentlichen auf ein paar „Hilfen“ für ruinierte Muschelpflücker; Strand, an dem Touristen spazieren gehen können, hat er noch genug; über den Image-Schaden bei Öffentlichkeit und Wählern wird Gras wachsen; und der Anklage der Umweltaktivisten, die sich beim Strandputzen schwer tun und die Entsendung von mehr Soldaten fordern, entnimmt er: Die, die da anklagen, machen es ja schon.
*
Das abschließende Wort der kundigen seefahrenden
Kaufleute: Umweltkatastrophen durch Öltanker lassen
sich auch in Zukunft nicht völlig verhindern
.
(Verband der Deutschen
Reeder) Wie wahr! Noch im Dezember werden drei
weitere Tanker-Havarien von den Weltmeeren gemeldet.