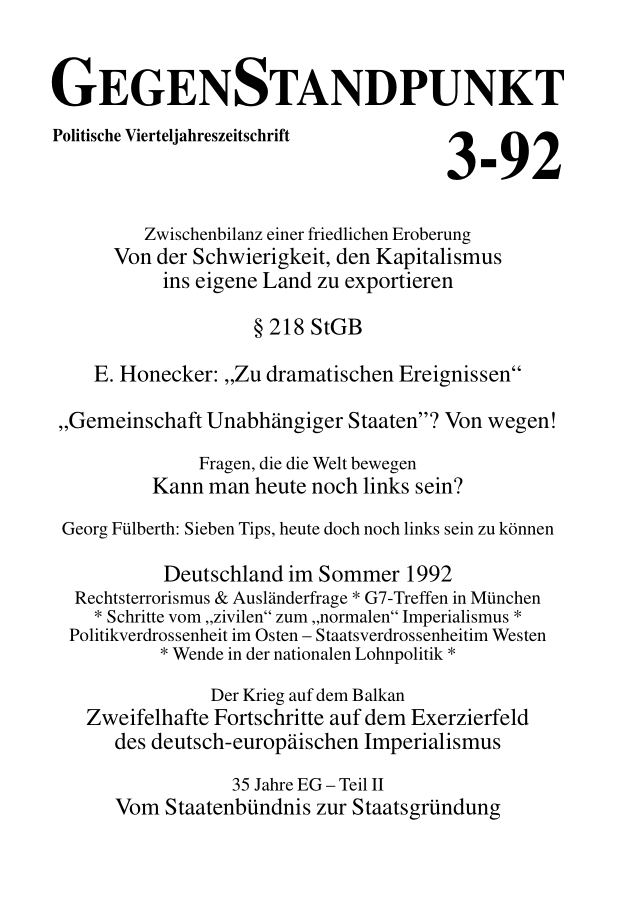Zwischenbilanz einer friedlichen Eroberung
Von der Schwierigkeit, den Kapitalismus ins eigene Land zu exportieren
Die Gründe der ökonomischen Unbrauchbarkeit der ehemaligen Zone liegen in den Maßstäben der Marktwirtschaft: die ökonomische Abwicklung des Zuschussbetriebs Zone produziert Schäden an der gesamtnationalen Ertragsrechnung, die mit unproduktivem Kredit für treuhänderische „Sanierung“ sowie durch Zusammenstreichen des Sozialstaats Ost behoben werden sollen – ein Programm, das alle gesamtdeutschen Haushaltsposten incl. ihrer nationalen Träger in die Pflicht nimmt. Des Weiteren die politisch-rechtliche Abwicklung der Ex-DDR, die den Notwendigkeiten der Unterordnung unter das Regime des Eigentums folgt und damit weitere Enttäuschungen im milieugeschädigten, wählenden Volk schafft. Das braucht deswegen mehr Aufsicht und Kontrolle.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Gliederung
- Der Plan der Politik: „Export“ von Kapital
- Zwischenbilanz des Anschlusses: Schäden an der nationalen Ertragsrechnung
- Die politisch-rechtliche Revolution der Zone
- Das vorläufige Ergebnis: Es klappt nicht recht Zu viel und zu wenig Staat fürs Geschäft
- Ein ganzes Volk – milieugeschädigt
- Die Folge: Der Aufsichtsbedarf wächst
- Von den Schwierigkeiten bei der Kontrolle der enttäuschten Nationalisten
Zwischenbilanz einer friedlichen Eroberung
Von der Schwierigkeit, den Kapitalismus ins eigene Land zu exportieren
Angesichts einer politischen Kultur, die unablässig die Probleme beim „Aufbau der DDR“ betränt, ist es an der Zeit, sie einmal beim Namen zu nennen. Damit wenigstens in einigen Köpfen Schluß ist mit den erfundenen Problemen, die alle nach einem Muster konstruiert sind: Alles, was nicht geht, geht deswegen nicht, weil die von Kommunisten versaute Zone nicht dafür geeignet ist. Abgesehen davon, daß kein Verfechter dieses vernichtenden Urteils aus seinem Richterspruch den einzig fälligen Schluß zieht, das marode Zeug und die marodierenden Insassen wieder in die Unabhängigkeit zu entlassen, fehlt der postkommunistischen DDR-Schelte ein notwendiger Hinweis. Der postmoderne Wahn, mit dem Kapitalismus das einzig senkrechte System zu zelebrieren, schließt jeden Gedanken daran aus, daß in den Maßstäben und Rechnungsarten des marktwirtschaftlichen Paradieses Gründe vorhanden sein könnten, die der flotten Benützung der ehemaligen DDR im Wege stehen. Nicht, daß sie nicht laufend zur Sprache kämen – als selbstverständliche Leistungen, die uns unsere neuen Länder schuldig wären. Aber als Quelle und Kriterium der berüchtigten Unbrauchbarkeit der Zone will sie niemand würdigen. Dabei ist der Verlauf der Operation „Blühendes Land“ eine einzige Ansammlung von Beweisen dafür, daß der funktionierende, normale Kapitalismus seine Sache auch unter unnormalen Verhältnissen macht, aber nicht gut.
Der Plan der Politik: „Export“ von Kapital
Der Grund, die Vereinigung von BRD und DDR zu einem großen Gesamt-Deutschland zu wollen, waren weniger „die Menschen“, die es nicht mehr ausgehalten hätten, in zwei getrennten Staaten zu leben. Zwei Jahre danach bekommt man ja die Klage zu hören, daß die „Spaltung“ bei den deutschen Menschen tiefer sei denn je. Der Bundesrepublik galt es als selbstverständliches Recht der Nation, daß die Selbstaufgabe des Ostblocks ihr den Ertrag DDR einzuspielen habe; also haben die politischen Chefs aus Bonn die Gelegenheit ergriffen und den Revanchismus wahrgemacht, den sie sich in ihr Grundgesetz geschrieben hatten. Dabei gingen sie selbstverständlich davon aus, daß ein größeres Deutschland quasi automatisch auch ein weltpolitisch mächtigeres, zu mehr politischer Einmischung in der Welt befähigtes sein werde. Und sie setzten darauf, daß das Mehr an Land, Leuten und Produktionspotenzen, die sie sich mit der DDR einverleibten, Deutschland auch eine größere ökonomische Wucht verleihen würde.
Ihren Anspruch auf mehr weltpolitische Ein- und Aufmischung machen deutsche Politiker tagtäglich wahr. Die Fähigkeit dazu ist ihnen allerdings weniger durch die Annexion der DDR als durch den Wegfall aller politischen Schranken zugefallen, die ihnen in der Existenz des Hauptfeindes im Osten auferlegt waren. Was den Zuwachs an ökonomischer Potenz angeht, sieht die Sache ein wenig anders aus. Die Bundesrepublik hat zwar von Anfang an alles getan, was nötig war, um aus der DDR ein zusätzliches Stück deutschen Kapitalismus zu machen; „Fehler“ in dem Sinne hat sie dabei jedenfalls nicht gemacht. Das Ergebnis ihrer Aktivitäten ist aber etwas anders ausgefallen als geplant.
Die Machtfrage einmal geklärt und der Sozialismus verboten, bestand der erste Einsatz der bundesdeutschen Gewalt auf dem Noch-DDR-Gebiet in der Einführung eines neuen Geldes. Mit der „harten“ DM anstelle „wertloser“ realsozialistischer Aluchips war keineswegs bloß das Zirkulationsmittel ausgewechselt, sondern ein neues ökonomisches Zwangsverhältnis eingerichtet, das die DDR-Wirtschaft einem neuen Zweck und Maßstab unterwarf: Ab sofort war sie Instrument der Akkumulation von Geld, und zwar in den Händen privater Eigentümer. Alles, was es in der DDR an Potenzen der Produktion gab – stoffliche Bestandteile wie Arbeitskräfte –, wurde dem Imperativ unterstellt, daß es sich lohnen müsse, und zwar für das Wachstum von Kapital. Indem die Bonner Machthaber noch vor jedem Einigungsvertrag 16 Mill. Neubürger von staatswegen dem Kommando privater Kapitalvermehrung unterwarfen, betrieben sie keineswegs verantwortungslos den „Ausverkauf der Zone“ an Geschäftemacher, sondern verwirklichten das politische Programm deutscher Einheit: Die Durchsetzung des im alten Westen gültigen Produktionszwecks auch im neuen Osten.
Der noch vom DDR-Staat geschaffenen Institution Treuhandanstalt übertrugen die Bonner Systemumwandler die ehrenvolle Aufgabe, den ehemaligen VEBs die gewünschte Form des privaten Geschäftsmittels zu verpassen. Als öffentlich-rechtliche Unterabteilung des Finanzministeriums und „Zwischeneigentümerin“ der VEBs wurde sie mit dem Auftrag betraut, das ökonomische Potential der DDR möglichst schnell in die Hände derer zu legen, deren Geschäft die Kapitalvermehrung ist. Zu diesem Zwecke bietet die Treuhand per Katalog ihr Inventar Geschäftsleuten, die auf Prospektion gehen, zur Auswahl an. Nach dem Muster einer Auktion unter den Interessenten läßt sie feststellen, was denen welcher Betrieb oder Betriebsteil wert ist, vergewissert sich der geschäftlichen Bonität der Interessenten und ihres Angebots und teilt schließlich per Verkauf dem neuen Eigentümer sein neues Eigentum zu. Alles aus der Erbmasse, das keinen Käufer findet, ist als erwiesenermaßen geschäftsuntauglich zur Liquidation vorgesehen – so jedenfalls der ursprüngliche Entwurf für den Vorgang der Eigentumsübertragung an die, die die eigentlichen Operateure des politischen Projekts „Aufschwung Ost“ darstellen.
Um der DM-Vermehrung in den frischgebackenen Privatfirmen auf die Sprünge zu helfen, haben die Bonner Kapitalismus-Exporteure im neuen kapitalistischen Osten auch ein ebenso neues Finanzkapital in die Welt gesetzt. Deutsche Finanzpolitiker wissen schließlich aus dem erfolgreichen Funktionieren ihrer Alt-BRD, daß für die Akkumulation von Kapital ein Kreditwesen, das für die jederzeitige Flüssigkeit des Geschäftsmittels Geld und für das Überwechseln des Kapitals von einer Geschäftssphäre in die andere zuständig ist, eine funktionelle Notwendigkeit darstellt und deshalb auch per Zins am Gewinn der industriellen Kapitalisten zu beteiligen ist. Im Zuge der Währungsunion erschufen sie deshalb von staatswegen Bankkredit in DM, indem sie den Ex-DDR- und neuen Treuhand-Betrieben Geldbeträge, die ihnen ehemals von der DDR-Staatsbank zugeschustert worden waren und die auch dort „Kredit“ hießen, als DM-Zahlungsverpflichtung gegenüber dem frisch aufgemachten kapitalistischen Bankwesen in die Bilanzen schrieben. Im „Arbeiter- und Bauernstaat“ waren diese „Schulden“ zwar gar kein kapitalistischer Kredit, keine Rechtstitel fremden Geldeigentums, an denen ein Betrieb hätte pleitegehen können, sondern ein weiterer „Hebel“ im Inventar der Planer und Lenker, um die Betriebe zur Erfüllung der Planvorgaben anzureizen. Sie kamen den Waigel und Co. aber gerade recht, um als „Altschulden“ in DM-Form von Anfang an zwischen Bankkapital und Betrieben Geschäftsverbindungen einzurichten, von denen beide Seiten profitieren sollten. Die Banken, indem sie so das neugeschaffene industrielle Kapital gleich als Geschäftsbasis und Gewinnquelle zugeschustert bekamen; und die Betriebe, indem ihnen mit dem eingerichteten Kredit zugleich eine Kreditlinie eröffnet sein sollte, die ihnen Zugang zu den für das Geschäft nötigen Finanzmitteln verschaffte.
Als Dienstleister am neugeschaffenen Privateigentum waren die Zonis vorgesehen. Die Versetzung der ehemaligen „Werktätigen“ der DDR in den davon doch ziemlich abweichenden Status einer Arbeiterklasse, die nicht mehr Gegenstand staatlicher Pflege, sondern Manövriermasse geschäftlicher Nachfrage ist, wurde politisch durch ihre Unterstellung unter die Agenturen des Arbeitsmarkts und der Sozialversicherung gemanagt. Daß dem Zonenvolk zum Empfang im neuen Deutschland ein Billiglohn-Niveau politisch verordnet wurde, entspricht der im Kapitalismus gültigen „Angebotsorientierung“ auf Unternehmer hin, die den Lebensunterhalt von Arbeitern als Kosten berechnen, die sich lohnen müssen – für’s Geschäft. Zum Einstieg in ihre neue Karriere als Dienstleister an fremdem Eigentum mußten die Zonis da schon ein Sonderangebot sein; für etwas später, wenn „der Aufschwung greift“, also das Kapital aus ihrer Arbeit genug Überschuß herausgeschlagen haben sollte, war ihnen eine Angleichung an das „Niveau“ des westdeutschen Arbeiterparadieses versprochen. Auch, daß der Arbeiterstand den Status der Reserve einschließt, der für jeden Dienst abrufbar ist, keinen Lohn sicher hat, wurde den Neulingen gleich klargemacht, sogar in ziemlich großem Umfang. Die neue politische Gewalt war jedoch so gut, mit „Qualifizierungs-“ und „Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen“ und dergleichen einen Haufen Leute durchzuziehen, deren Arbeitskraft keinen Käufer fand. Das ganze neue Arbeitsvolk aus der Zone galt ihr nämlich im Prinzip als brauchbare Dienstleistungsmannschaft, die demnächst gefragt sein würde. Die sollte deshalb, bis es soweit sei, zurecht„qualifiziert“ und ersatzbeschäftigt werden, um für spätere Anwendung paratzustehen.
Mit dem staatlichen Gewaltmonopol über Land, Leute und Produktionsstätten und der Einführung der kapitalistischen Rechnungsweise war die alte Zonen-Wirtschaft der mit Kapitalvermehrung befaßten Geschäftswelt zur Prospektion eröffnet. Die mußte dann nur noch ganz frei ihr Persönlichkeitsrecht auf Geldscheffelei entfalten, loslegen und sich der ertragbringenden Benutzung von Land und Leuten „drüben“ widmen. Die politischen Instanzen entfalteten darüber hinaus jede Menge Initiative, um den Geschäftskalkulationen die richtige Richtung zu weisen. Der „Vorschuß“ staatlichen Kredits – einerseits zur unmittelbaren Förderung von Investitionen durch Geschäftsleute, für die der Wirtschaftsminister einen eindrucksvollen Katalog staatlicher „Beihilfen“ aufgelegt hat, andererseits zur Aufmöbelung von Straßen-, Bahn-, Telefonnetzen und dergleichen allgemeiner Bedingungen des Geschäftemachens, für die von Haus aus der kapitalistische Staat zuständig ist – war ein deutliches Signal für die Verläßlichkeit des politischen Willens, es für den „Aufschwung Ost“ an nichts fehlen zu lassen, also noch eine solide Geschäftsbedingung. Der Export bundesdeutschen Rechts (von der Eigentumsgarantie bis zum Strafrecht) und bundesdeutscher Ämter (vom Grundbuch- bis zum Arbeitsamt) flankierte die politische Ökonomie der Währungsreform und sollte die Gewißheit stiften, daß die Ausrichtung der ganzen Gesellschaft auf ihre Abhängigkeit von und Funktionalität für das kapitalistische Geschäftsleben in der Zone genauso sichergestellt ist, wie dies vom rundherum fertigen Kapitalismus Marke BRD bekannt und beliebt ist.
Die „Vorleistungen“, die der Klassenstaat mit der Währungsreform und den sie flankierenden Gewalt-, Verkehrs- und Sozialmaßnahmen für seine Unternehmer erbrachte, waren natürlich keine uneigennützigen Dienste, schon gar nicht an „den Menschen“. Sie verstanden sich genauso wie entsprechende Maßnahmen im Westen als Auftrag an die Kapitalisten, den staatlich geschaffenen Kredit in lohnende Geschäfte umzusetzen. Sie sollten dafür sorgen, daß aus dem bereitgestellten Kredit ein tatsächliches Mehr an Reichtum, an Geldüberschüssen wird, indem sie ihn in fungierendes, Gewinn abwerfendes Kapital verwandelten. Ihr gelingendes und wachsendes Geschäft sollte aus Deutschland einen vergrößerten Kapitalstandort machen und so der Nation den Zugriff auf neue Potenzen des Reichtums und der Macht eröffnen, die in der imperialistisch hergerichteten Welt zählen.
Einmal angeschlossen und nach Strich und Faden den Verkehrsformen des gelungenen bundesdeutschen Kapitalismus samt seiner harten DM unterworfen – wie sollte die Zone da nicht ein Angebot an Kapitalisten sein, nach dem diese sich die Finger lecken? Das erschien deutschen Politikern so selbstverständlich, daß sie gar nichts dabei fanden, dem neuen Wahlvolk entsprechende Versicherungen zu machen. Inzwischen ist amtlich, daß es so gar nicht gekommen ist. Die geschäftstüchtige Prospektion der Zone hat stattgefunden, ihre Resultate sind enttäuschend ausgefallen. Erstens für die politischen Auftraggeber, zweitens für das Zonenvolk, das sich von seiner Zustimmung zur Wende auch anderes versprochen hatte. Die Enttäuschung dieser beiden Parteien hat freilich einen verschiedenen Inhalt, gehört also nacheinander abgehandelt. Auch wenn sich im Sprachdenkmal von den „blühenden Landschaften“, die jetzt auf sich warten lassen, beide Parteien wiederfinden können.
Die Enttäuschung der Politik und ihr Grund
Die Zwischenbilanz von oben fällt düster aus. Statt des bestellten Wirtschaftswachstums konstatieren die amtlichen Wachstumsstatistiker in regelmäßigen Abständen Rekorde beim Verfallen der Ost-Produktion. Auch wenn sie zwischendurch immer wieder Hoffnung schüren und für 1992 sogar ein „zehnprozentiges Wachstum der ostdeutschen Wirtschaft erwarten“, vermelden sie im Nachsatz, daß sie damit noch keineswegs zufrieden sein können „angesichts der niedrigen Vergleichsbasis im Vorjahr“. Dann korrigieren sie auch ihre 10%-Erwartung wieder nach unten. Ihren Hoffnungsfunken einer „lebhaften Baukonjunktur“ entwerten sie gleich selbst wieder mit dem Hinweis, daß diese sich hauptsächlich staatlichen Infrastrukturprojekten verdankt statt „selbständigem Wirtschaftswachstum“. Bei jeder Gelegenheit appellieren Kanzler und Wirtschaftsminister laut und vernehmlich an die Unternehmerschaft, sich beim Aufschwung Ost jetzt aber wirklich „vermehrt zu engagieren“, und halböffentlich beschweren sich Ministerialbeamte nach jeder Sitzung der einschlägigen konzertierten Gremien darüber, daß „die Unternehmer immer alles geschenkt haben wollen“. Und dann „brechen auch noch die Ostmärkte weg“, die Domäne der ostdeutschen Betriebe. Die Opposition sowie parteiübergreifend die Ost-Volksvertreter befürchten die „De-Industrialisierung der Ex-DDR“, wo sie doch so gerne ihre Kapitalisierung gefeiert hätten. Sämtliche Ost-Amtsträger, vom sächsischen Wirtschaftsminister bis zum Provinzbürgermeister, stellen fest, daß sie ihre Haushalte bei weitem nicht aus einheimisch verdienten Steuern bestreiten können, sondern auf lange Zeiträume auf Zuschüsse vom Bund und von den Westländern angewiesen sind. Und die deutsche Staatsverschuldung ist zum Ober-Sorgenkind von Politik und Öffentlichkeit avanciert, die sich ununterbrochen selbst und wechselseitig vor dem „Risiko dieses Kurses“ warnen, dem durch „rigorose Stabilitätspolitik“ Einhalt zu gebieten sei.
Dies also die Zwischenbilanz der Politik, ihr Projekt „Aufschwung Ost“ betreffend: Anstatt zusätzliche Quelle von Steuereinnahmen und Wirtschaftswachstum in DM zu werden, bleibt die Zone ein ewiger Zuschußbetrieb. Die Ansiedlung von Kapital hat sich für den Staat als eine kostspielige Anreizaktion erwiesen, Ergebnisse fallen ungenügend bis überhaupt nicht an. Die „Anschubfinanzierung“ auf diversen Sektoren hat nicht angeschoben, was sie sollte: ein autonomes Wachstum von Geschäften, an deren Erträgen die politische Gewalt partizipieren könnte. Deutsche Politiker sind tatsächlich ernsthaft unzufrieden mit ihren unternehmenden Lieblingsbürgern; diese haben den ihnen erteilten Auftrag nicht bzw. ziemlich unzureichend wahrgenommen.
Wie konnte das geschehen?
Die hohe Politik hat das östliche Zusatz-Deutschland immer unter dem Blickwinkel und im Vergleich zum Vorbild des fertigen und erfolgreichen Kapitalismus angesehen, dem sie vorsteht. Das bisher verschlossene und dem, so der VWL-Jargon, „ineffektiven staatswirtschaftlichen Ordnungsmodell“ ausgelieferte Gebiet per Gewalt dem Zugriff der vermeintlich unschlagbaren Erfolgsmethoden Marke Marktwirtschaft (und erst recht: Marke Deutschland) zu öffnen, hielt sie – und hält sie noch immer – für gleichbedeutend damit, daß der Aufschwung eine ausgemachte Sache sein müsse. Die „Instrumente“ des Rechts, der Wirtschafts- und Sozialpolitik, die die BRD, so sehen sie es, groß gemacht haben, haben sie auch im Osten in Anschlag gebracht – über andere verfügen sie, nebenbei gesagt, auch gar nicht. Die Geschäftswelt folgt dem Kalkül der Politik, wie sie es immer und überall tut, wo Marktwirtschaft herrscht; und dabei stellt sich heraus, daß auch in Deutschland die Vorhaben von Politik und Geschäft keineswegs von selbst zusammenfallen.
Tatsächlich hat der Export der kapitalistischen Rechnungsführung nach „drüben“ das Gegenteil von dem bewirkt, was die Politik sich davon erhoffte. Ab Stichtag der Währungsunion war aller sachlicher Reichtum dort mitsamt den Potenzen seiner Produktion dem Maßstab des Werts, des profitablen Wachstums privaten Geldvermögens unterstellt. Dafür war aber die realsozialistische Produktionsweise, ihre Produktionsmethoden, ihre Arbeitsteilung, die ganze Organisation ihrer Volkswirtschaft nicht eingerichtet gewesen. Also wurde alles entwertet, was sie an Reichtum und Versorgung immerhin zu bieten gehabt hatte. Der realsozialistische national-ökonomische Zusammenhang, in dem die Betriebe der DDR mit ihren jeweiligen Produktionen und Produkten standen, war mit der Einführung der DM zerschlagen – wie bezweckt. Und eben deshalb ist für das prospektierende Kapital auch kein Betrieb, wie es ihn als Teil dieser Arbeitsteilung gab, erfolgversprechendes Mittel und Quelle ertragreichen DM-Produzierens. Der vernichtende Befund der Geschäftswelt heißt: „Alles kein Kapital!“ In dem Maße, wie die Geschäftswelt diesen Befund gnadenlos an allem vollstreckt, was in der DDR Mittel von Produktion und Versorgung war, zerfällt auf dem Ost-Territorium auch das bißchen an Geschäftsleben wieder, was sich am Anfang hoffnungsfroh mit Blick auf den angekündigten Aufschwung etabliert hatte. Davon zeugen nicht nur lauter pleitegegangene Würstchenbudenbesitzer, Gebrauchtwagenhändler und Versicherungsvertreter: Amtliche Beobachter teilen mit, daß auf drei sogenannte Existenzgründungen zwei Pleiten kommen. Davon zeugt auch, daß auf dem flachen Lande die Grundversorgung stückweise zusammenbricht: Für die großen Handelsketten ist die dort vorhandene zahlungsfähige Nachfrage kein taugliches Geschäftsmittel, die alten Handelsorganisationen sind zerschlagen, und Kleinhändler können sich den Kredit nicht leisten, den es sie kosten würde, einen Laden aufzumachen. Im Kapitalismus ist eben jede, auch die kleinste Verdienst- und Ernährungsquelle abhängig gemacht davon, daß das Kapital die Benutzung eines Standorts, einer Region für lohnend befindet; daran hängt sich dann alles an „Mittelstand“, kleinen Warenverkäufern, Nischen- und Schwindelexistenzen an, was „das Leben“ in dieser Marktwirtschaft angeblich so bunt und vielfältig macht. Wo nichts zählt als die Rechenweise des Kapitals und dessen Verdikt „unbrauchbar“ heißt, veröden und verkommen eben Landstriche und Völker – was Politikern, die vor einem „Mezzogiorno im Osten“ warnen, durchaus vertraut ist. Aber doch nicht bei uns!
Es ist eben nicht Sache des Kapitals, sich quasi als Entwicklungshelfer bei der Einrichtung und dem Aufbau von „Märkten“ zu betätigen, die von sich aus gar keine lohnenden Geschäftssphären sind. Zumal dann nicht, wenn es von diesen Märkten ansonsten auf der Welt reichlich gibt, weil der moderne Weltmarkt fertig ist, Länder und Völker nach lohnenden und unbrauchbaren Verdienstquellen durchsortiert sind. Ist das Geschäft, das sich längst in allen Weltgegenden tummelt, vielleicht auf diesen Zusatz-Standort angewiesen? Warum soll es eine geschäftlich vernünftige Rechnungsart deutscher Multis sein, die dank des Wirkens der Politik schon laufend neue Geschäftsgelegenheiten von Portugal bis Korea wahrnehmen, sich bei ihrem Standortvergleich nicht nach dem besten Verhältnis von Kosten und Ertrag, sondern nach der Heimat der Produktionsfaktoren zu richten und ausgerechnet in Sachsen die nächste Fabrik für Videos hinzustellen? Sollen sie die in Portugal wieder zumachen? Das wäre ja auch nicht gerade im Sinne deutscher Weltpolitiker. Ist es etwa so, daß das Kapital, das im deutschen Westen schon seit 20 Jahren sein Wachstum mit der Freisetzung von Arbeitskräften betreibt und dort schon eine beträchtliche Reservearmee erzeugt hat, jetzt gerade auf die Anwendung von ca. 8 Mill. Zonis scharf sein müßte? Haben sie ihm gefehlt? Seit wann richten Kapitalisten überhaupt Produktionen ein, weil irgendwo Leute herumhängen, die ein Einkommen brauchen? Wenn westdeutsche Kapitalisten den einen oder anderen Zoni nutzbringend einsetzen können – entspricht es dann nicht viel mehr kapitalistischer Logik, daß sich die Arbeitskräfte auf die Beine machen und nicht die Fabriken? Ist es nicht ganz im Sinne „rationeller“ und „effektiver“ kapitalistischer Plusmacherei, wenn das bißchen „Kaufkraft“, aus dem sich drüben ein Geschäft machen läßt, aus vorhandenen westlichen Maschinenparks mit entsprechenden Überstunden und Sonderschichten bedient wird? Und was die berühmten „Ostmärkte“ angeht – warum sollte von denen nach Einführung der „Marktwirtschaft“ im Osten mehr übriggeblieben sein als in der Zone, mit deren Produkten westdeutsche Quelles und Ikeas ja auch kein schlechtes Geschäft gemacht haben, als sie noch DDR hieß und ein staatliches Außenhandelsmonopol hatte? Das geht eben wirklich nicht, eine ganze Produktionsweise zu zerstören und dann zu verlangen, daß ihre Zersetzungsprodukte die gleichen Dienste für’s westliche Geschäft zu erbringen hätten wie ehedem.
Schon gar nicht rührt sich beim Kapital das Bedürfnis nach neuen Standorten des Geschäfts, wenn schon das Geschäft an den alten nicht so läuft, wie es soll. Zur unternehmerischen Freiheit gehört es ja mit dazu, den Umfang der eigenen Produktionskapazität auf die Ergiebigkeit der Märkte zu beziehen. Das bedeutet nicht bloß, sich gegenseitig Marktanteile streitig zu machen, sondern auch, die künftig zu erwartende Nachfrage in Rechnung zu stellen. Und mit dieser Erwartung sieht es gegenwärtig schlecht aus, weil der Weltmarkt es gerade einmal wieder zu einer seiner periodischen Krisen gebracht hat. Das bringt der kapitalistische Geschäftsgang in seiner Freiheit eben so mit sich: Das mittels des Kredits rücksichtslos gegen die Zahlungskraft der Nachfrage akkumulierende Kapital (das heißt „Aufschwung“ oder „Boom“ und ist das, was wir alle schätzen am Kapital) bekommt seine Abhängigkeit von dieser Zahlungskraft zu spüren. Der Gang der Geschäfte ist an seine selbstfabrizierten Schranken gestoßen. Das Kapitalwachstum hat zu gut geklappt, es ist zuviel Kapital da; zuviel, um neue, lohnende Anlage zu finden. Allgemeine Kontraktion der Geschäfte findet statt, Kapital entwertet sich. Keine nationale Akkumulation kann sich aus einer solchen Krise heraushalten; auch das deutsche Muster-Wachstumsland nicht. Diese Lage der Weltwirtschaft, die Wirksamkeit der über alle lokalen Besonderheiten erhabenen Gesetze des Kapitalwachstums durchkreuzt die politische Berechnung auf ein kapitalistisches Wirtschaftswunder in der deutschen Ostzone noch ganz unabhängig davon, mit welchen Mängeln dieser Standort, kapitalistisch betrachtet, behaftet sein mag.
So lautet das allgemeine Ergebnis der gelaufenen Besichtigung der neu zur Kapitalisierung eröffneten Gegenden im deutschen Osten: Fehlanzeige. Kein Bedarf. Der Internationalismus des kapitalistischen Weltmarktes kennt zwar (im Gegensatz zu den Verdächten, die so manche Ossis hegen) keinerlei Vorurteile, auch östlich angesiedelte Manövriermassen geschäftlich zu benutzen. Aber der fungierende Kapitalismus im Weltmaßstab findet, daß sich der Osten nicht lohnt, macht also praktisch deutlich, daß er auf die Öffnung einer ganz neuen Sphäre der Akkumulation weder angewiesen ist noch gewartet hat. Von wegen also, in der Zone würde das kapitalistische Geschäftsleben „noch nicht richtig funktionieren“. Es sind genau die per Gewalt in Kraft gesetzten, gültigen und betätigten Maßstäbe des Kapitalismus, die Kapitalisten jetzt beim Investieren abwinken lassen. In ihren Gewinn- und Verlustrechnungen kommt eben der Posten „Deutschland“ gar nicht vor; sie sind keine freien Mitarbeiter des demokratischen deutschen Staates in Sachen national erwünschten Standortaufbaus.
So kann es einem ergehen: Da macht man sich als Staat mit all seiner Gewalt darum verdient, daß das falsche System im Osten, die leidige Ausnahme von der freien Verfügbarkeit der Welt für’s Kapital, endlich einpackt, und dann lassen die Kapitalisten dem politischen Zugriff den geschäftlichen gar nicht folgen. Andererseits haben deutsche Politiker an den Kalkulationen des Kapitals aber auch gar nichts zu kritisieren, im Gegenteil. Sie setzen ja wie die ganze freie Staatenwelt auf die Freiheit des Kapitals als Lebensmittel der Politik; und insofern bräuchten sie sich eigentlich auch nicht zu wundern, wenn die Geschäftswelt ganz borniert den Maßstäben ihres Materialismus folgt. Aber deutsche Politiker meinen anscheinend, daß ein Landstrich, den der deutsche Staat sich unterstellt, sich quasi automatisch so entwickeln und so erfolgreich sein müßte wie Deutschland West. Und da täuschen sie sich eben. Deutsche Systemkrieger aus den obersten politischen Etagen sind offenbar auf ihre eigene Erfolgsideologie hereingefallen, derzufolge das Gelingen des Wirtschaftens überhaupt und schlechthin eine Frage der korrekten (Bonner) Ordnungspolitik und der Anwendung marktwirtschaftlicher Erfolgsmethoden ist. Jetzt finden sie es unerhört, daß die Anwendung des privatkapitalistischen Geschäftskalküls und deren Ertrag für die Nation nicht zusammenfallen. Das pflegt zwar in kapitalistischen Nationen öfter vorzukommen, aber bundesrepublikanische Macher haben diese Erfahrung selten machen müssen. Jetzt müssen sie zur Kenntnis nehmen, daß es eine Sache ist, sich als der politische Vorstand eines fertig durchgestylten Kapitalismus zu betätigen, in dem eh und je schon „der stumme Zwang der Verhältnisse“ funktioniert und das Regieren eine klare und erfolgsgewohnte Angelegenheit ist, in dem die Staatsaufgaben feststehen und die politische Verfügung über die Mittel dazu auf verläßlichen Quellen basiert; und eine andere Sache, unter der Bedingung eines fertigen kapitalistischen Weltmarkts die Kapitalisierung einer kompletten neuen Geschäftssphäre zu realisieren, an der die Funktionäre des Wirtschaftswachstums kein Interesse haben. Dieses Projekt, das sie selber „Aufschwung Ost“ getauft haben, ist den Imperialisten aus Bonn/Berlin für’s Erste mißraten. Auch in Deutschland ist falsches Bewußtsein eben keine Erfolgsgarantie.
Die Enttäuschung von unten: „Deutsche zweiter Klasse“
Die ersten beiden „wirklich freien Wahlen“ im deutschen Osten wurden nicht zuletzt mit der Ausmalung „blühender Landschaften“ gewonnen. Das war gemünzt auf den Erwartungshorizont von Leuten, die nach Öffnung der Mauer in der alten BRD allen Ernstes ein „Baradies auf Ärden“ ausgemacht haben wollten. Nach der Decke wollten sie sich strecken dürfen; einen „Lebensstandard“ wie in Deutschland West, darauf meinten sie, als Deutsche ein Recht zu haben.
Jetzt sind sie schwer enttäuscht, und zwar in eben dieser Eigenschaft als Möchtegern-„Deutsche erster Klasse“. Sie bekommen eine Sonderzone eingerichtet, die sich am Vergleich zu den „alten Ländern“ immerzu blamiert, und sind fassungslos, daß man ihnen als Deutschen so etwas antun kann, statt ihnen die versprochene „Angleichung der Lebensverhältnisse“ zu bescheren. Dabei hätte wohl auch der stinknormale Kapitalismus wie im Westen, so sie ihn gekriegt hätten, das Echo ausgelöst: „So haben wir uns das nicht gedacht“. Bei so manchem, womit die Zonis jetzt unzufrieden sind, handelt es sich ja um Wirkungen des ganz gewöhnlichen kapitalistischen Lebens und gar keiner besonders schlechten Behandlung von „Ossis“.
Sie erleben zum ersten Mal, was es heißt, mit seinem Lebensunterhalt erpreßbar zu sein. Zum Leben braucht man Geld, die Lebensmittel sind nicht mehr subventioniert, sondern Gewinnmittel für’s Geschäft. Ein Einkommen gibt es für den menschlichen Träger der Ware Arbeitskraft nur, wenn ein Unternehmer sie benutzen will; sie sind dessen Kalkulationen ausgeliefert und haben selbst nichts in der Hand, um diese zu ihren Gunsten zu beeinflussen. Also dreht sich der Lebenskampf des deutschen „Neubürgers“ in erster und letzter Instanz um die Frage „Arbeit oder keine“.
Wer eine reguläre Arbeit hat, bekommt zu spüren, daß sein Lebensunterhalt für seinen Arbeitgeber einen Kostenfaktor darstellt. Der politisch verhängte Billiglohn-Tarif setzt dem Konsumrausch in der Zone extra enge Grenzen. Und die Leistung muß sich lohnen – für den Unternehmer. Mit dem sozialistischen Schlendrian am Arbeitsplatz ist Schluß; auf Pausen im Arbeitsprozeß wegen „ineffektiver“ Produktionsorganisation braucht man gar nicht zu hoffen. Auch in der Zone existieren jetzt Arbeitshetze und Arbeitslosigkeit nebeneinander. Wer von letzterer „betroffen“ ist, darf bemerken, daß an die Stelle des „bürokratischen Versorgungsstaates“ die „Eigeninitiative“ getreten ist: Von selbst bekommt man keinen Pfennig von irgendwelchen Ämtern; ob, wo und was man an „Hilfeleistungen“ beanspruchen darf, muß man selbst ermitteln, beantragen, nachweisen usw.. So ist man auch als Arbeitsloser beschäftigt.
Sie erfahren, daß „Konsumentenkredite“ nicht dazu da sind, um armen Leuten bei ihren Einteilungskunststücken mit dem Lohn unter die Arme zu greifen. Dafür bekommen die Zonis den neuen Berufsstand des Sozialbetreuers an die Seite gestellt, der das Problem der „Überschuldung privater Haushalte“ bewältigt, indem er Leuten mit zuwenig Geld beibringt, wie sie davon noch sparen können. Die Zeiten alter Ehestandskredite und Sparbücher, von denen es nichts zu kaufen gab, sind endgültig abgelöst durch geschäftstüchtige Banken mit staatlichen Gerichtsvollziehern zur Seite. Mit Geld umgehen muß man eben vor allem dann lernen, wenn man keines hat.
Auch mit dem Grundeigentum macht man im Osten so seine Erfahrungen. Daß Häuser zum Wohnen und Hauseigentümer zum Renovieren da sind, ist ein frommer Glaube, der jetzt enttäuscht wird. Grundeigentum ist Geschäfts- und Spekulationsartikel, weshalb normale Bürger mit ihrem Niedrigeinkommen in der Konkurrenz um Wohnraum ziemlich alt aussehen; und die Vermieter sorgen weniger für schmucke Bleiben als für’s Einkassieren von allerlei Neben-, Unterhaltungs- und sonstigen „Kosten“. Indem der Staat die Erhöhung des Mietzinses etappenweise verordnet und an Einkommenssteigerungen koppelt, sorgt er dafür, daß jeder Mehrverdienst gleich in die Taschen des Hauseigentümers wandert. Und wenn das immer noch nicht langt, subventioniert er mit „Wohngeld“ die Einnahmen des Hausbesitzers. Der Staat weiß eben, wie sich Eigentum und Wohnbedürfnisse armer Leute vertragen – gar nicht.
Soweit ist alles ziemlich normal in Zoniland. Unnormal – jedenfalls im Vergleich zu Verhältnissen, wie sie bislang im kapitalistischen Deutschland üblich waren – ist, daß sie ihre Erfahrungen mit dem kapitalistischen Eigentum an allen Produktions- und Lebensmitteln machen dürfen, ohne daß dieses Eigentum zugleich ein flächendeckendes Interesse an der Benutzung ihrer Arbeitskraft zwecks Vermehrung entwickeln würde. Die Zonis werden wie ihre Klassenbrüder im Westen vom Handels-, Bank- und Grundkapital geschröpft, aber anders als diese vom produktiven Kapital nicht benutzt.
Dem könnten Zonis durchaus entnehmen, daß ihre Vorstellung, im goldenen Westen würde sich proletarisches Zurechtkommen mit den Gewinnansprüchen des Kapitals bestens vertragen, ziemlich verkehrt war. Sie belieben, die Sache genau umgekehrt zu sehen. Ihnen ist etwas vorenthalten worden, worauf sie als gute Deutsche Anspruch haben: Nämlich unter Beweis zu stellen, daß sie diesem Kapital ebenso gut und fleißig dienen können wie die „Wessis“. Sie finden es äußerst ungerecht, daß sie vom Kapital nur geschröpft und nicht auch in Dienst genommen werden. Und sie sehen sich betrogen: Von der Politik, die das Kommen des Kapitals versprochen hat, und von den Unternehmen, die ihr neues Arbeits-Volk nicht wollen.
So tritt im Dialog zwischen oben und unten mancher Mißton auf. Der Kanzler kann behaupten, daß er -zig Milliarden in die Zone „transferiert“ habe (10 000 DM pro Kopf oder so), und die Ossis können sich beschweren, daß bei ihnen nichts angekommen ist. Recht haben natürlich beide, weil beide an völlig verschiedene Fassungen der Botschaft vom Auferstehen aus Ruinen denken.
Zwischenbilanz des Anschlusses: Schäden an der nationalen Ertragsrechnung
Die Lage ist nicht so, daß im Osten bloß ein Wirtschaftswachstum ausgeblieben wäre, auf das die Politik gespechtet hat. Indem es ausbleibt, bekommen die Anstrengungen, die die Politik für sein Zustandekommen unternommen hat, allesamt einen neuen Charakter. Aus staatlichen Aufwendungen, die aufs volkswirtschaftliche Lohnen berechnet waren, werden erst Kosten, dann Schulden, die die Nation drücken. Und aus Dienstleistungen, die den Aufschwung Ost befördern sollten, werden Belastungen, bei denen die Politik sich überlegt, ob und wie sie sie einschränken oder loswerden kann. Der gleiche Kredit, der zu Zeiten der Währungsunion als Vorschuß und Anreiz allen gerade recht war, wird nun zu einem einzigen Berg von Schulden und staatlichen Verlustposten.
Seitdem dies feststeht, sorgt sich die Nation, ehedem Hüter der unübertroffen harten DM, um ihr Geld. Und das hat mit dem bloßen Umfang des Kredits, den der deutsche Staat sich in den letzten Jahren genehmigt hat, allen Gerüchten zum Trotz wenig zu tun. Das Herbeten immenser „Haushaltsdefizite“ soll das Volk beeindrucken und erschrecken und einleuchten lassen, daß „wir“ jetzt alle den Gürtel enger schnallen müssen. Was den Staat betrifft, findet das Gegenteil statt: Noch in jedem Haushalt findet sich eine größere Summe dieser neuerdings als unlauter geltenden Finanzmittel. Der Staat befindet immer neuen Kredit für die Wahrnehmung seiner Aufgaben für unbedingt nötig; und zugleich gelten ihm Herkunft wie Gründe für diesen neuen Kredit als überaus bedenklich. Was ist da los?
- Die Bilanz der Treuhandaktivitäten ergibt: Statt daß dieses Institut über das Verscherbeln des DDR-Produktivvermögens an private Interessenten deren Schulden in Kapital verwandelt hätte, bleibt es auf ihnen sitzen. Ihr Eigentum an lauter wertlosen DDR-Betrieben macht die Treuhand zur Eigentümerin an lauter Zahlungsverpflichtungen, „alten“ wie neuen. Der Kredit, der im ursprünglichen Plan der Regierung als Grundlage gedeihlicher Geschäftsbeziehungen zwischen neuem produktivem Zonen-Kapital und Bankgewerbe gedacht war, bleibt in den Bilanzen der Treuhand als Schuldenberg stehen; laufend vermehrt durch das Anfallen von Bürgschaften, die sie für Kredite zum Fortführen der Produktion in den noch laufenden Betrieben übernommen hat. Das wertlose DDR-Vermögen hat sich nicht einfach in nichts aufgelöst, sondern bleibt als aus dem Staatshaushalt zu bedienende Schuld in den Büchern der Banken stehen.
- Die Bilanz der Sozialstaatsaktivitäten ergibt: Da sind lauter neue Ämter, Betreuungseinrichtungen und Ausgabenposten eingerichtet worden für die Pflege der Arbeitskraft von Leuten, für die kein kapitalistischer Bedarf besteht. Infolgedessen verwalten die östlichen Sozialstaatsabteilungen nicht, wie im Westen, die verschiedenen Abteilungen einer industriellen Reservearmee für’s Kapital, sondern ein totes Gewicht an nach allen gültigen Maßstäben überschüssiger Bevölkerung. Die ärmliche Alimentierung östlicher Massen stellt sich für den Staatshaushalt als wachsende Dauerkost heraus, deren Nutzen kein Politiker erkennen kann. Und soweit Steuereinnahmen aus „neuen Arbeitsplätzen“ im Osten fließen, lassen sie die staatlichen Kassenwarte auch nicht recht froh werden: Sie verdanken sich nämlich aus Staatsgeldern finanzierten Infrastrukturprojekten, die ihrerseits, statt sich als nützliche Bedingung für Kapitalanlage aus neu einfließenden Steuergeldern zu finanzieren, bloße Vermehrung staatlicher Schulden bewirken.
In allen Abteilungen wächst also der Staatskredit, der zu bedienen ist, schleppen sich Ausgabenposten fort, die zu finanzieren sind, ohne daß dieser Kredit Wachstum erzeugt. Deshalb erscheint die Sache ihren Akteuren jetzt rückwirkend so, als habe der nationale Haushalt mit seinen Ausgabenprogrammen für den Osten nicht notwendige Dienste für das kapitalistische Wachstum erbracht, sondern sich mit lauter Belastungen und Kosten befrachtet. In Wahrheit zeigt sich hier die Schranke, die die ökonomischen Bestimmungen des Kredits seinem Einsatz als Mittel der politischen Gewalt setzen. In dem Maße, in dem der neu ausgegebene Staatskredit, der Hebel für die staatliche Beförderung der Akkumulation, nicht durch ein kräftiges Wachstum von Reichtum in DM-Form und durch sprudelnde Steuerquellen untermauert und ins Recht gesetzt wird, erweist es sich, daß dieser Kredit auf nichts anderem beruht als dem Beschluß der Politik, sich qua Hoheit über Geld und Kredit mehr Zahlungsfähigkeit zu beschaffen. Dann kommt die Frage auf den Tisch, ob es sich bei dem Mehr an Geld, das vom Staat in Umlauf gebracht wird und das sich in Bilanzen von Firmen und Banken wiederfindet, tatsächlich um ein Mehr an „harter DM“ handelt oder ob hier nicht bloß die schwindelhafte Aufblähung der Masse zirkulierender Schuldzettel stattfindet. Dann ist von „Inflation“ und „gefährdeter Geldwertstabilität“ die Rede; und dann weiß jeder Politiker: Das nationale Geld, dessen Qualität als unbedingtes Zugriffs- und Finanzierungsmittel für alles, was der Staat sich leisten will und muß, ist in Gefahr.
Renovierung der Zone zum Angebot für’s Geschäft
Auch wenn jetzt klar ist, daß die Zone für Deutschland keine Reichtumsquelle, sondern Zuschußbetrieb ist: Man hat sie jetzt, Weggeben kommt nicht in Frage. Also fährt der deutsche Staat mit seinen Anstrengungen fort, aus ihr ein Angebot zu machen, das Kapitalisten zum Investieren anreizt. Für künftige Attraktion von Kapital die Bedingungen zu erstellen, ist und bleibt die komplementäre Seite dazu, sich mit dem Abschreiben von beträchtlichen Teilen von Land und Leuten „drüben“ politisch abzufinden. Aus der Schuldenlast, die der Staat sich in den ersten zwei Jahren „Aufschwung Ost“ eingefangen hat, folgt eben gar nicht unbedingt und überall das Streichen von Aufgaben und Ausgaben, sondern ebensogut das Gegenteil, vermehrtes Einschießen von Staatskredit.
Was von beiden wo ansteht, wo eine Auslage gut angelegt, wo herausgeschmissenes Geld ist, ist der Natur der Sache gemäß vorweg gar nicht entscheidbar. Es geht ja um zukünftige, um mögliche ökonomische Erträge, die die Politik herbeiregieren will. Dieser Umstand gibt zwar jede Menge Anlässe her für Streit innerhalb und zwischen den Parteien und für besserwisserische Kommentare von Politik-Beratern von der Presse und der Wissenschaftsfront. Das irritiert aber die Macher nicht weiter; sie verlassen sich, wie immer, auf die Überzeugungskraft ihrer Gewalt und ihres Geldes.
Der Auftrag der Treuhand wird neu definiert
Unter dem Titel „Privatisierung“ hat sich bei der Treuhand die Praxis eingebürgert, daß nicht der Käufer der Treuhand etwas zahlt, sondern umgekehrt die Treuhand Schulden und Umwelt-„Altlasten“ auf ihre Kappe nimmt und die Haushalte von Ländern und Kommunen mit allerlei Sondervergünstigungen und Subventionen nachhelfen. Wo sich nicht einmal auf diese Weise ein Investor finden läßt, steht die Treuhand vor der Entscheidung, entweder den entsprechenden Betrieb gleich dichtzumachen oder mit weiterem Kredit am Leben zu erhalten. Die Entscheidung fällt mal so, mal so; gute Gründe hat sie immer für beides.
Mit dem ursprünglichen Konzept der „Privatisierung“, nach dem die Treuhand dem Staatshaushalt durch den Verkauf von Vermögensbestandteilen Einnahmen einspielen sollte, hat diese Praxis nichts mehr zu tun. Die Treuhand hat sich längst vom Status einer Kosten und Erträge bilanzierenden Vermögensverwaltung, als die sie einmal eingerichtet war, verabschiedet, und sich in einen Zuschußbetrieb des Staatshaushalts verwandelt. Damit ist sie in die wirtschaftspolitische Schußlinie gekommen. Als läge es an irgendwelchen fehlerhaften Techniken bei der Wahrnehmung des Treuhand-Auftrags, werden „Fehlentscheidungen“, „schlechtes Management“, „borniertes betriebswirtschaftliches Denken“ dafür verantwortlich gemacht, daß die nationalen Rechnungen mit dem DDR-Vermögen nicht aufgehen. Überträgt die Treuhand ein Stück Produktion einem Kapitalisten zum Nulltarif, um der Staatskasse weitere Kosten zu ersparen, wird ihr „Verschleuderung von Volksvermögen“ vorgeworfen. Führt sie Betriebe weiter in der Hoffnung, doch noch einen kapitalkräftigen Käufer für sie zu finden, bekommt sie zu hören, sie schleppe bloß marode Produktionen auf Staatskosten fort.
Im Zuge dieser Beschwerden hat sich erst unterderhand, dann offiziell eine neue Bestimmung des Treuhand-Auftrags durchgesetzt: Sie soll nicht mehr nur „privatisieren“, sondern auch „sanieren“. Auf diese Weise soll doch noch der eine oder andere Bestandteil der DDR-Erbmasse vor dem „ökonomischen Kahlschlag“ gerettet werden.
Mit dieser Umdefinition ihres Auftrags wird aus der ehemaligen „Zwischeneigentümerin“, die nach Kosten- und Ertragsgesichtspunkten wirtschaften sollte, ein Instrument der Wirtschaftspolitik. Das ist verräterisch. So gesteht die Politik ein, daß es ihr nicht gelungen ist, aus dem Produktivvermögen der DDR Kapital zu machen, und beschließt gleichzeitig, dieses Ergebnis nicht gelten zu lassen. Wenn die konsequente Anwendung des ansonsten zum Grundprinzip allen Wirtschaftens hochstilisierten „Gesetzes“, nach dem sich eine Produktion „rechnen“ muß, jetzt als „betriebswirtschaftliche Bornierung“ kritisiert und als Maßstab der Treuhandpolitik korrigiert wird, dann rückt die Politik ein Stück weit ab von ihrem Standpunkt, nach dem das Kapital zuständig ist für’s Geschäftliche, die Politik dafür allenfalls Bedingungen bereitzustellen habe, und beauftragt sich selbst, für die nationalökonomische Brauchbarkeit alter DDR-Firmen im Kapitalismus zu sorgen.
Deshalb ist der Titel „Sanieren“ für den neuen Treuhand-Auftrag auch der reine Schwindel. Um „Sanierung“ handelt es sich nämlich gar nicht, wenn die Treuhand sich daranmacht, alte DDR-Betriebe in eigener Regie kapitalistisch auf- und umzumöbeln. Hier setzen sich nicht Bankenvertreter, Firmenleitung und Betriebsräte zusammen, um eine im Prinzip für rentabel gehaltene Firma, die „in Schwierigkeiten“ geraten ist, neu für die Konkurrenz herzurichten, mit der Streichung von Bankschulden, Kostensenkungen, Entlassungen, Produktwechsel und neuem Kredit. Hier werden vielmehr Betriebe auf Staatskosten weitergeführt und auf mögliche „Märkte“ hin zugerichtet, über die die geltenden Kriterien des Geschäfts gerade das Urteil „unbrauchbar“ gefällt haben. Hier haben nicht die Agenten lohnenden Produzierens eine zukünftige Gewinnquelle entdeckt, die sich zu renovieren lohnt, sondern der Staat will nicht zulassen, daß das in der Treuhand zusammengefaßte neue Volksvermögen sich endgültig als bloßes Minus herausstellt und die alte DDR dem neuen Deutschland endgültig nur Lasten aufbürdet.
Es handelt sich hier also nicht um „Sanieren“, sondern um staatliche Subventionen. Neuer Staatskredit wird nachgeschossen, um zu verhindern, daß der alte sich endgültig entwertet; um ihm per Staatsgewalt – in Teilen zumindest – doch noch eine politökonomische Substanz zu verleihen. Ökonomische Kriterien für die Auswahl der Sanierungsobjekte, für die Entscheidung, wann und nach wieviel zusätzlichem Finanzaufwand endgültig „klar“ wäre, ob sich das Sanieren gelohnt hat oder nicht, kann es logischerweise gar nicht geben. Es ist rein eine Frage der Wirtschaftspolitik, ob, wo und in welchem Umfang Produktionsstätten für sanierungswürdig erachtet werden. Also findet unter den Produktionszweigen und Regionen der alten DDR eine neue, politische Sortierung statt. Produktionen werden weitergeführt, damit „Regionen“ ökonomisch existenzfähig bleiben und sich doch noch zur Steuerquelle für ihre Regierenden mausern; ergänzend dazu erklärt die Politik Teile der alten DDR neu zu wirtschaftspolitischen „Fördergebieten“ und schreibt damit andere endgültig ab. Das führt zu einer etwas ungewöhnlichen Sorte Parteien- und Länderkonkurrenz, heizt das politische Leben im Osten mächtig an und gibt den entsprechenden Machern lauter schöne Gelegenheiten zu beweisen, daß sie doch allerhand tun für „die Menschen“.
Sozialstaat im Osten – neu besichtigt und für zu üppig befunden
Das mit den „blühenden Landschaften“ ist erst einmal vertagt. Inzwischen wird mit einem Großteil der werten „Neubürger“ als auf Dauer überflüssigem Menschenmaterial gerechnet. Damit steht für den Staat, Abteilung Soziales, fest, daß für deren Herrichtung als brauchbare Arbeitskraft für’s Kapital alles Nötige gelaufen ist, entsprechende Maßnahmen also gestrichen werden können. Daß im Osten massenhaft Leute nur aufgrund dieser Maßnahmen überhaupt ein Einkommen beziehen, ist den staatlichen Stellen zwar bekannt. Aber als dauerhaftes Lebensmittel sind solche Zahlungen weder geplant noch vorgesehen. Die Politik kennt wenig Hemmungen, ihr Urteil, daß der Lebensunterhalt von Leuten, die das Kapital nicht lohnend beschäftigen kann oder will, eine einzige Belastung für die Bilanzen dieser „reichen Industrienation“ ist, an den Zonis ziemlich flächendeckend zu vollstrecken. Die Kurzarbeit-Null-Regelung ist ausgelaufen, ABM-Maßnahmen werden als unlautere Konkurrenz für private Geschäftsleute kritisiert und gestrichen. Allerhand „Qualifizierungsmaßnahmen“ gibt es noch, aber der Schein, sie würden die Leute für den anstehenden Aufschwung fitmachen, verliert sich zusehends. Sie werden als Aufbewahrungseinrichtungen unterhalten, in denen Zonis von westdeutschen „Trainern“ zum x-ten Mal „Grundsätze der Marktwirtschaft“ („Verhalte dich immer kosten-/ ertragsoptimierend“ und so Zeug) oder der Umgang mit PCs beigebracht wird (wahrscheinlich heißt es dann demnächst, daß die Ossis das doch nie lernen). Zugleich will man jetzt an jeder Menge solcher Qualifizierungs- und Fortbildungsmaßnahmen samt den dafür neu eingerichteten und gegründeten privaten oder halboffiziellen Instituten entdeckt haben, daß hier bloß mit lauter für keinerlei spätere Berufstätigkeit tauglichen Scheinangeboten Leuten bzw. noch schlimmer dem Staat Geld aus der Tasche gezogen werde. So ziehen die staatlichen Instanzen stückweise die von ihnen selbst in Umlauf gesetzte Ideologie aus dem Verkehr, nach der „Qualifizierung“ schon fast so etwas wäre wie ein Mittel, sich einen Arbeitsplatz zu sichern.
So wird allmählich Schluß gemacht mit der Fiktion, das ganze Zonenvolk wäre Arbeitskraft auf Abruf und der Abruf nur eine Frage der Zeit. Stattdessen erfährt das neue Arbeitsvolk die Sortierung nach Maßgabe des stinknormalen Sozialstaates im Westen. An die Stelle von verdeckter Arbeitslosigkeit durch „Kurzarbeit Null“ tritt die Herstellung und Festschreibung eindeutiger Unterschiede zwischen Beschäftigten, Leuten mit Aussicht auf Wiederbeschäftigung und „Langzeitarbeitslosen“. Diese Sortierung definiert mit der dazugehörigen finanziellen Ausstattung auch alle Lebensumstände und zementiert verschiedene Grade der Verarmung als Dauerbestandteil der „Sozialstruktur der neuen Bundesländer“. Der Sozialstaat bundesdeutschen Typs organisiert eben die proletarische Laufbahn, auch die nach unten inklusive Pauperisierung und Verwahrlosung. An den schwindenden Mitteln der Arbeitslosen- und Rentenkasse und der stetig wachsenden Zahl von Sozialhilfeempfängern, die die kommunalen Haushalte auffressen, thematisiert die Politik, daß ihr wunderschöner Sozialstaat für diese massenhafte Inanspruchnahme nicht gemacht ist, und warnt sich selbst vor „amerikanischen Verhältnissen“. Die Rede von sozialstaatlichen Maßnahmen zur „Vermeidung sozialer Explosionen“ tut kund, daß deutsche Politiker ihr neues Volk inzwischen vorwiegend unter dem Standpunkt von Ruhe und Ordnung begutachten. Die Forderung nach besserer Ausstattung der Polizei in den neuen Ländern ist da nur logisch: Daß deutsche Stadt- und Kommunalväter den Übergang von der sozialstaatlichen zu nur noch polizeimäßiger Betreuung unbrauchbarer Volksteile beherrschen, haben sie ja schon bei einschlägigen Drogenszenen im Westen bewiesen.
Risiken an der Geldfront und ihre Bewältigung
Die deutsche Politik benötigt ständig mehr Geld und verschafft es sich auch. Der Preis, den sie dafür an mehreren Fronten zu zahlen hat, hat es allerdings in sich. Er führt dazu, daß keine der nationalen Rechnungen mehr problemlos aufgeht. Das nötigt die Politik, sich nach neuen Erfolgsrezepten umzusehen. Statt daß ein kapitalisierter Osten sich der Wucht des alten BRD-Kapitalismus hinzuaddiert hätte und dem deutschen Staat die Fortführung seines bisherigen ökonomischen Erfolgsweges auf neuer Stufenleiter eröffnet hätte, führt der Zuschußbetrieb Zone umgekehrt dazu, daß auch der Kapitalismus im Westen nicht mehr so weitergemacht werden kann wie vorher.
Zu Schaden kommt erstens der weltwirtschaftliche Erfolgsweg der deutschen Politik:
Die Staatsschulden steigen, die Zinsen ebenfalls, und die Bundesbank setzt den Diskontsatz hoch. Geldkapital zur Finanzierung der deutschen Staatsschuld ist kein Problem: Die deutschen Finanzmärkte erfreuen sich eines stetigen Zustroms spekulativer Mittel, die den DM-Kurs in die Höhe treiben und sicherstellen, daß die DM gegenüber Dollar und Yen „stark“ bleibt. So „kämpft“ die deutsche Politik an der Zinsfront darum, daß ihre Freiheit im Einsatz der DM nach außen, als Angebot und Erpressungsmittel in der weltwirtschaftlichen Konkurrenz, nicht durch die zunehmende Aufblähung des DM-Kredits zu Schaden kommt. Die deutsche Politik bricht mit Freunden und Konkurrenten einen Streit um den Erhalt der Zahlungsfähigkeit der Nationen vom Zaun und muß erfahren, daß der Schaden schon eingetreten ist:
- In der EG hängt die reibungslose Durchsetzung der Währungsunion auch daran, daß die anderen Nationen ihre Abhängigkeit von der DM vor allem als Nutzen für das Vorankommen ihrer nationalen Bilanzen begreifen. Zur Zeit mosert die europäische Konkurrenz vorwiegend über den Schaden, den die deutschen Zinsen an ihrem Haushalt und ihrem Wirtschaftswachstum anrichten, und droht mit Intransigenz, wenn die Deutschen EG-Mittel für den Osten anfordern. Daß die deutsche Politik sich bislang noch mit fast allen Forderungen hat durchsetzen können, ändert nichts an dem Befund, daß das Klima frostiger geworden ist, seit die Deutschen vermehrt den EG-Kredit für ihr nationales Projekt in Anspruch nehmen und offenkundig wird, daß hier nicht in unterschiedlichem Maße an einem Fortschritt partizipiert, sondern ein Schaden abgewälzt wird.
- Auch im Verhältnis zu den USA, denen gegenüber sich Deutschland nach dem Abdanken des Ostblocks gerne als ökonomisch potenter und zur Zusammenarbeit auf allen Ebenen bereiter „partner in leadership“ präsentiert hätte, tun sich ungewollte Streitpunkte auf. US-amerikanische Politiker schimpfen auf den deutschen Zins, und ihre deutschen Kollegen nehmen den Dollarkurs-Verfall wg. „Zinsdifferenz“ keineswegs wie früher freudig als Indiz eines amerikanischen „Verlustes an Wettbewerbsfähigkeit“. Sie halten vielmehr sorgenvoll Ausschau nach möglichen Wirkungen, die der schwindende Wert des Dollar nicht nur auf die „globalen Finanzmärkte“, sondern auch auf deren bislang noch einvernehmliche Beaufsichtigung durch die G7 haben könnte. Es ist eben eine Sache, sich unter dem Schutzschirm der Nato zur weltwirtschaftlichen Konkurrenz der USA aufzumandeln, und eine andere, den Streit um die weltweit fällige Entwertung von Kredit gegen sie durchzustehen. So kommen ein paar neue, häßliche Töne in die weltwirtschaftliche Diplomatie.
Zu Schaden kommen zweitens gewisse Bequemlichkeiten deutscher Wirtschafts- und Sozialpolitik:
Die deutsche Politik sieht sich genötigt, alle Abteilungen ihrer Politik nach innen dem obersten Gebot der Sanierung des nationalen Kredits unterzuordnen. Dauerhaft will sie die Stärke ihrer DM nämlich nicht ausschließlich von so unzuverlässigen Instanzen wie der internationalen Spekulation abhängig wissen. Daß die Nation die Attraktion von Geldkapital per Zinspolitik hinkriegt, hat ja die andere Seite, daß sie es nötig hat, dem Finanzkapital ein Sonderangebot zu machen. Daran zeigt sich, daß der Kredit den quasi automatischen Dienst, den er der deutschen Wirtschaft und der Nation noch bis vor kurzem geleistet hat, versagt: gleichzeitig lohnendes Geschäftsmittel für produzierende (Export-)Unternehmen, wachsende Anlagegelegenheit und Gewinnquelle für’s Finanzkapital und sichere Finanzierungsquelle für den Staatshaushalt zu sein. Jetzt verschafft zwar der Staat mit seinen Staatsschuldpapieren und Zinsen dem Finanzkapital lohnende Anlage. Aber die Vermehrung von deren Mitteln dient gar nicht als Ausgangspunkt für neues, produktives Geschäft, sondern zeigt sich bloß in ständig erweiterter Aufblähung des „Finanzsektors“. Die Unternehmen halten sich für steigende Kosten an der Zinsfront durch Preissteigerungen schadlos, die die Bundesbank als Inflation verbucht. Mehr Geld ist da, aber nicht mehr nationaler Reichtum.
In dieser Lage entfällt ein Stück weit das gewohnte, herzliche Einverständnis aller Abteilungen der herrschenden Klasse über ihre gemeinsam erbrachten, hervorragenden Leistungen. Stattdessen setzt ein dauerndes Gemecker aller Beteiligten ein darüber, was andere Zuständige versäumt hätten:
- Die Bundesbank, die die staatlichen Schuldverschreibungen ins Bankwesen schleust und die Zinsen hochsetzt, macht die staatliche Schuldenmacherei für die Lage verantwortlich und beschwert sich darüber, daß die Politik mit Kreditsubventionen im Osten die Bemühungen der Bundesbank um „Inflationsbekämpfung“ qua Kreditverknappung unterläuft.
- Die Regierung, die den Kredit will, stört sich an den Zinsen, die ihren Haushalt zusätzlich belasten, und gibt den Vorwurf an die Unternehmer weiter, sie würden ihre angehäuften Gelder in Finanztiteln „horten“, statt sie im Osten anzulegen.
- Die Kapitalisten beschweren sich ihrerseits über die Zinsbelastung und den „künstlich“ hohen DM-Kurs, die ihre Kosten hochtreiben und ihnen auswärtige Märkte kaputtmachen.
Der Ertrag dieses Gemeckers ist ein neuer nationaler Konsens. Erstens müssen die Zinsen, an denen sich alle stören, hoch bleiben, weil – so jedenfalls ihr Dogma – nur so gewährleistet sei, daß die allseitigen Bemühungen um neuerliche Solidität des Kredits diesen nicht gerade wacklig machen. Und zweitens müssen deshalb die „Belastungen“, mit denen die Politik ihre Wirtschaft befrachtet hat, an anderer Front kompensiert werden. Wenn, so der inzwischen allseits durchgesetzte Standpunkt, die deutsche Gesamtwirtschaft nicht genug einspielt, um dem Staat problemlos seinen Kredit für den Osten zu finanzieren, dann hat nicht einfach der Staat zuviel ausgegeben, sondern dann ist dieses Gesamt-Deutschland einfach zu teuer. Dann kostet es die Nation insgesamt zuviel, sich als ertragreicher Standort für Kapital zurechtzumachen; und dann kosten auch und vor allem die zuviel, aus deren Arbeitskraft das Kapital seinen Überschuß herausschlägt.
Seit dies feststeht, steht auch der Königsweg fest, mit dem alle Probleme der Nation gelöst werden können, ihr Kredit wieder solide gemacht, ihr Geld wieder unangefochten stark werden soll. Erstens ist der gesamte Staatshaushalt in allen seinen Abteilungen daraufhin durchzuforsten, wo Ausgaben, die bislang nötig, aufgrund der neuen Lage ab sofort überflüssig sind. Zweitens sind die in der Gesellschaft verdienten Einkommen darauf zu besichtigen, ob von denen nicht noch einiges mehr in die Staatskasse wandern kann. Und drittens muß ein neues nationales Lohnniveau her, das für neue, unschlagbare Attraktivität deutschen Staatsgebiets in Sachen Kapitalanlage und damit für neues, stabiles Wirtschaftswachstum sorgt.
Aufgrund der im Osten weiter zu finanzierenden Aufgaben nimmt der Staat bei seinen anderen Haushaltsposten eine Neudefinition dessen vor, was er sich leisten will. Dem fällt das eine oder andere Infrastruktur- und ähnliche Projekt im Westen zum Opfer. Daneben werden Politiker nicht müde im Entdecken und Erfinden neuer Einnahmequellen, die sich unterm Strich alle als dieselbe erweisen: Der Lohn, der Verdienst der normalen Sterblichen, ist zum Sanierungsinstrument des Staatshaushalts erkoren und unter dem Gesichtspunkt für ziemlich strapazierfähig erklärt. Dabei reicht es der Herrschaft nicht, das Volk einfach so zur Kasse zu bitten. Der Politik kommt es auf eine „geistige Wende“ an: Sie verkündet „Ehrlichkeit“ in der Kampfansage gegen „soziale Besitzstände“ und eröffnet dem Volk, daß es mit seinem angeblichen Bestehen auf alten Gewohnheiten in Sachen Konsum und sozialer Sicherung ein einziges Hindernis für die Lösung der nationalen Nöte sei; daß nun statt „Egoismus“ „Teilen“, statt „Anspruchshaltung“ „Solidarität“ angesagt ist. Dem kann man entnehmen, daß deutsche Politiker zur Bewältigung der Notlage des deutschen Kredits dem Volk noch einiges zuzumuten gedenken.
Die Politik kündigt also in voller Absicht den alten „sozialen Konsens“ in allen seinen materiellen wie immateriellen Abteilungen. Gegenüber den Gewerkschaften, den obersten Hütern dieses nationalen Gutes, sorgte die Regierung in der Tarifrunde im öffentlichen Dienst für die nötigen Klarstellungen. Stellvertretend wurde an der ÖTV durchexerziert, daß der Lohn im neuen Deutschland nicht mehr eine „Frage“ zwischen „Sozialpartnern“ ist, der die Politik allenfalls sachverständige „Leitlinien“ vorgibt, sondern eine pur nationale Frage, die sich nach Maßgabe der Notwendigkeiten von Haushalt, Staatskredit und DM zu entscheiden hat. Inzwischen ist auch dieses Diktum als neue nationale Lohnleitlinie abgehakt und findet in DAG-Lohnsenkungsangeboten, Öffnungsklauseln in Ost-Tarifverträgen u.ä. seine produktive Anwendung.
Ob mit diesen Maßnahmen die „Konjunktur“, die sich absehbar „nach unten“ bewegt, überhaupt „gestützt“, ob ihr nicht sogar eher geschadet wird; ob das neue Großdeutschland sich so mehr „kaputtsaniert“ oder „gesundschrumpft“, darüber streiten sich die Zuständigen dann wieder, werden aber dadurch an ihrem Standpunkt nicht irre, daß nur weitere Verarmung der Massen dem Reichtum der Nation auf die Beine helfen kann. Sichergestellt ist auf diese Weise jedenfalls, daß sich seit dem Anschluß der DDR so manches im Leben auch der Wessis verändert, und zwar nicht zum Besseren. Die täten gut daran, das nicht den Ossis vorzuwerfen und übelzunehmen.
Die politisch-rechtliche Revolution der Zone
Genauso selbstverständlich, wie die Macher der deutschen Einheit beim Geld-Umtausch darauf gesetzt haben, daß mit der „guten, harten De-Mark“ in der Zone unweigerlich ein kapitalistisches Geschäftsleben ausbrechen würde, sind sie auch davon ausgegangen, daß mit dem Export des politischen Überbaus, der Einrichtungen und Spielregeln Westdeutschlands in die Zone die andere Hälfte des Programms blühende Länder erledigt wäre. Arbeitsämter und Kassenwesen, Gerichte und der gesamte westdeutsche Gesetzesapparat, Bundesländer mit eigenen Regierungen und Haushalten, eine Parteienlandschaft nach westdeutschem Muster und ein öffentlich-rechtlich/privat sortiertes Medienwesen – die komplette Polit-Methodik der BRD ist auf die DDR draufgesetzt worden. In keinem Punkt haben sich Stimmen durchsetzen können, die die Brauchbarkeit der einen oder anderen DDR-Institution in Erwägung ziehen wollten, von den Polikliniken über das SERO-System bis zum Sandmännchen – so radikal hat die BRD-Politik nämlich darauf bestanden, daß ihr Politapparat in moralischer, menschenrechtlicher Hinsicht und überhaupt das beste Modell und als Erfolgsgarantie – für oben und unten – einfach unschlagbar sei. Die Instanzen müßten nur rübergeschafft werden, um die zweite Art Nützlichkeit der neuen Staatsbürger zu garantieren, ihre Tauglichkeit als demokratisches Volk, das sich im wesentlichen an die Gesetze hält, das wählen geht und auch korrekt wählt, das sich die passende Moral aneignet und überhaupt an den richtigen Stellen lacht, anstatt den Kanzler mit Eiern zu bewerfen. Mit der Kopie der bewährten westdeutschen Verwaltungs- und Regierungskunst sollten wiederum der Einsatz der neuen Staatsbürger und die Herstellung der politischen Voraussetzungen für das Wachstum gewährleistet sein – ein Zusammenspiel, das ja in der Westzone auch einwandfrei funktioniert.
Die Abwicklung eines ganzen Staats
Auch diese Kolonisierung der Ex-DDR ist zunächst einmal ein gigantisches Abbruchunternehmen, hauptsächlich mit dem Titel „Stasi“ begründet und durchgezogen: Der vorfindliche Staatsapparat wurde nicht übernommen, sondern zerschlagen und mit den einschlägigen Säuberungen ist man immer noch zugange. Nach dem Prinzip: Dienstleistung im alten Staat disqualifiziert für Dienste im neuen, ist die politische Elite des alten Staates ausgemustert worden. Aber nicht nur die, der Säuberungsbedarf der BRD hat sich sehr flächendeckend betätigt, Funktionsträger aller Art werden amtsenthoben. Schließlich haben ziemlich viele, wenn nicht fast alle, auf die eine oder andere Weise mit dem alten Staat kollaboriert, was immer wieder, bei immer neuen Anlässen, mahnend und verwarnend in Erinnerung gebracht wird.[1] Etliche Hunderttausend sind auf die Weise abgeschoben worden – ein neuer, politisch produzierter gesellschaftlicher Bodensatz.
Daß eine siegreiche Macht den unterlegenen Staat demontiert, ist einfach zu haben, durch Einsatz von Gewalt, das heißt in der BRD: Rechtsstaatlichkeit. Sich selbst auf dem neuen Staatsgebiet zu etablieren, ist ein anderes Kapitel: Die Installierung sämtlicher Behörden samt Personal ist verlangt. Beibehalten werden konnte da allenfalls die Müllabfuhr, auf allen anderen Gebieten mußten Ämter neu eingerichtet, Personal ersetzt werden. Und weil das menschliche Material, das die alte DDR für diese Posten zu bieten hat, entweder wegen seiner Karriere im alten Staat für untauglich befunden wurde oder auch gar nicht in genügender Masse vorhanden war, ist eine Verschickungsaktion größten Kalibers in Gang gekommen: Von Finanzbeamten bis zu Politikern, fast alle der neueingerichteten Staatsfunktionen werden von der BRD her personell bestückt.
Und auch noch mit Büros, mit Schreibtischen, Telefonen, Funk- und Schießgeräten ausgerüstet. Denn der bürokratisch-verknöcherte Staatssozialismus der alten DDR, dieses System, das mit seinem gigantischen Apparat die gesamte Gesellschaft gelenkt, überwacht und überwuchert hat, nimmt sich nun, in der Optik der kolonisierenden BRD, wie eine einzige Wüste in Sachen staatliche Ausrüstung aus: Komplette Leerstellen sind zu verzeichnen, was so segensreiche Einrichtungen wie Finanz-, Katasterämter, Versicherungen aller Art betrifft. Ortsansässige Rechtsanwälte lassen sich an einer Hand abzählen, und was sich dort Polizei nennt, ist einfach lächerlich. Nicht einmal für Parlamente und Regierungen, Bürgermeister- und Richterämter läßt sich das passende Material vor Ort auftreiben.
Abgewickelt und neueingerichtet werden mußten schließlich auch sämtliche Sphären der sogenannten politischen Kultur. 5 Landesväter mit Länderregierungen samt Parlamenten waren zu besetzen, und das im Idealfall mit Gesichtern, die, wenn sie von Plakaten herunterstrahlen, dem Wähler auch schon alles Nötige sagen. Dazu eine Parteibasis in der bewährten christlich / sozial / liberal / sozialdemokratisch / grünen Palette. Dazu anstelle der grauen Einheitspresse eine Medienlandschaft, die den Neubürgern politische Orientierung, Lebensberatung und -freude schenken soll. Einen Teil dieser demokratischen Aufgabe haben Bertelsmann, Burda und Bild ehrenamtlich für gutes Geld übernommen; den Augiasstall Staatsfunk und -fernsehen mußte ein einziger Herkules Mühlfenzl ausmisten. In dem System, das sich zum freien Meinen bekennt, ist nämlich nichts so wichtig wie eine ausgewogene, im Parteienproporz organisierte Betreuung des Meinens, damit das auf keine falschen Gedanken kommt. Vom Kinderprogramm bis zum Fernsehballett wurde die Überprüfung auf die Fähigkeit zur demokratischen Meinungsbildung und sittlich wertvollen Unterhaltung durchgeführt, in zahlreichen Fällen durch das Argument ‚Stasi‘ geregelt. Aus der aktuellen Kamera bekannte Gesichter mußten dem befreiten Volk selbstverständlich erspart, gewisse Publikumslieblinge zu seinem Trost wiederum beibehalten und das Ganze dann auch noch ‚bürgernah‘, nämlich auf Länderebene organisiert werden – auch diese größere Austauschaktion war nur mit West-Personal zu erledigen.
Das Programm der BRD läuft eben auch darauf hinaus, einen ganzen Staat auszutauschen. Und bei dem Versuch wird nun in aller Öffentlichkeit vorexerziert, was für eine Riesenapparatur ein kapitalistischer Staat ist. Auf wieviele Lebensregungen der Bürger eine demokratische Bürokratie aufzupassen hat, die dem sozialistischen Schlendrian völlig egal waren, der ja nicht einmal seine Schwangeren mit Mut zum Kind zwangsberaten wollte. Wieviele Amtsakte eine Wirtschaft erfordert, in der das Individuum und die Privatinitiative regieren, nämlich Geld und Privateigentum ihre rechtsförmliche, gewaltsame Sicherung verlangen. Einmal abgesehen von solchen Sparten wie Wissenschaft und öffentliche Meinungsmache, in denen mancher westdeutsche Beförderungsstau durch den unverhofften Glücksfall einer Professoren- oder Rundfunkkarriere in der Zone abgelöst worden ist – so viele Beamte, Richter, Polizisten, Rechtsverdreher, Finanzamtsmänner hat die BRD gar nicht in Reserve, um den von ihr verursachten Bedarf an diesen Chargen decken zu können.
Das vorläufige Ergebnis: Es klappt nicht recht Zu viel und zu wenig Staat fürs Geschäft
Die Geschäftswelt führt Klage darüber, daß ihr staatliche Dienste vorenthalten werden, amtliche Bescheinigungen nicht aufzutreiben sind, überhaupt Rechtssicherheit als Geschäftsbedingung abgeht, Geschäfte sich dadurch verzögern oder zerschlagen.
Erstens ist die personelle Ausstattung der Ämter, auf deren Funktionieren sich die Geschäftswelt verlassen will, lange noch nicht auf westlichem Standard. Zweitens aber ist der Austausch eines ganzen Staats mit der personellen Ausrüstung gar nicht erledigt. Der grundsätzliche Bedarf von Staat und Kapital an klaren Eigentumsverhältnissen trifft auf ein sozialistisches Erbe, das nicht einmal genügend brauchbare Anhaltspunkte für deren Ermittlung zur Verfügung stellt: Gar nicht vorhandene oder lückenhafte Grundbucheintragungen, Vermögensübereignungen in einem Stil, der westliche Rechtsexperten schaudern läßt, ein unübersichtliches Durcheinander von Gelände und Gerät und Eigentumsansprüchen. Demgegenüber steht der Gesetzesapparat der BRD, der das Grundprinzip der Marktwirtschaft, das Eigentum, den Ausschluß vom Reichtum, durch sämtliche ökonomischen Materialien hindurch und für sämtliche dazugehörigen Interessenskollisionen penibel festgelegt hat – in dem müssen sich erstens genügend Amtspersonen vor Ort überhaupt auskennen und dem müssen zweitens die unhandlichen DDR-Gegebenheiten erst subsumiert werden. Das verlangt wiederum lauter staatliche Entscheidungen, bei denen die darauffolgende Prozeßflut von seiten geschädigter Interessenten auch absehbar ist. Die Lebenshilfe, die der demokratische Rechtsstaat seinen Bürgern beschert, ist eben doch etwas anderes als die Ausformulierung von deren Rechtsempfinden, die ihnen dann wieder Orientierungshilfen gibt – der Oktroi der Kategorie Eigentum auf die Zone bedeutet eine gewaltige Umdefinition, inkl. Schädigung, von Interessen. So schafft die Einführung des Rechtsstaats ihm ein Material, bei dessen Bewältigung er kaum hinterherkommt.
Das schafft jedenfalls viele Arbeitsplätze, allerdings keinen Geschäftsboom. Mit dem Gesichtspunkt beschäftigt sich die öffentliche Debatte vor allem. In dem immer wieder neu aufgelegten Streit um das Prinzip Rückgabe vor Entschädigung und umgekehrt wird ein schöner Gegensatz verhandelt: Das staatliche Bedürfnis nach einer möglichst schnellen geschäftlichen Inbetriebnahme gerät mit dem anderen staatlichen Bedürfnis überkreuz, die Eigentumsfrage eindeutig, einheitlich, juristisch unanfechtbar zu regeln, eben der Zone erst einmal das neue Gewaltverhältnis aufzuerlegen. Daß daran das Geschäft in der Ex-DDR scheitern würde, ist allerdings ein Gerücht. Bezeichnenderweise klagen die interessierten Parteien über beides: Darüber, daß es zu wenig rechtliche Klärungen gibt, und darüber, daß viel zu viel Staat, zuviel Bürokratie im Weg steht. Genau dieselben Klagen gehören schließlich auch in der „funktionierenden“ BRD zum Standardrepertoire der geschäftlichen Beschwerdeführung. Die Wahrheit ist eher umgekehrt: Weil die geschäftliche Benützung der DDR ausbleibt, kommt auch die Überführung des westdeutschen Rechtsstaats in den Verdacht, Geschäft zu behindern. In diesem Fall nimmt die deutsche Staatsgewalt die Beschwerden sehr ernst; wegen ihrer eigenen Probleme mit dem ausbleibenden Wachstum in den neuen Ländern wird das Recht daraufhin durchgemustert, ob es nicht an die Lage angepaßt werden muß – ein bißchen Sonderrecht wie z.B. die Verkürzung der Genehmigungsverfahren bei Bauprojekten kommt darüber zustande.
Die Subsumtion der Zone unter Eigentumsverhältnisse verlangt also einigen Aufwand, ohne daß ein ökonomischer Ertrag in Sicht wäre; dazu kommt die Subsumtion des menschlichen Inventars unter demokratische Regeln, die auch nicht so reibungslos vonstatten geht, wie es die Lehre von der in der Menschennatur verankerten Demokratie vorsieht.
Ein ganzes Volk – milieugeschädigt
Wegen der Wirkungen, die die Revolution auf die Zonenbewohner ausübt, werden sie nicht zu einem Staatsbürgermaterial von der Qualität gebildet, mit der deutsche Politik wie gewohnt rechnen könnte. Das Fahnenschwenken vor 2 Jahren hat zwar toll geklappt, aber damit ist es eben nicht getan.
Zum einen werden die ehemaligen sozialistischen Staatsbürger jetzt mit einem Staatsapparat konfrontiert, bei dem sie sich schlicht nicht auskennen. Angefangen von etlichen Versicherungen und Ämtern, die die alte Zone gar nicht gebraucht hat, bis zu einer ganz andersartigen Einteilung zwischen staatlich und privat zu organisierenden Leistungen, organisiert als ein behördliches Hindernisrennen mit Unterlagen, Fristen, Antragsberechtigungen, bei dem auch genügend Westbürger ausscheiden. Bei vielen fällt die Wirkung ganz banal aus: Sie kennen sich hinten und vorne nicht mehr aus, wissen nicht, wo und wie eine Rente oder ein Wohngeld zu beantragen ist, daß eine Klage gegen Kündigung möglich wäre, daß es so etwas wie unsittliche Geschäftsbedingungen und Versicherungsbetrüger und ein rechtsstaatliches Vorgehen dagegen gibt. Und darüber versäumen sie einiges und fallen durch den Rost.
Soweit sie andererseits noch die moralischen Gewohnheiten des alten Systems an sich haben, werden die ihnen gründlich ausgetrieben. Wer z.B. meint, ein Recht auf gewisse Versorgungsleistungen zu besitzen oder sich auf die fürsorglichen Einrichtungen wie im alten Staat verlassen zu können, fällt auf die Schnauze. Wer im Stolz darauf, was man unterm alten System geleistet, welche nützlichen Sachen man doch produziert hat, nicht wahrhaben will, daß der eigene VEB auf der Abschußliste steht, muß sich ebenso umstellen.
Und auch diejenigen, die mit dem unbedingten Willen zur Anpassung antreten, fest daran glauben, daß mit viel Eifer und Sich-Kundig-Machen, mit dem Studium von Computerbüchern und Weisheiten der Marktwirtschaft der Erfolg zu greifen wäre, liegen schief. Der ist nämlich weder mit der Kenntnis eines behördlichen Instanzenwegs noch mit dem bloßen Willen zur neuen Leistung garantiert. Schließlich findet das ökonomische Einsortieren der Zonenbevölkerung, ihre Benützung als Arbeiterklasse so gut wie nicht statt. Also erfahren sie auch nicht die dadurch gültigen Sachzwänge und deren erzieherische Wirkungen. Die Disziplin, die das Ausfüllen eines kapitalistischen Arbeitsplatzes erfordert, die ordentliche Lebenseinteilung zwischen Arbeiten, Saufen, Schlafen, Meckern, die ein Arbeitsleben auferlegt, das bescheidene Selbstbewußtsein als Dienstleister, das die weltanschauliche Einteilung der Welt in ein gelungenes Verhältnis von Rechten und Pflichten für oben und unten gestattet, bleibt der überwiegenden Masse „vorenthalten“.
Veranstaltet wird in der Zone also eine Revolution, die das Volk zwischen alle Stühle setzt. So produzieren die westdeutschen Eroberer einen neuen Typus von Unzufriedenheit bei den Ostbürgern: Egal, ob sie begeistert für die Wende eingetreten und total anpassungsbereit sind oder eher skeptisch – alle werden gezwungen, sich umzustellen, ohne damit ein neues Arrangement eingehen zu können. Unzufrieden gemacht werden sie schließlich auch darüber, daß der deutsche Staat mit ihnen unzufrieden ist: Pausenlos sind sie im Schußfeld, werden korrigiert, ihre Gewohnheiten, Rechte und Pflichten werden umgestürzt – und es nützt nicht einmal etwas! Den Widerspruch muß das Zonenvolk jetzt mit sich selbst ausmachen, daß die Anpassung, zu der man ständig aufgefordert wird und die man auch erbringen will, nichts bringt. Man würde ja gerne auf die Parolen hören, Initiative und Unternehmertum zeigen, bekommt aber einfach keine Gelegenheit dazu, bestenfalls die, mit einem Imbißstand in die Pleite zu rauschen. Während der Anschlußkampagne ist die Zonenbevölkerung von allen Seiten damit indoktriniert worden, daß der alte Staat ihr Fehler gewesen sei, auf die Art und Weise hätten sie es natürlich nie zu einem Lebensgenuß bringen können, der neue Staat aber, der wäre genau das Erfolgsrezept, um ein bißchen Reichtum und Urlaub am Mittelmeer zu ergattern. So hat die BRD die Brüder und Schwestern agitiert, und die wollten das aus vollem Herzen glauben – genau dieselben Leute sollen jetzt verstehen, warum das alles nicht stimmt und die Misere letztlich an ihnen selber liegt.
Die kommunistischen Wahrheiten über die Marktwirtschaft und ihre Leistungen sind nach wie vor nicht beliebt, insofern bleibt ihnen bei der Bewältigung der neuen Lage nicht viel anderes übrig als Ratlosigkeit, etliche mögen darüber auch verrückt werden, ziemlich verdrossen sind sie auf jeden Fall. Das führt zwar nicht zu einem Aufstand gegen das neue Regime, aber ein ordentliches Staatsbürgerpersonal, nach den gehobenen Maßstäben der BRD-Politik, werden sie so auch nicht.
Die Folge: Der Aufsichtsbedarf wächst
Das Bedürfnis nach staatlicher Kontrolle, Ordnung und Regelung in Sachen Eigentum und Person wächst, während andererseits die elementaren Apparaturen zur Verwaltung der beiden „Grundwerte“ nicht oder nur unzulänglich vorhanden sind.
Der Aufsichtsbedarf wächst, erstens für alle normalen Leute, denen in der großen Masse ein auf Sozialhilfe, lächerliche Renten oder ABM-Sonderlöhne gestütztes Herumlungern und Ämter-Besuchen zwangsverordnet worden ist. Da wird sich dann dem Wert Familie ganz neu gewidmet, zumal auch die alten Kinderkrippen gesundgeschrumpft worden sind, und Polizei und Sozialämter registrieren wachsende Zahlen von Schlägereien, Kindsmißhandlungen und andere Zeichen von Familienleben. Zu den neuen Genüssen, die die Inanspruchnahme des westdeutschen Gebrauchtwagenmarkts gestattet, gehört auch eine Wahrnehmung des Prinzips ‚freie Fahrt für freie Bürger‘, bei der Verkehrsregeln für so etwas wie eine verbliebene Schikane des alten Staats gehalten werden.
Neben dieser Wahrnehmung der neuen Chancen steigen auch die Zahlen in den verschiedenen Verbrechenssparten. Ob es dazu wirklich eigens die echte Mafia braucht, ob nicht frustrierte Fans des Kapitalismus auch von selbst auf die Idee kommen, anders Geld zu verdienen, wenn es legal keine Gelegenheit dazu gibt, sei dahingestellt. Auf jeden Fall geben die deutschen Sicherheitsbehörden mit ihrer zunehmenden Warnung vor einer Ansiedlung der Mafia in den 5 neuen Bundesländern durchaus auch zu Protokoll, welche Zustände die BRD sich dort geschaffen hat: Eben eine Zone ohne so etwas wie eine Wirtschaft, mit einem weitgehend unbeschäftigten und verarmten Inventar, für das die Pornobranche, Autoverschiebereien und Rauschgifthandel u.ä. zu den wenigen Gelegenheiten gehören, überhaupt zu Geld zu kommen, so daß diese Branchen der Marktwirtschaft dort als erste zu „blühen“ beginnen.
Die ehemaligen DDR-Bürger mögen sich ungerecht behandelt fühlen – der Rechtsstaat würdigt sie als das, was sie in einem kapitalistischen Staat nunmehr sind: Unbenützte, folglich unbrauchbare Volksteile, die zu Unregelmäßigkeiten neigen. In nur zwei Jahren haben die Brüder und Schwestern in der öffentlichen Würdigung die Karriere von Freiheitskämpfern für Deutschland zu Kostgängern der Nation und Nährboden für allerhand soziale Laster absolviert. Die staatliche Fürsorge widmet sich nun einer Bevölkerung in slumähnlichen Gebieten mit einer Anhäufung von sozialen Problemen als Grundlage für Verbrechen, von Skinheads bis Mafia. Die verdient folglich die dazu passende Aufsicht und Einschüchterung durch staatliche Ordnungsorgane.
Der Ausbau der Apparate braucht aber seine Zeit, kostet Geld, das gerade den neuen Länderhaushalten grundsätzlich abgeht. Da muß in einer PR-Aktion schon einmal BMW ein paar Karossen stiften, damit die Leipziger Polizei Verbrechern überhaupt hinterherfahren kann. Und gleichzeitig streichen die Länder Planstellen, um dem Anspruch eines irgendwie geordneten Haushalts überhaupt nachkommen zu können. Außerdem findet das Säubern kein rechtes Ende, die Gauck-Behörde arbeitet immer noch Aktenberge durch, Polizisten werden immer noch gerne mit Stasi tituliert, und nicht zuletzt dadurch werden die Behörden nicht so recht tauglich.
Der bundesdeutsche Staat hat es schließlich nicht nur mit gewissen Armutsinseln neben einer ehrlichen Wirtschaft zu tun. Auch die Geschäftswelt bzw. das, was unter diesem Titel dort läuft, liefert immer wieder Anlässe für den Verdacht auf Betrug, Korruption und unredliche Machenschaften von Seilschaften alter und neuer Herkunft. Die Diestel-Villa ist da ein eher harmloses Beispiel. Wenn das schiere Zustandekommen von Geschäften, jede Eigentumsüberschreibung eine politische Aktion ist, nur unter Mitwirkung von Politikern über die Bühne geht, dann sind Korruption und Bestechung unweigerlich damit verknüpft, und die Politik fungiert als nicht ganz einwandfreie Geldquelle. Wenn zudem lauter spekulative Transaktionen vorgenommen werden, Versuche, Geschäfte überhaupt erst zu eröffnen, von denen dann viele auch gar keine werden, dann kommt der Verdacht auf Betrug und unlautere Manöver erst recht auf. Das Wirken der Treuhand und der Landesregierungen wird von lauter solchen Skandalen, Affären und Prozessen begleitet. Sie müssen immer wieder aus ihren eigenen Reihen schwarze Schafe entfernen, die Grundstücke „unter ihrem Wert“ oder Geschäfte an die eigene Klientel verhökern. Als Material der Parteienkonkurrenz führt das dazu, daß auch die politische Glaubwürdigkeit häufig leidet.
Von den Schwierigkeiten bei der Kontrolle der enttäuschten Nationalisten
Eines brauchen die Politiker der deutschen Einheit wegen der sozialen Enttäuschungen, die sie den Leuten bereiten, nicht zu fürchten: kommunistische Umtriebe. Denn die Ostdeutschen sind mit der Fahne heim ins Reich geströmt und an der messen sie nun alles. Von ihrem alten Staat wollten sie nichts mehr wissen und nur noch zum mächtigen, erfolgreichen Deutschland überlaufen – und dennoch entpuppen sich die neuen Bundesdeutschen als gar nicht pflegeleicht. Enttäuscht von dem, was ihnen das große Vaterland zu bieten hat, denken diese Volksgenossen nicht an der Behandlung weiter, die ihnen zuteil wird, sondern an der Nation – und die Ergebnisse dieses schwarz-rot-goldenen Denkens fallen ziemlich aus dem westdeutschen Rahmen heraus. Enttäuschter Nationalismus ist der Maßstab, den sie an die Verhältnisse anlegen, und deshalb müssen die Zuständigen immer mehr entdecken, was die Zone für ein politischer Sumpf ist.
Auch, was das politische Leben angeht, haben die Neubürger alles geschenkt bekommen und keine einzige Partei selber machen müssen. Dennoch funktioniert die Parteienkonkurrenz drüben gar nicht so wie in der Westzone. Nicht deshalb, weil es auch noch die PDS oder Erfolge für die Republikaner gibt – vielmehr ist die Parteiendemokratie einem Volk übergestülpt worden, das diese Einrichtung gar nicht recht versteht, was sich an den Volksvertretern ebenso bemerkbar macht wie am Verhältnis des Volks zu den Parteien.
Schon das 1. Wahlergebnis war zwar erfreulich für den Kanzler, aber demokratisch dubios: Das Zonenvolk wollte sich von den Sozis kein Problem ans Herz legen lassen, sondern es hat seinerseits erdrutschartig auf die Fahnenschwenker in der Politik gesetzt, nämlich auf die am entschiedensten vorgetragene Parole, Deutschland und Erfolg wären einunddasselbe. Und schon bei der nächsten Wahl sind in Ostberlin die skandalösen 30% für die PDS angefallen. Die Zonis entpuppen sich als ein Potential von Wechsel-, Protest- und Nichtwählern; sie jubeln und verlassen die Parteien wieder, stellen keine stabile Parteibasis, kein berechenbares Stammwählerkontingent – so etwas gehört sich einfach nicht in einer Demokratie. Dieses neueroberte Volk hat tatsächlich gedacht, die Parteien seien ein Instrument, und es zieht auch noch die Konsequenz daraus, daß sie keines sind. Man hat es da mit einem Volk zu tun, das die Methodik westdeutscher Politik nicht kapiert, das Versprechungen für bare Münze nimmt und allen Ernstes die Politiker dann daran messen will. Und wenn es dann enttäuscht wird, glaubt es Politikern nicht mehr. D.h. nicht, daß es sich die Polemiken aus dem „Schwarzen Kanal“ wieder einfallen ließe oder sich sogar eigene Ansichten über Demokratie und Kapitalismus bilden wollte, aber für die Parteien gerät ein solches Volk schon zum Problem, denn alle bequemen Gepflogenheiten westdeutschen Wählens, Regierens und Koalierens entfallen.
Es stellt sich kein rechter Amts-Bonus ein, schließlich eines der gewichtigsten demokratischen Wahl-„Argumente“. Weder bei den wenigen verbliebenen Ostkräften noch bei den aus dem Westen importierten „politischen Persönlichkeiten“, deren Nimbus sich zu verschleißen droht: Bejubelt als erprobte Macher, als leibhaftige Garantieträger für den Import westdeutscher Lebensumstände stehen auch sie als Abwickler da, die nicht einmal Kernbranchen zu „retten“ vermögen und deren Regierungsarbeit darin besteht, Sparhaushalte zu verordnen, die überall an die Substanz gehen. Nicht einmal, was die Politik selbst betrifft, erfüllen die Führungspersönlichkeiten in den neuen Ländern die Kriterien glaubwürdigen, energischen Regierens: Das Gemisch aus Stasi-Intrigen und Bestechungsaffären, aus Parteiaustritten und brüchigen Koalitionen nimmt sich wie nicht-vorhandenes Regieren aus. Auch die Volksvertreter im Anschlußgebiet sind nämlich nicht zuverlässig, d.h. deren Karriereberechnungen fallen unter den Zonen-Bedingungen gar nicht partei- und regierungstreu aus.
Daneben verschafft ausgerechnet die nicht-enden-wollende Stasi-Kampagne, mit Vorwürfen und Beweisen, die jedem sonstigen IM längst den Kragen gekostet hätten, einem Stolpe eine nach dem Fall Krabbe umso fanatischere Brandenburger Volksgemeinschaft. Und es ist unübersehbar, daß das kein Amtsbonus von westlichem Zuschnitt ist, sondern eine verbiesterte Sympathiewelle, die dem Ressentiment gegen die „Besser-Wessis“ entspringt: Am Fall Stolpe können die Zonenbürger das Arrangement im und mit dem alten System wiederentdecken, so wie es sich ungefähr jeder eingerichtet hatte, was jetzt als „Stasi“-Vorwurf gegen sie verwendet wird. Am Fall Stolpe können sie die Genugtuung genießen, daß zumindest ein – prominentes – Opfer der Stasi-Hetze sich nicht kleinkriegen läßt. Und dieses Symbol für ein beleidigtes Zonenselbstbewußtsein will sich ganz Brandenburg umso weniger von den Westlern abschießen lassen, je mehr Dreck am Stecken er haben soll. Das ist ein Zuspruch zur Politik, der gänzlich auf der Verdrossenheit und Übelnehmerei der Ossi-Wessi-Konfrontation beruht.
Es wird also an die Politik geglaubt, es wird gewählt, aber es wird unberechenbar geglaubt und gewählt, d.h. das Wählen ist auch nicht die verläßliche Garantie dafür, daß die Bürger nachher die Schnauze halten und den nötigen Gehorsam beweisen. Das Zonenvolk verarbeitet seine Unzufriedenheit nicht in der demokratisch dafür vorgesehenen Weise: Weder übersetzt es sie bruchlos in Argumente für die dafür extra eingerichtete Opposition, noch läßt es sich „Schwierigkeiten der Politik“ einleuchten und regt sich wieder ab. Stattdessen gründet es neben der Parteienlandschaft „Gerechtigkeitskomitees“. Wäre diese Idee nicht auch von der PDS ausgegangen und daher zielsicher als ‚links‘ eingestuft worden, niemand könnte sich eigentlich darüber täuschen, um was für eine patriotische Angelegenheit es sich dabei handelt. Eine Unzufriedenheit, die meint, daß zu wenig regiert, daß sich die Regierung zu wenig mit der Lage ihres Volks befassen würde – das ist das argumentative Arsenal jedes gewöhnlichen Stammtischs. Aber Stammtische, die sich als politische Bewegung verstehen und gründen, um den Oberen die Volksunzufriedenheit hörbar zu machen – das ist ein in der Demokratie nicht vorgesehener Einmischungsversuch. Man hat nun ein Volk vor sich, das glatt meint, aus der eigenen schlechten Meinung über „die da oben“ hätte etwas zu folgen; ein Volk, das das Kunststück, eine Meinung zu haben und sie im übrigen für völlig unerheblich zu halten, nicht beherrscht. Und wenn auch bei den Gerechtigkeitskomitees mehr als ein organisiertes Sich-Beschweren gar nicht daraus folgt und das wiederum von der Zensur der freien demokratischen Meinungswirtschaft und den Kollegen vom Verfassungsschutz weitgehend unschädlich gemacht wird – andere Volksteile drüben machen andere patriotische Meinungen ziemlich praktisch.
Ohne daß irgendetwas, was sonst unter dem Titel „verfassungsfeindliche Umtriebe“ läuft, Kommunismus oder kommunismus-verdächtige Gedanken vorzufinden wären, hat der deutsche Staat seit neuestem Probleme mit seiner inneren Sicherheit, seinem sozialen Frieden. Der Auftakt war vor ungefähr einem Jahr in Hoyerswerda, die Straßenschlachten in Rostock bilden den vorläufigen Höhepunkt. Mit der Parole „Deutschland den Deutschen“ werden Ausländer- und Asylantenheime angezündet. Des öfteren schaut die Polizei erst einmal zu, auch die Politik kann ihr „Verständnis“ für die Probleme – nicht der Angezündeten sondern – der Anzünder nicht verhehlen. Aber daß der Beifall der Zuschauer auch nicht aufhört, wenn die Polizei angegriffen wird, daß vielmehr eine große Sympathisantenschar die Aktivisten beschützt und dabei anfeuert, wenn sie der Polizei Straßenschlachten liefern, das ist etwas Neues. Das war bisher in der BRD nicht üblich, daß Bürger klatschen, wenn Autonome Polizisten verprügeln.
Seit ungefähr einem Jahr wird wegen solcher Anlässe eine breite Debatte veranstaltet, in der vor allem die Ostbürger wie eine Ansammlung von sozialpsychologischen Fällen diskutiert werden. Die da getroffenen Diagnosen und Ratschläge sind so albern wie verkehrt; weder ist Ausländerhaß eine Spezialität der unteren Schichten, noch ist Armut ein Grund für geknickte Identität, weder leiden die Zonis daran, daß zu wenig Weizsäckers auf sie „zugehen“ noch an zu wenig Therapie von Maaz und Co. Aber diese Debatte ist andererseits sehr wohl der Ausdruck eines Problems, das die Politik mit ihren neueroberten Bürgern hat. Sie hat nämlich ein ganzes beleidigtes Volk vor sich, das droht, aus dem Ruder zu laufen. Es ist eine Sache, über die Zonis als ein „Mentalitäts-“ und psychologisches „Problem“ zu reden – die Probleme, die sich die Politik wirklich stellt, registriert der Verfassungsschutz, der im Sommer 92 eine beeindruckende Statistik über die Zunahme „rechtsextremistischer Aktivitäten“ in den neuen Bundesländern vorgelegt hat.
Steinewerfer, die nur mit der Parole „Deutschland“ antreten, Skinheads und Jugendliche, die im Namen von Schwarz-Rot-Gold die Polizei angreifen, das sind die Aktivisten einer neuen Sorte Bürger-Bewegung, die sich die BRD mit ihrer Annexion geschaffen hat: Enttäuschte und daher unberechenbare Nationalisten. Das Überläufervolk aus der Zone praktiziert einen Staatsbürgerfanatismus, wie er in der Demokratie selten anfällt, wo er sich üblicherweise von oben bremsen und kontrollieren läßt. Demokratisch geschulte Bürger wissen mit ihrer Unzufriedenheit umzugehen. Wenn sie an allem der Politik die Schuld geben, so kennen sie auch „Sachzwänge“ und „Lagen“ der Politik, die die Politik daran „hindern“, ihre guten Aufgaben zu erfüllen. Demokraten glauben auch den Parteien und deren Versprechungen gar nicht wortwörtlich und lassen sich deshalb nicht so enttäuschen. Das Zonenvolk aber läßt die handelsüblichen Entschuldigungen, die zur Demokratie gehören, nicht gelten, klagt Versprechungen ein. Es besteht auf seinem Recht auf gute Regierung über das demokratische Maß hinaus, geht nicht bloß zur Opposition oder zum Protest-Wählen über, sondern unternimmt gelegentlich auch Sachen, die demokratisch verwaltetem Unmut gar nicht zustehen.
Mit einem Restbestand realsozialistischer Unsitten hat das nichts zu tun; höchstens mit den Neigungen und Vorlieben, die unter Honecker verboten waren, und dem Irrtum über die Demokratie, sie gestehe als Befreiung vom grausamen Joch des Anti-Faschismus jetzt den modernen faschistischen Meinungen und rassistischen Auffassungen ein Recht auf Wirkung zu. Das Lob der Demokratie haben die neuen Bürger der West-Propaganda nur zu gut abgekauft, ebenso wie die täglich neu amtlich beglaubigte Diagnose, daß Deutschland unter den Ausländern leidet.
Aus der demokratischen Ausländerhetze haben in den neuen Ländern manche, noch ganz junge Bürger, denselben Schluß gezogen wie einige Retter der deutschen Sache im Westen auch. Sie nehmen ganz autonom die Verfolgung von Ausländern, die der Staat so halbherzig oder gar nicht betreibt, in die Hand. Sie vollstrecken den Schuldspruch, den sie der Litanei vom „Ausländer- und Asylantenproblem“ entnehmen, an den Adressaten der gesamtdeutschen Anklageschrift. Und geraten bei ihren Hinrichtungsterminen mit der Staatsgewalt aneinander, die ihren Rassismus zwar ebenso versteht wie die schaulustigen Bürger, aber doch nicht ganz billigen will. Gelegen kommt die Randale ausdrücklich als Beweis für den staatlichen Handlungsbedarf gegen Ausländer; als Ersatz für die Staatsgewalt und als Zerstörung der inneren Ordnung wird sie jedoch zu einer ernsten Bedrohung, die in den Griff bekommen werden muß. So hat auch diese faschistische Szene, in der es den Glücksfall zu beobachten gibt, daß Ossis und Wessis wirklich keine Schwierigkeiten in Sachen „Zusammenwachsen“ haben, ihre Tücken. Dieses Züchtungsprodukt des demokratischen Nationalismus „geht zu weit“.
[1] Zu dieser gründlichsten Ent-fizierung aller Zeiten siehe GegenStandpunkt 2-92, S.33: Die BRD und ihr Stasi-Syndrom