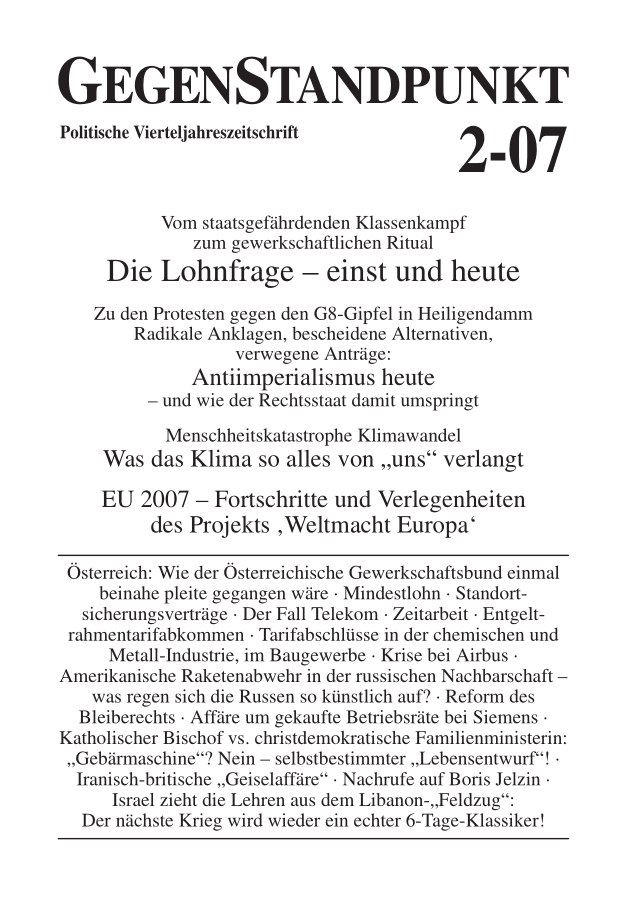Vom staatsgefährdenden Klassenkampf zum gewerkschaftlichen Ritual
Die Lohnfrage – einst und heute (I)
Im Wirtschaftswunderland BRD mit seiner sozialen Marktwirtschaft hat es den Anschein, als wäre die Lohnfrage in Bahnen gelenkt, in denen die Arbeiter, die nun Arbeitnehmer heißen, nicht mehr um ihre Existenz fürchten und kämpfen müssen. Längst sind sie keine rechtlosen Existenzen mehr, die hilflos der Willkür ihrer Fabrikherren ausgeliefert sind. Vielmehr erfreuen sie sich zahlreicher Anwälte ihres Interesses, an die sie sich jederzeit wenden können, wenn sie Grund zur Unzufriedenheit sehen oder sich ungerecht behandelt fühlen.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Siehe auch
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Gliederung
- Die Botschaft des DGB zum 1. Mai 2007: Du hast mehr verdient! – nämlich einen gesetzlich garantierten Mindestlohn von 7 Euro 50
- Eine neue Errungenschaft unserer sozialen Marktwirtschaft: Standortsicherungsverträge – Beschäftigung hat ihren Preis
- Der Fall Telekom: Beschäftigungssicherung als routinemäßige Kampfansage der Konzernleitung an ihre Belegschaft
- „Jobmotor“, „Jobwunder“ Zeitarbeit: Ein großer Schritt weiter in der Ökonomisierung des Personals
- Das Entgeltrahmentarifabkommen (ERA): Noch eine prima Gelegenheit zur Lohndrückerei – sowie für ein gewerkschaftssinnstiftendes Aktionsprogramm erster Güte
- Der Tarifabschluss in der chemischen Industrie: Ein Tarifvertrag ganz nach dem Geschmack des herrschenden ökonomischen Sachverstandes
- Kommentare zum Metall-Abschluss: Noch mehr Konjunktur-Argumente in der Lohndebatte
- Baugewerbe: Wie Gewerkschaft und Unternehmer mit einem Abschluss nach Maß den Flächentarifvertrag retten
Vom staatsgefährdenden Klassenkampf zum gewerkschaftlichen Ritual
Die Lohnfrage – einst und heute (I)
I.
Um den Lohn haben Mitglieder der Klasse, die von ihm leben muss, einmal gekämpft. Sie verweigerten – spontan und punktuell, manchenorts aber auch schon gewerkschaftlich organisiert – ihre Bereitschaft, zu den Bedingungen weiterzuarbeiten, zu denen man sie in den Fabriken gegen einen Lohn in Dienst und ihre Arbeitskraft in Anspruch nahm, weil sie dabei unter die Räder kamen. Sie rotteten sich, immer wieder, gegen die Macht des Eigentums zusammen, um den Kapitalisten, die ihnen als Leuteschinder und Ausbeuter vertraut waren und die sie auch so nannten, gewaltsam elementare Rücksichtnahmen auf ihr Interesse aufzuzwingen: Wollten die Fabrikherren weiter von ihrer Arbeitskraft Gebrauch machen, hatte dieser Gebrauch auch seine Schranken zu haben. Vom Lohn, von dem sie leben mussten, wollten sie auch leben können. Mit diesem Standpunkt führten sie – mehr oder minder entschlossen, mehr oder minder erfolgreich – einen nie erledigten Kleinkrieg um Lohn und Beschränkungen bei der Arbeitszeit; gegen Kapitalisten, die für den Lohn, den sie zahlen, mit größter Selbstverständlichkeit das Recht für sich beanspruchten, die Arbeitskraft nach ihrem Belieben lange und exzessiv zu benutzen; die bei der Lohnzahlung umgekehrt lauter Gründe für Abzüge und Zahlungsverweigerung kannten und geltend machten; für die ihre Arbeiter also offensichtlich nur das menschliche Material waren, an dessen produktiver Ausbeutung sie sich bereicherten, und dies umso besser, je rücksichtsloser sie sich auch noch über dessen unmittelbare Lebensnotwendigkeiten hinwegsetzten. Die also den Lebensunterhalt der Klasse als das behandelten, was er für sie einzig war: Abzug vom Profit, um den es ihnen ging.
Diesen Kampf um die eigene Fortexistenz hatten die Arbeiter allerdings von Anfang an nicht nur gegen die Fabrikherren zu führen. Sie bekamen es mit der Staatsgewalt zu tun und in der Weise die politische Natur des Produktionsverhältnisses zu spüren, in dem sie für die Rolle gefügiger und beliebig erpressbarer, möglichst billiger und williger Dienstkräfte einer Kapitalistenklasse vorgesehen waren, die sich ihrer zum Zwecke der Vermehrung ihres Reichtums bedient. Der Staat hat durch diejenigen, die die Lohnfrage aufgeworfen haben, unmittelbar sich herausgefordert gesehen und sich damit zu seiner Räson bekannt: nämlich dazu, dass er den Schutz der Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung, in der sich alles darum dreht, dass sich eine Klasse von Eigentümern möglichst erfolgreich an der Arbeit bereichert, die eine Klasse eigentumsloser Proletarier verrichtet, als seine oberste Aufgabe und seinen vornehmsten Zweck begreift. Den von Lohn abhängigen und um Lohn kämpfenden Arbeitern ist der Staat unmittelbar als Polizeigewalt entgegengetreten, als Obrigkeit, die im Dienst der Ausbeuter steht, Gewerkschaften verbietet und Arbeiter zu rechtlosen, diesen Ausbeutern schutzlos ausgelieferten Existenzen verurteilt.
Der Staat hat die Sache also viel prinzipieller genommen als diejenigen, die sie angezettelt und um ihr Überleben im System der Lohnarbeit gekämpft haben. Durch sein Vorgehen hat er praktisch klargestellt, dass die Lohnfrage an die Systemfrage rührt. In der Weise belehren lassen hat sich allerdings nur eine Minderheit innerhalb der Arbeiterbewegung: Kommunisten, die den Kampf um mehr Lohn und bessere Arbeitsbedingungen als den hoffnungslos widersprüchlichen und daher verkehrten Versuch kritisierten, vom kapitalistischen System der Ausbeutung dessen Vereinbarkeit mit den Lebensinteressen der Ausgebeuteten erzwingen zu wollen, und die ihrerseits die Systemfrage aufwarfen. Ihre Klassenbrüder versuchten sie für die Einsicht zu gewinnen, dass sie ohne die Abschaffung des Systems des Eigentums, das sie zu dauerhaften Opfern macht, auf keinen grünen Zweig kommen. An- bzw. durchgekommen sind sie damit bekanntlich nicht. Man hat sie von Staats wegen verfolgt und fertiggemacht. Und was ist aus der Lohnfrage geworden?
II.
Ein paar Jahrzehnte später und für ein paar Jahrzehnte – wir befinden uns im Wirtschaftswunderland BRD mit seiner sozialen Marktwirtschaft – sieht die Sache tatsächlich ganz anders aus. Es hat den Anschein, als wäre die Lohnfrage in Bahnen gelenkt, in denen die Arbeiter, die nun Arbeitnehmer heißen, nicht mehr um ihre Existenz fürchten und kämpfen müssen. Längst sind sie keine rechtlosen Existenzen mehr, die hilflos der Willkür ihrer Fabrikherren ausgeliefert sind. Vielmehr erfreuen sie sich zahlreicher Anwälte ihres Interesses, an die sie sich jederzeit wenden können, wenn sie Grund zur Unzufriedenheit sehen oder sich ungerecht behandelt fühlen.
Im Betrieb steht ihnen ein Betriebsrat zur Seite in allen Fragen, in denen sie sich von ihrem Arbeitgeber um ihre berechtigten Ansprüche betrogen oder mit übergebührlichen Arbeits- und Leistungsanforderungen konfrontiert sehen. Der verhilft ihnen nach Maßgabe einer Arbeits- und Sozialgesetzgebung, welche die Unternehmer bei ihrem geschäftlichen Umgang mit dem menschlichen Arbeitsmaterial auf gewisse, dessen Benutzbarkeit auf Dauer dienliche Rücksichtnahmen verpflichtet, und soweit es gemäß Betriebsverfassungsgesetz in seiner Macht liegt, zu ihrem Recht. Selbstverständlich steht ihnen in all diesen Fällen auch der Weg vors Arbeitsgericht offen. Sie selber brauchen für ihr jeweiliges Anliegen gar nicht mehr zu kämpfen. Darum kümmern sich höhere, mit staatlichen Kompetenzen ausgestattete Instanzen – an die sie damit freilich auch die Entscheidung darüber abtreten, was aus ihrem Anliegen wird und wie weit es Recht bekommt. Die Staatsmacht ist so in jede strittige Grundsatzfrage um Lohn und Leistung von Haus aus mit involviert und befindet darüber, wie viel Respekt nach dem Willen der Allgemeinheit den Notwendigkeiten des Lebensunterhalts von Arbeitern im Prinzip wie in Einzelfällen zu zollen ist. Sie hat sich nämlich eingeklinkt in den Klassengegensatz, der einmal zu einem Sprengsatz für die Klassengesellschaft zu entarten drohte, um diesen Gegensatz in friedliche Bahnen zu lenken. Sie hat ihn verrechtet und in dem Zuge den Proletariern ihr Interesse ein gutes Stück auch aus der Hand genommen.
Die Gewerkschaften sind längst nicht mehr verboten, sondern quasi als Körperschaften des öffentlichen Rechts mit staatlichem Sozialauftrag anerkannt. Arbeiter entrichten an sie einen Mitgliedsbeitrag, und die Leistung, die sie dafür von ihrem Verein bekommen, kann sich sehen lassen: Darum, was ihnen an Lohn zusteht und um dessen regelmäßiges Mitwachsen mit dem anderen Wachstum müssen sie sich keine Sorgen mehr machen. In Tarifrunden macht die Gewerkschaft stellvertretend für sie da alles Nötige aus, und dem Verhandlungsergebnis verleiht der Staat mit seiner Autorität auch noch Rechtsverbindlichkeit. Dieser große Fortschritt einer gesamtgesellschaftlichen Konsensfindung beim Kampf um den Lohn verdankt sich entscheidenden Lernprozessen, die auf beiden Seiten, beim bürgerlichen Klassenstaat und bei der Gewerkschaft, stattgefunden haben: Der Staat entdeckt den Nutzen von Arbeiterassoziationen, die die beim Kampf um den Lohn unvermeidlich aufgeworfenen Macht- und Erpressungsfragen ordentlich regelt, erhebt sie deswegen in den Status von gemeinnützigen Organisationen und stattet sie mit den passenden Rechten und Beschränkungen bis hin zum Streikrecht und seinen Regulativen aus, damit sie in seinem Sinne funktionieren. Die Gewerkschaften ihrerseits ziehen aus ihren Erfahrungen mit dem bürgerlichen Staat dieselbe Lehre andersherum: Wollen sie als Organe zur Vertretung des Arbeiterinteresses anerkannt und offiziell zum Kampf um den Lohn autorisiert sein, haben sie sich alle klassenkämpferischen Allüren ab- und alle rechtlichen Vorschriften anzugewöhnen, wie sie dem Interesse der von ihnen Vertretenen dienen dürfen. Im selben Maß, in dem sie das hinkriegen, dürfen sie tun, was sie sollen, und als autonomer Tarifpartner mit den Unternehmern vereinbaren, was als gesellschaftliches Lohnniveau im Land verbindlich zu gelten hat.
Die moderne Arbeitervertretung macht sich für den höheren Gesichtspunkt der gerechten Verteilung des Reichtums stark, den die Arbeiter schaffen. Sie bemüht zur Rechtfertigung dessen, was ihr dabei vorschwebt, so interessante Gesichtspunkte wie den ‚Gewinn‘, den die Arbeit ihren Ausbeutern ermöglicht hat, und die ‚gestiegene Produktivität‘, mit der sie ausgenutzt wird – um mit diesen und ähnlichen Verweisen auf den gelaufenen wie zukünftigen Geschäftserfolg des Kapitals die ‚Spielräume‘ zu benennen, die zur Umverteilung von Reichtum an die von ihr vertretene Klasse doch vorhanden wären. Gleichsam als dritte Partei zwischen den Klassen moderiert sie auf diese Art deren Gegensatz, indem sie den Lohn als Verhandlungsstoff ins Spiel bringt, über den beide Seiten, Kapital und Arbeit, einen Kompromiss zu erzielen haben und bei gutem Willen auch allemal herbeiführen können. An ihren konstruktiven Bemühungen jedenfalls – auch wenn sie bisweilen sogar mit Streik ‚Druck machen‘ muss – scheitert im Land eine einvernehmliche Lösung der Lohnfrage nicht mehr, so dass zwischen den Klassen Lohngerechtigkeit herrscht: Die eine erhält an Mitteln für ihren Lebensunterhalt immer das, was die andere mit ihrem Interesse an rentabler Ausbeutung für vereinbar hält. Der Lohn ist die Geldsumme, von der sich Arbeiter ihren Lebensunterhalt einzuteilen haben – daran aber, was sie dazu brauchen, nimmt die Ermittlung der fürs Leben Vieler entscheidenden Größe gar nicht Maß, wenn die moderne Arbeitervertretung ihren Lohnkampf treibt.
Wer wegen Arbeitslosigkeit, Krankheit oder Alter in Not gerät, landet im modernen Deutschland nicht mehr in der Gosse: Er kann zum Arbeits- und Sozialamt gehen, wo man sich im Rahmen des eingerichteten Sozialversicherungswesens um seine Anliegen kümmert. Auch da zeigt sich der bürgerliche Staat angesichts seiner langen Tradition lernfähig und zieht einen Schluss aus dem Umstand, dass die leidige ‚soziale Frage‘ für ihn allemal Ordnungsprobleme aufwirft. So unverträglich mit dem Lebensunterhalt der arbeitenden Massen soll der Kapitalismus im Nachkriegsdeutschland keinesfalls sein, dass wieder haufenweise unbrauchbare Elendsfiguren in den Hausfluren verkommen und die innere Ordnung – Weimar!
– vor die Hunde zu gehen droht. Also nimmt der Staat die Existenzsicherung seiner minderbemittelten Klasse in die Hand und sorgt für sozialen Frieden, wobei er auch aus dem – noch ziemlich präsenten – Wirken des Vorgängerstaats eine wichtige Lehre ziehen kann: Soviel unmittelbare Zwangsgewalt, wie der für nötig befand, braucht es zur erfolgreichen sozialen Befriedung einer kapitalistischen Klassengesellschaft gar nicht. Wo Faschisten in ihrer sozialen Fürsorge gleich alle Organe der Vertretung von Arbeiterinteressen zerschlugen, durch staatliche Funktionäre ersetzten und eine große ‚Arbeitsfront‘ schmiedeten, in der sich sogar Platz für die Existenzsicherung von kapitalistisch nutzlosen Volksgenossen fand – unter der Devise ‚Arbeit und Brot‘ wurden sie zum Arbeitsdienst abkommandiert –, verstaut das demokratische Gemeinwesen in Deutschland das als unabänderlich anerkannte Elend seiner Arbeiter in dem riesigen bürokratischen Apparat seines Sozialstaats. Es organisiert ein selbstverwaltetes Sozialversicherungswesen, das sich aus zwangsweise einbehaltenen Teilen des von der Klasse insgesamt verdienten Lohns finanziert und mit diesen Finanzen die notorisch Minderbemittelten durch die unausbleiblichen Wechselfälle ihres proletarischen Lebens manövriert. Derart sinnig gestreckt, gibt der Lohn der arbeitenden Klasse zwar auch keinen zufriedenstellenden Lebensunterhalt ihrer Mitglieder her, ihnen allen zusammen aber sichert er insgesamt schon die Subsistenz, so dass die Klasse in ihrer Armut überleben und auch noch für nachwachsende Generationen nützlicher Armer sorgen kann.
Die Elendsgestalten des Proletariats haben daher überhaupt keinen Grund mehr, sich irgendwie ‚entrechtet‘ oder sonst wie aus ihrem Gemeinwesen ausgegrenzt vorzukommen. Die Mitglieder der Klasse verfügen allesamt über Ansprüche, in bestimmten Not- und Bedarfsfällen von den Sozialkassen versorgt zu werden, und dürfen dabei – was deren Dimensionierung betrifft – auch noch von einem besonderen historischen Glücksfall zehren: Ihr Staat baut sich gerade als Speerspitze im Kampf gegen den kommunistischen Osten auf, legt daher ausgesprochen Wert auf den Beweis, dass sich für Arbeiter ein Mitmachen im freiheitlich-demokratisch verfassten System des Kommandos über ihre produktiven Dienste weit mehr auszahlt als ein Leben im ‚realen Sozialismus‘. Daher hat beides zu sein, ein KPD-Verbot auf der einen und eine ausgesprochen ‚soziale Marktwirtschaft‘ auf der anderen Seite, in der Arme sogar mit Lohnersatzleistungen über die Runden kommen können sollen.
Die Regierung tritt ihrer Arbeiterklasse gegenüber längst nicht mehr obrigkeitsstaatlich auf. Sie ist demokratisch gewählt, auch vom arbeitenden Teil ihres Volkes, das selbstverständlich ein Wahlrecht hat. Der Staat schätzt den Nutzen des Prinzips, sich beim ganzen Volk über die periodisch abgerufene Entscheidung, von wem es regiert werden will, dauerhafter politischer Loyalität wie bereitwilliger Hinnahme der kapitalistischen Geschäftsordnung zu versichern. Gerade bei der Klasse, auf deren produktive Dienste er scharf ist, bei der das Dienen aber naturgemäß mit einigen Härten verbunden ist, kommt der Vorteil dieses demokratischen Verfahrens der Ermächtigung besonders zum Tragen: Auch bei Leuten, die in Anbetracht ihrer praktischen Lebenserfahrungen notorisch Unzufriedenheiten mit der politischen Regulierung ihrer Bedürfnisse akkumulieren, bleibt es beim ehernen Grundsatz, wonach über die gesellschaftlichen – also auch über ihre eigenen – Lebensverhältnisse herrschaftlich und nach staatlicher Räson verfügt wird; und derselbe Grundsatz weist der unvermeidlichen proletarischen Dauerunzufriedenheit mit diesen Lebensverhältnissen einen denkbar konstruktiven Ausweg: die Wahl einer besseren Regierung, und darauf haben auch Arbeiter ihr gutes Recht!
Das genießen sie dann in vollen Zügen. Wo Macht grundsätzlich nur im Namen des Volkes ausgeübt wird, wollen die Herrschenden eben nicht nur ihre hohe moralische Verpflichtung kundtun, einzig und allein den in der Gesellschaft sich tummelnden Interessen zu Diensten zu sein. Sie stellen sich auch dem Resultat ihrer anheimelnden Werbung für sich und ihre Regierungskunst, riskieren es glatt, von der Macht auch wieder abgewählt zu werden, und damit ihnen das möglichst nicht passiert, sprechen die konkurrierenden Wahlvereine ihre Wähler entsprechend an: Auch Arbeiter, die ‚sozial Schwachen‘, sollen sich durch die Politik von Parteien, die hauptberuflich Volksparteien sind, in ihren speziellen Interessen bedient sehen. Sie sollen sich ihre notorischen Unzufriedenheiten mit ihrer Lebenslage als Versäumnisse zurechtlegen, die höheren Orts begangen werden – und mit ihrer Wahlstimme dafür sorgen, dass der Staat besser geführt wird. So ist die ‚soziale Frage‘ erfolgreich politisiert, weil komplett in einen Auftrag an ‚gutes Regieren‘ des Gemeinwesens und seiner unverrückbaren politischen Agenda übersetzt, und daher bei denen bestens aufgehoben, die ums Mandat für die Wahrnehmung dieses Auftrags kämpfen.
Wer seine Regierung nachhaltig für unsozial hält, obwohl die christliche Regierungspartei ein ‚S‘ für Soziales im Namen bzw. einen ‚Arbeitnehmerflügel‘ in den eigenen Reihen hat, kann die Opposition wählen und seine Unzufriedenheit dort abladen: Da steht eine sozialdemokratische Partei mit dem Versprechen in den Startlöchern, die Regierungsgeschäfte mit besonderer Rücksicht auf den ‚sozialen Aspekt‘ zu erledigen. Zwar hat diese Partei seit ihrer parlamentarischen Karriere mit dem Verdacht zu kämpfen, wegen ihrer Herkunft aus der Arbeiterbewegung und sonst wo her aus dem ‚linken Lager‘ stehe sie dem Kapitalismus distanziert bis ablehnend gegenüber – einigen ihrer Spitzenleute wird ihr Leben lang vorgehalten, Moskaus ‚5. Kolonne‘ in Bonn zu sein. Aber spätestens mit den ersten praktischen Beweisen, dass sie nicht nur eine ‚starke Opposition‘ ist, sondern auch in jeder Hinsicht ‚regierungsfähig‘, erledigt sich der Verdacht und hat die Arbeiterklasse mit der SPD einen Wahlverein im Dauerangebot, der beides zugleich kann: das kapitalistische Allgemeinwohl nach allen systembedingten Notwendigkeiten zu regieren – und daneben gnadenlos den Schein aufrechtzuerhalten, es ginge der Partei dabei im Grunde nur um eines, nämlich um das ‚Wohl der sozial Schwachen‘. Dieser Wahlverein kultiviert geradezu den ‚Stallgeruch‘, der einzige Hort aller Armen und sich entrechtet Fühlenden zu sein, präsentiert sich als der geborene Anwalt, Lohnabhängigen zu ihrem ‚guten Recht‘ zu verhelfen – und stellt an den Schalthebeln der Macht dann praktisch unter Beweis, dass dieses Recht am besten mit dem Erfolg der Nation bedient ist, den sie besser herbeizuregieren versteht als ihre Konkurrenz. So gewöhnt sich die Arbeiterklasse erfolgreich daran, ihr eigenes Fortkommen mit dem des nationalen Zwangsverbandes zu identifizieren, in dem sie ihre Dienste tut, kann daher umgekehrt dessen Erfolge dem eigenen Konto gutschreiben und sich im Gleichschritt mit denen bestens bedient sehen.
Und noch einen potenten Anwalt hat der moderne Arbeitsmann an seiner Seite: Die freien Medien kommen auch in Bezug auf seine Belange ihrer demokratischen Kontrollfunktion nach und machen jede Ungerechtigkeit zum öffentlichen Skandal. Sei es, dass sie einen für die Gestaltung des betrieblichen Alltags der Ausbeutung Verantwortlichen bei etwas Unerlaubtem erwischen, sei es, dass sie den politischen Dienern an der sozialen Gerechtigkeit Pflichtversäumnisse vorwerfen: Überall sind sie zur Stelle und prangern an, dass irgendwer ‚da oben‘ zuwenig Respekt vor den Nöten des redlichen kleinen Mannes zeigt. Für die haben sie nicht nur ein offenes Ohr. Sie wissen auch immer, welche Stellung sich ihnen gegenüber einzunehmen gehört, und leiten ihr Publikum beim Durchwursteln durch den Alltag der Klassengesellschaft mit der rechten geistigen Orientierung an. Auch noch geistig wird Arbeitern ihr Interesse aus der Hand genommen – mit Artikeln und Kommentaren zur Meinungsbildung über die Lebensbedingungen im Klassenstaat, die lauter Unterrichtseinheiten für die Einsicht in deren Unabänderlichkeit, also auch in die praktische Folgenlosigkeit des eigenen Gemurres über sie sind. Gute Dienste tun da Schulungen in der praxisbezogenen Anwendung der Technik des Vergleichs. Schon wahr: Ein Honigschlecken mag das Leben des gewöhnlichen Arbeitsmannes ja nicht sein; aber verglichen mit Lebensumständen, mit denen er es früher mal zu tun hatte, muss er schon auch zugeben, dass er in seiner demokratischen und sozialen deutschen Heimat im Grunde so schlecht nicht aufgehoben ist: sozial gesichert, am Wachstum beteiligt und mit seiner Mitgliedschaft in einer Wohlstandsgesellschaft fast schon unanständig gut bedient
*
So ist der moderne Arbeiter perfekt einsortiert im kapitalistischen Gemeinwesen. Nirgendwo ist für ihn ein Grund in Sicht, sich für sein Interesse gegen jemanden aufstellen zu müssen, weil er von Anwälten förmlich umzingelt wird, die für ihn tätig sind und seine Anliegen betreuen; sogar seine Ausbeuter sind dazu da, ihm zu dienen, und heißen Arbeitgeber. Kein Zweifel: Der Staat hat den Sprengsatz, den er sich mit seiner Arbeiterklasse eingerichtet hat, erfolgreich entschärft, die Klasse hat sich das Kämpfen abgewöhnen lassen.
III.
Heute – wir sind im Zeitalter einer ‚Globalisierung‘ – sieht die Sache wieder ganz anders aus. Die Lohnfrage ist so aktuell, dass kein Tag vergeht, an dem nicht nach passenden Antworten auf sie gesucht wird. Aktuell ist sie nicht als Kampf der Arbeiterklasse um die Sicherung ihres Lebensmittels, sondern als Reformeifer der Kapitalisten, die um die Perfektionierung ihrer Ausbeutungsbedingungen ringen. Für den Dienst, den sie ihren Arbeitskräften angedeihen lassen – sie beschäftigen sie –, verlangen sie mehr Arbeit für weniger Lohn und freie Verfügung über die Arbeitskraft je nach Betriebsbedarf und unabhängig vom Lebensbedarf der Lohnabhängigen. Von der Gewerkschaft fordern sie die Unterschrift unter die Arbeitszeitregelungen und Lohnkürzungen, die sie ihr diktieren – mit der Drohung, ihren Tarifpartner andernfalls gleich ganz aus dem Verhandlungs- und Konsensstiftungswesen auszumischen. Einschlägige Betriebsvereinbarungen, zu denen sie ihre Belegschaften erpresst haben, zeigen, wie weit sie damit schon gekommen sind.
Der politische Hüter des kapitalistischen Gemeinwohls steht dem Kampf seiner Unternehmer bei. Die ‚sozialen Errungenschaften‘, mit denen eine BRD die abgrundtiefe Verträglichkeit des kapitalistischen Ausbeutungswesens mit dem Lebensunterhalt der Massen unter Beweis stellte, werden heute als ein einziger Missstand gegeißelt: Ausgerechnet der rapide Zuwachs an Sozialfällen beweist die Unhaltbarkeit der bisherigen „Leistungen“. Der Ächtung folgt die Tat, und Zug um Zug wird als ‚untragbare Belastung‘ abgewickelt, woran sich Arbeiter ein halbes Jahrhundert lang als einigermaßen gesicherte Grundlagen ihrer Existenz haben gewöhnen dürfen. In den rechtlosen Zustand, in dem sie einst waren, zurückversetzt werden sie dabei keinesfalls. Der Sozialstaat behält sie fest im Griff – und bringt einfach alle sozialrechtlichen Instrumentarien, die einmal zur Befriedung der Klasse gut waren und getaugt haben, als Hebel zur Beschneidung ihres Lebensunterhalts in Anschlag. Der Friede, den die Klasse gibt, ist dabei unterstellt und wird eingefordert.
Das Ganze wird von einer öffentlichen Gesinnungspflege begleitet, die gleichfalls kämpft: gegen den Irrglauben, ein Lohn, den man fürs Arbeiten erhält, hätte für den Lebensunterhalt zu reichen – und für die Einsicht, dass es sich ab sofort genau umgekehrt zu verhalten hat: Überhaupt gegen ein geregeltes Entgelt an einem ‚Arbeitsplatz‘ antreten zu können – ist für Lohnabhängige eine Gnade, überhaupt benutzt und erfolgreich ausgebeutet zu werden, ist der erste Nutzen, den sie sich für sich ausrechnen dürfen. Weitergehende Ansprüche haben sie nicht zu stellen, schon gleich steht ihnen nicht zu, gegen irgendetwas Widerstand zu leisten, womit sie drangsaliert werden. Wenn Staat und Kapitalisten ihnen vorbuchstabieren, wie und wo an dem Mittel ihres Lebensunterhalts zu sparen ist, wird ihnen nur dieselbe Alternative geboten, mit der ihresgleichen einst ins Elend gezwungen wurden: Einen zu finden, der sie ausbeutet, zu welchem Preis auch immer.
*
Die Unvereinbarkeit von kapitalistischem Wachstumserfolg mit dem Lebensunterhalt seiner Produzenten, wegen der Arbeiter sich einmal aufgestellt haben, ist heute offiziell erklärtes und praktisch wahrgemachtes Programm. Und was macht die malträtierte Klasse? Kommt sie aus gutem Grund auf die gar nicht überholte Praxis des Lohnkampfes zurück? Nein. Sie bleibt dabei, ihr Interesse von anderen vertreten zu lassen, die wissen, was geht – und sieht zu, was aus ihr wird.
Die Botschaft des DGB zum 1. Mai 2007: Du hast mehr verdient!
– nämlich einen gesetzlich garantierten Mindestlohn von 7 Euro 50
Mitten in die Aufschwungsmeldungen und laufenden Tarifverhandlungen platzt der DGB mit seinem Aufruf zum 1. Mai 2007. Die Wirtschaft boomt, der Arbeitsmarkt kommt endlich in Bewegung. Die Arbeitnehmer haben diesen Aufschwung hart erarbeitet – und wollen endlich ihren verdienten Anteil. ... Wir wollen deutlich und nachhaltig am Aufschwung teilhaben.
(alle Zitate aus dem DGB-Aufruf zum 1.Mai 2007 und der Rede des DGB-Vorsitzenden Michael Sommer) Wann, wenn nicht jetzt, müssen sich die DGB-Funktionäre gedacht haben, ist nach all den mageren Jahren die Gelegenheit, mal wieder für eine ordentliche Besserstellung aller sozial Schwachen in dieser Republik zu demonstrieren:
„Du hast mehr verdient!
Mehr Respekt. Soziale Sicherheit. Gute Arbeit.“
Eine entschlossene Drohung an die Reichen und Mächtigen dieses Landes, die Demonstration einer irgendwie ernst gemeinten Kampfbereitschaft für die zahllosen Opfer von Krise und Aufschwung in Deutschland – das war vom DGB ja nicht direkt zu erwarten, auch wenn es Gründe dafür, möchte man meinen, heutzutage doch eigentlich mehr denn je gäbe: Massenarbeitslosigkeit, Privatisierung sozialer Sicherung, ... Millionen arbeiten in diesem Land für Hungerlöhne. Sie haben etwas gelernt, sie arbeiten hart und sie können sich und ihre Familien doch von ihrem Lohn nicht über Wasser halten. Rentenkürzungen, Schutzlosigkeit und unerträgliche Arbeitsbedingungen, usw. usf.
Und jetzt? Das ist und bleibt ein Skandal. Jeder Tag, der ins Land geht, ohne dass etwas dagegen getan wird, ist einer zu viel.
Ach, und das sagt ein DGB-Vorsitzender lautstark in die Mikrophone, ohne auch nur einen Moment lang rot bzw. von seinen werten Zuhörern ausgepfiffen zu werden: An keiner Stelle und kein einziges Mal auch nur im Ansatz probieren, die immerhin noch vorhandene Organisationsmacht seines Dachverbandes einzusetzen, um die Zumutungen der Gegenseite abzuwehren; noch nicht mal auf den Gedanken kommen, mit den versammelten 5 – 7 Millionen Mitgliedern den sozialen Frieden in dieser Republik mal ein bisschen zu stören; jahrelang mit seinen Einzelgewerkschaften nicht bloß tatenlos zuschauen, wie millionenfach Stundenlöhne von 2 bis 4 Euro durchgesetzt werden (von wegen „sittenwidrige“ Löhne!), sondern zigfach an deren tarifvertraglicher Verallgemeinerung mitwirken – und dann den verelendeten Kolleginnen und Kollegen
zurufen, dass sie eigentlich mehr als ihre tatsächlich Hungerlöhne verdient hätten: Du hast mehr verdient!
Semantisch hat sich der DGB mit diesem Motto ja schon mal schwer ins Zeug gelegt. Da steigt natürlich die Spannung ins Unermessliche, wie er sein wichtigstes Ziel
im Kampf um soziale Gerechtigkeit, die Abschaffung von Armutslöhnen
, so durchsetzen will: Das Problem ist bekannt. Wir haben die Lösung benannt. Solange Land auf Land ab Arbeitgeber ihre Beschäftigten mit Hungerlöhnen ausbeuten, so lange...
– Ja, wer, bitte schön, ist dann gefordert? – solange bleibt der Staat gefordert, zu handeln. Was wir in diesem Land brauchen, sind nicht selbst ernannte Arbeiterführer, sondern sozial gerecht handelnde Politiker.
Agenda 2010, Hartz IV, usw.: War da nicht was? Was ist denn mit all den Arbeits- und Sozialgesetzen, die deutsche Politiker aus allen regierenden Parteien inkl. der SPD seit Jahren durchsetzen, um Löhne und Sozialleistungen massiv und in breiter Front abzusenken? Reicht es nicht, dass ein fester Schulterschluss zwischen Regierung und Unternehmern praktiziert wird, damit in Deutschland Arbeit so billig wird, dass das oben geschilderte Massenelend zur Gewohnheit in diesem Land wird? Fünf Minuten vorher hat Sommer ja selbst noch die regierende Große Koalition der Arroganz der Macht
geziehen – und jetzt wendet er sich fordernd und vertrauensvoll an haargenau dieselben Politiker, damit die – ausgerechnet! – durchsetzen, was den von seinem DGB vertretenen Arbeitern zusteht. Bei den Politikern ist er andererseits schon genau an der richtigen Adresse, weil das, was er für seine Klientel fordert, ja nichts anderes ist, als das, was die sozial handelnden Politiker auf die Tagesordnung gesetzt haben: Es soll eine Untergrenze beim Lohnsenken geben.
Aber so ticken moderne deutsche Arbeitervertreter nun einmal: Ums Verrecken wollen sie der demokratischen Staatsmacht keinen Gegensatz aufmachen, auch wenn diese wirklich keinen Zweifel am Klassencharakter ihrer Politik aufkommen lässt; unbeirrbar und durch keine Erfahrung belehrbar wollen sie den Mächtigen im Lande durch ganz viel konstruktiven und verantwortlichen Geist nahebringen, dass das Interesse der Arbeitgeber und das Interesse an einem auskömmlichen Lohn doch irgendwie zusammengehen können müssten, und passen darüber ihre Forderungen Zug um Zug den Bedürfnissen der herrschenden Klasse an, damit sie ja nicht unangenehm auffallen. Dementsprechend sieht der Vorschlag des DGB auch aus: Wieviel haben denn die Millionen Ausgebeuteten
seiner Meinung nach mehr verdient
, damit sie ein Leben in Würde
führen können? Halt ungefähr genau so viel wie der Vorschlag vom sozialdemokratischen Arbeitsminister Münte vorsieht, wenn der in die Koalitionsverhandlungen um einen Mindestlohn geht. Mehr als das, was ‚politisch machbar‘ ist, will auch der DGB-Vorsitzende nicht verlangen; auch wenn es das Schäbigste vom Schäbigen ist: Niemand in diesem Land soll für weniger als 7,50 € in der Stunde arbeiten.
Siebenfuffzig die Stunde, 1200 brutto im Monat, das muss, gewerkschaftlich gut ausgerechnet, zum Leben reichen
. Da fangen der Respekt
und die gute Arbeit
an, und da hören skandalöse Ausbeutung und Armut
auf. Bevor nämlich ein deutscher Arbeiterführer bei der Forderung nach einem Mindesteinkommen auch nur eine Sekunde lang an die Bedürfnisse der arbeitenden Menschheit denkt, sorgt er sich längst um weit wichtigere gesellschaftliche Güter und kümmert sich um die Verträglichkeit eines solchen Mindestlohns mit den Interessen von Staat und Kapital: Dieser Mindestlohn zerstört keine Arbeit, sondern ist ein gutes Instrument zur Bekämpfung von Schwarzarbeit. In zwanzig europäischen Ländern gibt es einen gesetzlichen Mindestlohn. Selbst in den USA wird er gerade drastisch erhöht.
So als müsste er mit seiner Forderung glaubwürdig seine Regierungsverantwortung unter Beweis stellen!
Und wenn das alles immer noch nichts nützt, dann wird der DGB aber ganz böse und droht damit, das zu einem zentralen Wahlkampfthema bei der nächsten Bundestagswahl
zu machen. Da werden Merkel und Münte aber zittern!
Eine neue Errungenschaft unserer sozialen Marktwirtschaft: Standortsicherungsverträge – Beschäftigung hat ihren Preis
Es vergeht keine Woche, in der nicht das Management eines Großunternehmens mit der Ankündigung an die Öffentlichkeit tritt, dass im Zuge der Sanierung oder Umstrukturierung des Unternehmens massive Lohnsenkungen bei gleichzeitig drastisch ausgeweiteter Arbeitszeit fällig sind. Meldungen wie die folgenden machen die Runde:
„Jahreseinkommen um ca. 14 % abgesenkt“; „Anhebung der Wochenarbeitszeit von 35 auf 40 Stunden“; (Gieseke & Devrient sowie SiemensFujitsuComputer und INA Schaeffler), „Arbeitszeitverlängerung und Umwandlung“ von Lohnteilen „in eine ergebnisbezogene Erfolgsbeteiligung“ (Siemens), „Nullrunden“ bei VW, „Einbußen beim Entgelt“ (Linde), „Arbeitszeitverlängerung wöchentlich um 1 Stunde“ (Bahn und Bau) usw.
Die Unternehmen pflegen ihre so gearteten Vorstöße schlicht und ergreifend damit zu begründen, dass zur Erlangung eines befriedigenden Betriebsergebnisses die Personalkosten drastisch sinken müssen:
„Die Arbeitskosten müssen um 30 Prozent sinken“ (VW) bzw. „Einschnitte beim Personal sollen etwa 20 Mio. Euro bringen“ (FSC) oder gar „100 Millionen“ (SBS).
Wobei die betriebliche Lage, auf die in dem Zusammenhang gerne verwiesen wird und die dergleichen Einschnitte erforderlich machen soll, ganz unterschiedlich sein kann. Das reicht von „Problem-„ oder Schieflage
, in die ein Unternehmen geraten ist, über notwendige Reaktion auf Preiskämpfe
oder auf negative Effekte aus Materialpreiserhöhungen und dem starken Euro
bis hin zu Umstrukturierung
, wie sie bei einem im globalen Wettbewerb
stehenden Unternehmen zwecks Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit, der Innovationsfähigkeit und der Investitionsbedingungen
immer wieder mal fällig ist.
Ferner pflegt das Management in solchen Fällen Belegschaft und Öffentlichkeit damit zu konfrontieren, dass das von ihm vertretene Unternehmen Alternativen zur Erreichung seiner Ziele hat. Man informiert darüber, dass man gerade dabei ist, den Aufbau eines großen Osteuropa-Werks zu prüfen
. (Linde)
„In den vergangenen Monaten war spekuliert worden, Siemens könnte SBS an einen Konkurrenten abgeben“.“Der Konzern verfügt in Tschechien über Fabriken, in denen die Arbeitskosten nur halb so hoch sind wie in Deutschland“ (Continental). „MAN Roland prüft die Produktion von Teilen für die Druckmaschinen in Polen.“
Die wirkliche oder – wer kann das schon unterscheiden – berechnend ins Spiel gebrachte Alternative kann eine Standortverlegung, eine Standortschließung, der Verkauf eines Betriebs bzw. von Teilen desselben an einen Konkurrenten oder die Auslagerung von Abteilungen sein; ein wichtiges Argument, das in dem Zusammenhang in Anschlag gebracht wird, ist der internationale Vergleich der Arbeitslöhne, den die Unternehmen ja nicht nur theoretisch anstellen, sondern praktizieren. Verbunden ist die jeweilige Alternative, wie auch immer die im Einzelnen ausschauen mag, jedenfalls mit Entlassungen in ganz großem Stil: Tausende, wenn nicht Zehntausende von Arbeitsplätzen sind üblicherweise gefährdet.
Das alles wird schließlich in die Form eines Angebots gebracht: Der eigenen Belegschaft, der man – nach dem Motto: Wir können auch anders! – die denkbar beschissenste Perspektive vor Augen gestellt hat, eröffnet man das Angebot einer wie auch immer bedingten und zeitlich beschränkten Beschäftigungsgarantie, wenn sie im Gegenzug dazu bereit ist, die für fällig erachteten Lohnkürzungen und Arbeitszeitentgrenzungen zu akzeptieren. Unter dieser Bedingung wird dann abgeschlossen und stolz vermeldet:
„Standortsicherung bis 2012“ bei DaimlerChrysler (SZ; 23.7.04); „Arbeitsplatzgarantie bis 2011“ bei VW (SZ; 13.11.04); „Deutsche Bahn verzichtet auf betriebsbedingte Kündigungen bis 2010“ (SZ; 2.3.05); „Arbeitsplatzsicherung durch Lohnverzicht“ bei Heideldruck (SZ; 26.4.05); „Beschäftigungspakt bei MTU bis 2011“ (SZ; 25.6.05); „Linde verzichtet auf Verlagerung nach Osteuropa“ (SZ; 30.7.05); „SBS sichert Arbeitsplätze nachhaltig“ (SBS-Nachrichten der IG Metall, 09/2006); „Keine Werksschließungen“ bei Fujitsu Siemens (SZ; 15.11.06); Notendruckerei Gieseke & Devrient will „Arbeitsplätze erhalten und ausbauen“ (SZ; 6.2.07); Telekom „bietet Beschäftigungsgarantie“ (WiWo, 23.2.07); bei MAN-Roland gibt es „Mehrarbeit statt Job-Verlagerung“ und damit eine „Standortgarantie.“ (SZ; 21.3.07)
So kommt eine neue Errungenschaft in unsere soziale Marktwirtschaft und zu öffentlichem Ansehen: Standortsicherungsverträge.
***
Was sind das für Deals? Der Form nach ist ein Standortsicherungsvertrag ein Vertrag: Es gibt ein do ut des, Leistung und Gegenleistung. Aber was für vertraglich wechselseitig zugesicherte Leistungen stehen da eigentlich gegeneinander? Die Arbeitgeberseite verspricht der Belegschaft, sie weiterzubeschäftigen. Sie garantiert das für einen bestimmten Zeitraum, oft auch nur für einen Teil ihrer Belegschaft; Entlassungen sind bei diesem Deal ja keineswegs ausgeschlossen; sie sind in der Regel vielmehr fester Bestandteil eines solchen Gesamtabkommens. Dafür hat die andere Seite einen Preis zu zahlen, eben Lohnabschläge und Mehrarbeit zu akzeptieren. Dem Gehalt nach steht in diesen merkwürdigen Verträgen auf beiden Seiten das Interesse des Arbeitgebers: Leute zu beschäftigen, ist doch sein Mittel; er lässt sie für sich arbeiten, benutzt ihre Arbeitskraft für seinen Zweck einer gewinnbringenden Produktion. Man denkt – und so ist es ja auch! –, die Arbeit ist deren Leistung, für die der Unternehmer ihnen einen Lohn zu zahlen hat. Und für nichts anderes als dafür – sie nach seinen Maßgaben benutzen zu können – zahlt er ihnen ja auch tatsächlich ihren Lohn. In einem Standortsicherungsvertrag steht das alles aber denkbar verrückt auf dem Kopf: Dass man sie für den Gewinn des Unternehmens arbeiten lässt, kommt als Dienst des Unternehmens an ihnen daher, für den sie eine Gegenleistung erbringen müssen. Und die besteht darin, dass sie, was Lohn und Arbeitszeit anbelangt, Bedingungen akzeptieren, zu denen sie das Unternehmen noch mehr und effektiver für seinen Zweck einspannen kann. Aus der Perspektive der Beschäftigten ist so ein Standortsicherungsvertrag eine einzige Perversion: Sie sollen verzichten auf das, wofür sie sich beschäftigen lassen, damit sie beschäftigt werden.
***
Dass Gewerkschaften bzw. deren Vertreter in den Betrieben über eine so geartete Materie mit der Gegenseite überhaupt in Verhandlungen treten und glatt auch noch entsprechende „Verträge“ unterschreiben, ist nicht ganz normal. Noch nicht einmal im Kapitalismus. Bevor sich die deutschen Gewerkschaften zu solch fortgeschrittenen Formen gewerkschaftlicher Arbeit hinbewegt haben, waren erst einmal die Unternehmer im Lande tätig und am Zug. Mit der Drohung von Standortschließungen und Enlassungen sind sie auf breiter Front dazu übergegangen, an der Gewerkschaft vorbei unter Nichtbeachtung sämtlicher tarifvertraglich vereinbarter Bestimmungen in ihren Betrieben die Löhne und Arbeitszeiten durchzusetzen, mit denen sie ihr Geschäft auf Vordermann bringen, seine Rentabilität steigern und die Konkurrenzlage ihres Betriebes verbessern können. Pionierarbeit haben sie in der Hinsicht im Osten der Republik geleistet, wo das industrielle und agrarische Inventar der vormals sozialistischen Wirtschaft zur Abwicklung anstand und Betriebe massenhaft vor der Schließung und deren Belegschaften damit vor der Entlassung standen. Aber auch sonst in der Republik haben die Unternehmer zu der Zeit nicht geschlafen. Durch Austritt aus den Unternehmerverbänden haben sie sich den ihnen aus Tarifverträgen erwachsenden Verpflichtungen entzogen und sich einfach die Freiheit herausgenommen, auf betrieblicher Ebene Löhne weit unter Tarif und Arbeitszeiten jenseits aller tarifvertraglich vereinbarten Grenzen zu vereinbaren. Und nachdem sie auf diese Weise Fakten gesetzt hatten, sind sie in Gestalt ihrer Verbände – dafür waren die dann wieder gut! – den Gewerkschaften offensiv mit der Forderung entgegengetreten, sie möchten das, was doch längst unternehmerische Praxis und „gesellschaftliche Wirklichkeit“ ist, förmlich genehmigen. Sie plädierten für eine „zeitgemäße“ Interpretation des sogenannten „Günstigkeitsprinzips“, demzufolge von tarifvertraglich vereinbarten Bestimmungen nur zugunsten der Arbeitnehmerseite abgewichen werden darf: nämlich in dem neuen Sinne, dass es angesichts von fünf Millionen Arbeitslosen für von Entlassungen bedrohte Belegschaften doch als ein Vorteil angesehen werden muss, wenn sie zwar weniger Lohn kriegen und länger arbeiten müssen als tarifvertraglich vereinbart, dafür aber ihren Arbeitsplatz behalten dürfen. Nahegebracht hat man diesen Antrag der Gewerkschaft mit dem Argument, dass sich ansonsten bloß die Praxis der Tarifflucht vermehrt durchsetzen werde.
Bei all dem haben die Unternehmer Lage und Standpunkt ihres Gegenübers in jeder Hinsicht schamlos ausgenutzt. Wo sie es, wie vor allem im Osten der Republik, mit Belegschaften zu tun hatten, die – zum Teil noch nicht einmal gewerkschaftlich organisiert – mit dem Rücken an der Wand stehen, konnten sie denen einfach die ihnen genehmen sehr viel schlechteren Bedingungen, zu denen sie sie weiterbeschäftigen, diktieren. In Betrieben, in denen es wenigstens einen Betriebsrat gibt, fiel es ihnen in der Regel nicht schwer, diesen von der Notwendigkeit einer entsprechenden „Betriebsvereinbarung“ zu überzeugen. Den Gewerkschaftsvertretern vor Ort, denen die Rettung der Arbeitsplätze stets oberstes Anliegen war, war die Bereitschaft, dafür sämtliche von Seiten des Unternehmens geforderten schmerzlichen Einschnitte zu unterschreiben, leicht abzuhandeln. An ihnen lässt sich das erste Mal eindrucksvoll studieren, dass eine Arbeiterinteressenvertretung, die sich dem Kampf um Arbeitsplätze verschreibt, rettungslos verloren ist. Sie kommt in jeder Hinsicht zu spät. Sie hat nichts mehr zu fordern, will nur mehr eines: zu welchen Bedingungen auch immer das Dienstverhältnis, in dem ihre Klientel steht, aufrechterhalten – weil die ohne Arbeitsplatz ja auf jeden Fall noch schlechter dasteht. Und sie liefert sich mit diesem Standpunkt, mitsamt ihrer Klientel, der Erpressungsmacht der Unternehmer aus und macht sich am Ende nur noch zum Instrument der – möglichst moderaten, versteht sich – Durchsetzung all dessen, was die Unternehmensführung für fällig erachtet und auf die Tagesordnung setzt. Eine Zeitlang sind solche Betriebsvereinbarungen, mit denen die Tarifverträge reihenweise unterlaufen wurden, von der zuständigen Gewerkschaftszentrale offiziell noch als Verstoß gegen einzuhaltende Tarifverträge beklagt worden, den es zu verhindern gilt oder der wenigstens nicht zur Regel werden darf. Mit der Duldung solcher Vereinbarungen haben die Gewerkschaften jedoch bereits eingestanden, dass dieser Standpunkt unhaltbar ist – nicht weil sich die Einhaltung von Tarifverträgen nicht durchsetzen ließe, sondern weil sie sich selber dem Kampf um Arbeitsplätze verschrieben haben, in dem ihre Vertreter in den Betrieben unterwegs waren, und sich – so ist das eben, wenn man ‚Arbeitsplätze‘ fordert – dem Argument der Kapitalisten nicht verschließen konnten, dass ohne ausreichende Konkurrenzerfolge der Betriebe Arbeitsplätze nicht zu ‚erhalten‘ sind, diese Erfolge aber ohne ordentliche Kostensenkungen bei den Lohnkosten nicht zu erzielen sind. Und so zeigt sich ein zweites Mal und diesmal in ganz allgemeiner Form, dass eine Gewerkschaft, deren oberste Anliegen Arbeitsplätze und deren Erhaltung sind, die also unerbittlich daran festhält, dass ihre Mannschaft Lohnarbeit braucht, sich selbst zu der Ohnmacht verurteilt, in der sie sich dann zu nichts anderem mehr in der Lage sieht, als der anderen Seite alle Freiheiten einzuräumen. Mit dem Pforzheimer Abkommen hat die IG-Metall 2004 ein in dieser Hinsicht für die deutsche Arbeitswelt und Tariflandschaft richtungsweisendes Abkommen unterzeichnet. Es handelt sich dabei um die Absurdität einer tarifvertraglichen Vereinbarung, die gar keinen anderen Inhalt hat als den, dass mit Zustimmung des Betriebsrats vom Inhalt tarifvertraglicher Vereinbarungen abgewichen werden darf – wenn es dem Ziel dient, Arbeitsplätze zu sichern und neue Arbeitsplätze zu schaffen
. Und dem dient laut Abkommen alles, was dem Erhalt und der Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit, der Innovationsfähigkeit und der Investitionsbedingungen
eines Unternehmens, also seinem Profit dient. Ihre schon sehr verrückte Berechnung, mit der sie sich auf dieses Abkommen eingelassen hat, gibt die Gewerkschaft folgendermaßen zu Protokoll:
„Die Tarifautonomie darf nicht ausgehöhlt werden. Darauf mussten wir eine Antwort finden. Die lautet: Wir müssen unsere tarifpolitische Handlungsfähigkeit in den Betrieben stärken.“
Man hat sich also von der Gegenseite zunehmend aus der Rolle des Tarifpartners gedrängt gesehen, der in allen Lohn und Arbeitszeit betreffenden Fragen zuständig ist. Und diese Rolle hat man in der Weise verteidigt, dass man sich einklinkt in die Praxis der Unternehmer, ihre diesbezüglichen Affären an ihrem Tarifpartner vorbei und entgegen allen tarivertraglich ausgemachten Bedingungen in den Betrieben
zu regeln. Um als Tarifpartner im Geschäft zu bleiben, hat man kurzerhand so getan, als sei die Frage, ob man Lohn- und Arbeitszeitfragen in Tarifverträgen oder auf betrieblicher Ebene regelt, mehr eine Frage des Ortes. Und mit einem Abkommen, das in tarifvertraglicher Form die Außerkraftsetzung von Tarifverträgen regelt, hat man nun wieder ganz ordentlich die juristischen Voraussetzungen dafür geschaffen, dass die wesentlichen Dinge unabhängig davon, was man tarifvertraglich vereinbart hat und weiterhin vereinbaren will, in Verhandlungen zwischen Betriebsleitung und Betriebsrat ausgemacht werden können. Auf der ‚Ebene‘ ist man dann wieder verstärkt im Geschäft und beteiligt an der Durchsetzung all dessen, womit die Unternehmerseite demnächst ihren Profit zu steigern gedenkt – und darf darum streiten, wie die fälligen Massenentlassungen und neuen Lohn-Leistungszumutungen auf die für die Belegschaft schonendste Weise umgesetzt werden.
***
Seit dem Abschluss des Pforzheimer Abkommens hat sich einiges getan am deutschen Wirtschaftsstandort. Die Schleusen sind geöffnet: Seither haben Hunderte Unternehmen das Pforzheimer Abkommen im eigenen Betrieb angewendet.
(SZ, 21.3.07) Und die Tendenz zur Verallgemeinerung ist, wie abzusehen war, eindeutig: Die Notwendigkeit, mittels Standortsicherungsverträgen und sonstigen beschäftigungssichernden Betriebsvereinbarungen bei Lohn und Arbeitszeit drastisch von den tarifvertraglich vereinbarten Maßgaben abzuweichen, wird schon längst nicht mehr nur unter Verweis auf betriebliche Notlagen begründet, ebenso tut es der Verweis auf die Notwendigkeiten der Konkurrenz, in der man steht und die man schließlich gewinnen will, oder das Management einer Firma tritt gleich mit Renditevorgaben an die Öffentlichkeit, die ohne massive Einbußen beim Lohn und bei der Arbeit nicht einzuhalten sind.
Und die Gewerkschaft? Die scheint darin allen Ernstes ein neues Feld der Betätigung und so etwas wie einen neuen Lebenssinn entdeckt zu haben. Zuweilen kriegt man regelrecht den Eindruck, dass für sie vergessen ist, dass sie bis neulich gegen das Durchlöchern von Tarifverträgen durch betriebliche Sondervereinbarungen eingetreten ist und sich nur aufgrund eines Drucks der Verhältnisse
auf eine Verbetrieblichung
der gewerkschaftlichen Interessenvertretung eingelassen hat. Heute redet sie nüchtern sachlich von einem Zeichen der Zeit, und ist ziemlich stolz darauf, dass sie diesem Zeichen gefolgt ist und mittlerweile voll drinsteckt in der Verbetrieblichung der gewerkschaftlichen Arbeit: Wir können heute jedem, der es wissen will, sagen: Wir haben 872 einzelbetriebliche Vereinbarungen getroffen, davon sind 175 Fälle Regelungen nach Pforzheim.
Sie hält es glatt für einen gewerkschaftlichen Erfolg, dass es auf breiter Front gelungen ist, zwischen den Betrieben und der gewerkschaftlichen Vertretung in den Betrieben ergänzende Tarifregelungen zu vereinbaren
, die es ermöglichen, dass befristet von tariflichen Mindeststandards abgewichen
werden kann. Daneben schließt die Gewerkschaft in ihrer Eigenschaft als Tarifpartner weiterhin Tarifverträge ab und beklagt sich in dem Zusammenhang immer wieder einmal darüber, dass die Tarifnormen... immer öfter in den einzelnen Betrieben in Frage gestellt
werden (Magazin Mitbestimmung 09/2006) Aber insgesamt sieht sie ihre Handlungsfähigkeit
tatsächlich gestärkt. Sie hat ja auch viel zu tun und zu regeln, angesichts dessen, dass ein im internationalen Wettbewerb stehender Betrieb sein Innenleben regelmäßig umkrempelt. Dass bei dem, was sie da regelt, die Interessen der von ihr Vertretenen Arbeitsleute immer ein wenig unter die Räder kommen, ist nicht zu vermeiden. Aber es dient ja einem guten Zweck: der Beschäftigungssicherung.
***
Und, macht das jetzt wenigstens die Arbeitsplätze sicherer? Halten die Beschäftigungsgarantien, für die ‚im Gegenzug‘ Lohn und Arbeitszeit geopfert werden? Kaum abgeschlossen, stellt sich heraus: natürlich ist gar nichts garantiert. Ein Unternehmen nach dem anderen rückt nach mehr oder weniger kurzer Frist mit neuen Sanierungs- oder Umstrukturierungsplänen an, die erneut mit in die Tausenden gehenden Entlassungen verbunden sind. Und damit ist eine neue Runde Beschäftigungssicherung angesagt. Wie neulich beim Reifenhersteller Continental, der ein Werk dichtgemacht hat, nachdem die Belegschaft gerade mal ein halbes Jahr zuvor in einer beschäftigungssichernden Betriebsvereinbarung auf eine Lohnerhöhung verzichtet und eine wöchentliche Mehrarbeit von zweieinhalb Stunden akzeptiert hatte; wie bei AEG, wo man sich zur Standortverlagerung nach Polen entschließt, nachdem man sich kurze Zeit vorher noch über ein Konzept zur Standortrettung verständigt hat, das massive Lohneinschnitte, Mehrarbeit und Investitionen vorgesehen hat; wie auch bei Siemens, wo man die Handyabteilung an die chinesische Firma benq abstößt und mit diesem Deal alle innerbetrieblichen Vereinbarungen zur Makulatur werden lässt usw. usf.
Das empört die Gewerkschaft und die betroffene Belegschaft dann natürlich schon erheblich, und auch die Öffentlichkeit hält das für eine Zumutung. Und alle versuchen sich an einer Kritik am – oftmals ausländischen – Management, das sich mangels Kompetenz und ohne jedes Feingefühl über die an der Stelle nun wirklich berechtigten Interessen seiner deutschen Firmen-Belegschaft hinwegsetzt, statt mit dieser Belegschaft, mit deren Arbeitswillen und Arbeitsleistung den Firmenerfolg herbeizuführen, d.h. für deren rentablen Einsatz zu sorgen. Nach dem Motto, dass das doch gehen muss, wird auf einem ausgesprochenen Unsinn bestanden: Die Belegschaft garantiert durch Lohnverzicht und Mehrarbeit die Rentabilität des Unternehmens und das Management garantiert dafür die Beschäftigung. Dabei zeigen all diese Fälle doch klar und deutlich immer nur eines: Die Arbeit ist halt so lange garantiert, solange sie sich rentiert. Und um sie rentabel zu machen, ist es immer wieder einmal fällig, sie effektiver und billiger zu machen und sie von weniger Personal erledigen zu lassen.
Der Fall Telekom: Beschäftigungssicherung als routinemäßige Kampfansage der Konzernleitung an ihre Belegschaft
Im Herbst 2006 unterzeichnen Betriebsrat und Firmenleitung bei Telekom ein Abkommen, das verhindern soll, dass der Personalabbau über die schon beschlossene Streichung von 32 000 Arbeitsplätzen hinausgehen wird
(SZ, 23.10.06) – was ja für sich schon ein interessanter Fall von Beschäftigungssicherung ist. Vorausgegangen war dem, dass die Konzernleitung, damals noch unter Ricke, seit Ende 2005 unnachgiebig auf der Streichung von 32 000 Arbeitsplätzen bestanden und ihren Beschluss gegen den Willen von Verdi im Aufsichtsrat durchgedrückt hat. Daraufhin kam es prompt zu Protestveranstaltungen und Warnstreiks von Seiten der Gewerkschaft; schwierige und langwierige Verhandlungen standen an, welche schließlich mit besagtem Ergebnis erfolgreich zum Abschluss gebracht werden konnten: In dem bis 2008 laufenden Abkommen billigt die Gewerkschaft den beschlossenen Personalabbau, ‚im Gegenzug‘ verzichtet die Firmenleitung auf betriebsbedingte Kündigungen.
Bereits im Februar 07 kündigt die Konzernleitung, nun unter Chef Obermann, an, dass man den Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen nicht über 2008 hinaus verlängern werde. Und sie leitet damit eine neue Runde Beschäftigungssicherung ein: Im Service-Bereich müssten dringend die Kosten um 900 Millionen Euro gesenkt werden; betroffen seien wohl so an die 45.000, womöglich auch 60 000 Mitarbeiter, die man in eine neue Gesellschaft unter dem Dach-Namen T-Service auslagern wolle; dort sollten sie, Originalton Obermann, etwas weniger verdienen und etwas mehr arbeiten
, erhielten dafür aber sichere Arbeitsplätze
. Unter der Bedingung, dass die Gewerkschaft die zur Kostensenkung nötigen Lohnkürzungen und Mehrstunden akzeptiere, sei man dazu bereit, den Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen über 2008 hinaus
zu verlängern.
Im April des Jahres macht die Konzernleitung dann ihr ‚Angebot‘. Es sieht vor , dass die Gehälter der etwa 50 000 von der Ausgliederung betroffenen Mitarbeiter in drei Jahresschritten um zwölf Prozent sinken. Zudem sollten die Beschäftigten mindestens 38 statt bislang 34 Stunden arbeiten.
(SZ 18.04.07) Das wären zusammengerechnet schon mal 25,6 Prozent Lohnsenkung. Zudem sollen die Einstiegsgehälter bei Telekom von derzeit 30 – 34 000 Euro pro Jahr um 42 Prozent auf 20 000 gesenkt werden. Das alles ist in dem Sinne nicht verhandelbar, die Konzernführung will es zügig auch ohne Zustimmung der Gewerkschaft
bis zum 1. Juli umsetzen. Im Gegenzug wolle das Unternehmen Stellen zwei Jahre länger und damit bis 2010 garantieren.
Die Gewerkschaft kann sich ja überlegen, ob sie sich wirklich gegen dieses Angebot der Firma, Beschäftigung zu sichern, stellen will.
2010 – das steht damit auch schon fest – ist es dann spätestens wieder so weit. Dann steht routinemäßig die nächste große Runde Beschäftigungssicherung an.
„Jobmotor“, „Jobwunder“ Zeitarbeit: Ein großer Schritt weiter in der Ökonomisierung des Personals
Eine Branche streift ihr schlechtes Image ab. Leiharbeit, lange Zeit verboten und von den Gewerkschaften als modernisierte Sklavenhaltung
geächtet, macht positive Schlagzeilen: Nach Angaben der Bundesagentur entstanden hier die Hälfte aller neuen Arbeitsplätze, und auch fürs neue Jahr versprechen Randstad, Manpower, Adecco und Co. zweistellige Zuwachsraten
. Das Gewerbe schafft viele und – wie der Vorstandsvorsitzende des Weltmarktführers aus der Schweiz vermeldet – gute Jobs:
„Es gibt in jedem Fall einen ausreichenden Prozentsatz an Leuten, die Spaß daran haben, häufig woanders hin zu gehen. Nicht jeden Morgen in dieselbe Fabrik, in dasselbe Büro. Wenn ein Ingenieur zehn Jahre für denselben Autorückspiegel zuständig ist, weiß er darüber alles. Bessere Karrieremöglichkeiten hätte er bei uns, wenn er Projekte bei mehreren Autoherstellern kennenlernt.“ (Adecco-Chef Scheiff, FAS, 14.1.07)
Ob die Arbeitsplätze, die diese Branche schafft, wirklich so toll sind, ist im öffentlichen Meinungsbild umstritten, der Prognose Wolfgang Clements – als Ministerpräsident hat er Nordrhein-Westfalen zum Pionierland der Zeitarbeit in Deutschland gemacht –, wonach Zeitarbeit eine zentrale Rolle
bei den Lösungen der Probleme der Arbeitswelt von morgen
(FAZ, 8.1.) spielt, widerspricht jedenfalls keiner. Fragt sich nur, wer da in der Arbeitswelt von heute wie von morgen welche Probleme wie und womit löst.
1. Die entleihenden Kapitalisten
Wundersam ist am „Jobwunder“ Zeitarbeit nichts: Mit dem Ausleihen von Arbeitskräften treiben Unternehmer ihren Zweck voran, an Arbeit zu rentablen Preisen immer exakt das Quantum abzurufen, nach dem sie aktuell Bedarf haben. Sie ergänzen die Methoden, ihre Belegschaften auf das Minimum zu reduzieren, mit dem sich die nach Zeit und Menge unterschiedlich anfallenden Arbeiten verrichten lässt, um ein Verfahren, das sie durchgreifend von den Kosten entlastet, die ihnen aus der Bereithaltung von Personal erwachsen: Sie trennen dessen Benutzung einfach von allem finanziellen Aufwand ab, mit dem sie sich bislang seiner dauernden Verfügbarkeit versicherten. Um garantiert nur die Arbeit zu zahlen, die sie verrichten lassen, leihen sich die Unternehmer ihr Personal befristet aus – und schon eröffnet sich ihnen ein neues Freiheitsparadies bei der Wahrnehmung ihres Berufes. Man ahnt ja kaum, unter wie vielfältigen aufgezwungenen Rücksichtnahmen ihr Zugriff auf die produktiven Leistungen ihres fest angestellten Personals bislang gelitten hatte: Bei guten Geschäften wollten sie ja schon immer Leute zum Benutzen einstellen, konnten die aber dann, wenn sie nach ihnen keinen Bedarf mehr hatten, so schnell nicht wieder los werden – was Wunder daher, dass sie dazu die Gelegenheit wahrnehmen, wenn es sie gibt:
„Mittelständische Betriebe, aber auch große Konzerne ergänzen ihren Stamm an fest angestellten Mitarbeitern um einen flexiblen Pool an Zeitarbeitskräften zur Deckung zusätzlichen Bedarfs bei Auftragsspitzen und Projekten.“ (E. Gatzke, Randstad Geschäftsführer, FAZ, 8.1.)
Dann mussten sie sich dauernd den kostspieligen Luxus leisten, so viel Personal vorzuhalten und zu bezahlen, wie nötig, um eventuell auftretende Besetzungslücken zu schließen – logisch, dass der Wegfall dieses Aufwands für sie ein einziger Auftakt dazu ist, Beschäftigung zu schaffen:
„‚Der größte Vorteil ist, Leute kurzfristig und auch für kurze Zeit zu bekommen‘, sagt Schlachta (ein Personalchef). Ob für Urlaubsvertretungen, an Feiertagen oder für krankheitsbedingte Ausfälle, bei denen kurzfristig Personalersatz zur Stelle sein muss.“ (SZ, 16./17.12.06)
Und dann hatten sie bei der Kalkulation der Personalkosten immer die Tariflöhne zu berücksichtigen, obendrein den dicken Posten einzurechnen, der an die staatlichen Sozialkassen abzuführen ist und unter der Rubrik Lohn-‚Nebenkosten‘ zu Buche schlägt: Bei Arbeitskräften, die man sich ausleiht, fällt das einfach weg! Und schon ist eine Methode zur Senkung der Arbeitskosten ein „Jobmotor“:
„Personalleasing (ist) mittlerweile zu einem festen Bestandteil der langfristigen Personalplanung geworden.“ (FAZ, 8.1.07) „Die deutsche Wirtschaft setzt die Zeitarbeit nicht nur zu Überbrückung vorübergehender Engpässe ein, sondern zunehmend als Instrument der strategischen Personalplanung. (...) In den vergangenen 12 Monaten erhöhte fast jedes zweite (von 175 befragten Großunternehmen) den Anteil der Leihkräfte. Knapp jedes dritte gab an, inzwischen mehr als zehn Prozent fremdes Personal zu beschäftigen. Fast jedes zehnte Unternehmen arbeitet inzwischen sogar zu mehr als 30 Prozent mit geborgten Kräften.“ (Handelsblatt, 26.3.)
Arbeiter ausleihen und nach Gebrauch zurückgeben, ist also ein riesiger Befreiungsschlag für den kapitalistischen Zugriff auf Arbeitskraft – und dazu noch ein Geschäftszweig eigener Art.
2. Das Geschäft der Zeitarbeitsfirmen
Die Lagerhaltungskosten der lebendigen Arbeit in derselben Weise zu ökonomisieren, wie moderne Fabriken das mit den sachlichen Bestandteilen ihres Kapitals schon länger tun: Das ist der Dienst, den Zeitarbeitsfirmen kapitalistischen Produzenten leisten. Der ist die allererste Grundlage ihres Geschäfts, denn diese Leistung lassen sie sich honorieren, so dass sich das Verleihen von Arbeitskräften auch für sie lohnt. Sie gründen einen Mitarbeiterpool auf Abruf
, indem sie Leute ohne Arbeit fest bei sich anstellen. Die Verträge sind, wie es so schön heißt, über die Sozialversicherungen abgesichert
, laufen entweder befristet auf die Dauer der jeweiligen Entleihung oder über sie hinaus, wobei in letzterem Fall und immer dann, wenn die Angestellten gerade nicht nachgefragt werden, die Techniken der ‚Flexibilisierung‘ auch auf sie angewandt werden, zu deren Perfektionierung anderswo sie zur Verfügung stehen: Arbeitszeitkonten
, deren Auffüllung sich mal mit 10 oder 20, mal mit 60 wöchentlichen Arbeitsstunden gestaltet, Überstunden, die mit verleihfreien Zeiten entgolten
werden, usw. Der Lohn, den sie erhalten, wird im Subtraktionsverfahren ermittelt: In den Preis, den die entleihenden Kapitalisten für die geleistete Arbeitszeit an die Verleihfirma zu zahlen haben, kalkuliert die ihre Betriebskosten und ihren Profit mit ein, was übrig bleibt, ergibt die kalkulatorische Lohnsumme, die an ihre Angestellten geht. Entgegen einem kursierenden Gerücht sind es nicht nur Hungerlöhne, die dabei heraus kommen. Es gibt Ingenieure und andere hoch spezialisierte Kräfte
, deren Dienste sich manche Firmen sogar eine überdurchschnittliche Bezahlung kosten lassen. Daran profitiert dann auch die verleihende Firma überdurchschnittlich und entgilt diesen schönen Effekt ihrem Angestellten. Ansonsten freilich ist das Gerücht, eine Bande von Blutsaugern wäre da am Werk, überhaupt kein Gerücht:
„Ein Zeitarbeitnehmer, der zuvor als stellvertretender Lagerleiter (...) 1.498,76 Euro netto verdient hat, erhält bei Randstad 765,95 Euro für angeblich hoch qualifizierte Tätigkeiten.“ (Sozialreport Zeitarbeit, IG-Metall, 15.3.) „Bei Daimler-Chrysler (erhielten) einige bisher befristet Beschäftigte nun als Leiharbeiter für die gleiche Arbeit 20 Prozent weniger Geld.“ (MAZ, 17.5.)
Aber das ist ja auch nicht weiter erstaunlich: Das Geschäft mit dem Dienst, den die Verleihfirmen für ihre Kunden versehen, beruht nämlich zweitens auf der Billigkeit des Preises, zu dem ihnen ihr menschliches Geschäftsmittel zur Verfügung steht. In seiner übergroßen Masse setzt sich dies aus denen zusammen, die die Unternehmen über die letzten Jahre hinweg einer weiteren Verwendung für unbrauchbar befunden und aus ihren Betrieben hinaussortiert haben. Diese Leute durften eine Karriere als sozialpolitische Betreuungsfälle durchlaufen, in der sie nicht nur praktisch darüber belehrt wurden, dass im Sozialstaat ein Lebensunterhalt ohne „Beschäftigung“ nicht im Programm ist: Der Staat hat – und dies ist die dritte Voraussetzung, auf der das Verleihgeschäft mit ihnen beruht – dafür Sorge getragen, dass „Beschäftigung“ – zu welchem Preis auch immer – auch für sie zum praktizierten (Überlebens-)Zweck wird. Für seine ihm auf der Tasche liegenden, kapitalistisch nicht gebrauchten Massen hat er Wege eröffnet, sich doch irgendwie brauchbar zu machen – und in dem Zuge die Zeitarbeit, die er über Jahre nur restriktiv, als rechtlich beschränkte und zu beschränkende Ausnahme vom arbeitsvertragsrechtlichen Regelfall tolerierte, als seinen Hebel fürs Schaffen von Beschäftigung
entdeckt. Erst vermitteln statt verwalten
, dann vermarkten statt vermitteln
, heißt die Devise für den sozialpolitischen Umgang mit Arbeitslosen. Für die wird Leih- und Zeitarbeit als zumutbare Arbeit
definiert, die einer anzunehmen hat, will er nicht sein Recht auf Unterstützungszahlungen verwirken, und damit die Zumutung auch stattfinden kann, schafft man den passenden rechtlichen Rahmen: Private Agenturen dürfen sich der lästigen Kostgänger des Sozialstaats annehmen, die der unbedingt loswerden will. Sie können ab sofort Arbeitskräfte unbefristet verleihen, nachfragende Firmen können Personal auch befristet einstellen, so oft sie wollen, die Anstellung bei der Zeitarbeitsfirma darf auch synchron
gestaltet werden, d.h. exakt so lange dauern, wie der Entleihbetrieb die Arbeitskraft braucht – und prompt regnet es die Chancen auf den ‚Arbeitsmarkt‘ nur so herunter:
„Damit eröffnen sich auf dem Zeitarbeitsmarkt im Gegensatz zum regulären Arbeitsmarkt auch noch Chancen für gering oder gar nicht qualifizierte Kräfte.“ (SZ, 16/17.12.06)
3. Der gewerkschaftliche Kampf gegen Zeitarbeit
Wo sich bei der Schaffung von Arbeitsplätzen
auf einen Schlag so viel tut, kann und will der DGB natürlich nicht abseits stehen. Um nichts anderes kämpft er ja vornehmlich, und wenn nun das, was er mal als Sklaverei gebrandmarkt hat, zur kapitalistischen Realität
wird, fehlt der nur noch eines: eine Gewerkschaft, die diese Entwicklung
verantwortungsvoll mitgestaltet. Also schließt der Dachverband der deutschen Gewerkschaften in Gestalt der Chefs seiner Mitgliedsverbände mit dem Arbeitgeberverband der Zeitarbeitsfirmen einen Tarifvertrag ab, der den besonderen Bedingungen
der Zeitarbeit Rechnung trägt – in der Hauptsache besteht die Besonderheit dieser Bedingungen in Stundenlöhnen, die deutlich unterhalb des geltenden tariflichen Niveaus liegen, im Osten der Republik natürlich noch deutlicher darunter. Und kaum hat darüber auch diese ‚Branche‘ ihren Tarifstandard erhalten, fangen die Einzelgewerkschaften im DGB entschlossen gegen die Zeitarbeit zu kämpfen an: Zeitarbeit untergräbt Tarifstandards
, lässt die IG-Metall vorwurfsvoll wissen, findet es skandalös
, dass in den Betrieben gleiche Arbeit nicht gleich bezahlt wird
– als ob beides nicht gerade der Sinn und Zweck dieser Methode des Stiftens von Beschäftigung
wäre! Zum Klassenkampf wird aufgerufen, nämlich zum entschlossenen Kampf gegen die zunehmend um sich greifende Zweiklassengesellschaft in den Betrieben
– als hätte man dieser Spaltung der Belegschaften
in Stammpersonal und anderes nicht gerade seinen allerhöchsten tarifrechtlichen Segen erteilt! Und der Chef des Vereins, der mit dieser Lachnummer seine kämpferische Aufwartung macht, gibt dann das erste Etappenziel dieses Widerstands bekannt. Angesichts der Tatsache, dass von christlichen Gewerkschaften vereinbarte Löhne noch niedriger sind als die, die er mit seinem Dachverband mit den Vertretern der Zeitarbeitsbranche ausgemacht hat, verlangt der Herr Peters von der Regierung, sie
„solle die Vereinbarung für allgemeinverbindlich erklären, die die DGB-Gewerkschaften mit dem Bundesverband Zeitarbeit Personal-Dienstleistungen abgeschlossen haben. Sie sieht einen Mindest-Stundenlohn von 6,10 (neue Länder) und 7 (alte Länder) vor.“ (lt. Tagesspiegel, 15.3.07)
Die Betreuung einer schon so bedeutsamen und immer bedeutender werdenden Branche
in den Händen einer Konkurrenzgewerkschaft: Das ist für den DGB wie seine Mitgliedsverbände in der Tat das Allerschlimmste, was dem Leihpersonal der Ausbeutung passieren kann!
*
Währenddessen gehen kapitalistische Großbetriebe – Infineon, Airbus, Daimler-Chrysler... – die Fraktionierung ihrer Belegschaften in großem Stil an; strategisch
, wie das bei ihnen heißt. In so gut wie allen Schwergewichten der deutschen Industrie, in der Autobranche wie üblich vorneweg, werden ganze Fertigungsabteilungen im Betrieb zu Inseln von Beschäftigten, für die das gewerkschaftliche Tarifwerk einer IG-Metall von vorneherein nicht gilt. BMW beispielsweise setzt den Irrsinn einer ‚atmenden Fabrik‘, in der ein streng am Absatzerfolg orientiertes Kostenregime auch die „Personalflexibilität“ regiert und die Belegschaft mal an 60, mal an 140 Wochenstunden Betriebszeiten anpasst, gleich mit der Gründung seiner Leipziger Zweigniederlassung ins Werk: Ein Drittel der Belegschaft wird von entsprechend verfügbaren Leiharbeitern gestellt, weil, wie ein BMW-Sprecher verkündet, mit dauerhaftem Personal so etwas nicht möglich wäre.
‚So etwas‘: Damit meint er die Selbstverständlichkeit, mit der sich seiner Auffassung nach wechselnde Kapazitätsauslastungen bei der Fertigung unmittelbar in die betriebliche Kommandogewalt über das Personal zu übersetzen haben, mit der sich frei über dessen Entlohnung und fast beliebig über dessen Arbeitszeit verfügen lässt. Und weil ein moderner Betrieb ohne praktischen Gebrauch dieser Selbstverständlichkeit sich außerstande sieht, Leuten überhaupt noch die Gnade ihrer Beschäftigung zu erweisen, haben bei BMW auch die fest Angestellten etwas vom reichlichen Einsatz des ambulanten Dienstpersonals: Die Zeitarbeit trägt damit zur Sicherheit der Stammarbeitsplätze bei
– und so kommen alle Belegschaftsmitglieder, so unterschiedlich sie arbeiten und bezahlt werden mögen, doch wieder gemeinsam zum höchsten Gut aller Lohngerechtigkeit – einem sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplatz
!
Das Entgeltrahmentarifabkommen (ERA): Noch eine prima Gelegenheit zur Lohndrückerei – sowie für ein gewerkschaftssinnstiftendes Aktionsprogramm erster Güte
Noch bevor die Metalltarifrunde 2007 losgegangen war und die IG-Metall ihre 6,5 %-Forderung auf den Tisch legen konnte, hat sich für die Metaller der Lohn bereits drastisch geändert.
Das seit den 70er Jahren angestrebte Jahrhundert-Projekt der Gewerkschaft, die willkürliche
und sachlich nicht gerechtfertigte Differenzierung
der Tarife nach Arbeitern und Angestellten zu revidieren, ist nun nach zähem, beinahe dreißig Jahre währendem Ringen mit der Einführung des neuen Entgeltrahmentarifabkommens (ERA) erfolgreich zum Abschluss gebracht. Statt des bisherigen Zweiklassensystems
mit Gehaltsklassen für Angestellte auf der einen Seite und Lohngruppen für Arbeiter auf der anderen Seite gibt es nun einheitliche Entgeltstufen für alle Mitarbeiter, die dafür sorgen, dass Arbeit und Leistung nach zeitgemäßen Kriterien bewertet
und bezahlt werden. Die Tarifspezialisten der IG-Metall haben sich nicht lumpen lassen und ein hochkomplexes System ausgetüftelt. Danach wird der tarifvertraglich vereinbarte Ecklohn in nicht weniger als 17 Entgeltstufen ausdifferenziert, welche – gemäß den im Abkommen genauestens festgeschriebenen Kriterien einer „objektiven“ Stellenbeschreibung – die verschiedenen Anforderungen widerspiegeln sollen, die ein Arbeitsplatz stellt, sowie deren unterschiedliche Gewichtung. Auf das daraus sich ergebende Grundentgelt sattelt sich ein Leistungsentgelt, das sich nach einer – wiederum nach penibelst festgelegten Kriterien vorzunehmenden – Bewertung dessen richtet, wie weit der jeweilige Mitarbeiter den Anforderungen seines Arbeitsplatzes individuell entspricht. Hinzu kommen Belastungszulagen etc. pp., so dass man schon eine gewerkschaftliche Schulung mitmachen sollte, wenn man besagtes Jahrhundertwerk
im einzelnen und in all seiner Weisheit verstehen will – die Gewerkschaft hilft da mit entsprechendem Schulungsmaterial gerne weiter; mit den 122 von ihr ausgearbeiteten Tarifbeispielen z.B., die jeder Interessierte zum besseren Verständnis all der Differenzierungen durchspielen kann, die sich der gewerkschaftliche Gerechtigkeitssinn hat einfallen lassen und die offenbar nötig sind, damit die Entlohnung für die Gewerkschaft zu einer gerechten Sache wird.
***
Für die Verwirklichung ihres Jahrhundert-Projekts einer total gerechten Einklassen-Lohnhierarchie, war die Gewerkschaft bereit, die von den Arbeitgebern gesetzte Bedingung zu erfüllen – „die Einführung von ERA (hatte) dem von den Arbeitgebern geforderten Schlüsselkriterium der Kostenneutralität“ (Gesamtmetall online) zu genügen – und den von ihnen geforderten Preis zu bezahlen: Damit bei der Umstellung auf das neue Entlohnungssystem auf die Arbeitgeber auch garantiert keine zusätzlichen Belastungen zukommen, hat man die Bildung betrieblicher Ausgleichskonten vereinbart, die schon seit 2002 – jährlich, anläßlich der Tarifrunde – mit einbehaltenen Lohnprozenten bestückt wurden und deren Betrag sich bis 2005 auf immerhin 2,79 % der betrieblichen Lohnsumme aufsummiert hat. Dieser Betrag kann jetzt abgerufen werden
; zum Ausgleich
etwaiger Mehrbelastungen durch die Umstellung. Wo er nicht ausreicht, können durch ERA unbeabsichtigterweise verursachte Lohnsteigerungen ... z.B. durch eine vorübergehende Absenkung des tariflichen Urlaubs- bzw. auch Weihnachtsgeldes ... kostenneutral abgefedert
(Gesamtmetall online) werden. Auch das hat man vorsorglich mitvereinbart.
Umsichtig, wie sie ist, hat die Gewerkschaft bei der Ausarbeitung des Abkommens umgekehrt aber auch die Möglichkeit mitbedacht, dass sich Mitarbeiter mit ihrem Entgelt nach ERA – in Einzelfällen und natürlich ebenfalls unbeabsichtigterweise – schlechter stellen könnten, und eine Regelung solcher Härtefälle mit einbauen lassen:
„ERA kann im Einzelfall auch zu Abgruppierungen führen, insbesondere wenn jemand bislang fälschlich zu hoch eingruppiert worden war. Der alte Besitzstand soll jedoch gesichert bleiben, zwar nicht in der Eingruppierung, so doch im Geld. In solchem Fall der individuellen Entgeltsicherung wird auf das neue, niedrigere Tarifentgelt noch eine Besitzstandszulage gezahlt, die langsam von künftigen Tariferhöhungen aufgezehrt wird.“ (Gesamtmetall online, Hervorhebungen im Original)
In den Fällen sind also auch schon mal Lohneinbußen gesichert.
***
Auf dieser Grundlage waren auch die anfänglich skeptischen Arbeitgeber zur Unterschrift bereit. Und nach und nach haben sie an dem Abkommen richtig Gefallen gefunden. Wie sie erläutern, hat die alte tarifliche Lohn- und Gehaltsdifferenzierung die betriebliche Realität gar nicht mehr geprägt
, und sie beglückwünschen sich zu der neuen Entgelthierarchie, die sich wieder zur Personalführung
eignet und den Leistungsgedanken
, der aus ihrer Sicht in der modernen Arbeitswelt immer wichtiger wird
, in den Vordergrund stellt. Und wenn sie so daherreden, dann weiß man schon, wie der Hase läuft. Was auch immer die Gewerkschaft da für einen Narren gefressen haben mag an ihrem Einklassen-Entgeltrahmen – jedenfalls fällt ihnen nun die Aufgabe zu, ihre Belegschaften in diesen neuen Entgeltrahmen einzusortieren, und so eine Gelegenheit lassen sie sich nicht entgehen! Durch die fällige Neu-Eingruppierung ihrer Mitarbeiter werden die bislang geltenden Kriterien der Lohnbemessung und Lohnzurechnung außer Kraft gesetzt; der bisher anerkanntermaßen zu bezahlende Lohn wird damit fraglich; jeder Lohnbestandteil muss sein Existenzrecht neu rechtfertigen und sich überprüfen lassen. Und diese Überprüfung nehmen die Arbeitgeber ihrem Interesse gemäß vor. Die Einführung von ERA wird so zum Einfallstor für Lohnsenkungen im großen Stil, wie die Gewerkschaft nunmehr beklagt:
„Mittlerweile zeigt sich, dass in vielen Betrieben das neue Entlohnungssystem zu radikalen Lohnkürzungen verwendet wird. Von Kürzungen um durchschnittlich 20 % wird berichtet, auf der anderen Seite sind Erhöhungen kaum bekannt geworden.“ (IG-Metall online)
So, so, das zeigt sich also! Hätte man ja nie und nimmer damit rechnen können! Die Einführung von ERA hat also etwa den gleichen Effekt, als würden die Metallarbeitgeber auf einen Schlag ihre ganze Belegschaft mit ihren althergebrachten, in die heutige Lohnlandschaft mit ihren Niedriglohn-Verhältnissen gar nicht mehr passenden Besitzständen
los werden und sie durch Billiglöhner, die zu den heutigen Konditionen eingestellt werden, ersetzen – nur, dass sie ihre entwerteten Mitarbeiter im Unterschied zu denen noch nicht einmal einzuarbeiten brauchen.
***
Kein Wunder, dass die Mitarbeiter sauer sind:
„Als Jahrhundertwerk wurde er gepriesen. Doch mittlerweile hat der neue einheitliche Entgeltrahmen für Arbeiter und Angestellte in der Metallindustrie (Era) Glanz verloren. In vielen Betrieben sorgt die Einführung sogar für richtigen Ärger. In den letzten Wochen haben Zehntausende von Daimler-Mitarbeitern ihre neue Entgeltgruppe mitgeteilt bekommen. Dabei gab es viele lange Gesichter. Denn eine große Zahl von Beschäftigten wurde in Gruppen gesteckt, deren künftiges Grundentgelt deutlich niedriger war als das bisherige. In manchen Fällen betrug die Differenz sogar einige hundert Euro pro Monat.“ (Stuttgarter Nachrichten, 1.12.06)
Vereinzelt geht der Unmut der Kollegen
so weit, dass es zu spontanen Arbeitsverweigerungen und Protestaktionen kommt; z.B. bei MAN, wo ca. 1000 Mitarbeiter von Stufe 3b auf Stufe 1b mit Einkommenseinbußen von 100 bis 400 EUR pro Monat herabgestuft worden waren und wo sich Mitarbeiter aus Protest weigerten, Arbeiten, die in den Stellenbeschreibungen nicht ausdrücklich vermerkt worden waren, durchzuführen, und damit dafür sorgten, dass nicht weitergearbeitet werden konnte. Und, was fällt der Gewerkschaft da ein? Richtig! Noch nie war sie so wertvoll wie heute! Denn wo blieben die lieben Kollegen in dieser Lage ohne sie? Wohin sonst könnten sie sich mit ihren Reklamationen wenden? Wer würde sie darüber aufklären, wer die ungerechte Behandlung zu verantworten hat, über die sie sich beschweren, und wer würde sich ihrer Sache annehmen? Dafür gibt es doch die Gewerkschaft!
„Die Zuordnung einzelner Mitarbeiter zu diesen Tätigkeitsbeispielen war Aufgabe des Arbeitgebers. Dort setzte nun auch der Protest der Arbeitnehmer an, die sich durch die Arbeitgeberseite vielfach den falschen Beispielen zugeordnet sahen. Mittlerweile liegen Personalbüro und Betriebsrat fast 200 Reklamationen gegen die Zuordnung zu den Tätigkeitsbeispielen vor. Betriebsräte und Beschäftigte warfen daher dem Produktionschef Walter Grödl auf einer spontanen Protestversammlung vor, dass ERA bei Alstom als Entgelt-Reduzierungs-Abkommen übersetzt und als Kostensenkungsprogramm missbraucht werde ...
Die Veranstaltung endete nach 2 Stunden mit der Zusage, dass alle Reklamationen geprüft würden und offensichtliche Fehlentscheidungen bei der Zuordnung sofort korrigiert werden.
Der Betriebsrat kündigte an, die Frage der ERA-Umsetzung zum Hauptthema der in einigen Wochen vorgesehenen Betriebsversammlung zu machen, und forderte die Arbeitnehmer auf, ihr Reklamationsrecht zu nutzen, wenn sie sich ungerecht behandelt fühlen.“ (PR-Info, BR Alstom)
So kann die IG-Metall zeigen, wozu sie fähig ist: Erst spendiert sie den Arbeitgebern eine Steilvorlage fürs Lohnsenken. Dann sind ihre Leute darauf angewiesen, dass sie in Gestalt ihrer Betriebsräte das Schlimmste verhindert. Bei MAN wurden die Abgruppierungen nach Intervention des Betriebsrats sogar wieder zurückgenommen. Da sieht man doch:
„Wir sind im Betrieb für Sie da! Betriebsräte und gewerkschaftliche Vertrauensleute vor Ort sorgen dafür, dass die IG Metall immer präsent ist, wenn es um die großen und kleinen Probleme oder Erfolge geht, die das Arbeitsleben ausmachen.“ (IG Metall online, Mitgliederwerbung)
„Darum: Nicht abseits stehen! Ja ich möchte Mitglied werden.“ (PDF-Broschüre: „Wie komme ich zu meinem Leistungsentgelt?“, Hrsg. IG- Metall Baden Württemberg)
Prima Werbung!
Der Tarifabschluss in der chemischen Industrie: Ein Tarifvertrag ganz nach dem Geschmack des herrschenden ökonomischen Sachverstandes
Im Tarifabschluss zwischen IG Bergbau-Chemie-Energie (IG BCE) und dem Bundesarbeitgeberverband Chemie (BAVC) wird u.a. Folgendes vereinbart:
„Für den ersten Monat werden einmalig 70 Euro gezahlt. In den 13 Folgemonaten gehen jeweils 3,6 Prozent dauerhaft in die Lohn- und Gehaltstabellen ein. Weitere 0,7 Prozent je Monat werden zwischen dem 1. April und dem 30. Juni als variabler Einmalbetrag gezahlt. Dieser macht je nach Schichtmodell zwischen 9,8 und 12,8 Prozent eines Monatsentgelts aus. Dies entspricht nach Arbeitgeberangaben im Schnitt aller Einkommengruppen etwa 250 Euro. Dieser Betrag kann mit Einwilligung des Betriebsrats aber von den einzelnen Unternehmen gekürzt, gestrichen oder seine Auszahlung verschoben werden. Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit von 14 Monaten und gilt rückwirkend zum 1. Januar ... Verlängert wurde die Möglichkeit, Langzeitarbeitslose und Berufsanfänger (etwa Lehrlinge nach der Gesellenprüfung) im ersten Berufsjahr zu niedrigeren Einstiegstarifen von 90 und 95 Prozent des Tariflohns zu beschäftigen.“ (FAZ, 9.3.07)
So schaut ein Tarifvertrag aus, den deutsche Journalisten als Ergebnis effizienter Verhandlungsführung
(HB, 9.3.) begrüßen. Ein dickes Lob erteilen sie den beiden Tarifparteien, die nach nur zwei Runden ohne viel Gezeter
(SZ, 10.3.) und zum frühestmöglichen Zeitpunkt
(HB, 9.3.) eine Vereinbarung hingekriegt haben. Ein besonderes Kompliment geht dabei an die Adresse der Gewerkschaft, die auf Rituale verzichtet und pragmatisch ist
(SZ, 10.3.), statt mit klassenkämpferischen Drohgebärden
(HB, 9.3.) den wirtschaftspolitischen Sachverstand von Redakteuren zu nerven. Ganz besonders erfreulich bei der IG BCE ist die stabile Sozialpartnerschaft
(HB, 9.3.); bei ihr hat der Verzicht auf lästige gewerkschaftliche Kampfmaßnahmen eine ruhmreiche Tradition in der deutschen Arbeiterbewegung. Bei ihr liegt der letzte große Streik gut dreißig Jahre zurück
(SZ, 10.3.). Das muss man als Leistung anerkennen!
Selbstverständlich hat man sich in den Redaktionen auch die Frage gestellt, ob der Chemie-Tarifabschluss zu hoch ist
. Das Ergebnis: Er geht – mit Abstrichen – in Ordnung. Zwar ist er eindeutig kein Beitrag zu mehr Beschäftigung. Angesichts vielfältiger Empfehlungen aus der Politik hätte es aber noch schlimmer kommen können.
(HB, 9.3.) Klar, im Prinzip ist jedes Lohn-Prozent Gift für die Wirtschaft und für deren unablässiges Bemühen um mehr Beschäftigung. Aber bleiben wir auf dem Teppich: Die Arbeitgeber können mit dem Abschluss ganz gut leben.
Und sie geben es ja auch selber zu. Ihr Verbandspräsident lobt sich jedenfalls für einen Tarifabschluss mit einer eindeutig entlastenden Wirkung für die Kosten der Unternehmen
. (Voscherau, Präsident des Bundesarbeitgeberverbandes Chemie (BAVC) FAZ, 9.3) Erstaunlicherweise freut den für die andere Seite zuständigen Gewerkschafts-Chef derselbe Tarifabschluss, weil ein Lohnplus herausgekommen ist: Die Lohnsteigerung passt.
(Schmoldt, Chef der IG BCE, SZ, 10.3.) Alles in allem also eine wahre klassengesellschaftliche Wundertüte, aus der eine Einkommenssteigerung für Lohnabhängige zugleich als Senkung der Lohnkosten ihrer Lohnanwender herauskommt!
Aber wie dem auch sei, jedenfalls können auch die Chemiearbeiter mit ihrem neuen Lohn ganz zufrieden sein. Wenn man die verschiedenen Rubriken, unter denen dem Tarifvertrag zufolge Lohn gezahlt werden soll, zusammenrechnet und all seine Finessen berücksichtigt, kommt vielleicht nicht immer derselbe, auf jeden Fall aber ein ganz ansehnlicher Lohnzuwachs heraus: Das Einkommen der 550 000 Beschäftigten wird um maximal 4,3 Prozent erhöht
, haben die Rechenkünste der FAZ (9.3.) ergeben, während Adam Riese bei der SZ objektiv anders rechnet: Die Tarifparteien einigen sich auf eine Erhöhung um 3,6 Prozent
(SZ, 9.3.).
***
Bemerkenswert ist diese Tarifvereinbarung der Chemie, weil sie beispielhaft zeigt, wie einsinnig der Einfallsreichtum der Tarifpartner im 21. Jahrhundert den alten kapitalistischen Interessengegensatz, der im Lohn seinen Bezugspunkt hat – für die einen ist er eine zu senkende Unkost, für die anderen das deswegen stets unzureichende Mittel, um ihre Lebenskosten zu decken –, in lauter bei der Lohnzahlung zu berücksichtigende Unter- und Sonderpunkte mit allerlei Kautelen und Durchführungsbestimmungen aufgliedert – und in all diesen Punkten dann doch nur immer ein und dasselbe zu seinem Recht kommen lässt: Dass der Lohn nichts ist als die vom Erfolg des Kapitals abhängige Variable. Bemerkenswert ist darüber hinaus, dass dies von beiden Seiten auch so gesehen wird und beide Seiten nichts anderes zum Argument machen – was bei den Unternehmern ja auch nicht anders zu erwarten ist, bei der Gewerkschaft aber dann doch eine Erwähnung wert ist.
Die sehr zeitgemäße gewerkschaftliche Rechtfertigungslehre eines gerechten Lohns, mit der die IG-BCE zur Lohnfindung schreitet, will als Argument nur mehr eines kennen: dass die Unternehmer den geforderten Lohn gut vertragen und so viel verdient haben, dass sie ihn bequem bezahlen können. Nur unter dieser Voraussetzung und nur in dem Maße will die Gewerkschaft von ihnen überhaupt etwas verlangen. Was für die von ihr vertretenen Arbeiter verträglich oder nötig ist, kommt in ihren Überlegungen einfach nicht vor. So hat sie sich in Gestalt ihrer volkswirtschaftlich studierten Gewerkschaftsökonomen erst einmal die Gewissheit verschafft, dass die Gewinne der Wirtschaft im allgemeinen derzeit nicht zu knapp bemessen sind, um eine Lohnerhöhung für die Chemie-Beschäftigten herzugeben: Wir haben die wirtschaftliche Gesamtlage berücksichtigt.
(Schmoldt, SZ, 10.3.) Dann haben sich ihre Tarifexperten schlau gemacht, wie es ums Geschäft und um die Geschäftsaussichten speziell in der Chemiebranche steht, und festgestellt, dass auch hier alles im grünen Bereich ist. Die Chemie hat voriges Jahr ein exzellentes Wachstum von vier Prozent erzielt und wird in diesem Jahr um weitere zwei Prozent wachsen
. (Schmoldt, SZ, 10.3.) Zuguterletzt hat sie auch noch ein Auge darauf, dass ihre Lohnforderung durch das Betriebsergebnis der einzelnen Firma gerechtfertigt ist: Der Tarifvertrag soll helfen, die Entwicklung der einzelnen Firmen zu berücksichtigen. Es geht ja nicht allen Unternehmen gleich gut
(Schmoldt, SZ, 10.3.)
So gerüstet geht sie dann in die Tarifrunde und tätigt einen Abschluss, der mit seiner Mischung aus Einmalzahlung, Prozentzuwachs, Erfolgsbeteiligung, Spezialeinsteigertarife für Langzeitarbeitslose, Sonderregelungen für Azubis und dergleichen mehr ein einziges Dokument dafür ist, wie wenig das Argument, auf das sie sich eingeschossen hat, als Argument für Lohn hergibt: In ganz guten Zeiten, in denen sich die Unternehmer dann aber schon goldene Nasen verdienen müssen, rechtfertigt dieser Erfolg glatt einmal 3,6 % plus einen Sonderzuschlag. Dessen Auszahlung ist freilich gleich schon wieder fraglich, weil davon abhängig gemacht, ob er in die Kalkulationen des einzelnen Unternehmens hineinpasst; er ist dementsprechend variabel
und kann mit der Zustimmung des Betriebsrates gekürzt, gestrichen oder verschoben werden
. Abgesehen davon handelt es sich um einen Einmalbetrag
. Was durch ausnahmsweise hohe Wachstumsziffern gerechtfertigt ist, kann natürlich nicht dauerhaft in die Lohn- und Gehaltstabellen eingehen
. Vielmehr muss die Arbeit – unabhängig davon, ob die Wachstumsziffern nur ausnahmsweise so hoch gewesen sind – im nächsten Jahr wieder um diesen Lohnbestandteil billiger werden. Für die nächste Runde ist mit diesem Tarifabschluss jedenfalls schon präjudiziert: So einen Schluck aus der Pulle
kann es nicht jedes Jahr geben. Dann steht auf nach wie vor niedriger Tarifbasis
, die sich durch den Sonderzuschlag ja nicht erhöht
hat, erneut die Frage auf der Tagesordnung, ob die Lohnhöhe durch die Gewinnaussichten im allgemeinen, besonderen und einzelnen gerechtfertigt ist.
Kommentare zum Metall-Abschluss: Noch mehr Konjunktur-Argumente in der Lohndebatte
Anfang Mai kommt es im Pilotbezirk Baden-Würtemberg zum mit Spannung erwarteten Pilotabschluss in der Metall- und Elektroindustrie: Einmalzahlungen von je 400 Euro für die Monate April und Mai, im Juni folgt eine Tariferhöhung von 4,1 Prozent. Von Juni 2008 an steigt der Tariflohn noch einmal um 1,7 Prozent, dazu gibt es eine weitere Einmalzahlung von 0,7 Prozent je Monat bis einschließlich Oktober 2008
Freundlicherweise bekommt man angesichts des schwierigen Lohnsteigerungs-Berechnungsmodus die politically korrekte Deutung gleich mitgeliefert: Um eine außergewöhnliche Höhe des Abschlusses
handelt es sich, um den höchsten Lohnzuwachs seit 1992
und einen echten Erfolg der IG Metall: Im letzten Jahr hatte es erst 3 % mehr Geld gegeben, in 2005 nur 2,7 % und in 2004 gerade mal 2,2 %
. Glückliche Metaller
bekommen die größte Lohnerhöhung seit 15 Jahren
Und, so der Tenor, sie steht ihnen nach den vielen mageren Jahren für die Beschäftigten
und angesichts der Geschäftslage und des derzeitigen Auftragsbooms in der Metall- und Elektrobranche
diesmal in der insgesamt doch sehr ausgewogenen und vertretbaren
Höhe auch zu. (Alle Zitate aus Bild, FAZ und SZ vom 5.5.07)
Im Zuge ihrer Besprechung des Tarifabschlusses in der Metall- und Elektroindustrie knüpfen die Kommentatoren an das Argument, dass der Lohn und mithin das Arbeiterinteresse ausschließlich als eine dem Erfolg der Kapitalseite untergeordnete und unterzuordnende Angelegenheit zu betrachten ist, der man allenfalls in sehr sehr guten Geschäftszeiten und auch dann nur sehr vorsichtig etwas mehr Berücksichtigung angedeihen lassen kann, noch ein paar weitere interessante Reflexionen.
Unter der Überschrift: Der starke Arm der Konjunktur
erinnert die Financial Times Deutschland vom 4.5.07, die mit dem Tarifabschluss insgesamt ebenfalls ganz zufrieden ist, dass es gar nicht so sehr eine Frage der Gerechtigkeit und kapitalistischer Großzügigkeit ist, wenn die Beschäftigten in Zeiten guter Konjunktur ein bißchen mehr Lohn verdienen:
„Die Beschäftigten haben diesmal einen viel mächtigeren Verbündeten, als es selbst die Organisationsmacht Gewerkschaft je sein könnte: den Superaufschwung... die Arbeitgeber waren unter Druck. Ihre Auftragsbücher sind proppenvoll, sie arbeiten personell am Rande der Kapazitätsgrenzen, Produktionsausfälle durch Streiks hätten sie kaum aufarbeiten können. Vor allem aus diesen Gründen haben sie zugelassen, dass ihre Metaller einen kräftigen Schluck aus der Pulle nehmen können. Der aber war – nach Jahren der Reallohnkürzung – in der Tat überfällig. Und auch nach Ansicht vieler Volkswirte bewegt sich der Abschluss im Rahmen dessen, was die Branche verkraften kann.“
Dass eine Gewerkschaft mit all ihrer Organisationsmacht in Sachen Lohnerhöhung letztlich gar nichts ausrichten kann, wenn die Lage es nicht zuläßt, das steht für die FTD einfach fest. Das Lohninteresse eines Arbeiters ist auch für sie nichts, was sich gegen das Interesse von Arbeitgebern durchsetzen ließe, sondern eine abhängige Variable von deren Geschäftserfolg. Als diese Variable ist aber auch für den Lohn in Zeiten eines Superaufschwungs ein kleiner Aufschwung drin. Die Arbeitgeber geraten dann nämlich „unter Druck“ – und zwar nach Auskunft der FTD gar nicht so sehr unter den, den die Gewerkschaft ihnen aufmacht, und gar nicht so sehr deswegen, weil die Arbeitnehmerseite dann den Spieß einmal umdrehen und ihre Erpressungsmacht auspielen kann. Es ist vielmehr so, dass die Arbeitgeber in diesen Zeiten Bedarf nach zusätzlichen Arbeitskräften haben und diese mit einer etwas höheren Bezahlung attrahieren. Es ist noch nicht einmal die ganze Wahrheit, dass sie diese höhere Bezahlung der Gewerkschaft konzedieren. Zur Erläuterung dessen, warum der Tarifabschluss mit seinen 4,1 % Lohnerhöhung plus Konjunkturbonus ganz gut in die Landschaft passt, verweist der Artikel auf das folgende interessante Faktum:
„Die Lohndrift, also die Abweichung zwischen Tarif- und Effektivverdiensten, war im Dezember zum ersten Mal seit Langem wieder positiv. Das heißt, die Arbeitnehmer haben in ihrer Gesamtheit mehr verdient als in den Tarifverträgen vorgesehen. Eine solche Entwicklung ist normal im Konjunkturboom, weil die Firmen sich dann gezwungen sehen, etwas draufzulegen, um Beschäftigte zu halten oder abzuwerben.“
Aus ganz eigenem Geschäftsinteresse und eigenen Berechnungen sind die Unternehmer allgemein und schon seit einiger Zeit bereit, mehr Lohn zu zahlen als der Tarifvertrag es von ihnen verlangt. Hier findet die Abweichung vom Tariflohn also einmal andersherum statt, als man es nun jahrelang kennengelernt hat, aber auch diese Abweichung zeigt wieder nur eines: wie perfekt in diesem Laden der Lohn als abhängige Variable der Gewinnemacherei funktioniert. Nach jahrelanger Lohndrückerei von Seiten der Unternehmer, die ihre mit dem Arbeitslosenheer anwachsende Erpressungsmacht gegenüber den Arbeitern und deren Interessenvertretung schamlos zur Durchsetzung niedrigerer Tariflöhne und untertariflicher Bezahlung ausgenutzt haben, ist der tariflich vereinbarte Lohn nun so niedrig, dass ein paar Prozent Aufschlag für sie das probate Mittel sind, sich wechselseitig Arbeitskräfte abspenstig zu machen. Das erklärt auch ein wenig die Gelassenheit, mit der diese Tariferhöhung zur Kenntnis genommen wird. Ob und in welchem Maße die „Effektivverdienste“ mit ihr steigen, das können angesichts dessen, dass die ja im allgemeinen sowieso schon über dem alten Tarif liegen, die Unternehmer weitgehend frei entscheiden.
***
Für die Frankfurter Allgemeine Zeitung (ebenfalls vom 4.5.) geht dieser Abschluss hingegen gleich aus mehreren Gründen überhaupt nicht in Ordnung – dabei kennt ihr Herr Nico Fickinger auch kein anderes Argument, nur andere Verlängerungen desselben:
„Mit dieser Einigung ist die Gefahr eines Arbeitskampfs gebannt, der verheerende Wirkungen gehabt hätte. Das freilich ist die einzige frohe Kunde aus Sindelfingen. Ansonsten ist dem Tarifkompromiss wenig Gutes abzugewinnen. Die üppige Steigerung um 4,1 Prozent ist von keiner Lohnformel gedeckt...“
Herr Fickinger kennt natürlich sämtliche Lohnformeln. Und auch wenn er keinen näheren Einblick gibt, mit was er da rechnet: Jedenfalls hat er mathematisch unbestechlich und objektiv ausgerechnet, dass der Verteilungsspielraum bloß 3,6 Prozent (beträgt). Was darüber hinausgeht, ist beschäftigungsfeindlich.
Sein Argument:
„Damit wird ein Kostensockel zementiert, der schon jetzt jene Branchen belastet, die hart an der Gewinnschwelle wirtschaften, und später, wenn der Aufschwung endet, auch den Rest der Branche zu Anpassungsmaßnahmen zwingen wird. Die Zeche zahlen die Beschäftigten. Ob dieser Handel – „mehr Geld jetzt“ gegen „höheres Entlassungsrisiko später“ – in deren Sinne ist, darf bezweifelt werden.“
Da ist es also wieder, das Konjunkturargument, diesmal so hingedreht, dass man sich in Zeiten des Booms nur nicht dazu verführen lassen darf, die Lohnfindung an den guten Geschäftszahlen zu bemessen, sondern dass man in diesen guten Zeiten an die Zeit danach, wenn der Aufschwung endet
, denken und daran Maß nehmen muss. Denn tut man dies nicht, steht – anders als bei der Einmalzahlung, die nach Auffassung des FAZ-Ökonomen ruhig hätte höher ausfallen können, dann aber aus denselben konjunkturellen Gründen auch früher hätte kommen müssen – ein erhöhter Kostensockel in einer Konjunkturlandschaft, zu der er dann spätestens gar nicht mehr passt. Und zwar zum Schaden derjenigen, für die es dann wieder heißt: Die Lohnhöhe ist ein Beschäftigungshindernis. Besser man besinnt sich auch in einem Geschäftsjahr, in dem die Nachfrage nach Arbeitskräften boomt wie schon lange nicht mehr, auf den Grundsatz, dass Beschäftigung ihren Preis hat und steckt bei der Lohnforderung zurück. Aber da kann man ja reden und reden in diesem Land, in dem der vernüftig und langfristig Denkende immer die schlechteren Karten hat gegenüber der Mehrheit, die nur an ihre kurzfristigen Interessen denkt:
„Doch solche Argumente spielen in der erhitzten öffentlichen Debatte keine Rolle. Mit jedem Tag, der ins Land geht, wird der Aufschwung stabiler, die Konjunktur robuster. Das Ergebnis spiegelt daher nicht ökonomische Vernunft, sondern vor allem die gesellschaftliche Stimmung wider: Nach Jahren moderater Reallohnzuwächse stehe den Arbeitnehmern endlich ein sattes Lohnplus zu.“
Außerdem empört den Mann von der FAZ nachträglich noch immer – auch wenn mit der zügigen Einigung die Gefahr eines Arbeitskampfs gebannt
ist –, wie die IG Metall die Möglichkeit eines Arbeitskampfes überhaupt auch nur ins Gepräch bringen konnte. In dem Zusammenhang fällt auch ihm die Sache mit dem Druck
ein, unter dem die Arbeitgeber in Zeiten der Hochkonjunktur verstärkt stehen. Und auch der verleiht er eine interessante Wendung:
„Dass sich mit dem konjunkturellen Auf und Ab die Machtverhältnisse ändern, gehört zum Geschäft. Dass die wechselnde Erpressbarkeit das jeweilige Gegenüber zu einem unnachgiebigen Auftreten ermuntert, ebenfalls. Nicht in Ordnung ist aber, dass die IG Metall gleich mit einem Arbeitskampf gedroht hat. Damit hat sie den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit in eklatanter Weise verletzt. Die Politik wäre daher gut beraten, über eine gesetzliche Regelung des Streikrechts nachzudenken. Ein Arbeitskampf sollte erst zulässig sein, nachdem alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft wurden.“
Kaum sieht es für unseren FAZ-Redakteur so aus, als hätte sich unter den derzeitigen konjunkturellen Vorzeichen die Erpressungslage ein wenig umgekehrt, schon sieht er auch schon die Gewerkschaft ihre Erpressungsmacht schamlos ins Spiel bringen und ruft nach dem Staat, der diesem Treiben ein Ende zu bereiten hätte. Aber auch das ist noch nicht alles:
„Am schlimmsten an dem Sindelfinger Abschluss ist freilich, dass sich die IG Metall offenbar aus dem Prozess der kontrollierten Dezentralisierung ausgeklinkt hat. Die schrittweise Tariföffnung, 2004 mit dem Abkommen von Pforzheim eingeleitet und in der vorigen Tarifrunde eher zaghaft mit der Variabilisierung der Einmalzahlung fortgesetzt, ist zu einem vorläufigen Stillstand gekommen: Der Konjunkturbonus – der seinen Namen nicht verdient, weil er jetzt angemessen wäre und nicht im ungewissen Herbst 2008 – ist festgezurrt und von den Betrieben nicht abdingbar, die Flexibilisierung des Weihnachtsgeldes wurde vertagt. Damit gibt es während der Laufzeit keine Marscherleichterung für jene Betriebe, denen das Tarifpaket zu schwer ist. Man kann nur hoffen, dass dies keinen generellen Richtungswechsel bedeutet. Wäre es so, würden jahrelange Flexibilisierungsanstrengungen zunichte gemacht und die Lunte an den Flächentarif gelegt.“
Am schlimmsten ist also, dass sich konjunkturell bedingt für die Gewerkschaft die Erpressungslage gelockert hat, in der sie bereit war, Abkommen wie das Pforzheimer zu unterzeichnen. Wenigstens sieht das Herr FAZ-Redakteur so, der durch die gute Konjunktur den Prozess
der weiteren Flexibilisierung der Arbeit und des Lohnes zum Stillstand gekommen
sieht, der es den Unternehmern gestattet, nach ihrem Belieben und zu ihren Bedingungen auf Arbeitskraft zuzugreifen. Und diese Sorge trägt er mit einer ebenso typischen wie spitzenmäßigen Heuchelei aus der Werkstatt der FAZ als die Sorge darum vor, dass damit die Lunte an den Flächentarif gelegt
sein könnte: Wenn der nämlich überhaupt nur mehr auf der Grundlage gilt, dass die Arbeitgeber seine Bestimmungen auf der Grundlage entsprechender Zugeständnisse von Seiten der Gewerkschaft weitgehend nach ihrem Belieben flexibel interpretieren und umgehen können, dann ist jede Einschränkung dieser Flexibilität ein Angriff auf die Grundlagen des Flächentarifs und damit auf eine gewerkschaftliche Errungenschaft, ohne die unsere deutsche Republik nicht mehr dieselbe wäre!
Baugewerbe: Wie Gewerkschaft und Unternehmer mit einem Abschluss nach Maß den Flächentarifvertrag retten
Am 20. Mai 2007 haben endlich auch die Bauarbeiter dank erfolgreicher Schlichtung ihren Tarifabschluss:
„Erstmals werden die Einkommen der Beschäftigten zum 1. Juni angehoben: um 3,1 Prozent. Die zweite Stufe folgt im April 2008; dann steigen sie um weitere 1,5 Prozent. Im September legen sie nochmals um 1,6 Prozent zu. Die Laufzeit des Tarifvertrags endet am 31. März 2009. Hinzu kommen Einmalzahlungen: Vom kommenden Juni bis einschließlich März erhalten die Beschäftigten jeden Monat 0,4 Prozent extra, von April 2008 an jeweils 0,5 Prozent.“ So „profitieren“ die Bauarbeiter „nun vom Aufschwung der Branche“ und können – hochgerechnet – „in den kommenden zwei Jahren um bis zu 6,2 Prozent“ mehr verdienen.
Einmal andersherum und im Klartext gelesen fügt sich dieser Abschluss nahtlos in die aktuelle ‚Tariflandschaft‘ ein und bedeutet etwa Folgendes: Mitten im anhaltenden Boom der Bauwirtschaft werden die tariflichen Einkommen mit ziemlich marginalen prozentualen Erhöhungen langfristig festgeschrieben und gleichen – nach Jahren rückläufiger Reallöhne
, wie die SZ lapidar bemerkt – nicht einmal die Lohnverluste der Vergangenheit aus. Ein Gutteil der Erhöhung wird als Sonderzahlung auf Zeit gezahlt; damit ist klargestellt, dass es sich dabei um eine ausnahmsweise, nur durch exorbitant wachsende Gewinne gerechtfertigte Zuwendung handelt, auf die deswegen auch kein dauerhafter Anspruch besteht; steigende Lebenshaltungskosten, wachsende Leistungsanforderungen, frühere Lohnkürzungen oder überhaupt die generellen Anforderungen an ein ausreichendes Einkommen – das alles darf ohnehin keine Rolle spielen. Zudem sparen sich die Unternehmer zwei Monate Lohnerhöhung und sind außerdem gleich auf zwei Jahre alle weiteren Lohnforderungen und nach den zwei Jahren auf jeden Fall erst einmal die ‚Sonderzahlungen‘ los. Das alles in einer Branche, in der ohnehin der größte Teil der Beschäftigten am unteren Ende der Tarifskala angesiedelt ist – irgendwo im Umkreis des Mindestlohns, der, wie man nebenher erfährt, im Westen glatt um volle 2,8 % erhöht worden ist; nicht, weil die Mindestlöhner es besonders dringend brauchen – da wäre ja eine solche Anhebung eines solchen Niedrigeinkommens auch absurd –, sondern um ruinöse Konkurrenz durch Firmen zu verhindern, die keinem Arbeitgeberverband angehören.
Die gibt es also massenhaft, und die geben das Konkurrenzniveau vor, an dem sich die Tariflöhner mit Lohn und Leistung messen lassen müssen. So kommt es, dass ungelernte Arbeiter jetzt statt 10,30 Euro offiziell mindestens 10,70 Euro, Facharbeiter offiziell mindestens 12,85 Euro erhalten.
Zustande gekommen ist dieser Abschluss am Ende nur mit Hilfe des Schlichters. Nicht, weil sich die Gewerkschaft gesträubt und schlecht bedient gesehen hätte, sondern weil Teile des Unternehmerlagers den im März schon ausgehandelten Tarifvertrag als untragbar abgelehnt haben. Hier haben also einmal Unternehmer Widerstand geleistet – dass ihnen so etwas von der Gegenseite drohen könnte, haben sie offensichtlich nicht befürchtet. Damit hält ein neues Prinzip Einzug in die Welt der ‚Tarifrituale‘: Unzufriedene Unternehmer erzwingen Nachverhandlungen mit dem Anspruch, dass die Gegenseite sich gefälligst weitere Abstriche gefallen zu lassen hat, wenn sie ein Tarifergebnis für ‚untragbar‘ erklären und neuerlich um Prozentpunkte bei den tariflichen Lohnkosten streiten, mit denen sie dann in ihren Betrieben frei kalkulieren. Prompt stand für die Öffentlichkeit fest, dass sich die IG Bau darauf einstellen musste, nun schlechter abzuschneiden als im März
. Die IG Bau hat das glatt genauso gesehen – und sich nachträglich auf die zweijährige Laufzeit und darauf eingelassen, die Lohnerhöhung erst im Juni beginnen zu lassen.
Damit ist der unternehmerische Bedarf allerdings noch längst nicht zufrieden gestellt. Wenn schon tarifliche Lohnerhöhungen angesichts der gestiegenen Profitmargen unvermeidlich sind, weil sie als angemessen und vor allem als zahlbar gelten, dann darf das noch lange nicht heißen, dass die Unternehmen diese Erhöhungen auch alle zahlen müssen; dann muss vielmehr noch anerkannt werden, dass nicht alle Unternehmen so ausnehmend profitlich florieren, wie es zum Maßstab für die Berechtigung der Tariferhöhungen erklärt worden ist. Also erfährt der ‚konjunktur‘-gerechte Tarifabschluss eine ‚betriebs‘-gerechte Ergänzung, indem den bis zu 6,2 % Lohnerhöhung in den nächsten zwei Jahren
eine kleine Korrektur nachgereicht wird:
„Die Einkommenserhöhungen in Westdeutschland werden unter anderem durch die Möglichkeit flankiert, per Haustarifvertrag 8 % unter Flächentarifvertrag zahlen zu können. Um auf schwierige Situationen reagieren zu können, wie es in der Einigung heißt.“
Aufatmen bei Gewerkschaft und Öffentlichkeit: Einer der letzten bundesweiten Flächentarifverträge gerettet!
(alle Zitate SZ, 21.5.)
Glückwunsch!