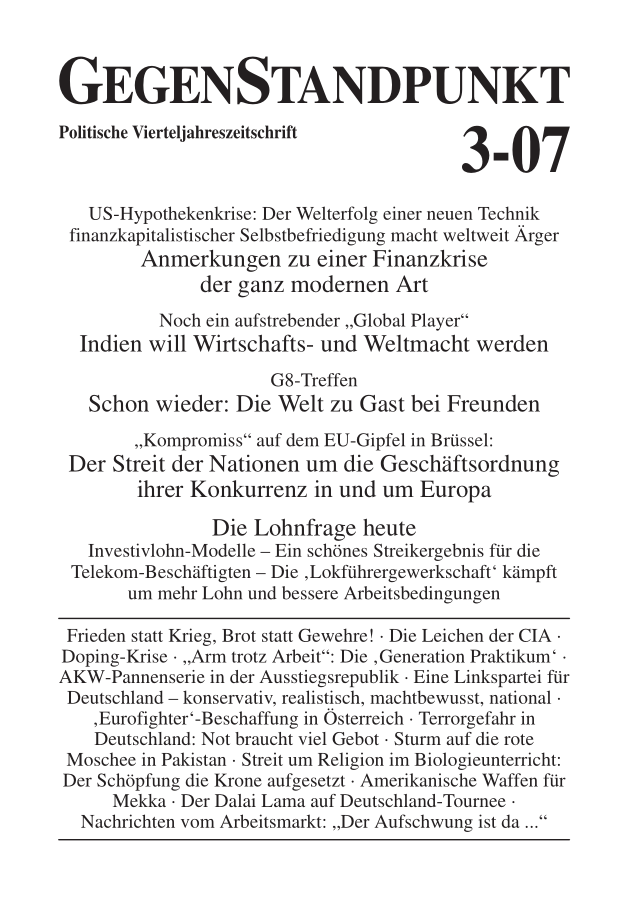Vom staatsgefährdenden Klassenkampf zum gewerkschaftlichen Ritual
Die Lohnfrage – einst und heute (II)
Im Wirtschaftswunderland BRD mit seiner sozialen Marktwirtschaft hat es den Anschein, als wäre die Lohnfrage in Bahnen gelenkt, in denen die Arbeiter, die nun Arbeitnehmer heißen, nicht mehr um ihre Existenz fürchten und kämpfen müssen. Längst sind sie keine rechtlosen Existenzen mehr, die hilflos der Willkür ihrer Fabrikherren ausgeliefert sind. Vielmehr erfreuen sie sich zahlreicher Anwälte ihres Interesses, an die sie sich jederzeit wenden können, wenn sie Grund zur Unzufriedenheit sehen oder sich ungerecht behandelt fühlen.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Siehe auch
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Gliederung
- Die neuesten Investivlohn-Modelle von SPD und Union: Einfach sensationell!
- Arbeiter brauchen eine Gewerkschaft (1): Ein schönes Streikergebnis für die Telekom-Beschäftigten – Unternehmenserfolg auf der ganzen Linie!
- Arbeiter brauchen eine Gewerkschaft (2) Die unendliche Geschichte der Bau-Tarifrunde: Die Unternehmer streiten über ihre Billiglohnkonkurrenz – die IG Bau macht immer neue Angebote
- Die ‚Lokführergewerkschaft‘ kämpft um mehr Lohn und bessere Arbeitsbedingungen – Die ganze Republik steht Kopf: Dürfen die das? – Bahn AG und Bahngewerkschaften sind sich einig: So nicht!
- Ein ganz normaler Lohnkampf – eine Ausnahme in diesem Land!
- Die Antwort der Bahn AG
- Gewerkschaftliche Schützenhilfe für die Bahn AG: Der Tarifabschluss der Bahngewerkschaften Transnet/GDBA
- Die GDL – ein einziger Angriff auf die Vertretungshoheit der Transnet
- Transnet und Bahn AG vereint gegen die GDL Der Kampf der Transnet gegen eine unliebsame gewerkschaftliche Konkurrenz
- Der Kampf der Bahn AG: Mit der Waffe des Rechts gewerkschaftliche Interessenvertretung erledigen
- Die unabhängige Justiz entscheidet und erläutert die Rechtsgrundsätze erlaubten Arbeitkampfs, und die Öffentlichkeit erörtert die Grundsatzfrage: Was soll, darf, muss eine ordentliche Arbeitervertretung?
Vom staatsgefährdenden Klassenkampf zum gewerkschaftlichen Ritual
Die Lohnfrage – einst und heute (II)
Um den Lohn haben die, die von ihm leben müssen, einmal gekämpft, um von ihm leben zu können. Das – das lehrte sie die tägliche Erfahrung ihrer ruinösen Lohnarbeit – muss ihren Anwendern, die mit ihrem Lohn als Kost in ihrer Gewinnrechnung kalkulieren, abgerungen werden. Also verweigerten sie spontan oder auch schon gewerkschaftlich organisiert die Bereitschaft, zu den gegebenen Bedingungen weiterzuarbeiten, um unter möglichst verbesserten wieder anzutreten. Ein paar Jahrzehnte später hat es den Anschein, als sei die Lohnfrage erledigt, als müsste das Proletariat, das jetzt ‚die Arbeitnehmer‘ heißt, nicht mehr um seine Existenz fürchten und kämpfen. Es erfreut sich zahlreicher Anwälte seiner ‚sozialen‘ Belange: anerkannte Gewerkschaften, die tarifvertraglich geregelt für Lohngerechtigkeit sorgen; Betriebsräte mit Mitwirkungsrechten im Unternehmen; Politiker, die dafür sorgen, dass die Marktwirtschaft ‚sozial‘ ausgestaltet wird. Heute ist die Lohnfrage wieder aktuell, weil die Anwender der Arbeitskräfte mit Berufung auf ihre Konkurrenz mehr Arbeit und freiere Verfügung über die Arbeitskraft für weniger Lohn auf die nationale Tagesordnung gesetzt haben. Sie bestehen auf der Unvereinbarkeit von kapitalistischem Wachstumserfolg mit dem Lebensunterhalt seiner Produzenten. Und was macht die malträtierte Klasse? Kommt sie aus gutem Grund auf den Lohnkampf zurück? Auskunft darüber in mehren Artikeln des GegenStandpunkt zu den aktuellen Auseinandersetzungen um Lohn und Leistung.
- Die Botschaft des DGB zum 1. Mai 2007:
Du hast mehr verdient!
– nämlich einen gesetzlich garantierten Mindestlohn von 7 Euro 50 - Eine neue Errungenschaft unserer sozialen Marktwirtschaft: Standortsicherungsverträge – Beschäftigung hat ihren Preis
- Der Fall Telekom: Beschäftigungssicherung als routinemäßige Kampfansage der Konzernleitung an ihre Belegschaft
- „Jobmotor“, „Jobwunder“ Zeitarbeit: Ein großer Schritt weiter in der Ökonomisierung des Personals
- Das Entgeltrahmentarifabkommen (ERA): Noch eine prima Gelegenheit zur Lohndrückerei – sowie für ein gewerkschaftssinnstiftendes Aktionsprogramm erster Güte
- Der Tarifabschluss in der chemischen Industrie: Ein Tarifvertrag ganz nach dem Geschmack des herrschenden ökonomischen Sachverstandes
- Kommentare zum Metall-Abschluss: Noch mehr Konjunktur-Argumente in der Lohndebatte
- Baugewerbe: Wie Gewerkschaft und Unternehmer mit einem Abschluss nach Maß den Flächentarifvertrag retten
Die neuesten Investivlohn-Modelle von SPD und Union: Einfach sensationell!
Der Investivlohn – diese alte Idee von Unionsparteien und SPD
– ist offensichtlich aktueller denn je:
„Merkel mit Blick auf die Globalisierung, auf wachsende Unternehmergewinne und stagnierende Löhne: ‚Diese Idee war vielleicht niemals so zwingend wie heute.‘“ (Spiegel online, 30.6.07) Parteifreund Laumann, Sozialminister in NRW, am gleichen Tag in der SZ: „Die Zeit für eine stärkere Beteiligung der Arbeitnehmer sei ‚überreif‘“, weil „ein Teil des aktuellen Aufschwungs auch durch Lohnzurückhaltung und längere Arbeitszeiten erreicht wurde, nun müsse man die Arbeitnehmer auch an den Erfolgen der Unternehmen beteiligen“. Bei der SPD hat „Kurt Beck ... die Initiative ergriffen und ... das Konzept eines ‚Deutschlandfonds für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer‘ vorgeschlagen.“ – „Die Schere zwischen den unterschiedlichen Einkommensarten wird in Deutschland immer größer ... Das ist ungerecht, unsozial und schwächt unseren Binnenmarkt.“ (spd.de)
Dabei ist es nicht so, dass dann, wenn die Koalitionspartner im Grunde am gleichen Strang ziehen – alle wollen, dass sich die Arbeitnehmer durch Beteiligung am Kapital der Wirtschaft vom Irrwitz
(Mehdorn, Deutsche Bahn) unzumutbarer Lohnforderungen abhalten lassen –, kein Profil der Parteien mehr zu finden bzw. zu entwickeln wäre. Im Gegenteil, auf dieser Grundlage lässt sich keine Partei die Chance entgehen, einen unverwechselbar eigenen Vorschlag zum Irrwitz einer kapitalverträglichen und wirtschaftsfördernden Belohnung des guten Arbeitervolkes vorzulegen. Jeder Politiker rühmt sein Konzept, seine parteispezifische Variante von Betriebs- oder Deutschlandfonds, von steuerlichen Begünstigungsmöglichkeiten und gesetzlichen Regelungsalternativen. Und wenn die Parteivorstände deswegen bis spät in die Nacht zusammensitzen, wird die Kanzlerin gar poetisch: Es ist den Schweiß der Edlen wert, es ist jede Anstrengung wert
. (SZ, 30.6.) Gelungen auch der SPD-Einfall, mit einem Deutschlandfonds an die letztjährige Deutschland-Begeisterung anzuknüpfen und die „Mitarbeiter indirekt (zu) Kapitalbesitzern und Teilhabern der Deutschland AG“ werden zu lassen (NZZ, 30.6.). Es ist sicher nicht ganz unbeabsichtigt, dass darüber die einzig interessante Frage zu einer relativ unwichtigen Nebensache wird: Woher kommt eigentlich das Geld, das da investiert werden soll?
Wird es den Arbeitnehmern vielleicht geschenkt – wie die SPD in ihrem Flugblatt Der Deutschlandfonds: Aufschwung für alle!
(Ende 2006) andeutet? Dort heißt es, dass „das Unternehmen seinen Mitarbeitern Mittel für die Beteiligung am Fonds zur Verfügung (stellt), die nicht vom Lohn oder Gehalt abgezweigt werden“.
Sollen es die Gewerkschaften den Arbeitgebern abhandeln? Vorschlag der SPD vom 27.6.:
„Die Beteiligung am Fonds könne Teil von Tarifverträgen sein, sofern Gewerkschaften und Arbeitgeber das wollten“, und weiter im Kleingedruckten: „Die Mitarbeiter der beteiligten Firmen kaufen Fondsanteile.“
Entstammt es womöglich einer Lohnerhöhung? Die Gewerkschaft Verdi kennt da gleich mehrere Varianten und klärt auf:
„Unterschieden wird zwischen Investivlohn mit und ohne Umverteilung. Ersterer wird zusätzlich zu den in der Regel über Tarifverträge ausgehandelten Barlöhnen zu Lasten der Gewinne gezahlt. Nach einer anderen Variante werden nur Anteile der tarifvertraglich festgelegten Lohnsteigerungen für eine Produktivkapitalbildung in Arbeitnehmerhand umgewandelt.“ (Verdi-b+b.de, Januar 2007)
Man kann sich da offenbar vieles denken. In den einschlägigen Modellen von SPD und Union, in denen die großartige Idee eines Investivlohns nun schön langsam konkrete Gestalt annimmt, ist allerdings von einem gar nicht mehr die Rede: dass die Beschäftigten, in welcher Form auch immer, vom wachsenden Reichtum, den die Unternehmen erwirtschaften, etwas abkriegen. Für das Problem, wie man sie dennoch in den Genuss einer Beteiligung am Erfolg der Wirtschaft kommen lassen kann, visieren die Vordenker in den Parteizentralen offensichtlich eine verblüffend einfache Lösung an: Sie müssen sich ja nur mit einem Teil ihres Einkommens an der Kapitalausstattung der deutschen Wirtschaft bzw. ‚ihres‘ Unternehmens beteiligen! Und schon sind sie beteiligt!
Was die Regierungsparteien nun unter dem Titel ‚Investivlohn‘ ins Spiel bringen, ist eine (gar nicht so) neue Form steuerlich geförderten proletarischen Sparens, worauf die ewig an Geldknappheit laborierenden Arbeitnehmer sicher schon lange gewartet haben. Andererseits, wenn man bedenkt, dass die ja auch nicht zu knappen Einzahlungen, die sie in die staatliche Rentenkasse leisten müssen, schon längst keine Rente mehr ergeben, von der irgendwer leben kann, und sie deswegen am Ende als Sozialfälle dann doch bloß dem Staat zur Last fallen, ist so ein „Investivlohn“ natürlich genau das Richtige für sie – meinen jedenfalls die sozialdemokratischen und christlichen Volksbeglücker, die ihre lohnabhängige Mannschaft mit ein paar steuerlichen Begünstigungen auch noch in dieser Form – zusätzlich zur Riester-Rente – zur Daseinsvorsorge motivieren wollen:
„Konkret schlagen die Sozialdemokraten vor, die Arbeitnehmersparzulage und den Umfang der steuerfreien Vermögensbeteiligung auszudehnen.“ (FTD, 26.6.) „Statt 72 Euro stünden dann jährlich 80 Euro an staatlicher Förderung zur Verfügung.“
Zudem sollen Einkommensgrenzen für die Sparzulagen großzügig angehoben werden. Und auch der bayrische Wirtschaftsminister Huber von der CSU will unsere Vision ..., dass wir aus einstmals abhängig Beschäftigten selbständige Arbeitnehmer und Mitunternehmer machen
(FTD, 29.6.), durch Steuervorteile von wahrhaft visionären Ausmaßen wahr werden lassen. Angedacht ist da etwa die Erhöhung irgendeines Freibetrags von derzeit 135 auf 500 Euro jährlich
. (ebd.)
Ungeachtet dessen, dass die Sache, die man so ‚subventionieren‘ will, immer noch darin besteht, dass die von Lohnarbeit lebenden Arschlöcher der Nation etwas von ihrem Geld aufsparen, sind die Zuständigen in beiden Regierungsparteien zutiefst davon überzeugt, dass sie den Menschen im Lande etwas spendieren. Die SPD tönt ungerührt von einen Aufschwung für alle
, der durch ihren Deutschlandfonds in die Welt kommt: Alle Menschen müssen durch gute Arbeit und gerechte Einkommen am Wohlstand teilhaben.
Die CDU will gewürdigt sehen, dass sie sich noch viel wirksamer für eine Beteiligung der Arbeitnehmer am Erfolg der Unternehmen
stark macht. Wer in dieser Republik Arbeitnehmer ist, kann sogar Mitunternehmer werden, wenn er nur seine Altersrücklagen steuerlich begünstigt in die Wirtschaft investiert! Und vor lauter Begeisterung darüber, dass von der arbeitenden Bevölkerung verdientes Geld dann der Geschäftswelt für ihre Zwecke zur Verfügung steht, scheinen die Vertreter beider Parteien gänzlich sofort wieder aus den Augen zu verlieren, dass man in dieser Angelegenheit doch ausnahmsweise einmal die Interessen des Arbeitsvolks zum Zug kommen lassen wollte – wir erinnern uns noch: wg. Aufschwung war das jetzt fällig! Ein CDU-Politiker, der soeben noch kundgetan hat, dass so ein wichtiges gesellschaftspolitisches Ziel
wie die Kapitalbildung in Arbeitnehmerhand auch ein gewisses fiskalisches Investment (erfordert)
– und damit der SPD in die Parade fährt, die aus höherer Sorge um den Staatshaushalt schon wieder bedauert, dass massive und unkalkulierbare Steuersubventionen den Kern des Unionsmodells darstellen
(FTD, 29.6.) –, will dann doch nicht dafür eintreten und haftbar gemacht werden, dass staatliche Fördermittel einfach für ein soziales Anliegen verpulvert werden. Er schiebt deswegen nach: Die Mitarbeiterbeteiligung ist schließlich auch ein Wachstumsförderungsprogramm.
(FAZ, 27.6.) Und auch in der SPD wechselt man bei der Erläuterung der Vorzüge dieser Form von Geldanlage unversehens in die Perspektive der Unternehmer:
„Der Anlagebetrag bleibt den Unternehmen erhalten. Das verbessert gerade bei kleinen und mittleren Unternehmen die Kreditchancen. Die Anlage steht für Investitionen zur Verfügung.“ (SPD-Flugblatt)
Die lieben Mitarbeiter dürfen mit ihrem Geld also auch noch all die Rationalisierungen mitfinanzieren, mit denen ihre Arbeitgeber ihre Arbeit immer effizienter und ihre Arbeitsplätze unsicher machen. Was sie selber von ihrer Investition in ihre Arbeitgeber haben, ist bei dieser Konstellation naturgemäß nicht so klar ersichtlich. Die Gewerkschaft, die begriffen hat, dass in Zeiten des Investivlohns die Lohnfrage eine Frage lohnender Geldanlage ist, ist jedenfalls eher skeptisch, was die Rendite betrifft. In ihrer Eigenschaft als Finanzberater bezweifelt sie, ob der erzielte Vorteil eines Investivlohns im Vergleich zu anderen Geldanlagen überhaupt vorhanden bzw. nennenswert ist
. (Verdi-b+b) Aber irgendeine Art von Dividende werden die Betriebe ihren neuen Anteilseignern schon zugestehen – solange das Geschäft brummt. Das ist sie dann, ihre Teilhabe am Wirtschaftserfolg. Im Übrigen bleibt es ihnen natürlich wie immer unbenommen, darauf zu setzen, dass alles, was ihrem Betrieb gut tut, ihre Arbeitsplätze sicherer macht.
Bleibt die Frage, was aus ihrem Geld wird, wenn ihr Betrieb Pleite macht. Auch darüber haben sich die Koalitionspartner Gedanken gemacht. In der SPD ist man der Auffassung, dass die Vorschläge der Union, denen zufolge die Arbeitnehmer ihr Geld in das Unternehmen ihres eigenen Arbeitgebers stecken sollen, hier den entscheidenden Mangel haben:
„Sie belassen das Hauptrisiko beim Arbeitnehmer ... Im Falle der Insolvenz verliere dieser nicht nur seinen Arbeitsplatz, sondern auch seine Einlage.“ (SPD-Generalsekretär Heil, SZ, 30.6.)
Deswegen favorisiert die SPD ihren Deutschlandfonds, in den im nationalen Maßstab alle zur Investition von Lohngeldern bereiten Arbeitnehmer einzahlen, und der seinerseits dann die Wirtschaft mit günstigen Krediten versorgt. Bei dieser Konstruktion bleibt der Arbeitnehmer, wenn wir die Auskünfte der SPD richtig verstanden haben, nämlich nur auf ein paar unerheblichen Nebenrisiken sitzen: Im Falle der Insolvenz seines Arbeitgebers verliert er seine Einlage nicht gleich ganz, sondern nur in dem Maße, in dem die Pleite das Fondsvermögen insgesamt mindert und damit auch die von ihm erworbenen Fondsanteile entwertet. Dafür trägt er als Anteilseigner des Fonds aber auch den Verlust mit, den jede andere Firmenpleite am Fondsvermögen anrichtet.
In der Union hält man dieses Konzept für die Ausgeburt einer in typisch sozialdemokratischer Weise fehlgeleiteten Politik: Der SPD-Vorschlag folge lediglich dem verteilungspolitischen Ziel, den Arbeitnehmern Kapitaleinkünfte zu verschaffen.
(FAZ, 27.6.) – auch ein gelungener Vorwurf, mitten in einer Kontroverse darüber, wie man die Kapitalbildung in Arbeitnehmerhand befördern kann! Die Christdemokraten vertreten in dieser Frage den übersichtlichen Standpunkt, dass alles von Übel ist, was der freien Verfügung der Unternehmer über die angelegten Arbeitnehmergelder abträglich sein könnte. Sie sind deswegen schon mal grundsätzlich gegen jede Fondsverwaltung: Nicht auszudenken, wenn die in fremde Hände geriete, wenn sich z. B. Politiker der entsprechenden Posten bemächtigen, um Investitionsentscheidungen beeinflussen zu können
; oder gar die Gewerkschaften – CSU-Landesgruppenchef Ramsauer sieht sich bereits entsprechend herausgefordert und meint unbedingt verhindern zu müssen, dass ein Fonds unter der Herrschaft der Gewerkschaft entsteht
. Es wäre für ihn und seine Parteifreunde offenbar der GAU, wenn über die Verwendung der von den Arbeitnehmern eingezahlten Gelder die Arbeitnehmervertretung mitzuentscheiden hätte. Wenn die Gelder erst einmal von einem Fonds verwaltet werden, ist das zudem absehbarerweise mit bürokratischem und finanziellem Aufwand verbunden – alles völlig unnötig nach christlich-sozialer Auffassung, wo doch die Unternehmer ganz unbürokratisch für den zweckdienlichen Einsatz dieser Finanzmittel sorgen würden. Hier, wie auch in der Frage der Insolvenzsicherung, trifft die Union ganz den Nerv der Wirtschaft:
„Positiv ist zudem zu bewerten, dass die Union keinen gesetzlichen Handlungsbedarf zur Insolvenzsicherung sieht.“ (DIHK-Hauptgeschäftsfährer Wansleben, FTD, 29.6.)
„Richtig ist auch, dass von gesetzlichen Regelungen zur Insolvenzsicherung abgesehen werden soll.“ (Arbeitgeberpräsident Hundt, FTD, 29.6.)
Man ist entschieden gegen jede Art von Sicherstellung der investierten Arbeitnehmergelder gegen den Verlust bei Insolvenz. Und zwar nicht bloß deswegen, weil für den Zweck ja auch nur – schon wieder völlig überflüssigerweise – Geld gebunden würde, das nicht für Investitionen zur Verfügung stünde. Man hält eine Minderung des Risikos für die Arbeitnehmer überhaupt für kontraproduktiv, im Hinblick auf die Funktion nämlich, die Christ- und Sozialdemokraten gleichermaßen mit ihrem Projekt einer Mitarbeiterbeteiligung verbinden und in der für sie zusehends auch der ganze Sinn einer solchen Beteiligung zu bestehen scheint: Wer die Mitarbeiter motivieren will, kommt ohne dieses Risiko nicht aus.
(der Mittelstandsbeauftragte der Bundesregierung, Hartmut Schauerte von der CDU, FAZ, 28.6.) Gemeinsam mit den Vertretern der Wirtschaft begeistert man sich mehr oder weniger hemmungslos für die Vorstellung, dass die Beschäftigten über das Geld, das sie in ihren Betrieb gesteckt haben, gewissermaßen schicksalhaft und auf Gedeih und Verderb mit ihrem Betrieb verbunden sind und dies zur neuen Quelle von Einsatzbereitschaft werden könnte. Die politische Konkurrenz dreht sich so schon längst um nichts anderes mehr als um die Frage, durch wessen Konzept die Bindung der Arbeitnehmer an den Betrieb
mehr befördert wird. Bei der SPD legt der Deutschlandfonds die gesammelte Anlagesumme der Mitarbeiter eines Unternehmens in diesem Unternehmen an
, dies ergibt eine Anlageform, mit der sie stärker an Wachstum und Erfolg ihres Unternehmens teilhaben. Das stärkt auch die Verbundenheit mit dem Betrieb.
Die Unionisten dagegen vertreten die Auffassung, dass Arbeitnehmer es bevorzugten, ins eigene Unternehmen zu investieren, anstatt in einen anonymen Fonds. Das schafft eine ganz andere Motivation und Bindung an den eigenen Betrieb
. (Stoiber, SZ, 30.6.) Da kann man sich kaum entscheiden: entweder für eine extra Portion Bindung an den Betrieb in einer Zeit, in der die meisten Arbeitnehmer von einem Arbeitsplatz, der für ein paar Jahre sicher wäre, nur träumen können, oder für mehr Verbundenheit mit einem Betrieb, der sich seinerseits natürlich gar nicht binden lässt. Wo die Betriebe ihre Belegschaften ständig umstrukturieren, ausdünnen, wieder ergänzen; wo sie massenhaft Frist- und Zeitarbeiter einsetzen und ihre Belegschaften durch Angebote wie entweder ihr arbeitet 20 % mehr oder ihr könnt gehen
motivieren; wo von ihrer Seite alle Bindung aufgelöst wird, alle Lohn- und Arbeitsbedingungen flexibilisiert werden und die Arbeiterexistenz darüber zum Spielball all der betrieblichen Umwälzungen wird, die die Gewinnrechnungen konkurrierender Unternehmen so gebieten, da können die Belegschaften gar nicht fest genug zu ihrem Betrieb stehen. Diese Verbundenheit soll das Geld bitte schön auch noch bewirken, das die Arbeitnehmer ihren Arbeitgebern zur Verfügung stellen sollen.
Arbeiter brauchen eine Gewerkschaft (1):
Ein schönes Streikergebnis für die Telekom-Beschäftigten – Unternehmenserfolg auf der ganzen Linie!
Am Ende muss Telekom-Chef Obermann seine Drohung doch nicht wahr machen, auch ohne Zustimmung der Gewerkschaft
mehr als 50 000 Beschäftigte zum 1. Juli 2007 kurzerhand in die drei geplanten Servicegesellschaften auszugliedern und ihnen auf diese Weise längere Arbeitszeiten und weniger Lohn schlicht aufzuoktroyieren [1] – eine Kampfansage, die Verdi mit Streik beantwortet, wenn es sein muss, bis zum September
, wie die Organisation verlauten lässt. Das eine wie das andere ist dann doch nicht nötig. Man einigt sich nach einigen Wochen Streik rechtzeitig vor dem Juli-Termin auf Folgendes:
- Die Wochenarbeitszeit in den neuen Service-Gesellschaften wird wie verlangt von 34 auf 38 Stunden verlängert, der Samstag – mit gewissen Einschränkungen – als Regelarbeitstag wieder eingeführt.
- Gleichzeitig wird der Lohn gesenkt – statt der ursprünglich angestrebten 12 % um 6,5 % ab Ende 2008 über zweieinhalb Jahre verteilt und bei den schon Beschäftigten – zur „Besitzstandswahrung“ – mit eventuellen Tariferhöhungen verrechnet. Für dieses Zugeständnis lässt sich die Telekom mit anderen Formen von Lohnsenkung entschädigen: Bis Ende 2008 wird der Lohn eingefroren; durch die Neuregelung der Arbeitszeit spart das Unternehmen Überstundenzahlungen; und außerdem wird der leistungsabhängige Anteil des Entgelts in den neuen Untergesellschaften erhöht; die dabei ausgehandelten Grenzen für Lohnminderungen sprechen Bände – nach drei Jahren soll dieser 15, später 20 %ige leistungsabhängige Anteil vom Gesamtlohn je nach ‚Leistung‘ bis auf die Hälfte gesenkt werden können – summa summarum also ein Freibrief zur zusätzlichen Einsparung von bis zu 10 % des Gesamtlohns.
- Die Einstiegsgehälter für Neubeschäftigte im Gesamtunternehmen werden – wie von der Telekom verlangt – um über 40 % gesenkt. Dafür verspricht das Unternehmen der Gewerkschaft, 4000 Auszubildende in den nächsten Jahren ordentlich zu übernehmen und dafür Leiharbeit abzubauen. Kunststück, bei dem selber produzierten Billigangebot!
- Das Versprechen, auf betriebsbedingte Kündigungen zu verzichten, wird von 2010 auf 2012 verlängert, die neu gegründeten Servicegesellschaften können aber schon ab 2010 verkauft werden – Siemens/Benq lässt grüßen.
Für zwei Jahre ohne betriebsbedingte Kündigungen – falls nichts dazwischen kommt – und für ein paar geänderte Modalitäten der Lohnsenkung zahlen die Beschäftigten also den Preis, den das Unternehmen zur Sicherung seiner Konkurrenzfähigkeit für nötig hält. Kurz: Mit dem wochenlangen Streik „erkämpft“ Verdi ziemlich genau das, was die Telekom von ihren Beschäftigten „erzwingen“ wollte. Soweit die Sache.
*
Für das Schönreden des Ergebnisses braucht man schon eine gewerkschaftliche Schulung. Mit der hört sich das so an: Wenn die Löhne vertraglich bis Ende 2008 festgeschrieben und danach in festgelegten Stufen gesenkt werden, dann haben sich, recht besehen, umgekehrt die Beschäftigten die Freiheit gesichert, schon ganz bald für sich tariflich wieder etwas rauszuschlagen: Zum 31.12.2008 sind die vereinbarten Entgelttarifverträge kündbar. Damit steht fest, dass schon ab diesem Zeitpunkt mit aktiver Tarif- und Entgeltpolitik die Möglichkeiten zu Entgelterhöhungen bestehen
. (Verdi, Tarifinfo 21 vom 20.6.) Und wenn die möglichen Lohnerhöhungen künftiger Tarifrunden vorweg für die sicher vereinbarten Verluste verpfändet werden, kann von Lohnsenkung laut den gewerkschaftlichen Rechenkünstlern nicht mehr die Rede sein; dann handelt es sich eindeutig um einen Kompromiss
, der beiden Seiten etwas bringt: Für die Telekom liegt der Vorteil darin, dass die Lohnverlaufsbahn flacher wird, und für die Beschäftigten liegt er darin, dass die Löhne stabil bleiben.
(Verdi-Bundesvorstand Schröder gegenüber dpa, 21.6.) Es handelt sich also insgesamt um ein, sicher, nicht gerade strahlendes, aber angesichts der unternehmerischen Drohungen doch mehr als passables Ergebnis; etwas komplizierter
vielleicht – als wäre das Resultat all der Rechenkunststücke nicht klar ersichtlich: einige Stunden länger arbeiten für entschieden weniger Geld! –, aber aufs Ganze gesehen doch eindeutig eine Tarifregelung, die über mehrere zusammenwirkende Mechanismen die Einkommen der Beschäftigten sichert. Eins steht fest
, nämlich das Gegenteil dessen, was garantiert feststeht: Die von ver.di durchgesetzten Regelungen schützen die vorhandenen Beschäftigten vor Einkommenseinbußen – und die von der Telekom beabsichtigte Absenkung der vorhandenen Einkommen gepaart mit Nullrunden, ist vom Tisch!
(Verdi, Tarifinfo 22 vom 22.6.) Egal, wie katastrophal das gewerkschaftlich ausgehandelte Tarifergebnis für die davon Betroffenen auch ist, die Verantwortlichen schaffen es eben immer noch mühelos, daraus einen gewerkschaftlichen Erfolg zu machen, nach dem Motto: Dafür haben wir gekämpft
(Tarifinfo 22), also geht auch alles in Ordnung, wofür wir unsere Mitglieder haben antreten lassen!
Auch die radikal gekürzten Einstiegsgehälter haben im Übrigen den ‚Kampf‘ gelohnt: Die neuen Entgelttabellen ... verhindern Armutslöhne und halten jedwedem Branchenvergleich stand.
(Tarifinfo 21) Eine bestechende Logik! Von ‚Armut‘ kann keine Rede sein – verräterisch immerhin, woran die gewerkschaftliche Vertretung hier wie selbstverständlich Maß nimmt –, wo doch andere – nicht zuletzt dank der Gewerkschaft – ebenso schlecht bezahlt werden. Verdi lässt sich darauf ein, dass die Einstiegslöhne und damit das ganze künftige Lohnniveau mit einem Schlag um über 40 % auf das niedrigste Branchenniveau abgesenkt werden, und schon ist dieses Niveau das neue, verträgliche Normalmaß, unterhalb dessen erst ‚Armutslöhne‘ beginnen – hätte sie sonst zugestimmt? So umstandslos werden auch für die Gewerkschaft aus den bisherigen Löhnen unhaltbare Privilegien aus der Vorzeit eines Staatsbetriebs.
*
Damit befindet sie sich in bester Gesellschaft. Die öffentlichen Kommentatoren finden nämlich schon längst, dass mit dem teuer bezahlten alten Trott
(FAZ, 21.06.) Schluss gemacht gehört. Allerdings will der FAZ-Schreiber, stellvertretend für die Mehrheit seiner Zunft, unbedingt noch öffentlich nachreichen, dass die Gewerkschaft mit ihrem Nachgeben gegenüber den unternehmerischen Forderungen eine Niederlage
erlitten hat – und zwar eine höchst verdiente. Gescheitert ist sie an der Realität
, ein Gütesiegel, das selbstverständlich nur dem Gewinninteresse der Unternehmer im Unterschied zum Geldbedarf der Proleten zukommt und das jeden noch so matten Einwand der Gewerkschaft als fehlenden Realitätssinn entlarvt, der sich am Ende zurecht an den unausweichlichen ‚Gegebenheiten‘ blamiert. Die Einschnitte in Sachen Lohn und Leistung verdanken sich also weder der Kompromisslosigkeit der Firmenleitung bei ihrem Programm, durch die radikale Verbilligung der Arbeitskosten Konkurrenten aus dem Feld zu schlagen, noch der Bereitwilligkeit, mit der Verdi das erfolgreich betätigte Gewinninteresse als Bedingung und gültigen Maßstab dafür akzeptiert, was die Belegschaft an Arbeitsanforderungen auszuhalten, was an Lohnansprüchen zurückzunehmen hat. Zu hohe Löhne
müssen einfach weg. Weil das Ergebnis des Tarifkampfs dem Mann von der antigewerkschaftlichen Schreibfront ausnehmend gut gefällt, erklärt er es für unwidersprechlich und vernünftig, was es ja nun vom Standpunkt des Unternehmens in der Tat ist. Stellt sich nur noch die Frage, warum sich die Gewerkschaft eigentlich nicht gleich und ohne weitere Umstände den Plänen der Telekom gebeugt hat, wo Sträuben doch falsch und völlig nutzlos ist und man sich damit nur in der Öffentlichkeit unbeliebt macht. Klar, aus reiner Uneinsichtigkeit hat sich die Verdi-Führung viel zu spät dieser Realität gebeugt
und dadurch hohe Erwartungen geweckt, die das Ergebnis nicht erfüllt
. Hämisch prophezeit ihr die FAZ als Quittung dafür den weiteren Verlust von Mitgliedern. Die Arbeitervertretung hätte eben ihren Mitgliedern gleich das unternehmerisch Verlangte, also für sie Verbindliche klar und deutlich mitteilen und diktieren sollen. Einem solchen Anspruch, noch bei den härtesten Einschnitten widerspruchslos und ohne Umschweife als Sprachrohr, Erfüllungsgehilfe und Disziplinierungsinstrument der Gegenseite zu fungieren, kann allerdings keine Gewerkschaft genügen, nicht einmal die moderne Dienstleistungsgewerkschaft mit Kleinschreibung und Punkt im Logo, die dem Bedarf nach freiem unternehmerischen Umgang mit den Arbeitskräften auf ihre Weise nun wirklich in jedem Sinne recht gibt.
Andere öffentliche Stimmen zeigen dagegen – angesichts des Ausgangs höchst zufrieden – durchaus ein gewisses Verständnis für die gewerkschaftlichen Nöte mit dem, was nun einmal sein muss. Die Süddeutsche Zeitung entdeckt da sogar einen tieferen Sinn in dem mehrwöchigen Streik. Er war nötig, also auch nur gut dafür, die Betroffenen an die – für sie, natürlich, harte, aber unausweichliche – ‚Realität‘ zu gewöhnen: Angesichts der fundamentalen Umstrukturierungen und der tiefen Einschnitte bei dem ehemaligen Staatsbetrieb ließ sich eine solche Konsequenz nicht auf die Schnelle verhandeln; sie musste im Prozess wachsen. So bitter es für den einzelnen Mitarbeiter ist: Die alten, guten Zeiten gibt es nicht mehr und wird es nie wieder geben; viele bei der Telekom müssen das erst mühsam lernen.
(SZ, 21.6.) – wohingegen der Schreiber von der SZ natürlich gleich gewusst hat, dass die Telekom nur als Global Player und als solcher selbstverständlich nur mit rücksichtslosen Lohnkostensenkungen in die moderne Zeit passt. Ein Arbeitskampf als erfolgreicher Lernprozess, als Hilfsmittel, um den Betroffenen die Unvermeidlichkeit ihrer Verarmung beizubringen und alle Einsprüche abzugewöhnen – so zynisch ergreift das liberale Weltblatt für gewerkschaftliche Vertretung Partei! Schlimm, dass es damit nicht einmal unrecht hat!
Arbeiter brauchen eine Gewerkschaft (2):
Die unendliche Geschichte der Bau-Tarifrunde: Die Unternehmer streiten über ihre Billiglohnkonkurrenz – die IG Bau macht immer neue Angebote
Zum zweiten Mal platzt die Tarifübereinkunft in der Baubranche. Nachdem die IG-Bau im Verlauf der Tarifrunde den Unternehmern weitere Zugeständnisse hinsichtlich der ohnehin niedrigen Lohnerhöhung nachgereicht hat – ‚notleidende‘ Betriebe können den Lohn um bis zu 8 % unter das Tarifniveau senken [2] – und ein Abschluss greifbar schien, kommt es doch noch zum ersten unbefristeten Streik seit 5 Jahren
. Nicht, weil die Lohnempfänger am Ende das katastrophale Ergebnis ablehnen und Nachbesserung fordern. Um die Durchsetzung von mehr Lohn, damit auch die Arbeitnehmer ihren Anteil am Aufschwung erhalten
, geht es nicht. Wie schon im März sind es auch diesmal wieder die Unternehmer, die auf ihre besonders kritische wirtschaftliche Lage
verweisen. Damit sie ihren „Anteil am Aufschwung“ nicht verpassen – die Konjunktur entwickelt sich nicht für alle Betriebe gleichermaßen positiv
–, verweigern die Unternehmerverbände Niedersachsens und Schleswig-Holsteins die Zustimmung und fordern neuerlich Nachbesserungen. Sie verweisen auf die Nähe zu den Ostgebieten mit deren niedrigerem Lohnniveau, den Konkurrenzdruck durch die vielen nicht tarifgebundenen Betriebe und ein regional geringeres Wachstum – und fordern für ihre Tarifbezirke Sonderregelungen bei der Umsetzung der Öffnungsklausel: Es fehlt eine eindeutige Erklärung der Gewerkschaft für die verbindliche Anwendung der Öffnungsklausel.
(Die Baustelle, Organ des Baugewerbeverbandes Niedersachsen, Juni 2007) Die Absenkung der Löhne soll ganz ohne Abstimmung mit der Gewerkschaft nur nach unternehmerischem Ermessen erlaubt sein. Unternehmer, die mit ihrem Kommando über die Arbeitsplätze laufend das Verhältnis von Lohn und Leistung gewinnsteigernd verändern, fordern Kompensation für Konkurrenzfortschritte, die in ihrer Branche darüber gewöhnlich geworden sind: Sie führen die verbreiteten elenden Lohnverhältnisse ins Feld, präsentieren sich als deren Opfer und verlangen wie selbstverständlich noch mehr Freiheit, den Lohn zu drücken. Also neuerlich: Tarifforderung seitenverkehrt!
Das geht der Gewerkschaft dann doch zu weit:
„Die Unternehmer des Baugewerbes in beiden Bundesländern wollten betriebliche Abweichungen patriarchalisch – ohne Beteiligung der Tarifparteien – ermöglichen. Das können wir nicht zulassen.“ (IG-Bau-Chef Wiesehügel, Junge Welt, 22.6.)
Lohnsenken – ja bitte; aber soviel gewerkschaftliche Vertretung muss sein, dass bei den zugestandenen unternehmerischen Freiheiten noch die Arbeiterorganisation konsultiert wird; zwar nicht immer und überall, aber jedenfalls im Prinzip, wie der IG-Bau-Vorsitzende einschränkend erläutert: Wir können schon deshalb keine Sonderregel für ein Gebiet erlauben, weil die anderen Länder dies dann ebenfalls wollen.
(Handelsblatt, 18.6.) Als regionale Ausnahme, da könnte er sich diese Erlaubnis zu ‚patriarchalischen‘ Lohnsenkungen dann doch vorstellen, aber dabei bleibt es eben nicht, und damit wäre die Mitzuständigkeit der Gewerkschaft bei diesem Geschäft ganz generell in Frage gestellt. Wenn es um ihre eigene Mitbestimmung geht, fällt Gewerkschaftsoberen glatt einmal ein, was sie sonst nicht wissen wollen: dass ausnahmsweise gewerkschaftliche Zugeständnisse an Unternehmer nie solche sind und bleiben, sondern zur beanspruchten Regel werden. Das, so die Gewerkschaftsführung, soll diesmal auf keinen Fall sein; bei allem Verständnis für die Konkurrenznöte der Arbeitgeberschaft, bei der Aushebelung des allgemeinen Lohntarifs soll dann doch eine bundesweit einheitliche Tarifregelung gelten. Dafür lohnt sich dann auch ein Streik.
*
Nach etwas mehr als zwei Wochen Arbeitskampf und einem Verhandlungsmarathon
kommt es neuerlich, also zum dritten Mal in der Tarifrunde zum Durchbruch
. Wieder nach bewährtem Muster: Damit die beiden Unternehmerverbände zustimmen, macht die IG Bau ein weiteres Zugeständnis und konzediert der Gegenseite genau das, was sie vorher als „patriarchalisch“ gebrandmarkt hat:
„Arbeitgeber und Gewerkschaft verständigen sich darauf, in welchen Betrieben die Absenkung gleichsam automatisch erfolgen kann und in welchen Unternehmen darüber noch mit dem Betriebsrat verhandelt werden muss.“ (FAZ, 6.7.)
So verhindert die Gewerkschaft wieder einmal, dass das gesamte Tarifwerk am Bau zerbricht
(Handelsblatt, 18.6.), indem sie Lohnsenkungen in den Betrieben, in denen ohnehin miserabel verdient wird, noch mehr ins Belieben der Unternehmer stellt.
Freilich, sie kann auch einen Erfolg verbuchen: Die Einigung mit den beiden Unternehmerverbänden sieht vor, dass die bei der Bundesregierung zu beantragende Erhöhung des Mindestlohns früher erfolgen und stärker ausfallen soll, als bisher im Tarifvertragsvorschlag des Schlichters vorgesehen. Dieser magere Fortschritt – ein Dokument, wie es um die Lohnverhältnisse steht, die zwischen Gewerkschaft und Unternehmerschaft zu regeln sind – kommt allerdings nicht deswegen zustande, weil die Gewerkschaft diese Aufbesserung für die Schlechtestgestellten fordert und durchsetzt. Es sind die norddeutschen Unternehmerverbände selber, die darauf bestehen, beim Mindestlohn nachzubessern; sie zielen damit auf eine Schlechterstellung ihrer Billiglohn-Konkurrenten; denn gemäß Entsendegesetz wird der tariflich vereinbarte Mindestlohn branchenweit verallgemeinert, so dass auch die nicht im Arbeitgeberverband organisierten Betriebe von Lohnerhöhungen betroffen werden:
„Durch die vorgezogene und kräftigere Anhebung des Mindestlohns auf 13 Euro soll die Konkurrenzsituation zwischen tariffreien und tarifgebundenen Betrieben schneller entschärft werden.“ (FAZ, 6.7.)
Dieses hartnäckig vertretene unternehmerische Konkurrenzinteresse beschert den absoluten Niedriglöhnern die unverhoffte Aussicht auf einen gar nicht beantragten Nachschlag. Als Hilfestellung im Kampf um die niedrigsten Lohnkosten macht die Gewerkschaft ihren neuen Schützlingen dafür im Gegenzug ein weiteres Zugeständnis. Bis die neue Mindestlohnregelung greift, sollen Betriebe, die kurzarbeiten oder in einem anderen kritischen Konkurrenzverhältnis stehen
(FAZ, 6.7.), die Löhne ihrer Mitarbeiter schon mal um 1,4 % kürzen dürfen.
Hier geht es also um mehr Lohngerechtigkeit
einmal ganz anders – um Waffengleichheit der Unternehmer in Sachen Lohndrückerei. Unternehmerfraktionen melden ihren Bedarf nach einem Tarifvertrag an, der genau auf ihre jeweiligen Bedürfnisse abgestellt ist, und die Gewerkschaft trägt dem Rechnung, damit tarifgebundene Unternehmen keinen ungebührlichen Konkurrenznachteil aushalten müssen – so sieht sie das nämlich auch. Sie vertritt die Auffassung, dass die nationale Bauindustrie, wo nötig, sich insbesondere gegen auswärtige und interne Billigkonkurrenz besser behaupten können muss; und ‚gegen‘ heißt eben genau genommen: in dieser Konkurrenz. Vom Standpunkt aus, dass die nationale Bauindustrie insgesamt erfolgreich konkurrieren können muss – es geht schließlich um „Arbeitsplätze in Deutschland“ – lässt sie sich die Ansprüche der feindlichen Brüder in Sachen Lohnkosten einleuchten: Die Löhne senken, immer wenn es erforderlich ist, und zugleich nach Unternehmerbedarf gewisse Schranken gegen unliebsame Konkurrenten einziehen – dieses Programm führt dann glatt zu einem Euro mehr am unteren Ende der Lohnskala. Sozusagen als Gratisgabe dafür, dass die IG Bau auf der anderen Seite bereitwillig den Tariflohn um etliches mehr nach unten öffnet.
So wird das Einkommen der am Bau Beschäftigten als pure Manövriermasse unternehmerischer Kalkulationen mit niedrigen Lohnkosten verhandelt und die Gewerkschaft zum Adressaten der verschiedenen Fraktionen aus dem Unternehmerlager, die das gewerkschaftliche Interesse am Fortbestand eines Flächentarifvertrags jeweils für sich nutzen wollen. Der Verband der Bauindustrie – Vertreter der großen Baufirmen – bricht während des Arbeitskampfs deswegen eine Lanze für dieses Gewerkschaftsanliegen:
„Der Flächentarifvertrag ist eine große Errungenschaft. Wenn künftig dazu übergegangen würde, mit einzelnen Unternehmen Tarifverträge abzuschließen, wäre dies ein fürchterliches Ergebnis ... Wenn das Prinzip des Flächentarifvertrags aufgegeben würde, wäre der Baumarkt nicht mehr handhabbar.“ (Pr-inside, 7.7.)
Der Hauptgeschäftsführer des Baugewerbeverbandes Niedersachsen dagegen deckt prompt das Konkurrenzinteresse auf, das dahinter steckt, beschuldigt die Gewerkschaft der Kumpanei mit den Großunternehmern – ‚Die Gewerkschaft führt den Kampf der Bauindustrie.‘ Die großen Konzerne wollten vor allem bundesweit einheitliche Standards und Ruhe im Haus. Lohnprobleme würden sie auf die Subunternehmer abwälzen.
(FR, 9.7.) – und meldet eigenen Bedarf an: Warum streikt die Gewerkschaft nicht gegen Billiglöhner?
(Die Baustelle, Sonderausgabe Juni 07)
*
Die gewerkschaftliche Anpassungsbereitschaft – diesmal an die besondere Interessenlage der norddeutschen Handwerksbetriebe – hilft dann doch wieder nichts. Kaum hat sich die Gewerkschaft glücklich mit deren Verbänden auf besagte Korrekturen geeinigt, die sowohl dem Bedürfnis des Zentralverbands und der Bauindustrie nach einem allgemeinen Tarifvertrag wie dem Sonderbedarf der norddeutschen ‚Mittelständler‘ Rechnung tragen sollen, kommen neue Unternehmereinwände von anderer Seite – gegen den viel zu hohen Mindestlohn. Da hätten ja jetzt wiederum sie einen nicht hinnehmbaren Konkurrenznachteil!
Der Zentralverband lehnt die Einigung mit dem Hinweis ab, dass viele Betriebe anders mit Mindestlöhnen und der tariffreien Konkurrenz kalkulieren und die Vorkehrungen gegen unliebsame Billigkonkurrenz sie selber zu teuer kommt:
„Skeptiker verweisen darauf, dass bei einer Erhöhung des Mindestlohns auch die Personalkosten von tarifgebundenen Betrieben steigen würden. Insgesamt erhalten etwa 20 % der Beschäftigten einen Mindestlohn, heißt es beim ZDB.“ (FR, 18.7.); insbesondere Landesverbände aus dem Osten melden ihre Vorbehalte an und verweigern die Zustimmung: „Die festgeschriebene Erhöhung des Mindestlohns West von 2008 an auf bis zu 13,80 müssen auch Ost-Firmen zahlen, wenn sie im Westen Aufträge übernehmen. Die Ost-Arbeitgeber sehen darin eine Abschottung des westdeutschen Marktes gegenüber den ostdeutschen Firmen. Im Osten gilt ab September ein Mindestlohn für Qualifizierte von 9,80 Euro pro Stunde.“(Freie Presse Sachsen, 18.7.)
So erfährt man wieder einmal, wie weit es die Branche auch mit Tarifbindung in Sachen Lohndrückerei schon gebracht hat.
Jetzt wird neuerlich um einen Abschluss gerungen. Also alles in allem ein ‚Tarifritual‘ eigener Art: Unternehmer rechten um Bedingungen für ihre Billiglohnkonkurrenz, setzen laufend Neuverhandlungen durch, erobern sich immer neue gewerkschaftliche Zugeständnisse – und sind darüber nicht zufrieden gestellt, sondern streiten sich in aller Freiheit weiter, ob sie sich mit ihren gegensätzlichen Ansprüchen noch auf ein allgemeines Ergebnis verständigen können. Die Gewerkschaft, die seit Monaten den immer neuen Ansprüchen hinterher hechelt, darf abwarten und hoffen, dass sich die Streitenden im Unternehmerlager zu guter Letzt irgendwann zu einer Unterschrift bequemen.
Und die IG Bau macht das auch. Sie wartet:
„Nach 5 Monaten Tarifverhandlungen und vier Wochen erfolgreichem Streik ist die Tarifrunde 2007 im Baugewerbe immer noch nicht zu Ende ... Die Arbeitgeberverbände können sich bundesweit nicht einigen und brauchen erneut Zeit. Ob sie sich einigen können, steht bislang in den Sternen!“ (Flugblatt der IG-Bau, 18.7)
Sie gibt den Unternehmern Zeit und mahnt nach einem Monat mal wieder eine Entscheidung an:
„‚Es wird immer schwerer, diesen Tarifstreit nach innen und außen begreiflich zu machen. Mit dem Hin und Her muss jetzt Schluss sein‘, fasste IG Bau-Vorsitzender Wiesehügel die Stimmungslage zusammen.“ Sie leistet Entscheidungshilfe: „Die Tarifkommission hat sich dafür ausgesprochen, dass die IG Bau ihre Zustimmung zu dem zuletzt gefundenen Lösungsvorschlag signalisiert für den Fall, dass die Arbeitgeber diesen zuvor schriftlich verbindlich für das gesamte Bundesgebiet angenommen haben.“ (IG Bauen Agrar Umwelt, Onlineausgabe, 4.8.)
Und sie findet es insgesamt ziemlich unmöglich, dass der Unternehmerverband seine Mitglieder nicht so im Griff hat wie sie die ihren. Denen kann sie jedes Tarifergebnis zumuten, das sie aushandelt; die legen sich jedenfalls nicht quer, wenn ihr Normallohnniveau weiter herabgedrückt wird, irgendwohin in die Nähe des Mindestlohns mit betriebsgerechten Schwankungen nach unten und oben.
*
Ganz am Ende wird dann doch noch alles gut. Die norddeutschen Bauunternehmen behalten ihre Vorzugskonditionen beim Lohnsenken, sie verzichten dafür aber großmütig auf die mit der Gewerkschaft ausgehandelte, aber im eigenen Lager umstrittene vorzeitige und größere Erhöhung des Mindestlohns – die Gewerkschaft verzichtet selbstverständlich umstandslos mit; und so einigen sich die Unternehmer endlich auf eine gemeinsame Zustimmung zu diesem Vertragswerk; sogar, wie von der Gewerkschaft verlangt, schriftlich, so dass die IG Bau mit ihrer unentwegt signalisierten Zustimmung nicht noch einmal blamiert dasteht. Die Arbeitervertretung atmet – ehrlich erleichtert – auf:
„Eine lange Tarifrunde, die uns viel Schweiß gekostet hat, geht zu Ende. Aber wir haben es noch einmal geschafft, den Flächentarifvertrag und damit bundesweit geregelte Arbeitsbedingungen am Bau zu erhalten.“ (Wiesehügel, IG Bau online, 20.8.07).
*
Arbeiter brauchen eine Gewerkschaft. Wozu eigentlich? Die Unternehmer wissen jedenfalls, wie sie diese Gewerkschaft gebrauchen können.
Die ‚Lokführergewerkschaft‘ kämpft um mehr Lohn und bessere Arbeitsbedingungen – Die ganze Republik steht Kopf: Dürfen die das? – Bahn AG und Bahngewerkschaften sind sich einig: So nicht!
Was dürfen Gewerkschaften fordern, wie ihre Forderungen vertreten und wie weit mit ihren Streikdrohungen gehen? Wo endet die Erlaubnis zum Arbeitskampf? Und wie soll überhaupt eine ordentliche Arbeitervertretung organisiert sein? Sind Einheitsgewerkschaften nach Art der DGB-Gewerkschaften das Rechte, oder können und sollen konkurrierende Berufsgewerkschaften eine nützliche Rolle spielen? Grundsatzfragen dieses Kalibers bewegen diesen Sommer die deutsche Öffentlichkeit. Mit Berufung auf höchste Rechtsgüter und gültige Sitten in der deutschen Arbeitswelt verbreiten sich Journalisten, Juristen und Politiker öffentlich darüber, wie eine Interessenvertretung der Lohnabhängigen generell auszusehen hat, die in die wirtschaftliche, soziale, rechtliche und politische Landschaft passt. Die maßgebliche Welt sieht sich aufgerufen, die Maßstäbe zu diskutieren, an denen sich hierzulande die Anliegen der arbeitenden Menschheit zu orientieren haben, und damit in Erinnerung zu bringen, dass die Vertretung von Arbeiterinteressen grundsätzlich eine Sache der Genehmigung ist, über die vom Standpunkt des großen Ganzen und keinesfalls vom parteilichen Standpunkt der Betroffenen aus entschieden wird.
Was ist geschehen? Eigentlich nichts Besonderes: Eine kleine Gewerkschaft, die ‚Gewerkschaft der Lokführer‘ (GDL), Vertretung des Fahrpersonals bei der Bahn, stellt Forderungen nach mehr Lohn und besseren Arbeitsbedingungen und macht Anstalten, die auch durchzusetzen. Damit ruft sie alle ehrenwerten Instanzen der Nation auf den Plan. Der Lohnkampf der GDL gerät zu einem Lehrstück: über die Anspruchshaltung, mit der hierzulande dem Ansinnen von Arbeitnehmern, ihre Einkommenslage und die Leistungsanforderungen zu ihren Gunsten zu korrigieren, begegnet wird; über die Mittel mit denen dies Ansinnen bekämpft wird; also darüber, wie unverträglich diese Anliegen der Beschäftigten mit den hierzulande gültigen Interessen sind.
Ein ganz normaler Lohnkampf – eine Ausnahme in diesem Land!
Der Hauptvorstand der GDL zieht Bilanz und beschließt, dass es reicht:
„Das Fahrpersonal hat seinen Beitrag zur Sanierung der Bahn bereits übererfüllt ... Während die DB das Betriebsergebnis seit der Bahnprivatisierung 1994 um 5 Mrd. erhöht hat und die Produktivität des Fahrpersonals um rund 200 % gestiegen ist, hat das Fahrpersonal einen Reallohnverlust von 9,5 % erlitten ... Die Lohnkurve muss stringent nach oben gehen.“ (der GDL-Vorsitzende Schell, GDL-Infodienst, 23.5.07)
Die gewerkschaftliche Vertretung des Fahrpersonals stellt sich auf den Standpunkt, dass nach Jahren von Lohnverzicht und Leistungssteigerungen das Lohninteresse der Beschäftigten wieder zu seinem Recht kommen muss. Die Leute brauchen mehr Geld und weniger Arbeitsbelastung, und die GDL will sich dafür einsetzen, dass sie beides bekommen. Ihr Forderungspaket zielt auf Kompensation der Schäden, die das Bahnunternehmen dem Fahrpersonal im Gefolge der Bahnsanierung aufgehalst hat: Durch eine kräftige Erhöhung der Grundgehälter sollen Reallohnsenkungen rückgängig gemacht werden; die gewachsene Belastung im Schichtdienst soll reduziert werden, die Arbeitszeit insgesamt erträglicher geregelt werden.[3]
Ein ganz normaler gewerkschaftlicher Forderungskatalog also. Dafür sind Gewerkschaften schließlich da. Wegen der Freiheit des Unternehmens, mit der Einrichtung der Arbeitsplätze auch die Arbeitsanforderungen zu seinen Gunsten zu gestalten, wegen der alltäglich stattfindenden Erpressung zu mehr Leistung für weniger Lohn müssen Arbeitervertretungen periodisch antreten, um die auf Basis der geltenden Tarifverträge stattfindenden Verschlechterungen für ihre Mitglieder soweit wie möglich wieder rückgängig zu machen. Die ganzen schönen Vertragswerke, die Gewerkschaften mit den Kapitalisten aushandeln, stellen in dieser Hinsicht gar nichts sicher; ohne periodische Kampfansage kommt nicht einmal das Anliegen zur Geltung, sich in Sachen Lebensunterhalt und Arbeitsumstände nicht laufend schlechter zu stellen. Auch was die Argumente angeht, mit denen die GDL ihre Forderungen begründet, folgt sie ganz der gewerkschaftlichen Logik eines den Arbeitenden zustehenden, gerechten Lohns. Sie verweist auf die Betroffenheit ihrer Mitglieder durch die Sanierungskünste der Bahn; auf die besonderen Belastungen, die das Fahrpersonal auszuhalten hat; auf die Verantwortung, die insbesondere die Lokführer tragen; auf die Leistungen, die ihre Mitglieder für den Erfolg der anderen Seite erbracht haben; und darauf, dass nun, da dieser Erfolg sich in Gestalt einer enormer Gewinnsteigerung eingestellt hat, das Unternehmen die Lohnerhöhung problemlos verkraften kann. Sie führt also lauter Rechtfertigungsgründe an, die in der Sache den eigenen Ausgangspunkt, das Interesse, die Geldnot ihrer Mitglieder und die gestiegenen Arbeitsanforderungen abzumildern, relativieren. Denn dieser Bedarf ergibt sich ja daraus, dass sie vom Lohn leben und sich ihre Arbeitskraft und Lebenszeit einteilen müssen; und diese Notwendigkeiten – vom Bedürfnis nach frei zu gestaltender ‚Lebensqualität‘ ganz zu schweigen – werden nicht mit einer besseren oder schlechteren Geschäftslage des Bahnunternehmens mehr oder weniger dringlich; und eigentlich, sollte man meinen, müssen sie nicht erst noch durch Hinweis auf die besonderen Dienste, die die Belegschaft ihren Anwendern leistet, als gerechtfertigt nachgewiesen werden. Aber Gewerkschaften, die das Vertragsverhältnis zwischen der Arbeitermannschaft und ihren Anwendern korrigieren, d.h. unter wieder verbesserten Bedingungen erneuern wollen, argumentieren genau so – so nämlich, dass sie selber diese Lebensnotwendigkeiten nur in dem Maße gelten lassen wollen, wie sich die Beschäftigten deren Berücksichtigung durch die Gegenseite nach den Grundsätzen von Leistung und Gegenleistung verdient haben. So auch die GDL.
Nicht zu übersehen ist allerdings, dass diese Gewerkschaft es mit den so begründeten Anrechten der Beschäftigten ernst meint und deren Anerkennung nötigenfalls auch erzwingen will. Damit stellt sie in der bundesdeutschen Gewerkschaftslandschaft eine Ausnahme dar. Denn die Arbeitervertretungen hierzulande pflegen gemeinhin solche öffentlichen Verweise auf die Berechtigung ihrer Tarifforderungen mit einem ‚eigentlich‘ zu versehen. Sie verkünden, was ihren Mitgliedern eigentlich zustehen würde, nur um gleichzeitig mehr oder weniger offen zu signalisieren, dass sie selbstverständlich ein Einsehen haben, wenn die Unternehmer diese Forderungen mit Verweis auf ihre Konkurrenzerfordernisse für unerfüllbar erklären und die Sachnotwendigkeiten ihrer Rechnung mit niedrigen Lohnkosten ins Feld führen. Sie richten ihre Forderungen schon im Vorhinein an diesen Einwänden aus und verstehen sie als Verhandlungsmasse, von der sie Abstand zu nehmen gewillt sind. Nicht so die GDL. Die verkündet ernstlich ein Ende der Bescheidenheit der letzten Jahre und lässt auch keine Zweifel daran, dass sie mit Widerstand der Gegenseite rechnet, dem aber nicht nachzugeben bereit ist. Deshalb hat sie schon bei der Planung ihrer Tarifauseinandersetzung einen Streik ins Auge gefasst. Dazu sieht sie sich durch das mangelnde Entgegenkommen der Bahn vollauf berechtigt. Sie sieht die Sache nämlich so, dass nicht sie die Störung des „Arbeitsfriedens“ zu verantworten hat; es ist die Bahn, die ihr keine andere Wahl lässt, weil sie den von ihr Vertretenen die ihnen zustehenden Verbesserungen verweigert: Sollte der Arbeitgeber seine Verweigerungshaltung beibehalten, dann provoziert er weitere Arbeitskämpfe. Für diesen Fall sprachen sich Hauptvorstand und Tarifkommission dafür aus, die Urabstimmung einzuleiten.
(GDL-Info-Dienst, 16.7.) Dabei ist sich die GDL der durchschlagenden Wirkung einer Arbeitsverweigerung ihrer Mitglieder bewusst - die Dienste, die ihre Mitglieder der Bahn AG erbringen, sind für den Fahrbetrieb insgesamt entscheidend, vor allem die Lokführer sind schwer ersetzbar, nicht zuletzt dank der kostensenkenden „Ausdünnung“ des Personals der Bahn in den letzten Jahren; sie ist sich zudem – nicht minder wichtig – sicher, dass ihre Leute das auch wollen:
„Die Streikbereitschaft ist hoch, die Kollegen haben die Schnauze voll. Und wir können mit ein paar Dutzend Kollegen alle Knotenbahnhöfe wie München oder Frankfurt stilllegen.“ (GDL-Sprecher Maik Brandenburger, TZ, 30.6.)
Und sie ist bereit, dies im Ernstfall auch zu tun und den Bahnbetrieb nachhaltig zu stören: Wir würden auch lieber den Bahnchef im schicken Berliner Bahntower bestreiken. Das hätte aber nicht die gewünschte Wirkung.
(Schell in der Bild-Zeitung 10.7.) Auch damit steht sie im Gegensatz zu den gewohnten Praxis deutscher Gewerkschaften, mit mehr symbolischen, wenig durchschlagenden Streikaktionen ausgerechnet bei der Arbeitsverweigerung die Verantwortung der Gewerkschaft und ihre Rücksichtnahme auf das Betriebswohl zu demonstrieren.
Mit ihrem entschieden gewerkschaftlichen Standpunkt fällt die GDL also gehörig aus dem Rahmen – und bekommt es gleich mit zwei Gegnern zu tun: dem Unternehmen und den konkurrierenden Bahngewerkschaften.
Die Antwort der Bahn AG
Die Bahn AG weist die Forderungen der GDL unmissverständlich zurück. Die verlangte Kompensation kommt nicht in Frage. Mit seinen Rationalisierungsmaßnahmen verfolgt das Unternehmen schließlich den Zweck, den Gewinn durch Senkung der Lohnkosten zu steigern, und das mit der Perspektive, die Bahn AG erfolgreich an die Börse zu bringen. Dabei rechnet der Bahnchef wie alle Kapitalisten mit Tarifrunden nur in einem Sinne: Sie sind im Prinzip lästig, bestenfalls die Gelegenheit, das Ergebnis erfolgreicher Lohnkostensenkungen möglichst weitgehend von den Gewerkschaften unterschreiben und absegnen zu lassen; sonst haben sie ihren Zweck verfehlt. In dieser Hinsicht sind die Arbeitgeber inzwischen mehr als anspruchsvoll, weil gewohnt, dass ihre diesbezüglichen Erwartungen beim gewerkschaftlichen Fordern berücksichtigt und als unverrückbare Vorgaben aller Verhandlungen respektiert werden. Tarifrunden geraten sogar zu Veranstaltungen, bei denen weniger um Gewerkschaftsforderungen nach einer gewissen Kompensation für die laufenden Verschlechterungen der Lohn- und Leistungsgegebenheiten gestritten wird als darum, dass die Unternehmerseite die Arbeitervertretung mit ihrem immer noch viel zu wenig bedienten Anspruch konfrontiert, bisherige Lohn- und Leistungsbedingungen zu Lasten der Belegschaft zu korrigieren. Insofern stellt das Ansinnen der GDL, für ihre Mitglieder tatsächlich eine Korrektur in die andere Richtung durchzusetzen, für den Bahnchef eine einzige Ungeheuerlichkeit dar: Irrwitzig
findet er das, rechnet die Forderungen bezüglich Arbeitszeit und Geld als Kosten zusammen, die der Bahn erwachsen würden – und seitdem weiß alle Welt, dass die GDL die Wahnsinnssumme von mehr als 31 % Lohnerhöhung haben will. Das sieht doch jeder unmittelbar, dass eine solche Forderung völlig aus der Welt ist; dass sie an den Realitäten
vorbei geht und die guten Sitten verletzt, die in Lohnfragen zu gelten haben. An welchen „Realitäten“ Löhne und Arbeitszeiten der Beschäftigten Maß zu nehmen haben, verschweigt der Bahnchef nicht. Mit ihren völlig überzogenen Ansprüchen gefährdet die GDL das zentrale Projekt ihres Arbeitgebers, den anstehenden Börsengang der Bahn. Als Vorwurf an die GDL ist diese Zurückweisung einerseits etwas absurd: Schließlich beruft sich Mehdorn nur auf das erfolgreich in Anschlag gebrachte Interesse der Bahn an gewinnsteigernden Lohnkostensenkungen, gegen das die GDL gerade antritt. So sieht er die Sache aber nicht; vielmehr so, dass jede gewerkschaftliche Lohnforderung maßlos und ungehörig ist, die sich nicht von vornherein am Programm der Gegenseite orientiert, den Lohn als Kost in den Dienst des Kapitalwachstums zu stellen und sich damit für das Bereicherungsinteresse finanzkräftiger Kapitalanleger attraktiv zu machen. Er hält es gar nicht für nötig, das Gewinninteresse der Bahn als Interesse ins Feld zu führen, das mit den gegenläufigen Lebensinteressen der Arbeiter abzugleichen wäre. Für ihn versteht es sich von selbst, dass die Frage, was der Lohn für die Leute, die für ihn arbeiten müssen, zum Leben taugt, bei der Auseinandersetzung darum, was Arbeitern zusteht, einfach nichts verloren hat; dass beim Befinden über dessen Höhe allein die Gesichtspunkte gewinnbringender Anwendung der Arbeitskräfte zählen. Das ist in der Tat der hierzulande gültige Konsens in Lohnfragen.
Gewerkschaftliche Schützenhilfe für die Bahn AG: Der Tarifabschluss der Bahngewerkschaften Transnet/GDBA
Dass Mehdorn sich auf das Unternehmensinteresse an geschäftsförderlichen Lohnabschlüssen wie ein Gewohnheitsrecht berufen kann, ist nicht zuletzt das Verdienst der Gewerkschaften, die der Bahnchef als maßgeblichen Tarifpartner im eigenen Haus hat – der Transnet, in Tarifeinheit verbunden mit der ursprünglich als Vertretung der Bahnbeamten gegründeten GDBA. Seit dem Beginn der Bahnprivatisierung sehen die ihre gewerkschaftliche Aufgabe darin, den Ausbau der Bahn zu einem weltweiten Logistikkonzern zu unterstützen. Im Oktober vorigen Jahres bietet Transnet der Bundesregierung offiziell an, auch zum geplanten Börsengang das Ihre beitragen zu wollen und beratend die inhaltliche Ausgestaltung des Privatisierungsgesetzes zu begleiten
(Papier von Transnet/GDBA zur Bahnprivatisierung) – selbstverständlich im Namen der Sicherung deutscher Arbeitsplätze. Was sie dafür für erforderlich hält, gibt sie in diesem Zusammenhang gleich mit zu Protokoll, nämlich Rücksichtslosigkeit gegen ihre eigenen Tariferrungenschaften von gestern; schließlich ist, so die Gewerkschaft unisono mit der Gegenseite, die wirtschaftliche Stabilität der DB AG und deren Wettbewerbschancen in Deutschland, Europa und weltweit für die Arbeitsplatzsicherung genau so relevant wie die Sicherung bestehender Tarifverträge.
(ebd.)
In diesem Geiste führt die Tarifgemeinschaft Transnet/GDBA auch die diesjährigen Verhandlungen. Die Bahnprivatisierung will sie nicht durch unmäßige Lohnforderungen gefährden; zugleich verlangt das gewerkschaftliche Selbstverständnis nach einem Abschluss, der sich vor der „Basis“ vertreten lässt. Beide Anliegen lassen sich leicht unter einen Hut bringen – zumal der Bahn-Vorstand mit-, und die Basis brav ihre Rolle spielt: Transnet meldet eine Lohnforderung von 7 % an; der Bahn-Vorstand weist das als völlig untragbar zurück und legt ein Gegenangebot von 2 % vor. Transnet inszeniert ein paar Warnstreiks – die Basis will schließlich auch bedient sein.[4] Die Bahn AG ist schwer beeindruckt und legt ein neues Angebot vor. Die Warnstreiks werden abgebrochen. Am Ende einigt man sich irgendwo in der Mitte. Die Kapitalseite tut der Gewerkschaft den Gefallen und betont, wie schwer sie die 4,5 % angekommen seien:
„Mehdorn sprach von einem Abschluss, der wehtue. Es handele sich um einen ‚der höchsten Abschlüsse, die in Deutschland in diesem Jahr gemacht worden sind ...‘ Die Bahn habe dem Tarifkompromiss ‚mit großen Bedenken zugestimmt‘.“ (FTD.de)
Das beweist nicht nur schlagend, dass 4,5 % ab dem 1.1.08 plus 600 Euro Einmalzahlung ein prima Ergebnis sind; es belegt auch, wie wichtig die Gewerkschaft ist, wenn es darum geht, die Interessen des Bahnpersonals mit denen ihres Arbeitgebers zu versöhnen:
„Hansen (der Transnet-Chef) sprach von einem Ergebnis, das sich auch vergleichen lässt mit dem hervorragenden Ergebnis der Deutschen Bahn AG im vergangenen Wirtschaftsjahr ... Das Ergebnis werde dazu beitragen, das Vertrauen der Belegschaft in die Unternehmensführung und ihre Strategie zu stärken.“ (FDT.de)
Deutlicher kann man es eigentlich nicht sagen. Die Gewerkschaft verpflichtet die von ihr Vertretenen darauf, dass sie mit dem Erfolg des Unternehmens in der Konkurrenz am besten bedient sind, dass sich also die Massenentlassungen, Lohnsenkungen und neuen Arbeitsbelastungen, die die Bahnbeschäftigten im Zuge der Privatisierung haben über sich ergehen lassen, für sie lohnen, weil sie sich für das Unternehmen lohnen. Und sie misst den Erfolg ihrer Tarifpolitik daran, dass sie ihrer Klientel beides glaubwürdig beibringt: dass an den Härten, die die Bahn AG ihnen im Zuge ihrer Privatisierung zumutet, kein Weg vorbeiführt; und dass sie im Rahmen der großen Herausforderungen, die auf die Bahn im Zuge des Börsengangs zukommen, alles ihr Mögliche getan hat, um auch für die Belegschaft etwas herauszuholen. So werden sich Bahn und Transnet handelseinig. Die Bahn zahlt ein paar Prozente; die Gewerkschaft garantiert ihr preisgünstig den Tariffrieden, den sie benötigt, um ihr kapitalistisches Erfolgswerk ungestört fortzusetzen – und die freie Presse bestätigt die Lüge, wie ausnehmend gut die Arbeiterschaft diesmal bedient worden sei, würdigt zugleich durchaus ehrlich den Abschluss als gelungenen Beitrag der Tarifpartner zum Fortgang des Bahngeschäfts, und benennt den gemeinsamen Störenfried, gegen den das Tarifergebnis diesmal gerichtet ist – die GDL:
„Bahnchef Mehdorn hat einen machtpolitischen Erfolg errungen. Mit einem Lohnzuschlag von 4,5 % ist er den Bahngewerkschaften Transnet und GDBA zwar weit entgegengekommen – es ist der höchste Tarifabschluss in der jüngeren Geschichte der Bahn. Zugleich bremst der Abschluss die Lokführergewerkschaft GDL aus ... Mehdorn zahlt viel, aber er kauft sich dafür wahrscheinlich sozialen Frieden beim größten deutschen Unternehmen... Der Abschluss liegt insgesamt deutlich näher an den Vorstellungen der Gewerkschaft als am Einstiegsangebot der Bahn. Ein bisschen politische Berechnung dürfte in diesem Ergebnis auch stecken. Die Gewerkschaft Transnet hat Konzernchef Mehdorn schließlich gegen viele Widerstände darin unterstützt, die Bahn inklusive des Schienennetzes an die Börse zu bringen.“ (FDT, 10.7.)
Für diese sozialfriedliche Kooperation zwischen ‚Kapital und Arbeit‘ stellt allerdings die GDL eine ernst zu nehmende Bedrohung dar, nicht nur, was die Bahn AG, sondern auch, was die Transnet/GDBA angeht.
Die GDL – ein einziger Angriff auf die Vertretungshoheit der Transnet
Die GDL macht keinen Hehl daraus, dass sie von der tarifpolitischen Linie der Transnet nichts hält; insbesondere nicht von der Art und Weise, wie sich Transnet der Bahn AG als unterstützende Kraft bei deren Börsengang andient. Die Lohnforderungen der Transnet für diese Tarifrunde hält sie für lachhaft und skandalös; für ihre Klientel ist das auf alle Fälle zu wenig; also beschließt sie, eigene Forderungen aufzustellen und aus eigener Kraft durchzusetzen. Nach wachsenden Unstimmigkeiten tritt die GDL im Mai 2006 aus der Tarifgemeinschaft mit der Transnet aus, führt nun ihre Auseinandersetzung um Lohn und Arbeitsbedingungen mit dem Kapital selbstständig und stellt dann auch klar, dass die GDL den zwischen dem DB-Vorstand und den beiden anderen Bahngewerkschaften erzielten Tarifabschluss auf keinen Fall unterzeichnen wird.
(GDL-Info-Dienst, 16.7.)
Damit geht sie nicht bloß auf Distanz zur Transnet; mit ihrem gewerkschaftlichen Standpunkt, ihren Forderungen und der Art ihres Auftretens stellt sie sich polemisch zu der ganzen Linie, die die anderen Bahngewerkschaften vertreten; damit aber auch automatisch in Gegensatz zu den DGB-Gewerkschaften insgesamt. Sie stellt deren Gewerkschaftspolitik und Rolle bei der Regelung der nationalen Lohnverhältnisse doppelt in Frage. Erstens untergräbt sie die Glaubwürdigkeit der gängigen gewerkschaftlichen Lebenslüge, die Arbeiterschaft würde mit der einvernehmlichen Regelung ihrer Lohnansprüche im Lichte einer gesunden und arbeitsplatzförderlichen Geschäftspolitik am besten fahren und mehr, als was die Unternehmerschaft und die für alle deren Konkurrenzansprüche empfänglichen Gewerkschaften jeweils für verträglich halten, sei eben beim besten Willen nicht ‚drin‘ gewesen. Allein schon damit, dass sie mehr fordert und sich bereit zeigt, für ihre Forderungen ernstlich zu kämpfen, sprengt sie das bei DGB-Gewerkschaften bewährte Konzept einer für beide Seiten verträglichen Lohnfindungspolitik. Ein Verein wie die GDL droht nicht nur den konkurrierenden Gewerkschaften die Mitglieder abspenstig zu machen; er provoziert mit seinem Beispiel unweigerlich auch Kritik in deren eigenen Reihen und gefährdet dadurch deren gewohnte Art gewerkschaftlicher Vertretung: das Kommando einer Gewerkschaftsführung, die ihrer folgsamen ‚Basis‘ sagt, was für sie zu holen ist und wann sie sich auf- und wann wieder abstellen lassen soll.
Zweitens gefährdet die GDL damit den anerkannten Alleinvertretungsanspruch der deutschen Einheitsgewerkschaften, und damit die Rolle, die sie in der Republik einnehmen und unbedingt einnehmen wollen. Im Programm vertrauensvoller Zusammenarbeit mit dem Kapital fungieren die Mitglieder als Beleg für das Recht der Gewerkschaft auf Mitsprache; als Allein-Vertreter der Beschäftigten, also in deren Namen reklamieren die Gewerkschaftsoberen Teilhabe an allen Entscheidungen des Kapitals, die Wohl und Wehe der Belegschaft betreffen; sie stehen ihrerseits dafür ein, die Beschäftigten auf alles festzulegen, was sie als Vertreter der Arbeitermannschaft mit den Herren der Produktion aushandeln. Die Machtposition der DGB-Gewerkschaften, ihre Beteiligung an der Regelung der Arbeitswelt beruht deshalb ganz und gar darauf, dass das Kapital und die hohe Politik ihre unternehmens- und staatsdienliche Leistung anerkennen, die von ihr Vertretenen verlässlich einzubinden und unterzuordnen unter die Ansprüche, die der Standort Deutschland ihnen abverlangt. Das muss die „Basis“ dann aber auch mit sich machen lassen; denn die Gewerkschaft braucht ihre Mitglieder als Beleg für ihre Fähigkeit, den sozialen Frieden
zu stiften und zu halten. Die sollen ihrer Gewerkschaftsführung daher auch und gerade dann die Treue halten, wenn sie im Namen von Beschäftigungssicherung oder gleich unverhohlen um der Konkurrenzfähigkeit der Firma im globalen Kampf um Märkte willen eine Lohnsenkung und Leistungssteigerung nach der anderen unterschreibt.
Nichts Geringeres als das Gesamtkunstwerk moderner gewerkschaftlicher Interessenvertretung steht also auf dem Spiel, wenn sich eine gewerkschaftlich organisierte Mannschaft aufmandelt und gegen den Willen der national etablierten Arbeitervertretung auszutesten droht, wie weit ihre Erpressungsmacht gegenüber dem Kapital reicht. Es ist von daher kein Wunder, dass Hansen, Sommer und Co. giftig werden.
Transnet und Bahn AG vereint gegen die GDL Der Kampf der Transnet gegen eine unliebsame gewerkschaftliche Konkurrenz
Da die Versuche scheitern, den Konkurrenzverein wieder in die eigene Tarifstrategie „einzubinden“, eröffnet die Führung der Transnet einen erbitterten Kampf, um den Sonderweg der GDL zu vereiteln.
Erstens ideologisch. Nachdem Transnet sich mit der Bahn AG auf besagte 4,5 % geeinigt hat, preist sie dieses Ergebnis in gewohnter Manier als soziale Errungenschaft und als Erfüllung all dessen, was Arbeitnehmer an Existenzsicherheit zu Recht erwarten dürfen – um dann der GDL vorzuwerfen, dass sie mit ihrem ‚Sonderweg‘ genau diese berechtigten sozialen Anliegen schädigt. Die GDL wird als Spalter zu denunziert, idem man ihr die zwei wichtigsten gewerkschaftlichen Totschläger entgegenuschleudert: ‚Flächentarifvertrag‘ und ‚Gewerkschaftseinheit‘:
„Dieser Tarifvertrag ... kann sich sehen lassen. Er gibt den Beschäftigten bei der Bahn wieder etwas mehr Luft ... und er unterstützt auch die immer lauter werdende Forderung der Gewerkschaften: ‚Arbeitnehmer, die in Vollzeit arbeiten, müssen davon leben und die Existenz einer Familie sichern können.‘ Ohne flächendeckende Warnstreiks und ohne geschicktes Verhandeln mit Augenmaß wäre diese beachtliche Gehalterhöhung undenkbar gewesen.
Zu denken gibt, dass die rund 32 000 Lokführer und Zugbegleiter nicht von der Partie sind: Sie fordern, soweit sie Mitglieder in der GDL sind, für ihre Berufsgruppe wesentlich größere Tarif-Erhöhungen – was man bei Kenntnis der derzeitigen Entlohnung versteht (!) ... Darüber hinaus will die GDL seit Mai 2006 einen eigenständigen Tarifvertrag ... Damit würde ein gemeinsamer Flächentarifvertrag Schiene in weite Ferne rücken. So notwendig und verständlich der Kampf um Lohnerhöhungen ist, so bedenklich ist eine Entwicklung, bei der die Arbeitnehmer ihre Ziele und Forderungen getrennt, teilweise sogar gegeneinander durchzusetzen versuchen. Eine fehlende Solidarität ... gefährdet meist die Grundlage aller gewerkschaftlichen Maßnahmen, was sehr schnell für alle Beschäftigten Nachteile mit sich bringen kann ... Ein sog. Flächentarifvertrag Schiene scheint für die Einheitsgewerkschaft Transnet der einzige Weg zu sein, Lohn- und Sozialdumping im Wettbewerb der diversen Verkehrsunternehmen zu verhindern. Die deutsche Gewerkschaftsbewegung hat in ihrer 130jährigen Geschichte schon viele Abtrennungen und Spaltungen miterleben müssen. Immer war es der einträglichere und auch gesellschaftlich bessere Weg, wenn die Beschäftigten einer Branche sich nicht gegeneinander ausspielen ließen.“ (Transnet-Stellungnahme zum Tarifabschluss, 9.7.)
Schon frech: Mit den gerade unterschriebenen 4,5 % in der Tasche heuchelt Transnet Verständnis für alle, denen das Geld nicht reicht, und stellt zugleich klar, dass das keinesfalls der Maßstab für die „Gewerkschaftseinheit“ ist, die sie beschwört. Die wäre ja im Übrigen auch dadurch zu haben, dass sich Hansen und Co. mit der GDL solidarisieren, sich deren Forderungen zu eigen machen und die versammelte Gewerkschaftsmacht dafür einsetzen, für alle Bahnbeschäftigten anständige Löhne zu erstreiten. Aber das Vorpreschen der GDL als Gelegenheit zu entdecken, ihrerseits für ihre Mitglieder mehr rauszuholen, kommt ihnen gar nicht erst in den Sinn. Stattdessen schwören sie ihre Adressaten darauf ein, dass keine Euro-Summe der Welt es wert sein kann, diese „Gewerkschaftseinheit“ auch nur ein Stück weit zu verlassen.
Und was den gewerkschaftlichen Fetisch ‚Flächentarifvertrag‘ angeht: Es mag ja sein, dass die Absicherung eines verbindlichen, nicht zu unterschreitenden Lohnniveaus für die Beschäftigten aller Bahngesellschaften den Angriffen des Kapitals auf Lohn und Arbeitszeit eine Schranke setzen würde. Bloß: Wenn Transnet die Spirale einer gegenseitigen Unterbietung bei Sozialleistungen, Arbeitsbedingungen, Arbeitszeiten und Gehältern
(Webseite der Transnet) beklagt, die die Bahn AG mit der Privatisierung systematisch in Gang gesetzt hat, dann ist das nicht zuletzt mit ihr Werk. An einen Zusammenschluss aller Bahnbeschäftigten zu einer möglichst schlagkräftigen Organisation, die das verhindern könnte und dafür sorgt, dass sich die Beschäftigten nicht gegeneinander ausspielen lassen, denkt sie ja zu allerletzt. Sie macht sich den Standpunkt der Bahn zueigen, ein Flächentarif wäre nur um den Preis des Verzichts auf Lohnbestandteile und der Verlängerung von Arbeitszeiten zu haben, und begegnet der Unternehmensstrategie, mit Ausgründungen von eigenen Gesellschaften die bestehenden Tarifverträge zu unterlaufen, mit dem verstärkten Bemühen, durch den „Tausch“ von Tarifzuständigkeit gegen Lohnbestandteile, also durch mehr Nachgiebigkeit im neu privatisierten Bahngewerbe, als Tarifpartei anerkannt zu bleiben. Wie weit sie es dabei gebracht hat, erhellt der Umstand, dass die Große Tarifkommission Transnet/GDBA im Februar dieses Jahres eine Kampagne „gegen Armutslöhne“ auf die Tagesordnung setzt – offenbar gehören Einkommen, von denen man nicht leben kann, nach einer Dekade gewerkschaftlich mitgetragener „Sanierung“ inzwischen zur Normalität im Bahngewerbe. Wenn eine Gewerkschaft wie Transnet den „Flächentarifvertrag“ verteidigt, dann hat das mit irgendeiner Absicherung eines allgemeinen Lohnniveaus also nichts mehr zu tun – materiell gesehen garantieren diese Verträge im Gegenteil nur die Verallgemeinerung schäbiger Löhne und die gewerkschaftliche Zustimmung zur hemmungslosen Konkurrenz um Verbilligung der Arbeitskräfte –; dann verteidigt die Gewerkschaft nichts weiter als ihre für die Vertretenen schädliche Alleinzuständigkeit für die Arbeitsbelange – auch und gerade gegen alle, die mit dem materiellen Ergebnis ihrer Tarifpolitik unzufrieden sind.
Das macht die Tarifgemeinschaft Transnet/GDBA dann zweitens auch praktisch, indem sie ihre Macht als anerkannte Tarifpartei gegen die GDL in Anschlag bringt, soweit das nur geht. Nachdem sie sich mit dem Unternehmen auf den von der GDL abgelehnten Tarifvertrag geeinigt hat, unterbreitet sie der GDL mitten in deren eigene Verhandlungen hinein das heuchlerische Angebot, ‚gemeinsam‘ für Verbesserungen auch für deren Klientel zu ‚kämpfen‘, und distanziert sich damit öffentlich von deren ‚Sonderverhandlungen‘:
„Die Eisenbahngewerkschaft Transnet hat sich vor dem heutigen Spitzengespräch zwischen Deutscher Bahn und der Gewerkschaft Deutscher Lokführer (GDL) in den Tarifkonflikt eingeschaltet und bietet den Lokführern an, gemeinsam ein neues Entgeltsystem im Konzern durchzusetzen. ‚Die derzeitigen Strukturen bei der Entlohnung sind überholt und ungerecht. Wir wollen zusammen mit der GDL Druck auf den Bahnvorstand machen und erreichen, dass bei der DB AG künftig stärker nach Belastung und Leistung bezahlt wird‘, sagte Transnet-Chef Norbert Hansen der Welt.“ (Welt-online, 19.7.)
Gleichzeitig gestaltet sie ihren Tarifabschluss zu einem regelrechten Kampfmittel gegen die GDL-Forderungen aus:
„Die Gewerkschaften Transnet und GDBA haben im Tarifabschluss mit der Deutschen Bahn eine Klausel durchgesetzt, die es nahezu unmöglich macht, dass Lokführer höhere Lohnzuschläge bekommen als die übrigen Bahnbeschäftigten ... Der Tarifvertrag mit Transnet und GDBA wäre hinfällig, sollten die Lokführer einen besseren Abschluss erzielen.“ (SZ, 13.7.)
Wie diese Klausel nicht gemeint ist, verrät der Transnet-Chef freundlicherweise gleich selbst:
„Hansen erklärte, es sei bei einer Einigung von Bahn und Lokführern im Sinne der GDL für Transnet ‚zweitrangig, den eigenen Abschluss nachzubessern. Wir laufen der kleinen Gewerkschaft nicht hinterher‘, meinte er. Doch sollte es dazu kommen, müsse ‚Transnet überprüfen, ob man den strategischen Kurs der Bahn weiter mittragen könne‘, sagte Hansen und kündigte damit unverhohlen die Möglichkeit an, Mehdorn nicht länger bei seinen Börsenplänen zu unterstützen.“ (Welt-online, 19.7.)
Zweitrangig
ist gut; dass die Transnet-Führung einen anderen Abschluss gar nicht will, hat sie mit den eigenen Tarifverhandlungen hinreichend bewiesen. Demonstrativ schwört sie das Kapital darauf ein, gegenüber der GDL hart zu bleiben, und droht – um Gewerkschaftsforderungen, die diesen Namen verdienen, zu verhindern! – mit der Aufkündigung der unternehmensförderlichen Kooperation mit der Bahn AG, falls sich der Bahnchef gegenüber der GDL in irgendeiner Weise ‚schwach‘ zeigen sollte.
Damit es die GDL-Mitglieder auch zu spüren kriegen, dass sie sich hier gegen den Willen der eigentlich für sie zuständigen Gewerkschaftsorganisation aufstellen, setzt sich Transnet dafür ein, dass die GDLer von der Einmalzahlung von 600,– Euro ausgeschlossen werden, die sie mit der Bahn AG für 2007 vereinbart hat:
„Die Gewerkschaft Transnet versucht, Funktionäre und Mitglieder der GDL gegeneinander auszuspielen ... Kirchner (Transnet) sagte, für die GDL-Mitglieder sei es ‚ärgerlich‘, wenn sie nun nicht von dem Abschluss profitieren könnten, den Transnet und GDBA erreicht hätten. ‚Wir wollen nicht, dass die Beschäftigten den Kopf für Funktionäre hinhalten müssen.‘ Hintergrund der Bemerkung ist, dass die ausgehandelte Einkommenserhöhung erst im Januar wirksam wird, während 600 Euro Einmalzahlung schon in diesem Jahr fällig ist ... Nach Deutung dieser Gewerkschaft gilt die Vereinbarung aber nur für Mitglieder von Transnet und GDBA.“ (SZ, 12.7.)
Diese Arbeitervertretung macht sich nicht für Verbesserungen stark; sie demonstriert Abweichlern ihren Willen und ihre Macht, sie zu schädigen. Wer Sonderwünsche hat, muss sich eben damit abfinden, dass er gar nichts bekommt.
Für die Verteidigung des Führungsanspruchs ‚ihrer‘ Gewerkschaft und den Beweis, dass die GDL keinesfalls die Interessen der Bahnbeschäftigten vertritt, dürfen die Beschäftigten nach guter gewerkschaftlicher Sitte selber als Sprachrohr ihrer gewerkschaftlichen Oberen antreten und der GDL Urabstimmung über Streik ein gegenteiliges Votum entgegensetzen:
„Transnet begann in den verschiedenen Betrieben der Bahn unter dem Motto ‚Votum für Solidarität‘ eine Unterschriftenaktion. Damit sollen die Beschäftigten bekunden, dass sie einen einheitlichen Tarifvertrag für alle Bahnmitarbeiter wollen, teilte die Gewerkschaft mit. ‚Wir verstehen die Aktion bewusst als Antwort auf die zurzeit laufende lange Urabstimmung der GDL‘, erklärte der Transnet-Vorsitzende Norbert Hansen.“ (AP, 3.8.)
So geht gewerkschaftliche Solidarität im Jahre 2007!
Der Kampf der Bahn AG: Mit der Waffe des Rechts gewerkschaftliche Interessenvertretung erledigen
Auf der anderen Seite nötigt das Bahnunternehmen der abweichenden Gewerkschaft nichts weniger als einen Existenzkampf auf. Der Bahnvorstand erteilt dem Antrag der GDL auf Verhandlungen über seine Forderungen von Anfang an eine prinzipielle Absage. Auf Gespräche über die eigentliche Materie lässt er sich gar nicht erst ein, sondern stellt klar, dass ein eigener Tarifabschluss mit der GDL, welchen Inhalts auch immer, nicht in Frage kommt. Damit zwingt der Bahnvorstand der GDL den Kampf um das Recht auf einen eigenen Tarifvertrag auf: Um überhaupt mit der Bahn AG über Löhne und Arbeitszeiten verhandeln zu können, muss sie dem Unternehmen erst einmal ihre Anerkennung als Verhandlungspartner abringen. Und da beißt die GDL bei der Bahn AG auf Granit.
Schon im Vorfeld der Tarifrunde, noch ehe die GDL irgendwelche Forderungen erhebt, bemüht das Unternehmen die höhere Instanz des Rechts. Es will per Gericht feststellen lassen, dass die GDL für ihre Forderungen gar nicht streiken dürfe, weil sie keine Tarifpartei sei. Damit wäre die Gewerkschaft ihres Druckmittels beraubt und wären ihre Forderungen mit einem Schlag hinfällig. Seitdem dreht sich der Streit zwischen GDL und Bahn AG vornehmlich um die Frage, ob die GDL überhaupt streiken darf:
„Schon seit Ende vergangenen Jahres will die DB der GDL das Recht absprechen lassen, mit Streiks einen speziellen Tarifvertrag für das Zugpersonal durchzusetzen ...‘Ein Tarifvertrag für alle Beschäftigten‘ lautet das Ansinnen, das der Bahnvorstand mit Hilfe der Justiz durchsetzen will. Die Mainzer Justiz ... will erst Mitte September verhandeln ... Die GDL, in der die Mehrzahl der gut organisierten Lokführer organisiert ist, sieht sich im Recht. Sie verweist auf ein Urteil des OLG Frankfurt aus dem Jahre 2003, in dem ihr zugestanden worden sei, für einen Spartenvertrag für das Zugpersonal zu streiken.“ (SZ, 11.7.)
Die Bahn AG behandelt die Auseinandersetzung also von vornherein als eine prinzipielle Machtfrage und bemüht die Gewalt des Rechts, um die störende gewerkschaftliche Interessenvertretung im Keim zu ersticken. Für Mehdorn und Co. ist der Fall klar: Der Rechtsstandpunkt, den die politische Gewalt gegenüber gewerkschaftlichen Arbeitskämpfen einnimmt, hat allemal identisch zu sein mit ihrem unternehmerischen Anspruch auf einen durch keinerlei gewerkschaftliche Einsprüche gestörten Gang des Geschäfts. Nach ihrer Ansicht haben Gewerkschaften und ihre Tarifverträge dem Erfolg des Unternehmens zu dienen; tun sie dies nicht umstandslos, dann sind die Gerichte beauftragt, dafür zu sorgen, dass diesem gewerkschaftlichen Treiben das Handwerk gelegt wird.
Für diesen Anspruch führt der Bahnchef gleich zwei unschlagbar gute Argumente ins Feld: Erstens das anerkannte Geschäftsinteresse eines deutschen Vorzeigeunternehmens, das schließlich an die Börse will und mit seinen Kostensenkungsprogrammen die Milliardengewinne zustande bringen muss, die die Finanzmärkte überzeugen. Zweitens und vor allem aber berufen sich Mehdorn und Co. auf die Sonderstellung, die die Bahn im nationalen Wirtschaftsleben einnimmt. Deren quasi-monopolistische Stellung im deutschen Transportwesen; die Bedeutung, die diese Geschäftssphäre für den gesamten nationalen kapitalistischen Betrieb einnimmt, begründet für deren Manager ihr bedingungsloses Recht, alle gewerkschaftlichen Einwände gegen die Konditionen niederzumachen, unter denen die Bahnbediensteten ihren Dienst ableisten. Wo die GDL auf die besondere Verantwortung des Lokführerdienstes pocht, die zu höheren Einkommen berechtigt, denkt und handelt der Bahn-Chef genau umgekehrt: Weil das Bahnpersonal nicht nur dem Konzern, sondern gleich dem ganzen Standort dient, hat es sich widerspruchslos den Bedingungen zu fügen, die das Geschäftsinteresse der Bahn AG gebietet. Eine bestechende Logik: Weil das Unternehmen aus einer unersetzlichen nationalen Standortbedingung sein Geschäft macht, gebührt diesem Geschäft der Status einer nationalen Institution und ist es berechtigt, von seinen Beschäftigten einen quasi beamtenmäßigen Gehorsam gegenüber all seinen Ansprüchen zu verlangen. Ausgerechnet ein Unternehmen, das keinesfalls mehr Staatsbetrieb sein will, sondern nur noch mit Kostensenkung und Gewinnmaximierung, positiver Unternehmensbilanz und ‚shareholder value‘, also in den Kategorien privatkapitalistischer Bereicherung rechnet, macht gegenüber den von diesen Kalkulationen Betroffenen eine Art nationaler Dienstpflicht zum Stillhalten geltend. Folglich versündigt sich die GDL an den höchsten Gütern der Nation, wenn sie von der Bahn AG mehr Geld will:
„Es kann nicht sein, dass eine kleine Berufsgruppe ganz Deutschland terrorisiert. Die Lage ist viel zu ernst, um mit dem Recht zu spielen.“ (Mehdorn)
Der Bahnvorstand „spielt“ deshalb nicht mit dem Recht – er setzt es ein. Gegen die Warnstreiks der GDL erwirkt er ein Streikverbot beim Arbeitsgericht; er droht der GDL mit Schadensersatzklagen, also mit finanzieller Vernichtung, weil sie sich herausnimmt, in der Zeit bis zur Zustellung des Verbots doch noch zu streiken; GDL-Mitglieder werden mit Abmahnungen und Entlassungsdrohungen schikaniert; usw. So soll die GDL dazu erpresst werden, sich dem Tarifabschluss unterzuordnen, den die Bahn mit Transnet/GDBA abgeschlossen hat, und in die Tarifgemeinschaft zurückzukehren.
Sonst, so die Auskunft, würde nämlich das Bahnunternehmen in seiner Existenz gefährdet:
„Gelänge es der GDL, einem eigenen Tarifvertrag für das Zugbegleitpersonal durchzusetzen, brächte das selbst die Schichtpläne des Unternehmens durcheinander. ‚Dann müssten wir vor der Aufstellung der Pläne jeden Beschäftigten fragen, bei welcher Gewerkschaft er wohl organisiert ist‘, sagt Suckale. Denn danach richtet sich dann die tägliche Arbeitszeit ... und die tarifvertraglich vereinbarten Pausen. ‚Das ist schlicht nicht akzeptabel‘, sagt Suckale.“ (SZ, 11.7.) Am Ende würde der ganze Konzern zusammenbrechen: „Wie soll die Buchhaltung arbeiten, wenn jede Gewerkschaft ihr eigenes Eldorado veranstaltet? ... Der Konzern könne nicht wissen, welche der 20 000 Lokführer Mitglieder der GDL, von Transnet oder von gar keiner Gewerkschaft seien. Alle Mitarbeiter ... arbeiteten in Schichten. Unterschiedliche Arbeitszeitvereinbarungen würden das ganze System zum Kollaps bringen ... Mehr als 400 Tarifverträge gibt es im Konzern ... Und all die Entgelt-, Beschäftigungssicherungs- oder Gewinnbeteiligungstarifverträge seien miteinander verknüpft ... Wer an einer Schraube dreht, legt das ganze System still.“ (Bahn-Verhandlungsführer Bayreuther, FAZ, 15.7.)
Die Beschwerde des Kapitals über die „Kompliziertheit“, die ein gesonderter Tarifvertrag mit der GDL in den betrieblichen Wust von Tarifregelungen und Schichtplänen bringen würde, ist einerseits ein schlechter Witz. Schließlich gibt es längst ein ganzes „System“ „unterschiedlicher Arbeitszeitvereinbarungen“ und Entgelttarife – auf dem Mist des Kapitals gewachsen, das jede Gelegenheit ausnutzt, irgendwelche besonderen Arbeits- oder Betriebsbedingungen in Lohnsenkungshebel umzufunktionieren, und gewerkschaftlich abgesegnet. Die Botschaft ist andererseits klar: In sein „Eldorado“ der Freiheit zum Herumschieben von Personal und Lohnbestandteilen lässt sich der Bahnvorstand nicht von einer Gewerkschaft hineinfunken, die für ihre Mitglieder Ansprüche anmeldet! Er beharrt auf seinem Recht auf eine Arbeiter-Interessenvertretung, die die ungehinderte Verfügbarkeit der Arbeiter unterschreibt – und sieht dies durch die etablierte Gewerkschaftsvertretung bestens gewährleistet. Es geht eben gar nicht darum, ob im Betrieb „Tarifeinheit“ herrscht oder lauter „Sonderabmachungen“ gelten: Die Bahn AG weiß einfach, was sie an der „Tarifeinheit“ hat, die Transnet als zuständige gewerkschaftliche Instanz für alle großen und kleinen Tariffragen repräsentiert. Wo eine Gewerkschaft im Prinzip als kapitaldienlicher Ordnungsfaktor wirkt, indem sie alle Beschäftigten auf genehme Vereinbarungen verpflichtet, da weiß ein moderner Konzernmanager deren Macht glatt einmal zu schätzen und tritt als Anwalt einer einheitlichen gewerkschaftlichen Interessenvertretung auf; die richtet sich nämlich nicht gegen ihn, sondern gegen jedes Sonderinteresse, das sich durch 50 Euro mehr im Monat schlecht bedient sieht und sich herausnimmt, auf eigene Faust mehr rauszuholen. Das gilt es zu unterbinden, natürlich nur im Dienst an einer Belegschaft, die sich mit den Härten, die ihr das Unternehmen mit seinen Rationalisierungsmaßnahmen zugemutet hat, das Anrecht erworben hat, dass von den Zumutungen keinesfalls etwas zurückgenommen wird, sondern das Unternehmen sein Sanierungswerk entschieden weiterführt:
„Ich werde nicht zulassen, dass wenige Gewerkschafter die Sanierungsleistung von 230 000 Bahnmitarbeitern kaputt machen.“ (Mehdorn in „BamS“, laut: wiwo.de)
Weil die GDL sich durch Drohungen, Schikanen und Einstweilige Verfügungen nicht einschüchtern lässt, eine Rücknahme des Streikverbots erwirkt und die Urabstimmung einleitet, greift der Bahnvorstand auch zu anderen Mitteln, um die Streikbereitschaft zu brechen. Er macht sich die Idee der Transnet zu eigen, die GDLer von der Einmalzahlung auszuschließen und veranstaltet eine ziemlich einmalige Briefaktion:
„‚Ich möchte die Leistungen nach Tarifvertrag vom 9.7. in Anspruch nehmen‘, können Deutschlands Bahner in den nächsten Tagen per Unterschrift entscheiden ... Ein Kreuz, eine Unterschrift, schon ist die ‚Einmalzahlung‘ da, auf die sich die Bahn mit den Gewerkschaften Transnet und GDBA geeinigt hatte... ‚Ansprüche’, so heißt es weiter in der Erklärung, ‚bestehen für mich nur als Mitglied einer der beiden Gewerkschaften Transnet und DGBA oder als nicht gewerkschaftlich organisierter Mitarbeiter.‘ Mit anderen Worten: Die aufmüpfigen Lokführer, sofern sie der GDL angehören, kriegen nichts.“ (SZ, 21.7.)
Ob dieses Vorgehen überhaupt rechtens ist, interessiert den Bahnvorstand weniger – Hauptsache, es wirkt als Drohung und spaltet die Belegschaft.[5]
Weil das alles nichts fruchtet, die GDL an ihrem Kurs festhält und sich auch noch über 90 % Zustimmung zum Streik sichert, schlägt der Konzern noch einmal mit der Waffe des Rechts zu: Wo immer die Bahn fährt, beantragen die Konzernjuristen einstweilige Verfügungen gegen den Streik. Irgendwo wird sich ja wohl ein Richter finden, der die Rechtslage so sieht wie die Bahn AG: dass nämlich wegen ihrer Wichtigkeit für die Volkswirtschaft
jeder Streik bei der Bahn schon im Ausgangspunkt „unverhältnismäßig“, also rechtswidrig ist.
Die unabhängige Justiz entscheidet und erläutert die Rechtsgrundsätze erlaubten Arbeitkampfs, und die Öffentlichkeit erörtert die Grundsatzfrage: Was soll, darf, muss eine ordentliche Arbeitervertretung?
Das Gericht findet sich. Eine Arbeitsrichterin in Nürnberg nimmt sich im Sinne der Bahn AG der Sache an und erlässt eine Einstweilige Verfügung gegen den Streik.[6] Das ist ein schöner Erfolg für Mehdorn – und in mancher Hinsicht eine bemerkenswerte Klarstellung.
Klargestellt ist schon mit der Annahme der Klage durch ein sich für zuständig erklärendes Gericht, was zwar auch vorher nicht zweifelhaft war, aber doch wert ist, mal wieder in Erinnerung gebracht zu werden: In einem ordentlichen sozialen Rechtsstaat darf noch lange nicht jeder Arbeitnehmerverein für sein Interesse streiken, der das mit Aussicht auf Erfolg kann. So sind die heiligen Grundsätze der freien Marktwirtschaft wie „Koalitionsfreiheit“ und „Tarifautonomie“ durchaus nicht gemeint, dass der Staat sich in der Frage des Lohnkampfes heraushalten würde. Den Bürgern sind diese Freiheiten gewährt; die Macht einer Gewerkschaft ist eine zugestandene und durch ihre Zulassung begrenzt; ihre Betätigung unterliegt hoheitlicher Kontrolle. Dass die Lizenz für Arbeitskämpfe die Pflicht einschließt, es nicht zu übertreiben und eine gemeinwohldienliche, also systemkonforme konstruktive Lösung anzustreben, steht damit auch schon fest und wird außerdem weiter klargestellt und konkretisiert durch die Gesichtspunkte, die die fränkische Richterin bei der rechtlichen Überprüfung des Streikvorhabens der GDL in Anschlag bringt und über die sich prompt der professionelle wie der freischaffende juristische Sachverstand der Republik hermacht.
Zweifel an der Tariffähigkeit der GDL und damit an ihrem daraus abzuleitenden Recht auf Arbeitskampf überhaupt begründet der vom Bundesarbeitsgericht entwickelte Grundsatz der Tarifeinheit, wonach in einem Betrieb pro „Regelungsgegenstand“ nur ein Kollektivvertrag zwischen der Unternehmerseite und der Arbeitnehmervertretung zur Anwendung kommen könne. Der Zweifel langt für ein „einstweiliges“ Streikverbot. Das belebt andererseits enorm einen Meinungsstreit über das Für und Wider eines solchen Prinzips, der wiederum von einem klaren Grundkonsens über einen vorliegenden Regelungsbedarf und über das Ziel einer so oder so ausfallenden Regelung getragen ist: Im Betrieb muss Ordnung herrschen, Ruhe in der Lohnfrage, und das nicht per Oktroi von oben, sondern auf Grund einer freiwilligen Vereinbarung, mit der die Betroffenen in Gestalt ihrer autonomen Vertretung sich selbst zum Aushalten und Stillhalten verpflichten. Gegenstand engagierter Besinnungsaufsätze ist die heiße Alternative, ob eine Konkurrenz unter mehreren tariffähigen Gewerkschaften zu einer freiwilligeren und insofern verlässlicheren Ordnung im Laden beiträgt oder mehr Unfrieden und Unruhe stiftet.
Noch gravierendere Zweifel am Streikvorhaben der GDL folgen fürs Arbeitsgericht und für die diskussionsfreudige Öffentlichkeit aus dem fürs bürgerliche Recht insgesamt so entscheidenden goldenen Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Diese sieht die Richterin nicht gewahrt, wenn ein so kleiner Verein ein so großes und wichtiges Unternehmen wie Deutschlands Eisenbahn lahm zu legen droht. Mit ihren Begründungen setzt sie sich allerdings nicht bloß bei sämtlichen Gewerkschaftsjuristen, sondern auch bei den Fachleuten so entschiedener Meinungsbildungsorgane wie der Süddeutschen und der Frankfurter Allgemeinen in die Nesseln. Ausgerechnet die belehren das Gericht darüber, dass ein Streik ohne Schaden für den bestreikten Betrieb nicht zu haben sei, weil es genau darum doch geht.[7] Über die Unterscheidung, die die Richterin zwischen einer Schädigung der Betriebsbilanzen und einer angeblich drohenden volkswirtschaftlichen Gesamtkatastrophe trifft, setzen sie sich dabei hinweg [8] und klammern so genau das Grundprinzip aus, von dem sie bei ihrer Urteilsschelte selber felsenfest ausgehen, mit dem es die kleine Richterin ihrer Meinung nach aber übertreibt: Natürlich darf ein Streik weder die Eigentumsordnung und das in ihr festgeschriebene Kommando des kapitalistischen Eigentums über die Arbeit antasten oder auch nur von ferne in Gefahr bringen; noch darf „die Allgemeinheit“ durch marktwirtschaftliche Arbeitskämpfe „über Gebühr“ in ihrem Alltags- und vor allem Erwerbsleben gestört werden.
Genau in diesem Sinn tut die Einstweilige Verfügung aus Nürnberg ihre Wirkung – und mit der Wirkung sind dann auch wieder alle einverstanden: Sie wird von der GDL angefochten, und das Gericht vermittelt einen „Vergleich“; danach zieht die Gewerkschaft ihre Streikdrohung bis auf weiteres zurück, und beide Seiten erklären sich mit Geheimverhandlungen unter der Regie eines mehr „wirtschaftsnahen“ und eines mehr sozialapostolischen C-Politikers einverstanden. Die sollen den Konflikt in sozialfriedliche Bahnen lenken und werden nur deswegen nicht als regelrechtes Schlichtungsverfahren deklariert, weil die Bahn AG der GDL damit schon irgendwie den Status eines tariffähigen Verhandlungspartners konzedieren würde: Für so eine Konzession gedenkt die AG bei der Gewerkschaft noch mehr an Gegenleistung herauszuholen als bloß den Streikverzicht. So werden die gewerkschaftlichen Ausreißer schön langsam wieder eingefangen und domestiziert.
Die einmal angestoßene Debatte über die Grenzen, die den Gewerkschaften und ihrem Streikrecht gezogen werden müssen oder nicht gezogen werden dürfen, läuft dessen ungeachtet noch eine ganze Weile weiter. Wer in der Republik etwas zu sagen hat, will auch zu der Grundsatzfrage etwas gesagt haben: Was für eine Gewerkschaft wollen wir eigentlich? Dabei werden die verschiedenen Möglichkeiten einer dialektischen Kombination der Alternative ‚Tarifeinheit oder Konkurrenz‘ mit dem Kontrollgesichtspunkt der ‚Verhältnismäßigkeit‘ durchgenommen und im Groben zwei gegensätzliche Positionen herausgearbeitet.
- Eine mehr wirtschaftsfreundliche Fraktion im Land ist vor allem für mehr Konkurrenz auf Arbeitnehmerseite und macht auch weiter gar kein Geheimnis daraus, warum: Die DGB-Gewerkschaften sind ihr zu groß und zu mächtig. Dass diese Vereine ihre Größe und ihre angebliche Macht profitwidrig missbrauchen würden, kann man ihnen gerade im vorliegenden Fall zwar beim besten Willen nicht vorwerfen; da führt sich ja gerade die kleine Konkurrenzgewerkschaft mächtig auf; aber das macht nichts. Die schiere Tatsache, dass es auf Arbeitnehmerseite so große Organisationen gibt, passt den Verfechtern der großen Freiheit nicht; und um diese Ansicht überzeugend kundzutun, langt es ihnen als Argument, den DGB-Gewerkschaften Etiketten wie „Tarifkartell“, „unbeweglich“ und „Dinosaurier“ aufzukleben. Die Gefahr, dass kleine Standesorganisationen sich unverhältnismäßig aufspielen könnten, sehen sie zwar durchaus,[9] nehmen sie aber locker: Die Konkurrenz wird’s schon richten![10] Dass proletarische Minderheiten sich Frechheiten erlauben, mag kurzfristig nicht zu verhindern sein; aber echte Chancen haben sie – im Unterschied zu einer echten Elite – ohnehin nicht: Wenn irgendwann, durch übertriebene Löhne induziert, die Lokführerschwemme da ist, kürzt sich das alles wieder heraus.[11]
- Eine mehr sozialfriedlich eingestellte Gegenfraktion buchstabiert denselben Ordnungsfanatismus genau spiegelbildlich durch. Sie sorgt sich hauptsächlich um den sozialen Frieden im Land, wenn lauter kleine elitäre Satelliten der großen Gewerkschaftsbewegung als Ausreißer unterwegs sind und unvernünftige Forderungen durchdrücken. Genauer gesagt: Sie sorgt sich um die Produktivkraft tarifeinheitlich geordneter Verhältnisse für die Wirtschaft, ums marktwirtschaftliche Kräftegleichgewicht und überhaupt um einen stabilen gesellschaftlichen Grundkonsens.[12] Den Managern, die in ideologischer Verblendung immer und überall „Flexibilität“ fordern, von ihren Arbeitnehmern und den Gewerkschaften nämlich, reden sie mit dem Hinweis ins Gewissen, an der 31-Prozent-Forderung der GDL könnten und müssten sie doch merken, was sie an ihren großen DGB-Gewerkschaften haben, die längst zur marktwirtschaftlichen Vernunft bekehrt, zu jedem Kompromiss bereit und dankenswerterweise mächtig genug sind, alles Notwendige bei Deutschlands Arbeitnehmerschaft flächendeckend durchzusetzen.[13] Wenn die eine ungefähr gleiche Armut für alle organisieren, herrscht Solidarität, und die Unternehmen haben Ruhe im Betrieb. Deswegen darf man konkurrierenden Sonderinteressen nur so viel Freiraum gewähren und organisierte Einflussnahme zugestehen, wie taktisch notwendig ist, um sie einzubinden und eben nicht zu Irrläufern werden zu lassen. Das muss man allerdings auch. Dass die DGB-Gewerkschaften dafür zu unflexibel sein könnten: Das ist die Gefahr, die diese Ordnungsfraktion immerhin auch sieht und ausgeräumt wissen will.[14]
So finden die gegensätzlichen Positionen dann doch allmählich zu einem Konsens: Gewerkschaften, wie die Nation, die Wirtschaft und die Arbeitnehmer sie brauchen, das wären flexible, nach innen durchsetzungsfähige, dabei für alle berechtigten Sonderinteressen offene, ansonsten möglichst machtlose Ordnungsfaktoren. Und siehe da: Ungefähr haargenau auf der Linie einigen sich GDL und Bahn AG mit ihren „Mediatoren“ vom Seniorenclub der CDU und den Mehrheitsgewerkschaften: Die Lokführer marschieren zurück in Richtung auf einen ordentlichen Tarifverbund mit Transnet und GDBA[15] und bringen da die nötige Flexibilität hinein. Und die Bahn AG verspricht, ihren Druck auf Lohn und Leistung in Zukunft mehr berufsgruppenspezifisch auszuüben.
[1] Vgl. GegenStandpunkt 2-07
[2] Vgl. GegenStandpunkt 2-07
[3] Die GDL will eine Erhöhung der Tabellenentgelte ohne Zulagen um 31 %, eine Verringerung der Wochenarbeitszeit um 1 Stunde, maximale Schichtlänge 12 statt 14 Stunden; mehr Ruhezeiträume, Ruhetage sowie freie Wochenenden und eine Verkürzung der ununterbrochenen Fahrzeit auf 4 Stunden von bisher 5; sowie die Festschreibung der ‚vollständigen Schichtsymmetrie‘, d.h. Beginn und Ende der Schicht am gleichen Ort.
(Junge Welt 6.8.07) Die meisten dieser Forderungen hat die GDL schon früher aufgestellt, bisher aber nicht durchsetzen können.
[4] Gewerkschafter haben kein Problem, mit ihrem zynischen Verhältnis zu den Mitgliedern zu werben: Die Warnstreiks haben ein Ventil geöffnet, die Mitarbeiter können endlich ablassen. Das war dringend nötig.
(ein Funktionär der Gewerkschaft Transnet, zit. nach Welt-online, 3.7.)
[5] Es ist unklar, ob die Bahn überhaupt einen Unterschied zwischen GDL-Mitgliedern und anderen Beschäftigten machen kann. ‚Unsere Tarifexperten prüfen das gerade‘, sagte ein Bahnsprecher.
(SZ, 12.7.) Fraglich ist, ob die Bahn-Strategie zu halten ist. ‚Man braucht darauf nicht zu antworten‘, sagt der Bonner Arbeitsrechtler Gregor Thüsing. ‚Beschäftigte haben auch ohne eine Antwort ein Anrecht auf diese Leistung. Auch die Gdler‘. Die Bahn sieht das anders: ‚Das ist aus unserer Sicht eine ganz saubere Sache‘, sagt ein Unternehmenssprecher. ‚Unsere Arbeitsrechtler haben das geprüft.‘ Sieht sehr danach aus, als müssten sich die Gerichte auch dieser Sache annehmen.
(SZ, 21.7.)
[6] „Die Lokführer dürften vorläufig zumindest nicht streiken, weil sie damit nicht nur der Deutschen Bahn AG, sondern der gesamten Volkswirtschaft insbesondere in der Hauptreisezeit immense wirtschaftliche Schäden‘ zufügen würden, hatte Steindl (Arbeitsrichterin in Nürnberg) entschieden. Sie habe ‚Zweifel an der Rechtmäßigkeit dieses Streiks‘. Diese Einschränkung des Streikrechts ‚im Rahmen einer Gesamtabwägung‘ sei ‚angesichts der irreversiblen Folgen derzeit eher hinzunehmen, als einen möglicherweise rechtswidrigen Streik zuzulassen‘. Eine Rechtsposition, die heftige politische Debatten ausgelöst hat, die Gewerkschaften bis hin zur GDL-Konkurrenz Verdi auf die Palme bringt und selbst unter Steindls Berufskollegen höchst umstritten ist.“ (SZ, 10.8.)
[7] Ein Ehrenpreis (in punkto Absurdität) gebührt einer deutschen Arbeitsrichterin, die auf die glänzende Idee kam, einen Streik zu verbieten, weil er wirtschaftlichen Schaden anrichten könnte. Sie hatte in ihrer Weisheit einen Moment lang übersehen, dass genau dies Sinn und Zweck eines Streiks ist.
(FAZ, 9.8.)
[8] In der Sache verwies das Nürnberger Gericht auf den hohen volkswirtschaftlichen Schaden, der durch den Streik gerade zur Hauptreisezeit entstünde; angesichts dessen sei er unverhältnismäßig. Aber eigentlich kommt jeder Streik zur Unzeit. Und fast jeder Streik führt, je nach Dauer, zu wirtschaftlichen Verlusten. Diese Verluste sind ja gerade das Druckmittel, die der streikenden Gewerkschaft eine Durchsetzungschance für ihre Forderungen gibt. Die Kritiker der Nürnberger Entscheidung weisen deshalb darauf hin, dass mit der bloßen Gewichtung des wirtschaftlichen Schadens das grundgesetzliche Streikrecht ausgehöhlt wird.
(SZ, 9.8.)
[9] Aber wäre tariflichen Zersplitterung wirklich ein Erfolg? ... Die Separierung birgt die große Gefahr, dass sich kleine Gruppen mit Partikularinteressen zum Schaden des Unternehmens und der Volkswirtschaft in Szene setzen.
(FAZ, 9.8.)
[10] In Frankfurt findet man Vorschläge aus der Politik grotesk, berufsständische Organisationen (Lokführer und Piloten) künftig nicht mehr als Gewerkschaften zuzulassen. Das wäre eine Art amtlicher Gewerkschafts-TÜV als Prüfstelle der Tarifwürdigkeit. Den mächtigen Verbänden des Tarifkartells käme das Verbot gerade recht; sie wären die letzten Wettbewerber losgeworden. Besser wäre es, die Politik dächte anstatt über mehr über weniger Regulierung der Lohnfindung nach und nähme den Gewerkschaften und Verbänden ihre Privilegien. Sollte sich dann herausstellen, dass Lokführer knapp und besonders produktiv sind, wird ihr Einkommen von allein steigen.
(FAZ, 9.8.) Dann bräuchten sie noch nicht einmal mehr die GDL; sie bräuchten bloß noch ihren Mehdorn, der seine Leute zählt, in seine Bilanzen guckt und prompt von ganz allein Geld ’rausrückt...
[11] Bestes Kriterium für den Preis der Arbeit ist die Knappheit der Qualifikation. Sind Ärzte und Lokführer rar, darf deren Einkommen steigen – bis ihnen, davon angelockt, Lohnkonkurrenz durch neue Berufsanfänger erwächst.
(FAZ, 14.8.) Und nochmal ausführlich die linksliberalen Kollegen: Schlagkräftige Eliten nutzen ihre exponierte Stellung, um im Alleingang ihre Wünsche durchzusetzen. ... Auch die Arbeitgeber brauchen die Tarifeinheit, weil es für sie unzumutbar ist, ständig neue Verhandlungen mit Minderheiten zu führen. Permanente Konflikte in den Betrieben wären die Folge, härtere Auseinandersetzungen, wildere und häufigere Streiks.
Aber: So muss es nicht kommen, und so wird es wohl nicht kommen. Die Angst, der Durchbruch der Ärzte und Piloten könnte die große Flut einleiten, ist weit übertrieben. Nur wenige Spezialisten verfügen über so viel Macht und Standesbewusstsein(!), um im Alleingang zu bestehen.
(FR, 29.8.)
[12] Die Arbeitgeber, in diesem Fall die Bahn, sind diesen Funktionseliten praktisch hilflos ausgeliefert, weil es sich um Arbeitnehmer handelt, die ein Unternehmen faktisch stilllegen können. Das verstößt aber gegen das Prinzip der Parität: Arbeitgeber und Arbeitnehmer sollen sich in Tarifverhandlungen auf gleicher Augenhöhe begegnen können. ... Das Prinzip der Aussperrung funktioniert im Bahnstreik nicht... Wenn man das zu Ende denkt, könnten die Lokführer auch 57 % mehr fordern und das theoretisch auch durchsetzen, weil die Arbeitgeber kein Mittel dagegen haben.
(Arbeitsrechtler Picker, tagesschau.de, 8.8.) Und noch einmal der FR-Kommentator, der offenbar eigene Kollegen zitiert, bevor er sich zur Entwarnung entschließt: Die geldgierigen Eliten kündigen der Mehrheit die Solidarität, reißen tiefe Gräben im Unternehmen auf und bringen die Tariflandschaft ins Wanken.
(FR, 29.8.)
[13] Gibt es in anderen Branchen nicht immer wieder Klagen über die Flächentarifverträge. Darüber, dass sie zu teuer und zu unflexibel seien? Dieser Konflikt dürfte vielen Arbeitgebern noch eine Lehre sein: Bei Mehdorn können sie besichtigen, was die Alternative wäre.
(SZ, 11.7.)
[14] Gerade Manager sollten wissen, dass sich das Wirtschaftsleben immer weiter differenziert, dass eben nicht mehr die gleichen Bedingungen für alle gelten können... Lokführer sind besser ausgebildet, arbeiten unregelmäßiger und tragen deutlich mehr Verantwortung als viele andere Bahnmitarbeiter. ... Wenn es den großen Gewerkschaften nicht gelingt, bei ihrem Tarifmix berechtigte Sonderinteressen zu berücksichtigen, werden sie zu Recht mit kleineren, schneidigeren Konkurrenten konfrontiert.
(SZ, 11.7.) Die Arbeitgeber und die Gewerkschaften, die laut die Aufspaltung beklagen, können ihr selbst entgegenwirken. Die Klinikärzte und Lokführer stoßen mit ihren Arbeitskämpfen auch deswegen in der Bevölkerung auf so viel Verständnis, weil ihre Anliegen in den kollektiven Tarifverhandlungen jahrelang zu wenig berücksichtigt wurden.
(FR, 29.8.)
[15] Die Lokführergewerkschaft GdL und ihr Vorsitzender Schell sind in der Wirklichkeit der deutschen Tarifpolitik angekommen – und in der stoßen allzu kämpferische Arbeiterführer rasch an Grenzen.
(ebd.) Dieser schöne Erfolg erklärt nebenbei, weshalb die Rundschau den Zwergenaufstand der Lokführer rückblickend so wenig brisant findet.