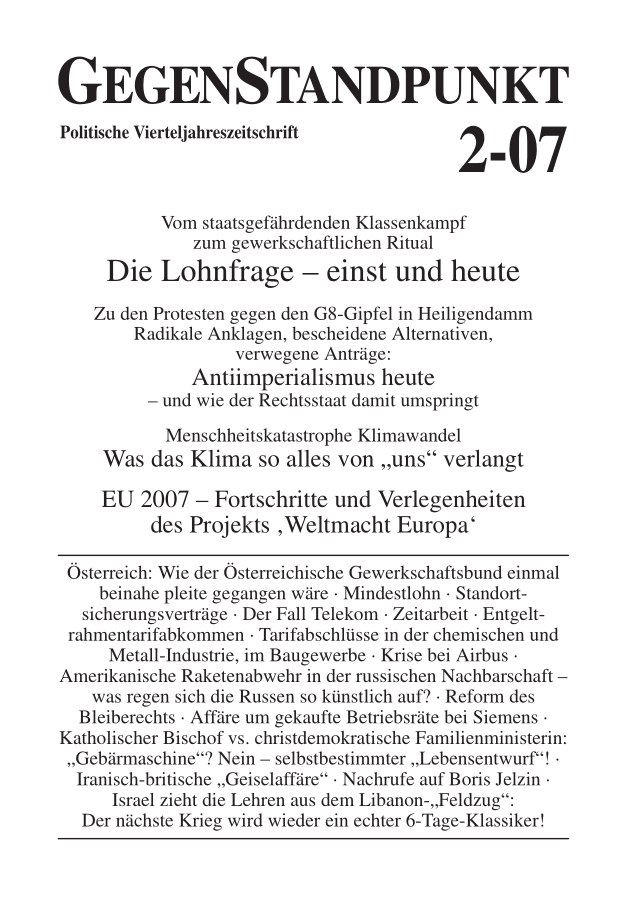Aus der Reihe „Chronik - kein Kommentar!“
Israel, von einem „politischen Erdbeben“ erschüttert, zieht die Lehren aus dem Libanon-„Feldzug“:
Der nächste Krieg wird wieder ein echter 6-Tage-Klassiker!
Ein gutes Dreivierteljahr nach dem Libanon-Feldzug, Anfang Mai, kommt die Winograd-Kommission zu dem überraschenden Ergebnis, dass es sich bei diesem Krieg um ein Scheitern auf breitester Front handelt, um ein „ernsthaftes Versagen“ der hauptverantwortlichen Akteure: „… es ist wahrscheinlich, dass die Entscheidungen, ihre Umsetzung und das Kriegsergebnis bedeutend besser ausgefallen wären, wenn jeder der drei besser gehandelt hätte.“ Noch ohne sich weiter durch den dicken Bericht durchgewühlt zu haben, lässt sich zu der von der hohen Kommission befolgten Aufgabenstellung, dem Misslingen der kriegerischen Aktion auf die Schliche zu kommen, immerhin soviel anmerken: Diese Kritik, die den letzten Krieg Israels für gescheitert erklärt, spricht „vielen Israelis“ aus der Seele, für die „der 34-Tage-Krieg ein Fehlschlag war, weil er nicht die beiden von Olmert gesteckten Hauptziele erreichte – die Rückkehr der Soldaten und das Zerschlagen des Hisbollah, der fast 4000 Raketen auf Nordisrael feuerte. Der Konflikt tötete 158 Israelis und mehr als 1000 Libanesen.“
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Israel, von einem „politischen
Erdbeben“ erschüttert, zieht die Lehren aus dem
Libanon-„Feldzug“:
Der nächste Krieg wird wieder ein
echter 6-Tage-Klassiker!
In Israel (im Unterschied zu autokratischen Herrscherhäusern, Diktaturen oder sonst wie völlig verkehrt angelegten und daher erst noch zu demokratisierenden Staatsgebilden des Middle East) ist man stolz darauf, in einer Demokratie leben zu dürfen, der einzig wahren, funktionierenden im ganzen Orient. Angeblich funktioniert sie deshalb so gut, weil hier niemand Kritik scheut. Dieser Staat hat an der freien Meinung eine ebenso staatstragende Stütze wie an dem an Vorzügen kaum zu überbietenden Gewaltapparat. Mutig wird selbst vor existentiellen Fragen nicht halt gemacht; Sein oder Nichtsein Israels, Krieg und Frieden gehören zu den Lieblingsthemen der kritischen Öffentlichkeit. In diesem aufgeklärten Staatswesen sind die höchsten Staatsmänner selbst die eifrigsten Förderer kritischer Fragestellungen. Manchmal rufen sie sogar Kommissionen ins Leben, die ihre Entscheidungen kritisch hinterfragen sollen; und müssen nach Bekanntgabe der Untersuchungsergebnisse um ihre Macht fürchten, weil eine Protestwelle sie zu überrollen droht. In diesem Land werden die gestalterischen, aufbauenden, staatsschützenden und strategieverbessernden Wirkungen der Kritik hoch geschätzt – und so vermag sie allerhand:
„Weil wir glauben, dass eine der größten Quellen der Stärke unserer Gesellschaft darin liegt, frei, offen und kreativ zu sein, legen wir in diesem Bericht die Betonung darauf, wie wichtig es ist, Lektionen zu lernen. Für uns sind unsere großen Errungenschaften ebenso existentiell wie die Abwehr von Bedrohungen für die israelische Gesellschaft. Um diese Bedrohungen zu bewältigen, muss Israel eine lernfähige Gesellschaft sein – eine Gesellschaft, die ihre Errungenschaften und, insbesondere, ihre Misserfolge einer Prüfung unterzieht, um ihre Fähigkeit, die Zukunft zu meistern, zu verbessern.“ (Die Hauptergebnisse des Winograd-Zwischenberichts zum 2. Libanon-Krieg – Haaretz 1.5.07)
Nach dem Ende des 2. Libanon-Feldzugs im letzten Sommer steht Premier Olmert auf verlorenem Posten. Seine Kabinettsmitglieder sehen ihn geschwächt und arbeiten mit Intrigen auf seinen Sturz hin. Das Volk, das sich nach der Gefangennahme von zwei israelischen Soldaten durch den Hisbollah zu über 80 % einen Krieg gewünscht hat, ist frustriert über das „magere“ Ergebnis und geht auf die Straße. Als Befreiungsschlag beauftragt die „lame duck“ einen Regierungsausschuss mit der Untersuchung der Gründe des „enttäuschenden“ Ertrags dieses Feldzugs. Ein gutes Dreivierteljahr später, Anfang Mai, kommt die nach ihrem Vorsitzende benannte Winograd-Kommission in einem vorläufigen Bericht zu dem überraschenden Ergebnis, dass es sich bei diesem Krieg um ein Scheitern auf breitester Front handelt, um ein „ernsthaftes Versagen“ der hauptverantwortlichen Akteure:
„... es ist wahrscheinlich, dass die Entscheidungen, ihre Umsetzung und das Kriegsergebnis bedeutend besser ausgefallen wären, wenn jeder der drei (sc. Premier, Verteidigungsminister und Generalstabschef) besser gehandelt hätte.“
Noch ohne sich weiter durch den dicken Bericht
durchgewühlt zu haben, lässt sich zu der von der hohen
Kommission befolgten Aufgabenstellung, dem
Misslingen der kriegerischen Aktion auf die
Schliche zu kommen, immerhin soviel anmerken: Diese
Kritik, die den letzten Krieg Israels für gescheitert
erklärt, spricht nicht nur vielen Israelis
aus der
Seele, für die
„der 34-Tage-Krieg ein Fehlschlag war, weil er nicht die beiden von Olmert gesteckten Hauptziele erreichte – die Rückkehr der Soldaten und das Zerschlagen des Hisbollah, der fast 4000 Raketen auf Nordisrael feuerte. Der Konflikt tötete 158 Israelis und mehr als 1000 Libanesen.“ (Washington Post 3.5.)
An Niveau kann diese Kritik es mit den im letzten Krieg verfolgten Zielen ohne weiteres aufnehmen, wenn sie auf deren lückenloser Umsetzung besteht und das Preis-Leistungs-Verhältnis der kriegerischen Aktion für unzumutbar befindet, weil auch nach dem Krieg noch 2 Soldaten fern der Heimat in finsteren Hisbollah-Verliesen schmachten müssen. Die Anspruchshaltung der kriegsentscheidenden Instanzen ist auch die der enttäuschten Israelis, wenn die das Ergebnis der Operation als Verrat an Israels Sicherheitsbedürfnissen in Grund und Boden kritisieren.
Was der Krieg bezweckte, war ja wirklich nicht einfach die Heimholung zweier gefangen genommener Soldaten. Die mit der Entführung abermals ihres Terrorismus überführte Organisation des Hisbollah sollte verfolgt und ausgerottet werden; der Nachbarstaat war in Schutt und Asche zu legen, weil er nicht den ihm zugedachten Auftrag, den Hisbollah zu entwaffnen und zu kontrollieren, zur Zufriedenheit Israels erledigt hat; auch „Unterstützerstaaten des Terrors“ wie Syrien und Iran sollte eine Lehre erteilt werden, da sie sich unzulässigerweise in die Geschicke des Libanon einmischen und den Hisbollah mit Mitteln versorgen. Und schließlich braucht auch die Völkergemeinschaft, die sich nicht schleunigst und nicht intensiv genug um die Umsetzung ihrer Beschlüsse – vor allem der UN-Resolution 1559 vom September 2004, mit der für die „Auflösung und Entwaffnung aller libanesischen und nicht-libanesischen Milizen“ gesorgt werden sollte – im Sinne Israels kümmert, einen kleinen Denkanstoß: Wenn die UNO nicht flott genug voranmacht, hat Israel – genauso wie sein großer Gönner – das Recht, selber zu erledigen, was eigentlich die Staatenschar für es erledigen soll. Ein gewisses gehobenes Anspruchsniveau bei der Umsetzung von Rechten, die in der Nachbarschaft geltend gemacht werden und von der ganzen Welt anerkannt zu werden haben, ist diesem Staat eine Selbstverständlichkeit. Schon bei der „Entführung“ zweier Angehöriger seines Militärs über eine international umstrittene Grenze sieht er sein „Existenzrecht“ bedroht und geht auf die Barrikaden – jenseits der Grenze, versteht sich. Zur Verteidigung seiner vitalen Interessen veranstaltet dieser Staat, wann immer „es sein muss“, Blitzkriege. Durch den Einsatz seiner allen Feinden kolossal überlegenen militärischen Stärke belehrt er Nachbarstaaten oder oppositionelle Gruppierungen über die Aussichtslosigkeit des Versuchs, israelischen Geboten widerstehen zu wollen. Er verschafft sich Respekt und seinen Rechtsstandpunkten Geltung, indem er alles niederbügelt, was sich ihm in den Weg stellt. Und dafür, dass er die Gegnerschaft der Araber üblicherweise in 6-Tagekriegen niederzwingt, erwartet er Bewunderung und Beifall der Staatenwelt.
Von dieser hohen Warte aus erscheint das im letzten Libanonkrieg erzielte Ergebnis äußerst kümmerlich, ja als „Scheitern“. Schon der Umstand, dass die Kampagne 34 Tage dauerte, lässt bei den Schnelleres gewohnten Israelis Zweifel an der Blitzschlagfähigkeit ihres Militärs aufkommen. Entsetzen herrscht, dass die beiden Kriegsziele nur partiell erreicht werden konnten: Zwar ist der Hisbollah geschwächt, die libanesische Regierung bestraft, das Land verwüstet und die Nordgrenze gesichert durch Blauhelm-Soldaten, die von der EU gestellt werden. Doch die Machtdemonstration des 34-Tage-High-Tech-Kriegs fällt für die Abschreckungs-Bedürfnisse der regionalen Supermacht viel zu poplig aus: Den Spezialkräften der israelischen Armee ist es nicht gelungen, die entführten Soldaten zu befreien – die bei der Kommando-Aktion getöteten libanesischen Zivilisten sind als Kollateralschäden, aber nicht als Erfolg zu verbuchen. Der Hisbollah verfügt immer noch über Raketen und Abschussmöglichkeiten; und noch immer steht ihm der Sinn nicht nach Kapitulation, obwohl seine Nachschubwege, d.h. die Infrastruktur des Libanon gründlich zerbombt und sein Hauptoperationsgebiet noch extra mit Cluster-Bomben zugepflastert wurde. Und schließlich macht sich Verzweiflung breit, weil der kaum erwähnenswerte Kriegsertrag mit nicht hinnehmbaren Verlusten – die Hisbollah-Raketen richteten in Nordisrael etlichen Schaden an – bezahlt werden musste:
„Zum ersten Mal wurde die israelische Heimatfront in einem Krieg so weitgehend geschädigt.“ (Daniel Bar-Tal: Der zweite Libanon-Krieg, das Friedenslager und Israel – Wissenschaft & Frieden 1/2007)
So unbefriedigend kann und so skandalös darf „es“ nicht weitergehen, warnt der Bericht der Winograd-Kommission, der Licht ins Dunkel des Scheiterns bringt und Wege aus der Finsternis weist:
„Je größer das Ereignis und je tiefer das Krisengefühl, umso besser stehen die Chancen zur Veränderung und Sanierung der für die Sicherheit des Landes wesentlichen Angelegenheiten.“
Hart geht die Kommission mit „den Verantwortlichen“ ins Gericht. Der in diesem Land verbreiteten Ansicht folgend, dass Israel eigentlich überhaupt keine Kriege verlieren kann, weil seine Gegner allesamt Luschen sind und ihm das Gewohnheitsrecht auf Sieg zusteht, wird hier die Entdeckung gemacht, dass im letzten Krieg Israel an sich selbst gescheitert ist. Zuallererst an seinen missratenen, in Kriegsdingen unerfahrenen Entscheidungsträgern. Der Premierminister – ein Zivilist, der nicht die Grundvoraussetzung für das höchste Staatsamt, die in diesem Land übliche und zu Höherem berechtigende Militärkarriere nachweisen kann; fast noch schlimmer: der Verteidigungsminister – ein ehemaliger Gewerkschaftsführer; und auch vom Generalstabschef lässt sich nichts Rühmliches vermelden außer seinem freiwilligen Rücktritt unmittelbar nach Kriegsende.
Deren verheerende Fehler werden minutiös enthüllt: Die Führung, bar jeglichen strategischen Denkens und ohne detaillierten militärischen Plan, ist „unüberlegt“ und „übereilt“ in diesen Krieg hineingeschlittert, hat mögliche Alternativen – z.B. die möglicherweise effektivere Kombination von Militärschlägen und diplomatischen Offensiven – gar nicht erst erwogen; hat äußerst „zweideutige“ und „vage“ Entscheidungen gefällt und – „ohne ein Verständnis für die Natur und die Implikation der Entscheidungen“ – trottelhaft nicht gewusst, was sie da tat. Die Armeeführung zeichnete sich durch besondere „Unkreativität“ und „Einfallslosigkeit“ aus. Die Kriegsziele wurden nicht „klar und sorgfältig abgesteckt“, und „über das Verhältnis zwischen diesen Zielen und den dafür erforderlichen Militärmitteln“ wurde „ keine Diskussion“ angesetzt. Alle beteiligten Führungskräfte zeichnen sich durch „Unflexibilität“ und „mangelndes Anpassungsvermögen“ aus: Nach ersten unerwarteten Schwierigkeiten, dem Beschuss Nordisraels durch Raketen des Hisbollah, werden keine „Korrekturen“ vorgenommen, eine Exit-Strategie oder ein diplomatisches Ausweich- bzw. Verstärkungs-Programm sind nicht im Tornister. Und auf die allmählich einsetzenden kritischen Einwände der Ministerkollegen erfolgen „keine adäquaten Reaktionen“. So geht’s jedenfalls nicht!
Für den Kriegserfolg von entscheidender Bedeutung – so lautet die Kritik positiv gewendet – sind politische Führer, die sich voller Bedacht in einen Krieg stürzen. Nicht ohne vorher – und nicht erst hinterher – den Rat aller kompetenten Fachleute einzuholen, die militärische Führung zu kontrollieren wie ihr andererseits sämtliche erforderlichen Freiheiten zum Kriegführen zu verschaffen, und vor allem alles rundherum richtig einzuschätzen: die Lage, den Gegner, die eigenen Kräfte, die Stimmung im Volk und den Druck von außen. Wo alle Mittel zur Erledigung der Gegner auf Israels Seite akkumuliert sind, da braucht es zum Sieg nicht viel mehr als eine entschlossene Führung, die weiß, was sie will, nämlich das Waffenarsenal mit Umsicht und Unerschrockenheit gegen den Feind zu lenken. Niederlagen – so der erfolgsverwöhnte Standpunkt einer Siegernation – gehören der Vergangenheit an.
Es sei denn, die Kriegsherren begehen einen Kapitalfehler - nämlich dass sie mit der Vorstellung in den Krieg ziehen, sich diesen eigentlich sparen zu können:
„Es dauerte bis zum März 2007, bis die Regierung die Ereignisse vom Sommer 2006 als den ‚2. Libanon-Krieg‘ bezeichnete. Nach 25 Jahren ohne Krieg erlebte Israel einen Krieg der anderen Art. Dieser Krieg rückte so einige kritische Fragen wieder in den Mittelpunkt, denen Teile der israelischen Gesellschaft lieber auswichen. – Die israelische Armee (IDF) war für diesen Krieg nicht bereit. Als einige unter den vielen Gründe dafür können wir anführen: Manche Mitglieder der politischen und militärischen Eliten Israels sind zu dem Schluss gelangt, dass sich Israel jenseits des Zeitalters der Kriege befindet. Es hatte genug militärische Macht und Überlegenheit, um andere von Kriegserklärungen gegen Israel abzuschrecken; beides reichte auch aus, um jedem, der anscheinend nicht abgeschreckt war, eine schmerzhafte Mahnung zu erteilen; da Israel nicht beabsichtigte, einen Krieg zu beginnen, schloss man, dass die wichtigste Herausforderung für die Landstreitkräfte in asymmetrischen Konflikten niedriger Intensität läge. – Angesichts dieser Annahmen musste die IDF nicht für einen ‚echten‘ Krieg vorbereitet sein.“ (Zwischenbericht)
Diese harten Töne schmettert die Kommission gegen die Führung eines Landes, das seit 40 Jahren ununterbrochen mit nichts anderem beschäftigt ist, als die Sicherheitsbedürfnisse Israels laufend auf den neuesten Stand zu bringen, unermüdlich einen Kampf nach dem anderen zur Verteidigung der existentiellen Rechte dieser Nation zu kämpfen. Das permanente Kriegführen, sei es in Gestalt „richtiger Kriege“ oder in Form von Razzien, Polizeiaktionen größeren Kalibers oder sonstiger verharmlosend „Aktionen“ titulierter Gewalteinsätze, ist Dauerzustand in dieser Nation. Der muss den Kritikern zu Kopf gestiegen sein, wenn sie den niedrig gehängten Titel, mit dem dieser Krieg als „Kampagne“ ausgerufen wurde, den Kriegsherren als Mangel an Entschlossenheit vorhalten, große Taten zu vollbringen. Mit dieser gezielten Verwechslung stellen sie eine Führung an den Pranger, die nicht bereit gewesen wäre, im Krieg das Äußerste zu geben; die vor Gewalt zurückschreckt und bei ihren Befehlen sich der Kriegsnotwendigkeiten nicht bewusst gewesen wäre; die „erfolgsverwöhnt“ und „bequem geworden“ die eigenen Kräfte nur noch an „asymmetrischen“ Zielen wie Steinewerfern, Palästinenserkindern und Selbstmordattentätern gemessen hätte. Eine solche Führung hat den Sinn für das Wesentliche verloren: „Das Zeitalter der Kriege“ ist nicht vorüber – jetzt geht’s doch erst richtig los! Israel soll und will – eine leise verhaltene Kritik am Schutzherren Amerika, der die Ära der asymmetrischen Kriegführung ausgerufen hat, klingt unterschwellig an – ab sofort wieder „richtige Kriege“ führen können.
Diesem, in Israel vermeintlich in Vergessenheit geratenen, Ziel dient der „Lernprozess“, den der Untersuchungsausschuss mit seinem kritischen Bericht „anstoßen“ will. Auf dass ein Ruck durch die Nation gehen möge und sie sich „den langfristigen Hoffnungen“ sowie „den Fragen, die im Zentrum ihrer Existenz als jüdischer und demokratischer Staat stehen“, mit dem nötigen von der Kritik geschärften Kampfgeist stellt:
Wenn das Land „die Totalität der Herausforderungen“ siegreich bestehen will, braucht es – Lektion Nr. 1 – die richtigen Führer. Also steht eine neue Wahlkampfrunde an, und im demokratischen Wettbewerb wird ermittelt, welche Führungskraft am radikalsten für die umfassendsten Sicherheitsbedingungen Israels sorgt. Führer, die aus der Arbeiterpartei kommen, haben kaum Chancen; wer keine Erfahrung als Generalstabschef vorzuweisen hat, kann sich eine Parteikarriere abschminken; und Olmert, der Kriegsverlierer, sitzt nun auf dem Schleuderstuhl. Der Maßstab des Parteienstreits heißt: Wem ist die Stärkung von Israels Kriegsfähigkeit und -bereitschaft am ehesten zuzutrauen? Und die Kriterien, mit denen sich Politiker gegenüber ihren Konkurrenten profilieren, sind militärische Erfahrung, unerschrockene Härte bei der Gewaltanwendung und Entschlossenheit im Antiterrorkampf bzw. bei der Vorbereitung des nächsten Kriegs.
Bei der Auswechslung der Führer darf es – so Lektion Nr. 2 – keinesfalls bleiben. Die neuen Führer brauchen ein neues Volk:
„Die Zeitung ‚Maariv‘ verurteilt sogar die gesamte israelische Gesellschaft: Die Winograd-Kommission sage nichts anderes, als dass man nun die Nation feuern müsste, wenn das nur ginge. Für die israelische Gesellschaft sei ‚die Lage auf dem Aktienmarkt viel wichtiger als an der nördlichen Grenze‘. Es handle sich um eine ‚hedonistische, betrunkene, korrupte Gesellschaft‘.“ (FAZ 2.5.)
Diese Kritik lässt das Volk im Freizeitpark Israel nicht auf sich sitzen. Es beweist seine demokratische Reife und geht nach der Veröffentlichung des Berichts zum Demonstrieren auf die Straße, verlangt den Rücktritt von Olmert und „Wahlen jetzt!“, damit sich verantwortlichere und erfolgstüchtigere Führer der großen Aufgaben der Nation annehmen. In Meinungsumfragen lässt es seine Kriegsbereitschaft abfragen und verlangt zu 71 % von den USA ein Zuschlagen gegen den Iran im Fall des absehbaren Scheiterns der diplomatischen Verhandlungen.
So kommt am Schluss dann doch wieder Israels wichtigste Tugend zum Vorschein: der zionistische Kampfgeist. Gemeinsam – so Lektion Nr. 3 – wird der nächste Krieg vorbereitet, geübt, gewonnen... Volk und Führung werden zum Exerzieren geschickt, um sich auf die neuen Kriegsaufgaben vorzubereiten. Es wird aufgerüstet, die Soldaten werden gedrillt, und auch an der Entscheidungsstruktur zwischen Militär und Politik wird jetzt ganz stringent gearbeitet. Eigentlich alles so wie immer. Bis auf eine umwerfende Neuerung: Der nächste militärische Feldzug Israels wird nicht mehr „Kampagne“ genannt werden.