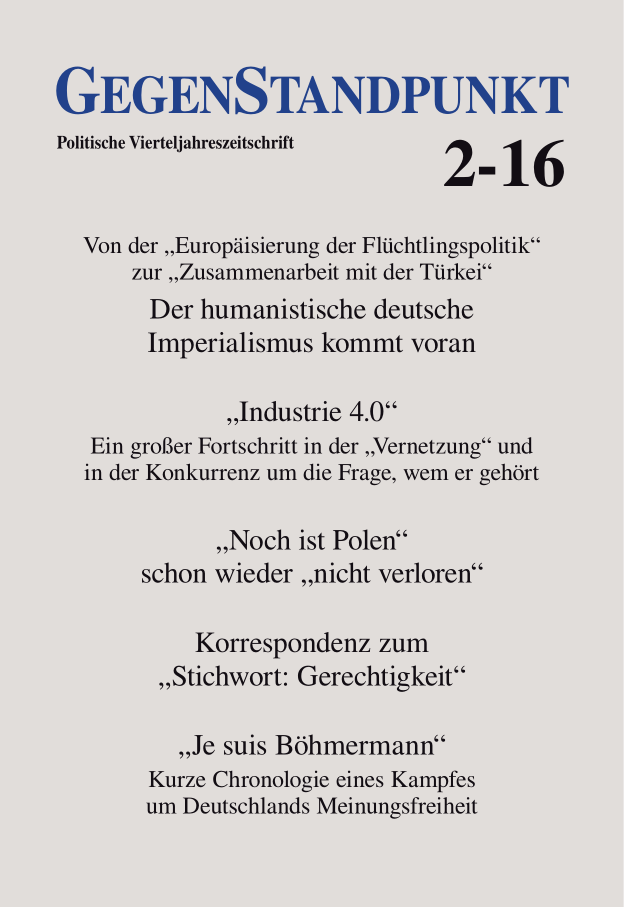Zu dem „Stichwort: Gerechtigkeit“
Zu dem „Stichwort: Gerechtigkeit“ haben uns zwei Leser ihre Bedenken und kritischen Nachfragen mitgeteilt. Wir nehmen uns Raum und Zeit, so gerecht wie möglich darauf zu antworten, und außerdem die Freiheit, ein paar zusätzliche Überlegungen mitzuteilen; zur Sache wie auch zur Art des Nachdenkens darüber.
Der eine Brief wird unter I. fortlaufend kommentiert; im Anschluss daran, unter II., führen wir zur Erläuterung des „Stichworts“ vor, mit welchen Schlüssen aus der uns bekannten Weltsicht moderner Bürger wir zu dem Begriff von Gerechtigkeit – Maxime staatlicher Herrschaft – gelangt sind, von dem die Ableitung ausgeht. Unter III. folgt die andere Zuschrift samt einer Antwort, die mehr methodisch auf selbstgeschaffene Schwierigkeiten beim Verständnis unseres Artikels eingeht.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Zu dem „Stichwort: Gerechtigkeit“ [1]
haben uns zwei Leser ihre Bedenken und kritischen Nachfragen mitgeteilt. Wir nehmen uns Raum und Zeit, so gerecht wie möglich darauf zu antworten, und außerdem die Freiheit, ein paar zusätzliche Überlegungen mitzuteilen; zur Sache wie auch zur Art des Nachdenkens darüber.
Der eine Brief wird unter I. fortlaufend kommentiert; im Anschluss daran, unter II., führen wir zur Erläuterung des „Stichworts“ vor, mit welchen Schlüssen aus der uns bekannten Weltsicht moderner Bürger wir zu dem Begriff von Gerechtigkeit – Maxime staatlicher Herrschaft – gelangt sind, von dem die Ableitung ausgeht. Unter III. folgt die andere Zuschrift samt einer Antwort, die mehr methodisch auf selbstgeschaffene Schwierigkeiten beim Verständnis unseres Artikels eingeht.
I. „Kritische Anmerkungen“ zum Artikel „Stichwort: Gerechtigkeit“
„Der Artikel ist absolut korrekt bis zu dem Punkt, wo die Rede auf „Tauschgerechtigkeit“ kommt, d.h. bis zur Zwischenüberschrift auf S. 51 oben.
Die Rede von der „Tauschgerechtigkeit“ ist jedoch in mehrfacher Hinsicht verfehlt:
– Sie stellt einen Bruch im logischen Fortgang des Artikels dar
– Sie ist überflüssig
– Sie beruht auf einer logisch unhaltbaren Definition
– Sie entspricht nicht der Wirklichkeit
– Sie verstellt den Blick auf wesentliche Aspekte der Gerechtigkeit
Sie stellt einen Bruch im logischen Fortgang des Artikels dar:
Auf S. 48 heißt es: Die Herrschaft beansprucht, durch
die Anwendung ihrer Gewalt gegen ihre Untertanen zugleich
ein Entsprechungsverhältnis herzustellen: In der
Exekution von Herrschaftsprinzipien will sie … eine
Ordnung gestiftet haben, die ihren Adressaten gemäß
ist.
Es ist also ein Entsprechungsverhältnis zu den
Personen, den Untertanen. Im Strafrecht wird der
Anspruch, der delinquenten Person zu entsprechen, dadurch
in die Tat umgesetzt, dass das Strafmaß von deren
Schuldfähigkeit, Vorsatz, Motiv, Vorleben etc. abhängig
gemacht wird. Und in der Überleitung zu Abschnitt 2. des
Artikels hießt es: „worin und wodurch sie [die
Herrschaft] ihren Untertanen [also Personen!]
zu entsprechen beansprucht, folgt weder aus dem
Formalismus der Unterwerfung, noch aus dem Prinzip der
Gerechtigkeit … [sondern] aus den besonderen
gesellschaftlichen Reproduktionsverhältnissen…“ (S.
50)
Zu Beginn des Abschnitts 2. wird als allgemeinste
Bestimmung der Bürger, denen der Staat im Kapitalismus
gerecht wird, die als gleiche und freie Privateigentümer
genannt. Der Staat nimmt sie als solche vor
Übergriffen in Schutz
und nötigt ihnen zugleich auf,
sich bei der Verfolgung ihres Materialismus an den
ebenso ins Recht gesetzten, konkurrierenden Interessen
der anderen zu relativieren.
(S.
50) In Bezug auf Kauf- und andere Verträge heißt
das, dass er bei deren Abschluss Praktiken wie arglistige
Täuschung, Nötigung, Überrumpelung o.ä. verbietet, da er
darin Angriffe auf die Entscheidungsfreiheit der
vertragschließenden Privatpersonen erkennt. Das geschieht
in schwereren Fällen durchaus auch durch das Strafrecht;
in leichteren Fällen beschränkt sich die staatliche
Sanktion darauf, dass er die inkriminierten
Machenschaften als Anfechtungsgründe gegen so zustande
gekommene Verträge anerkennt – und zwar unabhängig davon,
was in den Verträgen vereinbart wurde. Insoweit
bezieht sich auch hier das Recht – und die Gerechtigkeit
der staatlichen Sanktionen – auf die beteiligten
Personen.
So weit, so richtig.“
Das Kompliment beruht auf einer Fehlinterpretation des angesprochenen Abschnitts. Die „kritischen Anmerkungen“ (im Folgenden: k.A.) reden von „Kauf- und anderen Verträgen“ als von einem besonderen Bereich staatlicher Rechtsaufsicht und sehen diese in der Sanktionierung (im negativen Sinn des Wortes) betrügerischer Machenschaften verwirklicht. Gemeint und ausgedrückt ist in dem angegebenen Absatz etwas anderes: dass die bürgerliche Staatsmacht sich mit ihrem Recht insgesamt und überhaupt positiv auf die Konkurrenz ihrer Bürger ums Geld als ihr elementares Lebensmittel bezieht; so nämlich, dass sie diese Konkurrenz als antagonistisches Willensverhältnis zwischen kooperationswilligen Privateigentümern definiert und (im positiven Sinn des Wortes) sanktioniert. Ein Handelsrecht, das die formellen Kriterien für die Gültigkeit von Kauf- resp. Verkaufsakten aufstellt, ein Katalog unzulässiger Praktiken samt staatlichen Maßnahmen, die Zuwiderhandlungen mit Strafen belegen, und vieles andere ist in diesem Prinzip der bürgerlichen Rechtsordnung zwar eingeschlossen. Es ist aber falsch, das Verhältnis der Anerkennung und funktionalen Beschränkung, in das die bürgerliche Staatsgewalt sich mit ihrer Rechtsordnung zu den Lebensinteressen ihrer um Gelderwerb konkurrierenden Bürger setzt, gedanklich erst mit besonderen Rechtsbereichen und dem Einschreiten von Gesetzgeber und Justiz gegen verbotene Praktiken beginnen zu lassen.
„Nun kommt aber auf S. 51 die Rede auf etwas, das dort „Tauschgerechtigkeit“ genannt wird.
Das bisher Entwickelte ist kein Grund, von einer besonderen Form der Gerechtigkeit namens „Tauschgerechtigkeit“ zu sprechen, denn ebenso gut könnte man von einer „Eigentumsgerechtigkeit“ sprechen, weil der Staat Diebstahl, oder von einer „Lebensgerechtigkeit“, weil er Mord und Totschlag verbietet. Das ist auf S. 51 auch nicht gemeint.
Vielmehr kommt hier plötzlich ein ganz andersartiges
Entsprechungsverhältnis als Inhalt von Gerechtigkeit ins
Spiel, nämlich eine Äquivalenz von Geben und
Nehmen
im Tausch. Dies ist im Unterschied zu bisher
kein Entsprechungsverhältnis zwischen Herrschaft und
Untertan, sondern – allenfalls – eine temporäre Beziehung
von Bürgern zueinander – ja, genau genommen nur von
Sachen, denn im Tausch wird von den Personen
gerade abstrahiert: sie spielen nur eine Rolle als
Eigentümer der zu tauschenden Gegenstände, ganz
ungeachtet dessen, was sie sonst noch sind oder haben.
Daher kann die Rede von der Tauschgerechtigkeit nicht einlösen, was am Ende von Abschnitt 1. angekündigt wurde, nämlich den dort entwickelten Begriff von Gerechtigkeit – der sich ja auf das Verhältnis zwischen Herrschaft und Untertanen bezieht – für die kapitalistische Gesellschaft zu konkretisieren.“
Die k.A. setzen hier ihre Fehldeutung des einleitenden
Abschnitts fort: Wo unter der Zwischenüberschrift Das
Vertragsrecht und sein Ideal: die Tauschgerechtigkeit
vom „Tausch von Leistung und Gegenleistung“ als dem
allgemeinen Inhalt der antagonistischen
Willensverhältnisse die Rede ist, denen der bürgerliche
Staat im Vertrag die sachgerechte abstrakte Rechtsform
verpasst; wo also unzweideutig an die widersprüchliche
Beziehung wechselseitiger Benutzung bei wechselseitigem
Ausschluss zwischen Privateigentümern gedacht ist, die
der bürgerliche Staat als Grundfigur der
gesellschaftlichen Beziehungen durchsetzt, indem er sie
unter seinen Gewaltvorbehalt stellt; da lesen die k.A.
nur „Tausch“, denken sich dazu offenbar die „temporäre
Beziehung“, die Angestellte und Kunden im Kaufhaus
miteinander eingehen, und erklären den Status des
Eigentümers, mit dessen „Schutz“ der bürgerliche Staat
die politökonomische Identität seiner Bürger, nämlich ihr
Dasein als Charaktermasken kapitalistischer
Produktionsverhältnisse, in den Rang deren wichtigsten
Rechtsguts erhebt, zu einer ziemlichen Nebensache neben
dem, „was sie sonst noch sind oder haben“. Es ist klar,
dass dann der hohe Stellenwert unverständlich wird, den
wir der Forderung nach Tauschgerechtigkeit zuschreiben
und an dem wir auch festhalten – aus einem Grund, den man
sich mit Blick auf das generelle Bewusstsein bürgerlicher
Erwerbspersonen von ihren einschlägigen Bemühungen leicht
klarmachen kann:
Das Ideal einer gültigen Entsprechung zwischen Leistung und Gegenleistung – zwischen Ware und Preis, zwischen Aufwand und Ertrag, zwischen Arbeit und ihrer Vergütung, was auch immer den allgemeinen Begriff des Tauschs erfüllt – steht im bürgerlichen Verstand als verkehrter Grundbegriff der gesellschaftlichen Verhältnisse an der Stelle, wo in der – von Marx erklärten – Realität der kapitalistischen Ökonomie die „substanzielle“ Gleichung von abstrakter Arbeit und Wertschöpfung steht: menschliche Arbeit, nach ihrer notwendigen Dauer gemessen im Produkt durch dessen Gleichsetzung mit anderen Produkten, in dieser abstrakten dinglichen Bestimmung – als Wert –, getrennt von den gleichgesetzten Arbeitsprodukten, realisiert im Geld. Dieser Begriff des „Tauschwerts der Waren“, immerhin der Elementarform des Reichtums in kapitalistisch produzierenden Gesellschaften, ist und bleibt dem bürgerlichen Denken herzlich egal, weil es ihm in allen ökonomischen Verhältnissen auf die Menge des getauschten Werts ankommt. Dieses Interesse, von Staats wegen ins Recht gesetzt und in die Schranken des rechtlich Zulässigen verwiesen, verschafft sich mit der Gewalt seiner Mittel Geltung und versteift sich dabei zu seiner Rechtfertigung – in Ermangelung eines objektiven ökonomischen Kriteriums der Angemessenheit von Leistung und Gegenleistung – auf das Ideal eines moralisch befriedigenden Entsprechungsverhältnisses.
Mit der Ermächtigung und Beschränkung der konkurrierenden Interessen und der einschränkenden Lizenzierung ihres Machtkampfs begibt sich die bürgerliche Staatsgewalt in die Rolle des verantwortlichen Schiedsrichters: nicht allein des Monopolisten, der sich den Gebrauch von Gewalt vorbehält, sondern der höheren Instanz, die auch für die moralische Richtigkeit des von ihr überwachten Konkurrenzkampfes haftet.
„Sie ist überflüssig:
Vom Kinderzimmer („Der Felix hat ein viel größeres Stück Kuchen bekommen; das ist ungerecht!“) bis hin zu Parteiprogrammen („… gehört der Ertrag der Arbeit unverkürzt, nach gleichem Rechte, allen Gesellschaftsgliedern“ Gothaer Programm) ist der Gleichbehandlungsgrundsatz so eng mit dem Begriff der Gerechtigkeit verbunden, dass er mitunter geradezu als ein Synonym für dieselbe erscheint. Wie hängt der Gleichbehandlungsgrundsatz mit dem Begriff der Gerechtigkeit als einem Entsprechungsverhältnis der Herrschaft zu den Beherrschten zusammen? Ganz einfach: er ergibt sich daraus in einem simplen Umkehrschluss: da, wo keine für das Herrschaftsverhältnis relevanten Unterschiede zwischen den Beherrschten bestehen, sind diese auch nicht unterschiedlich zu behandeln.“
Was die k.A. als „simplen Umkehrschluss“ anbieten, löst das Entsprechungsverhältnis zwischen Herrschaft und Bürgern, wie das Ideal der Gerechtigkeit es postuliert, in eine Tautologie auf – die „Entsprechung“ läge darin, dass der Staat kein Aufhebens von Unterschieden zwischen seinen Untertanen macht, die für ihn ohnehin nicht relevant sind –, die weder mit Gerechtigkeit etwas zu tun hat noch mit dem zum Argument gemachten Gleichbehandlungsgrundsatz. Mit letzterem gebietet der bürgerliche Rechtsstaat sich und seinen Bürgern, alle Unterschiede in den materiellen Mitteln, mit denen die Akteure seiner Konkurrenzgesellschaft aufeinander losgehen und einander für ihren Gelderwerb funktionalisieren, dem Prinzip der wechselseitigen Anerkennung als freie Rechtssubjekte, als Inhaber eines förmlich zu respektierenden Willens, unterzuordnen. Diese einschränkende Ermächtigung, sich die gesellschaftlichen Verhältnisse zunutze zu machen, lässt die Unterschiede in den dafür benutzten materiellen Mitteln nicht bloß bestehen; mit ihr erkennt der Rechtsstaat diese Unterschiede und ihren Gebrauch im bürgerlichen Konkurrenzkampf, soweit mit seinem Schutz von Person und Eigentum kompatibel, als rechtlich korrekte Sachlage an; er sanktioniert sie (im positiven Sinn des Wortes). Eben deswegen ist der Gleichbehandlungsgrundsatz für die bürgerliche Gesellschaft und ihren Staat überhaupt so wichtig: Mit ihm stellt die Herrschaft sich die Aufgabe, die Interessengegensätze zwischen ihren Bürgern und den Gebrauch ihrer jeweiligen Mittel für gegenseitige Ausnutzung als ein Willensverhältnis freier Subjekte zu kodifizieren – als Vertragsverhältnis in dem Sinn, in dem davon schon die Rede war.
Das Gebot der Gleichheit formal freier Willen, das der bürgerliche Rechtsstaat damit sich selber und seinen Bürgern für ihren Umgang miteinander vorgibt, ist ein Prinzip der rechtlichen Ordnung eben der Konkurrenzgesellschaft, die Anlass genug zu flächendeckender Unzufriedenheit bietet. Auf dieses Produkt seiner Herrschaft bezieht dieser Staat sich mit seiner – in unserem Artikel ausgeführten – Lebenslüge, mit seiner ordnenden Herrschaft würde er dem wahren Wesen seiner Menschen gerecht. Diese Differenz zwischen Rechtsgrundsatz und staatlichem Ethos übersehen die k.A. mit ihrem „simplen Umkehrschluss“, lassen an dieser Stelle also Gerechtigkeit, den von allen Seiten beanspruchten höheren Sinn der Rechtsordnung, gar nicht als eigenen Gegenstand gelten. Insofern sind Überlegungen dazu in der Tat „überflüssig“.
„Damit sind wir schon mitten im Thema „Verteilungsgerechtigkeit“. Wozu also der Umweg zur „Tauschgerechtigkeit“ hin und zurück? Angemerkt sei, dass im Rest des Artikels bisweilen eingestreute Bezugnahmen auf „Tauschgerechtigkeit“ gar nicht für die Argumentation wesentlich und notwendig sind. Insbesondere werden die Gegenstände aus dem Abschnitt 4 („Maxime zwischenmenschlicher Gemeinheiten“) in der Schrift „Die Psychologie des bürgerlichen Individuums“ ganz ohne Bezugnahme auf so etwas wie Tauschgerechtigkeit dargestellt und erklärt.“
Von ihrem Beschluss, sich mit dem Begriff der Tauschgerechtigkeit nicht zu befassen, lassen sich die k.A. leider auch durch den Abschnitt nicht abbringen, der von dem wichtigsten ideologischen Gehalt dieser Idee handelt: Sie misst das im Geld beschlossene Kommando der Kapitalisten über die Arbeit am Ideal einer moralisch anerkennenswerten Äquivalenz zwischen Arbeit und Entgelt. Ihnen entgeht daher auch der Fortgang von diesem Ideal zur Idee einer von Staats wegen vorzunehmenden Korrektur an Konkurrenzergebnissen, die mit der Idee einer gerechten Äquivalenz nicht – mehr – in Einklang zu bringen sind; was übrigens allemal dann der Fall ist, wenn ein bürgerlicher Staat sich aus handfesteren Gründen zu sozialpolitischen Eingriffen in das herrschende Ausbeutungswesen entschließt. Dass diese Eingriffe nicht zu weit gehen, wird dann wieder im Namen der Leistungsgerechtigkeit gefordert und gerechtfertigt …
Mit dem Verweis auf unsere Schrift über „Die Psychologie des bürgerlichen Individuums“ dokumentieren die k.A. – nebenbei – die Mangelhaftigkeit einer Lektüre, die einen Text auf den Gebrauch bestimmter Wörter hin inspiziert. Im Begriff der Tauschgerechtigkeit kann ein Leser des „Psychologie“-Buchs leicht den Gehalt der dort als Leitfaden benutzten Lebensmaximen Anstand & Erfolg wiedererkennen.
„Anmerkung: Im Artikel wird als
Argument, weshalb nun von „Tauschgerechtigkeit“ die Rede
sein müsse, angegeben: Weil die Reproduktion der
kapitalistischen Gesellschaft der Form nach als
Sammelsurium unterschiedlichster Vertragsverhältnisse
vonstattengeht, ist der Vertrag der elementare
Gegenstand, auf den die Lebenslüge der bürgerlichen
Herrschaft sich bezieht. Das Ethos der
Vertragsbeziehungen ist die Tauschgerechtigkeit.
(S. 51) Das ist nicht
schlüssig. Denn gewiss, es ist aus K I, Kap. 1 und 2
bekannt, dass Ware, Tausch und Vertrag die
Elementarformen sind, aus deren Analyse die gesamte
kapitalistische Ökonomie zu entwickeln ist – aber eben
erst einmal nur die Ökonomie. Wenn es darum geht, „höhere
Sphären“ wie Recht, Moral und Gerechtigkeit zu erklären,
kann auf die gesamte Analyse der bürgerlichen
Ökonomie Bezug genommen werden; es besteht kein Grund,
sich auf die Betrachtung der Warenanalyse zu
beschränken.“
Ihre Ablehnung des Begriffs der Tauschgerechtigkeit begründen die k.A. hier mit einer falschen Bezugnahme auf die Anfangskapitel von Marx‘ „Kapital“ sowie mit einer fragwürdigen Empfehlung, wie „höhere Sphären“ des bürgerlichen Staatslebens besser zu erklären wären. Um es mit dem Bezug auf Marx einmal ganz genau zu nehmen: „Ware, Tausch und Vertrag“ sind nicht „die Elementarformen, aus deren Analyse die gesamte kapitalistische Ökonomie zu entwickeln ist“. Von „Elementarform“ sollte man nur reden, wenn man weiß, um wessen elementare Form es sich handelt – um die des Reichtums kapitalistisch produzierender Gesellschaften bei der Ware –; „Tausch“ ist die widersprüchliche Zweckbestimmung des in produzierten Waren vergegenständlichten Gebrauchswerts; „Vertrag“ ist die allgemeine Rechtsform des gesellschaftlichen Verkehrs im kapitalistischen Gemeinwesen und kennzeichnet im 2. Kapitel des „Kapital“ die dort unterstellte und nicht weiter behandelte rechtliche Seite des marktwirtschaftlichen Geschäftslebens; und „aus KI, Kap. 1 und 2“ ist überhaupt nicht „bekannt“, dass daraus schon die gesamte kapitalistische Ökonomie abzuleiten ist – das weiß man erst, wenn man die Ableitung mit vollzogen hat; im ersten Kapitel ist das erst einmal ein sehr anspruchsvolles implizites Versprechen. Wer sie mitvollzogen hat, hat wiederum kein Problem damit, in der kapitalistischen Ökonomie die gnadenlosen Konsequenzen der Ökonomie der Privatmacht des Geldes zu erkennen, und wird die „Betrachtung der Warenanalyse“, was immer das sein soll, jedenfalls den theoretischen Gehalt dieser Analyse nicht als eine Erkenntnis „betrachten“, auf die man sich fürs Begreifen ganz anderer Gegenstände „beschränken“ könnte. Dann wird man allerdings auch die Erklärung von Dingen „wie Recht, Moral und Gerechtigkeit“ weder aus dem Begriff des allgemeinen Äquivalents deduzieren wollen noch mit der Lizenz in Angriff nehmen, sich dafür „auf die gesamte Analyse der bürgerlichen Ökonomie“ beziehen zu können – schon gleich nicht, wenn mit dieser Gesamtanalyse dann doch wieder nicht mehr gemeint ist als die Fehlinterpretation der „trinitarischen Formel“, die die k.A. am Ende noch anzubieten haben.
Die Weigerung, Tauschgerechtigkeit einmal so zu verstehen, wie sie in unserem Artikel erläutert ist – und eben nicht im Sinne der Gleichsetzung von Waren, die Marx als die widersprüchliche Natur des kapitalistischen Reichtums begriffen hat –, wird uns mit dieser „Anmerkung“ nicht einsichtiger.
„Sie beruht auf einer logisch unhaltbaren Definition:
Auf S. 51 heißt es:
Sie [die Tauschgerechtigkeit] ist das Versprechen des bürgerlichen Staats,
1. mit der im Vertrag formalisierten freiwilligen Übereinkunft, eigentlich den Ausschluss von Übervorteilung, nämlich Fairness beim Konkurrieren,
2. mit der rechtlichen Vereinbarung gegensätzlicher Willen zugleich deren Vereinbarkeit und
3. durch die vollzogene Gleichsetzung von Leistung und Gegenleistung im Prinzip eine Äquivalenz von Geben und Nehmen realisiert zu haben.
Gerechtigkeit ist ein Versprechen? Herrscht Gerechtigkeit auch dann, wenn das Versprechen nicht eingelöst wird? Wenn nein, dann bestünde die Gerechtigkeit in dem, was da versprochen wird, nicht im Versprechen.“
Die Logik dieser rhetorischen Fragen erschließt sich uns ebenso wenig wie der damit anvisierte Nachweis der „logischen Unhaltbarkeit“ einer Erläuterung, in der die k.A. eine „Definition“ sehen. Klargestellt ist damit immerhin, dass die k.A. mit der zu Anfang begrüßten Erklärung der Gerechtigkeit als Maxime der Herrschaft und verheißungsvolle Ansage an die Beherrschten in Teil 1. unseres Artikels inzwischen nichts mehr anfangen können. Doch:
„Sehen wir uns dennoch die einzelnen Punkte des Versprechens an:
Zu 1.: Ist Fairness beim Konkurrieren dasselbe wie Ausschluss von Übervorteilung? Wenn ja, wäre das so ähnlich, als würde man sagen: wenn im Fußball alle fair und regelkonform spielen, ist ausgeschlossen, dass eine Mannschaft verliert. Oder sollen mit Übervorteilung nur die Fälle gemeint sein, bei welchen das schlechte Ergebnis auf unfaire Machenschaften beim Vertragsabschluss zurückgeht? Dann würde der Punkt 1. zu einer Tautologie zusammenschnurren.
Zu 2.: Die gegensätzlichen Willen als vereinbar zu behandeln – oder auch nicht –, bleibt ganz den Kontrahenten überlassen; was tut der Staat mit seiner Gerechtigkeit dazu?
Zu 3.: Was ist mit „Äquivalenz von Geben und Nehmen“ gemeint? Eine objektive Gleichwertigkeit? Soweit eine solche vorliegen kann, kennen die Agenten des Vertrags oder auch der Staat die doch gar nicht. Oder ist doch nur das Faktum gemeint, dass die beiden Seiten durch den Vertrag gleich-gesetzt werden. Aber damit bliebe wieder nur eine Tautologie übrig.“
„Zu 1.“ bekräftigt die Weigerung, die moralische Maxime staatlicher Herrschaft mitsamt der dadurch begründeten idealistischen Anspruchshaltung der Beherrschten als eigenen Gegenstand neben den herrschaftlich etablierten gesellschaftlichen Lebensverhältnissen theoretisch ernst zu nehmen. Dabei hätte sogar noch das Fußball-Beispiel, das die k.A. ins Feld führen, sie darauf aufmerksam machen können, wie hartnäckig das Ideal der Fairness neben dem tatsächlichen Gang der Ereignisse seine Geltung behauptet.
„Zu 2.“: Die aneinander interessierten Konkurrenzsubjekte finden eine Vereinbarung – oder auch nicht –; die Vereinbarkeit konkurrierend aufeinander bezogener Interessen unterstellt der bürgerliche Rechtsstaat in seinem Vertragsrecht und gibt den Vertragssubjekten mit der Rechtssicherheit, die er stiftet, die Garantie dafür an die Hand, dass das Vereinbarte auch gilt. Diesen praktischen Dienst seiner Gewalt am System der Konkurrenz und dessen Akteuren hält er sich als Wohltat zugute, mit der er dem inneren Selbstverwirklichungsstreben seiner Bürger entspricht.
„Zu 3.“ fällt uns nichts Neues ein.
„Sie entspricht nicht der Wirklichkeit:
Die Rechtsform, mit der die Herrschaft widerstreitende
Ansprüche regelt, ist der Vertrag
(S. 51)
Die Herrschaft regelt nicht die widerstreitenden Ansprüche, das tun die konkurrierenden Bürger selbst. Der Staat gibt ihnen in der Rechtsform des Vertrags nur die Rahmenbedingungen dafür vor.“
Um es noch einmal genau zu nehmen: Die konkurrierenden
Bürger „regeln“ ihre „widerstreitenden Ansprüche“ nicht
in dem Sinn, wie hier von einer Regelung die Rede ist:
Sie werden sich handelseinig – oder auch nicht –; die
Regeln, die hier gemeint sind, sind diejenigen, mit denen
die Staatsgewalt per Ermächtigung und Beschränkung der
widerstreitend aufeinander bezogenen Interessen die
Bedingungen für eine rechtsfeste Übereinkunft vorgibt und
Sicherheit für deren Einhaltung stiftet. Diese Regeln
sind vielleicht im Urteil selbstbewusster Kontrahenten,
in der Sache aber alles andere als ein nur
. In
unserem Aufsatz, und explizit direkt vor dem
inkriminierten Satz, ist – zwecks Abgrenzung von dem
Gerechtigkeits-Ethos der Herrschaft – von der
bürgerlichen Rechtsordnung als dem
Gewaltverhältnis die Rede, mit dem der Staat die
Konkurrenz um Gelderwerb „als die einzig erlaubte Weise
gesellschaftlicher Kooperation allgemein-verbindlich in
Kraft setzt“; aus dem Zusammenhang geht hervor, dass
„gesellschaftliche Kooperation“ nichts Geringeres als den
Reproduktionsprozess des kapitalistischen Gemeinwesens
meint; der zitierte Satz samt nachfolgendem Absatz
erläutert den Vertrag als die Rechtsform, die
der Rechtsstaat dieser Kooperation auferlegt, damit sie
in ihrer Widersprüchlichkeit ihren Gang gehen kann – all
das wird nicht zur Kenntnis genommen. Wir geben zu, dass
solche Überlegungen z.B. im Beratungsgespräch eines
Rechtsanwalts mit einem „konkurrierenden Bürger“ fehl am
Platz wären; wir sehen auch ein, dass sie einem Menschen
fremd sind, der sein Dasein als „konkurrierender Bürger“
überhaupt als eine sehr begrenzte Aktivität neben all den
schöneren Dingen wahrnimmt, die er treibt, und sich mit
der öffentlichen Gewalt nur unter dem Gesichtspunkt
befasst, dass sie seiner Handlungsfreiheit ab und zu, in
speziellen Fällen, „Rahmenbedingungen“ setzt. Eben
deswegen haben wir ja ganz etwas anderes aufgeschrieben.
„Was hier nur wie eine unglückliche Formulierung
erscheint, zieht sich durch den ganzen Absatz durch,
z.B.: Ausschluss von Übervorteilung
– jeder in
dieser Gesellschaft weiß, dass er permanent
selbst darauf aufpassen muss, dass er nicht bei
Kauf, Verkauf oder sonstigen Vertragsabschlüssen übers
Ohr gehauen wird. Die rechtlichen Regelungen bieten
allenfalls die Bedingungen dafür. Oder die
Zwischenüberschrift Das Vertragsrecht und sein Ideal:
die Tauschgerechtigkeit
: Das Ideal zum Vertragsrecht
ist die Vertragsfreiheit, und die besagt so
ziemlich das Gegenteil von einer vom Staat geregelten
Realisierung einer Äquivalenz von Geben und
Nehmen
: nämlich, dass sich der Staat prinzipiell
eben nicht einmischt in die Frage, wer wem was
für welchen Preis verkauft.
Die Moral der Bürger folgt im Übrigen ganz den skizzierten Rechtsverhältnissen: wenn einer über seinen Kontrahenten die Nase rümpft wegen dessen Gerissenheit, Schlitzohrigkeit oder Schlimmerem, dann spricht er damit nur den Verdacht aus, dieser würde sich der inkriminierten Angriffe auf die Entscheidungsfreiheit schuldig machen; wo kein solcher Verdacht besteht, wird einer, der vorteilhafte Geschäfte macht, wegen seiner „Geschäftstüchtigkeit“ bewundert, und ist der, der sich übervorteilen lässt, „selber schuld“. In den Köpfen der Leute findet sich so etwas wie die Moral von Tauschgerechtigkeit offenbar nicht; aber Tauschgerechtigkeit – sofern es so etwas gibt – ist ein Ideal, also ein Gegenstand des Bewusstseins, müsste also in den Köpfen zu finden sein.
Das gilt ebenso für die Tugenden. Von Gerechtigkeit als Tugend ist – ganz im Einklang mit Abschnitt 1. – im allgemeinen Sprachgebrauch da und nur da die Rede, wo persönliche Abhängigkeiten bestehen: Vorgesetzte können gegenüber ihren Untergebenen gerecht oder ungerecht sein, Lehrer gegenüber den Schülern oder Eltern gegenüber den Kindern. In allen diesen Verhältnissen geht es aber gerade nicht um Tausch. (Um möglichen Einwänden zuvorzukommen: bei den Vorgesetzten sind die Arbeitsverträge nur die Voraussetzung für deren Tätigkeit; Gegenstand der Tätigkeit ist die Organisation des Gebrauchs der Arbeitskraft)
Die ethische oder moralische Kategorie der Gerechtigkeit
ist etwas, was mit dem Tausch weder im allgemeinen
Bewusstsein in Verbindung gebracht wird, noch damit in
begrifflichem Zusammenhang steht. Das elementare Ethos
der bürgerlichen Gesellschaft
(S. 51) kann Tauschgerechtigkeit – was
immer das sein soll – erst recht nicht sein.“
Die Beispiele, auf die die k.A. sich in diesem und einigen der folgenden Abschnitte berufen, werden in der Rekapitulation des Stichworts unter II. aufgenommen und eingeordnet.
„Sie verstellt den Blick auf wesentliche Aspekte der Gerechtigkeit:
Auf S. 52 heißt es: Damit leistet die
Verteilungsgerechtigkeit sich das Quidproquo, die
Inkommensurabilität der verschiedenen ‚Einkommen‘ – vom
Lohn abhängig Beschäftigter bis hin zur Realisierung von
Gewinnen aus der profitablen Ausnutzung fremder Arbeit –
in einen bloß quantitativen Unterschied verdienter
Anteile an einem imaginierten großen Geld-Kuchen zu
übersetzen.
Diese richtige Feststellung dient im
Artikel bedauerlicherweise lediglich als Sprungbrett zur
Idee der Leistungsgerechtigkeit, ohne dass die daraus
möglichen Rückschlüsse auf das zugrundeliegende
Bewusstsein der Leute und die damit verbundenen
Gerechtigkeitsvorstellungen aufgezeigt würden.
Kapital – Profit, Boden – Grundrente, Arbeit –
Arbeitslohn, dies ist die trinitarische Form, die alle
Geheimnisse des gesellschaftlichen Produktionsprozesses
einbegreift.
(K III, S.
822)
und weiter hierzu: Die Vulgärökonomie tut in der Tat
nichts, als die Vorstellungen der in den bürgerlichen
Produktionsverhältnissen befangenen Agenten dieser
Produktion doktrinär zu verdolmetschen… Es darf uns also
nicht wundernehmen, … [wenn der Vulgärökonomie] diese
Verhältnisse um so selbstverständlicher erscheinen, je
mehr der innere Zusammenhang an ihnen verborgen ist, sie
aber der ordinären Vorstellung geläufig sind.
(ibid. S. 825)
Die trinitarische Formel ist demnach die Form, in der den „Dramatis Personae“ der bürgerlichen Ökonomie ihre Rolle in letzterer in ihrer „ordinären Vorstellung geläufig“ ist. Der Übergang, den das bürgerliche Bewusstsein von dort zu Gerechtigkeitsidealen macht, ist ebenso einfach wie verkehrt: weil jede ökonomische Rolle im Rahmen der als selbstverständlich und naturgegeben aufgefassten kapitalistischen Produktionsweise ihre Notwendigkeit hat – sonst ließe sich aus ihr ja keine Revenue erzielen – glaubt ein jeder, mit seiner bestimmten Rolle ein „nützliches Glied der Gemeinschaft“ zu sein, und fordert dafür eine entsprechende ideelle und materielle Würdigung ein. Um den Bezug zum Abschnitt 1. des Artikels aufzuzeigen: Es ist diese verkehrte Form, in der die Staatsbürger ihre eigene Stellung in der Ökonomie – und natürlich auch die der anderen – wahrnehmen, und gemäß der sie ein gerechtes Entsprechungsverhältnis der Herrschaft zu sich einfordern.“
Das anfangs geäußerte Bedauern gilt der Tatsache, dass der Artikel bei seinem Thema bleibt. Er macht weder den Absprung zum „Bewusstsein der Leute“ im allgemeinen noch im besonderen den Fehler, den Grund des Ethos der Gerechtigkeit und seiner bürgerlichen Ausformungen – so wie im Attribut „zugrundeliegend“ insinuiert – in diesem „Bewusstsein“ zu suchen. Der „Übergang“, den die k.A. dafür anbieten und für den sie sich ausgerechnet auf Marx’ „trinitarische Formel“ aus dem 3. Band des „Kapital“ berufen, ist in seinen beiden Gedankenschritten verkehrt.
Das falsche Bewusstsein der „‚Dramatis Personae‘ der bürgerlichen Ökonomie“ hat – nach dem Wortlaut des Marx-Zitats – seinen Grund in der ‚Befangenheit‘ der Menschen „in den bürgerlichen Produktionsverhältnissen“, seinen Inhalt folglich darin, dass sie ihre objektive Bestimmtheit als funktionale Momente im Verwertungsprozess des Kapitals so nehmen und verstehen, wie sie – darin „befangen“ – damit zurechtkommen müssen, nämlich als die – einzige – ihnen verfügbare „Revenuequelle“. Die „ordinären Vorstellungen“ über Wirtschaft und Gesellschaft verdanken sich dem affirmativen instrumentellen Standpunkt, mit dem die „Charaktermasken“ dieser Produktionsweise von der Rolle abstrahieren, die sie darin spielen; ihr Fehler liegt eben darin, dass sie ihren Gelderwerb als die Wahrheit über ihr ökonomisches Dasein betrachten, weil ihnen praktisch keine Alternative bleibt. Die k.A. stellen diesen Zusammenhang genau auf den Kopf, unterstellen nämlich als Inhalt des falschen Bewusstseins der Leute die „Notwendigkeit“ ihrer „ökonomischen Rolle im Rahmen der als selbstverständlich und naturgegeben aufgefassten kapitalistischen Produktionsweise“; diese „Notwendigkeit“ würde sich ihnen als Dienst an „der Gemeinschaft“ darstellen, für den sie „eine entsprechende ideelle und materielle Würdigung“ einfordern könnten. Offenbar denken die k.A. so, dass das von Patrioten gepflegte Selbstbild als „nützliches Glied der Gemeinschaft“ im Prinzip dasselbe wäre wie variables Kapital, Mehrwert und Tribut ans Grundeigentum, durch die Brille der Selbstverständlichkeit als „naturgegeben“ gesehen – und das trifft weder auf das notwendig falsche Bewusstsein der „‚Dramatis Personae‘ der kapitalistischen Produktionsweise“ zu, noch erklärt sich so – in einem „ebenso einfachen wie verkehrten Übergang“ – das patriotische Rechtsbewusstsein von Staatsbürgern (die sich, das nur nebenbei, in ihrer Anspruchshaltung ganz bestimmt kein bisschen zurückhalten, wenn ihrer vorgestellten Dienstbarkeit im Gemeinwesen überhaupt keine „Notwendigkeit“ „im Rahmen der kapitalistischen Produktionsweise“ zukommt). Dass die k.A. den „befangenen Agenten dieser Produktion“ so, als wäre das ein hinreichendes Zwischenargument, auch noch die Reflexion unterstellen – oder ist es etwa bloß ihre eigene Überlegung? –, ohne die tatsächliche Notwendigkeit ihrer Rolle im kapitalistischen Verwertungsprozess wäre „ja keine Revenue zu erzielen“, ist ein abenteuerlicher Einfall, der nur den Fehler unterstreicht, die objektive ökonomische Funktion der Klassen im Kapitalismus mit nationalistischem Anspruchsbewusstsein in eins zu setzen.
„Gerechtigkeit bezieht sich auf die Person, die gerecht oder ungerecht behandelt wird; ein Beispiel: Ist Arbeitslosenunterstützung gerecht? Gewöhnlich gilt sie durchaus als gerecht, weil – und insoweit – der Arbeitslose bereit und willens ist, sich durch Arbeit (wieder) gesellschaftlich nützlich zu machen. Diesen Standpunkt teilen auch die, die gegen Arbeitslosengeld argumentieren, denn sie kommen nicht ohne das dümmliche Zwischenargument aus „wer wirklich arbeiten will, findet auch Arbeit.“ Die Gerechtigkeit macht sich also bestimmt nicht am Tausch fest, denn ein solcher findet hier nicht einmal der Form nach statt. Deshalb sind auch Sozialleistungen an Kranke, die sich überhaupt nicht nützlich machen können oder gemacht haben, gerecht, indem sie der Person immer noch in ihrer „Menschenwürde“ entsprechen. Das geschieht nicht als bloßes Almosen (was Beliebigkeit auf Seiten des Gebers bedeuten würde), denn über die angemessene Höhe der Sozialhilfe wird nach allen Regeln der öffentlichen politischen Debatte gestritten, bis hin vors Verfassungsgericht. Wie verfehlt der Gedanke ist, „Tauschgerechtigkeit“ wäre die elementare Form der Gerechtigkeit, wird hier an seinen absurden Konsequenzen deutlich, denn der Standpunkt, es wäre gerecht, Kranke verhungern zu lassen, weil sie ja keine „Gegenleistung“ erbringen, findet sich wirklich nirgends im gesamten politischen Meinungsspektrum.“
Auch dazu wird unter II. in der Rekapitulation des Gedankengangs unseres Artikels alles Nötige gesagt.
„Wer sich ungerecht behandelt fühlt, fühlt sich in seiner ganzen Person missachtet. Dieser wesentliche Aspekt geht in der Rede von der „Tauschgerechtigkeit“ notwendigerweise verloren, denn im Tausch kommt die Person nur in ihrer Eigenschaft als Eigentümer der zu tauschenden Ware in Betracht.“
Dass „dieser wesentliche Aspekt“ nicht verlorengeht, geht aus dem Fortgang unseres Artikels – bis hin zum Glauben an eine Lebensleistungsrente im Jenseits – hinreichend hervor.
„Mit dem oben dargestellten Übergang zur Gerechtigkeitsfrage erlaubt sich das bürgerliche Bewusstsein nicht nur im Hinblick auf die Inkommensurabilität der Einkommensquellen ein Quidproquo, sondern auch im Hinblick auf seine eigene Person. Während er tatsächlich nur zusieht, wie er mit den ihm gegebenen Mitteln ein möglichst gutes Einkommen erzielt, gefällt er sich daneben in der Einbildung, so recht eigentlich im Dienst der Allgemeinheit unterwegs zu sein. Er hat die materialistische Sphäre der Verträge, durch die er sein Einkommen bezieht und sich reproduziert, geistig hinter sich gelassen und steht nun ganz auf dem nationalistischen Standpunkt: er als Teil des großen Ganzen. Auch dieser Aspekt der Gerechtigkeitsideale wird durch das Konstrukt der Tauschgerechtigkeit verdeckt.
Im Bewusstsein der Leute spielt sich der Übergang so ab: solange einer meint, es nur mit seinem persönlichen Arbeitsvertrag schlecht getroffen zu haben, hält er Ausschau nach einem besseren Job. Vielleicht kann er sich tatsächlich ein wenig verbessern; da mag er dann sagen, der frühere Arbeitgeber wäre knausrig gewesen, aber er kommt nicht auf die Idee, hier die Frage nach gerecht oder ungerecht zu stellen. Gewöhnlich wird einer aber bald merken, dass sich bei den am Arbeitsmarkt eingependelten Löhnen keine allzu großen Spielräume auftun – und erst dann macht er den Übergang zur Gerechtigkeit. Dass einer trotz seiner wichtigen, verantwortungsvollen, aufreibenden, anspruchsvollen etc. Dienste als Maurerpolier, Lehrer, Trambahnkontrolleur oder was auch immer am Ende so mies dasteht, das beweist ihm, wie ungerecht es im Lande zugeht.“
„Oben dargestellt“ ist ein verkehrter Kurzschluss von der objektiven Rolle eines Menschen im kapitalistischen System auf seine nationalistische Gesinnung. Was die k.A. hier hinzufügen, ist die Klarstellung, dass sie mit ihrer Ablehnung des Begriffs der Tauschgerechtigkeit nicht bloß – im Sinne der Anfangsargumente – den einzelnen Kauf- und Verkaufsakt im Sinn haben, der in seiner Begrenztheit nie und nimmer den Glauben an Gerechtigkeit als herrschenden Bewusstseinsinhalt begründen könne: Sie spalten den bürgerlichen Materialismus insgesamt, die ganze Welt der kapitalistischen Konkurrenz um Gelderwerb, von der „höheren Sphäre“ ab, in der sie die Maxime der Gerechtigkeit beheimatet sehen. Das geht – um es noch einmal in anderen Termini zu sagen – deswegen nicht in Ordnung, weil zum „Bourgeois“, der in Konkurrenz mit anderen sein Geld verdient, allemal der „Citoyen“ gehört, der im Staat die für ihn unentbehrliche Ordnungsmacht anerkennt – oder umgekehrt zum Staatsbürger, der sich einer sittlich gefestigten Rechtsgemeinschaft unter politischer Führung zurechnet, allemal das eigennützige Privatsubjekt, das mit den ihm verfügbaren Mitteln um sein Einkommen kämpft –: Gerade im Verlangen nach Gerechtigkeit geht es diesem modernen Hybrid darum, dass sittlicher Anstand und materieller Konkurrenzerfolg zusammenfallen sollten; dass Fairness regieren möge, so dass Leistung sich lohnt und der Privatmensch mit seinem regelkonformen Existenzkampf auf seine Kosten kommt. Bei diesem Verlangen handelt es sich auch nicht um die nationalistische Deutung politökonomischer Verhältnisse, sondern um die subjektive Haltung, mit der das bürgerliche Mischwesen aus „Bourgeois“ und „Citoyen“ das Versprechen seiner rechtsstaatlichen Herrschaft quittiert, mit ihrer Ordnung stiftenden Gewalt täte sie dem Geldmaterialisten und dem Sittenwächter im modernen Menschen gleichermaßen Genüge.
Das Beispiel, mit dem die k.A. den „Übergang“ „im Bewusstsein der Leute“ aus der Sphäre des Materialismus in die des – mit Gerechtigkeit gleichgesetzten – nationalistischen Anspruchsdenkens und in Wahrheit keinen Übergang, sondern die Scheidung beider Sphären demonstrieren wollen, zeugt tatsächlich von dem in Abrede gestellten Zusammenhang: vom Zusammenfall der beiden Lebensmaximen Anstand und Erfolg im Gerechtigkeits-„Bewusstsein der Leute“.
„Nachtrag (zur Vorwegnahme möglicher Einwände):
Wenn ein gerechter Lohn, ein gerechter Erzeugerpreis für Milch, oder gerechter Handel mit der Dritten Welt gefordert wird, so ist die Logik dahinter die: erst wird das Resultat der hier waltenden Konkurrenzverhältnisse als ungerecht (gemäß Verteilungsgerechtigkeit oder Leistungsgerechtigkeit) empfunden und dann macht man dies an den Preisen fest. Dies ist ein Fehler und wird bestimmt nicht dadurch besser, dass man noch einen weiteren Fehler, nämlich den unzulässigen Schluss vom Besonderen auf das Allgemeine, draufsetzt und die genannten Parolen als Beleg dafür nimmt, dass Tausch als solcher etwas mit Gerechtigkeit zu tun hätte.“
Erst vermissen Gewerkschaften Gerechtigkeit, und dann illustrieren sie ihren Nationalismus mit einer Lohnforderung? Erst jammern die Bauern über Ungerechtigkeit, und dann kommen sie auf die Idee mit dem Milchpreis? Geldforderung als „Parole“, um den eigenen Patriotismus auszutoben? Vielleicht gibt es ja bei Pegida-Demonstranten Übergänge in eine solche Verrücktheit. Den Begriff der Gerechtigkeit erklärt man so nicht.
Das geht eher wie folgt.
II. Antwort der Redaktion auf „Kritische Anmerkungen“ zum Artikel „Stichwort: Gerechtigkeit“
Seine Einwände stellt der Leserbriefschreiber seinem Schreiben in Form einer Gliederung voran:
„Die Rede von der ‚Tauschgerechtigkeit‘ ist (…) in mehrfacher Hinsicht verfehlt:
– Sie stellt einen Bruch im logischen Fortgang des Artikels dar
– Sie ist überflüssig
– Sie beruht auf einer logisch unhaltbaren Definition
– Sie entspricht nicht der Wirklichkeit
– Sie verstellt den Blick auf wesentliche Aspekte der Gerechtigkeit“
Im Folgenden werden im Wesentlichen zwei Einsprüche geltend gemacht:
– Erstens kann die Rede von der Tauschgerechtigkeit
nicht einlösen, was am Ende von Abschnitt 1. angekündigt
wurde, nämlich den dort entwickelten Begriff von
Gerechtigkeit – der sich auf das Verhältnis zwischen
Herrschaft und Untertanen bezieht – für die
kapitalistische Gesellschaft zu konkretisieren.
Denn
der Tausch sei kein Entsprechungsverhältnis zwischen
Herrschaft und Untertan, sondern allenfalls
eine
Beziehung der Privatsubjekte zueinander; dort aber, wo
der Materialismus von Eigentümern praktiziert wird, sei
für Gerechtigkeitsvorstellungen kein Platz. Die hätten
vielmehr immer zum Gegenstand, was eine übergeordnete
Instanz zu tun und zu lassen habe.
– Zweitens verpasse der Artikel deshalb genau die
wesentliche Seite von Gerechtigkeit, die dem Kritiker am
Herzen liegt: Dass dieser nämlich die Vorstellung eines
„Großen Ganzen“ zugrunde liege, als deren „Teil“ sich der
Fan von Gerechtigkeit begreife: Er hat die
materialistische Sphäre der Verträge, durch die er sein
Einkommen bezieht und sich reproduziert, geistig hinter
sich gelassen und steht nun ganz auf dem
nationalistischen Standpunkt...
In der Hauptsache wird der Artikel zum „Stichwort: Gerechtigkeit“ also einer theoretischen Todsünde bezichtigt: Die Tauschgerechtigkeit, die der Artikel als Elementarform aller hierzulande verbreiteten Gerechtigkeitsvorstellungen ermittelt haben will, sei ein Gedankenkonstrukt, eine bloße theoretische Erfindung, die mit der Realität dessen, worum es sich bei Gerechtigkeit handle, nichts zu tun habe, wodurch wesentliche Aspekte von dem verloren gehen, was Gerechtigkeit überhaupt ausmache. Die Kritik bestreitet genau das, was der Artikel als die Besonderheit aller hierzulande gängigen Gerechtigkeitsvorstellungen herausgefunden haben will: dass sie der Geist sind, in dem der Bürger seinen Geld-Materialismus und sein sonstiges Dasein praktisch vollzieht, und dass ihnen das Ethos des Staates selbst zugrunde liegt, im Vollzug seiner Herrschaft gegen seine Untertanen immer recht eigentlich dafür Sorge zu tragen, dass die Bürger im rechtlich kodifizierten freien, privaten Verkehr untereinander zu „dem Ihren“ kommen. Deshalb eine Erläuterung, wie wir überhaupt darauf gekommen sind.
1. Uns ist nämlich genau umgekehrt
aufgefallen, wie allgegenwärtig im sozialen
Leben kapitalistischer Demokratien die Beschwerde ist,
ungerecht behandelt worden zu sein; nicht zu bekommen,
was, oder gewürdigt zu werden, wie es einem eigentlich
zusteht. Es ist eine Sache der unmittelbaren Anschauung
festzustellen, dass das moderne Individuum es lässig
beherrscht, das Gefühl der Benachteiligung – denn um mehr
als ein Gefühl handelt es sich zunächst nicht – auf alle
Beziehungen und jeden Zusammenhang anzuwenden, in dem es
so steht: Im Privatleben ebenso gut wie beim Lohn, beim
Internet-Kauf wie bei der Rentenversicherung, im
Kollegenkreis wie im Straßenverkehr, als Mann, als Frau,
aber ebenso gut als Bürger seines Stadtviertels, dem
neulich Flüchtlinge zugewiesen wurden, während die
Reichen … Überall findet eine muntere geistige
Vergleicherei statt zwischen dem, was einem zustünde, und
dem, was man tatsächlich bekommt; und die ziemlich
disparaten Befunde, die da unterwegs sind, beziehen sich
keineswegs nur auf Handlungen von Leuten, denen man
untergeordnet ist. Entgegen der behaupteten
Einschränkung: Vorgesetzte können gegenüber ihren
Untergebenen gerecht oder ungerecht sein, Lehrer
gegenüber den Schülern oder Eltern gegenüber den
Kindern
, ist es eben schon empirisch keineswegs so,
dass die Beschwerde über ungerechte Behandlung
ausschließlich dort ventiliert würde, wo sich der Mensch
auf sein Verhältnis zu Instanzen bezieht, die das Sagen
haben.
a) Solche Klagen betreffen also zum einen die Sphäre der Ökonomie, die Tauschverhältnisse, mittels derer die Bürger ihre privaten Interessen verfolgen. An denen kann der Leserbriefschreiber das Ideal eines gerechten Tauschs nicht entdecken. Allerdings beweisen die Beispiele, die er für den Nachweis bringt, dass im Hin und Her von Waren, Dienstleistungen und Geld kein Ideal gerechter Tauschverhältnisse unterwegs sei, das Gegenteil dessen, was behauptet wird:
„Jeder in der Gesellschaft weiß, dass er permanent selbst darauf aufpassen muss, dass er nicht bei Kauf, Verkauf oder sonstigen Vertragsabschlüssen übers Ohr gehauen wird“. „Wenn einer über seinen Kontrahenten die Nase rümpft wegen dessen Gerissenheit, Schlitzohrigkeit oder Schlimmerem, dann spricht er damit nur den Verdacht aus, dieser würde sich der inkriminierten Angriffe auf die Entscheidungsfreiheit schuldig machen; wo kein solcher Verdacht besteht, wird einer, der vorteilhafte Geschäfte macht, wegen seiner ‚Geschäftstüchtigkeit‘ bewundert, und ist der, der sich übervorteilen lässt, ‚selber schuld‘.“
Wenn Bürger in dem Bewusstsein, dass sie Acht geben müssen, nicht „über’s Ohr gehauen zu werden“, ein- oder verkaufen, Miete zahlen oder einkassieren, einen Arbeitsvertrag unterzeichnen, Gehälter überweisen oder überwiesen kriegen …; wenn sie sich umgekehrt darauf verstehen, einen gewissen Stolz zu entwickeln, mal ein „Schnäppchen“ gemacht oder jemandem ein Schnippchen geschlagen zu haben und sich oder anderen „Schlitzohren“ das als „Gerissenheit“ zugutezuhalten – dann legen sie selbst Zeugnis ab von der gewussten Diskrepanz zwischen den diversen wirklichen Tauschverhältnissen und ihrer Vorstellung von einem un-angemessenen Tausch: Vom Standpunkt ihrer Erwartung an den Verlauf und das Ergebnis eines Händewechsels wird der tatsächliche Austausch mit dem „Verdacht“ einer Über- bzw. Minder-Erfüllung gedeutet, also mit dem Ideal der Äquivalenz verglichen, die in der Realität nie so ganz zustande kommt, aber eigentlich zustande kommen sollte. Dass es die Leute selbst sind, die Tauschverhältnisse eingehen, sich da also nichts betätigt als ihr Wille, und sich zugleich Zufriedenheit mit den Ergebnissen nie so recht einstellt: das ist in der Tat ein Widerspruch – aber nicht, wie der Leserbriefschreiber behauptet, einer der Erklärung, vielmehr in der Sache. Offenkundig sieht sich die große Masse der Leute genötigt, sich mit Ergebnissen eingegangener Tauschakte abzufinden, die dem Zweck widersprechen, dessentwegen sie sie überhaupt eingehen – was unvoreingenommen betrachtet den Mittelcharakter von Konkurrenz und Tausch für die Interessen der Individuen mindestens fragwürdig erscheinen lässt. Die allerdings halten offenkundig unbeirrbar gegen ihre schlechten Erfahrungen daran fest, dass sie „das Ihre“ von einer Ökonomie des Tausches erwarten können.
b) Dieses Bewusstsein ist nicht nur in
Sphären ökonomischer Konkurrenz anzutreffen, erstreckt
sich vielmehr auf alle Lebensbereiche. Auch davon zeugen
neben der Phänomenologie des gesellschaftlichen und
privaten Lebens die Gegenbeispiele des
Leserbriefschreibers selbst: Sicher ist auch ihm nicht
unbekannt, dass man sich „nach einem langen Tag“ sein
Bier zum Feierabend „redlich“ oder umgekehrt ein
Geschenk, eine Krankheit oder auch den ungehobelten
Freund „nun wirklich nicht verdient“ haben will. Er
selbst kennt immerhin Klagen aus dem Kinderzimmer
:
‚Der Felix hat ein viel größeres Stück Kuchen
bekommen; das ist ungerecht!‘
, und weiß von einer
allgemeinen Stellung zu verschiedenen Leistungen des
Sozialstaates:
„Ist Arbeitslosenunterstützung gerecht? Gewöhnlich gilt sie durchaus als gerecht, weil – und insoweit – der Arbeitslose bereit und willens ist, sich durch Arbeit (wieder) gesellschaftlich nützlich zu machen.“ „Deshalb sind auch Sozialleistungen an Kranke, die sich überhaupt nicht nützlich machen können oder gemacht haben, gerecht, indem sie der Person immer noch in ihrer ‚Menschenwürde‘ entsprechen.“
Die Beweisabsicht seiner Beispiele: Die Gerechtigkeit
macht sich also bestimmt nicht am Tausch fest, denn (!)
ein solcher findet hier nicht einmal der Form nach
statt
, ist einigermaßen schräg. In all diesen
Beziehungen mag ja kein Tausch im Sinne eines
ökonomischen „do ut des“ vorliegen,
nichtsdestotrotz werden sozialstaatliche Leistungen, der
Genuss im Privatleben oder die Bindungen im Familien- und
Freundeskreis einer Bewertung unterzogen, die ganz der
Logik des Tausches folgt. So wird bspw. die körperliche
oder geistige Anstrengung wofür auch immer als
Vorleistung definiert, wegen der man ein Objekt seiner
Begierde nicht einfach will, sondern als Gegenleistung
verdiene; oder eine hoheitlich verfügte staatliche
Geldzuweisung unter die Vorstellung eines Tausches
subsumiert, in dem sich „Arbeitsbereitschaft“ und
„Unterstützung“ entsprechen sollen… Und selbst der Fall,
bei dem die Analogie eines gerechten Gebens und Nehmens
an ihre Grenze stößt, weil Elendsgestalten „sich
überhaupt nicht nützlich machen können“, also nichts als
ihre „Menschenwürde“ anzubieten haben, um derentwillen
Sozialleistungen als gerecht verbucht werden, bestätigt
die Erläuterungen des Artikels. Denn behauptet war
ausdrücklich nicht, dass es im
marktwirtschaftlich-demokratischen Staat neben der
Tauschgerechtigkeit nicht auch noch andere
Gerechtigkeitsgesichtspunkte und Übergänge zu anderen
Idealen gibt: So liefert z.B. auf Grundlage des Ideals
gerechter Tauschverhältnisse das Gesamtergebnis der
kapitalistischen Produktionsweise den fortwährenden
Anlass dazu, im Namen sozialer Gerechtigkeit Korrekturen
am gesellschaftlichen Resultat der Reichtumsverteilung
einzuklagen; und angesichts der wirklichen Härten, die
mit der sozialstaatlichen Betreuung marktwirtschaftlicher
Armut eingerichtet sind, ist auch der rigide vertretene
Standpunkt der Äquivalenz zu dem Übergang aufgelegt, der
Menschlichkeit wegen Gnade und Barmherzigkeit zu fordern
bzw. walten zu lassen. Dieses Gegenbeispiel fällt
mitnichten aus dem Rahmen der Ableitung; die erklärt
gerade den Zusammenhang der verschiedenen
Gerechtigkeitsgesichtspunkte.
Auf die eine oder andere Weise ist also auch neben der Sphäre der Ökonomie eine Geisteshaltung unterwegs, die im Prinzip, d.h. von dem besonderen Stoff der Beziehungen einmal abgesehen, von einem Ideal des Austausches lebt: So wenig gerade diese Vorstellungen darüber, was einem wegen welcher persönlichen Darbietung von wem eigentlich zustünde und wer deswegen gegen welche Anforderung gerechter Behandlung verstoßen habe, untereinander kommensurabel sein mögen – in ihnen kommt allemal dasselbe ideelle Kriterium zur Anwendung: nämlich das einer Adäquanz zwischen dem, was man selbst ist, darstellt, leistet ... und dem, was andere einem schulden, was sie deswegen eigentlich zu tun oder zu lassen hätten.
*
Kaum fragt man nach, in welcher Hinsicht jemand meint,
dass ihm Unrecht geschehe, stößt man in allen Sphären des
gesellschaftlichen Lebens auf diesen Grundgedanken: Dass
es doch ein elementares Passungsverhältnis geben
müsste zwischen dem, was man selbst – in welcher Hinsicht
auch immer – von sich gibt und dem, was einem seitens
seiner „Umwelt“ als – in welcher Hinsicht auch immer –
angemessenes Entgegenkommen zusteht. Bei all den
verschiedenen Hinsichten, in denen Bürger über Gott und
die Welt im Namen der Gerechtigkeit Klage führen oder
Forderungen aufstellen, gemeinsam ist all diesen
Fassungen das Eine: Unter der Maxime einer
imaginierten Angemessenheit von Geben und Nehmen
klagen Bürger ein, dass und wie die eigenen Interessen in
dieser Gesellschaft Anerkennung zu erfahren hätten. Wenn
der Leserbriefschreiber feststellt: In den Köpfen der
Leute findet sich so etwas wie die Moral von
Tauschgerechtigkeit offenbar nicht
, liegt er also
ziemlich daneben. Denn selbst wenn nicht jeder das Wort
des „gerechten Tausches“ im Munde führt und explizit mit
ihm argumentiert, so erweist sich die Kategorie der
Tauschgerechtigkeit sehr wohl als das allgemeine Prinzip
des Bewusstseins, in dem Bürger ihren beruflichen Alltag
bestreiten und unter das sie auch alle möglichen
Verhältnisse ihres privaten Lebens beugen. Von daher
erweist sich auch der Einwand als verkehrt, dass die
Leute beim Anlegen des Kriteriums eines gerechten
Entgelts für erbrachte Dienste die materialistische
Sphäre der Verträge geistig hinter sich lassen
, sich
statt dessen in ihrer ganzen Person missachtet
fühlen und daneben in der Einbildung, so recht
eigentlich im Dienst der Allgemeinheit unterwegs zu
sein
, gefallen würden. Denn dass es den Übergang zum
Standpunkt der rechtschaffenen Persönlichkeit und des
nationalistischen Geistes auch noch gibt, wird schon so
sein. In den zitierten Beispielen wird aber gerade ein
Entsprechungsverhältnis von eigener ‚Leistung‘ und
‚Verdienst‘ eingeklagt; so, nämlich im
Bewusstsein einer angemessenen Gegenleistung, will der
Bürger seine materiellen Interessen
berücksichtigt sehen. Wer sein ökonomisches
Treiben in diesem Geist vollzieht, der weiß um eine
gültige Maxime der Äquivalenz einerseits
getrennt von dem und andererseits in Bezug
auf das, womit er selbst in seinen vielfältigen
Tauschverhältnissen tatsächlich konfrontiert ist.
(Tausch)Gerechtigkeit ist das Ideal der
Individuen, die in der kapitalistischen Konkurrenz und
unter der Ägide des staatlich durchgesetzten Rechts ihre
Reproduktion bestreiten, ein Ideal, das sie darüber
hinaus auf alle möglichen Beziehungen anwenden: Aus ihm
folgt selber kein einziger konkreter Zweck, aber mit
einer bloßen Ideologie ist dieses Ethos deswegen
keineswegs zu verwechseln; es ist das verkehrte
Bewusstsein, in dem Bürger ihre gegensätzlichen
Interessen als ihr gutes Recht praktisch immerzu
verfolgen.
2. Wer seine Unzufriedenheiten gewohnheitsmäßig unter dem Gesichtspunkt einer eigentlich angesagten gerechten Berücksichtigung persönlicher ‚Verdienste‘ vorträgt, der erklärt seinen Unmut (worin auch immer er bestehen mag) zu einer Sache der Allgemeinheit – zum Ausweis eines als Un-Gerechtigkeit oder Un-Angemessenheit betitelten Bruchs mit einem allgemeinen Prinzip. Der Maßstab einer vorgestellten Äquivalenz von Geben und Nehmen, der in solchen Klagen und entsprechenden Forderungen allgegenwärtig zur Anwendung kommt, unterstellt selber eine allgemein-gültige Norm, die zu achten sich einfach gehört; den Imperativ einer geltungswürdigen Gesetzmäßigkeit, der sich selbstverständlich alle pflichtschuldig anpassen wollen sollen. Nur deswegen versteht sich jeder darauf, mit bestem Gewissen im Verkehr mit seinen Freunden, dem Vermieter, dem Chef, dem Ordnungsamt … an die Hochachtung vor einer eigentlich gebotenen gerechten Würdigung seiner ‚Leistungen‘ zu appellieren. Weil der Ruf nach Gerechtigkeit implizit von einem höheren Ordnungsprinzip ausgeht, das allgemeine Geltung beanspruchen kann, ist mit ihm immer schon die Idee einer Instanz postuliert, die diesen Geltungsanspruch begründet und verbindlich macht. Der Appell zur Berücksichtigung einer eigentlich gebotenen Äquivalenz von Geben und Nehmen, den Bürger sich vor allem wechselseitig um die Ohren hauen, aber auch im Verkehr mit Vertretern der Staatsmacht verlauten lassen, geht von der Vorstellung eines übergeordneten Subjekts aus, das es allemal braucht, um die Allgemeinheit der behaupteten Verpflichtung zu gewährleisten. Was als diese Idee zirkuliert, wird sie mal beim Namen genannt, ist einerseits das abstrakte Bild von ‚der Gesellschaft‘, einem ‚Wir‘, mit ‚unserem Wertekanon‘. Andererseits ist jedem mit dem Ideal der Gerechtigkeit befassten Menschen zugleich klar, worin ‚die Gesellschaft‘ ihren weltlichen Vertreter hat, der mit der Verantwortung bedacht wird, für wirklich gerechte Verhältnisse zu sorgen: Die landen mit ihren Gerechtigkeitsforderungen, wann auch immer intransigente Mitmenschen, private oder auch öffentliche Einrichtungen sich partout nicht an das gute Prinzip gerechter Verhältnisse halten wollen, zielsicher bei ‚ihrem‘ Staat – und damit bei einem Ideal der politischen Gewalt, ihrer Institutionen und Amtsträger. Spätestens dann, wenn Bürger das moralische Pflichtbewusstsein ihrer Konkurrenten, kommerzieller oder politischer Verantwortungsträger oder gleich ganzer Institutionen versagen sehen – also im Prinzip ständig –, kennen sie den Staat als den zuständigen Schiedsrichter dafür, mit Nachdruck für eine gerechte Ordnung zu sorgen, durch die jeder zu dem kommt, was (und garantiert niemand zu mehr, als) ihm zusteht.
3. Das kommt nicht von ungefähr. Denn der Staat tritt selber als Sachwalter der Gerechtigkeit auf. An dieser Stelle sei an den Einstiegsgedanken aus dem Artikel „Stichwort: Gerechtigkeit“ erinnert: Dass die Leute sich mit ihren Klagen im Namen der Gerechtigkeit an die Adresse der Herrschaft nicht einfach lächerlich machen, sondern umgekehrt damit rechnen und rechnen können, zumindest auf Gehör zu stoßen – das beruht darauf, dass die Gerechtigkeit der Geist ist, in dem (neben ihren historischen Vorgängern auch) die bürgerliche Herrschaft ihre Ordnungsleistungen vollzieht. Dass Bürger mit ihren Gerechtigkeitsforderungen Richtung Politik nicht automatisch davon ausgehen müssen, dass ihnen von Seiten der Staatsgewalt Schlimmeres droht, weil die ihnen Überheblichkeit und Amtsanmaßung vorwerfen würde, vielmehr darauf bauen und bauen können, im Prinzip den rechten Ton angeschlagen zu haben, der ihnen wenigstens ein Stück Aufmerksamkeit verschafft – das verdankt sich dem Umstand, dass der bürgerliche Staat selber beim Vollzug seiner Regelungskompetenz auf dem Standpunkt des Ideals steht, eine angemessene Behandlung seiner Bürger und eine Ordnung zu gewährleisten, durch welche die Maxime einer gerechten Äquivalenz in deren mannigfachen Verhältnissen geregelt sein soll.
Das versteht sich alles andere als von selbst: Denn was
(auch) die bürgerliche Herrschaft in dem Geiste,
Gerechtigkeit herzustellen, der Sache nach ist
und treibt, unterscheidet sich nicht nur von ihrem hehren
Anspruch, sondern steht im Widerspruch zu ihm.
Immerhin besteht das Ethos, in dem die Obrigkeit ihren
Willen praktiziert, in der Idealisierung der für den
bürgerlichen Staat eigenen Herrschaft der
Rechtsverhältnisse, durch deren Gewährleistung er sich
sein Land und seine Leute als Quelle seiner Macht
zurichtet. Wie jede Herrschaft, die einer
gesellschaftlichen Ordnung kraft ihrer Gewalt allgemeine
Geltung verschafft, ist auch die bürgerliche der Vollzug
eines Gegensatzes zwischen Staat und Untertanen.
Daran ändert sich auch im
marktwirtschaftlich-demokratischen Staatswesen nichts, in
dem die Untertanen sich als Bürger reproduzieren und
deren Unterwerfung als Herrschaft des Rechts
vonstattengeht, das denen tatsächlich in ihrer Rolle
als private, konkurrierende Eigentümer dient.
Der moderne Rechtsstaat entspricht all seinen Bürgern mit
dem Schutz von Person und Eigentum darin, dass
er ihnen die unabdingbare Voraussetzung stiftet, sich mit
ihren privaten Geld-Interessen in Konkurrenz zu all den
anderen überhaupt zu reproduzieren. Dass er damit deren
widersprüchliches Verhältnis – sich
wechselseitig ausschließender und mit ihrem Geldinteresse
zugleich aufeinander angewiesener Privateigentümer –
überhaupt erst als gesellschaftlich
verbindliches und einzig erlaubtes allgemeines
Prinzip von Produktion, Verteilung und Konsum
festschreibt und dauerhaft absichert,
ist die sachliche Leistung der politischen Gewalt der
kapitalistischen Gesellschaft. Zu der gehört ebenso die
staatlich abgesicherte Rechtsform des gesellschaftlichen
Konkurrenzverkehrs: Mit seinem Vertragsrecht kodifiziert
der Gesetzgeber die wirklichen Tauschverhältnisse seiner
Bürger, in denen die ihre gegensätzliche Kooperation
vollziehen und auf die sich deren
Gerechtigkeitsidealismus (unter anderem) bezieht; er
oktroyiert Vertragskonditionen, unter denen die
Konkurrenzsubjekte als freie und gleiche
Rechtspersonen über einen Händewechsel übereinkommen, den
sie aus privaten Nutzenerwägungen eingehen. Das will der
bürgerliche Staat nicht einfach als die Praxis eines
Herrschaftsgegensatzes verstanden wissen, er
beansprucht, damit zugleich ein Stück
gerechter Ordnungskompetenz betätigt zu haben,
mit der er den inneren Anliegen seiner
Untertanen entspricht. Versprochen ist damit
etwas Widersprüchliches: Durch die
herrschaftliche Anwendung von Gewalt gegen seine Bürger
soll zugleich ein von dieser prinzipiellen
Gegensätzlichkeit befreites Vermittlungsverhältnis
verwirklicht sein. Im Fall des Vertragsrechts soll mit
der im Vertrag formalisierten freiwilligen
Übereinkunft eigentlich der Ausschluss von
Übervorteilung, nämlich Fairness beim
Konkurrieren, mit der rechtlichen Vereinbarung
gegensätzlicher Willen zugleich deren
Vereinbarkeit und durch die vollzogene
Gleichsetzung von Leistung und Gegenleistung im
Prinzip eine Gleichheit von Geben und Nehmen
realisiert sein, durch die alle zu ‚dem Ihren‘
kommen sollten. Darum liegt der Leserbriefschreiber ganz
grundsätzlich daneben, wenn er anlässlich dieser Auskunft
die Frage stellt: Gerechtigkeit ist ein Versprechen?
Herrscht Gerechtigkeit auch dann, wenn das Versprechen
nicht eingelöst wird?
Das nimmt dieses „Versprechen“
nicht als den Anspruch des Staates ernst, der er ist –
nämlich ein praktisch hochgehaltenes Ideal der
wirklichen Leistungen, mit denen er die Gegensätze seiner
Bürger regelt. Das kann einerseits überhaupt nie wirklich
„eingelöst“ werden, weil es ja den eigentlich guten
Sinn und Zweck z.B. des Vertragsrechts herzustellen
beansprucht, der mit der wirklichen Leistung der Gewalt
definitiv inkommensurabel ist. Andererseits ist
dieses „Versprechen“ dann doch, aber in einer ganz
anderen Hinsicht immerzu „eingelöst“ – nämlich vom
Standpunkt des Staates, der das Vertragsrecht erlässt und
das immer schon als die Einlösung eines
Entsprechungsverhältnisses zu den Kontrahenten und
zwischen ihnen versteht.
4. So hat die GegenStandpunkt-Redaktion darauf geschlossen, dass Gerechtigkeit eine Maxime des Willens des Staates ist und dass hierin ihre erste begriffliche Bestimmung liegt, auf der beruht, dass die Gerechtigkeit sich als Maßstab von Kritik und Forderungen im Verkehr der Bürger miteinander und mit der Politik bewährt. Das hakt der Leserbriefschreiber als Selbstverständlichkeit ab – als gäbe es da überhaupt nichts zu erklären und als wäre jedem klar, dass Gerechtigkeit zuallererst das Ethos politischer Gewalt: das praktizierte Ideal eines Unterwerfungsverhältnisses ist. Der kritisierte Artikel zum „Stichwort: Gerechtigkeit“ hat es sich erlaubt, ausgehend vom Ergebnis der Schlussfolgerung, die auf den paar Seiten dieser Antwort dargelegt sein soll, abzuleiten, was jeder als Gerechtigkeitsvorstellung seiner Mitmenschen ständig vor der Nase hat. Das unterscheidet übrigens eine wissenschaftliche Erklärung bzw. Ableitung von einem Dogma – dem theoretischen Kapitalverbrechen, das der Leserbriefschreiber dem Artikel vorwirft.
III. Leserbrief 2 zu „Stichwort: Gerechtigkeit“
„Hallo Gegenstandpunkt,
ich hab da einige Fragen zu einem neulich im Gegenstandpunkt erschienenen Artikel über Gerechtigkeit. Ich wäre schon dankbar für eine Antwort, denn ich grüble schon lange und wüsste gern was Sache ist.
Anbei meine Bemerkungen.
S. 51 GS 4-14:
1. Frage
Was der Artikel zum staatlichen Ethos der Gerechtigkeit auf den Seiten 47 ff. ausführt leuchtet mir ein: für die bürgerliche Staatsgewalt genügt es nicht, dass die Untertanen den Gesetzen und Regeln befolgen, das Regelwerk soll auch den Privatinteressen der Bürger in der Konkurrenz ums Privateigentum so entsprechen, dass ihrem Eigennutz auf eine Weise gedient wird, dass die Herrschaft damit Anerkennung verdient: „Die Herrschaft beansprucht, durch die Anwendung ihrer Gewalt gegen ihre Untertanen zugleich ein Entsprechungsverhältnis herzustellen.“ „Gerechtigkeit ist das praktizierte Ideal jeder Herrschaft, dass ihr kraft Gewalt geltendes Recht auch geltungswürdig ist.“ „Weswegen Untertanen ihrer Herrschaft nicht nur Botmäßigkeit, sondern Anerkennung schulden.“ Damit befolgt die Herrschaft immer wenn sie die kapitalistische Konkurrenz kodifiziert ihrem Ideal der Gerechtigkeit gegenüber den Privatpersonen. Das ist ihre Maxime.
So steht es auch im Buch Der bürgerliche Staat
zum
Thema Rechtsstaat: „Nicht durch seine Parteinahme, seinen
unmittelbaren Einsatz für das Interesse bestimmter Teile
der Gesellschaft, wird er Diener einer Klasse – das
allen garantierte Gesetz und die Gerechtigkeit
organisieren den Vorteil der Stärkeren und den bleibenden
Nachteil der minder bemittelten Bürger: der demokratische
Staat vertraut auf die Macht des Privateigentums, er
entspricht den gesellschaftlichen Verhältnissen, wenn
er sie kodifiziert.“ (§ 3 a)
§ 3 b: „Die Macht, mit der die Organe des Staates sich von der Gesellschaft ausstatten lassen, nicht anders zu gebrauchen, als es den Zwecken der Bürger gemäß ist, betrachtet der Rechtsstaat als eine Pflicht. Er kommt ihr nach, indem er seine Kollisionen mit den Bürgern dem Kriterium der Grundrechte unterwirft.“
Meine Frage: Damit hat die Verfassung doch ein Versprechen abgegeben, jeden Bürger die Teilnahme an der Konkurrenz ums Privateigentum zu garantieren und versprochen, sich als Herrschaft selbst an das Recht zu halten und sein Handeln an den Grundrechten messen zu lassen. Damit hat der bürgerliche Staat kundgetan, eine gerechte Herrschaft zu sein, die den Interessen der Bürger dient. Ist das so? Wenn ja, warum braucht es zusätzlich eine Ableitung des Gerechtigkeitsideals der Herrschaft aus dem Vertragsrecht? Mehr dazu bei Frage 3.
Ihr schreibt doch selbst in der Überschrift. „Der bürgerliche Staat entspricht dem Geld-Interesse seiner Bürger mit dem Schutz von Person und Eigentum“ und Seite 51 oben: „Mit der eingerichteten Rechtsordnung dient die Herrschaft der kapitalistischen Gesellschaft dem Privatinteresse der Bürger, indem sie den Antagonismus um Geldreichtum konkurrierender Privateigentümer als die einzig erlaubte Weise gesellschaftlicher Kooperation allgemein-verbindlich ins Werk setzt“, und entspricht damit dem Eigennutz der Bürger.
2. Frage
S. 51: Die Formulierung „Die Rechtsform, mit der die Herrschaft widerstreitende Ansprüche regelt, ist der Vertrag:“
Werden wirklich „widerstreitende Ansprüche“ im Vertrag geregelt? Ist es nicht so, dass sich gegensätzliche Interessen der um Eigentum konkurrierenden Bürger im Vertrag auf gegenseitige Leistungen einigen (müssen) – erst damit entstehen doch die widerstreitenden Ansprüche, um deren vertragliche Erfüllung es dann geht?
Oder soll mit „widerstreitenden Ansprüchen“ gemeint sein,
dass weil die Privatsubjekte bei ihren Geschäften mit
anderen nur ihren Nutzen im Auge haben, muss der Staat
ihnen die Grundform rechtlichen Verkehrs, den Vertrag
aufherrschen, und zwar durch penibelste Vorschriften
bezüglich aller zum Vertrag gehörigen Momente
, und
deshalb die Herrschaft den Kontrahentengewaltsam
...den ausschließenden Charakter des von allen begehrten
und geschätzten, deshalb stets missachteten
Privateigentums
(so § 4 bürg.
Staat) beibringen? Die zwei nächsten Sätze führen
das in diesem Sinne aus: dass jeder das Eigentum des
anderen anerkennen muss, wenn er dies Eigentum erwerben
will, das wird den Bürgern mit dem Vertragsrecht
aufgeherrscht – „die Gleichsetzung von veräußerlichem
Eigentum“. Verstehe ich das richtig so? Aber
dasselbe wie Ansprüche regeln ist das doch nicht?
3. Frage
Die eigentliche Schwierigkeit die Ableitung des Ethos Tauschgerechtigkeit aus dem Vertragsrecht nachzuvollziehen, liegt für mich
– erstens in der Formulierung, dass der Vertrag der
elementare Gegenstand
ist, auf den die Lebenslüge
der bürgerlichen Herrschaft sich bezieht
: wie oben
schon ausgeführt, gibt die Verfassung des bürgerlichen
Staates bereits kund, dass alles Recht und
ständige Messlatte der Staatsagenten die Gerechtigkeit
gegenüber allen Individuen ist, die ihrer Freiheit
Eigentum zu erwerben nachgehen, also schon vom Ethos der
Gerechtigkeit ausgeht. Darauf, auf alles was kodifiziert
wird, nicht nur auf Verträge, bezieht sich deshalb die
Lebenslüge der Herrschaft, die behauptet dass alle
Privatbürger durch die Gerechtigkeit immer zu ihren
materiellen Erfolgen in der Konkurrenz kämen.
Elementar ist natürlich der Vertrag darin, weil dieses Recht den Bürgern vorschreibt wie sie Geld verdienen dürfen um Eigentum zu erwerben und zu vermehren, die gegensätzlichen Interessen der Bürger werden so aufrechterhalten; es ist verboten sich fremdes Eigentum anders als mittels Vertrags anzueignen. Das ist das Zwangsverhältnis des Rechts, das der Reproduktion in dieser kapitalistischen Ökonomie entspricht. Deshalb verstehe ich schon, dass die Lebenslüge der Herrschaft sich ebenso auf den Vertrag bezieht. Allerdings nicht so wie es im Artikel abgeleitet wird, denn
– zweitens, in der Formulierung: Das Ethos der
Vertragsbeziehungen ist die Tauschgerechtigkeit. Sie ist
das Versprechen des bürgerlichen Staates, mit der im
Vertrag formalisierten freiwilligen Übereinkunft...
im ersten Satz kann sich Tauschgerechtigkeit einzig auf
die vertragsschließenden Privatsubjekte beziehen, denn
die sind es ja, die vertragliche Beziehungen mit einander
eingehen. Der Staat regelt mit ihrem, den konkurrierenden
Bürgern entsprechendem, also gerechten Vertragsrecht
nicht die freiwillige Übereinkunft der
Konkurrenzsubjekte. Die Freiwilligkeit der Vereinbarungen
ist ganz auf der Seite dieser Subjekte, das
„formalisiert“ ja das Vertragsrecht;
– drittens, in der Formulierung eigentlich den
Ausschluss von Übervorteilung, nämlich Fairness beim
Konkurrieren, mit der rechtlichen Vereinbarung
gegensätzlicher Willen zugleich deren
Vereinbarkeit...
verstehe ich das „eigentlich“ nicht:
denn das Vertragsrecht schreibt schon vor was beim
Vertrag nicht erlaubt ist, warum also „eigentlich“? Und
die Vereinbarung gegensätzlicher Willen über die
Gegenstände des jeweiligen Vertrages, heißt doch nicht,
dass diese Willen damit weniger gegensätzlich wären,
nämlich „zugleich deren Vereinbarkeit“? Nein, die
Willensäußerungen müssen sich an die gültigen Normen des
Gesetzes halten, Verstöße dagegen macht den Vertrag
ungültig bzw. geht man vor Gericht. Die Interessen die
beim Kaufvertrag unterwegs sind, sind gegensätzliche,
jede Partei will das Eigentum des anderen und seins nicht
aufgeben – der Vertrag als einzige erlaubte Form Eigentum
zu erwerben schreibt die Einigung der Parteien
vor, das jeweils eigene Eigentum aufzugeben, um sich
fremde Eigentum aneignen zu können, und das ist was
anderes als Vereinbarkeit;
– viertens, in der Formulierung ... und durch die
vollzogene Gleichsetzung von Leistung und Gegenleistung
im Prinzip eine Äquivalenz von Geben und Nehmen
realisiert zu haben
, das wird schon der Zweck der
Konkurrenzsubjekte sein, wenn sie einen Vertrag
vereinbaren – aber das der Staat das mit seinem
Gerechtigkeits-Ethos verspricht, bezweifle ich.
Freilich sehe ich das auch so, dass die
Tauschgerechtigkeit wegen des besonderen Stoffs, auf dem
sie beruht, ... die grundlegende Maxime des
gesellschaftlichen Verkehrs, eine Forderung, die Bürger
gegeneinander in Anschlag bringen
ist, aber dass die
Tauschgerechtigkeit die allgemeinste Tugend der
politischen Gewalt im Umgang mit ihren Untertanen
ist
, kann ich der Ableitung auf S. 51 nicht
entnehmen, denn das staatliche Gerechtigkeits-Ethos
bezieht sich, wie oben schon gesagt, auf alle Bereiche
der Gesellschaft und auf alle Konkurrenzsubjekte
gleichermaßen.“
Antwort der Redaktion
Was den sachlichen Fehler deiner Einwände und Problematisierungen angeht, findest du in der Antwort auf den anderen Leserbrief die wesentlichen Argumente, die falsche Ineinssetzung von Recht und Gerechtigkeit betreffend. Den Fehler machst auch du bei deinem Grübeln über die Natur der gesellschaftlichen Verkehrsform der kapitalistischen Gesellschaft, den Vertrag, und das zu dieser Form gehörige Gerechtigkeitsethos: Die Vertragsverhältnisse zwischen konkurrierenden und zugleich mit ihren Eigentümerinteressen aufeinander verwiesenen Bürgern hältst du falsch gegen die diese Eigentumsverhältnisse sichernde und die Vertragsform des gesellschaftlichen Verkehrs dekretierende Staatsgewalt – und verpasst damit auch das Ethos der Gerechtigkeit, das diesem staatlich verbindlich gemachten Verkehr innewohnt.
Allerdings möchten wir dir noch ein paar sachdienliche Hinweise zu deiner verkehrten Art der Befassung mit dem Gerechtigkeitsartikel mit auf den Weg geben. Wir meinen nämlich, dass deine kritisch fragenden und zweifelnden Einlassungen einer verkehrten Herangehensweise an den Artikel geschuldet sind: Statt die Argumente an der behandelten Stelle unvoreingenommen zur Kenntnis zu nehmen und zu prüfen, problematisierst du die Verständlichkeit des Textes, unterwirfst ihn einem Vergleich mit Aussagen bzw. mit deinem Verständnis von Aussagen eines anderen Textes, unseres Staatsbuchs, und gewinnst ihm eine dir einleuchtende oder nicht einleuchtende Bedeutung ab, indem du beide Texte aneinander bzw. an dem, wie du sie auffasst, misst. Ein paar Erläuterungen dazu.
I.
Deine Zuschrift steigt ähnlich ein wie die vorangehend
besprochene: Du bekundest dein Einverständnis mit dem
ersten Teil unserer Ausführungen; kaum schreibst du
nieder, was dir einleuchtet
, steht
allerdings etwas ganz anderes da als die Argumentation
unseres Textes. Du zitierst aus dem ersten Teil des
Artikels zustimmend zwei Sätze, aus denen hervorgeht,
dass da von einer Eigentümlichkeit jeder
Herrschaft
die Rede ist, nämlich von der, ihre auf
Gewalt gegründete Verfügungsmacht über ihre Untertanen
mit dem höheren moralischen Sinn auszustatten,
ihnen
damit recht eigentlich nur
entsprechen
zu wollen. Dieses Urteil über die
Staatsgewalt als solche zitierst du, denkst es aber
offensichtlich für sich gar nicht nach: Du machst es dir
plausibel mit einem Blick auf die bürgerliche
Staatsgewalt
, von der an dieser Stelle der
Argumentation ausdrücklich nicht die Rede ist, weil es
eben um eine allgemeine Bestimmung von
Herrschaft geht. Die findest du einleuchtend, weil sie zu
etwas passt, was du dir gelegentlich der Lektüre unserer
Staatsableitung hast einleuchten lassen. Dass in dieser
Schrift vom bürgerlichen Staat die Rede ist, an
der von dir erwähnten Stelle näher vom
Rechtsstaat als der Form, in der dieser
Staat seine Herrschaftsgewalt vom Einfluss des privaten
Willens auf sein Handeln emanzipiert, usw., kümmert dich
weiter nicht: Auf diese Passage greifst du zurück, weil
es dir die Stichworte Gesetz und Gerechtigkeit angetan
haben und dir der Satz über den Staat gefällt:
„er entspricht den gesellschaftlichen
Verhältnissen, wenn er sie kodifiziert“. Damit
meinst du alles erfasst zu haben, was im ersten Abschnitt
unseres Gerechtigkeits-Aufsatzes zur Lebenslüge der
Herrschaft steht. Weil dir mit dem Begriff
„Entsprechungsverhältnis“ alles schon so klar ist, dass
du dich gar nicht mehr mit den jeweiligen Erläuterungen
in unseren Schriften darüber befasst, wer oder was da wem
wie „entspricht“ und warum, stehst du komplett auf dem
Schlauch, wenn unser Artikel in seinem Fortgang dann auf
das Vertragswesen zu sprechen kommt: Warum braucht es
zusätzlich eine Ableitung des Gerechtigkeitsideals aus
dem Vertragsrecht?
, fragst du dich und uns, und das
ist keine Frage, sondern der Fehler, der aus der
umstandslosen Ineinssetzung von bürgerlicher mit
staatlicher Herrschaft überhaupt folgt: Weil du unsere
Ausführungen zum Ethos der Herrschaft von vorneherein
daraufhin inspizierst, wie gut sie zu denen passen, die
du aus einer anderen unserer Schriften kennst und denen
du entnommen haben willst, dass Gerechtigkeit als Ideal
der Herrschaft dasselbe ist wie der Rechtsstaat
und sein Recht, liest du unseren Artikel entsprechend
selektiv. Nicht einmal der fett gedruckten Überschrift zu
Pkt. 2 magst du entnehmen, dass es jetzt überhaupt erst
losgeht mit den bürgerlichen Verhältnissen, die
Gerechtigkeit also gar nicht ein zweites Mal
abgeleitet
wird, sondern jetzt den Inhalt
bekommt, den sie unter kapitalistischen Vorzeichen hat.
Vor dieser Überschrift wird übrigens das erste Kapitel
auch in diesem Sinne noch einmal zusammengefasst und
erklärt, dass und warum jetzt das nächste den Gegenstand
bestimmter fasst.
II.
Bei deiner zweiten Frage stellst du deine Lesebemühungen
nach der von dir zitierten Textstelle ein. Der besagte
Satz hört nämlich mit einem Doppelpunkt auf, und der ihm
nachfolgende Satz erklärt näher den angesprochenen
Fortgang vom gegensätzlichen Willensverhältnis der Bürger
eines kapitalistischen Gemeinwesens zum do ut
des des Vertragswesens. Und vor dem von dir
zitierten Satz, mit dem der neue Gegenstand eingeführt
wird, handelt ein ganzer Abschnitt von der Organisation
der Antagonismen der ums Eigentum konkurrierenden Bürger
als Rechtsverhältnisse zwischen Freien und Gleichen. Dort
steht deutlich genug, was gemeint
ist mit diesen
widerstreitenden Ansprüchen
und ihrer
Verrechtlichung. Du machst dir daraus ein Problem und
legst das dem Text zur Last, weil du die dort gegebenen
Auskünfte nicht zur Kenntnis nimmst, sondern wieder den
Rückgriff auf unsere Ableitung des bürgerlichen Staats
bemühst und die verquere Frage stellst, ob in
der eventuell steht, was hier gemeint ist,
um dann festzustellen, dass es wohl ‚in diesem Sinne‘ im
Folgenden auch da steht, dann aber doch wieder Zweifel
äußerst, ob da wirklich dasselbe gemeint sein kann... So
verrätselst du im vergleichenden Hin und Her zwischen
Staatsbuch und Gerechtigkeits-Artikel beides gehörig –
nicht gerade produktiv fürs Verständnis.
III.
Im dritten Fragekomplex reihst du dann alle Verhängnisse aneinander, die daraus resultieren, dass du dich auf die Unterscheidungen zwischen Recht und Gerechtigkeit nicht einlässt, um die der Artikel sich bemüht:
– Zu deinem „erstens“: Aus welcher Verfassung kennst du
denn das Grundrecht ‚Gerechtigkeit‘, das alles
Recht
umfassen soll? Woher hast du eine dem Recht per
se innewohnende ‚Gerechtigkeit‘, die zusammen mit dem
dann auch noch so herrscht, dass sie den Bürgern immer
zu ihren materiellen Erfolgen in der Konkurrenz
zu
verhelfen verspricht? Und was deine Auffassung angeht,
dass die Verfassung, weil die allgemeine Fassung
herrschaftlicher Prinzipien, auch logisch dem
staatlich geregelten Vertragswesen und den dazugehörigen
Gerechtigkeitsvorstellungen vorausgeht und es deswegen
keinesfalls sein kann, dass die
Tauschgerechtigkeit das sittliche
Grundprinzip des bürgerlichen Verkehrs und der
ihn regelnden Rechtsgewalt darstellt, welches als solches
zum Maßstab für alle kapitalistischen
Lebensverhältnisse verallgemeinert wird: Diese
deine Auffassung stammt sicher nicht aus einer
unvoreingenommenen Lektüre der Erklärungen zu Verfassung,
Rechtsstaat und Recht in den einschlägigen § § des Buchs
zum bürgerlichen Staat.
– Zu deinem „zweitens“ bis „viertens“: Was den Satz
betrifft, den du ziemlich mutwillig in drei Bestandteile
zerlegst, um jeden einzelnen unter Hinweglassung der
jeweils anderen kritisch zu durchleuchten: In der von dir
zitierten Textstelle ist vom Ethos
der
Vertragsbeziehungen die Rede, von der höheren
sittlich-moralischen Leitidee, die der Staat seinem
Vertragswesen zugrunde gelegt und was er mit dem
einschlägigen Recht im Grunde genommen –
eigentlich
! – auf den Weg gebracht und seinen
Bürgern versprochen haben will. Um die im Vertragswesen
versprochene (Tausch-)Gerechtigkeit geht es, also um die
Bestimmung des Inhalts der bürgerlichen
Gerechtigkeit. Weil du die im Artikel erläuterte
Unterscheidung zwischen Herrschaft und ihrem
Ideal nicht mitmachst, erschlägst du eben diesen
Inhalt und damit die komplette Gedankenführung mit deiner
falschen Phrase vom gerechten Vertragsrecht
, das
schon allein deswegen gerecht ist, weil es den Bürgern
grundsätzlich entspricht
: Das eigentlich
im
von dir zitierten Satz verstehst du nicht, weil du auch
ihn mit deinem Vorurteil konfrontierst, wonach
Gerechtigkeit im Grund dasselbe ist wie der bürgerliche
Rechtsstaat und mit dem Recht zusammenfällt, mit dem der
den Interessen seiner Bürger dient. Und was deine
Hinweise zum Wesen des Vertrags angeht, die
jeweils eine Seite dieser widersprüchlichen
bürgerlichen Verkehrsform fest- und gegeneinander und
damit gegen den Artikeltext halten: Dass die
Freiwilligkeit der Vereinbarungen ganz auf der
Seite
derer liegt, die diese Vereinbarungen treffen –
wo haben wir etwas anderes behauptet?! -; und dass das
Ideal der Vereinbarkeit
gegensätzlicher Willen
ihren Gegensatz nicht zum Verschwinden bringt – wo hätten
wir denn das Gegenteil vertreten?!
Am Ende bekräftigst du dann noch einmal deine falsche Trennung und Entgegensetzung der eigentümlichen Gerechtigkeitsmaximen, die die Bürger in Bezug auf ihr Verhältnis untereinander und aufs Recht pflegen, und des Gerechtigkeitsethos‘ der rechtsetzenden Staatsgewalt – und das ausgerechnet mit dem einigermaßen eigentümlichen ‚Argument‘, der GegenStandpunkt hätte da etwas zur Hauptsache erklärt, was dem Staat zwar schon auch von Wichtigkeit sei in Sachen Gerechtigkeit, aber so wichtig dann auch wieder nicht, weil ja, deinem Dogma zufolge, bei seinem Recht Gerechtigkeit sowieso immer schon und überall herrscht.
Eine unbefangenere Lektüre, die dem Text nicht mit exegetischen Kraftakten und schiefen Vergleichen mit anderen Schriften und denen abgewonnenen Vorstellungen zu Leibe rückt, würde viel falsches Grübeln und Einwenden hinfällig machen.
[1] Erschienen in GegenStandpunkt 4-15