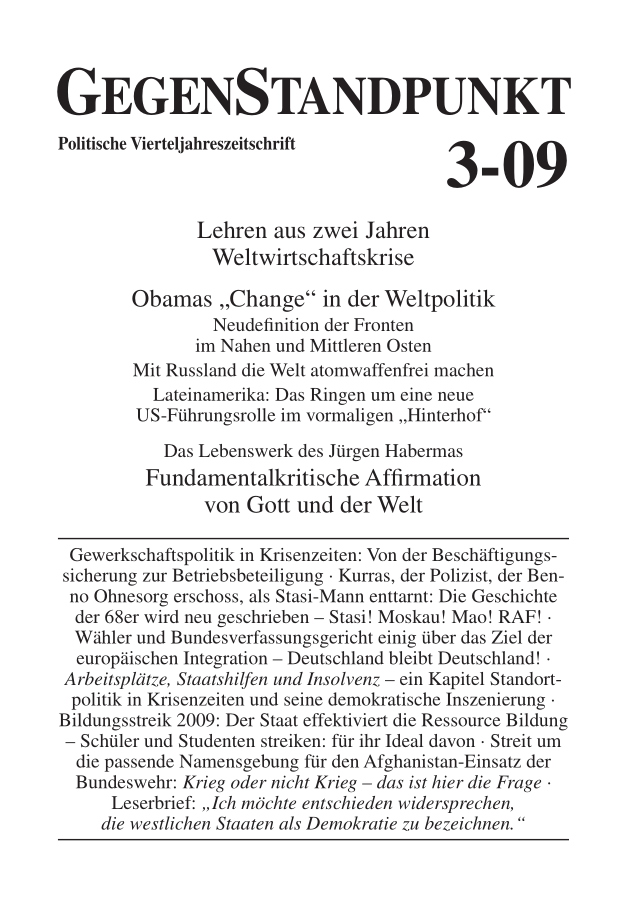Das Lebenswerk des Jürgen Habermas:
Fundamentalkritische Affirmation von Gott und der Welt
J. Habermas, ein „großer Vordenker“, „kritischer Diskursführer“, „Deutschlands größter lebender Philosoph“ gar, steht anlässlich seines 80. Geburtstags mit seinem Lebenswerk zur Ehrung an. Nichts Geringeres als der „Geist der Moderne“ sei es, der in dem Werk des Philosophen mit sich Zwiesprache hält und im „Grundmotiv seines Denkens“ vor sich hin mäandert. Dieser Geist sei für geneigte Leser zwar manchmal „schwer zu finden“, tritt aber gerne auch „offen zutage“, ganz besonders dort, wo der „Erbe der ‚Kritischen Theorie‘ Horkheimers und Adornos“ die „Forderung nach radikaler Demokratie und radikaler Kritik“ zu bedienen verstand: Anerkennend darf man staunen über die „Sprengkraft“, die seine „über Schelling vermittelte, mit Marx angereicherte und den Mitteln der Linguistik ausgehärtete Kommunikationsphilosophie“ bei „theoriehungrigen Intellektuellen“ hatte. Weniger interessant ist für die geneigten Rezensenten, was es mit einem derart verfassten Theorie-Amalgam – andere rühren es aus Kant, Heidegger und Marx zusammen – auf sich hat, und ganz und gar nicht erstaunlich finden sie die Metamorphose der „radikalen Kritik“, die Habermas populär machte. Sie loben ihn dafür, immer und immer wieder „mit pathetischer Beredsamkeit für Rechtsstaat und Demokratie“ eingestanden zu sein und ein Denken erfunden zu haben, dem die Bundesrepublik „ganz entscheidend ihre moralische Neugründung verdankt.“ Offensichtlich ist da dem Exponenten „kritischen Denkens“, der sich ja so trefflich aufs Vermitteln und Anreichern versteht, mit seiner Synthese zwischen Kant und Marx noch eine ganz andere gelungen.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Gliederung
- I. Der große Wurf zum Einstieg in die Wissenschaft: Idealdemokratische Regeln für die Wahrheitsfindung
- II. Sozialphilosophischer Fortgang: Wie ein wissenschaftstheoretischer Wahn zum Prinzip des Weltlaufs ausreift
- Das Habermas-Problem: Wie könnte überhaupt gehen, woran die Kollegen sich versuchen und scheitern?
- Die Luhmann-Kontroverse: Wie lässt sich Umweltkomplexität zuverlässig reduzieren?
- Marxismus: Wie lässt sich ein toter Hund fruchtbar machen?
- Demokratie: Die denkbarste aller möglichen Bedingungen herrschaftsfreier Konsensbildung?
- III. Moralkritische Wortmeldungen zum Zeitgeschehen
- IV. Die fundamentalkritische Konsensphilosophie und ihre tatsächliche praktische Wahrheit
Das Lebenswerk des Jürgen Habermas:
Fundamentalkritische Affirmation von Gott und der Welt
Freischaffende wie in öffentlich-rechtlichen Diensten stehende Pfleger hoher Kultur haben zu tun: J. Habermas, ein großer Vordenker
, „kritischer Diskursführer, Deutschlands größter lebender Philosoph
gar, steht anlässlich seines 80. Geburtstags mit seinem Lebenswerk zur Ehrung an. Das erledigen sie durch die Bank gerne. Für ‚Die Zeit‘ gilt es die Weltmacht Habermas
zu feiern, weil das Werk des Mannes aus dem Geistesleben sogar in China und Japan nicht wegzudenken ist. Denker mit gleichfalls großem Namen geben bekannt, was ganz speziell sie ihm zu verdanken haben, von vielen anderen, die in FAZ und SZ zu Wort kommen, erfährt der normalsterbliche Zeitgenosse, wovor auch er sich respektvoll zu verneigen hat: Nichts Geringeres als der Geist der Moderne
sei es, der in dem Werk des Philosophen mit sich Zwiesprache hält und im Grundmotiv seines Denkens
vor sich hin mäandert. Dieser Geist sei für geneigte Leser zwar manchmal schwer zu finden
, tritt aber gerne auch offen zutage
, ganz besonders dort, wo der Erbe der ‚Kritischen Theorie‘ Horkheimers und Adornos
die Forderung nach radikaler Demokratie und radikaler Kritik
zu bedienen verstand: Anerkennend darf man staunen über die Sprengkraft
, die seine über Schelling vermittelte, mit Marx angereicherte und den Mitteln der Linguistik ausgehärtete Kommunikationsphilosophie
bei theoriehungrigen Intellektuellen
hatte. Weniger interessant ist für die geneigten Rezensenten, was es mit einem derart verfassten Theorie-Amalgam – andere rühren es aus Kant, Heidegger und Marx zusammen – auf sich hat, und ganz und gar nicht erstaunlich finden sie die Metamorphose der radikalen Kritik
, die Habermas populär machte. Sie loben ihn dafür, immer und immer wieder mit pathetischer Beredsamkeit für Rechtsstaat und Demokratie
eingestanden zu sein und ein Denken erfunden zu haben, dem die Bundesrepublik ganz entscheidend ihre moralische Neugründung verdankt.
Offensichtlich ist da dem Exponenten kritischen Denkens
, der sich ja so trefflich aufs Vermitteln und Anreichern versteht, mit seiner Synthese zwischen Kant und Marx noch eine ganz andere gelungen.
I. Der große Wurf zum Einstieg in die Wissenschaft: Idealdemokratische Regeln für die Wahrheitsfindung
Ein Gelehrter im Umkreis der ‚Frankfurter Schule‘ findet Gelegenheit, sich mit seiner Wissenschaft nützlich zu machen: Im Nachwuchs der deutschen Intelligenz wird Unzufriedenheit laut; nicht wenige nehmen Anstoß am Innenleben einer Demokratie, die sich für sie schlecht bis gar nicht mit allen Erwartungen deckt, die sie an das Versprechen von „Freiheit“ knüpfen; sie wollen nicht hinnehmen, dass unter Berufung auf dieses hohe Gut Leuteschinder wie der Schah von Persien in den Demokratien des Westens gerne gesehene Gäste sind, und schon gleich nicht, dass die ihre Freiheit in Vietnam auch noch mit Krieg „verteidigen“; und sie sehen sich in all ihren kritischen Drangsalen von der Wissenschaft nicht bedient, mit der sie es an ihren höheren Bildungsstätten zu tun haben – der wissenschaftliche Denkbetrieb kommt ihnen wie eine einzige Veranstaltung zur Beschönigung der Praxis vor, an der sie Anstoß nehmen, den Ungeist der ‚braunen Vergangenheit‘ sehen sie nicht nur in Politik und Öffentlichkeit, sondern auch in nicht wenigen ihrer Professoren personifiziert. Ein Angebot für Kritik in Theorie und Praxis ist an den Universitäten für sie jedenfalls nicht in Sicht – und ihnen kann der Philosoph Habermas gleich doppelt dienen: Erstens mit einer Kritik der Wissenschaft und zweitens mit einer Idee, wie Kritik geht.
Was erstere betrifft, so hat er in Wissenschaft und Gesellschaft ein Denken entdeckt, das ihm zufolge für ziemlich gewaltige Missstände verantwortlich ist. Ein technokratisches Bewusstsein
sei es, das „mit der Verschleierung praktischer Fragen (...) das partielle Herrschaftsinteresse einer bestimmten Klasse rechtfertigt und das partielle Bedürfnis der Emanzipation auf seiten einer anderen Klasse unterdrückt“;[1] in positivistisches Gemeinbewusstsein
legitimiere die Entpolitisierung der Masse der Bevölkerung
, die verdinglichten Modelle der Wissenschaften wandern in die soziokulturelle Lebenswelt ein und gewinnen über das Selbstverständnis objektive Gewalt
(ebd., S. 90 f.). Insgesamt legt ihm seine Befassung mit dem Empirismus
der modernen Wissenschaft die Deutung nahe: dass erfahrungswissenschaftliche Theorien die Wirklichkeit unter dem leitenden Interesse an der möglichen informativen Sicherung und Erweiterung erfolgskontrollierten Handelns erschließen
,[2] und was den sozialwissenschaftlichen Funktionalismus
betrifft, der dieses Denken bestimmt, bringt er das ihn leitende Interesse wie folgt auf den Punkt: In ihm verbirgt sich die uneingestandene Verpflichtung der Theorie auf herrschaftskonforme Fragestellungen, auf die Apologie des Bestehenden um seiner Bestanderhaltung willen.
[3]
Das ist seine Kritik an der etablierten bürgerlichen Wissenschaft: Wegen ihres Interesses an brauchbarem Wissen, wegen ihrer apologetischen Absichten beim Denken kann bei diesen Wissenschaften von Erkenntnis, wie er als Fachmann sie durchgehen lassen würde, nicht die Rede sein, was sie produzieren ist Ideologie. Dem setzt er das Vorhaben einer Wissenschaft entgegen, die sich gleichermaßen um Erkenntnis wie Kritik verdient macht – und die hebt mit einer einzigen Relativierung seines Einspruchs gegen die praktizierte Wissenschaft an. Denn keinesfalls folgt der Entdeckung, dass interessiertes Denken Wissen negiert, der begründete Antrag, dieses Denken wegzuwerfen und dafür Sorge zu tragen, dass in der Wissenschaft frei von ihr äußerlichen Interessen nachgedacht wird. Dass es im Prinzip darauf ankäme, ist Habermas bekannt – auf Objektivität hat für ihn Wissenschaft schon zu gehen: Mit Recht zielt deshalb die Disziplin des geschulten Denkens auf die Ausschaltung solcher Interessen. In allen Wissenschaften sind Routinen ausgebildet worden, die der Subjektivität des Meinens vorbeugen
.[4] Aber, so hört man von ihm, da darf man sich nichts vormachen: Weil sich die Wissenschaft die Objektivität ihrer Aussagen gegen den Druck und die Verführung partikularer Interessen erst erringen muss, täuscht sie sich andererseits über die fundamentalen Interessen hinweg, denen sie nicht nur ihren Antrieb, sondern die
Bedingungen möglicher Objektivität
selber verdankt.
(Ebd.)
Der Mann bringt also den Gegensatz von Erkenntnis und Interesse zur Sprache – und gibt im Nachsatz zu verstehen, dass anders als interessiert in der Wissenschaft gar nicht gedacht werden kann. ‚Erkenntnis und Interesse‘ betitelt er sein großes Werk, und das ‚und‘ denkt er so, wie er es hinschreibt. Dass all ihr Trachten nach Objektivität grundsätzlich – fundamental
, immer schon
heißen die Stereotypen dafür – bestimmt vom Interesse des Denkers ist: Darüber hat sich die Wissenschaft nichts vorzumachen, damit muss sie leben. Sich umgekehrt dieser Einsicht hartnäckig zu verschließen, ist der Grund, weswegen er den Empirismus
der modernen Wissenschaft nicht als Erkenntnis durchgehen lassen will. Der sei nämlich von einem Verständnis von Wissenschaft geleitet, welches in allergrößter Naivität die Beziehungen zwischen empirischen Größen, die in theoretischen Aussagen dargestellt werden, als Ansichseiendes (unterstellt)
(ebd., S. 155). Objektivistisch
nennt Habermas es, wenn Wissenschaftler meinen, sie hätten in den „Beziehungen“, die sie theoretisch ermitteln, etwas materiell Existierendes erfasst. Genau darin täuschen
sie sich – weil man ja schließlich spätestens seit Kant weiß, dass dieses „Ansichseiende“ eine einzige Täuschung ist. Sie lassen außer Acht, wie überhauptmäßig ihr Interesse all dem vorgelagert ist, was sie in ihrer Wissenschaft treiben. Sie ignorieren, wie sehr alles, was sie als ‚Objektivität‘ behaupten, bedingt ist durch das, was ihre Interessiertheit ihnen zu denken gebietet – und das ist der Defekt der Wissenschaften, den Habermas zu heilen verspricht. Denn ihrem parteilichen Denken genauso wie den Theorien, die sie aus ihm heraus verfertigen, fehlt im Grund nur eines: Das kritische Hinterfragen des Interesses, das sich in ihnen unweigerlich Bahn bricht, und die Reparatur dieses Mangels ist möglich, denn:
„Der Geist kann sich auf den Interessenzusammenhang, der vorgängig Subjekt und Objekt verknüpft, zurückbeugen – und dies ist allein der Selbstreflexion vorbehalten. Sie kann das Interesse gewissermaßen einholen, wenn auch nicht aufheben.“ (Ebd., S. 163)
So geht die Kritik des interessierten wissenschaftlichen Denkens nahtlos über in die kritisch-problematisierende wissenschaftstheoretische Rechtfertigung des Interesses in der Wissenschaft, und denselben Theorien und Methodologien, die man immerhin mit dem Vorwurf belegt hat, Ideologie zu sein bzw. zu rechtfertigen, verordnet man unter dem Titel Selbstreflexion
eine meta-wissenschaftliche Befassung mit sich selbst, in der sich das forscherische Subjekt der in ihm liegenden Mächte innewerden soll, die bestimmen, was ihm als objektiv gilt: Ein schon sehr konstruktiver Beitrag zur apologetischen Wissenschaft, der da unter dem großen Titel ‚Kritik‘ als Gegenentwurf zu ihr angekündigt wird.
Immerhin, viele von Deutschlands neuer Demokratie enttäuschte Intellektuelle waren damit für ihr Kritikbedürfnis ganz gut bedient. Dem Zuspruch des Frankfurter Philosophen konnten sie entnehmen, dass es darauf ankommt, politische Gewaltaktionen und Klassenverhältnisse nicht zu kritisieren und auch nicht deren ideologische Rechtfertigungen, vielmehr kritisch zu sein; was so viel heißen sollte wie: überhaupt kein Urteil, schon gar nicht in der Wissenschaft, gelten zu lassen, bis dessen Urheber sich dazu bequemt, sich reflektierend
zu dem interessierten Vorurteil zu bekennen, das ihn so urteilen lässt. Damit hätte man den Ideologen ertappt – und wenn der sich gegen das verlangte zurückbeugende
Bekenntnis sträubt, hat man ihn erst recht erwischt, in flagranti, bei der Ursünde ideologischen Denkens, die eigenen Vorurteile noch nicht einmal zuzugeben oder gar zu kaschieren. Natürlich ist damit kein einziges verkehrtes, apologetisch interessiertes Urteil revidiert, kein Übel dieser Welt auf den Begriff gebracht. Stattdessen ist pauschal jede Behauptung, die einer in die Welt setzt, für reflexionsbedürftig erklärt und zur Welt und ihren ideologischen Interpretationen eine Haltung überlegener Distanz eingenommen, die keinerlei wissenschaftliche Anstrengung erfordert, ohne jede Erkenntnis auskommt und so grundsätzlich daherkommt, dass sie selber schlechterdings nicht mehr in Frage zu stellen ist – ein schönes Billigangebot für das Bedürfnis, intellektuelle Unzufriedenheit nicht nur auszuleben, sondern auszukosten.
Habermas freilich hat sich eine andere Lebensaufgabe gewählt. Ihn hat die Vorstellung fasziniert, „die Wissenschaften“, nämlich alle Bemühungen ums Begreifen gesellschaftlicher Verhältnisse, wären über die Bedingungen ihrer Möglichkeit erst noch aufzuklären, und er, Habermas, wäre mit der Aufdeckung der unvordenklichen, „je schon“ realisierten Abhängigkeit jeglicher Erkenntnis von einem leitenden Interesse diesem tiefen Geheimnis auf die Schliche gekommen. Immer wieder, in immer neuen Anläufen berichtet er von seiner Erleuchtung:
„Vernunft erfasst sich als interessierte im Vollzug der Selbstreflexion. Auf den fundamentalen Zusammenhang von Erkenntnis und Interesse stoßen wir daher, wenn wir Methodologie in der Weise der Erfahrung der Reflexion entfalten: als die kritische Auflösung des Objektivismus, nämlich des objektivistischen Selbstverständnisses der Wissenschaften, das den Anteil subjektiver Tätigkeit an den präformierten Gegenständen möglicher Erkenntnis unterschlägt.“ [5]
Erklärtermaßen geht es Habermas also nicht darum, Wissenschaft zu treiben, sondern um deren Selbstverständnis; dem kommt man auf die Spur, wenn man sie methodologisch, als Verfahrensweise versteht; bei diesem Selbstverständnis muss die Vernunft sich selbst beobachten; und worauf sie da stößt, hat Habermas herausgefunden: Sie merkt, dass sie ein Interesse hat und verfolgt. Selbstverständlich nicht das schlichte Interesse, über gesellschaftliche Verhältnisse etwas Richtiges herauszufinden; das wäre ja trivial, und die ganze komplizierte Denkfigur der sich beim reflektierenden Selbstverständnis zusehenden Vernunft würde sich auf die Aufforderung zusammenkürzen, wissenschaftlich, also ohne Voreingenommenheit für den zu erklärenden Sachverhalt, über den Staat, die Ökonomie oder auch über die eigentümliche Logik ideologischen Denkens nachzudenken. Genau das wäre jedoch eine Spielart des „objektivistischen Selbstverständnisses“, aus dessen Klauen Habermas die Wissenschaft befreien will. Denn auch wenn vorerst im Dunkeln bleibt, worin das Interesse besteht, auf das die Vernunft als „vorgängigen“ Leitfaden ihrer reflektierten Selbsterfahrung stößt, so viel steht fest, dass es Objektivität jedenfalls nicht zum Inhalt hat. Das kann schon deswegen nicht sein, weil es sich zweifellos um etwas Subjektives handelt – eine Selbsterfahrung der Vernunft, mit der Habermas sich allerdings überhaupt nicht von den „Positivisten“ unterscheidet, denen er einen solchen unreflektierten „Objektivismus“ vorwirft. Eine derartige Anschuldigung brauchen die nicht auf sich sitzen zu lassen:
„Alle Sicherheiten in der Erkenntnis sind selbstfabriziert und damit für die Erfassung der Wirklichkeit wertlos.“ (H. Albert)
Den lächerlichen „Schluss“ von der Tatsache, dass Gedanken von Subjekten fabriziert werden – von wem denn sonst, von den gedachten Gegenständen ganz bestimmt nicht –, auf die Unmöglichkeit, dass diese Tätigkeit das leistet, wofür sie angestellt wird, nämlich Sachverhalte auf ihren Begriff bringen, ihren tatsächlichen Zusammenhang erkennen und sich so Sicherheit für den Umgang mit ihnen verschaffen: diese Albernheit beherrschen die gescholtenen „Objektivisten“ mit ihrem „kritischen Rationalismus“ so gut wie der Frankfurter Philosoph. Für den fängt der Spaß damit aber erst an. Habermas will mit seiner Selbsterfassung der Vernunft nämlich herausgefunden haben, dass es eine Objektivität in dem Sinn, dass die Erkenntnistätigkeit des Subjekts sie garantiert verfehlt, gar nicht gibt; zumindest nicht als Gegenstand möglicher Erkenntnis; woraus messerscharf zu folgern ist, dass Erkenntnis nur insofern, insofern aber tatsächlich möglich ist, als ihre Gegenstände gar nicht getrennt von ihr existierende Objekte, sondern selber schon durch subjektive Tätigkeit präformiert
sind. Womit selbstverständlich wieder nicht die schlichte Tatsache gemeint ist, dass gesellschaftliche Sachverhalte weder auf Bäumen gewachsen noch vom Himmel gefallen, sondern allemal von Subjekten erzeugt sind. Vielmehr steckt, der philosophischen Selbsterfahrung der Vernunft zufolge, das Interesse, das die Vernunft bei ihren Erkenntnisleistungen leitet, in den Gegenständen drin, sobald die methodischen Bemühungen der Vernunft sich auf diese richten. Recht eigentlich erkennt die Vernunft also nicht mehr und nicht weniger als ihr eigenes Interesse in ihren Erkenntnisgegenständen wieder, und anders geht Erkenntnis gar nicht, so aber ganz prima.
Es ist schon toll, was für Erfahrungen die Vernunft im Frankfurter Philosophenturm mit sich selber macht. Und Habermas verschweigt auch nicht, wie er auf diese Selbsterfahrung gekommen ist:
„Seit Dilthey sind wir daran gewöhnt, das Spezifische der Geisteswissenschaften darin zu sehen, dass sich das erkennende Subjekt auf einen Objektbereich bezieht, der selber die Strukturen der Subjektivität teilt. In Anknüpfung an idealistische Traditionen kann diese besondere Stellung von Subjekt und Objekt so gedeutet werden, als begegnete der Geist in den Objektivationen des Geistes sich selbst.“ [6]
Unter Geistes- und Gesellschaftswissenschaftlern ist es – erfährt man – zur lieben Gewohnheit geworden, aus den Objekten wissenschaftlicher Befassung den Sinn herauszuholen, den man im Zuge der Beschäftigung mit ihnen in sie hineinsteckt; dazu sagt man ‚hermeneutischer Zirkel‘, dann geht die Sache in Ordnung – auch ideologiekritisch: man hat sich zu der Vorurteilsabhängigkeit der eigenen Forschungen ja bekannt –; und deuten lässt sich das Ganze als Begegnung des Geistes mit sich selbst. Eine solche traditionalistische Deutung kann Habermas allerdings nicht billigen; die muss man schon wieder nach rückwärts auflösen in methodologisches Problematisieren; und also müssen die fröhlichen Sinnstifter von der Hermeneuten-Schule sich fragen lassen:
„Wie lässt sich der Anspruch auf Allgemeinheit, den sie für ihre Theorien erheben, mit ihrer Intention vereinbaren, individuierte geschichtliche Prozesse zu erfassen?“ [7]
Die Antwort findet Habermas selbstverständlich nicht in den befragten „Theorien“, die auf ihre Art ja offenbar „Anspruch“ und „Intention“ irgendwie „vereinbaren“, an denen sich also ermitteln ließe, wie richtig oder absurd das ist, was da getrieben wird. Habermas tut es nicht unter der Frage nach den Bedingungen der Möglichkeit des hermeneutischen Zirkels mit seinen „komplementär“ durch einander definierten Polen, nach dessen gewohntem Muster er selber die Bedingung der Möglichkeit von Erkenntnis herbeireflektiert hat:
„Eine Reflexion auf das, was die hermeneutischen Wissenschaften tun, muss deshalb vorgängig klären, wie überhaupt der Bildungsprozess, in dem Geistiges sich objektiviert, und wie der komplementäre Akt des Verstehens, der das Objektivierte ins Innere rückübersetzt, zu denken seien.“ [8]
Das ist schon ziemlich viel verlangt: „Vorgängig“, also vor der Befassung mit dem „Akt des Verstehens“, an dem die „hermeneutischen Wissenschaften“ sich versuchen, soll herausgefunden werden, wie man diesen Akt überhaupt denken kann. Immerhin hat man die lästige Befassung mit den Bibliotheken füllenden Elaboraten besagter Wissenschaften vom Hals; und vom Ergebnis steht das Wichtigste auch schon vorab fest: Gedacht werden kann dieser Akt nur als „komplementäres“ Gegenstück des „Bildungsprozesses“ der Gegenstände, auf die er sich richtet, weil er ja auf alle Fälle schon „vorgängig“ als deren „Rückübersetzung“ ins „Innere“ gedacht ist. Außerdem kennt Habermas wieder Vorgänger, die derartige Untersuchungen über den transzendentallogischen Aufbau der Welt möglicher Subjekte
( ebd., S. 205) auch schon unternommen, sich also gefragt haben, wie eine Objektwelt durch möglicherweise sie denkende Subjekte vorkonstruiert sein müsste, damit sie von denkbaren Subjekten überhaupt gedacht werden kann. Viel geworden ist aus diesen „Untersuchungen“ allerdings nicht, weil ihre Rezeption gehemmt
worden ist durch ein positivistisches Verständnis von Methodologie
– offenbar ein Fallbeispiel dafür, dass in dieser Wissenschaft Forscher nur „rezipieren“, was sie sich schon selber gedacht und zum Auswahlkriterium ihrer Gegenstände gemacht haben. Um die Frage nach den Bedingungen der Möglichkeit einer Gegenstandswelt, die zugleich als Bedingung der Möglichkeit ihrer Erkenntnis gedacht werden kann, richtig zu stellen, muss man sie also so stellen, dass sie nicht mehr nicht gestellt werden kann; und das geht so:
„Ich möchte die Problematik des Sinnverstehens (...) auf einer Ebene der Methodologie (aufnehmen), die auch durch positivistische Vorentscheidungen nicht zum Verschwinden gebracht werden kann. (…) (Die) auf Dewey und Peirce zurückgehende Tradition hat den Vorzug, sich eng an die logische Analyse der Forschung anzuschließen, ohne die positivistische Beschränkung auf Sprachanalyse anzunehmen. Der Pragmatismus hat methodologische Regeln stets als Normen der Wissenschaftspraxis begriffen. Der Bezugsrahmen der Wissenschaftslogik ist deshalb der Kommunikationszusammenhang und die Experimentiergemeinschaft der Forscher, also ein Netz von Interaktionen und Operationen, das auf dem Boden einer sprachlich gesicherten Intersubjektivität ausgespannt ist.“ (Ebd., S. 205 f.)
Die Lösung seines Problems, die Habermas sich von zwei Denkern soufflieren lässt, die eher seine „positivistischen“ Gegner ihrem Lager zurechnen, ist, in etwas andere „sprachlich gesicherte“ Redeweise „rückübersetzt“, überraschend einfach. Sie liegt darin, dass der „transzendentallogische“ Meta-Methodologe ganz „pragmatisch“ ernst macht mit seinem Entschluss, sich auf eine „Ebene der Methodologie“ jenseits der „positivistischen“ Befassung mit wissenschaftlichen Urteilen und deren Richtigkeit oder Verkehrtheit zu stellen. So von außerhalb betrachtet, ist Wissenschaft ein Betrieb in dem unter Kollegen kommuniziert, experimentiert, interagiert, operiert und auch noch gesprochen wird – nicht viel anders als in Krankenhäusern zum Beispiel. So von außerhalb betrachtet, stellt sich außerdem heraus, dass die „Forscher“ beim „Interagieren“ gewisse Verfahrensregeln befolgen, deren Inhalt nicht weiter interessiert, von denen aber feststeht, dass sie ihrer Verständigung dienen. Und weil am Ende wissenschaftliche Werke herauskommen, muss der Schluss erlaubt sein, dass man es bei der regelgerechten Kommunikation innerhalb der Forschergemeinde mit dem gesuchten „Bezugsrahmen der Wissenschaftslogik“ zu tun hat: mit der Bedingung der Möglichkeit dafür, dass die Wissenschaft mit ihren erkenntnisleitenden Interessen sich mit ihren dadurch präformierten Gegenständen interesse- und erkenntnismäßig handelseinig wird.
Bleibt nur noch die Frage nach den Bedingungen der Möglichkeit des Kommunikationszusammenhangs
, der für die Wahrheitsfindung zuständig ist, und die nimmt sich der kritische Experte als nächstes vor. Fest steht – um noch mal aufs Elementare zurückzugehen –, dass wissenschaftliche Theorien nichts mit einer von ihnen unterschiedenen Objektwelt zu tun haben:
„Theorien sind Ordnungsschemata, die wir in einem syntaktisch verbindlichen Rahmen beliebig konstruieren.“ (Ebd., S. 17)
Andererseits sind wissenschaftliche Theorien „Ordnungsschemata“ mit Anspruch: Sie enthalten einen Geltungsanspruch, den wir mit Aussagen verbinden, indem wir sie behaupten.
[9] Nun gibt es Geltungsansprüche der unterschiedlichsten Art; der von Gesetzesparagraphen ist anderer Art als der von Liebeserklärungen; usw. Bei wissenschaftlichen Theorien geht es um etwas, wovon wir sagen dürfen, es sei wahr oder falsch
– aber was heißt das schon? Angesprochen ist damit eine „Idee“, bei der das Entscheidende ist, dass man es hinkriegt, sie zu „entfalten“; und das geht nur so:
„Die Idee der Wahrheit lässt sich nur mit Bezugnahme auf die diskursive Einlösung von Geltungsansprüchen entfalten.“ (Ebd., S. 218)
Die Unterscheidung von wahr und falsch in der Wissenschaft führt also wieder auf Geltungsansprüche und die Art ihrer Einlösung zurück; und daran wird deutlich, welches erkenntnisleitende Interesse Habermas verfolgt, wenn er sich von der Befassung mit dem Inhalt wissenschaftlicher Theorien dispensiert und ihren Wahrheitsanspruch zum Gegenstand einer externen methodologischen Betrachtung macht. Für ihn geht es da um Geltung im ganz unwissenschaftlichen Sinn des Wortes: um die Durchsetzung und Anerkennung von Behauptungen. Nicht die Richtigkeit eines Urteils ist das Kriterium seiner Geltung, sondern – pragmatisch-transzendentallogisch gedacht – sein durchgesetzter Geltungsanspruch das Kriterium für „wahr“ oder „falsch“. Wie ernst der Philosoph das meint, wird an der Forderung deutlich, die er an die „Einlösung“ des aufgestellten „Geltungsanspruchs“ einer Theorie stellt, damit sie als wissenschaftskonform und folglich erkenntnisstiftend gelten kann: die Einlösung muss diskursiv
geschehen; und darunter versteht Habermas nichts anderes als: gewaltfrei. Mit Blick auf die Sinnverständnisproblematik, die er den hermeneutischen Wissenschaften nachsagt, formuliert er dieses Kriterium ausdrücklich so:
„Die Annahme des Wahrheitsanspruchs einer Tradition kann freilich nur mit Erkenntnis selber gleichgesetzt werden, wenn in der Tradition Zwanglosigkeit und Unbeschränktheit der Verständigung über Tradition gesichert wären.“ „Deshalb bedarf es des prinzipiellen Vorbehalts universaler und herrschaftsfreier Verständigung, um dogmatische Anerkennung von wahrem Konsensus grundsätzlich zu unterscheiden.“[10]
Ginge es in der Wissenschaft, die Habermas sich vorstellt, um wahre Erkenntnis, dann wäre, wenn die erreicht ist, der Konsens der Forscher die triviale Folge; und die Kategorie der Herrschaft hätte auch in der Form, dass Zwang negiert wird, dabei nichts zu suchen. Habermas konstruiert das Verhältnis konsequent umgekehrt: Wahrheit ist für ihn tatsächlich das, wovon wir sagen dürfen, es sei wahr oder falsch
; und das „dürfen“ nimmt er wörtlich: Was die interagierende Forschergemeinde zulässt, worauf sie sich diskursiv einigt, ist als Wahrheit zugelassen. Das Kriterium für Wahrheit ist ein moralisches; und es ist nicht zu übersehen, welchen Sitten das sittliche Ideal der Zwanglosigkeit bei der Konsensfindung entstammt: Habermas kennt den Wissenschaftsbetrieb – und da möchte man ihm gar nicht Unrecht geben – als Konkurrenzveranstaltung; und das geht für ihn in Ordnung, wenn die Konkurrenten sich anständig aufführen und keine Theorie – man erinnert sich: es geht um die interessengeleitete Konstruktion eines beliebigen Ordnungsschemas – per Verbot, dogmatisch, ausgrenzen.
Es wäre allerdings wiederum nicht Habermas, wenn der Konsenstheoretiker sich nicht selber noch einmal kritisch ins Wort fallen würde. Nicht, dass er es so schlicht ausdrücken würde, aber Tatsache ist ja, dass sich ein Konsens, und zwar sogar ein ziemlich zwangloser, über den größten Blödsinn erzielen lässt, wenn man sich mit der richtigen „Experimentiergemeinschaft“ zusammentut. Qualifiziert müssen die Diskursteilnehmer also schon sein, damit ihre Kommunikation zu anerkennenswerten Ergebnissen führt; und wenn sie sich und einander daraufhin überprüfen, ob sie sich beim Pochen auf die Geltung ihrer Behauptungen auch wirklich und zutiefst wahrhaftig an die Kriterien „universaler und herrschaftsfreier Verständigung“ halten, dann steht von diesen Kriterien und in Sachen Wahrhaftigkeit ebenso wie hinsichtlich der Qualifikationsfrage fest, dass das alles unbedingt selber auf dem Wege eines zwanglosen Diskurses überprüft und festgestellt werden muss. Im Zweifelsfall, und wie wäre der auszuschließen, steht auch dieser Diskurs wieder unter dem Vorbehalt, nur so wahr zu sein, wie er unter ehrlichen, fachlich anerkannten Konkurrenten zwanglos abläuft – und an dem infiniten Regress, der sich da abzeichnet, hat der Frankfurter Philosoph seine Freude. Denn der beweist ihm, wie richtig er liegt: In jeder wissenschaftlichen Bemühung ist „je schon“ als Bedingung enthalten, was er fordert.
„Die Unterscheidung des wahren vom falschen Konsensus muss in Zweifelsfällen durch Diskurs entschieden werden. Aber der Ausgang des Diskurses ist wiederum von der Erzielung eines tragfähigen Konsensus abhängig. (...) Die Idee des wahren Konsensus verlangt von den Teilnehmern eines Diskurses die Fähigkeit (...), kompetent die Wahrheit von Aussagen, die Wahrhaftigkeit von Äußerungen und die Richtigkeit von Handlungen zu beurteilen. In keiner der drei Dimensionen können wir jedoch ein Kriterium namhaft machen, das eine unabhängige Beurteilung der Kompetenz möglicher Beurteiler erlauben würde. (...) Vielmehr müsste sich die Beurteilung der Beurteilungskompetenz ihrerseits ausweisen an einem Konsensus der Art, für dessen Bewertung Kriterien gerade gefunden werden sollten.“ [11]
Punkt für Punkt lässt sich diesem Zirkel entnehmen, was seinem Erfinder als Gang der Wahrheitsfindung so vorschwebt. Er inthronisiert das von jedem gedachten Inhalt abstrahierende Prinzip des grundlosen Sich-selbst-Hinterfragens als den prinzipiellen Vorbehalt
, der jedem Gedanken gilt – und das ist das Kritische dieses kritischen Denkens. In dieser Kritik wird kein Gedanke nachgedacht, weil Urteile, die seine Gültigkeit betreffen, in ihr gar nicht vorgesehen sind. Sie bescheinigt jeder Theorie und jeder Methode ihre – angesichts aller anderen Theorien und Methoden – stets bloß relative Gültigkeit, aber in dieser Relativität eben auch ihre Geltung als Wahrheitsanspruch
. Sie will dies als Common Sense in der Forschergemeinde verankert wissen und peilt so in diesem Treiben von sich wechselseitig mit Wahrheitsansprüchen traktierenden wie im selben Zug darin zurücknehmenden Forschern das Ideal einer schiedlich-friedlichen letztinstanzlichen Einheitsfindung an. Derart soll man die Wissenschaft als permanent tagendes Obergericht begreifen, das jedes Insistieren auf Objektivität und Gültigkeit des Wissens von vornherein und ganz grundsätzlich als Pochen auf dogmatische Anerkennung
verteufelt. Den Weg der Erkenntnis soll man sich denken als den nicht enden wollenden Dauerprozess der Relativierung von allem und jedem an allem anderen, und als Wahrheit würdigen, worauf sich die Streitgemeinschaft der Forscher nach gründlicher, im Grundsatz freilich nie abzuschließender Hinterfragung aller ihrer Vorentscheidungen
der Idee nach einigen können sollte: Mit diesem unglaublich kritischen Ansinnen führt der Mann sich in die Wissenschaft ein. Sie ist für ihn und hat nichts anderes zu sein und zum Inhalt zu haben als Kommunikation über die Bedingungen ihrer eigenen Möglichkeit im Lichte des Ideals einer garantiert herrschaftsfreien
Einigung von Konkurrenten – des demokratischen Ideals von Verständigung
mithin, wonach gültig ist, was in einer frei und engagiert geführten Diskussion letztlich akzeptiert wird, worauf man sich also ohne Übereinkunft in der Sache zu einigen vermag.
II. Sozialphilosophischer Fortgang: Wie ein wissenschaftstheoretischer Wahn zum Prinzip des Weltlaufs ausreift
Der Transzendentalphilosoph Habermas macht, wie man sieht, ernst mit seiner Idee einer Erkenntnistheorie als Gesellschaftstheorie
. Und wie der Zeitgeist so will, findet er auch damit Anklang bei solchen philosophisch veranlagten Freunden und Förderern, Mitmachern und Wortführern der akademischen Protestbewegung, die den Gottseibeiuns der Adenauer-Republik, Marx und dessen Kritik der politischen Ökonomie, für sich gerade wiederentdecken. Die problematisieren nämlich gerne an dem „notwendig falschen Bewusstsein“ herum, das in der bürgerlichen Welt die Szene beherrscht und dem sie klassenkämpferisch auf die Sprünge helfen wollen; durch Habermas sehen sie sich mit einer Theorie bedient, die das Bewusstsein gleich komplett aus „sozial bedingten“ Interessenslagen ableitet, folglich sowohl den herrschenden „Verblendungszusammenhang“ erklärt als auch den richtigen „Klassenstandpunkt“ als Bedingung der Möglichkeit, mit Marx doch hinter die Geheimnisse des Kapitalismus zu kommen...
So hat Habermas das natürlich nie gemeint. Die „gesellschaftliche Bedingtheit“, die allem Erkennen als Bedingung seiner Möglichkeit „vorausliegt“ und per Selbsterfahrung der auf sich reflektierenden Vernunft zu fassen zu kriegen ist, hat nichts anderes zum Inhalt als seine Idealvorstellung von einem „herrschaftsfreien Diskurs“ und alle möglichen, auf unreflektierten Vorentscheidungen beruhenden Abweichungen von diesem Ideal. Diese Theorie des zwanglosen Diskurses schließt freilich auch – „je schon“ – eine komplette Gesellschaftstheorie ein; und wie die geht, ist damit auch schon klar. Sie handelt – wie die Erkenntnistheorie, die sich darin vollendet – von, man ahnt es schon, der herrschaftsfreien Kommunikation. Natürlich nicht von irgendwelchen lockeren Unterredungen und auch nicht von dem billigen Ideal zwangloser Gemeinschaft, sondern von diesem sittlichen Höchstwert – dreimal unterstrichen: – als letzter Bedingung der Möglichkeit von Gesellschaft; und die liegt nicht einfach „objektivistisch“ irgendwo und irgendwie vor, sondern ist als solche nur auf dem Wege einer tief schürfenden Reflexion der Gesellschaftsmitglieder auf die Bedingungen der Möglichkeit ihres Zusammenlebens zu erfassen und, versuchs- und ansatzweise, als wirkliches Verständigungsprinzip zu verwirklichen. Der Sinnspruch zur ersten Hälfte dieses tiefen Gedankens lautet: Man kann nicht nicht kommunizieren!
– wer das bestreitet, hat schon verloren, nämlich kommuniziert; und wer das noch nicht einmal bestreitet, hat zumindest den Abbruch von Kommunikation kommuniziert und damit das „je schon“ möglichkeitsbedingende Grundprinzip gesellschaftlichen Zusammenlebens realisiert. Genauso wichtig ist die zweite Hälfte dieser sozialphilosophischen Urweisheit, nämlich dass „Gesellschaft“ zwar vom Kommunizieren lebt, der darin „je schon“ vorausgesetzten Norm der Herrschaftsfreiheit aber bei weitem nicht genügt. Ihr Prinzip existiert also zugleich als moralischer Endzweck: als vorgegebener sittlicher Auftrag, in bewusst reflektierender Kommunikation die Prämisse aller gesellschaftlichen Vermittlung „einzuholen“: Die Bedingung der Möglichkeit ist das Telos der Gesellschaft und umgekehrt.
Und dieser fade Idealismus soll schon alles sein, was der große Sozialphilosoph in seinem umfänglichen Lebenswerk der Gesellschaft mitzuteilen hat?
Einerseits schon, nämlich was den ideologischen Gehalt seiner Transzendentalsoziologie betrifft. Andererseits ist deren Durchführung dann doch noch eine ganz andere Sache. Denn was er da „mit Geltungsanspruch“ behauptet, hat Habermas sich mitnichten einfach ausgedacht. Er geht den vielfältigen wissenschaftlichen Bemühungen nach, das Wesen von Gesellschaft zu ergründen. Keinen Methodologen und keinen Methodenkritiker der Sozialwissenschaft lässt er aus: Sie alle befragt er darauf, ob und wie sie der Frage nach den Bedingungen, die voraussetzungsgemäß für „Gesellschaft“ wie für jedes Nachdenken über sie zuständig sind, nachgehen. Und angesichts der unbestreitbaren Tatsache, dass sie die Entdeckung der herrschaftsfreien Konsensbildung als Stein der Weisen ihm überlassen haben, hinterfragt er sie darauf hin, wie die Bedingungen der Möglichkeit von Gesellschaft und ihres eigenen Nachdenkens über Gesellschaft in ihren Theorien eben doch enthalten sind. Was er dabei zutage fördert, ist klar: je schon, aber unzureichend. Wie Habermas dabei zu Werk geht, kann nach all seinen erkenntnisleitenden Vorüberlegungen aber auch nicht mehr überraschen: Er lässt die Theoretiker des Sozialen bzw. der Theoriebildung über Soziales miteinander diskurrieren; garantiert herrschaftsfrei insofern, als er deren Gespräch ganz zwanglos in seinen Werken stattfinden lässt – wenn sich einer findet, der ihm widerspricht: umso besser. Dann gibt es eine Habermas-xy-Kontroverse, die schon mit ihrem Stattfinden den lebendigen Beweis abliefert, dass Kommunikation der Weg zur Wahrheitsfindung ist und insofern, transzendental gesehen, selber schon die Wahrheit aller denkbaren Wahrheiten. Und außerdem bietet sich im öffentlichen Raum die Gelegenheit, die Habermas sich aber genauso gern in seinen wissenschaftlichen Beiträgen selber verschafft: den Nachweis zu führen, dass seine Kollegen ebenso wie die Gesellschaft, die sie erklären wollen, „im Horizont“ diskursiver Zwanglosigkeit herumdenken, dass sie in der Durchführung freilich hinter der angemessenen Würdigung und vollen praktischen Realisierung dieses Ideals „zurückbleiben“, dass sich aber zwischen den Beteiligten – wieder: zwischen den Sozialtheoretikern wie zwischen den gesellschaftlichen Sinnträgern – sinnstiftende Beziehungen und Ergänzungsverhältnisse herstellen lassen, die dem wahren Gelingen von Gesellschaft und Wahrheit schon ziemlich nahe kommen.
Das Habermas-Problem: Wie könnte überhaupt gehen, woran die Kollegen sich versuchen und scheitern?
Habermas erforscht die Logik der Sozialwissenschaften
. Dazu lässt er sich von den Fachleuten der Disziplin erst einmal sagen, was die so treiben. So erfährt er von deren Mainstream: Die Soziologie hat es nur mit institutionalisierten Werten zu tun
; und das gibt ihm zu denken. Nein, nicht darüber, ob das überhaupt die gesellschaftliche Realität trifft, wenn die Wissenschaft gleich von der Idee eines Sollens, eines sittliche Vorschriften erlassenden höheren Willens ausgeht und die gesellschaftlichen Verhältnisse von vornherein als die Verfestigung solcher Direktiven deutet. Der ideologiekritische Wissenschaftstheoretiker will der Disziplin, in der so viele Experten sich mit einer derartigen Weltdeutung abmühen, auf die Sprünge helfen, indem er deren „Logik“ erforscht – aber was heißt da schon Logik, und vor allem: was heißt da schon erforschen? Für Habermas heißt das, sich der Frage zu widmen:
„Wie sind allgemeine Theorien des Handelns nach institutionalisierten Werten (oder geltenden Normen) möglich?“ [12]
Geht das überhaupt, was die Sozialwissenschaftler sich da vornehmen, und wie könnte es allenfalls gehen: Dieses Problem drängt sich dem Sozialphilosophen beim Stichwort „Normen & Werte“ deswegen auf, weil er an dem Unterfangen, ‚Gesellschaft‘ unter diesem Gesichtspunkt zu interpretieren, sogleich einen logischen Zirkel entdeckt. Wenn nämlich die Ableitung aller gesellschaftlichen Wirklichkeit aus vorgegebenen Imperativen stimmt – gilt dann nicht auch für die Wissenschaft, selber ja ohne Zweifel ein gesellschaftliches Phänomen, dass sie vorab institutionalisierte Werte
exekutiert? Wie kann sie diese dann aber erfassen?
Zum Glück gibt die Fragestellung bereits die Antwort her: Wenn die wissenschaftliche Problemlage schon so zirkulär ist, dass der Untersuchungsgegenstand bereits in den Prämissen des Nachdenkens über ihn drinsteckt, dann heißt es diesen Zirkel konsequent vollführen. In den Worten des Logikers:
„Wir können uns auf die verinnerlichten Normen erst zurückbeugen, nachdem wir unter äußerlich imponierter Gewalt zunächst blind ihnen zu folgen gelernt haben. Aber indem die Reflexion jenen Weg der Autorität erinnert, auf dem die Sprachspielgrammatiken als Regeln der Weltauffassung und des Handelns dogmatisch eingeübt wurden, kann der Autorität das, was an ihr bloße Herrschaft war, abgestreift und in den gewaltloseren Zwang von Einsicht und rationaler Entscheidung aufgelöst werden.“ (Ebd., S. 305)
Wenn es in den Sozialwissenschaften schon um „geltende Normen“ gehen soll, dann geht Wissenschaft nicht so, dass sie einfach die Welt als deren Anwendung deutet – natürlich schon gleich nicht so, dass sie die behaupteten Normen und herrschenden Werte selber zum Objekt einer Untersuchung macht: damit hätte man ja schon die Prämisse verletzt, dass sie gelten, also fürs sie untersuchende Subjekt selbst verbindlich sind. Erkenntnis ist dann vielmehr nur möglich als Reflexion auf den Prozess, der die Gültigkeit der Werteordnung, ihre Anerkennung als ein höheres Sollen, in den Gesellschaftsmitgliedern verankert hat. Wobei eben von vornherein klar zu sein hat, dass diese Reflexion grundsätzlich affirmativ zu sein hat: Sie darf die Anerkennung des vorgegebenen sittlichen Kodex nicht aufheben, noch nicht einmal suspendieren, sondern muss sie bewusst vollziehen und dadurch auf eine höhere Ebene heben, womit das Normative normativ bleibt, aber seinen Zwangscharakter verliert und einsichtig wird. Man entkommt der Autorität des normativ Vorgegebenen nicht, aber das macht nichts; denn man kann sie zu einem gewaltloseren Zwang
veredeln, indem man sich rational
zur Anpassung entscheidet
: diese Gedankenfigur findet Habermas mit der Vorstellung gesellschaftlicher Verhältnisse als Exekution von „Sprachspielgrammatiken“ ganz prima getroffen. Und das muss man seiner „Logik“ schon lassen: Er nimmt das soziologische Geschwafel von „Normen & Werten“ viel ernster als die Soziologen selbst, wenn er darauf besteht, dass – wenn schon, denn schon! – Wissenschaft auch nichts anderes ist als ein Stück der von Normen geleiteten Selbstverständigung einer von Normen geleiteten Gesellschaft. Und er tut das mit großem theoretischem Gewinn. Denn so verwandelt sich ganz von selbst das erste Problem einer Logik der Sozialwissenschaften in einen ziemlich fertigen Begriff von ‚Gesellschaft‘: Die ist überhaupt nichts anderes als ein sich selbst reflektierender Wertekanon. Die Sozialwissenschaften sind der edelste Teil jener affirmativen Selbstreflexion der Gesellschaft, die deren wahren Sinn und Zweck ausmacht und als letztlich unerlässliche Funktionsbedingung zu deren Wertekanon dazugehört. Mit Habermas‘ Worten: Sozialwissenschaft, wenn sie von „Normen & Werten“ kündet, versteht eigentlich immer schon, ob sie das selber kapiert oder nicht,
„die Gesellschaft als einen Handlungszusammenhang von sprechenden Menschen, die den sozialen Verkehr in den Zusammenhang bewusster Kommunikation einholen und sich selbst darin zu einem handlungsfähigen Subjekt bilden müssen – sonst (müssen) die Geschicke einer im einzelnen immer strenger rationalisierten Gesellschaft insgesamt der rationalen Zucht, der sie umso mehr bedürfen, entgleiten.“ [13]
Vorstellen darf man sich also in etwa Folgendes: Die Leute denken und handeln, wie zu denken und zu handeln sie gewohnt sind, weil man es ihnen so beigebracht hat. Das ist ihr sozialer Verkehr, den sie dann mit bewusster Kommunikation einholen
– und kaum haben sie den ‚eingeholt‘, sich selbst und einander wechselseitig selbstreflexiv-kritisch daraufhin hinterfragt, was ihnen da so überaus verbindlich ist, schon ist der Zwang, dem sie dann gehorchen, ein viel gewaltloserer Zwang
als der, der von ihnen Gehorsam erzwungen hat: Auf den haben sie sich mit Erfolg „zurückgebeugt“ und dabei erfasst, dass in Wahrheit sie mit ihrer kommunikativen Selbstvergewisserung die einzige Autorität
sind, der sie Folge leisten. Dann handeln sie nicht nur, wie sie handeln, sondern sind überhaupt erst das handlungsfähige Subjekt
‚Gesellschaft‘ und damit die herrschaftsfreie Räson des großen Miteinander, die überhaupt erst dessen Geschicke
, worin auch immer sie bestehen, davor bewahrt zu entgleiten
, was immer das auch bedeuten mag. Das alles hat Habermas herausgefunden; und zwar nicht durch soziologische Feldforschung oder in einer Umfrage, sondern mit logischer Notwendigkeit ermittelt aus dem Vorurteil der meisten Sozialforscher, ihr Objekt unter dem Aspekt institutionalisierte Werte
zu erforschen. Dann nämlich sind die Sozialwissenschaften ebenso wie die Gesellschaft, von der sie der vorbildlich und maßgeblich reflektierende Teil sind, ihrem Wesen nach die affirmative Selbstreflexion eines autoritativ wirkenden Wertekanons – und die Logik der Sozialwissenschaften hat ihr nächstes fruchtbares Problem: Wenn es denn um ein Sich-Zurückbeugen der Subjekte auf die Autorität geht, die ihnen ihre „Sprachspielgrammatiken“ eingeimpft hat – ist so etwas nicht eine zutiefst individuelle Geschichte? Etwas Singuläres? Wenn das aber so ist: Wie ist dann eine allgemeine Theorie darüber denkbar?
Das ist logische Problemstellung mit selbstreflexivem Niveau; und Habermas gefällt sich darin – das ist es überhaupt, was seinem mageren Gedanken Fülle und den Umfang dickleibiger Bücher verschafft –, mit der auf alle erreichbaren Größen der Geistes- und Gesellschaftswissenschaften loszugehen und ihnen nachzuweisen, dass eine solche Theorie so, wie die sich das gedacht haben, auf alle Fälle nicht geht. Heraus kommen dann Urteile der folgenden Art:
„Auch die institutionalisierten Werte gehören zu einem in umgangssprachlicher Form überlieferten, mehr oder weniger artikulierten, stets geschichtlich konkreten Weltbild sozialer Gruppen. Parsons entkleidet die Auffassung tradierten Sinns ihrer Problematik durch die vereinfachende Annahme eines Wertuniversalismus. Die in Wertsystemen objektivierten Bedeutungsgehalte sind demnach nicht in einzigartige Kulturen und Traditionen eingelassen; sie bauen sich vielmehr aus elementaren Wertbestandteilen auf (…). Diese elementaristische Annahme (...) schneidet die Frage ab: ob sich die Handlungstheorien in der unvermeidlichen Dimension einer hermeneutischen Aneignung von tradiertem Sinn nicht der Problematik stellen müssen, die Max Weber unter dem Namen der Wertinterpretation immerhin beachtet hat.“[14]
Werte sind tradierter Sinn
– und von der Problematik
bei dessen Auffassung
ausgehend hat Habermas ja seinen Weg hin zur kommunikativen Wahrheitsfindung im Karussell der Konsensfindung zwischen experimentierfreudigen Forschern gepflügt. Jetzt erfahren wir, dass an Habermas und seinen gedanklichen Wegen grundsätzlich keine anderen vorbeiführen: Es ist einfach unvermeidlich
, dass sich einem beim Nachdenken über die gesellschaftlichen Sitten und Gebräuche die Dimension
aufdrängt, in der sich Hermeneuten in ihrem Zirkel gehen zu lassen pflegen. Auch Parsons ist so besehen schon den Weg von Habermas gegangen, nur war er sich dessen wohl nicht so recht bewusst: Er stand kurz vor der einzigen Frage
, die Habermas bewegt, nämlich wie die jeweilige Einzigartigkeit eines sich reflektierenden Wertekosmos einer theoretischen Verallgemeinerung zugänglich gemacht werden könnte; die hat er dann aber doch nicht gestellt, sondern vielmehr abgeschnitten
. Er hat sich mit seinen vereinfachenden Annahmen
also selbst darum gebracht, sich auf die ja so unglaubliche Tiefe der zirkulären hermeneutischen Sinn-Reflexion zurückzubeugen
– obwohl er die ja unvermeidlich
anstößt, kaum redet er auch nur irgendwie von Werten. Max Weber hingegen hat mit der Ablieferung eines passenden Stichworts unmittelbar vor Augen gestellt, dass sich Werte hermeneutisch interpretiert gehören, womit schon mal zwei gewichtige Vertreter soziologischen Denkens bezeugen dürfen, dass das Telos der soziologischen Theoriebildung nicht anderes ist und unvermeidlicherweise sein kann, als die Teleologie der Gesellschaft zu denken, die Habermas mit dem Stichwort ‚Kommunikation‘ ins Spiel bringt. Gesellschaft ist die gedachte Möglichkeit, im Wege der kommunikativen Selbstvergewisserung ihrer Mitglieder über die Vermittlungsschwierigkeiten zwischen ihrem internalisierten
normativen Sollen einerseits, ihrem eigenen Wollen andererseits überhaupt erst recht eigentlich zu sich selbst zu finden – und in Habermas hat sie zumindest schon einmal die Bedingung dafür, diese Möglichkeit im Irrealis denken zu können:
„So ist denn das soziale Handeln eine Resultante aus beidem: aus reaktiven Zwängen und sinnvollen Interaktionen. (...) Erst wenn die abgespaltenen Motive und tief internalisierten Regeln aus ihrem objektiven Zusammenhang mit den rationalen Zwängen der kollektiven Selbstbehauptung einerseits und mit den irrationalen Zwängen funktionslos gewordener Autoritäten andererseits begriffen, wenn sie in den Köpfen der Handelnden selber mit den subjektiv sinnvollen Motiven versöhnt wären, könnte sich soziales Handeln zu einem wahrhaft kommunikativen Handeln entfalten.“ (Ebd., S. 202)
Habermas will ja nicht zu viel versprechen: Wenn die abgespaltenen
mit den subjektiv sinnvollen
Beweggründen der Leute versöhnt wären
– der Habermasische Konjunktiv, der immerhin ein kleines Licht der Hoffnung aufsteckt –, dann könnte
jenes Ideal wahr werden, das jede Sozialwissenschaft insgeheim schon als Bedingung der Möglichkeit ihrer selbst wie ihres Objekts voraussetzt. Tatsächlich versöhnt hat sich immerhin schon einmal Habermas mit den Vorstellungen von Parsons und anderen darüber, wie ‚Gesellschaft‘ ihr Funktionieren übers Internalisieren von Normen und Werten regelt: Sie taugen ihm als Sprungbrett dafür, sich mit seiner Idee von ‚Gesellschaft‘ als konsequenter Zu-Ende-Denker dessen einzuführen, was die funktionalistischen Abstraktionskünstler der Soziologie eigentlich gedacht haben wollten.
Die Luhmann-Kontroverse: Wie lässt sich Umweltkomplexität zuverlässig reduzieren?
Gewisse Fortschritte des systemtheoretischen Denkansatzes
bieten Habermas Gelegenheit, seine Art des hermeneutischen Sich-Zurückbeugens auf die Soziologie gleich in das Format eines Richtungsstreits über die Zukunft der Disziplin zu bringen. Bezugspunkt der sog. Habermas-Luhmann-Kontroverse
ist der in der Soziologie verbreitete Konsens, Gesellschaft als System zu betrachten, alles in ihr als untergeordnete Momente eines übergeordneten Zusammenhangs zu sehen, diesen selbst als das Funktionieren seiner selbst zu bestimmen, Strukturen als Bedingung der Möglichkeit solchen Funktionierens zu postulieren. Luhmann hat sich einiges wissenschaftliches Renommee damit erworben, dass er diesen tiefen Gedanken als eine Art Sachzwang interpretiert hat, ihn zu radikalisieren und mit einer – die Anmerkung sei dann doch gestattet – etwas kindischen Vorstellung von „viel Durcheinander draußen“ und „Heimat ist, wo man sich auskennt“, zu füllen:
„Man kann die Entwicklung der Systemtheorie (...) als Trend interpretieren und extrapolieren. Das führt auf die allgemeine These, dass Systeme der Reduktion von Komplexität dienen, und zwar durch Stabilisierung einer Innen/Außen-Differenz. Alles, was über System ausgesagt wird, (...) lässt sich (...) funktional analysieren als Reduktion von Komplexität. (...) Die soziale Kontingenz sinnhaften Erlebens ist nichts anderes als ein Aspekt jener unermesslichen Weltkomplexität, die durch Systembildungen reduziert werden muss.“ [15]
Ein interessanter Trend und noch interessanterer Höhepunkt, auf den das funktionalistische Denken da in Gestalt einer „allgemeinen These“ zusteuert: Gefordert ist, „System“ streng funktionalistisch als ein „Innen“ zu denken, dem eine „unermessliche Weltkomplexität“ als „Außen“ gegenübersteht, und daraus auf eine Leistung zu schließen, die ein System zum System werden lässt; nämlich die, zwischen Innen und Außen den Unterschied herzustellen, dass weniger drin ist als draußen. Die Fiktion einer allgegenwärtigen Beliebigkeit von Alternativen zu allem, was als System betrachtet wird, ist dessen „Umwelt“; woraus folgt, dass „System“ sich selbst erhält, indem es die Reduktion von (Umwelt-)Komplexität
zustande bringt. Was Luhmann auszeichnet, ist die Kaltschnäuzigkeit, mit der er diesen Kinderkram als Inbegriff sozialwissenschaftlicher Weisheit vertritt und sämtlichen denkbaren Gegenständen der wirklichen Welt damit theoretisch Genüge getan haben will, dass er sie in sein Schema einfügt. Von seinem diesbezüglichen Beschluss – dem systemtheoretischen Denkansatz
– lässt er sich dazu überreden, von allem und jedem nichts weiter als entscheidende Bestimmung auszusagen als eben dies, dass es an der „Reduktion von Komplexität“ mitwirkt und ein Stück Übersichtlichkeit in die Welt bringt; der legt
zum Beispiel nahe, Wahrheit funktional zu definieren als das Medium der Übertragung von Sinn, das sich auf bestimmte Weise von anderen Medien wie Macht, Geld oder Liebe unterscheidet.
[16]
Das findet Habermas aufregend. Was dieser Soziologe so alles gedanklich auf einen Haufen wirft; dass er unbesehen alles gleichermaßen als Dienst feiert, die Menschheit vor einem grauenvollen Universum unvorstellbarer Möglichkeiten zu bewahren: Respekt – der kritische Philosoph verfügt über Gesichtspunkte
, unter denen er Luhmanns Entwurf einer Systemtheorie lehrreich
[17] findet. (ebd., S. 270). Freilich kennt er auch solche, und die überwiegen, unter denen dies nicht der Fall ist; und die laufen zielstrebig auf einen hinaus: Habermas stößt sich daran, dass in der Denkwelt des Kollegen der Sinn von Gesellschaft, wie er ihn denkt, und die Methoden kommunikativer Sinnstiftung, die er als gesellschaftliches Rationalitätsprinzip elaboriert hat, einfach nicht vorkommen.
„Die zentrale (...) These, mit der Luhmanns Theorie steht und fällt, ist nämlich, dass die funktionalistische Analyse den einzigen zulässigen Weg der Rationalisierung von Entscheidungen weist (...); diese Theorie stellt sozusagen die Hochform eines technokratischen Bewusstseins dar, das heute praktische Fragen als technische von vornherein zu definieren und damit öffentlicher und ungezwungener Diskussion zu entziehen gestattet.“ (Ebd., S. 144 f.)
Grundsätzlich einer Meinung mit seinem Diskussionspartner ist Habermas darüber, dass Sozialwissenschaft nicht zu erklären hat, wie die Gesellschaft funktioniert. Ersatzweise hat er dafür seine Vorstellung im Angebot, wozu ‚Gesellschaft‘ zu funktionieren hätte, nämlich als groß angelegtes Diskursmanöver aller Beteiligten zur problematisierenden Rechtfertigung von Entscheidungen
, denen in der Manier zu ihrer Rationalisierung
verholfen würde. Sein Kollege Luhmann hingegen sieht mit jeder Entscheidung
den Lebenssinn von ‚Gesellschaft‘ perfekt verwirklicht: Komplexität
ist mit ihr reduziert
worden, wieder ein Stück Übersichtlichkeit mehr, System sei Dank; für eine kritische Hinterfragung, ob Entscheidungen
dem moralischen Bild eines diskursiv ermittelten allgemeinen Konsenses über ihre Rechtfertigung entsprechen, ist seine funktionalistische Analyse
schlicht nicht vorgesehen. Aber was heißt das schon. Auch wenn diese Sorte von ‚Analyse‘ einfach kein „Weg“ hin zu dem Problem ist, das ihn umtreibt: Er ist so frei, die Gedankengänge seines Kollegen einfach als einen solchen Weg zu nehmen. Und da stellt sich dann allerdings schnell heraus, dass Luhmanns Art, die Funktionsbedingungen von ‚Gesellschaft‘ zu reflektieren, dem gehobenen Anspruch einer Rationalisierung von Entscheidungen
vermittels öffentlicher und ungezwungener Diskussion
nicht genügt. Diesen Vorwurf macht er z.B. an dessen Definition von ‚Wahrheit‘ als auch so einem sinnstiftenden ‚Medium‘ wie Macht oder Geld fest: Dass – wenn man alles andere mal beiseite lässt – ‚Wahrheit‘ die Funktion hat, etwas, was einer für sinnvoll hält, anderen zu vermitteln, also einen ‚Geltungsanspruch‘ zu transportieren, mit dem man gemeinsam ein Stück Umweltkomplexität reduziert, das ist für Habermas ein durchaus diskussionswürdiger „Ansatz“. Aber wenn schon funktionalistisch gedacht werden soll, dann bitte konsequent; und da muss Habermas dem Kollegen sagen, dass Sinnvermittlung und ‚Wahrheit‘ als Medium nur funktionieren können unter der Bedingung der „Erwartung eines Konsensus, der sich unter Bedingungen einer idealen Sprechsituation immer wieder ergeben müsste“ (ebd., S. 223). Entgegenkommend schmiegt sich Habermas an Jargon und Denkweise seines Gesprächspartners an und erklärt ihm den entsprechenden Vorzug einer sinnverstehenden Soziologie
mit der Auffassung von ‚Gesellschaft‘ als Zusammenhang, dessen Faktizität auf (...) Kritisierbarkeitsansprüchen beruht
: ‚Rational‘ wird die Welt nur dann, dann aber schon, und der Tatbestand von ‚Wahrheit‘ ist genau dann erfüllt, wenn die mit der Reduktion von Umweltkomplexität befassten Subjekte darauf bestehen, ihre wechselseitige Zumutung, etwas als gültig zu akzeptieren, für „kritisierbar“ halten dürfen; deswegen ist aus der gemeinschaftlichen Systembildung der herrschaftsfreie Diskurs über wechselseitige Sinn-Zumutungen als Bedingung der Möglichkeit nicht wegzudenken. Im Sinne seines eigenen Erkenntnisinteresses hätte Luhmann also besser daran getan, sich Habermas anzuschließen:
„Dieses Vorzugs begibt sich Luhmann mit der Funktionalisierung seines Wahrheitsbegriffs.“ (Ebd., S. 225)
Stattdessen trägt er dazu bei, die Sozialwissenschaft zu „verkürzen“ und so den gesellschaftlichen Reflexionsprozess zu behindern: Luhmanns Gedankengebäude kann glatt als Rechtfertigung der systematischen Einschränkung praktisch folgenreicher Kommunikation dienen.
(Ebd., S. 267) Von solchen Figuren ist die Welt des Sozialphilosophen Habermas also anscheinend bevölkert: von Guten, die praktisch folgenreich
kommunizieren möchten; von welchen, die dieses edle Unterfangen systematisch
beschränken; und schließlich von Kollegen, die so was auch noch rechtfertigen. In dieser Geisterwelt trifft er auf Luhmann; und der antwortet kongenial aus der seinigen mit dem Hinweis, wie weit er es mittlerweile beim Reduzieren von Umweltkomplexität gebracht hat:
„Die Systemtheorie hat sich von Vernunft und Herrschaft emanzipiert. (...) Vernunft und Herrschaft sind für sie (...) überhaupt keine brauchbaren Begriffe mehr.“ [18]
Wer wollte ihm da widersprechen.
Marxismus: Wie lässt sich ein toter Hund fruchtbar machen?
Wie schon gesagt: Habermas legt großen Wert auf den Nachweis, in seiner Synthese von Erkenntnis- und Gesellschaftstheorie die nachgerade zwangsläufige Konsequenz aus all dem gezogen zu haben, womit die wissenschaftliche Tradition
von Plato bis Kant, von Schelling bis Peirce und von Gadamer bis zum Materialismus von Marx sich – letztlich erfolglos – herumgeschlagen hat. Über die Grundsätze des Zustandekommens dieser großen geisteswissenschaftlichen Synthese, die da gleichsam aus ihm spricht, lässt er folgendes wissen:
„Rekonstruktion bedeutet in unserem Zusammenhang, dass man eine Theorie auseinandernimmt und in neuer Form wieder zusammensetzt, um das Ziel, das man sich gesetzt hat, besser zu erreichen: das ist der normale (ich meine: auch für Marxisten normale) Umgang mit einer Theorie, die in mancher Hinsicht der Revision bedarf, deren Anregungspotential aber noch (immer) nicht ausgeschöpft ist.“ [19]
In den Kreisen dieses Gelehrten liest man eine Theorie also grundsätzlich nicht mit dem Ziel zu verstehen, was sie behauptet, und zu prüfen, ob ihre Behauptungen in Ordnung gehen. Man liest sie eigentlich gar nicht in dem Sinn, weil man aus ihr nur herausliest, was man in sie hineingelesen hat: Das Ziel, das ein Wissenschafts-Methodologe wie er bei der Befassung mit ihr im Auge hat, ist die Sichtung dessen, was von ihr übrig bleibt, hat er sie erst einmal durch die Brille seiner ‚Wissenschaftslogik‘ betrachtet und entsprechend auseinandergenommen
. Dann kann er am Produkt seiner Verfremdung prüfen, was an ihr mit den Prinzipien kommensurabel ist, nach denen er seinen Gegenständen zuleibe zu rücken gedenkt, und was umgekehrt keinesfalls ein auszuschöpfendes Anregungspotential
in diesem Sinne und daher zu ignorieren ist.
Marx besser (...) verstehen, als er sich selbst verstanden hat
,[20] nennt der Meister das, und will uns damit in aller Bescheidenheit andeuten, dass Marx eigentlich nur darauf gewartet hat, als Methodologe mit Habermas verglichen, so endlich „ausgeschöpft“ und richtig verstanden zu werden.[21]
Da ist als erstes einmal – selbstverständlich „kritisch“ – festzuhalten, dass Marx
eine erkenntniskritische Rechtfertigung der Gesellschaftstheorie nicht für nötig gehalten (hat)
[22]. Es gehört zum gesunden Selbstbewusstsein dieser Variante von ‚Kritik‘, sich selbst als richtende Instanz aufzubauen und statt eines Arguments den vorwurfsvollen Hinweis auf Folgen von Entscheidungen zu präsentieren, die man sich anders gewünscht hätte; die Kunst der Negation und das Schwafeln im Konjunktiv stehen bei Habermas hoch im Kurs; hätte Marx nicht ..., wäre aus ihm ein früher Habermas geworden:„Hätte Marx Interaktion mit Arbeit nicht unter dem Titel der gesellschaftlichen Praxis zusammengeworfen, hätte er stattdessen den materialistischen Begriff der Synthesis auf die Leistungen instrumentalen und die Verknüpfungen kommunikativen Handelns gleichermaßen bezogen, dann wäre die Idee einer Wissenschaft vom Menschen nicht durch die Identifikation mit Naturwissenschaft verdunkelt worden.“ (Ebd., S. 85)
Hätte Marx nicht übersehen, dass die Menschen nicht als Taubstummen-Kollektiv antreten, wenn sie arbeiten, sondern auch kommunizieren, wäre ihm erstens klar geworden, dass Sprache neben Arbeit die zweite Konstitutionsbedingung jeder Gesellschaft ist, und dass es deswegen zweitens selbstverständlich eine eigene
Wissenschaft vom Menschen
braucht, die unermüdlich an diesen Sachverhalt erinnert und für herrschaftsfreie Kommunikation als Bedingung der Möglichkeit von Gesellschaft wirbt.Auch die Marxsche Wertlehre ist nicht frei von Mängeln, im Kern aber brauchbar:
„Die Wertlehre lässt sich als ein System von Zuordnungsregeln verstehen, das gestattet, Aussagen, die den kapitalistischen Wirtschaftsprozess unter Steuerungsgesichtspunkten systemtheoretisch beschreiben, in Aussagen über antagonistische Beziehungen zwischen sozialen Klassen zu übersetzen. (...) Forschungsstrategisch hat die Wertlehre den Sinn, Probleme der Systemintegration auf der Ebene der Sozialintegration abbildbar zu machen.“ [23]
Hier ist durchaus etwas zu machen; man muss sich nur von einem engen inhaltlichen Verständnis der Werttheorie befreien und sie neu in den Blick nehmen: als Anleitung (
System von Regeln
), wie schöne systemtheoretische Vorstellungen von einer möglichen Steuerung des Kapitalismus zusammengebracht werden könnten mit dem Antagonismus der Klassen. Liest man sie aus der Sicht des Problems, unter welchen Bedingungen Klassengegensätze möglicherweise irgendwie miteinander versöhnt und gesteuert werden könnten, erhält sie sofort ihren guten Sinn. Der leuchtet Habermas so sehr ein, dass wohl auch Marx gar keine andereForschungsstrategie
gehabt haben kann, als sich mit seiner Werttheorie an der Verbesserung des Kapitalismus zu beteiligen und einen Vorschlag einzureichen, wie der Zusammenhang zwischen kapitalistischem Fortschritt (Systemintegration
) und dessen sozialen Begleiterscheinungen sicht- und womöglich beherrschbar zu machen wäre.Dieser durch Habermas nicht abgestoßene, sondern aufgeklärte Marx hat uns noch mehr zu sagen:
„Marx hatte den Systemzusammenhang der Selbstverwertung des Kapitals (...) als fetischistische Totalität begriffen; daraus hatte sich die methodische Forderung ergeben, alles, was korrekterweise unter eine systemtheoretische Beschreibung zu bringen ist, zugleich als einen Prozess der Verdinglichung lebendiger Arbeit zu dechiffrieren. Dieser weitgehende Anspruch entfällt aber, wenn wir im kapitalistischen Wirtschaftssystem nicht nur eine neue Formierung von Klassenverhältnissen, sondern ein fortgeschrittenes Niveau der Systemdifferenzierung erkennen. Unter dieser Prämisse verwandelt sich die semantische Frage, wie etwas aus einer Theoriesprache in die andere übersetzt werden kann, in die empirische Frage, wann das Wachstum des monetär-bürokratischen Komplexes Handlungsbereiche berührt, die nicht ohne pathologische Nebenwirkungen auf systemintegrative Mechanismen umgestellt werden können.“ [24]
Positiv wird hier vermerkt, dass Marx das Kapital und seinen Verwertungsprozess als Systemtheoretiker analysiert hat; offenbar gilt es in dieser Disziplin als wissenschaftliche Errungenschaft, wenn ein Ding als
Totalität
begriffen
wird. Irgendwie muss Marxdaraus
auf die methodische Forderung verfallen sein, alles in diesem System als Verdinglichung zu „dechiffrieren“ – wobei im Dunkeln bleibt, warum die von ihm begriffene kapitalistische Totalität nur Chiffren enthält. Wie immer dem auch sein mag: Das Projekt, alles und jedes im Kapitalismus auf den Grundwiderspruch zwischen Lohnarbeit und Kapital zurückzuführen – das nämlich soll der Inhalt der Marxschen Methode sein –, muss als überholt gelten, wenn man besagten Kapitalismus systemtheoretisch anders interpretiert. Nämlich „nicht nur“ als geprägt von Klassen, sondern eher von einer Differenzierung, die man getrost für einen Fortschritt halten darf – das hat Marx übersehen. Er hat nicht ausreichend getrenntzwischen dem in der Moderne ausgebildeten Niveau der Systemdifferenzierung und den klassenspezifischen Formen seiner Institutionalisierung
(ebd., S. 500 f.) und sich deswegen darüber getäuscht,dass jede moderne Gesellschaft, gleichviel wie ihre Klassenstruktur beschaffen ist, einen hohen Grad an struktureller Differenzierung aufweisen muss.
(Ebd., S. 501)Nichts gegen das Konzept der Klassen, die gibt es – da weiß der Philosoph Bescheid – ganz einfach in jeder „modernen“ Gesellschaft; es gibt in ihnen aber auch immer mehr Unterschiede, denen man mit dem Reduktionismus des Klassenkonzepts nicht mehr beikommt. So dass sich zum einen die
semantische Frage
erhebt, wie wir die Verdinglichungs-Methodologie von Marx heute noch weiterkauen können angesichts der Tatsache, dass ihre Anwendungsbedingungen in dem Sinn nicht mehr vorliegen, auf Habermasisch: Wie wir seineTheoriesprache
in eine modernereTheoriesprache
übersetzen
können. Diese Frage soll sich wiederum in dieempirische Frage
verwandeln
– offenbar kennt der Philosoph auch nicht vorhandene Fragen –, ob das ungebremste Wachstum desmonetär-bürokratischen Komplexes
in Gesellschaften mit fortgeschrittener Systemdifferenzierung nicht die Bedingung der Möglichkeit einer allseitigen Zustimmung zu dieser Gesellschaft aushöhlt. Ob nicht durch eine Überdosis Kapitalismuspathologische Nebenwirkungen
zu befürchten wären, wenn der Sozialstaatein Netz von Klientenverhältnissen über die privaten Lebensbereiche ausbreitet
und die in diesen Lebensbereichen gängigenhandlungskoordinierenden Verständigungsmechanismen
ablöst und umstellt aufMedien wie Macht und Geld
. (Ebd., S. 534)
Was übrig bleibt von Marx ist der transzendentale Wahn von Habermas, der – egal, ob es um Wissenschaft oder moderne Gesellschaften geht – zielstrebig das Problem, den herausgehobenen Stellenwert und die Bedingungen herrschaftsfreien kommunikativen Handelns identifiziert.
Demokratie: Die denkbarste aller möglichen Bedingungen herrschaftsfreier Konsensbildung?
Es hat keinen Sinn, Habermas‘ Theorie zur Möglichkeit einer Sozialtheorie mit einer Erinnerung daran zu konfrontieren, wie es wirklich zugeht auf der Welt. Ob der Mann die Gemeinheiten des Systems der Konkurrenz, die Macht und die Absurditäten des kapitalistischen Reichtums, die Notwendigkeiten produktiver Armut, das Elend eines Großteils der Weltbevölkerung, den alltäglichen und den gelegentlichen außerordentlichen Einsatz staatlicher Gewalt für die Aufrechterhaltung dieser Verhältnisse und für die Position der eigenen Nation darin und anderes von der Art überhaupt zur Kenntnis nimmt, ist schwer zu sagen, aber auch völlig gleichgültig. Wenn er sich in einem eigenen Aufsatz der Frage widmet:
Können komplexe Gesellschaften eine vernünftige Identität ausbilden?
[25]
dann figuriert schon in seiner Problemstellung die fertig ausgebildete kapitalistische Gesellschaft, die er zweifelsohne im Auge hat, als Fall einer Gattung von Gesellschaft, in deren wesentlicher Bestimmung – komplex
– jeder sachliche Gehalt getilgt und durch den leeren Verweis auf eine Menge Mannigfaltigkeit in dem einen Ding ‚Gesellschaft‘ ersetzt ist; die Frage zielt dementsprechend auf ein Vermittlungsproblem der denkbar abstraktesten Sorte, für dessen Lösung möglicherweise ein Ding namens ‚Vernunft‘ zuständig sein könnte. Die Antwort erfolgt in zwei Schritten und macht, der Fragestellung entsprechend, klar, dass Habermas tatsächlich nichts anderes als den Funktionalismus einer funktionierenden Stiftung von Einheit in der Vielfalt bedacht wissen möchte. In einem ersten Schritt lehnt er den Gedanken, die erfragte „Identität“ von ‚Gesellschaft‘ könnte irgendeinen Inhalt haben, rundheraus ab; wobei dem Hinweis auf heute
und der Konzession, allenfalls
ließe sich eine rein formale
Sorte von Bedingungen der Herbeiführung einer solchen Identität
in Anschlag bringen, die semantische Funktion zukommt, andere Auffassungen von vornherein ins Abseits der Naivität und der Gestrigkeit zu stellen:
„Eine kollektive Identität können wir heute allenfalls in den formalen Bedingungen verankert sehen, unter denen Identitätsprojektionen erzeugt und verändert werden.“ (Ebd., S. 107)
Der Nachsatz legt nahe, dass Vorstellungen von einem gesellschaftlichen Zusammenhalt, die irgendeine sachliche Bestimmung zum Inhalt haben, zwar vorhanden sind, aber den Charakter bloßer Einbildungen – Projektionen
– haben, die für sich genommen eine wirkliche Vermittlung von Vielfalt zu einer heute allenfalls
möglichen Identität eher verhindern, auf jeden Fall aber, soll es mit der Einheitsstiftung klappen können, gewissen formalen Bedingungen ihrer Erzeugung untergeordnet werden müssen. Deren Definition liefert Habermas in seinem zweiten Gedankenschritt:
„Die Vernünftigkeit der Identitätsinhalte bemisst sich dann allein an der Struktur dieses Erzeugungsprozesses, d.h. an den formalen Bedingungen des Zustandekommens und der Überprüfung einer flexiblen Identität, in der sich alle Gesellschaftsmitglieder wiedererkennen und reziprok anerkennen, d.h. achten können.“ (Ebd.)
Der Weg ist das Ziel; und Vernunft ist, wenn die Methode der Erzeugung von Identitätsvorstellungen garantiert nirgends anders hinführt als dazu, dass alle Beteiligten die Chance haben, sich mit den Konstruktionsprinzipien ihrer Einbildungen in den Zulassungsbedingungen für deren Herstellung gut und verträglich mit ihresgleichen aufgehoben zu fühlen. An welches Stück einer „heute allenfalls“ existierenden gesellschaftlichen Realität könnte man da denken?
Dass ‚Gesellschaft‘ „heute“ ungefähr so „vernünftig“ funktioniert, will Habermas freilich auch gar nicht behauptet haben. Doch immerhin, eine Theorie der Moderne hat er schon; und in der rangiert, immer vornehm zurückhaltend im Konjunktiv, sein Idealismus des herrschaftsfreien Konsens, der in den Zitaten ja leicht wiederzuerkennen ist, durchaus als Telos der Weltgeschichte – und die Demokratie als denkbarste aller möglichen oder möglichste aller denkbaren Annäherungen daran. Um die theoretischen Umstände, die Habermas um dieses Bekenntnis macht, nicht unzulässig zu verkürzen, sei in die Mitte seines 1000-seitigen Hauptwerks hineingegriffen – jedes andere Werk, an beliebiger Stelle aufgeschlagen, führt über kurz oder lang zu demselben Ergebnis –, wo der Autor für seinen einen immer gleichen Gedanken unter dem Stichwort Lebenswelt
schöne und besonders durchsichtige Formulierungen gefunden hat. Dort heißt es:
„Die Lebenswelt speichert die vorgetane Interpretationsarbeit vorangegangener Generationen; sie ist das konservative Gegengewicht gegen das Dissensrisiko, das mit jedem aktuellen Verständigungsvorgang entsteht. Denn die kommunikativ Handelnden können eine Verständigung nur über Ja/Nein-Stellungnahmen zu kritisierbaren Geltungsansprüchen erreichen. Die Relation zwischen diesen Gewichten ändert sich mit der Dezentralisierung der Weltbilder. Je weiter das Weltbild, das den kulturellen Wissensvorrat bereitstellt, dezentriert ist, um so weniger ist der Verständigungsbedarf im vorhinein durch eine kritikfest interpretierte Lebenswelt gedeckt“.[26]
Da hat man also nochmals alles beieinander: ‚Gesellschaft‘, die jetzt eben zur Abwechslung Lebenswelt
heißt, als gelebte Hermeneutik; diese als kritisches Verhältnis zwischen „gespeichertem“ Einverständnis und Risiko von Meinungsverschiedenheiten – worüber auch immer: worauf es Habermas hier wie überall ankommt, ist die formelle, von jedem Inhalt abstrahierende Konfrontation eines faktischen Konsenses mit Geltungsanspruch und der Herstellung eines Konsenses, was allemal unterstellt, dass der erst hergestellt werden muss, also nicht vorliegt –; und ein ‚je – desto‘, das schon ein wenig auf jene „Lebenswelt“ verweist, in der es einen Habermas gibt, der an ihr herumproblematisiert; mit kritikfest interpretiert
schiebt sich da jedenfalls nicht mehr viel. Und das ist gut so. Denn daraus erwächst eine Art hermeneutischer Sachzwang, der in die Richtung dessen drängt, was Habermas unter Ratio versteht, nämlich hin zu jenem Konsens, der nicht einfach da ist, sondern erst entstehen muss: Je mehr der Bedarf nach Verständigung
„durch die Interpretationsleistungen der Beteiligten selbst, d.h. über ein riskantes, weil rational motiviertes Einverständnis befriedigt werden muss, um so häufiger dürfen wir rationale Handlungsorientierungen erwarten. Deshalb lässt sich die Rationalisierung der Lebenswelt vorerst in der Dimension ‚normativ zugeschriebenes Einverständnis‘ vs. ‚kommunikativ erzielte Verständigung‘ charakterisieren. Je mehr kulturelle Traditionen eine Vorentscheidung darüber treffen, welche Geltungsansprüche wann, wo, für was, von wem und wem gegenüber akzeptiert werden müssen, um so weniger haben die Beteiligten selbst die Möglichkeit, die potentiellen Gründe, auf die sie ihre Ja/Nein-Stellungnahmen stützen, explizit zu machen und zu prüfen“ (ebd.).
Ob kulturelle Traditionen
von sich aus, ganz ohne Beteiligte
, die dazu Ja oder Nein sagen und dafür möglicherweise sogar Gründe nennen könnten, zwangsweise für die Akzeptanz von Geltungsansprüchen
sorgen, mag dahingestellt bleiben; darauf kommt es schon auch nicht mehr an bei Geltungsansprüchen
, die gar keinen anderen Inhalt haben, als dass es welche sind. Ob es so richtig vernünftig ist, wenn Beteiligte
noch nicht einmal ihre wirklichen Gründe für die Ablehnung oder Anerkennung von was auch immer prüfen
, sondern bloß die Möglichkeit haben müssen, mögliche Gründe explizit zu machen
, ist auch schon egal – klar genug ist ohnehin, worauf Habermas hinaus will. Für ihn ist ‚Gesellschaft‘ ein Verständigungsprozess, sogar dann, wenn die Beteiligten sich von sich aus über gar nichts wirklich verständigen; dass sie genau das tun sollten, weil erst und nur dadurch ‚Gesellschaft‘ ihren eigentlichen Sinn verwirklicht, und dass kulturelle Traditionen
diesen Prozess behindern können, aber nicht dürfen: das ist der neue kategorische Imperativ des Transzendentalphilosophen. Dessen Gültigkeit erblickt Habermas, wohin er auch blickt – im Recht zum Beispiel: Kein Zweifel, dass es sich beim staatlichen Gesetzeswerk einerseits
um einen gar nicht besonders diskursiven „Geltungsanspruch“ handelt, der den Rechtssubjekten faktische Beschränkungen
auferlegt; andererseits
kann aber auch die Durchsetzung der Gesetze nur unter der Bedingung als möglich gedacht werden, dass die betroffenen Subjekte sie als ihr „Inter-„ anerkennen
: Sie müssen
„zugleich eine sozialintegrative Kraft entfalten, indem sie den Adressaten Verpflichtungen auferlegen, was (...) nur auf der Grundlage intersubjektiv anerkannter normativer Geltungsansprüche möglich ist.“ [27]
Deswegen gilt es freilich auch aufzupassen, dass ‚Gesellschaft‘ mit ihrem Bedürfnis nach Integration nicht zurückfällt auf jenen technokratischen Weg, dem Habermas erkenntnistheoretisch bereits das positivistische Wasser abgegraben hat: Gerade die moderne Gesellschaft, der ihre zwangsweise selbstverständlichen Vorab-Festlegungen, insbesondere solche religiös-dogmatischer Art, abhandengekommen sind, schlägt sich irgendwie laufend mit dem Problem herum,
„ob ein und gegebenenfalls welches Teilsystem an die Stelle des Religionssystems treten kann, so dass in ihm das Ganze einer komplexen Gesellschaft repräsentiert und zum einheitlichen normativen Bewusstsein aller Gesellschaftsmitglieder integriert werden kann.“ [28]
Der sittliche Auftrag, den kein geringerer als die Bedingung der Möglichkeit vernünftig funktionierender gesellschaftlicher Integration erteilt, ist jedenfalls eindeutig. Und in dem Maße, wie er befolgt wird, verliert das, was ‚Gesellschaft‘ einstweilen faktisch zusammenhält, nämlich ‚Herrschaft‘, zwar nichts an offenbar nötiger politischer Macht, aber ihr Moment von Irrationalität, und Habermas gestattet der 1. Person Pluralis eine Antwort auf die Kantische Sinnfrage ‚Was dürfen wir hoffen?‘:
„Rationalisierung der Herrschaft dürfen wir nur erhoffen von Verhältnissen, die die politische Macht eines an Dialoge gebundenen Denkens begünstigen.“ [29]
Ganz Habermas-mäßig als warnende Einschränkung formuliert, winkt da doch, auf Basis seiner Hermeneutik, die politische Machtergreifung der Vernunft. Und sie winkt nicht bloß als ferne Hoffnung: Ein wenig ist sie bereits unterwegs. Denn nichts Geringeres als das ist es,
„worauf Demokratie abzielt: in dem Maße, in dem mündige Bürger unter Bedingungen einer fungierenden Öffentlichkeit, durch einsichtige Delegation ihres Willens und durch wirksame Kontrolle seiner Ausführung, die Einrichtungen ihres gesellschaftlichen Lebens selber in die Hand nehmen, wird personale Autorität in rationale überführbar; das würde den Charakter von Herrschaft verändern; und sofern in der Politik immer auch ein Moment von blinder Herrschaft steckt, mahnt die Idee der Demokratie an die Vergänglichkeit des Politischen als solchen.“ [30]
Um es mal so auszudrücken: Dem Mann wird nicht schlecht, wenn Meinungsbildner von der Springer-Presse bis zur ARD, unterstützt durch Regierungssprecher und die Spin-Doctors der Parteien, als Öffentlichkeit fungieren; wahrscheinlich denkt er an die mal wieder gar nicht, wenn er der fungierenden Öffentlichkeit
den Rang einer Bedingung für Vernunft im politischen Handeln zuschreibt. Der Mann wird auch nicht irre, wenn er die in Wahlen praktizierte Delegation
des Bürgerwillens an die Herrschaft für einsichtig
hält, die öffentliche Kontrolle des Herrschaftswillens nicht bloß für wirksam
, sondern offenbar auch für einen Schritt zu dessen Vernünftig-Werden, und wenn er das alles als eine Art und Weise ansieht, wie die gesetzlich bevormundete Bürgerschaft ihre Existenzbedingungen selber in die Hand
nimmt – die Idiotien eines demokratischen Wahlkampfs sind ihm anscheinend noch nie so recht aufgefallen, zumindest nicht da, wo es um Komplimente an die demokratische Idee geht; und von einer Staatsräson, der die öffentliche Gewalt ihren Standort unterwirft und mit der all die Einrichtungen
des gesellschaftlichen Lebens
definiert und praktisch vorgegeben sind, mit denen die mündigen Bürger
alsdann klarzukommen versuchen, weiß er ganz bestimmt nichts. Habermas kennt, was Herrschaft betrifft, überhaupt nur die Alternative zwischen personaler
und rationaler Autorität
; und ganz vorsichtig, im Konjunktiv, meint er, im Sinne der Zielsetzungen der Demokratie wäre erstere in letztere überführbar. Was an Wünschen in Sachen Rationalität noch offenbleibt, sieht er immerhin ersatzweise mit der demokratischen Lebensweisheit bedient, wonach die Frist, die die Demokratie der Amtszeit der Regierenden setzt, den blinden
Herrschaftsanspruch der politischen Machthaber gnädig relativiert. Und mit Entdeckungen solcher Art will Habermas dann schon der demokratischen „Lebenswelt“ seinen transzendentalen Segen erteilt und bescheinigt haben, dass sie durchaus die wesentliche Bedingung der Möglichkeit einer Annäherung von ‚Gesellschaft‘ an das Ideal rationaler Integration durch herrschaftsfreie Kommunikation sein dürfte.
Mit derlei Komplimenten an die Adresse der modernen Staatsgewalt kann Habermas seinem großen Kollegen und virtuellen Diskussionsgegner Popper die Hand reichen. Schon der hat unter dem Titel „kritischer Rationalismus“ seine erkenntnistheoretische Absage an sicheres Wissen mit einer Politphilosophie für den Sonntagsgebrauch demokratischer Machthaber und Meinungsmacher zusammengeschlossen und die Demokratie zu der Gesellschaftsform erklärt, die als einzige der Unfähigkeit des Menschen zu objektiver Wahrheit Rechnung trägt und so die Menschheit bewahrt vor der Vergewaltigung durch Behauptungen, die nicht unter den Vorbehalt gestellt werden, dass man den letzten Schwan noch nicht gesehen hat. Freilich denkt Habermas da noch viel tiefer. Popper bekennt sich offensiv zu dem Dementi von Herrschaft und staatlicher Gewalt, das die Ideologen der demokratischen Herrschaft und Staatsgewalt aus deren institutionalisierter Gleichgültigkeit gegen den weltanschaulichen Gehalt zulässiger, weil im Rahmen marktwirtschaftlich-nationaler Politikalternativen verbleibender politischer Überzeugungen abzuleiten pflegen; dieses Dogma setzt er unmittelbar gleich mit seiner Einsicht in die Gleichberechtigung aller theoretischen Konstruktionen, die sich an seine Vorschrift halten, nur vorläufig gelten zu wollen, also ihre eigene Unverbindlichkeit behaupten. Habermas geht von der gleichen Verklärung demokratischer Herrschaft zu einem immerwährenden Verständigungsprozess aus und interpretiert diese Idee als Abglanz seines eigenen epochalen Einfalls, die Sache mit dem unabschließbaren Diskussionsprozess zum Prinzip und Telos von ‚Gesellschaft‘ überhaupt zu verabsolutieren – fundamentaler geht’s wirklich nicht. Was andererseits allerdings die Vermutung nahe legt, dem Mann könnte die apologetische Lebenslüge der demokratischen Staatsgewalt – die Rechtfertigung von Herrschaft durch das Verfahren organisierter Zustimmung des beherrschten Volkes: das wird nicht nur nach allen Regeln der marktwirtschaftlichen Kunst benutzt oder auch nicht, sondern außerdem für die Ermächtigung der konkurrierenden Machthaber in Anspruch genommen, und diese Vereinnahmung wird als öffentlicher Meinungsbildungsprozess inszeniert – ein wenig zu Kopf gestiegen sein: Keiner hat so unerbittlich wie er die billigste demokratieidealistische Sozialkundeweisheit zur transzendentalphilosophischen „Erkenntnis-als-Gesellschaftstheorie“ ausgearbeitet.
Dieses Verdienst ist es freilich nicht allein, was Habermas zum bundesdeutschen Nationalphilosophen gemacht hat. Dazu gehört schon auch, dass ihm im Zusammenhang mit der einstigen studentischen Protestbewegung ein hoher Bekanntheitsgrad und der Ruf eines kongenialen Epigonen der für fundamentale Gesellschaftskritik hochberühmten „Frankfurter Schule der Sozialwissenschaften“ zugewachsen ist. Dazu gehört andererseits, dass ihm zu Protestaktionen wie Vorlesungsstörungen das Schimpfwort „Linksfaschismus“ eingefallen ist; dafür hat die politische, akademische und feuilletonistische Rechte ihm ihr eigenes Missverständnis seiner Philosophie als Sumpfblüte des Frankfurter Neo-Marxismus verziehen. Und weil seine Werke zwar kaum jemand, die geistig-moralische Quintessenz aber letztlich jeder Intellektuelle ganz gut verstanden hat, lag – wie man am Ergebnis sieht – seiner Karriere zum Mentor, der die Republik unentwegt an ihr dialogisches Prinzip erinnert, nichts mehr im Weg.
III. Moralkritische Wortmeldungen zum Zeitgeschehen
Habermas, der sich in seinem Denken vornimmt, das Gelingen von Wissenschaft, Gesellschaft und Demokratie ideell zu verantworten, und obendrein noch den praktischen Gang der Welt erfolgreich als – in letzter Instanz zumindest – reale Inszenierung seiner verantwortungsvollen Einbildungen zu deuten versteht, kann mit sich zufrieden sein. Zum einen deswegen, weil er es in seiner Wissenschaft zur anerkannten Autorität gebracht hat: Mit seiner philosophisch abgrundtief durchreflektierten Kombination von Kompliment und Kritik an Wissenschaft, Gesellschaft und Demokratie wissen Fachkollegen viel anzufangen. Zum anderen ist eine solche wissenschaftliche Autorität auch außerhalb ihrer ureigenen Domäne eine Stimme von bleibendem Gewicht
(Die Zeit): Wer als Fachmann in der Frage, wie sich in der demokratischen Lebenswelt was kritisch gedacht gehört, Reputation genießt, dem leiht der intellektuelle Geist auch außerhalb der Universität gerne sein Ohr. Also wird der große Experte fürs ‚Quo vadis?‘ von Menschengattung, Gesellschaft und Demokratie nicht nur um seine Stellungnahme gebeten, wann immer bei großen Ereignissen auch sein gewichtiges Wort die Meinungsbildung des Zeitgeistes abrunden soll: Er sieht sich selbst auch immer wieder zu Wortmeldungen gedrängt. Regelmäßig ist dies dann der Fall, wenn andere schon perfekt für den Schwindel gesorgt haben, der Gang des politischen Zeitgeschehens wäre als – stets problematischer – Vollzug höherwertiger Moralität zu interpretieren: Da gibt es so gut wie kein großes Thema, in das nicht Habermas in der ihm eigenen Reflexionstiefe eingestiegen wäre – um die bürgerliche Menschheit wissen zu lassen, worum der moralische Diskurs eigentlich geht, den sie gerade aufgeregt führt. Freilich nimmt er die Sache auch schon einmal in seine eigenen Hände – und dann erfährt man in seinen unverwechselbaren Worten, um welche genuin moralischen Fragen Politik und alles andere sich in Wahrheit drehen. Zu beidem die folgende kleine Auswahl.
Deutscher Nationalismus: Eine schon sehr verkürzte kollektive Identität
Die als „Historikerstreit“ in die Annalen der deutschen Ideologiegeschichte eingegangene Kontroverse nimmt ihren Ausgangspunkt bei Faschismus-Forschern wie Nolte, Fest, Stürmer u.a., die es nicht mehr aushalten, bei der Befassung mit dem NS-Regime einfach nur immer die Unfassbarkeit des Verbrechens namens ‚Holocaust‘ repetieren zu sollen. Die Freiheit ihrer Wissenschaft und deren Verpflichtung auf Objektivität könne sich keinen polit-moralischen Denkverboten beugen, auch ein Phänomen wie der Völkermord an den Juden sei einer Erklärung zugänglich, und um die machen sie sich dann auf ihre Weise verdient. Hitler habe bei seiner Ausrottung der Juden einen europäischen Bürgerkrieg
gegen die von ihm gesehene bolschewistische Gefahr geführt, sein Krieg wäre eine rein präventive Reaktion gewesen, der Völkermord als asiatische Tat
der Bedrohung angemessen, schließlich hätten für Gemetzel dieser Art die Russen das Copyright. Was das Kriegsende betrifft, so wäre der Abwehrkampf gegen die Rote Armee mit allem, was zu ihm nun einmal gehörte, vom Standpunkt einer sich verteidigenden Nation wohl eine durch und durch ehrenwerte Sache gewesen... Nicht wenigen deutschen Patrioten spricht diese späte Rehabilitation des „großdeutschen Befreiungskrieges“ aus der Seele; zum antikommunistischen Grundkonsens der bundesdeutschen Demokratie passt es auch sehr gut, wenn hinter den Nazis eigentlich die Bolschewiken stecken. Andererseits hat die Republik – aus Gründen, die mit historischer Wahrheit ohnehin nichts zu tun haben – auf andere Weise mit ihrer Vergangenheit ihren Frieden gemacht: Als schlichtweg unbegreifliche Missetat ist alles Böse am „3. Reich“, der Völkermord an den Juden in erster Linie, aus der ansonsten gut begreiflichen Nationalgeschichte Deutschlands ausgegrenzt worden; mit der Bekundung von völligem Unverständnis und absolutem Abscheu hat das neue Deutschland seine unanfechtbare sittliche Läuterung bewiesen.
Diese Manier, den Nationalsozialismus aus jedem politischen Zusammenhang mit einer imperialistischen Staatsräson der deutschen Nation herauszuoperieren, findet Habermas in Ordnung; diese Manier sieht er in Gefahr – nicht ganz zu Unrecht bemerkt er gewisse Sympathien der herrschenden Partei für neue, offensivere Töne in der „Vergangenheitsbewältigung“ –; er findet sich herausgefordert, die Kultur der bedingungslosen Absage ans Nazi-Reich zu retten; und er tritt ein in einen Dialog mit den neuen „Regierungshistorikern“, zu dem er herrschaftsfrei ein einziges Urteil beisteuert, das freilich in dem Fall nichts weiter als die Verweigerung eines Diskurses zum Inhalt hat: Hitlers Herrschaft ist erkenntnis- wie gesellschaftstheoretisch als Singularität anzusehen, als schwarzes Loch im Kontinuum der deutschen Geschichte, noch nicht einmal als Irrweg eines im Prinzip wenigstens erklärbaren nationalen Selbstbehauptungsbestrebens; wer überhaupt eine Erklärung versucht, versündigt sich am politischen Ethos der Republik und an den Bedingungen der Möglichkeit einer angemessenen Reflexion auf jenes Unbegreifliche – ein Fall von negativer Hermeneutik offenbar. Ganz gleich, ob kritisch oder, wie bei Nolte & Co, apologetisch gemeint: Wenn Geschichtsbetrachtungen laut werden, die ein bisschen beleuchten könnten, wie Judenmord und Weltkrieg zum Programm eines deutsch-nationalen Erfolgswegs zur Weltmacht passen, die die Nazi-Herrschaft überhaupt als ein Stück deutsche Politik vorstellig machen, dann heißt es weghören, die Ohren zuhalten – dafür liefert der größte lebende Diskurstheoretiker das schlagende Argument, indem er sozialphilosophisch auf einzigartig und wissenschaftskritisch auf jenseits der Erklärbarkeit plädiert. In diesem Verdikt hat dann kein geringerer als der seinerzeitige Bundespräsident dem Frankfurter Philosophen hochoffiziell Recht gegeben; und damit ist der und nicht seine Gegner in der Hierarchie der nationalen Moralautoritäten ein gutes Stück hochgerückt. In dieser Eigenschaft hat Habermas dann gleich wieder in mehr konservativen Kreisen Anstoß erregt, insgesamt aber doch auch viel nachdenkliche Zustimmung gefunden mit seinem Konzept eines demokratiemethodisch garantiert unbedenklichen Nationalgefühls: Die Tugend unbedingter vaterländischer Parteilichkeit verliert den Charakter einer dogmatisch eingeübten
, gegen Kritisierbarkeitsansprüche resistenten Sprachspielgrammatik
, erweist sich vielmehr als kostbare Sinnressource
, wenn man davon ausgeht und daran glaubt, dass der Wertehimmel des Grundgesetzes die wahre und eigentliche nationale Heimat ist. Diese schöne Gesinnung heißt „Verfassungspatriotismus“; und die gehört sich für mündige Bürger
.
Als diskurstheoretisch korrekt kann freilich auch nur eine solche Gesinnung Anerkennung finden; und der Gang der politischen Dinge gibt Habermas schon wenige Jahre später Anlass, daran kritisch mahnend zu erinnern: Das Volk der DDR läuft geschlossen zu dem Staat über, der es sich ideell und staatsbürgerrechtlich schon längst vorher eingemeindet hatte. Die gesamtdeutsche patriotische Aufwallung erfasst auch den Denker; Mitgefühl
, Entzücken
gar, vor allem aber Solidarität mit Landsleuten
[31] verspürt er in sich. Dann aber auch ein gewisses Unbehagen, ob denn die alte Republik, die unter seiner moralischen Oberaufsicht doch so wohl geraten ist, nicht durch unreflektierte nationale „Sprachspiele“ einiges von ihrem betörenden Reiz verlieren könnte. In dem so ganz und gar un-nationalen Republikanismus
des Bonner Staates war sein Ideal eines allein normativ verankerten
Gemeinschaftswesens schon fast verwirklicht – und jetzt feiern Volk und Führer mit einmal nur noch eines: die Nation, die sich so glücklich mit sich selbst vereint hat. Da kann er nicht an sich halten: Bloßen „DM-Nationalismus“, bloß niedere, materielle Beweggründe entdeckt er ausgerechnet in einem gesamtvölkischen Bekenntnis, das Deutschland gilt; als bloßes DM-Imperium
will ihm ausgerechnet die Annexion eines kompletten Staates erscheinen, weil sie über den Export westdeutscher Geldmacht vollzogen wird – und eben nicht über eine Große Verfassungsgebende Versammlung zum Schmieden eines neuen gesamtdeutschen Wertehimmels, an der er hätte konstruktiv mitwirken können. Mit seinen Einlassungen macht er sich etwas unbeliebt, der deutsche Zeitgeist lässt sich die Feier der Nation nicht vermiesen. Irgendwann aber macht auch Habermas mit dem neuen Deutschland seinen kritischen Frieden, zumal es ja noch manch anderes für ihn zu kritisieren gibt.
Gentechnik: Ein moralischer Abgrund
Dolly, ein geklontes Schaf, erblickt das Licht der Welt. Phantasien darüber, was demnächst wohl noch alles möglich wäre in Sachen Genforschung, machen die Runde, ein anderer großer deutscher Philosoph, P. Sloterdijk, träumt laut Ideen einer künftigen technologischen Optimierung des Menschengeschlechts vor sich hin. Darf der das denken?, heißt die wissenschaftliche Fragestellung des kritischen Philosophen Habermas, und Nein! die kategorische Antwort, die er dann auch noch selbstverständlich begründet. Erstens trifft bei der Manipulation von Chromosomen eine Person
,[32] eine Entscheidung über die ‚natürliche Ausstattung‘ einer anderen Person
, ohne sich vorher deren Zustimmung abgeholt zu haben: Ein glasklarer Verstoß gegen die Grundaxiome der Konsenstheorie. Zweitens stellt ein Eingriff in die Zufallskombination von elterlichen Chromosomensätzen
einen Angriff auf die Selbstbestimmung des Menschen
[33] dar. In Gefahr gerät die ‚Autonomie des Subjekts‘ und seine konsensual-diskursive Identitätsbildung nach dem habermasischen Idealtypus also dort, wo dieses Subjekt noch gar keines ist. Auch wenn ihm die Gedankenfigur fremd ist: Dank Habermas kann sich der Mensch zusätzlich zu allem, was er sonst so tut, auch noch die private Verfügung über den Zufall bei der Weitergabe seiner Chromomensätze als Inbegriff seiner Autonomie und Selbstbestimmung einbilden, wenn er mag.
„Islamistischer Terror“: Tiefen metaphysischer Irritation und ihre noch tiefer ergrübelte Behebbarkeit
Am 11. September 2001 zerlegen Terroristen die zwei Türme des ‚World Trade Centers‘, für sie Symbol der verhassten amerikanischen Weltmacht. Für Habermas ein ganz anderes Symbol:
„Aber am 11. September ist die Spannung zwischen säkularer Gesellschaft und Religion auf ganz andere Weise explodiert. Die zum Selbstmord entschlossenen Mörder (...) waren durch religiöse Überzeugungen motiviert. Für sie verkörperten die Wahrzeichen der globalisierten Moderne den Großen Satan. (...) Als hätte das verblendete Attentat im Innersten der säkularen Gesellschaft eine religiöse Saite in Schwingung versetzt, füllten sich überall die Synagogen, Kirchen und Moscheen.“ (Ebd.)
Letzteres wird wohl wahr sein, und beides, den religiösen Überschwang verblendeter
Attentäter wie der, der sich da in eher unauffälligen Dienern Gottes regt, findet der Philosoph hochinteressant. Das ist exakt das Thema, das er unter dem Stichwort ‚Moderne‘ schon länger in gebotener Tiefe beackert, und da weiß er über die Denkungsart der Attentäter augenblicklich Bescheid. Er weiß nämlich von einem Etwas, das sich in den Heimatländern der Täter (...) infolge einer beschleunigten und radikal entwurzelnden Modernisierung herausgebildet hat
(ebd.). Dieses Etwas ist ein entscheidendes Nichts, nämlich ein Nicht-Stattfinden von dem, was in diesen Heimatländern eigentlich hätte doch auch stattfinden sollen: Entscheidend ist der durch die Gefühle der Erniedrigung blockierte Geisteswandel, der sich politisch in der Trennung von Religion und Staat ausdrückt.
(Ebd.) Das ist Imperialismus und terroristische Gegenwehr philosophisch tief gedacht: Eine ‚Moderne‘ entwurzelt Völker, die sich erniedrigt vorkommen, darüber geistig blockiert sind und sich nicht dazu aufraffen können, so modern zu werden wie die Moderne ist; anstatt die Religion vom Staat zu trennen, wollen sie einen Gottesstaat und verwechseln den Staat, der ihnen das verwehrt, prompt mit dem Satan; das explodiert dann in New York.
Doch auch wenn damit eindeutig feststeht, dass sich diese Entwurzelten zu einer verkehrten kollektiven Identität
entschlossen haben: Dass umgekehrt in Bezug auf diesen problematischen Höchstwert der habermasischen Moral- und Sozialphilosophie in den säkularisierten Staaten der ‚Moderne‘ alles zum besten bestellt wäre, gilt für den kritischen Philosophen deswegen noch lange nicht. Wie schon ganz zu Anfang bemerkt, kreist sein Denken im Grunde immer nur um die Möglichkeit einer kommunikativ-diskursiv zu verankernden Normativität herum, welch Idealität es den geschätzten autonomen Subjekten nicht nur erlaubte, sich in all ihren gewöhnlichen Drangsalen einer imaginierten höheren Zweckhaftigkeit verpflichtet zu wissen: Ein derart ermittelter Sinn ermöglichte ihnen auch noch, ihn als garantiert selbst gedacht und so als Krönung all ihrer Ratio und Freiheit feiern zu können. Und da erinnert sich der Philosoph, dass er ja auch schon sehr früh erkannt hatte, welche Probleme
moderne Staaten mit der Suche nach dieser ihrer wertgestützten Legitimität
resp. nach jenem Teilsystem
haben, das die Funktion erledigt, die diesbezüglich die Religion einmal vorbildlich erledigt hatte. Jetzt, wo sich mit dem Attentat in New York, Kopftüchern und Aufständen muslimischer Jugendlicher in Frankreich, verbrannten Türken in Deutschland usw. Zeichen für ihn mehren, die irgendwie von einer Vitalität des Religiösen
[34] künden, erkennt er sofort, wie richtig er schon immer gedacht hat. Dass die Moral eines autonomen modernen Bürgers in der Überzeugung ihren festen Sitz hat, in allem, was er zusammen mit allen anderen zu tun und zu lassen hat, einer höheren kollektiven Sinnhaftigkeit verpflichtet zu sein; dass umgekehrt sich derart in praktizierter Sittlichkeit vereint zu wissen der Gesellschaft als Gratisgabe den Zusammenhalt garantiert: Das hat er ja nun wirklich unter dem weiten Kapitel ‚Probleme der Identitätsstiftung’ oft genug wiederholt. Dass eine diskursiv-konsensmäßig herbeigeführte kollektive Normstiftung Risiken
hat, der Bedarf der Gesellschaft nach ihr aber stets grenzenlos ist, gleichfalls. Auch den Kunstgriff, einerseits sein unbedingtes Interesse am Effekt, den er sich von – irgendeinem, Hauptsache verbindlichem
– Sinn wünscht, andererseits die konsens-methodischen Kompliziertheiten, an die er selbst sein Zustandekommen knüpft, gleich als dessen ganze Bestimmung auszudrücken, hat er schon vor 30 Jahren beherrscht und ausgedachten normativen Blödsinn als eine knappe und immer knapper werdende Ressource
[35] gefasst. Hinzu kommt jetzt nur noch der altersgereifte Einfall, dass man sich mit seinen so fundamentalkritischen Sorgen ja der Instanz auch als konstruktiver Tippgeber empfehlen kann, um deren Erfolg man besorgt ist: Keinesfalls, meint der überparteiliche Regierungsphilosoph,
„sollte der demokratische Staat die polyphone Komplexität der öffentlichen Stimmenvielfalt (...) vorschnell reduzieren, weil er nicht wissen kann, ob er die Gesellschaft sonst nicht von knappen Ressourcen der Sinn- und Identitätsstiftung abschneidet. Besonders im Hinblick auf verwundbare Bereiche des sozialen Zusammenlebens verfügen religiöse Traditionen über die Kraft, moralische Intuitionen überzeugend zu artikulieren.“[36]
Sicher: Um eine im vorhinein
ziemlich kritikfest interpretierte Lebenswelt
handelt es sich beim Glauben an Gott, den Allmächtigen, irgendwie schon. Aber das kann man ja zugunsten der wünschenswerten moralischen und darüber gemeinschaftsbildenden Derivate, die so ein Glaube allemal hat, vergessen und Gott als auch so einen Geltungsanspruch
nehmen, der mit allen anderen in Konkurrenz um verbindliche Anerkennung steht. Und weil jedenfalls Habermas das problemlos kann, müssen sich eben auch die demokratischen Bürger den expliziten Gegensatz zu allem Wissen als wertvollen Beitrag ihrer und aller gesellschaftlichen Rationalität
einleuchten lassen und sich
„auf eine Interpretation des Verhältnisses von Glauben und Wissen einlassen, die ihnen ein selbstreflexives und aufgeklärtes Miteinander möglich macht“ (ebd.).
Muss nur noch Gott sein Einverständnis zur Einspeisung seines Geltungsanspruchs in die habermasische Konsensustheorie der Wahrheit geben, und diesbezüglich sieht es nicht schlecht aus: Seinen Stellvertreter hat er schon mal zum Dialog mit Habermas vorgeschickt, und das Gespräch war, was man so hört, absolut herrschaftsfrei.
Die imperialistische Welt: Normative Identität, auch noch supranational gedacht
Kurz gesagt passt die Welt dem Philosophen höchst selten, nämlich nur dann, wenn jemand mal hergeht und die Verwirklichung der Ideale des Menschengeschlechts praktisch in die eigene Hand nimmt. Der Krieg der Nato gegen Jugoslawien und der von Bush sr. gegen Saddams Irak zum Beispiel, die haben dem Philosophen gefallen, die haben das Menschenrecht
befördert und den Fortschritt der Zivilgesellschaft
. Nationen rechtfertigen ihre Kriege, Habermas applaudiert ihnen, weil er den Fortschritt begrüßt, den der Weltenlauf in seiner normativen Idealität hinzulegen verspricht: Da sind Menschenfreunde unter sich. Doch so eine Art konsensgestützte Weltinnenpolitik
gibt es für ihn viel zu selten. Der Krieg von Bush jr. zum Beispiel war ein typischer Rückfall hinter alle völkerrechtlichen Innovationen
, die im alten Europa, der Wiege aller humanen Idealitäten, verwahrt werden. Doch nicht einmal Europa kriegt hin, wofür es da ist, was vor allem deswegen zum normativen Himmel schreit, weil die ganze Welt darauf wartet, von Europa zu ihrem Besseren geführt zu werden:
„Die Probleme des Klimawandels, des extremen Wohlstandsgefälles und der Weltwirtschaftsordnung, der Verletzung elementarer Menschenrechte, des Kampfes um knappe Energieressourcen, betreffen alle gleichermaßen. Während alle von allen immer abhängiger werden, beobachten wir auf der weltpolitischen Bühne die Verbreitung von ABC-Waffen und eine sozialdarwinistische Enthemmung der Gewaltpotenziale. Müsste nicht ein handlungsfähiges Europa im eigenen Interesse sein Gewicht für eine völkerrechtliche und politische Zähmung der internationalen Gemeinschaft in die Waagschale werfen?“[37]
Die Weltmacht Europa – das wäre er endlich, der Auftakt zur Weltherrschaft des Guten. Denn wenn Europas Nationen anderen vorschreiben, was sie zu tun und zu lassen haben, nehmen sie nur die Verpflichtung zur Domestizierung der Menschheit wahr, die ihnen der Weltgeist auferlegt hat – doch was muss der Philosoph bemerken? Sie drücken sich vor ihrer Pflicht, die deutsche Nation insbesondere:
„Die Berliner Republik vergisst (...) die Lehren, die die alte Bundesrepublik aus der Geschichte gezogen hatte. Die Regierung reckt sich mit Wohlgefallen in ihrem seit 1989/90 erweiterten außenpolitischen Handlungsspielraum und fällt zurück ins bekannte Muster der nationalen Machtspiele zwischen Staaten, die doch längst auf das Format von Duodezfürstentümern geschrumpft sind.“ [38]
Ungenutzt lassen sie die günstige Gelegenheit liegen, das Vakuum aufzufüllen, das Amerika, in der jetzigen Doppelkrise geschwächt
, bei dem bitter nötigen Unterfangen hinterlässt, sich in seinem anmaßenden Selbstverständnis des paternalistischen Weltbeglückers gründlich zu revidieren
und für eine internationale Ordnung
zu sorgen, die keine Supermacht mehr nötig hat.
Anstatt als vereintes Europa die Welt ihrerseits mit der habermasischen Idee vom dezentrierten Universalismus der gleichen Achtung
zu beglücken, sperren sich die Euro-Länder weiter in ihre nationalstaatlichen Käfige
ein und liefern (..) sich als Onkel Sams Pudel an eine ebenso gefährliche wie chaotische Weltlage aus.
Gut, dass da wenigstens einer den Überblick behält und nicht müde wird vor der Gefahr zu warnen, die der Welt ohne eine Weltmacht ‚Vereintes Europa‘ droht.
IV. Die fundamentalkritische Konsensphilosophie und ihre tatsächliche praktische Wahrheit
Es kommt nicht von ungefähr, dass die intellektuelle Elite der bürgerlichen Meinungsbildung den großen Theoretiker der Öffentlichkeit auch als deren wirklichen Vordenker
begreift. Ob überhaupt und wie auch immer sie sich in die Werke des großen Meisters vertieft haben: Deren moralische Quintessenz haben sie jedenfalls erfasst – und begrüßen die tiefe Einsicht, um deren Zementierung der Obermethodologe des Widerspruchs einer ‚subjektiven Wahrheit‘ sich so verdient gemacht hat: Keine Wissenschaft könne pure Objektivität und Neutralität beanspruchen. Vor allem jede soziologische Behauptung von ‚Sachgesetzlichkeit‘ oder ‚Systemlogik‘ unterschlage zivilisatorische Alternativen und führe zu inhumaner Technokratie.
[39] Da hat einer erfasst, was Herrschaftsfreiheit im Diskurs auch noch heißt: Wer im Endlosprozess der wissenschaftlichen Wahrheitsfindung ein definitives Urteil worüber auch immer wagt, vergeht sich an der Freiheit der Diskutanten und übt – Gewalt aus! ‚Stalin!‘ fällt tendenziell einem bürgerlichen Kopf zu einem ein, der der Auffassung ist, dass so, wie er es denkt, die Sache auch ist – obwohl er gar keinen Geltungsanspruch
, sondern bloß den – allemal kritisierbaren! – Anspruch auf Richtigkeit seines Urteils angemeldet hat. Zumindest ist bei so einem der Verdacht angebracht, er habe einen Anschlag auf den Fortschritt aller Zivilisation und Humanität im Auge, denn wozu es die menschliche Ratio in ihrer Hybris nur bringt, weiß man seit Adornos ‚Dialektik der Aufklärung‘ ja: Auschwitz, GULAG, Technik und Wissenschaft als ‚Ideologie‘... Damit will der Mann selbstverständlich nicht einem Kritikverbot das Wort reden, sondern nur festgestellt haben, wie allein Demokratie und Kritik zusammenpassen:
„Jede Erkenntnis, die sich selbst verantwortet, sei emanzipatorischen Zielen verpflichtet. Emphatischer kann eine Kritik, die alle Wissenschaft auf das Forum der Menschheitsinteressen hebt, kaum sein. Vielleicht zeigt sich hier die besondere Größe von Habermas am deutlichsten. Denn Größe und Redlichkeit gehörte dazu, diese Fundamentalkritik in der Sache und im Ton zu dämpfen, ohne ihren Impetus zu verraten.“ (Ebd.)
Verantwortlich also hat Erkenntnis sich selbst zu sein, und das ist sie dann, wenn sie alle im demokratischen Wertehimmel verankerten Idealitäten, mit denen sich der bürgerliche Kopf sein banales Leben im Kapitalismus als Vollzug einer höheren Bestimmung von Menschentum zurechtlegen kann, auch als ihren ideellen Fixpunkt nimmt, von dem aus sie die Welt bedenkt. Die ist dann Gegenstand einer Kritik, in der nichts kritisiert, weil stattdessen nur die idealistische Verlogenheit gnadenlos exekutiert wird, die demokratische Wirklichkeit sei als Verwirklichungen höherer – zivilisatorischer
, emanzipatorischer
, jedenfalls: – Menschheitsinteressen
zu begreifen. Freilich darf man an der nicht ausbleibenden Entdeckung, dass sie dies einfach nicht ist, nicht irrewerden: Zu einem irgendwie ernst zu nehmenden Vorwurf an die Adresse der Wirklichkeit darf sie nicht geraten. Diese Sorte Fundamentalkritik
hat schon zu bleiben, was sie ihrer Logik nach ist, nämlich die ideelle Begleitung der schnöden Welt von Geschäft und Gewalt in Form des Ausmalens von lauter höheren Wertigkeiten und mit der Botschaft, dass es letztlich und eigentlich im wirklichen Leben um die ginge. Sich da in der Sache und im Ton
zurückgenommen und so gegen mögliche Missinterpretationen dieses kritischen Impetus
Vorkehrungen getroffen, der eigenen idealisierenden Geschwätzigkeit also immer die Versicherung nachgereicht zu haben, beim Denken an ihre ideale Lichtgestalt geistig wirklich nur das Gelingen der wirklichen Demokratie zu verantworten: Das macht nicht nur die Größe von Habermas
. So wie der als affirmativer Radikaldemokrat
, besonnener Alarmist
und pessimistischer Optimist des Fortschritts
(ebd.) herumzudenken: Gemäß dem Selbstverständnis moderner Intellektueller ist das der Inbegriff ihrer eigenen kritischen Vernunft. Man darf die Demokratie kritisieren – und der Umstand, dass man es darf, macht sie über jede Kritik erhaben. Also nimmt man sich seine kritische Freiheit heraus, die Demokratie immer wieder einmal an ihren sittlichen Kodex und mit dem daran zu erinnern, dass manches in ihr schon noch schöner zu haben sein könnte; bei drohenden Fehlentwicklungen hebt man den Zeigefinger und formuliert besonnen den Antrag an die Regierenden, sie möchten doch bitte besser ihres Amtes walten; und man gefällt sich überhaupt in der Pose, auf Basis des grundsätzlichen Vertrauens in die, die für die Lebenswelt
und ihren Fortschritt nun einmal zuständig sind, sich stets doch auch das Recht zu reservieren, etwas weniger zuversichtlich in das Gelingen ihrer Werke sein zu dürfen: Affirmation in der Sache, notorisch distanziert in der Form – das ist es, was Intellektuelle als ‚Kritik‘ verstehen und praktizieren.
Dass Wissen und Kritik dermaßen auf den Hund gekommen ist: Das kann sich Habermas sicher nicht als sein exklusives Verdienst anrechnen. Wahr ist, dass er sich mit seinen verkehrten Gedanken ein Leben lang um nichts anderes verdient gemacht hat. Insofern ist er mit seiner falschen Theorie über die bürgerliche Öffentlichkeit und ihre Diskurskultur in der Tat ihr goldrichtiger Vordenker.
[1] Technik und Wissenschaft als ‚Ideologie’, Frankfurt a.M. 1969, S. 89
[2] Erkenntnis und Interesse, in: Technik..., S. 157
[3] Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie?, in: Habermas, J., Luhmann, N., Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie?, Frankfurt a. M. 1974, S. 170
[4] Erkenntnis und Interesse, in: Technik..., S. 160
[5] Erkenntnis und Interesse, Frankfurt a.M. 1968, S. 261
[6] Zur Logik der Sozialwissenschaften, Frankfurt a.M. 1982, S. 203 f
[7] Erkenntnis und Interesse, Frankfurt a.M. 1968, S. 223
[8] Zur Logik..., S. 204
[9] Wahrheitstheorien, in: Fahrenbach, Hrsg., Wirklichkeit und Reflexion, Pfullingen 1973, S. 211 f.
[10] Der Universalitätsanspruch der Hermeneutik, in: Hermeneutik und Ideologiekritik, Frankfurt 1971, S. 156 f.
[11] Vorbereitende Bemerkungen zu einer Theorie der kommunikativen Kompetenz, in: Habermas, J., Luhmann, N., Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie?, Frankfurt a.M. 1974, S. 135
[12] Zur Logik..., S. 185
[13] Theorie und Praxis, Frankfurt a.M. 1963, S. 309
[14] Zur Logik..., S. 199
[15] N. Luhmann, Moderne Systemtheorie als Form gesamtgesellschaftlicher Analyse, in: Habermas/Luhmann, S. 11
[16] Ders., Soziologische Aufklärung, Köln und Opladen 1970, S. 233
[17] Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie? Eine Auseinandersetzung mit Niklas Luhmann, in: Habermas/Luhmann, S. 270
[18] N. Luhmann, Systemtheoretische Argumentationen, in: Habermas/Luhmann, S. 401
[19] Zur Rekonstruktion..., S. 9
[20] Theorie und Praxis, S. 244
[21] Da stellt sich dann beispielsweise heraus, dass Marx, der sich recht unhöflich von der Philosophie verabschiedet und in übertriebenem Optimismus sogar gemeint hatte, das Entstehen der modernen Wissenschaft würde ihr endlich den Garaus machen, sich eigentlich um ihre Fortentwicklung verdient gemacht hat – durch Verknüpfungskunstwerke, die – schon im 19. Jahrhundert! – fast das Format eines Habermas erreichen: In seiner Kritik versöhnt Marx den durch Hegel aufgehobenen Vico mit Kant.
(Theorie und Praxis, S. 275) Mit diesen „Synthesen“ wird nicht nur Marx bedacht. Keine der von Habermas aufgegriffenen Größen der Geistesgeschichte ist davor sicher, sich in einer Synopse ungefähr folgender Machart wiederzufinden, die durch jeden Kommentar ihre Schönheit nur verlieren würde: Cassirer hat Humboldt mit den Augen eines durch Hamann nicht abgestoßenen, sondern aufgeklärten Kant gelesen.
[22] Erkenntnis und Interesse, S. 62
[23] Zur Rekonstruktion. S. 223
[24] Theorie des kommunikativen Handelns, Bd. II, Frankfurt 1981, S. 548
[25] Zur Rekonstruktion ..., S. 92
[26] Theorie des kommunikativen Handelns, Bd. I, S. 107
[27] Faktizität und Geltung, Frankfurt a.M. 1992, S. 44
[28] Zur Rekonstruktion..., S. 107
[29] Technik und Wissenschaft..., S. 119
[30] Legitimationsprobleme des bürgerlichen Staates, in: Kultur und Kritik, Frankfurt a.M. 1973, S. 12
[31] Vgl. FAZ, 24. 6. 2009
[32] Die Zukunft der menschlichen Natur, Franfurt a.M., 2001, S. 30
[33] Aus: Dankrede für den Friedenspreis des deutschen Buchhandels, SZ, 15.10.2001
[34] Die Dialektik der Säkularisierung, in: Blätter für deutsche und internationale Politik 4/2008, S. 34
[35] Legitimationsprobleme im Spätkapitalismus, S. 104
[36] Die Dialektik der Säkularisierung, S. 46
[37] ‚Ein Lob den Iren‘, SZ, 17.6.08
[38] Nach dem Bankrott, Die Zeit, 6.11.08. Die folgenden Zitate ebd.
[39] A. Zielcke, SZ, 18.6.2009