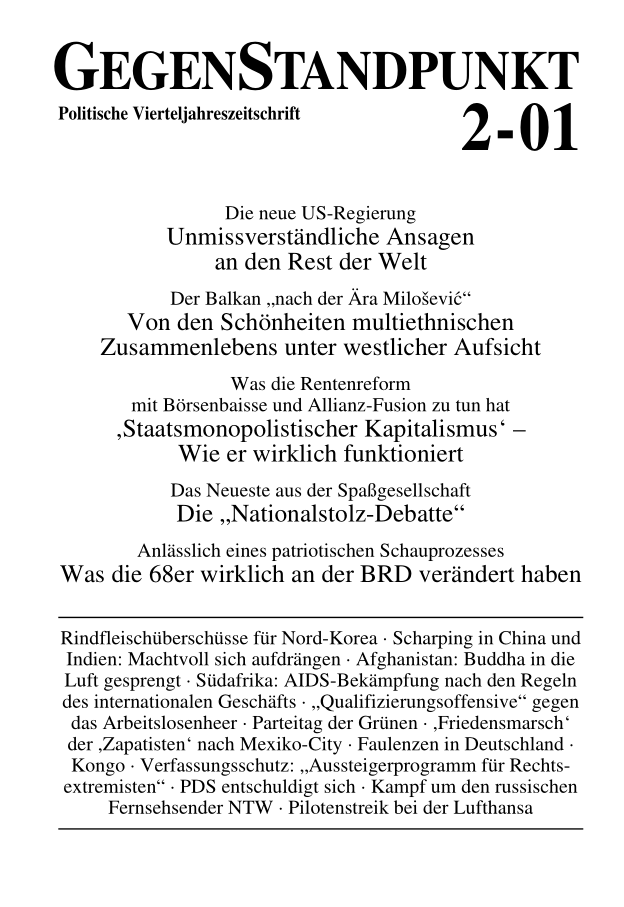Aus der Reihe „Chronik - kein Kommentar!“
Kopfjäger auf Borneo: Ein Zeugnis für den Zustand der indonesischen Staatsmacht
Der indonesische Präsident Suharto entwickelte mittels Kredit von außen und viel Gewalt im Innern, aktuell gegen Ureinwohner auf Borneo, sein Inselreich zu einem „emerging market“. Die Krise lässt eine Staatsgewalt zurück, der mit dem Kredit ihre ökonomische Grundlage und mit dem Wechsel der Herrschaft das Gewaltmonopol über das Territorium entzogen ist. Das imperialistische Lager verlangt die Wiederherstellung einer wieder benützbaren Ordnung ohne die Zusage finanzieller Unterstützung.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Kopfjäger auf Borneo: Ein Zeugnis für den Zustand der indonesischen Staatsmacht
Mitte Februar schaffen Kalimantan und seine
Naturvölker
den Sprung vom Reiseteil der Zeitungen
auf die Politikseite: In diesem indonesischen Teil
Borneos findet ein barbarisches
Gemetzel statt.
Veranstaltet wird es von den Dayak, den Ureinwohnern der
Insel. Mit „traditionellen Waffen“ wie
Macheten, Speeren und Buschmessern machen sie Jagd auf
Maduresen, Zugewanderte von der Halbinsel Madura. An die
500 Tote, Zehntausende von Flüchtlingen – das ist die
Bilanz nach knapp zwei Wochen Kopfjagd, einem Brauch,
der längst als ausgestorben galt
(SZ, 28.2.). Der westliche Zeitungsleser
und Fernsehzuschauer erfährt nicht nur das Motiv
der Täter – mit der Wiederbelebung ihrer steinzeitlichen
Rituale wollen die Dayak die Einwanderer, die sie für die
Zerstörung ihrer Lebensgrundlagen verantwortlich machen,
aus Kalimantan vertreiben; auch über den historischen
Hintergrund des Schlachtens wird er nicht im
Unklaren gelassen – Suhartos Kolonisierungspolitik ist
die Ursache des Dramas, das sich gegenwärtig in
Kalimantan abspielt
(SZ,
27.2.); und die Einordnung der Fakten
wird ihm auch noch frei Haus geliefert: Die Massaker
in Borneo, so zynisch es klingen mag, sind nur eine
weitere Facette, ein weiteres Indiz für den Gesamtzustand
eines Landes, das alles bietet – nur keine einfachen
Antworten.
(Tagesthemen,
26.2.01) Entsprechend komplex fällt dann die
zusammenfassende Diagnose aus: Niedergang aller
Ordnung im Vielvölkerstaat
(Die
Welt, 28.2.). „Vielvölkerstaat“ – das
kann ja nicht gutgehen; schon gar nicht da
hinten, wo die vielen Völker sich auch noch auf zahllose
Inseln verteilen und überhaupt nichts „einfach“ ist…
Ist aber jahrzehntelang gut gegangen; jedenfalls gut genug für die westliche Welt mit ihren strategischen und kommerziellen Interessen an der Inselwelt zwischen Asien und Australien. Doch vielleicht war ja die Freude an dem entwicklungspolitischen Musterfall Indonesien, das wegen seiner ökonomischen „Dynamik“ zeitweise sogar als ein möglicher Konkurrent für die deutsche Wirtschaft gelobt wurde, schon genau so zynisch wie der jetzige Nachruf auf ein Projekt, dem man im Nachhinein von vornherein sein Scheitern hätte voraussagen können.
Tatsächlich handelt es sich bei den Unruhen in Kalimantan – ebenso wie bei dem militanten Separatismus in anderen Provinzen, den blutigen Gemetzeln zwischen Religionsgruppen, der latenten und bisweilen akuten Bürgerkriegssituation in den entwickelten Zentren des Landes – um das sachgerechte Ende eines nationalen Erschließungsprogramms, das im Falle Borneos mittels Bevölkerungspolitik vorangetrieben worden ist.
1. Das Vorhaben war groß und anspruchsvoll: aus der Erbmasse der niederländischen Kolonialherrschaft eine moderne Nation zu „entwickeln“ – mit einer Staatsgewalt, die ganz souverän die Inselwelt effektiv durchorganisiert, und mit Einwohnern, die ungeachtet ihrer vielvölkischen Herkunft und ihrer einstweilen noch primitiven Lebensverhältnisse als Volk von nützlichen Staatsbürgern funktionieren. Dem Ehrgeiz des eigentlichen Staatsgründers Sukarno, dieses Projekt aus eigener Kraft zu verwirklichen und seine Fortschritte nicht gleich wieder den Interessen der imperialistischen Mächte und ihrer Kalten Krieger auszuliefern, wird zwar mit dem Sieg von General Suharto über Sukarnos „Sozialismus à la Indonesia“, verbunden mit der Abschlachtung der großen Kommunistischen Partei des Landes, das Genick gebrochen. Das Programm, aus den vielen Inseln einen Staat und aus den vielen Volksgruppen ein Staatsvolk zu machen, wird aber neu aufgelegt: Mit Hilfe der Freien Welt, die schon beim Putsch gegen die „kommunistische Gefahr“ so tatkräftig geholfen hat, soll schon so etwas wie ein wohlorganisiertes nationales Umfeld für flächendeckende kapitalistische Wirtschaftstätigkeit und eine respektable Regionalmacht entstehen. Dafür müssen allerdings große Teile des Landes dem Zugriff der zentralen Ordnungsgewalt überhaupt erst einmal unterworfen werden. Speziell der größere indonesische Teil Borneos, mit seinen 539000 Quadratkilometern ein Drittel des Staatsgebiets, ist zunächst noch „unberührte Wildnis“, was nunmehr so viel bedeutet wie: eine einzige brachliegende Ressource, die als Machtbasis territorial gesichert und einer staatsnützlichen Verwendung zugänglich gemacht werden muss. Dessen Bewohner haben von einer nationalen Regierung in Jakarta noch nie gehört, geschweige denn eine Vorstellung davon, dass sie jetzt der gehören und auf sie hören sollen; sie befinden sich in jenem Stand einer bloßen „Urbevölkerung“, der so viel bedeutet wie: ein vom kolonialistischen Zugriffsinteresse für politökonomische Verwendungszwecke für untauglich befundenes Menschenmaterial, das auch nicht unbedingt „zivilisiert“ werden muss – Menschen hat die indonesische Regierung mehr als genug unter ihrer Fuchtel.
2. Das Mittel, um die koloniale Erbmasse
seiner politischen und ökonomischen Verfügungsgewalt zu
unterstellen, findet Suharto in den überbevölkerten
Herrschaftszentren Java und Madura. Mit dem Auftrag, die
Außeninsel für die Berechnungen der Zentralmacht urbar zu
machen, werden im Rahmen des weltgrößten
Umsiedlungsprogramms Transmigrasi
Hunderttausende
von Maduresen nach Borneo verschifft – insgesamt sind es
650000 Familien, die von den Zentralinseln in Gegenden
mit sehr geringer Bevölkerung umgesiedelt werden. Dort
sind die Maduresen – ob sie es wollen oder nicht – als
Agenten Jakartas unterwegs: Ihrer Mission entsprechend
ausgestattet, rücken sie als aggressive
Pioniersiedler, Soldaten und Bauern in einer Person
an, siedelten entlang der Flüsse in die Regenwälder
hinein, schufen Infrastruktur, rodeten große Flächen
(FTD, 5.3.) und stellen somit
die elementaren Voraussetzungen für eine
kapitalistische Verfügung über Land und Leute
her.
3. Eine gewalttätige Angelegenheit ist
diese Massenansiedlung ausgewählter
„Entwicklungs“-Pioniere schon deswegen, weil die Siedler
eben nicht auf menschenleere Gebiete stoßen, sondern auf
Ureinwohner, die der politischen Vermarktung der Insel im
Weg stehen. Die Dayak sind ein einziges Hindernis für die
produktive Ausnutzung der Naturbedingungen, weil für ihre
primitive landwirtschaftliche Produktionsweise stets
neues Land unerlässlich ist – sie leben vom Fischfang und
davon, dass sie im Regenwald kleine Flächen roden, ein,
zwei Ernten einfahren und weiterziehen, wenn der Boden
ausgelaugt ist. Und aus diesen steinzeitlichen
Lebensverhältnissen will man sie auch gar nicht
herausholen – überflüssige Kosten wären das für das
staatliche Aufbauprogramm. Als dessen Erfüllungsgehilfen
sind eben die Leute aus Madura vorgesehen. Denen werden
Land und Holzkonzessionen zugeteilt; die Dayak werden aus
ihren gewohnheitsmäßig genutzten Lebensräumen vertrieben.
Und mit der fortschreitenden Verwandlung der
„unberührten“ Natur in Rohstoffabbaugebiete und
agrarische Anbauflächen durch exportorientierte
Holzhändler, Plantagenbesitzer und Minenbetreiber
kommt auch die Zerstörung dieser Lebensräume voran, ohne
dass für die Ureinwohner irgendwelche Alternativen
geschaffen würden. Der Bedarf an Verwaltungspersonal und
billigen Wald-, Plantagen- oder Minenarbeitern ist durch
die eingewanderten Maduresen abgedeckt; die Dayak bleiben
unberührt (!) von modernen Wirtschaftsformen
(SZ, 27.2.) und müssen
zusehen, wo sie in den verbleibenden
Naturreservaten
noch was zu fressen finden. Dass
eine solche Scheidung der Inselbewohner in unbrauchbare
und brauchbare Bevölkerungsteile einen bleibenden
Ordnungsauftrag darstellt, also andauernd Gewalt braucht,
versteht sich von selbst: Auf Borneo blieben die Dayak
auf der Strecke: Ohne Landrechte ihrer Existenzgrundlage
beraubt, ohne Bildungsmöglichkeiten an den äußersten Rand
der Gesellschaft geschoben und mit brutaler Gewalt vom
Militär in Schach gehalten.
(FTD, 5.3.)
4. Das Ergebnis des Aufbauprojekts ist
die Umformung der Außeninseln in ein kapitalistisches
Rohstofflager, aus dem die westlichen Industrienationen
pünktlich und zu Preisen beliefert werden, die den
Konjunkturen ihres Geschäftsganges entsprechen. Dem
indonesischen Staat bringen sie Devisen ein, die er für
den Aufbau seiner „Neuen Ordnung“ dringend braucht – ein
positiver Posten im Haushalt eines Schuldnerlandes, das
für seine „Entwicklung“ auf auswärtige „Hilfe“ in Form
von Krediten und den Zustrom internationalen Kapitals
setzt. So werden durch eine innere
Kolonisierung, die ausschließlich durch einen
flächendeckend präsenten Militärapparat zu sichern ist,
Devisenquellen erobert. Großräumige Verwüstung von Land
und Vertreibung von Leuten auf den äußeren Inseln,
Errichtung industrieller Enklaven durch Import
auswärtigen Kapitals und Stiftung inländischer Firmen auf
der Hauptinsel: Diese Sorte Standortpolitik funktioniert
30 Jahre lang reibungslos – Jede Form von Protest und
Konflikt wurde im Keim erstickt
–, so dass alle Welt
sicher ist, dass Suharto über ein harmonisches
Inselreich herrschte
(taz,
2.3.). So mancher Großkonzern entdeckt in dieser
„Harmonie“ eine passable Anlagebedingung für das eine
oder andere Geschäft. Auch das internationale
Finanzkapital lässt sich überzeugen und macht in den
letzten Jahren der Suharto-Ära aus Indonesien einen
„emerging market“, auf dessen Wachstumschancen es kräftig
spekuliert. Die Regierung sorgt für das nötige
Investitionsklima, indem sie politische Stabilität
garantiert. Ein Entwicklungsland, das Hunger und Armut
fest im Griff hat, hat und bekommt Kredit.
5. Das sachgerechte Ende des „Wirtschaftswunders“ kommt mit der Asienkrise. Das „Wirtschaftswunder“ wird von denselben beendet, die es zuvor gestiftet haben. Die Finanzwelt hat den schönen Zirkel in Gang gesetzt: Spekulative Finanzinvestitionen steigern die auswärtigen Ansprüche an Indonesien als unendlich viel versprechende Geldquelle, zusätzlich zu den Ansprüchen des Staates, der in seinem Bemühen um die Inszenierung eines umfassenden kapitalistischen Geschäftslebens im Land auf dessen noch gar nicht erwirtschaftete Erträge zugreift; zugleich erhalten dieselben Zuflüsse von Finanzmitteln den Schein nationaler Zahlungsfähigkeit aufrecht, der zu immer neuen „Investments“ ermuntert und dadurch wiederum die Ertragsansprüche an den „emerging market“ über jedes Maß hinaus steigert. Dieselbe Finanzwelt findet nun in eben diesem Zirkel lauter Gründe, ihrer eigenen Spekulationsblase zu misstrauen, macht selbstverständlich nicht sich für ihre spekulative Überakkumulation haltloser Kredittitel, sondern Indonesien für ihre „enttäuschten Erwartungen“ haftbar, stuft das Land als krisenanfälligen Investitionsstandort ein und entzieht ihm den Kredit, auf dem sein ganzer Fortschritt als Rohstoffbasis und Spekulationsobjekt für auswärtige Interessen beruhte. Die Krise, in die das Land so schlagartig wie sachgerecht „stürzt“, vollzieht den nationalen Aufstieg quasi im Schnelldurchlauf rückwärts: Der Schein, die Rupiah besäße einen soliden Wert als kapitalistisches Geschäftsmittel, löst sich in allgemeines Missfallen auf; die Banken, die die nationale Währung als ihr Geschäftsmittel verwenden, gehen kaputt; Tausende Unternehmen sind mit der Annullierung ihres Geschäftsmittels konfrontiert und machen pleite. IWF-Auflagen und Regierungsbeschlüsse zur Überwindung der Krise, also für einen von außen per Kredit neu angestoßenen Wiederaufbau eines nationalen Geldwesens und eines damit reanimierten kapitalistischen Geschäftslebens im Lande, definieren erst einmal ganz praktisch das Ausmaß der Lahmlegung der indonesischen Ökonomie.
Das Volk, flächendeckend verelendet, reagiert – sehr praktisch für die Obrigkeit, die sich um diese Zielrichtung der allgemeinen Unzufriedenheit angeblich auch mit Nachdruck gekümmert hat – zunächst mit internem Zwist und Pogromen gegen Nachbarn, an deren chinesischer oder andersgläubiger Menschennatur es den Ausbeuter und Krisengewinnler entlarvt. Dann lässt es sich aber auch dazu bewegen, verzweifelte Hoffnungen auf eine vom Ausland gewünschte Auswechslung der regierenden Figuren nach dem Vorbild demokratischer Wahlverfahren zu setzen. Es sorgt für Abwechslung in den höchsten Staatsämtern, was zwar seine Lage nicht bessert, seine Unzufriedenheit aber wenigstens teil- und zeitweise auf eben die wunderbare „Lösung“ festnagelt, in der jeweils angesagten Auswechslungsaktion heftig Partei zu ergreifen.
6. Was übrig bleibt, das ist eine Staatsgewalt, der die Grundlage ihrer alten Ordnung entzogen ist: Im Zuge ihrer „Sanierungs“-Anstrengungen bricht ihr ihr ökonomisches Fundament weg, und zugleich entgleitet ihr im Zuge ihrer demokratieförmigen Personalwechsel die flächendeckende, Parteien und Völkerschaften übergreifende Kontrolle über ihr Land. Alle inneren Zwistigkeiten leben heftig auf, nachdem die Suharto-Diktatur weg ist und die Protagonisten kämpferischer Unzufriedenheit sich per Demokratie ins Recht gesetzt finden. Das Militär geht – selektiv – dagegen vor, vor allem gegen hochverräterische Abspaltungsversuche, wird aber im Fall Osttimor durch auswärtige Intervention und einen erpressbaren Präsidenten nachdrücklich ins Unrecht gesetzt[1] und findet seither in der formellen Staatsspitze überhaupt keinen entschiedenen Auftraggeber für staatsdienliche Gewaltaktionen mehr, macht aber auch umgekehrt nicht den Übergang, die Staatsspitze selber zu übernehmen. Die amtierende Führung hat sich voll den Standpunkt zu eigen gemacht, den die Krise des Landes sowie vor allem das von auswärtigen Ratgebern empfohlene „Sanierungs“-Programm ihr ohnehin vorgeben: Indonesiens Zukunft liegt fürs Erste darin, sich politökonomisch auf das – überaus geringe – Maß des weltwirtschaftlich Brauchbaren „gesund-“, also als Nation in Grund und Boden zu schrumpfen. Für irgendeinen politischen Ehrgeiz, aus den vielen Inseln eine durchorganisierte Macht und einen funktionstüchtigen Kapitalstandort zu machen und aus dessen diversen Bewohnern ein nützliches Staatsvolk, bleibt da schlechterdings kein Raum. Die neuen Chefs der Nation personifizieren diesen „gesundgeschrumpften“ politischen Willen, ihr Land im Sinne des brutalen Untauglichkeitsurteils der imperialistischen Welt durchzusortieren. Statt mit (Wieder-)Aufbauplänen schlagen sie sich mit puren Selbstbehauptungs- und elementaren Ordnungsproblemen herum, von denen sie bald so viele wie Inseln haben.
7. Ein staatliches Notstandsprogramm ist
daher auch alles, wozu sich die Zentrale im Falle Borneo
entschließt: Dem Schlachtfest der Dayak schauten
Polizei und Soldaten zehn Tage lang tatenlos zu. (…) Als
Indonesiens Militär nach zehn Tagen mit 3000 Mann
Verstärkung endlich in den Konflikt eingriff, beendeten
die Soldaten nicht etwa das Blutbad; sie halfen bei der
ethnischen Säuberung, verluden die Flüchtlinge auf
Schiffe und ließen die Dayak ihren Amoklauf
fortsetzen.
(FTD, 5.3.)
Die Reaktion ist kennzeichnend. Sie ist von gleicher Art
wie der Umgang mit den Separatisten auf Aceh: Denen
bietet Jakarta weitgehende Autonomie und einen höheren
Anteil an den Erlösen des Öl- und Gasexports an – die
bisher zum größten Teil in die Regierungskasse flossen –,
wenn sie im Gegenzug ihre Unabhängigkeitsbestrebungen
aufgeben. Im ersten Fall holt die Staatsmacht ihre
aggressiven Pioniersiedler
aus der Schusslinie –
was übrigens mit „ethnischer Säuberung“ nur in dem Sinn
etwas zu tun hat, dass hier ein empörter Berichterstatter
zum aktuell schlimmsten Schlagwort für politische
Gewaltverbrechen gegriffen hat –; im zweiten Fall
überlässt sie den Rebellen die lokalen Pfründe. In beiden
Fällen ringt die Zentralmacht mit für ein Gewaltmonopol
ungewöhnlichen Zugeständnissen um den nurmehr pur
formellen Erhalt der nationalen Einheit. So dokumentiert
ihre Reaktion das definitive Ende dessen, was mal
indonesische Staatsräson war – und den Beginn einer
Karriere als Staatsgebilde, das seine in Verfall
begriffenen Gewaltmittel statt für das Programm
nurmehr für funktionelle Restbestände und einen
halbwegs glaubwürdigen Schein einer integren
nationalen Macht mobilisiert.
8. Der imperialistische Standpunkt ist
eindeutig: Nicht einmal für die Einrichtung einer
anständigen nationalen Konkursverwaltung kann Indonesien
auf tatkräftigen Beistand von außen setzen. Das Land
hat keinen Kredit – weder im prinzipiellen
politischen noch im kommerziellen Sinn. Was es geliehen
bekommt oder bekommen soll – konkret: die nächste Rate
eines IWF-Hilfspakets über 5 Milliarden Dollar –, steht
unter der Bedingung, dass die politischen Verhältnisse
einen sachgerechten und erfolgreichen Einsatz dieser
Summe garantieren müssen. Die andere suprastaatliche
Kreditagentur stellt dieses Bedingungsverhältnis auf mehr
fürsorgliche Art genauso klar: Die Weltbank warnte vor
einem wirtschaftlichen Zusammenbruch Indonesiens, wenn
die Regierung die in den verschiedenen Landesteilen
herrschende Gewalt nicht in den Griff bekommt und für
politische Stabilität sorgt.
(FR, 24.2.) – als ließe sich „politische
Stabilität“ einfach so beschaffen, wenn sie einer
Regierung gerade komplett abhanden kommt; als ließen sich
geordnete Gewaltverhältnisse in allen Landesteilen
herstellen ohne einen landesweiten Gewalteinsatz, zu dem
das demokratisierte Regime schon kaum mehr in der Lage,
aber auch gar nicht bereit ist und schon gleich nicht
durch die Instanzen, die über legitimen und verbotenen
Gewaltgebrauch in der Staatenwelt befinden, ermächtigt
würde; und als stünde im Falle des Scheiterns solcher
Bemühungen der „wirtschaftliche Zusammenbruch“ erst noch
bevor – aber offenbar ist der Ruin des Landes in den
Augen der Weltbank noch durchaus steigerungsfähig. Die
praktische Botschaft ist jedenfalls klar: Erst
muss die indonesische Staatsgewalt intern aufräumen – was
freilich, wie gesagt, ganz gewiss keine Rückkehr zu dem
diktatorischen Staatswillen bedeuten darf, der so etwas
allenfalls bewerkstelligen wollte und könnte; da sind die
Freunde von Demokratie und Menschenrecht vor, die
gleichzeitig im Interesse einer funktionierenden
Marktwirtschaft auf ordentlichen Gewaltverhältnissen
bestehen –; dann allenfalls kommen Maßnahmen
gegen den „wirtschaftlichen Zusammenbruch“ in Frage. Für
die Erledigung dieses Ordnungsauftrags ist mit Krediten
als Ausstattungshilfe nicht zu rechnen; die Vorleistung
hat Indonesien erst einmal ganz sozialfriedlich selbst zu
erbringen.
Was sich an Indonesien weiterhin ausnutzen lässt, ist mit diesem Junktim von eigenverantwortlich hergestellter Ordnung und IWF-Kredit keineswegs abgeschrieben – die Nation als ordentlicher Geschäftspartner aber schon ein gutes Stück weit.
9. Der dazugehörige weltöffentliche
Zynismus gibt sich verständnisvoll: Die tiefe
politische Zerklüftung der Gesellschaft entlang komplexer
religiöser, ethnischer, sozialer und regionaler
Bruchlinien erschwert ein verantwortliches Regieren.
(Die Welt, 12.3.) Deswegen,
so der einhellige Schluss aller demokratischen Experten,
hätten verantwortliche Regenten aber auch besser von
vornherein die Finger von dem Versuch gelassen, unter
Einsatz ihrer Gewalt besagte „Bruchlinien“ aus der Welt
schaffen und die „politische Kluft“ zwischen
maduresischen Siedlern und steinzeitlichen Kopfjägern
zuschütten zu wollen. Was die „verantwortlich
Regierenden“ jahrzehntelang betrieben haben: das brutale
Unternehmen, ihre diversen Untertanen zu einer
wohlsortierten Dienstmannschaft für weltwirtschaftlich
ertragreichen Gebrauch durch kapitalistische
Geschäftsleute herzurichten – wobei ganz neue „soziale“
Frontlinien aufgetan worden sind, auf die sich die Massen
nicht zuletzt nach Maßgabe „ethnischer“ und „regionaler“
Besonderheiten verteilt haben und aus denen dem
„religiösen“ Rechtsbewusstsein in seinen verschiedenen
Spielarten ganz neue Interpretationsaufgaben zugewachsen
sind –, das wird weiter gar keiner näheren,
geschweige denn kritischen Befassung gewürdigt. Wozu
auch. Für eine Absage an den indonesischen
Staatsgründungsversuch reicht völlig die Feststellung,
dass die Regierenden es nicht zu einem Produkt
nach dem Geschmack weltkundiger Standortgutachter
gebracht haben: Dann war es wohl auch verkehrt,
einen solchen Versuch überhaupt zu unternehmen! Über die
Erkenntnis, dass der Niedergang Indonesiens und die
Wiederkehr der Kopfjagd irgendwie gerechte Quittungen für
eine vermessene Aufbruchsambition sind, die nicht gut
gehen konnte, arbeitet man sich zu dem Urteil
vor, dass so etwas wie ein richtiger Staat da
hinten einfach nicht geht. Der Imperialismus
schreibt die (Un-)Kosten zur Aufrechterhaltung der
Herrschaft in solchen Nationen zunehmend ab – und seine
freie Öffentlichkeit weiß sofort, dass für die Menschen,
die das Pech haben, außerhalb der kapitalistischen
Zentren überleben zu müssen, halbwegs zivile
Lebensverhältnisse dann wohl auch nicht drin sind.
[1] Wie der Zerfall Indonesiens mit dem Ruf nach „Demokratisierung“ international betreut wird, kann man schon im GegenStandpunkt 4-99, S.144 nachlesen.