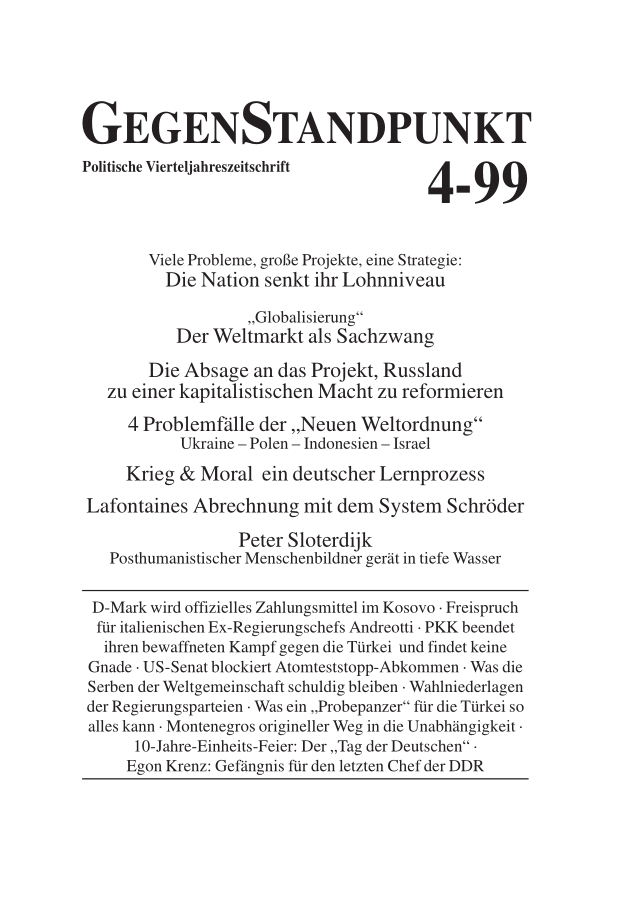Der Fall Indonesien
Die international betreute Demokratisierung eines Krisenlandes und ihre Folgen
In der Vergangenheit war Indonesien mit seiner Militärherrschaft den westlichen Imperialisten recht, vor allem dadurch, dass Suharto die kommunistische Partei mit mehr als 3 Millionen Anhängern zerschlagen hatte: das internationale Finanzkapital behandelte es als „emerging market“. Seitdem das internationale Kapital abgezogen ist, was ökonomischen Zusammenbruch, wachsende Unzufriedenheit bei den Herrschenden und politische Unruhen in der Bevölkerung zur Folge hatte, entdeckt man überall nur ruinöse Vetternwirtschaft. Seitdem kreidet der Imperialismus dem Regime seine Gewalttätigkeit an und empfiehlt Demokratie, damit die vermisste Stabilität wieder hergestellt wird.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Gliederung
Der Fall Indonesien
Die international betreute
Demokratisierung eines Krisenlandes und ihre
Folgen
In Indonesien herrschen unmögliche Zustände: Massenproteste, Aufstände und ihre blutige Niederschlagung sind an der Tagesordnung; systematische Menschenrechtsverletzungen häufen sich; es regieren nach wie vor – siehe Osttimor – Terror und militärische Willkür; auch nach dem Sturz Suhartos geben die Generäle die Macht nicht aus der Hand; der Interims-Präsident ist kaum mehr als eine Marionette; die korrupte Clique der Suharto-Günstlinge ist alles andere als entmachtet; Unruhe im Volk und Einmischung des Militärs begründen Zweifel am demokratischen Charakter der veranstalteten Wahlen, das Ergebnis und seine Anerkennung durch die Militärs, die alten Cliquen und die Straße ist zweifelhaft; und die Massen verfallen zunehmend dem Elend. So ungefähr sah bis vor kurzem nach Auskunft der Öffentlichkeit die Lage aus.
Ein paar Wochen später sind alle voll des Lobes. Der Übergang zur Demokratie kommt voran; der Sieg der Opposition wird erstaunlich friedlich akzeptiert; der unheilvolle Einfluss des Militärs wird mehr und mehr zurückgedrängt – nur noch fünf Generäle in der Regierung und der Verteidigungsminister ein Zivilist! –; dem neugewählten „integren“ Präsidenten gelingt das „Kunststück“, alle politischen Kräfte in eine „Regierung der nationalen Einheit“ einzubinden; Osttimor hat endlich seine Unabhängigkeit; und überhaupt besteht jetzt begründete Hoffnung auf wirtschaftliche Gesundung, auf dauerhafte Verbesserung der Lebensverhältnisse der Massen und auf politische Konsolidierung.
Was hat sich in der Zwischenzeit so fundamental geändert? Osttimor ist weitgehend verwüstet, Teile der Bevölkerung umgebracht, vertrieben, deportiert; die indonesischen Streitkräfte und das Parlament haben nach dem Wüten der indonesischen Milizen nur widerwillig und gezwungenermaßen ihren Anspruch auf die Region aufgegeben und sie internationaler Aufsicht überlassen; anderswo gehen sie weiterhin gewaltsam gegen ethnische Aufstände und Unabhängigkeitsbewegungen vor. An allen substantiellen Staatsproblemen, an der ökonomischen Krisenlage, an den fundamentalen Streitpunkten der Machtverteilung und nationalen Ausrichtung, an den ethnisch-religiösen Gegensätzen im Land hat sich nichts geändert, an der wachsenden Verelendung weiter Teile der Bevölkerung schon gleich nicht.
Aber es hat eine Wahl stattgefunden. In Jakarta haben die alten und neuen politischen Figuren – Generäle, Suharto-Günstlinge, islamische Führer und Mitglieder politischer Familienclans, also all die, die von den internationalen Beobachtern gestern als überkommene korrupte Kreise, als selbstherrliche Militärs, als fundamentalistische Gefahr und zweifelhafte politische Größen identifiziert worden sind – ihre Gegensätze zurückgestellt, und die Machtpositionen unter sich ausgeklüngelt. Und sie haben sich dem internationalen Verlangen gebeugt, Osttimor aufzugeben. Das war sie die großartige „Demokratisierung“, mit der sich nach Auffassung der kritischen Begutachter – so wollen sie es zumindest eine Weile sehen – alles zum Besseren gewendet haben soll. Geändert hat sich damit nämlich eine, in ihren Augen entscheidende Sache: Indonesiens Politiker haben sich die Kritik zu Herzen genommen, die das Ausland an ihnen geübt hat. Alles, was nach allgemeiner Auffassung in diesem Land im Argen liegt, sollte ja einem einzigen Übel geschuldet sein: dass nicht ordentlich regiert wird. Wie regiert zu werden hätte, dafür hatte man auch ein passendes Generalrezept: Nach „unserem Vorbild“, also „demokratisch“. Damit ist erst einmal und vor allem anderen gemeint, dass sich die Zuständigen im Lande an den Anforderungen und Maßstäben zu orientieren haben, die „wir“ an brauchbare Verhältnisse da hinten stellen. Den Willen dazu entnimmt man den indonesischen „Reformbemühungen“. Das ist es, was auf einmal die weitreichendsten „Hoffnungen“ begründet.
Der ausländische Ruf nach Demokratisierung Indonesiens
Dabei ist die rückblickende Verurteilung der bisherigen Machtverhältnisse durch und durch verlogen. Bis vor gar nicht langer Zeit war Indonesien mit seiner Militärherrschaft den auswärtigen Mächten nämlich recht und den Begutachtern wenig Aufhebens wert. Gegen Aufständische im ausgedehnten Inselreich vorzugehen, das war gebilligt, das machte Indonesien zu einem Hort der Stabilität und zu einem Bollwerk gegen den Kommunismus. Es zählte zu den großen staatsmännischen Leistungen Suhartos, in einem jahrelangen Bürgerkrieg mit hunderttausenden Opfern die größte kommunistische Partei Südostasiens mit ihren mehr als drei Millionen Anhängern, die einen anderen, volksfreundlicheren Weg der Nation im Sinn hatten, zu zerschlagen. Während dieser Zeit und noch lange darüber hinaus hat keiner darauf gedeutet, dass der Staat von Generälen und Clans diktatorisch regiert, jeder Widerstand blutig unterdrückt wird. Im Gegenteil: Die mit Terror hergestellten und gesicherten Verhältnisse qualifizierten das Land zu einer verlässlichen Adresse für das westliche Ausland und haben das internationale Finanzkapital so überzeugt, dass es kräftig auf dieses Land spekuliert hat. Das hat ihm den Status eines „emerging market“, also eines aufstrebenden Teils des Weltfinanzmarkts beschert. Und im Gefolge davon würdigte die weltöffentliche Kommentierung die heilsame starke Hand, ohne die so ein Land nicht regierbar ist. Indonesien wurden unter Suhartos entschlossener Führung die viel versprechendsten nationalen Fortschrittstendenzen attestiert. Der völkerrechtliche Streitfall Osttimor war jahrelang bedeutungslos und in der UNO begraben; der dauernde Terror gegen die Aufständischen dort und anderswo wurde zu den antikommunistischen Säuberungswerken gezählt und stillschweigend gebilligt.
Dieselben, die dem Land lauter gute Noten bei dem segensreichen Projekt zugeschrieben haben, mit seinen chinesischen Geschäftsleuten und mit internationalem Kapitalzustrom einen „indonesischen Kapitalismus“ aufzubauen, wissen inzwischen genau, dass das alles nur Korruption, Verschwendung, unrechtmäßige Bereicherung und Cliquenwirtschaft gewesen ist – eben: das „System Suharto“. Das wissen sie, seit das internationale Kapital abgezogen und Indonesien als Krisenland eingestuft worden ist. Die Folgen, die der Entzug des internationalen Kredits für das Land gezeitigt hat – ökonomischer Zusammenbruch, wachsende Unzufriedenheit in den herrschenden Kreisen und laufende politische Unruhen in der Bevölkerung – werden nämlich der Führung des Landes als deren eigenes Versagen angekreidet. Seitdem entdeckt man allenthalben nur noch ruinöse Vetternwirtschaft. Seitdem kennt man auf einmal die katastrophalen Lebensverhältnisse, die schlechtes Regieren belegen. Seitdem kümmert sich die Welt darum, wie in Indonesien das Militär rebellierende Massen und widerspenstige ethnische Minderheiten erledigt. Seitdem kreidet die Weltöffentlichkeit dem Regime seine Gewalttätigkeit an – wegen deren mangelndem Erfolg bei der Befriedung des Landes. Seitdem weiß alle Welt, dass dort die Menschenrechte verletzt werden – und macht keinen Hehl daraus, dass damit die Unfähigkeit gemeint ist, das Land ohne Widerstand von unten zu regieren. Und seitdem empfiehlt man dem Land Demokratie, und zwar keineswegs bloß eine unmaßgebliche Öffentlichkeit, sondern die entscheidenden weltpolitischen Instanzen. Dieselben, die neulich gewusst und gebilligt haben, dass es das Militär zur Befriedung im Land braucht, messen seitdem die Zustände an dem Ideal, das Regierungsgeschäft müsste auch dort unabhängig vom Personenwechsel feststehen und gelingen. Auch dort, so die neue Auffassung, müsste ohne ständige Gewalt und besser zu regieren gehen, wenn nicht eine Figur mit ihrem persönlichen Anhang und gestützt auf das Militär die Fäden der Macht in Händen hielte. Die Macht sollte sich statt auf die Armee und eine Führungsclique auf die Zustimmung der Bevölkerung verlassen können, und das Land auf diese Weise durch alle Krisen hindurch und trotz aller Härten gegen das Volk „regierbar“ sein. Kurz, das Ausland dringt auf „Demokratie“, damit das (wieder)hergestellt wird, was es vermisst: „Stabilität“. Als ob die Herrschaftsmethoden, die in gefestigten kapitalistischen Nationen das Regieren verlässlich organisieren, unter ganz anderen, und zwar ausgerechnet unter staatlichen Notstandsverhältnissen Stabilität erzeugen könnten. An dem Anspruch, dass dieser „Partner“ des Westens für die ausländischen Interessenten brauchbar bleibt oder wieder wird, werden die Fortschritte in Sachen „Menschenrechte“ und „demokratische Errungenschaften“ gemessen. Deswegen halten die Kritiker der eingerissenen Zustände stur an der Messlatte fest, Indonesien sei eigentlich ein ganz normaler Staat, so ungefähr wie Deutschland – nur eben noch nicht ganz so weit und durch und durch schlecht regiert.
Eine denkbar ignorante Einstellung; denn die eingerissenen Zustände sind ja keineswegs das Werk falschen Regierens, und Indonesien ist keineswegs eine über zigtausend Inseln verteilte, bloß etwas zurückgebliebene und in Unordnung geratene Art Bundesrepublik. Die Zuständigen in Jakarta haben schon genau so regiert, wie es den dortigen Verhältnissen entspricht. Sie haben mit ihren jetzt missbilligten Herrschaftsmethoden den Notwendigkeiten einer Herrschaft Rechnung getragen, der die entscheidenden Stützen der Demokratie – eine entwickelte kapitalistische Nationalökonomie und der staatsbürgerliche Gehorsam eines entsprechend national sortierten Volks – fehlen. Man muss gar nicht fragen, wie Schröder und sonstige demokratische Macher unter solchen Umständen regieren würden; die Paragraphen demokratischer Verfassungen, die den inneren Gewaltbedarf für Fälle des Staatsnotstands gesetzlich regeln, sowie die einschlägigen Fälle beim Vorgehen gegen Terrorismus und Separatismus geben ja erschöpfend Auskunft über die „Wehrhaftigkeit“ auch von funktionierenden Demokratien. Auch ökonomisch hat sich das indonesische Regime an den kapitalistischen Gegebenheiten ausgerichtet und auf den Weltmarkt und das internationale Finanzkapital gesetzt. Weil das Land über kein flächendeckend tätiges nationales Kapital und ein dafür nützlich gemachtes Volk gebietet, reichten die Fortschritte hin zu einem kapitalistischen Standort allerdings immer nur so weit, wie internationaler Kredit in das Land und durch die Hände der Herrschaft floss. Die finanzierte damit das Programm eines „nationalen Aufbaus“; dessen Unternehmungen taugten dabei regelmäßig vornehmlich zur Bereicherung der Herrschaftsfiguren – wie denn auch sonst, wenn die Förderung nationalen Reichtums im Wesentlichen Staatsprojekt ist und bleibt. Die internationalen Finanzmärkte haben mit ihrer negativen Spekulation dann den Schein einer aufstrebenden nationalen Ökonomie gründlich zerstört und den Status eines immerzu wachsenden „emerging markets“ nachhaltig untergraben. Damit ist das „Modell“ eines im und mit dem Weltmarkt aufstrebenden, weil für das internationale Kapital nützlichen Landes, das als berechenbarer und benutzbarer Bestandteil der asiatischen Region seine Dienste tut, gescheitert. Verfall der Währung, Bankenpleiten, der Einbruch des ohnehin beschränkten einheimischen Geschäftslebens und die schlagartige Zunahme der Massenarmut waren die Folge. Der Entzug des internationalen Kredits und die Auflagen des IWF haben der Herrschaft nämlich den Zwang aufgenötigt, ihr Programm einer „nationalen Entwicklung“ aufzugeben und sich der „Sanierung“ Indonesiens zu widmen. Das hat als Erstes bedeutet, rigoros dort zu sparen, wo der Staat gar nicht verschwenderisch tätig war: bei den Massen. Wesentlicher Inhalt des von den internationalen Kreditagenturen verordneten „Sanierungskonzepts“ war die Entlassung von Staatsbediensteten, die Streichung von Lebensmittelsubventionen und die Vervielfachung der Lebensmittel- und Benzinpreise. Die Folge waren Armuts- und Hungeraufstände sowie der nationalistische Aufruhr, der sich gegen die chinesischen Geschäftsleute, aber auch gegen die eigene Obrigkeit richtete, mitgetragen von Studenten und Intellektuellen, die dem Regime den Niedergang des Landes und des Volkes zur Last legten.
Die hiesigen Kritiker wissen, woher das alles kommt. Die Manier, mit der bisher durchaus zur Zufriedenheit der internationalen Instanzen regiert worden ist, macht – so lautet jetzt das Urteil – das Land anfällig für Widerstand, weil die Herrschaft und der Nutzen aus ihr von den Falschen, den regierenden Clans, monopolisiert werden. Diese Konzentration der Macht und ihrer Erträge in den Händen einer Herrschaftsclique liefert, wie man ja sieht, für die von der Herrschaft ausgeschlossenen Anwärter und für die Massen lauter Gründe, die Mitwirkung und den Gehorsam zu verweigern. Deswegen kann im Land nichts vorangehen, und deswegen ist das Land dann auch nicht fähig, das Ausland mit seinen berechtigten Geschäfts- und Ordnungsinteressen zu bedienen. Also sollen die Zuständigen vor Ort tunlichst dafür sorgen, dass das Land „regierbar“ ist und gescheit funktioniert, und gefälligst alles abstellen, was dazu nicht passt. Das betrifft in erster Linie sie selber. Sie sollen ihr Machtmonopol, das man als Ursache aller Übel ausgemacht hat, aufgeben, die Machtausübung vom persönlichen Kommando ablösen, eine Konkurrenz aller politischen Kräfte eröffnen und sie vom Volk entscheiden lassen, auch wenn der Staat nicht über ein ordentliches Volk, über eine einige friedlich-schiedlich um die Machtausübung konkurrierende politische Klasse und über ausreichend Reichtum für die Bedienung aller an ihn gestellten Ansprüche verfügt. Vom Militär wird erwartet, sich auf die Rolle eines Instruments der Politik nach außen zurückzuziehen, wie wenn es nicht für den nationalen Staatszusammenhalt und die feste Ausrichtung des Landes unerlässlich wäre. Und den Herrschaftsfiguren wird mit dem „Kampf gegen die Korruption“ empfohlen, sich auf die vom IWF und den Kreditgebern verordnete ökonomische Bescheidenheit einzustellen, indem sie freiwillig Ausübung der Macht und private Bereicherung trennen. Das bedeutet zugleich, das ganze Programm der Entwicklung eines nationalen Kapitalismus zu streichen; das ja im Wesentlichen gar keine andere Grundlage haben konnte als die ökonomischen Unternehmungen der Machtträger, also die „Familienunternehmen und -banken“ der Clans und der beteiligten Militärs. Und das gerade massenhaft verarmte Volk soll sich ausgerechnet durch ein neues politisches Klüngelwesen in Gestalt konkurrierender Parteien und durch das Recht auf Stimmzettel gut bedient und zu verantwortlichem staatsbürgerlichen Gehorsam veranlasst sehen.
Deswegen ist in den Augen der kritischen Begutachter mit
der Wahl ein entscheidender Durchbruch erzielt. Endlich
sind, so die Erwartung, alle Kräfte, die von der Macht
ausgeschlossen waren, mit einbezogen, das Monopol der
alten Clans ist tendenziell beseitigt und damit auch der
Widerstand ausgeräumt: Das ‚Traumpaar‘
(Wahid/Megawati) verspricht politische Stabilität. Die
täglichen Demonstrationen, die oft in blutige Kämpfe
zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften ausarten,
dürften ein Ende nehmen – entscheidendes Fundament für
einen wirtschaftlichen Neuanfang.
(SZ, 23.10.) Indonesien wird durch die
Demokratisierung für alle ein einfacherer Partner.
(Der australische Außenminister,
Handelsblatt, 21.10.). Dass der Kreis der Clans
bloß erweitert ist, wird nicht einfach vergessen, sondern
uminterpretiert: Es stehen eben noch lauter Aufgaben an.
Jetzt muss man auf dem eingeschlagenen Wege weitergehen,
das Cliquenwesen endgültig abschaffen, das Militär
dauerhaft aus der Politik drängen, das Volk richtig reif
für die Demokratie machen – natürlich alles so, dass das
Land an Stabilität gewinnt und die Gegensätze nicht
wieder ausbrechen. Deshalb geht auch die etwas
ungewöhnliche, allumfassende Regierungsbildung in
Ordnung.
Die Unzufriedenheit mit den Ergebnissen von einigen Jahrzehnten Zugehörigkeit Indonesiens zum Westen und zum Weltmarkt berechtigt deren Subjekte also nach ihrer Auffassung zur kritischen Einmischung in die indonesischen Verhältnisse; sie verpflichtet umgekehrt die Regierenden in Jakarta, sich an dem Verlangen nach einer dienstbaren Herrschaft auszurichten, ohne dass ihnen mit der Forderung nach „Demokratie“ ein taugliches Rezept oder gar Unterstützung an die Hand gegeben würde.
Demokratie wagen auf indonesisch
Indonesiens Machthaber, das muss man ihnen lassen, haben den guten Rat ihrer auswärtigen Freunde beherzigt, deren leuchtendem Vorbild nachgeeifert und „mehr Demokratie gewagt“. Und zwar so, wie es sich gehört und alle Mal angesagt ist, wenn eine bestehende Staatsgewalt sich zur Demokratie entschließt, nämlich im Sinne einer viel versprechenden Herrschaftstechnik. Um mit den Hungeraufständen, dem militanten Überdruss mit der alten Herrschaft, dem chinesenfeindlichen Aufruhr und den teilweise wohl demokratieidealistisch, teilweise islamistisch inspirierten Studentenunruhen fertig zu werden, ohne den materiellen Interessen der verelendeten Massen und den radikalen Änderungswünschen des akademischen Nachwuchses nachzugeben, haben die Spitzen der Regierungspartei und die maßgeblichen Militärs sich darauf geeinigt, bestimmten Oppositionsparteien dosiert mehr Recht einzuräumen, die allgegenwärtige Gehorsamskontrolle zurückzunehmen und Parlamentswahlen ohne vorab feststehendes Ergebnis anzustreben. Für ihre Verhältnisse war das schon enorm viel Umsturz; schließlich war die Unterwerfung des Volkes unter den Willen der Herrschaft – also das, was man „politischen Grundkonsens“ nennt und was jedes funktionierende Staatswesen braucht – seit Jahrzehnten auf die Art organisiert gewesen, dass weder sachliche noch personelle Alternativen in Sachen nationaler Führung überhaupt in Betracht kamen. Doch so unangefochten wie bisher ging es mit dieser Methode nun ja nicht weiter. Also gingen die Machthaber das Risiko eines Methodenwechsels ein und meinten sich das auch leisten zu können. Immerhin blieb der wichtigste Pfeiler der politischen Herrschaft, die Macht des Militärs, unangetastet, und auch die kapitalistische Staatsräson der Nation wurde nicht zur Disposition gestellt. Auf die Ergebnisse des einstigen Massenmords an der „kommunistischen Gefahr“ im Lande war nach wie vor Verlass, von einer sozialistischen Staatsgegnerschaft weit und breit nichts zu sehen. Und wo die islamistische Opposition zu radikal zu werden drohte, wurde sie zumeist schon von ihren eigenen „besonnenen“ Führern und religiösen Würdenträgern vom Programm einer antiwestlichen Gottesrepublik abgebracht. Tatsächlich ist die Sache dann auch nicht schief gegangen: Die Massen haben die bedingte Zulassung nicht übermäßig alternativer Oppositionsparteien zur Wahl mit einer im Großen und Ganzen friedlichen Stimmabgabe honoriert und insoweit als gerechtes Angebot an ihre Unzufriedenheit anerkannt; und mit dem Wahlergebnis haben sie die militärischen Machthaber und die sonstige „politische Klasse“ ihrer Nation auch nicht vor allzu große Probleme gestellt – die Wahlniederlage der alten Staatspartei fiel halbwegs glimpflich aus, der Wahlerfolg der großen Alternative hielt sich in Grenzen. Auch ohne allzu wüste Manipulationen, ohne erneuten Aufruhr und vor allem ohne Staatsstreichversuche der unterlegenen Herrschaftsfraktion wurde nach mehrwöchigem Stimmen-Auszählen ein passendes Resultat festgestellt, verkündet und akzeptiert. Und nach einigem Hin und Her, Drohungen des Militärs und Stimmenschacher inklusive, hat das gewählte Parlament es schließlich sogar zur Wahl eines allgemein freundlich begrüßten Präsidentschafts-Gespanns gebracht.
Nur ist Indonesien mit dieser einstweilen als geglückt zu bezeichnenden Umstellung von der Herrschaft einer einzigen Staatspartei auf einen echten Mehrparteien-Parlamentarismus noch lange nicht zu einer Großausgabe eines parlamentarisch verfassten kapitalistischen Gemeinwesens „herangereift“. Alle Umstände dieses großartigen Demokratisierungs-Wagnisses geben deutlich genug Aufschluss darüber, dass von einem bürgerlichen Gewaltmonopolisten, der ohne Alternativen in der Sache, dafür mit einem Überangebot an ambitionierten Politikern über eine politökonomisch fürs Kapital nutzbar gemachte und durchorganisierte „Zivilgesellschaft“ regiert, und von einer staatsbürgerlichen Loyalität, die in den Sachzwängen des staatlich betreuten Erwerbslebens und den darin befangenen Vorteilsrechnungen der freien Untertanen ihre feste Grundlage hat, nicht die Rede sein kann. Mit einer sachlichen Berechtigung, deren Grund sie gar nicht zu kennen brauchen, haben berichterstattende Landeskenner daher auch bis zuletzt voller Sorge den Demokratisierungsprozess begutachtet, abwechselnd um die Stabilität der Herrschaft und um die Einhaltung der demokratischen Geschäftsordnung gefürchtet; und mittlerweile legen sie nach kurzer Euphorie auch schon wieder die Stirn in Falten. Dennoch muss man dem Verfahren der Vereinnahmung des Volkes für die Herrschaft im Wege der Zustimmung zu einem vorausgewählten Herrschaftspersonal auch im indonesischen Fall seine Leistungsfähigkeit bescheinigen: Ohne dass sich in der Substanz viel geändert hätte – das Militär hat nach wie vor letztinstanzlich das Heft in der Hand und geht selbstverständlich davon aus, dass sich die zugelassenen Parteien und zivilen Politiker mit ihrer Konkurrenz an der Aufgabe zu bewähren haben, für mehr Ruhe und Ordnung im Land zu sorgen, von einem „Rückzug in die Kasernen“ kann also keine Rede sein; und kapitalistischen Reichtum gibt es nach wie vor als von ausländischen Interessen abhängiges Bereicherungsmittel hauptsächlich in den Händen der Staatsagenten, die der auswärtigen Geschäftswelt die einheimischen Geschäftschancen anzubieten haben –, hat das Land einen förmlichen Herrschaftswechsel hinter sich gebracht. Wie haltbar die neue Verfassung der Nation ist, wird sich dann schon zeigen.
Und es zeigt sich bereits an einem ganz speziellen Bestandsproblem des indonesischen Staates, das mit der Zerrüttung der alten ökonomischen und politischen Verhältnisse und ihrer formellen Sanierung mittels Demokratie unmittelbar gar nichts, mittelbar dann aber doch sehr viel zu tun hat.
„Unabhängigkeit für Osttimor“: Ein nicht beabsichtigter neuer internationaler Konfliktfall im Gefolge der Demokratisierung
Die Bevölkerung zahlreicher Landesteile hat schon in der Vergangenheit eigentlich nie einen plausiblen Grund dafür gefunden, weshalb sie sich ausgerechnet von Jakarta aus regieren lassen sollte. Den absurden Verheißungen, ein im volksmäßigen Sinn mehr „eigenes“ Gemeinwesen wäre auch alle Mal ein besseres, wird schon lange gern geglaubt. Diese Sorte politisierter Unzufriedenheit hat mit dem zunehmenden Elend auf der einen Seite, den Anfechtungen der politisch-militärischen Unterdrückungsmacht der Zentrale auf der anderen Seite einen ziemlichen Aufschwung genommen; und durch den Beschluss, demokratische Bräuche einzuführen und oppositionellen Standpunkten ein Recht einzuräumen, hat dieser Separatismus – auch ohne dass er gemeint war – sich ins Recht gesetzt gefunden. Überall im „ethnisch gemischten“ Inselreich haben sich deshalb Unabhängigkeitsbewegungen wieder verstärkt zu Wort gemeldet, die Zugehörigkeit verschiedener Landes- und Bevölkerungsteile zu diesem Staat mit aller Entschiedenheit verneint und den Kampf für einen jeweils eigenen Staat intensiviert. So ist mit der Neuorganisation der indonesischen Macht die heiße Frage des Staatszusammenhalts auf die Tagesordnung gekommen. Militär und Regierung sahen sich prompt herausgefordert, der Demokratisierung Grenzen zu ziehen.. Die indonesische Mehrheit im Staat – Militärs, alte Kräfte, aber auch die neu zugelassene Opposition – war sich einig, dass solche Bewegungen nach wie vor unterdrückt werden müssen. Schließlich sollte mit den Reformen die Herrschaft neu gefestigt, aber nicht ausgerechnet antiindonesischen Bestrebungen im Land Recht gegeben werden. Also ist das Militär mit allgemeiner Zustimmung des Mehrheitsvolks seiner gewohnten Aufgabe nachgegangen, die widerspenstigen Inseln und Volksteile gewaltsam bei der Stange zu halten. Kaum aufgebracht, war damit die Idee, Indonesien ließe sich ohne dauerndes Eingreifen des Militärs – vielleicht sogar besser – zusammenhalten und regieren, blutig widerlegt. Kein Wunder, beruht doch die Herrschaft in diesem „Vielvölkerstaat“ nicht auf einem allgemein akzeptierten Gewaltmonopol, sondern darauf, dass es im Innern laufend gegen abweichende Herrschaftsbestrebungen durchgesetzt und gegen separatistische Widerstände zur Geltung gebracht wird.
Im Fall Osttimor blieb es allerdings nicht der indonesischen Zentrale überlassen, nach ihrem Gutdünken mit den neu entflammten Unabhängigkeitsbestrebungen zu verfahren. Die Rechnung der nationalistischen Befreiungskämpfer, mit tatkräftigem Widerstand das Ausland auf sich aufmerksam zu machen, ist aufgegangen. Nicht, weil in Osttimor die Unterdrückung besonders blutig gewesen wäre – da hätten sich genügend andere Fälle auch angeboten. Das Ausland hat sich vielmehr – nicht gleich und entschieden, dann aber unter Führung der EU doch mehr und mehr – dazu entschlossen, die alte, ewig bedeutungslose und deswegen immer noch unerledigte Osttimorfrage zum Prüfstein für den indonesischen Reformwillen und damit zum Material ihrer Aufsicht über den Demokratisierungsprozess zu machen. Schließlich gab es hier einen völkerrechtlichen Titel, der sich im Lichte der Demokratisierungsforderungen ganz anders ausnahm als zu Zeiten des Ost-West-Gegensatzes, wo die Sache faktisch durchaus für passend geregelt befunden worden war. Jetzt wurde die völkerrechtliche Definition Osttimors neuerlich, bzw. erstmals ernsthaft zu einer Streitfrage erklärt, die zwischen Indonesien und den für die internationale Ordnung zuständigen entscheidenden Mächten zu regeln sei. Mit unterschiedlichem Nachdruck, – ausgerechnet die vormalige Kolonialmacht Portugal vertrat am lautesten die Forderung nach Freiheit und Menschenrechten für Osttimor, weil sie die einseitige Annexion durch Indonesien immer schon und immer noch als antiportugiesischen Gewaltakt auffasste –, dann aber immer geschlossener verlangten die entscheidenden Subjekte der „internationalen Gemeinschaft“, dass Indonesien in dieser Angelegenheit ihnen gegenüber in der Pflicht sei. Die Machthaber in Jakarta sollten den Bedenken gegen ihren einseitig festgehaltenen Hoheitsanspruch Rechnung tragen und dem Inselteil zumindest Autonomie gewähren. Nachdem das Militär den entgegengesetzten indonesischen Anspruch demonstrativ gegen den wieder aufflammenden Widerstand und unter den Augen von EU-Emissären durchfocht, bestand man auswärts auf einer Volksabstimmung über die Zukunft Osttimors:
„Ende Juni 98, angesichts eines Besuchs der EU-Troika in Timor, erreichten die Demonstrationen und die Gewalt der Armee auf der Insel ihren Höhepunkt, es gab viele Tote. Die Troika beschloss daraufhin, ihren Besuch abzubrechen. Ihr Bericht lautete: ‚Uns erscheint eine Lösung der Osttimorfrage ohne eine direkte Befragung der Bevölkerung nicht möglich. Der Rückzug der indonesischen Truppen hat absolute Priorität.‘“ (taz, 17.2.)
Indonesiens Übergangspräsident gab nach, nicht zuletzt, um einen sich abzeichnenden Konfliktfall mit dem Ausland zu erledigen und Indonesien damit freie Hand für die Niederschlagung des Separatismus in anderen Landesteilen zu sichern; zudem nährte er die Hoffnung und tat einiges dafür, dass die Abstimmung im indonesischen Sinn ausfiele. Dieses Zugeständnis war freilich eine gewaltige Herausforderung an den indonesischen Nationalismus: Die „Selbstbestimmung“ der Osttimoresen gehörte ja eigentlich nicht zum Programm indonesischer Demokratisierung, so dass Habibie nationaler Verrat und feiges Nachgeben gegenüber auswärtiger Einmischung vorgeworfen wurde. Kaum hatte die befragte Bevölkerung für Abtrennung gestimmt, wurden vor Ort Milizen des indonesischen Bevölkerungsteils, der vom Herrenvolk zur schikanierten Minderheit zu werden drohte – und was das bedeutet, da kannten sie sich aus –, mit Duldung und Unterstützung des Militärs aktiv. Mit Terror gingen sie daran, das Referendum hinfällig zu machen, und das Militär übernahm das Kommando. Damit war die geplante einvernehmliche Lösung gescheitert, bei der Indonesien quasi als Beauftragter und Garant einer von der UNO mitbetreuten Regelung firmieren sollte. Das Vorgehen der Milizen und des Militärs stellte die UNO mit ihren Beobachtern vor Ort bloß; sie wurden selber zur Zielscheibe von Angriffen und verließen Osttimor.
Mit dieser Auseinandersetzung um die Reichweite der „Demokratisierung“ Indonesiens stand also nicht mehr nur der innerindonesische Machtkampf zwischen dem Präsidenten und den Militärs auf der Tagesordnung. Jetzt ging es auch für die auswärtigen Aufseher um eine Herausforderung neuer Art. Schließlich war nicht mehr bloß die „wehrlose Bevölkerung“ Opfer von Angriffen, sondern die Repräsentanten mächtiger Staaten waren betroffen – und damit diese selber in ihrer Rolle als zu respektierende Aufsichtsmächte. Also standen sie vor der Entscheidung, wie sie mit dieser Insubordination gegen den von ihnen gebilligten und betreuten Übergang umgehen sollten. Sie entschlossen sich, auf Einhaltung der Abmachungen zu bestehen. Also verlangten sie von Indonesien Nachgeben. Damit war der Konfliktfall endgültig zu einer ernsten Gewaltfrage zwischen Indonesien und den Weltaufsichtsmächten gediehen. Prompt entdeckte die Weltöffentlichkeit einen „kalten Putsch des Militärs“, sowie einen nicht hinnehmbaren „Rückschlag im Reformprozess“. Seit diesem Zeitpunkt wusste man endgültig, dass es sich hier wieder einmal um einen eklatanten Fall von „Menschenrechtsverletzung und Völkermord“ handelte, dem man nicht tatenlos zuschauen konnte. Zugleich wurden allerdings alle Gesichtspunkte bekannt gemacht und öffentlich besprochen, die – „Menschenrecht“ hin, „Völkermord“ her – im Unterschied zum Kosovo diesmal Vorsicht geboten erscheinen ließen:
„Indonesiens Einheit gerät in Gefahr. Osttimor kann der Zündfunke für einen Flächenbrand werden, der sich quer über das Archipel der 13000 Inseln zieht. In Aceh, Ambon, West Irian und auf Borneo sind separatistische Bewegungen am Werk. Sie dürften alles daran setzen, die Schwäche der Regierung für ihre Ziele zu nutzen.“ (HB, 7.9.)
Die demokratischen Medien gaben ohne falschen Moralismus Auskunft darüber, dass in diesem Fall zwei widerstreitende imperialistische Gesichtspunkte gegeneinander standen: Auf der einen Seite war niemand an einer Destabilisierung Indonesiens interessiert; man war auf haltbare und berechenbare Zustände aus und nicht darauf, lauter unerwünschte Auseinandersetzungen im Land und mit ihm zu riskieren. Auf der anderen Seite konnten sich weltweit zuständige Ordnungsmächte die Missachtung des Rechts der UNO, die Neuordnung der indonesischen Herrschaft zu beaufsichtigen, nicht gefallen lassen: Die Weltorganisation von fanatisierten indonesischen Nationalisten vorführen zu lassen, kam nicht in Frage, das war den teilnahmsvollen Kommentatoren klar. Also war man sich einig, dass die eigene Seite, schon um ihrer „Glaubwürdigkeit“ willen, um ein Eingreifen wohl nicht herumkäme. Ob das der Stabilisierung indonesischer Verhältnisse dient, war jetzt nicht mehr entscheidend; jetzt ging es erst einmal darum, das Gehorsamsgebot gegenüber Indonesien durchzusetzen, also um die Prinzipienfrage der imperialistischen Rangordnung. So ist Osttimor, ohne dass irgendeiner Seite an Feindschaft gelegen war, zu einem internationalen Konfliktfall eskaliert, und Indonesien hat einsehen müssen, dass es in seiner Souveränität nur bedingt anerkannt ist.
Allerdings haben die herausgeforderten Mächte bei ihrem Einschreiten den beiden widerstreitenden Gesichtspunkten dann durchaus wieder Rechnung getragen. Die Intervention, die sich gegen die angemaßte indonesische Entscheidungshoheit richtete, kündigte, anders als im Fall Serbien, nicht den Respekt gegenüber der Macht, die man praktisch in die Schranken wies. Das Eingreifen wurde in Form einer UNO-Mission organisiert, die mit Zustimmung Indonesiens Osttimor unter internationalen Schutz stellen sollte. Dieselbe UNO, die neulich noch von der Nato bloßgestellt worden war, kam jetzt als die Instanz zu Geltung, die Indonesien gegenüber die Ordnungsansprüche der internationalen Gemeinschaft vertreten sollte. Zugleich sollte sie die Gewähr dafür bieten, dass Jakarta sich zum Vollzugsgehilfen der international erwünschten Neusortierung seines Herrschaftsbereichs macht. Mit dem Placet der USA war die Sache entschieden, Australien übernahm die Führungsrolle, und andere beteiligten sich an der Aufstellung einer UNO-Truppe. Jakarta wurde dazu gedrängt, dem Ansinnen zuzustimmen, Osttimor aus dem indonesischen Herrschaftsbereich herauszulösen und bewaffneter internationaler Kontrolle zu unterstellen. Mit Sanktionsdrohungen, mit diplomatischen Erpressungen und mit demonstrativen Vorbereitungen für die Truppenstationierung wurde dafür gesorgt, dass die indonesische Seite sich zum Mitmachen bereit erklärte. Allerdings haben sich nicht nur die indonesischen Militärs und Milizen, sondern auch die Mehrheit der Politiker durch den Verlust und die ausländische Einmischung in ihren nationalen Rechten verletzt gesehen. Das kann gar nicht ausbleiben, wenn die auswärtige Hilfestellung bei der „Demokratisierung“ auf die Einmischung in elementare nationale Bestandsfragen hinausläuft.
Die imperialistische Bilanz
Eingebracht hat das alles der internationalen
Gemeinschaft erstens auf nicht absehbare Zeit einen neuen
– nutzlosen und bedeutungslosen – Betreuungsfall; noch so
ein Protektorat, das aus eigener Kraft nicht lebensfähig,
aber bis auf weiteres Gegenstand laufender
Auseinandersetzungen mit Indonesien ist. Zweitens mögen
die Interessenten an verlässlicher politischer Ein- und
Ausrichtung Indonesiens noch so sehr den Schein pflegen,
als sei Indonesien jetzt auf dem – schwierigen,
langwierigen, gefährlichen, aber letztlich – besten Wege,
zu geordneten Verhältnissen im Land und zum Status eines
konsolidierten und ökonomisch brauchbaren Partners. Dass
Indonesien wieder zum boomenden Spekulationsobjekt
internationaler Anleger wird, ist bis auf weiteres nicht
abzusehen; das IWF-Schuldenregime beschert dem Land
keinen neuen Kreditsegen, sondern regelt die Folgen des
Kreditentzugs für das Bankenwesen und den Staat. Und die
Zerrüttung der politischen Herrschaft ist mit den
Reformen nicht beseitigt, sondern vorangeschritten. Alle
Machtkonflikte, die mit dem Übergang zur Demokratie ein
für alle Mal gelöst werden sollten, sind kurz nach der so
nachdrücklich begrüßten Einrichtung der neuen Regierung
und nach dem Abzug des Militärs aus Osttimor schon wieder
bedrohlicher auf der Tagesordnung und weltöffentliches
Thema. Der Separatismus ist nicht befriedet, sondern
nimmt sich jetzt überall an der Osttimor-Regelung ein
Beispiel. So wiederholt sich in der für Indonesiens
Ökonomie und territorialen Bestand ziemlich
entscheidenden Provinz Aceh die Auseinandersetzung um den
indonesischen Staatszusammenhalt. In der Provinz
demonstrieren Millionen für das Recht, selber über ihre
Staatszugehörigkeit zu entscheiden, und verlangen
Unabhängigkeit. Prompt bricht unter den gerade mühsam
beruhigten Kontrahenten in Jakarta der Streit um den
besten Umgang mit dieser Bedrohung des Staates neuerlich
auf. Der neue Präsident verordnet militärische
Zurückhaltung; er verspricht, jüngste Übergriffe auf die
Bevölkerung untersuchen zu lassen, und will der Region
einen größeren Anteil aus den Exporterlösen der dortigen
Erdgas- und Erdölförderung zugestehen. Vor allem aber
stellt er für die Aufstandsprovinz ein späteres
Referendum in Aussicht und denkt dabei, wie er
versichert, nicht an Unabhängigkeit, sondern an einen
Autonomiestatus, der den Verbleib im indonesischen
Staatsverbund sichern soll – genauso wie es von
indonesischer Seite anfangs im Falle Osttimors geplant
war. Sein eigener Außenminister warnt gleichzeitig im
Hinblick auf die Unabhängigskeitsbestrebungen in anderen
Provinzen vor einer ‚drohenden Auflösung‘
Indonesiens.
(SZ, 5.11.)
Und das Militär sowie die Mehrheit der Politiker quer
durch alle Reihen wenden sich entschieden dagegen, den
Bestrebungen in irgendeiner Weise nachzugeben, weil damit
nur die staatszersetzenden Tendenzen befördert,
Staatseinheit und Staatsautorität untergraben würden. So
stellt sich mit dem Problem des unbefriedeten
Separatismus auch gleich wieder die grundsätzliche
Machtfrage an der Staatsspitze. In der Krisenprovinz wird
derweil die Sicherheitslage kritisch. Die große
Erdgasanlage Arun wird kaum noch bewacht, ausländische
Techniker und ihre Familien sind evakuiert worden.
(FAZ 15.11.)
Auch den Kommentatoren, die lauter hoffnungsvolle Indizien für eine Wendung zum Besseren entdecken wollen, bleibt also der Ernst der Lage nicht verborgen:
„Alles dreht sich in Indonesien um einen Neuanfang. Je mehr sich die Drehung beschleunigt, desto stärker werden die Fliehkräfte.“ (SZ, 10.11.) „Aber das machtgewohnte Militär, der religiöse Fundamentalismus und die in der Suharto-Zeit angestauten ethnischen Feindseligkeiten stellen ernste Gefahren dar. Ein Scheitern wäre nicht nur für Indonesien fatal. Es würde auch die Kräfte in Asien stärken, die in der Demokratisierung nur staatlichen Zerfall und Chaos sehen.“ (FAZ, 12.11.)
Selbst da, wo die hiesigen Begutachter längst von der Gefahr handeln, dass dieses Land sich zu einem dauerhaften „Unruheherd für die ganze Region“ entwickeln könnte, auf deren „Ruhe“ „wir“ selbstverständlich ein Anrecht haben, halten sie gleichwohl an der Fiktion eines heilsamen Reformprozesses fest. Die fortschreitenden Gegensätze deuten sie standhaft als neuerliche Bewährungsprobe für das Gelingen des großen Werks, mit Demokratie für Stabilität und Funktionalität des Landes zu sorgen. Sie bekräftigen damit erstens den Anspruch auf eine uns genehme „Normalisierung“. Alles andere als demonstrativer Optimismus bezüglich der Erfolgsaussichten auf dem langen beschwerlichen Weg dahin wäre zweitens gleichbedeutend mit dem endgültigen Eingeständnis, dass Indonesien mit dem konstatierten „Wandel“ gar nicht tauglicher geworden ist, sondern sich eher zu einem großen, schwer kontrollierbaren Problemfall ausgewachsen hat – mit allen negativen Folgen für die Region und die an ihr hängenden Geschäfts- und Ordnungsinteressen.
Wie alle solche Affären „internationaler Krisenbewältigung“ hat auch der Fall Osttimor für manche Beteiligte
eine bereitwillig ergriffene Gelegenheit für Engagement
geboten. Zu denen, die sich in besonderer Weise zum Handeln gefordert sahen, gehörte erstens der indonesische Nachbar Australien, der sich als entscheidende, dem „Westen“ zugehörige Regionalmacht in besonderer Weise für zuständig erklärte. Das Land hat sich einen Statusgewinn der aktuell passenden Art erobert, indem es – unterstützt von Großbritannien – als Anwalt eines internationalen Eingreifens aufgetreten ist. Mit seiner Vorreiterrolle bei der UNO-Mission hat es die imperialistische Lehre beherzigt, die die Nato im Kosovo-Krieg vorexerziert hat: Ein Staat gewinnt auf jeden Fall an Bedeutung und Einfluss, wenn er sich im erlauchten Kreis der Ordnungsmächte für deren Eingreifen stark macht, damit bei den entscheidenden Adressen Recht bekommt und beim gemeinsamen militärischen Einsatzkommando dann auch noch federführend beteiligt ist. Deswegen hat sich ausgerechnet Australien, das als einziger Staat die Annexion Osttimors durch Indonesien diplomatisch anerkannt hatte, unter den neuen Vorzeichen am entschiedensten dafür stark gemacht, Indonesien die Zuständigkeit für dieses Territorium aus der Hand zu nehmen.
Zweitens wollte auch das vom fernöstlichen Schauplatz etwas weiter entfernte Deutschland diesmal nicht abseits stehen und hat sich mit einem symbolischen Kontingent an der gemeinsamen Sache beteiligt:
„Fischer begründete den Einsatz mit Verpflichtungen der Bundesrepublik gegenüber den Verbündeten in Europa und den UN. Die Bundesregierung könne nicht internationale Organisationen stärken wollen und ein Gewaltmonopol der UN einklagen, wenn sie nun zurückstehe. Der Einsatz liege im deutschen Interesse, weil damit eine humanitäre Katastrophe abgewehrt, die demokratische Entscheidung einer Volksgruppe durchgesetzt und die Solidarität mit den Verbündeten demonstriert werde.“ (SZ, 8.10.)
Bei der ersten Gelegenheit nach dem Kosovo-Krieg demonstriert der deutsche Außenminister, wie seine Ankündigung vor der UNO-Vollversammlung gemeint ist, Deutschland werde sich künftig mehr als bisher für den Frieden und die weltweite Geltung der Menschenrechte einsetzen. Der menschenrechtsliebende Mann verkündet Deutschlands Pflicht, reklamiert also Deutschlands Recht, bei den weltweit fälligen Ordnungsaktionen verstärkt mitzuwirken. Dabei hat er der UNO eine Führungsrolle reserviert – weil Deutschland auf eine mitentscheidende Rolle in dieser Organisation aus ist. Wenn deutsche Sanitäts-Soldaten unter UNO-Befehl da hinten tätig werden, dann – so die deutsche Position – bringt die Bundesrepublik die internationalen Zuständigkeiten ins rechte Lot: Sie rückt den Angriff der Nato auf die UNO zurecht, setzt umgekehrt rückwirkend die Kosovo-Aktion endgültig ins Recht, nimmt zugleich Deutschlands eindeutig gewachsene Verantwortung in weltpolitischen Aufsichtsfragen wahr und meldet mit dem konsequenten Einsatz für die UN zugleich den deutschen Anspruch auf mehr Mitentscheidungsrechte in der Führungsetage der obersten Instanz der Weltgemeinschaft an. Wofür 100 Bundeswehr-Sanitäter in Osttimor doch alles gut sind!