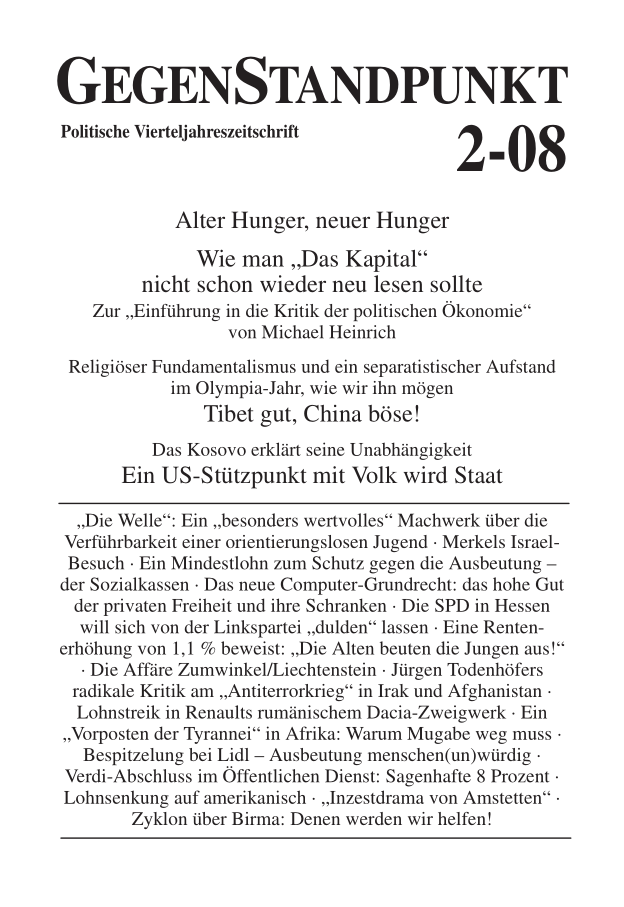Aus der Reihe „Chronik - kein Kommentar!“
Du sollst nicht lügen – beim Fertigmachen von abweichenden Meinungen:
Die SPD in Hessen will sich von der Linkspartei „dulden“ lassen – Die Öffentlichkeit dreht durch
Anfang März geht ein Gespenst um in Deutschland: die Öffentlichkeit wittert den Vorabend zur Diktatur des Proletariats. Der Spiegel titelt mit einer Abwandlung der im Realsozialismus beliebten Ahnenreihe der Büsten von Marx, Lenin zu Lafontaine und Beck. Es droht die Vertreibung aus dem Paradies. In der Anzeigenwerbung für n-tv verführt die Eva Gysi den Adam Beck mit einem roten Apfel zur Erbsünde. Aber das ist noch alles matt gegen den Hauptschlager „Lügilanti!“: der „Wahlbetrug“ der hessischen SPD. Den brauchen sich die Hessen doch wohl wirklich nicht bieten lassen.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Länder & Abkommen
Du sollst nicht lügen – beim
Fertigmachen von abweichenden Meinungen:
Die SPD in
Hessen will sich von der Linkspartei „dulden“ lassen –
die Öffentlichkeit dreht durch
Anfang März geht ein Gespenst um in Deutschland: Die Öffentlichkeit wittert den Vorabend zur Diktatur des Proletariats. Der Spiegel titelt mit einer Abwandlung der im Realsozialismus beliebten Ahnenreihe der Büsten von Marx, Lenin zu Lafontaine und Beck. Es droht die Vertreibung aus dem Paradies. In der Anzeigenwerbung für n-tv verführt die Eva Gysi den Adam Beck mit einem roten Apfel zur Erbsünde. Aber das ist noch alles matt gegen den Hauptschlager „Lügilanti!“ (Bild): der „Wahlbetrug“ der hessischen SPD. Den brauchen sich die Hessen doch wohl wirklich nicht bieten lassen. Gleichzeitig wird die Nation mit Rückblicken über die ge- und misslungensten politischen „Wahllügen“ aller Parteien aus den letzten 50 Jahren unterhalten, wobei sich so manche „Lüge“ durch ihren Erfolg rechtfertigt. Spätestens mit der Frage nach der „Glaubwürdigkeit des Parteiprofils“ ist eine Ebene der öffentlichen Aufregung erreicht, wo sich Anlass, nationale Bedeutung, parteipolitische Kalkulationen, Moral der Führungselite und Wahlprognosen schwer auseinander halten lassen. Also der Reihe nach.
Die Landtagswahlen in Hessen bringen ein für die Machtkonkurrenten höchst unbefriedigendes Ergebnis. Die CDU kriegt mit der FDP keine Mehrheit zusammen. Auch die wahltaktische Absage der SPD an jegliche Zusammenarbeit mit ihrer neuen linken Konkurrenz, um deren Wähler wegen der Folgenlosigkeit einer linken Stimmabgabe zum Kreuz beim sozialdemokratischen Original zu bewegen, geht nicht vollständig auf. Für Rot-Grün langt es ohne die Stimmen der linken Abgeordneten nicht. Diese würden sich für die „Duldung“ auch hergeben, die rot-grüne Minderheitsregierung in Hessen an die Macht bringen, ihre Unabkömmlichkeit bei einer Herrschaftsbestallung im Westen als ihren größten anzunehmenden Wahlerfolg feiern – und sonst nicht weiter stören.
Die politische Öffentlichkeit jedoch stört diese
Aufwertung der Linken ganz erheblich. G. Nonnenmacher von
der ortsansässigen FAZ gibt am 2.3.08 die Richtung vor,
um die es ihm geht: Das entscheidet über das Schicksal
der Republik
... Denn der Preis, den Lafontaine,
Gysi und Co. für ihre gnädige Zustimmung zu einer
SPD-geführten Regierung verlangen würden, wäre klar: Dazu
gehört das Ausscheiden aus der westlichen
Bündnissolidarität, vor allem aber der endgültige
Abschied von der Agenda 2010
. Dass dies zwar nicht in
Wiesbaden entschieden wird und auch im rot-roten Berliner
Rathaus – wo die Linke sogar mitregieren darf – nicht auf
der Tagesordnung steht, dürfte dem Mitherausgeber der
Zeitung für Deutschland sicher nicht unbekannt sein. Aber
allein schon den Afghanistaneinsatz ablehnen und den
unzufriedenen Opfern der gelaufenen Sozialreformen Recht
geben – das ist kein zugelassener Standpunkt im
demokratischen Pluralismus, sondern das offene
Anstreben einer sozialistischen Gesellschaftsordnung
(FAZ, 6.3.). Eine Partei, die
mit dieser Kritik an der Außen- und Sozialpolitik
Parlamentssitze erobert, ist folglich ein klarer Fall von
einer auszugrenzenden Ungeheuerlichkeit. Wo Wählerstimmen
sonst zur Herrschaft ermächtigen – diese
Wählerstimmen rechtfertigen nichts.
Die „inhaltliche Auseinandersetzung“ mit der Linken
gestaltet sich demgemäß eher wortkarg. Das allgemeine
journalistische Stilmittel zur Meinungsbildung in Sachen
Rettung der Nation besteht in der schlichten Denunzierung
des linken Parteietiketts: Ohne Mühe erkennt die
differenzierte Öffentlichkeit eine Ansammlung von
Kommunisten und Sozialisten
(FAZ), ehemalige SED-ler
(Handelsblatt), reaktiviert
so elaborierte Argumente wie DDR
Stasi
Mauer
(diverse), so
dass jetzt knapp 20 Jahre nach dem Ende der DDR deren
Neuauflage, der Linksstaat
drohe (Bild).
Die Zulassungsbedingungen zum politischen Geschäft diktiert dieser Linken die SZ:
„Mit der Linken ist im Westen auf geraume Zeit kein Staat zu machen. Sie ist noch lang kein stabiler und akzeptabler Faktor. Sie besteht aus drei Parteien: der PDS-Ost, die sich dort demokratisch bewährt hat; der PDS-West, zusammengesetzt aus verrückten K-Gruppen; und der Ex-WASG, in der Gewerkschafts-Sozis sitzen. Solange die Läuterung nicht fortgeschritten ist, kann man sich mit der Linken nur äußerst vorsichtig einlassen.“ (SZ, 25.2.)
Opposition ist entweder ein staatstragender Faktor oder gar nicht. Erst wenn „die Linke“ den Inhalt ihres Oppositionsprogramms verleugnet, darf sie beim Staatmachen mitspielen. Erst wenn sie sich von ihren Verrückten trennt und uns damit beweist, dass sie nichts „Linkes“ mehr durchsetzen will, darf sie wie schon in Berlin und im Osten den Etablierten den Steigbügel halten und auch im Westen den zur Macht wirklich Befugten stabile Regierungsmehrheiten verschaffen. Diese Selbstreinigung der Linkspartei steht nach Auffassung der demokratischen Öffentlichkeit noch aus, und stellvertretend fordert die SZ sie ein.
Eine weitere demokratische Methode, unliebsame Kritik loszuwerden, bringt ein ehemaliger Verfassungsrichter und Bundespräsident ein: Er schlägt vor, das Wahlrecht gleich so zu ändern, dass Minderheiten gar keine Mandate bekommen. Zwar eine begrüßenswert klare Auskunft, dass es bei Wahlen auf eine Bestellung der Herrschaft ankommt und Parlamente kein Sprachrohr für Bürgerwünsche sind, trotzdem wird der Vorschlag mit höflichem Schweigen übergangen. Dem Ex-Bundespräsidenten geht es um die Stabilität des demokratischen Gemeinwesens, aber die durch das Auftauchen der „Linken“ im Ernst gefährdet zu sehen, scheint erstens doch ein wenig übertrieben. Zweitens steht der Aufwand in keinem rechten Verhältnis zum Problem. Eine Grundsatzdebatte über das Wahlrecht anzetteln, um dann angesichts aller absehbaren Winkelzüge der Parteienkonkurrenz eine Verfassungsänderung auf den Weg zu bringen: Das ist für das „Problem“, das die „Linke“ darstellt, dann doch eine Nummer zu groß. Der Antrag auf ein Zweiparteien“system“ wird abgelehnt. Man ist sich einig: mit diesen Linken muss die Republik auch so fertig werden.
Das ist die Aufgabe der Sozialdemokraten, die zuständig erklärt werden für die eingeforderte Verdauung dieser unbeliebten Neulinge, und die sich selbst auch zuständig finden. Die sind deshalb nach allgemeiner Auffassung aber auch Schuld am heraufbeschworenen Abgrund, an dem Deutschland steht. Schließlich haben sie es nicht geschafft, die Opfer ihrer eigenen Sozialreformen bei der Stange zu halten. So ähnlich sieht das die Partei selber. Deshalb gibt es Streit in der SPD darüber, ob sich die Linke eher durch Ausgrenzen oder durch Zwang zum Bewähren vorführen und erledigen lässt, welche Tour also am meisten Erfolg dabei verspricht, die der Sozialdemokratie gehörenden Wählerstimmen wieder heimzuholen. Nach dem Urteil der Öffentlichkeit soll sich die SPD dabei nicht bloß saudumm, sondern vor allem unehrenhaft angestellt haben.
Hoher Anspruch an die SPD: Beim Fertigmachen der Linkspartei auch noch sauber bleiben
Die Vorgabe dafür kommt von der um ihre Regierungsmacht
fürchtenden CDU. Sie wirft der SPD für den hessischen
Koalitionsversuch Wortbruch vor, um ihr damit
zumindest moralisch das Führungsrecht in Hessen zu
bestreiten und für sich selbst zu beanspruchen. Das wird
von den politischen Meinungsbildnern zum alles
entscheidenden sittlichen Vorwurf aufgeblasen.
Ehrlichkeit ist jetzt der Prüfstein, an dem sich die SPD
mit dem Versuch der geduldeten Minderheitsregierung
versündigt hat und an dem sie sich nun neu bewähren muss.
Wobei die penetranten Verfechter des Mantras
Wahlbetrug, Wahlbetrug
überhaupt nicht beruhigt
wären, hätte die SPD die Duldungsoption an die Linke vor
der Hessen-Wahl nicht ausgeschlossen und wäre so
ehrlich
gewesen. Auf das Versprechen der
Nichtzusammenarbeit sollte die SPD nach dem Willen der
CDU vor der Wahl festgenagelt werden, um ihr hinterher
diese Option zu verbauen. Das ist die Falle, in die die
Sozialdemokraten laufen sollten: Gebt ihr zu, dass ihr
über eine Duldung nachdenkt, entlarven wir euch als
Kommunisten, gebt ihr es nicht zu, als unehrlich. Da
hilft es Ypsilanti jetzt nichts, sich mit einem anderen
Wahlversprechen – die Regierung zu übernehmen – zu
rechtfertigen. Dieses „Wahlversprechen“ darf sie gerne
brechen.
Mit dem Totschläger der „Unehrlichkeit“ ist die
anvisierte Duldung durch die „Linke“ in die schlimmste
Verletzung der politischen Moral verwandelt. Die Hetze
gegen die Linkspartei hat damit ihre Schuldigkeit getan
und braucht in der politischen Kommentierung meist nicht
mehr vorzukommen. Jeder weiß, wie es gemeint ist, wenn
nun die Wiedergutmachung der verletzten Moral gefordert
und deren Sieg entsprechend gefeiert wird: Ehrlichkeit
vor Macht. Es gibt noch Anstand! Eine einfache
SPD-Landtagsabgeordnete hat geschafft, was Parteichef
Beck nicht konnte – oder wollte. Sie ist der
wortbrüchigen Andrea Ypsilanti gerade noch in den Arm
gefallen. Weil sie ihrem Gewissen gefolgt ist.
(Bild, 8.3.) Das lässt die
Bildzeitung aufatmen: von einer kleinen Abgeordneten ist
die politische Ehrlichkeit gerettet worden.
Auch die Befürworter der misslungenen Machtergreifung
argumentieren auf der Ebene der „Ehrlichkeit“. Die
Frankfurter Rundschau gibt den Vorwurf der Unmoral
einfach zurück: Wer über Moral und Wahrhaftigkeit in
der Politik sonst nur lächelt und seine Wahlversprechen
pragmatischen Machtoptionen zu opfern pflegt, sollte
jetzt den Mund halten. Die neue Bündnis-Variante im
Westen zu probieren, ist kein Verbrechen.
(FR, 4.3.) So schlimm ist das
Vergehen doch nicht, und die SPD wird doch auch mal die
Wahrhaftigkeit der Machtpragmatik opfern dürfen wie die
anderen Heuchler.
Das schmutzige Geschäft der Macht verträgt keine Unehrlichkeit
Dem ersten Teil dieser Aussage kann sich auch die Konkurrenz von der FAZ, die das Pochen auf „Sachaussagen“ und „Inhalte“ auch gern einmal beiseite schiebt und es der Pflege illusionsloser demokratischer Standfestigkeit für eher abträglich hält, nicht verschließen, und was die Prinzipien einer erfolgreichen demokratischen Wahlwerbung betrifft, wird auch sie deutlich:
„Bislang wurden gebrochene Wahlversprechen üblicherweise mit einem neuen Erkenntnisstand gerechtfertigt ... Diese geheuchelte Überraschung über den Sachzwang ist die traditionelle Form, in der Wahlphrasendrescherei entschuldigt wurde. Entsprechend niedrig stehen seit jeher Sachaussagen des politischen Personals vor Wahlen im Kurs. Der Bürger konnte sich darauf verlassen, dass überhaupt nur Sätze Gültigkeit haben, die sich auf Machtfragen bezogen.“ (FAZ, 6.3.)
Doch gerade weil sich dermaßen perfekt aufgeklärte demokratische Bürger, wie sie der FAZ-Redaktion vor Augen stehen, über die notorische Heuchelei der Kämpfer ums Wählervertrauen rein gar nichts mehr vormachen, haben sie ein umso größeres Recht, in Bezug auf die wirklich entscheidenden, nämlich die Macht betreffenden Fragen in den Grundkoordinaten ihrer politischen Meinungsbildung nicht durcheinander gebracht zu werden: Wer mit wem regiert – da muss der Bürger sich schon auf den Schatz seiner gewohnten Erfahrungen verlassen können. Ihn dabei mit der Kalkulation einer „neuen Bündnis-Variante“ bös überrascht zu haben, ist das Verbrechen der SPD. Dabei kommt erschwerend hinzu, dass für den professionellen Verstand eines journalistischen Parteiforschers natürlich auch an dieser Front ‚Ehrlichkeit‘ eng mit der Wertschätzung korreliert ist, die man einer Partei entgegenbringt, worüber sich schon wieder feine Differenzierungen konstruieren lassen:
„Die Machtfrage selber, in der man sich zuvor eindeutig erklärte, wird (nun) behandelt wie irgendein Programmpunkt, der sich eben unter gegebenen Umständen nicht durchsetzen lässt. Bislang galt die Lizenz zum gleichwohl schmählichen Umfallen allenfalls für Parteien, die ohnehin kaum Macht hatten. Man kann eine Selbstbeschreibung der SPD darin erkennen, dass sie diese Lizenz nun auch für sich beansprucht.“
Umfallen
ist freilich immer schmählich
,
aber es kommt doch sehr darauf an, wer umfällt. Denen,
die sich aufgrund ihrer Kleinheit immer erst zu einer
größeren Partei und damit zur Macht hinrobben müssen,
kann man einen Unehrlichkeitsvorschuss beim hohen Gut
„Machtfrage“ irgendwie nicht verwehren. Aber eine so
große Partei wie die SPD verspielt doch glatt ihre ganze
Größe, wenn sie sich um der Macht willen an „die Linke“
heranwanzt und sich dermaßen von den Launen krummer
Wahlausgänge abhängig macht – das ist ein
‚Umfallen‘, das einem Sympathisanten der C-Parteien für
die SPD so richtig schmählich vorkommt.
Die SZ-Redaktion zeigt sich – der gemeinsame Kampfauftrag gegen die „Linke“ macht’s möglich – einerseits solidarisch und verlängert die „Selbstbeschreibung“ der SPD in einen „Glaubwürdigkeitsverlust“, den sie gegenüber der politologischen Denkerriege aus München schon zu „rechtfertigen“ hat. Andererseits enthält man sich einer dezidierten Verurteilung. Man zieht es vor, des Lesers moralisch-geistige Anteilnahme an der doch recht überschaubaren Frage, ob die SPD sich in einem Bundesland im Westen von der „Linken“ ‚tolerieren‘ lässt oder nicht, über einen Ausflug in die Erörterung allerhöchster Prinzipienfragen zu wecken:
„Vor diesem Problem stehen jetzt zwei Parteien: Die Grünen müssen sich darüber klar werden, wie hoch der Preis für das Regieren sein darf, sprich: wie verträglich eine Kooperation mit der CDU für ihre Prinzipien wäre. Und auch die SPD hat in Hessen die Frage zu beantworten, wie viel Glaubwürdigkeitsverlust der Griff nach der Macht rechtfertigt ... Für die Sozialdemokraten steht mehr auf dem Spiel: Sie entscheiden nicht nur über die Perspektiven der Partei, sondern auch über ihr Verständnis von politischer Ehrlichkeit. Die Grünen können sich dem Kompromiss als Normalfall der Demokratie fügen. Für die SPD geht es ums Ganze.“ (SZ, 26.2.)
Mindestens, und solange Beck und Co. da nicht ein machtvolles Grundlagenpapier zum Thema politische Ehrlichkeit in Münchens Sendlingerstraße einreichen, steht für die Sozialdemokraten die SPD auf dem Spiel.