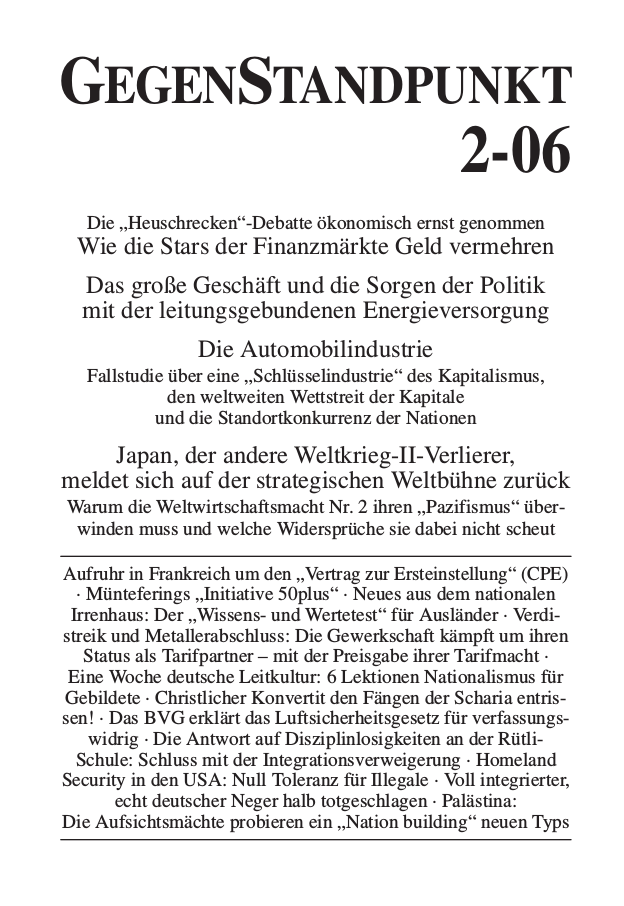Die „Heuschrecken“-Debatte ökonomisch ernst genommen
Wie die Stars der Finanzmärkte Geld vermehren
Vor allem amerikanische und britische Hedgefonds und Private-Equity-Gesellschaften haben Deutschland entdeckt und investieren von Jahr zu Jahr neue Rekordsummen. Das ist jetzt auch wieder nicht recht. Ex-SPD-Chef und Arbeitsminister Müntefering bezichtigt die mühsam hergebetenen Investoren-Fonds, wie Heuschrecken über gute deutsche Firmen herzufallen, sie für ihre Profite auszuschlachten und dann, Wirtschaftsruinen hinter sich lassend, weiter zu ziehen, anstatt Arbeitsplätze zu schaffen und Deutschland voranzubringen.
Aus der Zeitschrift
Teilen
Systematischer Katalog
Gliederung
- Die Speerspitzen der New Economy kaufen Old Economy
- Wyser-Pratte setzt bei IWKA auf den „Break-up-Value“
- „Texas-Pacific-Group“ (TPG) unterzieht die Friedrich Grohe AG einem „financial engineering“
- Goldman Sachs „saniert“ eine Drogeriekette und ein Spielzeugeisenbahnwerk – „Distressed-Debt“-Strategen machen aus Pleiten ihren Gewinn
- The Children’s Fund (TCI) hebt den Schatz der Deutschen Börse
- Ein Dreh weiter in der Spirale des spekulativen Wahnsinns
- Müntes verlogene „Heuschrecken“-Nummer – ihr Grund und ihr Zweck
Die „Heuschrecken“-Debatte ökonomisch ernst genommen
Wie die Stars der Finanzmärkte Geld vermehren
Jahrelang klagten Regierungen und Wirtschaftsverbände über einen Mangel an ausländischen Investitionen. Selbstkritisch vermerkte man, dass Deutschland für internationale Anleger unattraktiv geworden sei – selbstverständlich wegen der hohen Löhne, aber auch wegen bürokratischer Überregulierung und der Unzugänglichkeit der so genannten Deutschland-AG für Investoren von außen. Der Standort könne es in punkto Rendite mit dem Kapitalismus der angelsächsischen Länder einfach nicht aufnehmen. Am Maßstab dieser Vorbilder hat man das Land von den Löhnen und Sozialkosten bis hin zu den Zugangsbedingungen zum Finanzmarkt umgekrempelt und sich bemüht, es den kapitalkräftigen Investoren aus Übersee recht zu machen. Mit Erfolg. Vor allem amerikanische und britische Hedgefonds[1] und Private-Equity-Gesellschaften[2] haben Deutschland entdeckt und investieren von Jahr zu Jahr neue Rekordsummen.[3]
Das ist jetzt auch wieder nicht recht. Ex-SPD-Chef und Arbeitsminister Müntefering bezichtigt die mühsam hergebetenen Investoren-Fonds, wie Heuschrecken über gute deutsche Firmen herzufallen, sie für ihre Profite auszuschlachten und dann, Wirtschaftsruinen hinter sich lassend, weiter zu ziehen, anstatt Arbeitsplätze zu schaffen und Deutschland voranzubringen. Mit aller gebotenen Zurückhaltung reaktiviert er die alte, von den Faschisten populär gemachte Unterscheidung zwischen dem schaffenden Kapital, das „wir alle“ brauchen und uns wünschen, und dem raffenden Kapital, das „uns“ nur ausnutzt und ärmer macht. Freilich soll die Rufschädigung keinesfalls das Finanzkapital mit seinen Zins- und Renditeansprüchen insgesamt treffen; man will die weltweiten Investoren ja nicht abschrecken. Ihre Geldmacht soll sich hierzulande betätigen und nicht anderswo, aber bitte wachstumsfördernd und mit Rücksicht auf die sozialdemokratische Ideologie vom Kapital als Quelle menschenfreundlicher Arbeitsplätze.
Solche Anforderungen kommen den Managern der „Heuschrecken“-Szene nicht bloß sach- und weltfremd vor. Sie passen auch nicht zu dem Ethos, mit dem sie ans Werk gehen.[4]
Die Speerspitzen der New Economy kaufen Old Economy
Die Finanzgenies der kapitalistischen Welt sind schon längst nicht mehr im normalen Leihgeschäft von Banken und Sparkassen tätig und auch schon nicht mehr eigentlich auf dem Börsenparkett zu Hause. Ihr Betätigungsfeld ist die Spekulation auf den Gang der Spekulation mit Wertpapieren aller Art. Geld schlagen sie unter Einsatz kurzfristig geliehener Finanzmittel von enormer Größe aus nahezu beliebig kleinen Differenzen bei Zinssätzen oder Devisenkursen, aus Optionen auf die Wertentwicklung von Aktien und Anleihen bzw. aus Unterschieden zwischen solchen Optionen, aus marginalen Abweichungen zwischen den Renditeversprechen gleichartiger „Finanzprodukte“ heraus. Sie rühmen sich ausdrücklich ihrer quasi alchimistischen Kunst, in allen Marktlagen positive Renditen zu erzielen
, also auch geschäftlichen Misserfolg ihrer Investitionsobjekte, fallende Aktienkurse, Krisen, Devisenturbulenzen, Zinswechsel etc. zur Quelle ihrer Bereicherung zu machen.[5] Dafür sammeln sie Geldkapital, für das große Anleger – ‚institutionelle Investoren‘ wie Banken, Versicherungen, Pensionsfonds – sonst keine lohnende Anlagemöglichkeit finden. Mittlerweile sieht die Elite der internationalen Finanzwelt allerdings auch in dieser gehobenen Abteilung des spekulativen Irrsinns keine standesgemäße Herausforderung mehr. Sie hat sich auf den spekulativen Handel mit kapitalistischen Unternehmen geworfen und gleich eine Vielzahl von einschlägigen „Geschäftsmodellen“ erfunden, mit denen sie Überschüsse erzielt.
Wyser-Pratte setzt bei IWKA auf den „Break-up-Value“
Der amerikanische Fondsmanager kauft anonym über die Börse Aktien des badischen IWKA-Konzerns zusammen, der Werkzeug-, Verpackungsmaschinen und Industrieroboter herstellt. Dank der Mitwirkung einiger anderer Hedgefonds, die auch IWKA-Aktien halten, reicht Wyser-Pratte ein Aktienanteil von 6,6%, um in der Hauptversammlung der AG als bestimmende Aktionärsmehrheit aufzutreten und eine Neuausrichtung der Geschäftspolitik durchzusetzen: Er will den Mischkonzern auflösen, die Sparten Werkzeug- und Verpackungsmaschinen verkaufen und das Geschäft auf Industrieroboter konzentrieren. Wyser-Pratte rechnet darauf, dass sich sein Aufwand für den Aktienkauf durch den Erlös aus dem Verkauf der zwei minder rentablen Sparten und durch die höhere Rendite des fortgeführten Robotergeschäfts in kürzester Frist weit mehr als bezahlt macht, so dass er mit einem Gewinn wieder aussteigen kann; einem Gewinn, der mit unverhältnismäßig wenig eigenem Kapitalvorschuss „erwirtschaftet“ wäre – den Kauf der Firmenanteile finanziert ein geschickter Manager für die kurze Frist bis zum alsbaldigen Wiederverkauf mit einem billigen Kredit – und deswegen als hochprozentige Rendite zu Buche schlägt.
Ähnliche Kalkulationen stellen Beteiligungsfonds mittlerweile auch mit ungleich größeren Firmen an: Bei Daimler-Chrysler, VW, MAN, Linde und anderen Musterkonzernen der deutschen Industrie entdecken sie bestens laufende Geschäftsfelder oder Tochterunternehmen neben anderen, weniger oder gar nicht profitablen Bereichen; auch da könnte ein „Break-up“ – nach Abzug der Kosten einer kurzfristigen Kreditaufnahme für die Unternehmens-Übernahme – ganz viel „Value“ für den Fonds kreieren. Für VW hat man sich z.B. ausgerechnet, dass die Tochter Audi allein schon einen fast so großen Preis an der Börse erzielen könnte wie derzeit der ganze Konzern.
„Texas-Pacific-Group“ (TPG) unterzieht die Friedrich Grohe AG einem „financial engineering“
Der Private-Equity-Fonds versilbert dem Haupteigentümer und Sohn das Erbe, veranlasst als neuer Hauptaktionär den Aufkauf der übrigen Aktien in Streubesitz und nimmt die Aktiengesellschaft von der Börse. Die so eroberte, von keiner Publizitäts- oder öffentlichen Bilanzierungspflicht mehr eingeschränkte Kontrolle über die Firma nutzt der Fonds zugunsten seiner Rendite. Nämlich so, dass er als Erstes die Schulden, die er für den Erwerb der Aktien gemacht hat, der erworbenen Firma aufbürdet, damit also quasi zum Nulltarif in den Besitz des kompletten Unternehmens gelangt.[6] Das ist freilich jetzt stark verschuldet, muss das aber aushalten können, nämlich aus seinen laufenden Einnahmen den Kredit bedienen, der ihm aufgehalst worden ist; deswegen kommen für dieses Kunststück des „financial engineering“ auch nur Unternehmen in Frage, die im Verhältnis zu ihrem Umsatz und Überschuss wenig Schulden aufweisen und auf absehbare Zeit auch keinen Kredit für Investitionen zur Fortführung des Betriebs benötigen.[7] Und auf unabsehbare Zeit wollen die Fonds-Manager ihre Neuerwerbung gar nicht betreiben; sie wechseln nicht ins Fach der Badezimmerarmaturenfabrikanten, sondern lassen ihrem Einstieg den zweiten Akt ihres „financial engineering“ folgen: Frei von allen Bindungen und Rücksichten des Alteigentümers steigern sie die Rentabilität des angewandten Kapitals durch Verlagerung der Produktion an Billig-Standorte und Entlassung teuren Personals sowie durch Verkauf oder Stilllegung minder rentabler Geschäftsfelder – also nach dem Muster der „Break-up-Value“-Schöpfung –; Immobilien sowie anderes überflüssig gewordenes Firmenvermögen machen sie zu Geld, das sie an sich selbst als Eigentümer auszahlen.[8] Am Ende steht als dritter Akt der „Exit“,[9] der in verschiedenen Formen abgewickelt werden kann. Im besten Fall findet der Fonds für seine auf ihre profitträchtigsten Aktivitäten reduzierte Firma einen Käufer oder bringt sie an die Börse und kassiert den Preis bzw., was Geldanleger für neue Grohe-Aktien hinlegen. Im schlechteren Fall ist der Kunstgriff des Einstiegs auch schon der Leitfaden für den Ausstieg:[10] Der Fonds belastet die Firma mit weiteren Anleihen, lässt das geliehene Geld als „Dividende“ an sich überweisen und „rekapitalisiert“ sich auf diese Weise mit Gewinn. Wenn der Laden darüber Pleite geht, dann hat der Investor seinen Schnitt längst gemacht. Die Konkursmasse ist ein Fall für das „financial engineering“ einer nächsten Abteilung moderner Kredithaie:[11]
Goldman Sachs „saniert“ eine Drogeriekette und ein Spielzeugeisenbahnwerk – „Distressed-Debt“-Strategen machen aus Pleiten ihren Gewinn
Überschuldung, Zahlungsunfähigkeit und Konkurs sieht die Branche als Chance, sich das Eigentum derer anzueignen, die die Entwertung des in der Konkurrenz unterlegenen Kapitals tragen müssen. Das sind erstens die Banken, die die uneinbringlichen Kredite vergeben haben, zweitens die alten Eigentümer, die die Kredite nicht bedienen können, und drittens manchmal auch noch die übrigen Gläubiger der verschuldeten Firma.
„Hedgefonds kaufen Hausbanken Kreditforderungen von konkursbedrohten Unternehmen zu billigsten Konditionen ab und verschaffen sich über eine Umschuldung Managementeinfluss. … Sie erreichen bei Unternehmen mit Schieflagen über den ‚Schuldeneinstieg‘ mehrere Ziele: Erstens erhalten sie die Forderungen zu einem deftigen Abschlag; bei Not leidenden Krediten richtet sich der Preis meist nur noch nach den verwertbaren Sicherheiten der Kredite. Vermutet ein Hedgefonds, dass das Unternehmen mit einer geschickten Restrukturierung gerettet werden kann, birgt ein mit Abschlag gekaufter Kredit ein erhebliches Gewinnpotential. Zweitens erhalten die Hedgefonds bei einer Umschuldung des konkursbedrohten Unternehmens hohe Risikoprämien auf frisches Geld, das sie zur Verfügung stellen. Und drittens verschaffen sich die Hedgefonds im Rahmen einer Umwandlung von Verbindlichkeiten in Eigenkapital (‚Debt-Equity-Swap‘) eine Eigenkapitalmehrheit an einem Unternehmen, das sich wieder erholt. … Der Hedge-Fonds-Arm von Goldman Sachs übernahm nach Differenzen mit der Deutschen Bank sämtliche Schulden des Unternehmens, erhielt die wertlosen Eigenkapitalanteile der Familie Frömbling für einen symbolischen Preis und setzte einen Schuldenverzicht der Gläubiger von mehr als 50 Prozent durch. Heute gehört (die Drogeriekette) ‚Ihr Platz‘ zu 100 Prozent dem Hedge-Fonds-Arm von Goldman Sachs. Die Gläubigerversammlung hat dem Sanierungsplan und Schuldenverzicht am 17. November zugestimmt, und in wenigen Wochen wird das Unternehmen aus der Insolvenz saniert hervorgehen.“ (FAZ, 16.12.05)
„Märklin leidet unter schrumpfenden Umsätzen und einer hohen Zinslast. Die Banken drängen die Familieneigentümer seit dem vergangenen Jahr, neue Investoren zu suchen und die Firma zu sanieren. Jetzt könnte es zu einer Neuordnung kommen. Goldman Sachs will weitere Kredite kaufen“ – „annähernd 20 Prozent der Kredite“ des Unternehmens hat die Investmentbank bereits „mit einem Abschlag aufgekauft“ – „und verhandelt offenbar gleichzeitig über den Erwerb von Eigenkapitalanteilen. Kommen die Eigentümer der Bank nicht entgegen, könnte Goldman Sachs Kredite fällig stellen, die Familie aus dem Unternehmen drängen und eine harte Sanierung erzwingen.“ (SZ, 18.3.06)[12]
Wenn die Entwertung des erfolglosen oder für seinen Schuldenstand nicht genügend erfolgreichen Kapitals andere tragen, kann ein billig erworbener Schuldschein die beste Investition sein: Wird er doch wieder bedient, dann ist der Zins, den er abwirft, angesichts des günstigen Kaufpreises sehr hoch, ebenso die dann einsetzende Kurssteigerung des Titels. Wird er nicht wieder bedient, kann der Besitzer der Firmenschulden den Konkurs oder die Übereignung des Restvermögens erzwingen; und als potenter Eigentümer kann er dann auch noch den übrigen Gläubigern die Frage vorlegen, ob sie nicht lieber auf einen Großteil ihrer Ansprüche verzichten und auf eine Bedienung der reduzierten Schuldtitel setzen wollen, als auf einer Aufteilung der Konkursmasse zu bestehen, die für die Befriedigung ihrer Ansprüche ohnehin nicht ausreicht. Ein nahezu zum Nulltarif angeeignetes Unternehmen lässt sich mit begrenztem Risiko fortführen und gegebenenfalls später zu einem überhaupt nicht symbolischen Preis an den nächsten Interessenten verkaufen.
The Children’s Fund (TCI) hebt den Schatz der Deutschen Börse
Value für ihre Fonds kreieren kann die Branche auch bei Firmen, bei denen sie weder einen Break-up-Value noch ausnutzbare Über- oder Unterverschuldung entdeckt, sondern bei denen sie einfach durch einen außerordentlich guten Geschäftsgang angelockt wird: Das Vorhaben des Vorstands der Deutschen Börse, ihr Londoner Pendant aufzukaufen, signalisiert einem ganzen Rudel von Hedgefonds unter Führung von TCI eine „gut gefüllte Kriegskasse“, d.h. viel akkumulierten, noch nicht investierten Gewinn. Den holen sie sich ab. Sie kaufen genug Aktien des Börsenbetreibers, um die Hauptversammlung zu dominieren, lehnen dort den Expansionsplan des Managements ab und drücken angesichts der guten Kassenlage eine Sonderausschüttung an die Aktionäre durch. Der erzwungene Verzicht auf die Expansion wirft sofortigen Gewinn ab, den die Fonds sich im Maß ihres Aktienbesitzes aneignen. Manche Hedgefonds verkaufen die Aktien der Deutschen Börse schon wieder; andere setzen das Spiel fort. Mit ihrer ungeheuren Geldmacht kaufen sie sich ebenfalls bei der französisch-spanisch-niederländischen Börsengesellschaft Euronext ein, boykottieren auch deren Versuch, die Londoner Börse zu übernehmen, und drängen sodann die Deutsche Börse und Euronext zu Fusionsgesprächen. So produzieren sie selbst die Börsennachrichten, deren Wirkung auf die Kurse sie dann ausnützen. Nach dieser Seite hin ist das Geschäftsmodell ein hochoffizieller Insiderhandel.
Ein Dreh weiter in der Spirale des spekulativen Wahnsinns
Wie vor dem Platzen der Dot-Com-Blase die New Yorker Broker und Derivatehändler, so gelten nun die Manager von Hedge- und Private-Equity-Fonds als Finanzgenies unserer Tage, und gerne geben sie sich auch so. Als hätten sie den Kapitalismus neu erfunden, kritisieren sie das industriell und kommerziell engagierte wie das Finanzkapital als verschlafen und unnötig genügsam – zufrieden nämlich mit viel zu wenig Rendite. Sie zeichnen das Bild von Managern, die selbstzweckhaft ihr Unternehmen fortentwickeln, als ob sie vergessen hätten, dass es nicht ihnen gehört, sondern den Aktionären, denen sie Überschüsse schulden; und von Geldanlegern, die jede Menge Erträge verschenken – die nämlich, die sie aus den Firmen herauszuquetschen gedenken, über die sie sich hermachen. Und das Eine ist ihnen ja wirklich nicht zu bestreiten: Es ist ihnen gelungen, dem finanzkapitalistischen Überbau der herrschenden Marktwirtschaft – der Spekulation, die das Finanzkapital regiert, das über den Einsatz des Eigentums an Produktionsmitteln Regie führt, das seinerseits die gesellschaftliche Arbeit kommandiert und den gesamten gesellschaftlichen Lebensprozess bestimmt – eine weitere Facette des machtvollen Schmarotzertums hinzuzufügen und die Evolution der Charaktermaske dieses Irrsinns, des Aktienspekulanten, noch einen Dreh weiter voranzutreiben.
Der Aktionär und sein fiktives Kapital
Dieser eigentümliche Kapitalist tut sich – ganz gegen seine sonstigen Konkurrenzinteressen und -gepflogenheiten – mit anderen seinesgleichen zusammen, steckt Geld in ein Unternehmen, für dessen Betrieb sein eigenes Vermögen nicht reicht, und wird dadurch formell Teileigentümer der neuen Firma, nicht aber Mit-Unternehmer. Mit dem von den Aktionären aufgebrachten Kapital wirtschaften bezahlte Manager, die im Rahmen ihrer Kompetenzen Gewinn und Wachstum der Aktiengesellschaft zu ihrer Sache machen. Seine Einlage kann der Aktionär nicht mehr herausziehen; sie gehört der Firma, solange sie existiert. Dafür erhält er in Gestalt der Aktie einen Anrechtsschein auf einen Anteil am – in der Höhe nicht feststehenden, evtl. auch ganz ausbleibenden – Gewinn der AG, die Dividende.
Dieser Anrechtsschein ist Gegenstand eines Handels eigener Art, für den es sogar einen speziellen Marktplatz – die Börse – gibt; eines Handels, bei dem es nur noch ausnahmsweise darum geht, dass Geldanleger ihr Eigentum in ein Unternehmen – ein neues oder neu an der Börse eingeführtes oder in die Erweiterung eines dort schon „gelisteten“ Unternehmens – stecken; an normalen Börsentagen handeln Aktionäre bzw. deren Makler mit Wertpapieren, die schon mehrfach den Besitzer gewechselt haben. Dieser eigenartige Handelsartikel zeichnet sich dadurch aus, dass beide „Parteien“, die AG und ihre Anteilseigner, ihre eigenen Rechnungen mit ihm anstellen.
- Die Aktionäre haben Geld hergegeben und sich in einen eigenständigen Akkumulationsprozess eingekauft, in dem das eingezahlte Kapital auf Gedeih und Verderb drinnen steckt. Doch das ist der Auftakt zu einer Karriere ihres Vermögens, die mit dem Geschäftsgang der AG nicht zusammenfällt. Ihr Geldvermögen existiert nämlich neben seiner Verwendung durch das Unternehmen und für dessen Konkurrenzkämpfe weiter in den Wertpapieren, die sie an der Börse gekauft haben und dort auch wieder zu Geld machen können. Dort entscheidet sich auch, was aus ihrer Geldanlage wird, was sie – noch oder mittlerweile – wert ist und wie es mit ihr weitergeht. Der Wert eines Aktionärs-Vermögens ergibt sich nicht einfach aus der mehr oder weniger gelungenen Verwertung des geschäftlich genutzten Firmenkapitals; er ist das Resultat einer Bewertung, die durch den Wertpapierhandel an der Börse zustande kommt und börsentäglich im Kurswert der Aktien ausgewiesen wird.
- Die Firma hat sich mit der Ausgabe von Aktien und deren „Zeichnung“ durch interessierte Geldanleger ihr Startkapital verschafft. Damit wirtschaftet sie los, macht Gewinn, so gut sie kann, und akkumuliert Firmenvermögen. Doch was sie da an Verwertung und Mehrung des geschäftlich angewandten Kapitals zustande bringt, ist nicht das, was sie wert ist. Sie besitzt nämlich einen Börsenwert, der sich aus den Preisen errechnet, zu denen ihre Aktien gehandelt werden. Dieser „Wert“ gewichtet die per Ausbeutung und am Markt erwirtschaftete Akkumulation und entscheidet darüber, wie schlagkräftig das Vermögen, wie groß die kapitalistische Potenz der Firma wirklich ist: Er bemisst ihre Kreditwürdigkeit, befähigt sie im günstigen Fall zur Schaffung neuen, zusätzlichen Eigenkapitals per Emission neuer Aktien; er ist also ausschlaggebend für die Finanzkraft der AG und damit für ihre Konkurrenzfähigkeit auf dem gehobenen Niveau, auf dem Kapitalisten im Kollektiv anzutreten pflegen. Fortgang und Erfolg des Unternehmens hängen so von dem Kurs ab – dem tatsächlich erzielten Preis im Unterschied zum aufgedruckten Nennwert –, den die AG ihren Aktien im Börsenhandel zu verschaffen vermag.[13]
Diese Bewertung, mit der, wie gesagt, AG und Aktionäre je auf ihre Art kalkulieren, hat zwei feste Anhaltspunkte. Den einen liefert die von der AG an ihre Aktionäre ausgezahlte Dividende, wobei die zuletzt realisierte „Ausschüttung“ keineswegs einfach für alle Zukunft als Ertrag fortgeschrieben werden kann; sie ist nur der erste Anhaltspunkt dafür, welchen Ertrag ein Aktienkäufer sich von seinem Wertpapier erwarten darf. Die andere wichtige Berechnungsgröße ist der ortsübliche Zinssatz für Leihkapital, die nächstliegende praktische Alternative zu einer „Investition“ in Aktien: Nimmt man beides zusammen und rechnet die Dividende als Verzinsung einer Geldanlage, dann ergibt sich aus dem Rückschluss auf die Geldsumme, die sich üblicherweise in Höhe der Dividende verzinsen würde, die Bewertung des Wertpapiers – wobei natürlich auch die aktuellen Zinssätze, von denen es überdies je nach Güte des Schuldners immer mehrere, durchaus verschiedene gibt, nicht mehr als einen Anhaltspunkt für den zweiten Faktor der Rechnung liefern. Es eröffnet sich also ein weites Feld der Spekulation, die von einem Widerspruch gekennzeichnet ist, der nicht aufzulösen ist – zum Glück für die Aktienhändler, denn er garantiert ihnen die schlechte Unendlichkeit ihres Geschäfts: Je stichhaltiger die Bewertung ausfallen soll, desto unsicherer wird sie.
Denn um sich ihrer Anhaltspunkte zu vergewissern, ziehen die Profis dieses Geschäfts alle möglichen Umstände als mögliche Einflussgrößen in Betracht – und erweitern mit jeden Aspekt, der Gewissheit stiften soll, das Feld der unsicheren Variablen. Sie begutachten also auf der einen Seite die Geschäftsaussichten der Firma, um deren Aktien es gerade geht, diejenigen ihrer Konkurrenten, die Lage der Branche, in der die Firma tätig ist, die Konjunktur und deren mutmaßlichen Gang in dem Land, in dem die Firma ihren Standort hat, sowie der Weltwirtschaft insgesamt; also den Konkurrenzkampf der Kapitale in seinen verschiedenen Sphären, über alle Geschäftssphären hinweg, auf verschiedenen Aggregationsstufen, in unterschiedlichen zeitlichen Perspektiven usw.; außerdem würdigen sie die Geschäftspolitik der jeweiligen Firma unter den einander widersprechenden Gesichtspunkten einer reichlichen Gewinnausschüttung einerseits, einer zukunftssicheren Akkumulation andererseits. Auf der anderen Seite behalten sie die Vielzahl alternativer Geldanlagen nach Höhe und Sicherheit der Rendite im Blick, zuallererst alle anderen Aktien – denn für den Handel mit diesen Papierwerten gibt es kein Hindernis beim Sphären- oder Ortswechsel wie für die Firma selbst –, außerdem die allgemeine Zinsentwicklung und deren Determinanten bzw. was sie als deren Determinanten ins Auge fassen, um es sachgerecht zu gewichten; auch da wieder den nationalen und den globalen Konjunkturzyklus und anderes mehr. Sie kalkulieren mit lauter inkommensurablen Variablen, indem sie deren mutmaßlichen relativen Einfluss auf den Handelswert ihres Dividendenpapiers abschätzen, vergleichen die Daten, die sie aus ihren Einschätzungen ableiten, begründen ihre Einschätzungen aus den Vergleichen, die sie anstellen, und verzweifeln darüber nicht.[14] Denn eine Bewertung kommt am Ende auf alle Fälle heraus, weil es um nichts weiter und nichts geringeres als eine handfeste Konkurrenzaffäre zwischen kauf- und verkaufswilligen Geldanlegern geht, die sich irgendwo handelseinig werden oder auch nicht: Praktisch ergibt sich aus der Summe der an der Börse getätigten Kauf- und Verkaufsentscheidungen ein Börsenkurs – und auf den beziehen sich die engagierten Händler als den ersten und allerwichtigsten Anhaltspunkt für die Bewertung, die sie für ihren Geschäftsartikel reklamieren, schreiben ihn fort und orientieren sich daran. Dass sie damit einen kompletten Zirkelschluss praktizieren, irritiert sie überhaupt nicht. Zufrieden sind sie mit dem Ergebnis aber auch nicht, suchen vielmehr nach Festigkeit und Verlässlichkeit in der Kursentwicklung, die sie produzieren. Da sind sie für jeden Blödsinn zu haben, der eine womöglich sogar in mathematischen Modellen nachzubildende Gesetzmäßigkeit der Bewegung der Aktienkurse im Allgemeinen behauptet. Für ihr Alltagsgeschäft langt ihnen freilich die Maxime, nie zu spät „auf den fahrenden Zug aufzuspringen“, aber auch nicht zu früh, und keinesfalls „ins fallende Messer zu greifen“.
Mit diesem ganzen Irrsinn wird der Geldwert der gehandelten Wertpapiere, die zum Aktienkurs hochgerechnete Spekulation auf künftige Dividenden, nicht bloß beziffert, sondern gemacht: Was die Aktionäre der ersten Stunde an Geld in ‚ihre‘ AG hineingesteckt haben, steckt dort drin, zirkuliert dort und vermehrt sich günstigenfalls; was sie bzw. ihre Nachfolger und Makler an der Börse zirkulieren lassen, verkaufen bzw. bezahlen oder gegeneinander austauschen, ist errechnetes, insofern fiktives Kapital, dessen ‚Verwertung‘ und Akkumulation sich allein aus den verbrieften und gehandelten Bewertungen des Erfolgs einer AG ergibt, dabei aber durch deren wirklichen Geschäftsgang und die ausgeschütteten Erträge alimentiert wird – oder auch nicht. Der Aktienkäufer setzt sein Geld auf Erfolge ‚seiner‘ AG in der Konkurrenz, verbucht die fiktive Hauptsumme, die die Börse auf Basis der kritisch verglichenen, spekulativ gewichteten mutmaßlichen Gewinnausschüttungen der Firma veranschlagt, als sein Vermögen und ist tatsächlich so reich, wie der im Börsenhandel erzielte Preis seines Wertpapiers sein errechnetes Vermögen praktisch beglaubigt. So hängt die Entwicklung des in Aktienform verbrieften Reichtums, spekulativ vermittelt, vom wirklichen Konkurrenzerfolg des im Unternehmen angewandten Kapitals ab.
Umgekehrt wirkt der Aktienkurs mit seinem Auf und Ab auf die Geschäftstätigkeit der Unternehmen zurück; ganz praktisch darüber, dass sein daraus errechneter Börsenwert, siehe oben, darüber entscheidet, wie leicht, zu welchem Preis und in welchem Umfang es sich für die Fortführung und Erweiterung seines Betriebs Kredit verschaffen kann – sei es direkt von seiner Hausbank oder per Unternehmensanleihe, sei es mit der Ausgabe neuer Aktien, die ihm im Maße des erzielten Aktienkurses neue flüssige Mittel zuführt. Wenn andererseits das Kollektiv der Aktienspekulanten, die Börse, zu dem Schluss kommt, dass man sich bei einer Aktie oder womöglich sogar insgesamt mit den gestiegenen Aktienkursen vertan und in Bewertungen hineinspekuliert hat, die durch den Geschäftsgang der Firmen definitiv nicht mehr zu rechtfertigen sind, dann annulliert der Zusammenbruch der Aktienkurse die Geschäftsmittel des angewandten Kapitals und richtet es zugrunde. So hängt der Konkurrenzerfolg des im Unternehmen angewandten Kapitals von der Kursentwicklung der spekulativ darauf bezogenen Wertpapiere ab.
Eine Anmerkung zum Fetisch „Shareholder Value“
Vom Standpunkt des Unternehmens, das die Rendite seiner Aktionäre erst einmal verdienen muss, haben Aktien gegenüber einem aufgenommenen Kredit den Vorteil, dass sie keine Tributpflicht gegenüber einem externen Gläubiger begründen. Stattdessen ist das Management den Eigentümern gegenüber rechenschaftspflichtig. Denen geht es um eine unendliche, starke, rasante und zugleich sichere, kurz: ideale Aufwärtsentwicklung des Kurswerts ihrer Aktie. ‚Ihr‘ Unternehmen soll die Voraussetzungen dafür liefern, dass ihr rechnerisches Vermögen wächst und sein Wachstum von der Gemeinde der Geldanleger, an der Börse, Recht bekommt; mit andern Worten: dafür, dass das fiktive Kapital sich aufblasen kann und darin vom angewandten Firmenkapital durch Rendite und Wachstum bestätigt wird.
Das Schlagwort vom „Shareholder Value“ drückt diesen Anspruch als besonderes Unternehmensziel aus, so als ginge es in einer AG nicht sowieso immer und nur darum. Damit kriegt erst einmal nur der ökonomische Lebenszweck der Firma einen englischen Namen. Der Imperativ, der in diesem Namen steckt, reflektiert den Verdacht der Eigentümer, das Management ließe es, bei allem Einsatz für das Wachstum der Firma als solcher, in der entscheidenden Hinsicht fehlen, nämlich an Pflege und Mehrung des Börsenwerts – als wären es nicht sie selber, die an der Börse tätigen Spekulanten, die mit ihren spekulativen Bewertungen der Unternehmensstrategie und ihrer Miss- und Erfolge den Value ihrer Shares schöpfen und beziffern. Seine Grundlage hat dieser Verdacht denn auch in nichts anderem als in der Spekulation der Shareholder selber: Niedrige Erwartungen der potentiellen Aktienkäufer enttäuschen die hohen Erwartungen der Aktienbesitzer; die Kalkulation von heute mit dem Geschäftsgang von morgen und übermorgen blamiert die Kalkulation von gestern. Die Spekulation findet sich insgesamt zu wenig freigesetzt oder zu wenig beglaubigt oder beides; das fiktive Kapital kann sich auf Basis des tatsächlichen Unternehmenswachstums zu wenig aufpumpen oder wird als bloß aufgepumpte Blase entlarvt – im schlimmsten Fall sowohl als auch.
Der Fortschritt von der Spekulation auf Kursgewinne zur Herstellung von „Basisdaten“ für die Spekulation auf Kursgewinne – eine neue Dimension der Aufblähung des fiktiven Kapitals
Das Verhältnis zwischen Firmenerfolg und Kursentwicklung, das dem Aktionär schlaflose Nächte bereitet, weil er es ausnutzen will, ohne etwas zu riskieren, ist eines von etlichen Geschäftsobjekten der Hedgefonds. Im Elementarfall versichern sie[15] den besorgten Shareholder gegen Value-Verluste, kassieren dafür Gebühren oder einen Anteil eventueller Kursgewinne; mit Termingeschäften sichern sie sich ihrerseits so ab, dass auch aus einem begrenzten Kursrückgang für sie ein Plus herausschauen kann. Innerhalb der eigenen Welt der papierenen Werte, des fiktiven Kapitals, pflanzen sie auf das spekulative Schmarotzertum des einfachen Aktienhandels eine zweite Etage drauf: Sie spekulieren auf vermutete Schwankungen in der spekulativen Bewertung von Aktien; nicht mehr mit dem Ziel, ihr Aktienvermögen zu vergrößern, sondern um mit einer ausdrücklich so deklarierten „Wette“ auf Richtung und Größe der zu einem bestimmten Zeitpunkt vermuteten Schwankung als solcher von Kontrahenten, die sich auf die Art gegen Verluste absichern wollen oder ihrerseits auf eine andere Marge spekulieren, Geld abzugreifen.
Diese Art von Spekulationsgeschäft ist den Aktivisten der Hedgefonds- und Private-Equity-Szene zu passiv. Als radikale Protagonisten einer Firmenpolitik des Shareholder-Value halten sie die Wachstumsstrategien der meisten Unternehmen für verfehlt, nämlich für un- bis kontraproduktiv für den Zweck, ihre Spekulation auf besonders ergiebige Wertsteigerungen im Reich der Wertpapiere zu bedienen. Sie kennen sich aus in der Kunst, solche Steigerungen zu erzielen – durch geschickte Börsenmanipulationen auf der einen Seite; auf der anderen Seite durch Eingriffe in den Geschäftsgang des angewandten Kapitals. Und – was das Wichtigste ist – sie verfügen über hinreichende Massen an anlagesuchendem Geldkapital und an Kredit, um ihre Expertise in die Tat umzusetzen. In der festen Überzeugung, dass ihre Finanzmacht ihren Erfolg garantiert, gehen sie als Firmenkäufer auf Unternehmen los, die in Produktion, Handel oder „klassischem“ Kreditgewerbe tätig sind, und unterwerfen deren Fortgang ihren Konzepten zur Mehrung des fiktiven Kapitals, die ein fungierendes Kapital ihrer Ansicht nach herzugeben hätte. In diesem Sinn manipulieren sie an der produktiven oder kommerziellen Aufstellung ihrer Erwerbungen, an deren Finanzausstattung und den Eigentumsverhältnissen herum, krempeln sie um [16] und instrumentalisieren sie nach Strich und Faden dafür, dass sie die Bewertungsdifferenzen auch rechtfertigen, die sie spekulativ antizipieren.
Mit diesem Übergang ins spekulative Firmen-Management beleben die Beteiligungsfonds das Spekulationsgewerbe – und bieten der Spekulantenwelt zugleich ein neues Objekt und Betätigungsfeld, nämlich sich selbst als neue Geldanlage-Gelegenheit, als neue Variante fiktiven Kapitals. „Investoren“ versprechen sie eine sagenhafte Rendite, weil sie deren Geld für die Herstellung von Bewertungsdifferenzen einsetzen, die mit herkömmlichen Winkelzügen des Spekulationsgeschäfts bei autonomem Geschäftsgang des fungierenden Kapitals nie und nimmer zu erzielen wären. Freilich sind solche Differenzen, die den Shareholder-Value mästen, mit einem Geschäftsobjekt in der Regel auch nur einmal zu erreichen; das liegt in der Natur und der Absicht eines derartigen Eingriffs, der ja alles an Bewertungsdifferenz aus einer Firma herausholen will und soll, was aus ihr herauszuholen ist. Dabei organisieren die engagierten Fonds aber gar keine einmaligen Überfallaktionen, sondern – wie der Name „Fonds“ schon sagt – eine auf Dauer angelegte Geldanlage; sie sammeln Geldkapital mit dem Versprechen einer Rendite, die zwar weniger sicher sein mag, dafür aber höher und auch dauerhaft lohnender ausfallen soll als diejenige „klassischer“ Investitionen in ein akkumulierendes Kapital.
Dieser kleine Widerspruch zwischen Geschäftszweck und Geschäftsartikel verleiht dem Firmengeschäft der Hedge- und PE-Fonds seine spezielle Dynamik. Als Spekulationsunternehmungen der höheren Art machen die sich anheischig, ihr eigenes Rendite-Versprechen, aus dem die Geldanleger sich den Kurswert ihrer einmal gekauften Fonds-Anteile hochrechnen dürfen, mit der Akquisition immer neuer Objekte und der erfolgreichen Abwicklung immer neuer Neubewertungs-Aktionen zu beglaubigen. Mit diesem Angebot verschaffen sie sich die Mittel und bringen sich in Zugzwang, ihren entsprechenden Zugriff auf ausnutzbare Firmen dem Mittelzuwachs entsprechend auszuweiten, mehr und größere, damit natürlich auch riskantere Übernahme-, Umgestaltungs- und Exit-Aktionen zu bewerkstelligen. Das tun sie mittlerweile nicht bloß in Konkurrenz zu „klassischen“ Anlageformen, sondern gegeneinander; und dieser Konkurrenzkampf verschärft sich in dem Maße, wie der neue Geschäftszweig insgesamt Geldkapital attrahiert: Die Fonds müssen sich um lohnende Objekte streiten, machen sich damit wechselseitig den billigen Ein- und teuren Ausstieg schwer, kooperieren auf der Basis auch wieder, um sich gemeinsam über Firmen der gehobenen Größenordnung herzumachen.[17] Einem dieser Fonds Geld anvertrauen bedeutet, eine spekulative Wette darauf einzugehen, dass es ihm tatsächlich gelingt, an immer neuen und im Umfang seiner Verfügungsmasse mehr und größeren Objekten eine seiner Spekulation entsprechende Neubewertung des aus denen abgeleiteten fiktiven Kapitals durchzusetzen.[18] Auf die Art leisten die Fonds selber als Unternehmen zur Geldanlage eine ansehnliche Aufblähung des fiktiven Kapitals; und mit ihrer Konkurrenz gegeneinander treiben sie deren Ausmaß in immer neue Größenordnungen. Damit steigern sie natürlich auch das Risiko, sich selber als bloße Blase zu erweisen, nämlich – zu platzen und das eingesammelte Geldkapital zu vernichten.
Beides: die Masse der verfügbaren Mittel wie die Größe der Unsicherheit ihrer spekulativen ‚Verwertung‘, macht die Hedge- und PE-Fonds in ihrem Firmengeschäft aggressiv.
Angriff und Verteidigung
In manchen Fällen sind die spekulativen Firmenkäufer willkommen; etwa wenn es darum geht, einem Familienunternehmen das Problem des Generationswechsels abzunehmen oder ein Geschäft an die Börse zu bringen, oder wenn eine überschuldete Kommune ihren einstmals aus sozialen Gründen geschaffenen Bestand an Wohnungen zu Geld machen will. Viel öfter ist ihr Zugriff aber ein Angriff auf das Unternehmen; jedenfalls auf die Art, wie es bis dahin gemanagt worden ist, und deswegen nicht selten auch auf dessen Fortbestand. Die angestrebte „Übernahme“, insbesondere wenn durch heimliche Aktienkäufe eingeleitet, ist – nach der herrschenden Sprachregelung – eine „feindliche“.
Das ist kein Wunder. Denn bei aller Verwandtschaft im spekulativen Geist verfolgen Firmen-Manager und spekulative Firmen-Käufer unterschiedliche Interessen, die nur ausnahmsweise im Ergebnis deckungsgleich sind und im Normalfall kollidieren: Dem Vorstand der AG geht es um die möglichst kräftige und möglichst immerwährende Steigerung des Börsenwerts seines Unternehmens, analog dem kapitalistischen „Mittelständler“ um die Erhaltung und Erhöhung des aus der Ertragskraft zu errechnenden Preises seines Geschäfts und damit seines Vermögens. Dem Beteiligungsfonds hingegen ist es um die möglichst prompte „Verflüssigung“ und Aneignung einer möglichst großen positiven Differenz in der Bewertung des Firmenvermögens zu tun, die er durch seine Finanzmanipulationen und sein alternatives Firmenmanagement zustande bringt bzw., seiner bescheidenen Selbsteinschätzung zufolge, „freisetzt“.
Dabei müssen die unternehmerischen Eingriffe ins Betriebsgeschehen sich gar nicht immer widersprechen oder auch nur unterscheiden – deswegen können die Unternehmensstrategien beider Seiten tatsächlich über weite Strecken konform gehen. Auch leitende Manager und Unternehmenspatriarchen trimmen alle Abteilungen ihres Betriebs auf maximale Rentabilität; stoßen weniger ertragreiche Geschäftsfelder ab und eröffnen neue, von denen sie sich mehr versprechen; fusionieren oder kaufen zu; sourcen out oder bringen „Töchter“ an die Börse; suchen unablässig nach dem goldenen Schnitt zwischen Größe und Ertragskraft, Profitrate und Profitmasse; und zufriedene Shareholder gehen einem AG-Vorstand über alles. Umgekehrt kommen auch die Abgesandten einer Beteiligungsgesellschaft nicht umhin, sich – je nach eingeschlagener Erfolgsstrategie – in der Firma, die sie übernommen haben, um sie aufzuwerten oder auszuschlachten, um den Betriebsalltag, um „technischen Fortschritt“, um die Abwicklung von Entlassungen, um den dauernden Kampf um Marktanteile und dergleichen mehr zu kümmern. Nur richtet sich bei alledem das Interesse der ersteren eben auf ein dauerhaftes Wachstum ihrer Firma, was im Kleinen wie im Großen zu spekulativen Kalkulationen „herkömmlicher“ Art und den entsprechenden Maßnahmen nötigt, also z.B. ein zeitweiliges Opfer an Rendite zwecks langfristiger Marktbeherrschung, ein Nebeneinander von unterschiedlich rentablen, auf Dauer einander wechselseitig stützenden Unternehmensteilen, die Ansammlung „stiller Reserven“ oder einer „Kriegskasse“ für größere Konkurrenzoffensiven zweckmäßig erscheinen lässt; sogar für den Umgang mit der Belegschaft können sich da besondere Rücksichten und Gemeinheiten als ratsam erweisen, in denen ein spekulativer Firmenkäufer nur einen überflüssigen, also schädlichen Kostenaufwand entdecken kann. Denn dessen Interesse zielt auf die Mobilisierung einer maximalen Revenue für seinen Beteiligungsfonds in der prinzipiell möglichst kurz zu haltenden Frist zwischen Einstieg und Exit; für Investitionen in zukünftige Marktmacht gelten dementsprechend restriktive Kriterien – es geht um das Unternehmen eben nicht als das „Subjekt“ kapitalistischer Akkumulation, sprich: eines unbefristet zu steigernden Börsenwerts, sondern als das Objekt einer im Prinzip einmaligen, erschöpfenden Um- und Neu-Bewertung zum Vorteil des vorübergehend engagierten Fonds: Der ist das kapitalistische „Subjekt“, dem die Sorge seiner Manager gilt. Wenn der von der Liquidierung des gekauften Unternehmens profitiert, dann sind eben auch für sich genommen konkurrenztüchtige Etablissements und Konzerne vor Zerschlagung, De-Investition und abschließender Resteverwertung nicht sicher.
Unter dem süßen Druck und vermöge der Macht des vielen Geldes, das sie mit dem Versprechen rasanter Vermehrung einsammeln, nehmen spekulative Firmenhändler mittlerweile, wie gesagt, auch bedeutende Multis deutscher Nation, große Sumpfblüten der rückblickend so genannten Deutschland AG wie Daimler-Chrysler oder VW, ins Visier. Und allenthalben rüsten Unternehmen, die sich als autonom agierende Größen im kapitalistischen Weltgeschehen behaupten und durchsetzen wollen, zur Abwehr gegen drohende – angedrohte oder auch nur mögliche – Übernahme-Attacken verbündeter Beteiligungsgesellschaften. Dabei bedienen sie sich interessanterweise derselben Techniken des „financial engineering“ wie die Spekulanten, deren Angriff sie fürchten. Um sich für die unattraktiv zu machen, bauen sie in ihre Selbsterhaltungs- und Wachstumsstrategie lauter Elemente der spekulativen Bewertungssteigerung ein. Sie mobilisieren Reserven und zahlen sie an ihre Aktionäre aus, trennen sich rigoros von renditeschwachen Abteilungen, steigern durch selbstverstümmelnde „Break-ups“ und andere Manöver ihren Börsenwert[19] usw. – und führen so den praktischen Beweis, wie sehr die spekulativen Unternehmenshändler im Prinzip marktwirtschaftlich im Recht sind, nämlich alle kapitalistische Logik auf ihrer Seite haben. Sogar hier, in den höchsten Etagen der Spekulation, gilt ganz offensichtlich das Grundgesetz, dass die jeweils höhere, also absurdere und kapitalkräftigere Stufe des Finanzkapitals über ihre Voraussetzungen dominiert, dass die Gewinnerwirtschaftung immer nur ein Instrument der geldmächtigen Spekulation darauf ist und dass dem Recht des Eigentums auf Rendite im Zweifelsfall deren Mittel zu opfern sind – deswegen helfen gegen die „Corporate Raiders“[20] nur deren Methoden.
Um sich als Weltkonzerne weiter zu behaupten und ihren Aufwuchs zu internationalen „Champions“ fortzusetzen, helfen die um ihre Eigenständigkeit besorgten Großkapitale deutscher Nation sich außerdem gegenseitig. Durch wechselseitige Aktienkäufe stellen sie untereinander Verflechtungen her, mit denen sie sich gegen heimlichen Aufkauf und unvorhergesehene Aktionärs-Mehrheiten absichern – und das, nachdem soeben erst die über Jahrzehnte „gewachsene“ Verflechtung deutscher Großbanken mit deutschen Industriekonzernen, die berüchtigte Deutschland AG, durch die steuerliche Entlastung und rechtliche Erleichterung von Firmenkäufen und -verkäufen erfolgreich „aufgebrochen“ wurde und das nationale Wirtschaftsleben zum einladenden Tummelplatz für Finanzinvestoren der neuesten Generation hergerichtet worden ist…
Müntes verlogene „Heuschrecken“-Nummer – ihr Grund und ihr Zweck
Wenn der damalige SPD-Vorsitzende und heutige Vizekanzler im Vorfeld des letzten Bundestagswahlkampfs Beteiligungsgesellschaften polemisch mit Heuschrecken vergleicht, die ehrliche deutsche Konzerne kahl fressen und Arbeitsplätze vernichten, dann bezieht er sich, was deren am Standort Deutschland neuartiges Geschäftsgebaren betrifft, auf Konsequenzen der Politik seines eigenen sozialdemokratischen Kanzlers. Dessen Regierung hat schließlich, um den Standort zu „modernisieren“, für Kapitalanleger aus aller Welt attraktiv zu machen und so „Anschluss“ an die neuesten Fortschritte der „Globalisierung“ zu gewinnen, alles von Staats wegen Nötige dafür getan, die „verkrustete“ Symbiose von Finanz- und Industriekapital aus der Ära des „rheinischen Kapitalismus“ aufzulösen und Hedge- wie Private-Equity-Fonds ungehindert ihre Geschäfte machen zu lassen.
Die tun, wozu sie eingeladen worden sind, und brauchen sich wirklich nicht nachsagen zu lassen, wehren sich auch gegen die üble Nachrede, sie wären die volks- und menschenfeindlichen „Auswüchse“ eines im Prinzip unendlich arbeitnehmerfreundlichen Systems. Dass es ihnen „nur“ um Rendite geht, ist wahrhaftig kein Verstoß gegen diese Wirtschaftsweise, sondern ihr Prinzip. Nicht erst der Hedgefonds, schon der brave „schaffende“ Kapitalist kennt überhaupt nichts anderes. Auch in seinem Unternehmen ist die Herstellung von Gütern und die Bezahlung von Arbeitskräften, die von Lohn leben müssen, nie der Zweck der Veranstaltung, sondern das Mittel seiner Plusmacherei. Unter dem staatlichen Schutz des Privateigentums gibt sein Geld ihm die Macht, den gesamten Reproduktionsprozess der Gesellschaft als Mittel seiner Bereicherung mit Beschlag zu belegen und danach zu entscheiden, welche Bedürfnisse unbedingt befriedigt werden müssen und bei welchen das überhaupt nicht geht. Und dass die Kredithaie mit ihrer Verfügungsmacht über das Geld der Gesellschaft die Maßstäbe für diese produktive Bereicherung setzen, dass die Kapriolen des Börsengeschäfts über Produktion und Konsum in der Marktwirtschaft entscheiden, dass die planerische Vernunft dieses Systems in den spekulativen Berechnungen von Wertpapierhändlern besteht und zu ihren Spitzenleistungen aufläuft, wenn die auf ihre selbst erzeugten spekulativen Erwartungen spekulieren: auch das ist systemimmanente Notwendigkeit und keine Erfindung von Goldman Sachs und Wyser-Pratte. Umgekehrt kann jede Kapitalistenfraktion für sich reklamieren, dass sie einen unentbehrlichen Dienst am materiellen Reproduktionsprozess der Gesellschaft leistet: Der ist ja nichts anderes als ein Anhängsel der Akkumulation ihres Vermögens; „versorgt“ wird die Menschheit nur mit dem – mit dem aber reichlich –, woran sie verdienen, müsste ohne wagemutige Kapitalisten also glatt zugrunde gehen. Und wenn schon alles von erfolgreich investiertem Geld abhängt, dann sind die Herren des großen Geldes logischerweise die wahren Wohltäter der Menschheit. Müntefering will von verantwortungsvollen Arbeitgebern wissen, die mit nimmermüder Risikobereitschaft und innovativen Methoden Land und Leute ernähren – dieses Kompliment können die erfindungsreichen Fondsmanager schon gleich mit vollem Recht auf sich beziehen und tun das auch: Sie „restrukturieren“ unterbewertete ebenso wie überschuldete Unternehmen; auch wenn sie mal eines zerschlagen und auflösen, leisten sie im Endeffekt einen Beitrag zur „Rationalisierung des Kapitals“ und zu einer besseren „Ressourcen-Allokation“; sie fördern gezielt „Zukunftsfähiges“, setzen Maßstäbe bei der Befreiung des Standorts vom Übel unrentabler Arbeitsplätze und befähigen so die Volkswirtschaft, die sie frei aufmischen dürfen, dazu, in der rauen Konkurrenz der Nationen zu überleben. Wenn schon Marktwirtschaft, dann gilt auch: Nichts braucht eine moderne Nation dringlicher als finanzstarke Experten, die sich um die Aufblähung und Beglaubigung des fiktiven Kapitals verdient machen.
Freilich ist nicht zu übersehen, dass die Elite der Finanzwelt mit ihrem Firmenhandel ein paar neue Sitten in den bundesdeutschen Kapitalismus einführt. Sie räumt auf mit dem altväterlichen Ethos der „Versöhnung von Kapital und Arbeit“, mit dem gepflegten Schein, es ginge beim Wirtschaften noch um andere Belange als den maximalen Profit, mit der Moral der Rücksichtnahme aufs Betriebspersonal und auch mit einigen dafür einschlägigen nationalen Gepflogenheiten kapitalistischer Firmenpolitik wie etwa einer „Unternehmenskultur“, die eine offizielle Arbeitnehmervertretung am Management der Ausbeutung beteiligt. Die Absurditäten und Gemeinheiten, die die agilen Firmenhändler so entschieden zu ihrem Programm machen, sind aber die des marktwirtschaftlichen Systems und schon seit eh und je essentieller Inhalt des herrschenden Gemeinwohls. Was sie an Neuerungen durchsetzen, sind finanzkapitalistische Errungenschaften, die sich in diesem System wie von selbst als logische Konsequenz aus dem weltweiten Siegeszug der freien Marktwirtschaft aufdrängen. Und dazu haben die Fonds-Manager nicht bloß die Lizenz der bundesdeutschen Standortverwaltung – schon der rotgrünen, jetzt der schwarzroten –, sondern geradezu den wirtschaftspolitischen Auftrag.
Die Beschwerden Münteferings, des leibhaftigen Repräsentanten der Kontinuität dieser Schröder-SPD-Politik, sind insofern schon besonders verlogen. Sie haben ihren Grund aber auch gar nicht in den speziellen Beiträgen der Investment-Sparte zum nationalen Finanzgeschäft, sondern in der aktuellen, seinerzeit für die rotgrüne Regierung besonders schmerzlichen schlechten Ertragsbilanz des nationalen Kapitalismus insgesamt. Sie zielen auch überhaupt nicht auf eine Revision der gesetzlich geschützten Geschäftsbedingungen, denen die Branche ihren Aufschwung verdankt, sondern drücken die generelle Unzufriedenheit der Staatsmacht mit der Entwicklung des Standorts aus: Die Nation kommt auch mit all ihren kapitalförderlichen Reformen nicht in der gewünschten Weise auf ihre Kosten. Der Grund dafür liegt in den Konjunkturen des Welt-Kapitalismus im Allgemeinen, den Konkurrenz-Misserfolgen wie -Erfolgen deutscher Konzerne im Besonderen, aber zuallerletzt an denen, die aus der misslichen Gesamtlage noch das marktwirtschaftlich Beste, nämlich eine neue stabile Sumpfblüte der Spekulation und des spekulativ aufgeblasenen fiktiven Kapitals zu machen verstehen. Dass der damalige Chef der deutschen Sozialdemokratie sich gerade die heraussucht, um Schuldige an der „Wirtschaftsflaute“ und der Massenarbeitslosigkeit dingfest zu machen, verdankt sich einer ebenso deutschen wie sozialdemokratischen politischen Spekulation: Eine unzufriedene Wählerschaft sollte die Regierung mit ihrem Stimmzettel-Volkszorn verschonen und sich lieber mit nationalistischer Empörung über ausländische Raffgeier schadlos halten, die das höchste Gut ruinieren, das ein sozialdemokratisch sozialisierter Volksgenosse sich vorstellen kann und wünschen darf: Arbeitsplätze…
Doch das sind ideologische Schlachten von gestern. Längst ist Rückkehr zu neuer Sachlichkeit angesagt. Und „Sache“ ist ein kapitalistisch erfolgreiches Deutschland. Dazu gehören die Leistungen des internationalen Finanzkapitals. Das will auch ein Müntefering im Land haben. Deswegen darf man es nicht vergraulen und ihm auch nicht vorschreiben wollen, auf welchen Wegen es seine Geldgier befriedigt. Denn nur wenn ihm das gelingt, tut es seinen Dienst. Dementsprechend wird an seinem Image gearbeitet. Die Macht der Fonds, ursprünglich der Stein des Anstoßes, wird herausgestellt, macht Eindruck, und das offizielle Gemecker verstummt. Allein im vergangenen Jahr haben sie in Deutschland 30 Mrd. Euro investiert; 800.000 Arbeitnehmer im Land, in Großbritannien sogar 20% aller nicht öffentlich bediensteten Arbeitskräfte, sind von diesen Interims-Arbeitgebern abhängig. Muss man sie da nicht auch als Arbeitgeber würdigen? Aus Pleiten machen sie Rendite. Retten sie damit nicht Firmen und Arbeitsplätze, die es ohne ihre Risikobereitschaft schon nicht mehr gäbe? Kapitalistische Geldgier ist eben doch ein einziger Segen fürs Land – auch in ihrem Fall!
[1] Zu diesem Geschäftszweig steht das Nötigste in den Artikeln „Geschäfte mit Optionen und Futures – Spekulation auf die Spekulation“, GegenStandpunkt 2-95, S.24, sowie „Vom Weltgeld, seiner Krise, seinen Hütern, 1. Teil, Ein Hedgefonds in der Krise“, GegenStandpunkt 4-98, S.107.
[2] Private-Equity-Gesellschaften sind rechtlich als private Partnerschaften von Anlegern außerhalb der Publizitätspflichten und der Finanzaufsicht verfasst, die etwa für Aktiengesellschaften, Investmentfonds und andere öffentlich gehandelte Wertpapiere – Public Equity – gelten. Ihre Anteile sind nicht handelbar und werden vom Fonds nicht jederzeit zurückgenommen. Zudem investieren PE-Fonds in der Regel selbst in nicht börsengehandelte Firmen oder nehmen AGs, in die sie sich einkaufen, erst einmal von der Börse – ein „Going private“.
[3] Allein Hedgefonds, noch ohne Private Equity, verwalten gegenwärtig angeblich 1 Billion Dollar. Weltweit 8000 Fonds kontrollieren ca. 25% des deutschen Aktienmarktes und sollen an manchen Handelstagen für die Hälfte der Umsätze der New Yorker Börse verantwortlich sein (Handelsblatt, 7.9.05). Kenner der Szene sagen ihnen ein Wachstum auf 6 Billionen im nächsten Jahrzehnt voraus (FAZ, 2.9.05.). Dabei werfen diese Fonds sich zunehmend auf Aktivitäten, die die Beteiligungsgesellschaften auf Private-Equity-Basis entwickelt haben: Noch wird diese Goldgräberstimmung (der PE-Fonds) von den historisch niedrigen Zinsen und der Finanzierungsfreude der Banken angeheizt. Doch das könnte sich rasch ändern. … Zudem schießen neue Beteiligungsfonds wie Pilze aus dem Boden. Und mit den Hedgefonds, denen die klassischen Investitionsziele ausgehen, tummeln sich neue Wilderer im Revier. Im vergangenen Jahr haben Hedgefonds 23 Unternehmen im Wert von 30 Milliarden Dollar gekauft. Private Equity Manager … erwarten, dass die Unterschiede zwischen Private Equity und Hedgefonds immer mehr verschwimmen. So manche Beteiligungsgesellschaft ist gerade dabei, eigene Hedgefonds zu gründen.
(FAZ, 17.9.05.)
[4] Unter dem Titel „Hassliebe zu Deutschland – Firmenkäufer müssen sich mehr denn je mit dem Thema Arbeitsplätze auseinandersetzen“ berichtet die SZ am 20.2.06 von einem Kongress mit dem vielsagenden Titel „Super Return“, den „die Firmenkäufer der Welt“ gerade wieder – wie jedes Jahr – in Frankfurt am Main abgehalten haben: Finanzinvestoren (loben) unverdrossen das Potenzial, das in der deutschen Wirtschaft und vor allem in vielen Unternehmen stecke.
Zu schaffen macht ihnen der Streit um … Stellenabbau
und um andere weiche Faktoren
, die angeblich eine wichtige Rolle spielen, wenn etwa Konzerne Töchter an Finanzinvestoren verkaufen
. Jedoch: „Konflikte um den Umgang mit Arbeitnehmern werden Finanzinvestoren nicht abhalten, noch mehr deutsche Firmen zu kaufen. Erstens betonen Beteiligungsmanager, dass sie mit den Betriebsräten meist (für wen wohl?) befriedigende Lösungen fänden. Zweitens hat ein gutes Dutzend der größten Firmenkäufer neue Fonds über jeweils fünf bis zehn Milliarden Euro aufgelegt, die sie (was für ein Sachzwang!) nun investieren müssen.“ Und drittens sind sie sich sicher: Beschäftigungszusagen und ähnliche Faktoren werden
bei Verhandlungen über einen Firmenkauf „auch (!) in Zukunft nur eine Rolle spielen, wenn die Preise zweier Bieter nahe beieinander liegen.“
[5] Ein Mr. Rubenstein, Mitbegründer der amerikanischen Beteiligungsgesellschaft Carlyle, die über 18 Jahre eine Eigenkapitalrendite von 34% per anno erzielt haben will, erläutert den Sachverhalt kindgemäß so: Man muss jedoch bedenken, dass wir in zwei Geschäftsfeldern aktiv sind: Kaufen und Verkaufen. Wenn die Konjunktur erlahmt, ist es eine gute Zeit, um billig zu kaufen. Wenn die Konjunktur an Fahrt gewinnt, ist es eine großartige Zeit, um zu verkaufen, weil die Leute höhere Preise bezahlen werden. Sollte das Wirtschaftswachstum sinken, sind Private-Equity-Fonds also nicht so sehr betroffen.
(FAZ-Interview, 5.10.05)
[6] Das Finanzkunststück, eine Firma mit dem Geld zu kaufen, das aus ihr erst noch herauszuholen ist, heißt auf Englisch „Bootstrapping“ und spielt auf den Baron Münchhausen an: In England zieht der sich nicht am Haarschopf, sondern an den Stiefelschlaufen aus dem Sumpf.
[7] Bei einer Analyse von über 100 europäischen Private Equity Gesellschaften fällt auf, dass sich die Anforderungsprofile, die Finanzinvestoren an Unternehmen stellen, ähneln. (Sie) präferieren reife Unternehmen in etablierten Märkten. … Die Aktie des Unternehmens sollte unterbewertet sein. … Um Risiken zu reduzieren, sollte das Unternehmen über prognostizierbare, hohe Cash Flows verfügen, um später die Fremdkapital-Verbindlichkeiten zurückzahlen zu können. Aufgrund des Fremdkapitaldienstes sollte das Unternehmen – zumindest in den folgenden vier bis sieben Jahren – keine substanziellen Investitionen in das Anlagevermögen erfordern.
(Case Study: Friedrich Grohe AG; in: Webnotes der Universität Witten-Herdecke)
[8] Die Betriebswirtschaftslehre versteht inzwischen auch diese sehr direkte Art der Aneignung von Vermögenswerten als einen Beitrag zur Vernunft des Kapitalismus, einen Dienst nämlich an der Effizienz des Kapitaleinsatzes. Sie übernimmt den Blick, mit dem die Fonds die Unternehmenslandschaft nach Kandidaten absuchen, deren Kapital sie sich aneignen können. Wo die zugreifen, Firmen also wenig Schulden, freie Akkumulationsmasse oder Reserven haben, so die theoretische Aufwertung des Zugriffs, muss ein Fehler des Managements vorliegen, den die Fonds durch ihr Ausschlachten heilen. Wenn die Geld herausziehen und ihre Objekte mit Schulden überhäufen, stellt die Wissenschaft das Gesetz auf, dass eine Verminderung des Betriebsvermögens eine Steigerung des Börsenwerts immer dann bewirkt, wenn das Betriebsvermögen vorher größer als nötig war. Ökonomen finden die ‚Free Cash Flow‘-Theorie von Michael Jensen nützlich, um diese Operationen zu verstehen. Die Theorie behauptet, dass hohe Verschuldung (high leverage) ein sehr starkes Instrument der Disziplinierung sein kann, denn es zwingt die Spitzenmanager, wertsteigernde strategische Veränderungen vorzunehmen. Firmen mit reichlich Cash Flow, aber wenig rentablen Investitionsmöglichkeiten, sollten das überflüssige Geld an die Aktionäre ausschütten, um den Shareholder Value zu maximieren. Dieser Theorie zufolge ist ein Management, das überflüssiges Geld nicht auszahlt, sondern in diversifizierende Akquisitionen oder wenig rentierliche Projekte steckt, schuld daran, dass der Aktienkurs der Firma unter seinem optimalen Wert liegt und damit ein ‚Value Gap‘ entsteht. ‚Leveraged Buyouts‘ (LBOs) und andere schuldenfinanzierte Rekapitalisierungen zwingen Manager, nicht profitable Abteilungen zu verkaufen, wenig rentierliche Investitionen zu vermeiden, Geld verschleudernde Firmenausgaben und diversifizierende Akquisitionen zu beseitigen und die operative Effizienz zu steigern, um dem Zinsendienst auf dem hohen Schuldenniveau gerecht zu werden. Die erzwungene Effizienz eliminiert das Value Gap und schafft netto ökonomische Vorteile für die Aktionäre. Auch wenn dies eine harte Lösung ist, die die Firma während der wenigen Jahre nach dem LBO unter finanziellen Druck setzt, hat sich erwiesen, dass LBO und Schulden erhöhende Restrukturierung in den 80er Jahren große Nettogewinne für die Shareholder geschaffen haben.
(Gregg A. Jarrell, Takeovers and Leveraged Buyouts, in: The Concise Encyclopaedia of Economics, www.econlib.org.) Auch wenn…
ist gut…
[9] Zu diesem wichtigen Akt bemerkt der britische ‚Economist‘ treffend: A crucial factor will be how easily private-equity firms can dispose of their investments. Without an ‚exit‘, there can be no profits.
(The new kings of capitalism, The Economist, 25.11.04)
[10] Noch mal zur Technik dieser Art der Gewinnschöpfung: Die Übernahmen würden dabei immer stärker mit Bankkrediten finanziert, konstatierte Hans Albrecht, früherer Deutschlandchef der amerikanischen Private-Equity-Firma Carlyle. Diese Schulden bürde man dann den erworbenen Firmen auf. Steige das Zinsniveau wieder an, könne dies die Unternehmen in eine ungemütliche Lage bringen. Etablierten Private-Equity-Häusern sei diese Entwicklung selbst nicht mehr geheuer, sagte der Brancheninsider. Deshalb zögen sie immer öfter bereits kurz nach dem Kauf ihr Eigenkapital wieder aus dem Unternehmen ab. Dazu dienten ‚Rekapitalisierungen‘: Dabei wird zum Beispiel eine Anleihe aufgelegt, aus deren Aufkommen sich die Beteiligungsgesellschaft Dividenden auszahlt und so ihren Einsatz bereits vor einem Weiterverkauf wieder einspielt.
(NZZ, 20.1.06) Diese ‚Rekapitalisierungen‘, bei denen der Schuldenstand der Unternehmen nochmals erhöht wird, haben laut der Ratingagentur Fitch in diesem Jahr bereits 10 Milliarden Euro an Dividenden in die Taschen der Beteiligungsbranche gespült. Die Schuldenstände bei LBOs sind auf einem Rekordhoch.
(FAZ, 16.12.05) Die in Europa aktiven Beteiligungsgesellschaften bitten ihre erworbenen Unternehmen immer schneller zur Kasse. Finanzinvestoren haben bei den großen Unternehmenskäufen (LBOs) durch ‚Rekapitalisierungen‘ im Schnitt binnen 20 Monaten 77 Prozent ihres eingesetzten Eigenkapitals wieder herausgezogen. Durch diese Rekapitalisierungen sei der Schuldenstand der betroffenen Unternehmen im Vergleich mit dem Einstiegszeitpunkt des Private-Equity-Investors vom 4,5-fachen des operativen Ergebnisses auf das 5,5-fache gestiegen.
(FAZ, 20.1.06)
[11] Leon Black, Gründer des Private-Equity-Hauses Apollo Management, sieht bei der gezielten Erhöhung der Schuldenstände der Firmen eine ganze Menge Kredit-Missbrauch. So viele von den Rating-Agenturen … als Ramsch bewertete Schulden habe er noch nie gesehen. Er ist dennoch sehr gelassen: Wenn die zu hoch verschuldeten Unternehmen in Schwierigkeiten geraten, werde Apollo eben die faulen Kredite kaufen und die Unternehmen restrukturieren.
(FAZ, 22.2.06)
[12] Märklin in der Zange – Finanzinvestoren kaufen Banken Kredite ab und gewinnen so die Kontrolle über deutsche Firmen
, teilt die SZ in der Überschrift mit. Angeblich werden in London bereits Kredite von etwa 100 deutschen Firmen gehandelt
; den Berg fauler Kredite in Deutschland
, aus denen innovative Schuldenhändler Gewinn herausholen, taxieren Experten … auf 150 bis 400 Milliarden Euro.
[13] Der Zusammenhang des Unternehmensschicksals mit dem Recht der Aktionäre auf ihr Aktienvermögen macht sich in besonderer Weise beim Zusammenschluss zweier Aktiengesellschaften praktisch geltend. Wenn eine Firma eine andere übernimmt oder beide in einer neuen aufgehen, dann dienen in der Regel die Aktien des übernehmenden resp. des neuen Unternehmens als „Akquisitionswährung“: Die Fusion der fungierenden Kapitale wird mit dem in Aktienform verbrieften Versprechen bezahlt, dass das fiktive Kapital, das von der Firma getrennt existierende Eigentum der Aktionäre, zumindest keinen Schaden leidet, vielmehr auf seine Steigerung spekuliert werden kann. – Näheres dazu in dem Kapitel II. Die Vereinigung zweier Profitquellen
in dem Aufsatz ‚Mega-Mergers‘ – Kapitalkonzentration im globalen Maßstab
in GegenStandpunkt 4-98, S.143, darin S.151-160.
[14] Die Experten und Ratgeber aus dem Reich der kapitalistischen Leitkultur finden das alles im Gegenteil völlig normal. Ungerührt und ohne jeden Anflug von Ironie informiert z.B. die „Bayerische Vereinsbank“ ihre Kundschaft in der Broschüre Oft verwendet – kurz erklärt
, S.110 und 114, über die zwei Schritte einer professionellen Aktienbewertung: Grundsätzlich teilt man die Aktienbewertung in zwei Bereiche ein, in die fundamentale und in die technische Analyse. Ziel der Fundamentalanalyse ist es, den inneren Wert einer Aktie annähernd zu bestimmen. Dabei werden die Ertrags- und Bilanzzahlen einer Gesellschaft untersucht. Außerdem berücksichtigt man die Branchensituation, die allgemeine Konjunkturlage und die Verfassung des Kapitalmarkts.
Im Gegensatz zur Fundamentalanalyse orientiert sich die technische bzw. Chart-Analyse ausschließlich am Marktgeschehen. Als Grundlage dienen die an der Börse registrierten Kurs- und Umsatzbewegungen der einzelnen Aktien. Diese Daten vermitteln einen Einblick in die Kräfteverhältnisse am Aktienmarkt, in die Intensität von Angebot und Nachfrage. Der Chartanalyst geht grundsätzlich davon aus, dass sich die Summe der mehr oder weniger gut abschätzbaren Bestimmungsfaktoren (wirtschaftliche, politische, psychologische usw.) über die Beeinflussung der Angebots- und Nachfragekonstellation schließlich im Kurs niederschlägt.
So dass er vom Resultat seiner komplexen Einschätzungen als guter Grundlage seiner Einschätzungen ausgehen kann…
[15] Daher ihr Name.
[16] Inzwischen sind verschiedene Fonds auf verschiedene Strategien spezialisiert. Die einen ziehen wirkliche Vermögenswerte – Anlagevermögen, Immobilienbesitz, Reservefonds – aus der Firma heraus und eignen sie sich an, in der Erwartung, dass diese Plünderung eines weiterhin funktionierenden Betriebs seine Börsenbewertung nicht oder nicht im selben Umfang in Mitleidenschaft ziehen wird. Manchmal wagen sie sogar – wie im Fall der Deutschen Börse – die Spekulation, eine Sonderausschüttung der „Kriegskasse“ an die Aktionäre werde die Attraktivität der Aktien dieser Firma und deren Kurs steigen lassen. Andere zerlegen Firmen, schneidern aus diversen Eroberungen neue Einheiten („buy & build“-Strategie) und nähren damit bei prospektiven Käufern die Hoffnung auf eine Steigerung des wirklichen Gewinns, um deren Bereitschaft zu fördern, höhere Preise für die Eigentumstitel dieser Kreationen zu zahlen. Sie analysieren die Firmen, die sie sich vornehmen, daraufhin, ob sie sich für das Vorhaben eignen, durch diverse Manipulationen zwischen dem Zeitpunkt des Ein- und des Ausstiegs eine Differenz in der Bewertung des fiktiven Kapitals zu erzeugen. Firmen, bei denen sie sich das zutrauen, nennen sie „unterbewertet“, ganz so als wäre das eine objektive Eigenschaft eines Aktienkurses und nicht das spekulative Urteil derer, die an diesem Kurs drehen wollen; tatsächlich entdecken sie ihre Chance ja nur, weil vor ihrem Eingriff niemand einen Grund hat, höhere Preise für die Eigentumstitel der Firma zu bezahlen. Um für dieses Manöver zu taugen, muss ein Unternehmen weder vor dem Eingreifen der Fonds erfolgreich in der Konkurrenz sein noch nach der Kur, die sie ihm angedeihen lassen. Noch nicht einmal das konjunkturelle Umfeld muss günstig sein: Je nach gewählter Strategie kommt es nicht auf die absolute Rentabilität des Objekts an, sondern ausschließlich auf die von anderen Geldanlegern honorierte Differenz zwischen Vorher und Nachher.
[17] Hierzu eine Erläuterung aus der FAZ, 17.1.06: Im Rudel auf Unternehmensjagd … Sieben Beteiligungsfonds haben sich zu einer enorm finanzstarken Bietergemeinschaft zusammengeschlossen, um den mehr als 7 Milliarden Euro schweren Unternehmenskauf zu stemmen. Diese Allianzen auf Zeit … sind in der Beteiligungsbranche zuletzt in Mode geraten. … Warum nicht im Alleingang? Private-Equity-Fonds schieben derzeit einen gewaltigen Kapitalberg vor sich her, der investiert werden muß. Und dank der gebündelten Kräfte geraten auch große Konzerne in Reichweite …, die für einzelne allein eine Nummer zu groß sind. … um das Risiko gering zu halten, dürfen die Fonds selten mehr als 10 Prozent des Anlagekapitals in ein Unternehmen investieren. Ein weiterer Vorteil der Allianzen ist, daß Private-Equity-Gesellschaften oft unterschiedliche Spezialisierungen haben, die sich ergänzen. … Doch ein derartiges Vorgehen birgt auch Risiken: … die Interessen von fünf, sechs oder sieben Finanzinvestoren (sind) kaum unter einen Hut zu bringen …, wenn es um den Zeitpunkt des Verkaufs geht.
[18] Wenn das misslingt, können die Fonds trotzdem weiterexistieren und sogar Gewinn ausschütten; so lange nämlich, wie Geldanleger noch an ihren Erfolg glauben, ihnen Bares anvertrauen und Kredit geben. Endgültig schief gegangen ist die Sache erst dann, wenn solcher Nachschub unterbleibt oder sogar Einlagen abgezogen werden: Dann verwandelt die ganze Geschäftsidee sich rückwirkend in ein bloßes „Schneeballsystem“.
[19] Manche Industriekonzerne, allen voran General Electric, verhalten sich mittlerweile fast wie Beteiligungsgesellschaften. In atemberaubendem Tempo stoßen sie Sparten ab, die Renditevorgaben nicht erfüllen, und kaufen neue Wachstumsträger hinzu.
(SZ, 17.9.05) Auch Siemens lässt da nichts anbrennen, bereinigt das Portfolio und stößt Geschäftsfelder ab, die zur Gesamtrendite nicht genug beitragen. Dabei erschließt der deutsche elektronische Weltkonzern eine neuartige, heute immer bedeutendere Quelle der Profitsteigerung durch puren Eigentümerwechsel – eine Quelle, die für manchen Verkauf und manches Out-sourcing die eigentliche Triebfeder sein dürfte: Siemens schenkt seine komplette Handysparte dem taiwanesischen Hersteller Benq und legt noch ca. 250 Millionen Euro obendrauf, um sich von Sozialplanpflichten freizukaufen, die im Fall einer Stilllegung in eigener Regie fällig wären. Für die Belegschaft, die der neue Besitzer selbstverständlich ausdünnt, geht es auch sonst keineswegs weiter wie bisher: Mit dem Eigentumsübergang entfallen die vertraglich geregelte Höhe der Bezahlung, die vereinbarte Betriebsrente sowie andere Leistungen und die Regelung der Arbeitszeit, die bei Siemens üblich waren. So wird der Wechsel des Eigentümers selbst zur Profitquelle. Fabriken und Geschäftsfelder, die im alten Konzern die geforderte Rendite nicht erwirtschaften konnten, können es mitunter allein schon deshalb, weil unter fremden Kommando frei von alten „Rechten“ und Gewohnheiten ein neues Niveau der Ausbeutung erzwungen wird; wenn der neue Eigentümer dann auch noch mit null Euro Kapitalvorschuss eine funktionierende Fertigung betreiben kann, wird aus einem Problembereich des alten Konzerns leicht eine Perle des neuen. So bekommt die Belegschaft die Verteidigung ihrer Industrie gegen die neuesten Finanzhaie zu spüren.
[20] Diesen unschönen Namen – ‚raid‘ bedeutet Überfall, gewaltsames Eindringen – haben sich die ersten Private-Equity-Investoren in der großen Krise der US-Industrie in den 80-er Jahren verdient, weil sie mit ihrem Standpunkt der Firmenverwertung feindlich gegen das jeweilige Management ihrer Kaufobjekte aufgetreten sind, das sich der Rettung seiner Firma und der Wiederherstellung ihrer Profitabilität verschrieben hatte.